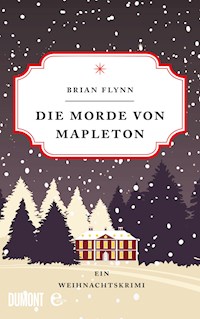
8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Wohlige Weihnachtskrimis
- Sprache: Deutsch
Es ist Heiligabend und Sir Eustace Vernon hat eine kleine Gesellschaft eingeladen, um bei einem Dinner Weihnachten zu feiern. Während des festlichen Abendessens jedoch bestürzt Sir Vernon eine geheime Botschaft in seinem roten Knallbonbon dermaßen, dass er sich ohne weitere Erklärung in sein Studierzimmer zurückzieht. Die Gäste schenken dem sonderbaren Vorgang wenig Beachtung und lassen sich nach dem Essen zu einer Partie Bridge im Spielezimmer nieder. Erst einige Stunden später wundern sie sich über Sir Eustaces lange Abwesenheit. Kurz vor Mitternacht dann ertönt ein Schrei, und der Butler Purvis wird tot aufgefunden. Sir Austin Kemble und Anthony Bathurst von Scotland Yard, die zufällig in der Gegend unterwegs sind, werden informiert und nehmen die Ermittlungen auf. Bald stellen sie fest, dass im altehrwürdigen Herrenhaus von Sir Eustace nichts so ist, wie es auf den ersten Blick scheint … ›Die Morde von Mapleton‹ ist ein im besten Sinne klassischer Weihnachtskrimi – und Anthony Bathurst ein bisher unbekannter Ermittler aus dem Goldenen Zeitalter des Detektivromans, den es nun zu entdecken gilt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Ein Mord zu Heiligabend
Ein festliches Dinner im Herrenhaus zu Mapleton: Sir Eustace Vernon hat all seine Liebsten versammelt, um mit ihnen Weihnachten zu feiern. Doch eine geheime Nachricht in seinem Knallbonbon bestürzt ihn dermaßen, dass er die Tafel verlassen muss. Die heitere Gesellschaft lässt sich von der Abwesenheit ihres Gastgebers nicht erschüttern, und die Feierlichkeiten gipfeln in einer Partie Bridge – bis ein markerschütternder Schrei ertönt. Wenig später wird der Butler Purvis vergiftet aufgefunden. Anthony Bathurst von Scotland Yard nimmt die Ermittlung auf und findet sich bald inmitten eines mörderischen Verwirrspiels …
Kurzweilig, spannend, atmosphärisch – ein Krimiklassiker für die kalte Jahreszeit
Brian Flynn (1885-1958) hat über fünfzig Kriminalromane veröffentlicht, die meisten davon drehen sich um die Ermittlerfigur Anthony Bathurst. Als Zeitgenosse von Agatha Christie ist er einer der Vertreter des Goldenen Zeitalters des britischen Detektivromans.
Barbara Först studierte Anglistik, Romanistik und Ethnologie und übersetzt seit über zwanzig Jahren aus dem Englischen. Zu den von ihr ins Deutsche übertragenen Autoren zählen u.a. Richard Russo, Patricia Wentworth, Philippa Gregory, Kerstin March, Francis Duncan und Jill McGown.
BRIAN FLYNN
DIE MORDEVON MAPLETON
EIN WEIHNACHTSKRIMI
Aus dem Englischen von Barbara Först
eBook 2019
Die englische Originalausgabe erschien 1929 unter dem Titel ›The Murders near Mapleton‹ bei J. Hamilton Ltd., London. © Brian Flynn
© 2019 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Übersetzung: Barbara Först
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildung: Haus © eyewave/istockimages
Landschaft © exxorian/Getty Images
Satz: Fagott, Ffm
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN eBook 978-3-8321-8477-3
www.dumont-buchverlag.de
KAPITEL 1
DER BEGINNDES SCHRECKENS
Sir Eustace Vernon straffte seine Schultern und erhob sein Glas. »Lassen Sie uns noch einmal anstoßen, Ladies und Gentlemen, bevor die Damen uns verlassen! Ein Toast, den wir zu Weihnachten, wie ich meine, stets ausbringen sollten.« Er sprach sehr feierlich, und nach und nach stellten die Gäste das Plaudern ein und schauten erwartungsvoll über die lange, hell erleuchtete Tafel auf ihren Gastgeber. Denn Sir Eustace war ein Mann, der hohes Ansehen genoss. »Ich möchte Sie alle bitten«, begann er in gemessenem Ton, »Ihre Gläser zu erheben und auf die ›leeren Stühle‹ anzustoßen. Auf jene Lieben, die einst unter uns weilten, nun jedoch ›das Zeitliche gesegnet‹ haben, denn das wird uns allen eines Tages widerfahren.« Ein Chor ernst klingender Stimmen schwebte auf ihn zu und erwiderte seinen Trinkspruch. »Ich danke Ihnen, Ladies und Gentlemen.« Sir Eustace nahm Platz. Auf seinem stattlichen Gesicht zeichnete sich jedoch eine leichte Beunruhigung ab. Das Tischgespräch lebte wieder auf, doch die Gedanken des einen oder anderen schienen nicht bei der Sache zu sein.
»Was hat dein Onkel nur in letzter Zeit?«, fragte ein charmanter junger Mann seine bezaubernde Tischdame.
Das Mädchen warf ihm mit großen Augen einen fragenden Blick zu. »Was willst du damit sagen, Terry? Hast du vielleicht …?«
»Etwas bemerkt?«, fiel er ihm ins Wort. »Jawohl, das habe ich. Und zwar deutlich! Außerdem irre ich mich wohl kaum, wenn ich annehme, dass auch dir etwas aufgefallen ist.«
Helen Ashley warf einen verstohlenen Blick auf die Gäste, die neben ihnen an der langen Tafel saßen, dann fasste sie Terence Desmond am Arm. »Du hast wirklich recht, Terry, ich habe etwas bemerkt! Etwas setzt meinem Onkel schon seit geraumer Zeit zu – falls du das Gleiche meinst wie ich. Aber sag: Was genau hast du wahrgenommen? Beschreibe es.«
Desmond wollte eben antworten, als er eine gedämpfte Stimme an seiner Seite vernahm. »Ja, danke, Purvis. Ich nehme noch einen Schluck.« Mit geziemender Würde füllte der Butler das Glas des jungen Mannes.
»Für mich bitte nicht mehr, Purvis«, sagte Helen Ashley. »Was wolltest du sagen, Terence? Verzeih, wenn ich zu sehr insistiere – aber die Wahrheit ist, dass ich mir große Sorgen um Onkel Eustace mache.«
»Lass mich nachdenken. Wie lange bin ich jetzt hier, Helen?«
»Nicht mal eine Woche. Aber lange genug …«
»Dass mir so einiges auffallen könnte und ich genug Zeit hätte, um mich bei Sir Eustace gründlich in die Nesseln zu setzen, nicht wahr?«, erwiderte er augenzwinkernd. Helens Blick blieb ernst. Desmond fuhr fort: »Ich glaube, dass er Angst hat, Helen; dieser Eindruck beherrscht mich schon die ganze Woche über. Zu sagen, ihn ›quälen Sorgen‹, würde seinem Zustand nicht einmal annähernd gerecht. Es ist viel schlimmer und vermutlich auch etwas ganz anderes als das. Ich habe Angst häufig gesehen, in den unterschiedlichsten Formen und Ausprägungen, zu häufig, um sie nicht zu erkennen, wenn sie sich mir offenbart. Dein Onkel fürchtet sich vor etwas«, fasste er zusammen, »daran habe ich keinen Zweifel.«
»Ich glaube, du hast recht«, stimmte Helen Ashley zu, »du hast die Situation genau so beschrieben, wie ich sie wahrnehme. Und es greift auch meine Nerven an, das ist das Schlimmste daran.« Sie schaute zum Kopf der Tafel, wo Sir Eustace in ein angeregtes Gespräch mit seiner Tischdame vertieft war.
»Ich bin nun alt genug, MrsTrentham«, hörten sie ihn sagen, »um Weihnachten voll und ganz zu genießen. Nur die Jugend langweilt sich während der Festtage. Zweifellos geht es Ihnen auch so.«
»Mir ist in Vernon House noch nie langweilig gewesen«, erwiderte die Dame. »Sie sind ein viel zu aufmerksamer Gastgeber, um so etwas wie Überdruss aufkommen zu lassen. Ich finde es wirklich bedauerlich, dass Vernon House keine Hausherrin hat.« Das sagte sie mit einem Lächeln, das zugleich züchtig und herausfordernd war. Sir Eustace zwirbelte seinen grauen Schnurrbart und erwiderte das Lächeln.
»Dieser Mangel könnte durchaus behoben werden, Ruby. Es ist nie zu spät, um –«
Einem Dienstmädchen glitt das Tablett aus den Händen; scheppernd fiel es zu Boden. Sir Eustace verstummte mitten im Satz, sein Mund zuckte, sein Gesicht war aschfahl geworden. »Mein Gott!«, rief er. »Was war das?« Dann wurde ihm bewusst, dass MrsTrentham ihn neugierig musterte. »Meine Nerven sind seit der Grippe angegriffen«, versuchte Sir Eustace sich wenig überzeugend zu rechtfertigen. »Jeder unerwartete Lärm treibt sein übles Spiel mit mir und wirft mich glatt um. Ich fürchte, es klingt albern …« Er hielt inne und musterte seine Tischdame, um die Wirkung seiner Worte zu prüfen. Doch in Ruby Trenthams Augen las er Verständnis.
»Aber gar nicht«, widersprach sie. »Ich glaube, den meisten Finanziers ergeht es ebenso: Morris zum Beispiel ist das reinste Nervenbündel, und er kann sich nicht einmal mit einer kürzlich überstandenen Krankheit rechtfertigen. Wenn er ein gutes Geschäft an der Börse macht oder ein lukratives Angebot erhält, zittert er immer wie ein kleines Vögelchen, nicht wahr, Morris?« Damit wandte sie ihr schönes Antlitz ihrem übergewichtigen und wohlhabend wirkenden Ehemann zu.
»Wenn du es so hinstellst, meine Liebe, dann muss ich dir wohl zustimmen. Wie du mir ja beigebracht hast«, äußerte er mit leicht angesäuerter Stimme.
Obwohl Trentham zu den Männern gehörte, die förmlich danach lechzen, dass ihre Frauen von allen bewundert werden, sollte sich diese Bewunderung doch innerhalb gewisser Grenzen bewegen. Es wurde sogar gemunkelt, dass er Sir Eustace Vernons Interesse an seiner schönen Gemahlin mit merklichem und wachsendem Missfallen betrachte.
»Ich konnte nicht umhin, Ihr Gespräch zu belauschen, Sir Eustace«, mischte sich ein hochgewachsener, glatt rasierter Mann ins Gespräch, der Trentham gegenübersaß, »besonders deswegen, weil es zufällig in meinen persönlichen Arbeitsbereich fällt. Sie haben durchaus recht. Die Grippe treibt ihr böses Spiel mit den Menschen, lässt so manches andere Übel wie einen Scherz wirken – und das Nervensystem des Kranken ist einer ihrer bevorzugten Jagdgründe. Ist sie erst einmal dort eingedrungen, lässt sie den Teufel los.« So sprach Dr.Lionel Carrington, Sir Eustace Vernons medizinischer Beistand, zu dem der Hausherr großes Vertrauen gefasst hatte.
»Da haben Sie’s, Trentham: Carrington eilt mir zu Hilfe! Er kennt mich. Er versteht mich.«
Der Arzt schmunzelte zustimmend, doch in diesem Moment ergriff bereits ein anderer Gast das Wort.
»Sie sind viel zu bescheiden, Sir Eustace. Sie unterschätzen sich und verkennen die Strapazen, denen Sie ausgesetzt waren. Man muss nicht lange nach den Ursachen für Ihre Unpässlichkeit suchen. Warum sprechen Sie von ›Grippe‹? Haben Sie schon die Nacht des elften Januar vergessen? Sicherlich nicht! Was Sie getan haben, wird für immer in den Herzen der Menschen von Mapleton weiterleben.«
Die Stimme des Mannes zitterte vor Erregung und klang beinahe wie die eines fanatischen Eiferers. Dr.Carrington drehte sich zur Seite und schaute seinen Nachbarn fragend an. Der sprang auf.
»Ladies und Gentlemen!«, rief der Geistliche Father Jewell voller Dramatik und mit einer Stimme, die vor Rührung bebte. »Ich möchte noch einen Toast ausbringen, bevor die Tafel aufgehoben wird. Lassen Sie uns auf die Gesundheit der Kinder anstoßen – der Männer und Frauen von morgen –, denen Sir Eustace Vernon das Leben rettete!«
Wie ein eiskaltes Messer schnitt seine kultivierte, scharfe Stimme durch die Länge der gedeckten Tafel. Die Gäste jedoch reagierten begeistert und prosteten ihm zu. Major Prendergast hatte sein Glas am Stiel gefasst und schwenkte es über den Tisch.
»Hört, hört«, dröhnte er beifällig, »Sir Eustace Vernon! Sir Eustace Vernon! Einer der tapfersten Männer, die ich kenne.«
Diana Prendergast, ein Inbegriff der Lieblichkeit mit blitzenden Augensternen, legte ihrem Mann die Hand auf den Arm. »Sei still«, befahl sie. »Sir Eustace will etwas sagen. Hör zu!«
Die anderen Gäste waren zu der gleichen Erkenntnis gekommen. Das Murmeln erstarb und sie sanken schweigend zurück in ihre Stühle. Sir Eustace erhob sich. Während er dort stand, am Kopf der Tafel, wurde Terry Desmond mehr denn je bewusst, wie sehr sein Gastgeber gealtert war. Unbarmherzig leuchtete sein kahler Kopf unter den grellen Lampen, und seine Schultern wirkten erschlafft. Seine Augen hinter dem Zwicker blitzten jedoch so lebhaft wie eh und je. Mut und Furchtlosigkeit standen darin zu lesen, Eigenschaften, die Sir Eustace in die Lage versetzt hatten, immer wieder die Fassade eines brennenden Hauses zu erklimmen, um ein Dutzend hilfloser Kinder zu retten. Da die Feuerwehr zu einem anderen Brand gerufen worden war, hatten die Kleinen keine andere Chance als Sir Eustace gehabt. Für seine heroische Tat und sein großes Engagement für die Gemeinde Mapleton war ihm daher am Geburtstag des Königs der Rang eines Baronets verliehen worden. Das hatte den übrigen Stadträten und Ratsherren reichlich Bauchschmerzen beschert, vom Bürgermeister und den ehemaligen Bürgermeistern ganz zu schweigen!
»Father Jewell misst einer ganz gewöhnlichen Tat zu viel Bedeutung bei«, begann Sir Eustace. »Ich habe nur meine Pflicht getan, so wie sie jeder aufrechte Engländer unter ähnlichen Umständen tun würde – und bin dafür belohnt worden. Eines besonderen Lobes bedarf es nicht mehr.«
Der Bürgermeister von Mapleton – Alderman Alfred Venables – wurde allmählich ungehalten. Selbst bei einem Weihnachtsessen schien es ein Ding der Unmöglichkeit zu sein, dem übermächtigen Schatten zu entgehen, den Vernons Adelsrang warf. MrVenables brummte seiner Frau etwas zu und starrte finster auf die imposante Gestalt seines Gastgebers.
»Mein Lohn«, fuhr Sir Eustace fort, »besteht nicht in der Ehrung, die mein König mir gewährte. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch.« Unvermittelt hielt er inne, und in der nachfolgenden Stille war Alderman Venables’ verächtliches Schnauben nicht zu überhören.
Helen schaute entrüstet zu dem Bürgermeister hinüber. Emily Venables fing ihren Blick auf und erwiderte ihn herausfordernd und kühl. Für einen Moment war die Höflichkeit der Gastfreundschaft außer Kraft gesetzt.
Sir Eustace fuhr fort: »Meinen Lohn habe ich in den Augen des ersten kleinen Mädchens erblickt, das ich in Sicherheit bringen konnte. Und mehr will ich dazu nicht sagen.« Er setzte sich und nahm den roten, in Krepppapier gewickelten Knallbonbon auf, der neben seinem Teller lag. Die Gäste nahmen dies als Erlaubnis, nun ebenfalls ihre Bonbons aufzureißen, und bald knallte es fröhlich rund um die lange Tafel. Doch dann, urplötzlich, nahm Sir Eustace’ Gesicht die Farbe von Zigarrenasche an, und in seinen Augen stand eine unerklärliche Angst. Seine Tischnachbarn bemerkten es. Sir Eustace erhob sich halb von seinem Stuhl und sank dann wieder zurück, als wüsste er nicht, was er tun sollte. Sein Blick suchte Purvis. Der Butler fing ihn auf und eilte sogleich herbei. Sir Eustace bedeutete ihm, sich vorzubeugen, und flüsterte ihm etwas zu. Purvis nickte zum Zeichen, dass er verstanden hatte, und verließ ruhigen Schrittes den weitläufigen Saal. Sir Eustace wartete, bis der Butler verschwunden war, dann erhob er sich erneut. Er schwankte ein wenig, und seine Stimme zitterte leicht. Nur mühsam brachte er die Worte heraus.
»Ladies und Gentlemen! Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn die Damen sich sogleich zurückziehen und die Herren ihnen nach angemessener Zeit Gesellschaft leisten würden. Ich sehe mich leider gezwungen, Sie kurzfristig zu verlassen, werde aber hoffentlich bald wieder zu Ihnen stoßen. Bitte nehmen Sie meine aufrichtige Entschuldigung für diese Unhöflichkeit an. Ich kann Ihnen jedoch versichern, dass deren Ursache sich meinem Einfluss entzieht. Ich würde viel darum geben, es ungeschehen zu machen. Ich habe gerade eine sehr böse Nachricht erhalten.«
Die erschrockenen Blicke seiner Gäste folgten ihm, als er durch den Saal schritt. Sir Eustace war so aufgewühlt, dass er offenbar nicht mehr wusste, was er tat. Denn er hatte von der Tafel zwei rote Knallbonbons mitgenommen und hielt sie nun in der Hand. Als er die Tür passierte, sah Ruby Trentham, dass es sich um seinen Kracher handelte und um den, der für sie bestimmt gewesen war.
KAPITEL 2
HAMMONDSCHREIT
Geraume Zeit später und nach reiflicher Überlegung äußerte Dr.Carrington, dass er bereits in jenem Moment die grimmige Präsenz der Tragödie gespürt habe. Wie genau er zu dieser Überzeugung gelangt war, konnte er allerdings nicht erklären. An dem Abend selbst hatte er scheinbar kein Wort davon verlauten lassen. Keiner der anderen konnte sich daran erinnern, was ja zu gewissen Schlüssen verleitet. Jedenfalls zogen die Damen sich zurück, wie Sir Eustace es angeregt, ja geradezu verlangt hatte. Ungefähr eine halbe Stunde später – genauer gesagt: um neun Uhr fünfunddreißig – erhoben sich auch die Herren von der Tafel und gesellten sich zu den Damen. Terence Desmond ging voraus in den üppig möblierten Salon, und die anderen folgten ihm. Inzwischen hatte sich jedoch etwas Undefinierbares in der Atmosphäre des Hauses verdichtet; wie ein Leichentuch hing es über der Gesellschaft und sorgte dafür, dass nahezu alle Versuche, die Stimmung zu heben, zum Scheitern verurteilt waren. Die Unterhaltung plätscherte ziellos dahin. Zwei Stunden verstrichen in quälender Langsamkeit. Nach einer Weile fanden sich einige der Gäste zu einer Partie Bridge zusammen, das Ehepaar Venables, Morris Trentham und Diana Prendergast. Helen Ashley, Ruby Trentham, Major Prendergast und Father Jewell begaben sich in das angrenzende Musikzimmer, während Desmond und Carrington ins Billardzimmer abwanderten, um, wie Ersterer es ausdrückte, »die Kugeln ein bisschen herumzustoßen«, denn beide Herren waren passionierte Spieler. An dieser Stelle der Geschichte sei vielleicht angemerkt, dass der Salon sich direkt neben dem Musikzimmer befand, und daran schloss sich der Billardraum an.
»Was möchtest du tun, Ruby?«, fragte Helen, während sie sich vor dem Klavier niederließ. »Du wirkst ein wenig verloren. Wenn du bei mir bleibst, singe ich dir gerne etwas vor. Sag mir nur, was du hören möchtest.«
»Danke – aber ich habe leichtes Kopfweh. Ich merke schon seit einer Weile, dass es kommt. Wenn es dir nichts ausmacht, schaue ich lieber den Jungs im Billardzimmer zu.«
Ruby Trentham war so blass, dass man ihr die Kopfschmerzen ohne Weiteres abnehmen konnte. Sie wandte sich zum Gehen und ließ Helen am Klavier allein.
Somit war die Bühne in Vernon House an jenem Weihnachtsabend um Viertel vor zwölf für die Inszenierung eines der sonderbarsten Kriminalfälle bereitet, den ein Ermittler jemals zu enträtseln hatte.
Unvermittelt fiel Helen Ashleys Blick auf die goldbronzierte Kaminuhr. »Meine Güte, Terry!«, rief sie aus. »Sieh nur, wie spät es ist! Was in aller Welt kann Onkel Eustace nur so lange aufgehalten haben? Wenn er nicht um Punkt zwölf wieder bei uns ist, gehe ich ihn suchen.«
Terence machte ein ernstes Gesicht. »Das ist wirklich höchst ungewöhnlich – er ist bereits seit drei Stunden fort. Ich mache mir schon seit einer ganzen Weile Sorgen. Weiß der Himmel, was für Nachrichten er erhalten hat – und noch dazu am Weihnachtsabend! Wenn du dich auf die Suche begibst, Helen, dann komme ich mit.«
Venables kam durch das Zimmer auf die beiden zu. »MrsVenables und ich werden Sie nun leider verlassen müssen, Miss Ashley. Schon in der nächsten halben Stunde, wie ich fürchte. Ich habe meinen Wagen für halb eins bestellt. Falls Ihr Onkel vorher nicht auftauchen sollte, bestellen Sie ihm doch bitte beste Grüße und erklären Sie ihm die Situation, wären Sie so nett? Es bekommt MrsVenables nicht, allzu spät noch unterwegs zu sein. Die kalte Nachtluft und ihr Asthma …«
Genau in diesem Augenblick, als Alderman Venables seinen historischen Beitrag beisteuerte, erscholl ein markerschütternder Schrei in Vernon House. Es war ein Schrei der Angst – und mehr als nur gewöhnlicher Angst: Panik sprach aus ihm und darüber hinaus das schiere Entsetzen! Er schien, von der Halle aus gesehen, von der gleichen Seite des Hauses zu kommen, wenn auch mehr zur Rückfront hin. »Großer Gott!«, rief Morris Trentham. »Was in aller Welt hat das zu bedeuten? Das war ja eine Frau!«
Ohne ein weiteres Wort setzten sich die Leute in Bewegung und eilten durch die Halle. Nun war Stille eingetreten. Wer auch immer da geschrien hatte, besaß nicht die Energie, eine derartige Lautäußerung zu wiederholen. Der Suchtrupp verharrte, ungewiss, welche Richtung er nehmen sollte, sowie in Unkenntnis über das genaue Ziel. Lionel Carrington drehte sich um und wandte sich an Father Jewell.
»Woher ist bloß dieser Schrei gekommen, Father?«, fragte er nervös. »Haben Sie eine Ahnung?«
Hilflos schüttelte der Geistliche den Kopf. Um seine Erregung zu lindern, presste er beide Hände auf die Brust.
Ruhig schaltete sich Helen Ashley ein. »Ich glaube, er ist aus dem Arbeitszimmer meines Onkels gekommen.« Obwohl sie äußerlich gefasst schien, bebte ihre Stimme. »Ganz sicher aus der Richtung.« Sie bemühte sich um eine genauere Beschreibung. »Das Zimmer rechts am Ende des Korridors. Es führt auf den Garten hinaus.«
»Der Meinung bin ich auch, Helen!«, rief Terence Desmond. »Kommen Sie – beeilen wir uns!«
Prendergast und er überholten die anderen und langten als Erste vor der Tür an. Die war jedoch verschlossen und außen steckte kein Schlüssel.
»Wir müssen sie rammen«, entschied Major Prendergast, als die Übrigen keuchend zu ihnen aufschlossen. »Gehen Sie ein wenig beiseite, meine Damen, bitte. Das hier ist Männersache.«
Die Herren warfen sich mit ihrem ganzen Gewicht gegen die Tür. »Ich weiß einen besseren Weg hinein!«, rief Desmond unvermittelt. Er machte auf dem Absatz kehrt und lief zurück, durch den Salon, das Musikzimmer und das Billardzimmer bis in den Garten. Helen Ashley sah ihm mit weit aufgerissenen Augen nach, Angst im Blick. Eine ganze Weile hielt die Tür stand und trotzte sämtlichen Anstrengungen. Sosehr die Männer sich auch abmühten, sie wich und wankte nicht – bis sie endlich gerade mal einen Zoll breit nachgab. Schmerzhaft gering schien der Erfolg, bei umso größerer Ungeduld. Doch urplötzlich gab die Tür dem Ansturm nach. Als sie im Zimmer standen, kam ihnen auch schon Terence Desmond entgegen, der den Weg durch die Türen zum Garten genommen hatte. Helen Ashley bemerkte den stummen Vorwurf in seinem angstbleichen Gesicht, als sie zugleich mit den Männern in den Raum stürzte – im Widerspruch zu dem klaren Befehl, der kurz zuvor von Major Prendergast ausgegeben worden war. Doch Helen hatte ihm unmöglich Folge leisten können. Auf dem Teppich, gerade vor den Gartentüren, lag der Körper einer Frau, reglos, wie tot.
»Es ist Hammond!«, rief Helen. »Eine der Küchenmägde! Was ist mit ihr? Was tut sie hier?«
Dr.Carrington schritt rasch auf den hingesunkenen Körper zu und kniete neben der jungen Frau nieder, um eine erste Untersuchung vorzunehmen. Die Gäste versammelten sich in einem Halbkreis und blickten erwartungsvoll, aber auch von übler Vorahnung erfüllt, auf die Szene. Dann verkündete Carrington etwas, das alle überraschte: »Sie ist lediglich ohnmächtig. Hat jemand vielleicht Riechsalz dabei? Und wäre jemand so nett, ihr ein Glas Wasser zu holen?«
Diana Prendergast, die sich im Hintergrund gehalten hatte, kam der Bitte des Arztes unverzüglich nach. Binnen weniger Augenblicke kehrte etwas Farbe in die Wangen des Mädchens zurück. Dann schlug es die Augen auf, in denen noch das Grauen über sein Erlebnis stand, was auch immer es gewesen sein mochte.
»Kommen Sie, Hammond«, sagte Carrington besänftigend. »Was hat denn das alles zu bedeuten? Reißen Sie sich zusammen und erzählen Sie.« Während er sprach, half er dem zitternden Mädchen auf die Beine und setzte es in einen Sessel. Hammond durchlief ein Schauder. Angstvoll sah sie sich im Zimmer um.
»Die Hand!«, rief sie aus. »Die eisige Hand!« Wieder durchfuhr sie ein Beben. »Das vergesse ich im Leben nicht. Es war schrecklich!« Sie klammerte sich an Dr.Carringtons Arm. »Lassen Sie nicht zu, dass sie mich wieder anfasst, Sir«, flehte sie. »Ich könnt’s nicht ertragen.«
»Schon gut, mein Kind«, sprach der Arzt begütigend, »haben Sie keine Furcht. Beruhigen Sie sich, fassen Sie sich. Erzählen Sie uns, was Ihnen solche Angst gemacht hat. Je eher Sie es uns sagen, desto rascher können wir Ihnen helfen. Nun denn – was ist geschehen?« Er sah ihr forschend ins Gesicht.
»Ich will’s ja gern sagen«, erwiderte Hammond, die sich nun ein wenig gefasst hatte. »Ich bin vom Garten reingekommen …«
Sofort wurde sie unterbrochen. »Was haben Sie zu dieser nächtlichen Stunde im Garten gemacht, Hammond?« Helen Ashleys gebieterischer Ton hallte durch das Zimmer; sie stellte damit genau die Frage, die ihnen allen durch den Kopf gegangen war.
»Ich bin im Zwinger gewesen, Miss Helen.« Ruhig blickte Hammond ihre Herrin an. »Boris, dem Wolfshund, geht’s ja nicht gut, und er bekommt seit drei Tagen Spezialfutter. Aus dem einen oder andern Grund – Stevens hat ihn nicht rechtzeitig füttern können – hat er mich heute Abend gebeten, das für ihn zu übernehmen. Ich hatte es eine Weile vergessen, aber vor Kurzem war es mir wieder eingefallen.«
»Weiter«, drängte Helen Ashley.
»Wie ich auf den Gartenweg komme, stelle ich erstaunt fest, dass die Gartentüren vom Arbeitszimmer sperrangelweit offen stehen. Der Mond schien ja, und da konnte ich sie ganz deutlich sehen. Es war fast wie am Tag. Ich fand das ganz schön merkwürdig, also bin ich drauf zugegangen. Ich wollte bloß nachsehen, ob alles in Ordnung war, oder dafür sorgen, wenn Sie so wollen. Im Zimmer war’s dunkel, das elektrische Licht war nicht an, und da bin ich erst vor den Türen stehen geblieben und hab gelauscht. Plötzlich glaube ich, ein komisches Rascheln zu hören – aus dieser Richtung.« Hammond zeigte auf die linke Zimmerecke, wo eine schwere Portiere an einer Messingstange hing und die Türöffnung zum Nachbarzimmer verdeckte. Alle Augen blickten automatisch zu dem Vorhang, während Hammond mit ihrer Erzählung fortfuhr. »Ich spähe also in die Dunkelheit – es war fast schwarz in der Ecke da –, obwohl ich am liebsten davongerannt wäre. Plötzlich springt eine grauenhafte Gestalt auf mich zu, sie hält was Glänzendes in der Hand. Ich glaub, das war ein riesiges Messer. Es hat so geblitzt in der Dunkelheit. Und dann kommt so eine eiskalte Hand, und eisige Finger drücken auf mein Gesicht – und da hab ich vor Schreck aufgeschrien!«
»Ja, das haben wir gehört«, sagte Dr.Carrington trocken. »Geschrien haben Sie, das kann man wohl sagen.«
»Aber wer war es, Hammond? Haben Sie irgendeinen Verdacht?«, fragte Desmond.
Verwirrt schüttelte die Küchenmagd den Kopf.
»War es überhaupt jemand, den Sie kannten?«, fragte Morris Trentham mit leisem Vorwurf in der Stimme.
»Ich kannte die Person nicht«, sagte Hammond unsicher. »Es war ja nicht genug Zeit dafür. Ich kann nur eins über sie sagen.«
»Was denn?«, hakte Major Prendergast nach. »Jede noch so unbedeutende Kleinigkeit kann uns weiterhelfen. Was ist Ihnen aufgefallen?«
»Es war eine Frau«, erwiderte Hammond.
»Warum glauben Sie das?«, fragte Desmond.
»Ich glaube es nicht – ich weiß es«, antwortete das Küchenmädchen. »Ich weiß es«, wiederholte sie, »weil sie an mir vorbeigelaufen ist, im Dunkeln, und da hat mich ihr Kleid oder ihr Rock gestreift.«
Noch während Hammond sprach, begannen die Uhren im Haus, in der Kirche und in den anderen Gebäuden der Nachbarschaft die volle Stunde zu schlagen. Sie waren nicht ganz synchron – manche tönten ein paar Sekunden zu früh, andere zu spät –, aber alle verkündeten das Gleiche: Mitternacht!
KAPITEL 3
DIE FORTSETZUNGDES SCHRECKENS
»Würden Sie bitte mal herkommen, meine Herren?«, fragte Helen Ashley mit versagender Stimme. Sie stand vor dem Schreibtisch ihres Onkels, das Gesicht verzerrt, bleich wie der Tod. Die anderen eilten zu ihr, Dr.Carrington voraus. »Sehen Sie«, fuhr sie fast tonlos fort. »Sehen Sie! Was ist das für ein Fleck, da, auf dem Löschblock?« Sie deutete auf die weiße Schreibunterlage, die auf Sir Eustace Vernons Schreibtisch lag. Alle Blicke richteten sich darauf. Father Jewell tat einen erschrockenen Ausruf. Auf dem weißen Löschblatt war ein winziger dunkelroter Fleck zu erkennen, kein Tintenfleck, das war allen sofort klar. Wie eine kalte Hand legte sich Entsetzen um die Herzen.
»Sieht mir ganz nach Blut aus«, urteilte Dr.Carrington. »Nur die Ruhe, Miss Ashley! Sie dürfen keine voreiligen Schlüsse ziehen. Selbst jetzt mag noch alles in Ordnung sein. Nehmen Sie nicht gleich das Schlimmste an – nur aufgrund dieses Flecks.« Er warf einen scharfen Blick auf Helen Ashley, als befürchtete er, sie könne die Fassung verlieren.
»Mein Onkel«, murmelte sie lediglich. »Mein Onkel. Ich habe Angst.«
Die Dezemberkälte drang durch die offenen Gartentüren und verstärkte den Eindruck der schaurigen Entdeckung. Die Wirkung auf die Gäste war höchst unterschiedlich. Major Prendergast und seine Frau versuchten, eine Haltung anzunehmen, die man am besten als »aristokratische Unnahbarkeit« bezeichnen kann: Sie schienen den anderen demonstrieren zu wollen, dass das Wort »Angst« nicht zu ihrem Vokabular zählte. Alfred und Emily Venables hingegen – plebejisch und geldstolz – unternahmen keinerlei Anstrengungen, ihre Unruhe zu verbergen. MrsVenables’ künstliche Zähne klapperten vernehmlich, und wäre der Hinweis auf eine düstere, grausige Tragödie nicht so deutlich gewesen, wäre Terence Desmond wohl in Lachen ausgebrochen – ein Lachen, das ihm durchaus angemessen erschien. Wenn ihre Zunge nicht schnattert, dann tun’s ihre Zähne, dachte er zynisch. In seiner Miene jedoch spiegelte sich Besorgnis, die vor allem Helen Ashley galt. Immer wieder glitt sein Blick zu ihr. Helen dagegen schien sich resigniert einer höheren Macht überantwortet zu haben. Diese Macht war ganz plötzlich in ihr Leben eingedrungen und hatte sie vorerst in einen Zustand eigenartiger Passivität versetzt. Er würde vorübergehen, das wusste sie, doch noch war der Zeitpunkt nicht gekommen.
Schmallippig stand der asketisch wirkende Father Jewell neben Dr.Carrington; seine schwarze Soutane fügte den Vorgängen einen Hauch des Makabren hinzu. Die harten, strengen Linien seines Gesichts verrieten nichts über seine Empfindungen, aber in seinen tief liegenden, fast eingesunkenen Augen lauerte die Wachsamkeit. Ein Funke sprühte in ihnen, der sich jederzeit zu einem Feuer entwickeln konnte.
Die Trenthams hielten sich ein wenig abseits, am Rande des Geschehens. Die blasierte Selbstgefälligkeit Morris Trenthams war zweifellos erschüttert worden, wie sein feistes und dennoch faltiges Gesicht nur zu deutlich verriet. Ruby hatte die Augen weit aufgerissen, und hätte man in diesem Moment die französische Methode der »Herzschlagaufzeichnung« bei ihr angewandt, so hätte das Gerät einen alarmierenden Zustand angezeigt. Dr.Carrington als Arzt schien dagegen anzukämpfen, von seinen Gefühlen als Mitmensch überwältigt zu werden. Terence, der ihn scharf beobachtete, vermerkte mit Bewunderung, wie hart der Mann seinen Kiefer anspannte. Major Prendergast zündete sich eine Zigarre an, um seine Nerven zu beruhigen. Carrington wandte sich noch einmal an Hammond, die inzwischen ihre Ruhe und Fassung wiedererlangt hatte, und zwar so gründlich, dass sie von allen Anwesenden am gelassensten wirkte.
»Sie sind ganz sicher, dass nur ein Mensch aus dem Zimmer gekommen ist, nachdem Sie vom Garten eingetreten waren?«
Hammond nickte zuversichtlich. »Soweit man sich im Dunkeln, wo ich mich ja befand, sicher sein kann, Sir. Stockduster war es in der Ecke da.« Und wieder zeigte sie auf den schweren Vorhang vor dem Durchgang zum Nebenzimmer.
»Was meinen Sie, Dr.Carrington«, schaltete sich Major Prendergast ein, »sollen wir nachschauen, was sich dort verbirgt? Ist das nicht unsere Pflicht?« Er nickte in die Richtung, in die Hammonds ausgestreckter Finger wies.
»Ich denke schon. Ich glaube, das sind wir Miss Ashley schuldig. Ich gehe doch recht in der Annahme, Miss Ashley, dass sich hinter dieser Portiere die Bibliothek Ihres Onkels befindet?« Helen nickte stumm. »Sie haben nichts dagegen, wenn der Major und ich …?« Fragend hob er die Augenbrauen.
»Überhaupt nicht, Doktor«, lautete ihre leise Antwort. »Es ist mir bewusst, dass es nötig ist. Falls es Ihnen aber nichts ausmacht, würde ich lieber hierbleiben, bis …«
»Selbstverständlich, Miss Ashley. Das verstehe ich nur zu gut.«
Carrington gab Terence Desmond ein Zeichen, der jungen Frau im Notfall beizustehen, denn er fürchtete die Entdeckung, welche die nächsten Minuten bringen würden. Desmond ließ sich das nicht zweimal sagen, und bevor der Arzt und der Major das Nebenzimmer betreten konnten, stand er bereits an Helens Seite. Major Prendergast zog den Vorhang beiseite, und die beiden Männer verschwanden in dem kleineren Raum. Einen Augenblick lang herrschte unheilvolles Schweigen. Dann steckte der Arzt den Kopf aus dem Zimmer.
»Würden Sie bitte für einen Moment hereinkommen, Miss Ashley?« Besorgt versuchte sie in seiner Miene zu lesen, was sie dort erwarten mochte, bevor sie seiner Aufforderung Folge leistete. Carrington bemerkte ihre Angst. »Es ist nichts Schlimmes«, versicherte er. »Hier ist nichts, vor dem Sie sich fürchten müssten. Ich möchte nur, dass Sie uns in einer bestimmten Sache helfen.«
Mit leichten, schnellen Schritten ging Helen auf den Arzt zu und verschwand hinter ihm in der Bibliothek. Alle außer Desmond versammelten sich vor der Portiere.
»Schauen Sie mal hier, Miss Ashley«, sagte Dr.Carrington, »was hat das zu bedeuten?« Der Safe in der Wand stand offen, der Schlüssel – einer von vielen an einem Schlüsselbund – steckte im Schloss. »Sie wussten natürlich, dass sich in dieser Wand ein Safe befindet?«, fragte der Major.
»Natürlich, Major Prendergast. Ich habe ihn schon viele Male gesehen.«
Sämtliche Schubladen in dem Safe waren verschlossen.
»Wenn Sie ihn jetzt anschauen – meinen Sie, es könnte etwas daraus entwendet worden sein, Miss Ashley?«
Helen schüttelte den Kopf, wenn auch zweifelnd. »Ich weiß nicht, was mein Onkel hier hinter Schloss und Riegel aufbewahrt«, erklärte sie. »Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Oberflächlich betrachtet scheint es mir aber nicht so, als hätte sich jemand am Inhalt zu schaffen gemacht. Soweit ich das beurteilen kann.« Wieder schüttelte sie den Kopf, nun doch von stärkerem Zweifel befallen. »Aber wo ist mein Onkel?«, murmelte sie. »Er könnte es Ihnen sagen; für mich sieht hier alles aus wie immer.«
Major Prendergast rüttelte an den Griffen der Schubladen, die in den Tresor eingepasst waren. Alle waren gesichert. »Merkwürdig«, brummte er. »Die Safetür steht weit offen, außerdem steckt der Schlüssel – sieht ganz so aus, als wäre jemand hier gewesen, der dann überrascht worden ist und keine Zeit mehr hatte, sein Vorhaben auszuführen. Sind Sie nicht auch dieser Meinung, Doktor?«
Carrington machte eine zustimmende Handbewegung. »Es sieht auf jeden Fall danach aus.« Dann aber schien auch er von Zweifeln befallen zu werden und schüttelte düster vorahnend den Kopf. »Aber ich werde einfach nicht schlau daraus! Wer war die Person im Zimmer, die Hammond solche Angst eingejagt hat? Was hatte sie hier zu suchen? Und wo steckt unser Gastgeber?«
Ein schriller Ausruf von Terence Desmond aus dem Nebenraum ließ alle aufhorchen.
»Doktor! Major Prendergast! Kommen Sie bitte schnell her!«
Desmond klang so aufgeregt, dass die beiden Männer sogleich zu ihm eilten. In seiner Hand hielt er ein weißes Blatt Briefpapier. »Lesen Sie!« Er drückte es Dr.Carrington in die Hand und ging wieder zu Helen, baute sich beschützend an ihrer Seite auf. Desmond wusste: Was nun kam, würde für sie eine größere Prüfung bedeuten als alles bisher Geschehene. »Ich habe das Blatt dort unten auf dem Teppich gefunden, es hatte sich um das Tischbein gerollt.« Er legte den Arm um die Taille der jungen Frau. Der Major spähte über die Schulter des Arztes und versuchte, die Nachricht zu lesen. Für einen kurzen Moment herrschte angespanntes Schweigen, nur unterbrochen von dem vernehmlichen Atmen der Menschen im Raum.
»Was steht drin?«, rief Trentham mit einem Mal. »Zum Donnerwetter, Doktor, stehen Sie nicht einfach so da – erlösen Sie uns aus der Ungewissheit!«
»Es sind schlechte Nachrichten, Miss Ashley … Meinen Sie nicht, dass Sie lieber …?«
Helen wirkte nervös, aber entschlossen. »Es wäre besser, es zu erfahren, Dr.Carrington. Alles ist leichter zu ertragen als diese Ungewissheit. Was steht in dem Brief?«
»Ich verstehe einfach nicht, was hier vorgeht. Ich werde nicht schlau daraus. Oberflächlich betrachtet ist dieser Brief absurd – unfassbar. Besonders für diejenigen unter uns, die Sir Eustace gut kennen. Doch ich werde ihn vorlesen.« Das Schreiben, das dem Arzt so viele Bedenken verursachte, war nicht sonderlich lang. Die Zuhörer drängten sich zusammen, wie es Menschen in kollektiver Sorge instinktiv tun.
Vernon House,
Rodding,
am Weihnachtsabend
Meine liebe Helen, liebe Freunde!
Heute Abend ist ein unerwartetes Ereignis in mein Leben getreten, dem ich mich nicht stellen kann. Ich wähle daher eine Ausflucht, die man vielleicht »feige« nennen könnte. Dies jedoch ist Ansichtssache. Jedenfalls werde ich den Weg wählen, der mir ein rasches, schmerzloses Ende beschert.
Lebt wohl, meine Freunde – und Euch allen ein frohes neues Jahr.
Eustace Vernon
Wieder war es einen Augenblick lang totenstill im Raum. Dann löste sich Helen Ashley aus Desmonds Arm, streckte die Hand zu Dr.Carrington aus und sagte mit leiser, gepresster Stimme: »Darf ich den Brief sehen – bitte?«
Der Arzt gab ihr das Schreiben, wobei er sie forschend musterte. Während Helen las, schien sie sich an einen letzten Funken Hoffnung zu klammern. Dann jedoch schüttelte sie langsam den Kopf, denn der Funke war erloschen. »Es ist die Handschrift meines Onkels«, räumte sie ein. »Ich hatte geglaubt, der Brief sei vielleicht …«
Venables stellte sich neben sie und schaute auf den Brief. »Kein Zweifel, Miss Ashley«, ergänzte er. »Ich habe seine Schrift viel zu oft gesehen, um sie nicht zu erkennen.«
Father Jewell schaltete sich ein. »Wenn Sir Eustace Vernon von eigener Hand gestorben ist«, merkwürdigerweise legte er beide Hände auf die Brust, als zeugte er dieser Handlung in gewisser Weise Respekt, »und das anzunehmen, ist ja nur vernünftig, da wir den Blutfleck auf der Löschunterlage gefunden haben … wo ist dann die Leiche?«
»Genau das habe ich mich auch gerade gefragt«, sagte der Major.
Desmond ergriff das Wort. »Was sind wir doch für Idioten, dass wir hier noch herumstehen und reden! Vielleicht ist sein Versuch fehlgeschlagen, und er liegt verletzt irgendwo auf dem Grundstück!«
Prendergast wandte sich an seine Frau. »Diana, bring die Damen bitte in ein anderes Zimmer. Wir Männer müssen uns auf die Suche begeben. Der arme Vernon liegt vielleicht irgendwo dort draußen und braucht unsere Hilfe. Desmond hat zweifellos recht.«
Diana Prendergast legte ihren rechten Arm um Helen und bedeutete Ruby Trentham und MrsVenables, ihnen zu folgen. »Kommen Sie, meine Liebe«, sagte sie teilnahmsvoll. »Kommen Sie mit uns. Vielleicht finden die Männer ihn, und alles klärt sich auf. Machen Sie sich nicht zu viele Sorgen.«
»Danke, MrsPrendergast. Sie meinen es gut. Aber ich werde schon nicht zusammenbrechen, keine Angst. Dafür geht mir zu vieles im Kopf herum.«
»Soll ich Ihnen etwas bringen, Miss?«, fragte Hammond beflissen.
Bevor Helen antworten konnte, ergriff Terence Desmond das Wort. »Wir stellen also sofort einen Suchtrupp zusammen. Übernehmen Sie das Kommando, Major? Hammond, sagen Sie Stevens, er möchte uns sechs von den Dutzend Laternen geben, die im alten Stall hängen, wären Sie so nett? Hat jemand eine Taschenlampe zur Hand?«
»Ich«, meldete Major Prendergast unverzüglich. »Habe ich immer dabei zu dieser Jahreszeit und in diesem Teil des Landes. Wäre reinweg verloren ohne das Ding. Wenn wir die Laternen bekommen, hält jeder ungefähr ein Dutzend Schritte Abstand zu seinem Nebenmann, und dann rücken wir in möglichst geschlossener Phalanx vor. Wenn jemand etwas entdeckt –« Er verstummte abrupt, denn zum zweiten Mal in dieser Nacht erschütterte ein Schrei die Stille von Vernon House. Er schien jedoch von einem anderen, entfernteren Teil des Hauses zu kommen.
»Du meine Güte!«, stieß Prendergast hervor. »Was in aller Welt geht heute in diesem Haus vor?«
Einige wirkten wie gelähmt vor Angst. Die Ereignisse hatten ihnen allen Mut geraubt.
»Ein äußerst frohes Weihnachten«, brummte Alderman Venables mit grimmiger Ironie. Helen achtete nicht darauf, sondern packte Desmond ungestüm am Ärmel.
»Das ist aus dem Dienstbotentrakt gekommen, Terry«, sagte sie erregt. »Ich nehme an, jemand hat den armen Onkel Eustace gefunden.« Nervös griff sie sich an die Kehle.
»Sehr wahrscheinlich, Miss Ashley«, äußerte Dr.Carrington eifriger, als der Situation angemessen war. »Ich sollte besser sofort nachschauen. Möglicherweise werde ich gebraucht. Vielleicht ist es noch nicht zu spät …«
»Hier entlang, Doktor«, sagte Desmond entschlossen, »folgen Sie mir.«
Carrington und Desmond stürmten davon, Major Prendergast und Father Jewell folgten ihnen auf dem Fuße. Morris Trentham wandte sich an Alderman Venables. »Sie bleiben mit den Damen hier, Venables. Mir scheint, an diesem höllischen Ort sollte heute Nacht niemand allein sein. Die Damen brauchen unseren Schutz. Ich schließe mich den Gentlemen an.«
Carrington und Desmond mussten nicht weit laufen, um eine eindeutige Botschaft zu erhalten. Eben hatten sie die Biegung des langen Korridors passiert, der zum Dienstbotentrakt führte, als sie beinahe mit einer jungen Frau zusammengestoßen wären, die atemlos auf sie zustürzte. Ihre Lippen waren ebenso bleich wie ihr Gesicht, und die Angst sprang ihr förmlich aus den Augen. Es war eine Dienstmagd, und es war nicht zu übersehen, dass sie etwas Grauenhaftes erlebt hatte. Desmond erkannte die junge Frau: Sie war das Serviermädchen, das beim Dinner das Tablett hatte fallen lassen. Auch kannte er sie von früheren Besuchen in Vernon House. Ihr Name war Palmer, was ihm in dem Moment einfiel, als sie sie in ihrem rasenden Lauf stoppten.
»Waren Sie das, die so geschrien hat, Palmer?«, fragte er gebieterisch.
Das Mädchen schwankte und wäre den beiden Männern beinahe in die Arme gesunken.
»Halt!«, befahl Carrington. »Ganz ruhig. Was ist denn los, Mädchen? Was hat dir solche Angst gemacht?«
Palmer ballte die Fäuste; dann deutete ihr zitternder Zeigefinger in die Richtung, wo sich Desmonds Wissen nach die Anrichte befand, aus der der Butler vor dem Servieren die Speisen holte.
»Purvis!«, rief sie. »Da drin … Gehen Sie bitte rein, sofort!«
Die Männer benötigten keine weitere Aufforderung. Die Tür stand offen. Auf einem Stuhl neben dem kleinen Tisch saß Purvis, mit dunkelviolettem, aufgedunsenem Gesicht. Carrington verlor keine Zeit. Er rüttelte an den Schultern der zusammengesunkenen Gestalt, deren Muskeln vollkommen schlaff schienen. Der Arzt zog die Lider hoch und begutachtete Purvis’ Pupillen, die klein wie Stecknadelköpfe waren. Er suchte den Puls, horchte nach dem Herzschlag, tastete Gesicht, Hals und Arme ab. Alles fühlte sich gleich an: kalt wie Stein. Dr.Carrington schaute sich nach den anderen um und schüttelte den Kopf.
»Tot«, lautete sein Urteil. »Vergiftet!«
»Wie?«, blaffte Prendergast. Aufregung und Anspannung der letzten Stunden hatten auch sein Nervenkostüm angegriffen.
»Chloral, würde ich meinen«, erwiderte der Arzt. »Später werde ich es genau bestimmen. Aber die Symptome – die Muskelerschlaffung und der Zustand seiner Augen – deuten auf eine Chloralhydratvergiftung.« Sein Blick fiel auf den Tisch, die anderen folgten der Augenbewegung und sahen sogleich, was seine Aufmerksamkeit erregt hatte. Es handelte sich um ein Glas, das in der Gastronomie als »Pony« bezeichnet wird: ein sehr kleines Bier- oder Schnapsglas. Carrington nahm es in die Hand und roch daran. »Whisky, denke ich. Die Kristalle des Chloralhydrats haben einen äußerst stechenden Geruch und Geschmack, und ein kräftiger Whisky könnte benutzt worden sein, um diesen zu verdecken. Eine ganz merkwürdige Geschichte, nicht wahr, meine Herren? Alle diese Vorfälle! Wir werden uns an die Polizei wenden müssen, wir dürfen, wie ich fürchte, nicht länger damit warten.«
»Was meinen Sie, Doktor«, fragte Father Jewell, während er angesichts der Leiche andächtig das Kreuzzeichen schlug, »war es Selbstmord?«
»Mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit, Father. Wir haben keinen Grund, etwas anderes anzunehmen, soweit ich das beurteilen kann. Es wäre jedoch das Beste, wenn die Polizei die Leiche an Ort und Stelle in Augenschein nähme. Desmond, würden Sie bitte mit Mapleton telefonieren? Richten Sie Inspector Craig aus, dass Dr.Carrington ihn unverzüglich in Vernon House sprechen muss. Sagen Sie ihm, ein plötzlicher Todesfall erfordere seine Anwesenheit, da die Begleitumstände mehr als dubios sind. Wir hingegen sollten uns wieder der Suche nach Sir Eustace widmen. Sagen Sie ihm – Craig, meine ich – noch nichts von Sir Eustace, lassen Sie uns damit noch warten, bis er vor Ort ist. Dann wird die Situation einfacher zu erklären sein, vielleicht wissen wir bis dahin auch schon Näheres. Es ist eine vertrackte Angelegenheit! Man weiß einfach nicht, was das beste Vorgehen wäre. Aber eine Sache hat auf jeden Fall Vorrang: Wir müssen alles daransetzen, den armen Vernon zu finden. Kommen Sie, Major!«
Terence Desmond nickte zustimmend, rief dann aber überrascht aus: »Was ist denn das?« Er deutete auf die Innentasche des Fracks, den der Butler trug. Dort schaute etwas Rotes heraus. Father Jewell beugte sich vor, senkte seine Finger in die Tasche und zog den Gegenstand heraus, der Desmonds Aufmerksamkeit erregt hatte – es war ein Knallbonbon.
»Merkwürdig«, äußerte der Major, »so etwas in seiner Tasche herumzutragen.«
Der katholische Priester war jedoch bereits dabei, ein Ende des roten Knallbonbons zu untersuchen. Gebannt schauten die anderen zu. Aus dem gekräuselten Ende zog er ein Blatt gewöhnliches Briefpapier und entfaltete es. Nur ein paar Worte standen darauf. Die Männer reckten sich über Father Jewells gebeugte Schulter, um sie zu lesen. Der Text lautete: »Noch eine Stunde zu leben:Du bezahlst Deine Schuld – heute Nacht!« Besorgt schaute der Geistliche die anderen Männer an. »Das ist kein Selbstmord, Gentlemen, wie Dr.Carrington vermutete. Es ist Mord! Kaltblütiger Mord! Je eher wir die Polizei hier haben und Sir Eustace Vernon finden, desto besser!« Seine dunklen Augen loderten vor Vehemenz, aber Desmond sah, dass er dabei zitterte.
KAPITEL 4
EIN SCHOCKNACHDEMANDEREN
»Father Jewell hat zweifellos recht«, sagte der Major. »Es führt kein Weg daran vorbei. Desmond – das Revier in Mapleton. Wir anderen versuchen, Vernon so rasch wie möglich zu finden. Carrington?«
»Ja. Machen wir es so, wie Sie vorgeschlagen haben. Unter den gegebenen Umständen – aufgrund der neuen Sachlage – werde ich bei dem Leichnam bleiben, bis Inspector Craig eintrifft. Das ist meiner beruflichen Position angemessener, verstehen Sie.«
Desmond tat mit einem Nicken sein Einverständnis kund. »Dann rufe ich jetzt an. Bin in zwei Minuten wieder bei Ihnen, Major. Wenn Sie die Laternen haben, stecken Sie bitte auch eine für mich an und warten auf mich. Zwei Minuten sollten für ein Telefonat reichen. Nur gehen Sie nicht ohne mich los.«
»Schön!«, rief Prendergast mit schneidender Stimme. »Wir lassen also den Doktor hier, wie er es gewünscht hat, und erwarten Sie dann an der Gartentür des Arbeitszimmers.«
»Mir gefällt das alles überhaupt nicht, Major«, brummte Trentham, als die drei Männer den Dienstbotentrakt verließen. Nervös schaute er sich um. »Mich schaudert’s – und nicht vor Kälte. Wenn ich an die Leiche des Butlers denke und daran, wie Vernons Arbeitszimmer ausgesehen hat … leer … der Safe offen … die Tür zum Garten ebenso … dieser Fleck auf der Löschunterlage und die beiden Dienstmädchen, die vor Schreck geschrien haben … dann gefriert mir das Blut in den Adern. Wenn ich vorher gewusst hätte, was ich jetzt weiß, dann wäre ich nie –«
Major Prendergast machte dem Selbstvorwurf rasch ein Ende. »Jetzt reißen Sie sich mal zusammen, Trentham. Es ist für uns alle schrecklich. Denken Sie um Himmels willen daran, dass es unsere vordringliche Aufgabe ist, Vernon zu finden. Mit ›Zittern und Zagen‹ werden wir ihn ganz gewiss nicht aufspüren. Dazu braucht es Taten!«
Die Damen standen immer noch zusammengedrängt im Arbeitszimmer unter dem etwas zweifelhaften Schutz Alderman Venables’. Stevens, der Chauffeur, wartete schon mit den einsatzbereiten Laternen. Auch Desmond tauchte bereits wieder auf. Fragend blickte er zum Major, der sofort verstand.
»Purvis hat eine Art Absence erlitten«, verkündete Prendergast. »Doktor Carrington kümmert sich um ihn, während wir uns auf die Suche nach Sir Eustace konzentrieren. Diana! Würdest du bitte die Damen in den Salon bringen? Sobald wir mit Bestimmtheit wissen, was geschehen ist, kommen wir zu Ihnen, Miss Ashley.« Helen neigte leicht den Kopf; sie hatte verstanden. »Vorwärts, Gentlemen! Sie auch, Stevens, ja? Sie können sich ebenfalls nützlich machen.«
Ruhigen Schrittes verließ der Suchtrupp das Haus. Als sie im Park waren, rief der vorausgehende Prendergast: »Geben Sie sofort Meldung, wenn Ihnen etwas Ungewöhnliches auffällt!«
Sie hatten kaum das Haus verlassen, als Terence Desmond von einem Gefühl der Unwirklichkeit ergriffen wurde. Ihm schien, als wären seit dem Dinner erst wenige Minuten vergangen, und als hätte er seine wirkliche körperliche Existenz hinter sich gelassen und spielte nun die Rolle einer Fantasiegestalt in einem grotesken Weihnachtsmärchen. Gleichzeitig waren seine Sinne geschärft und aufs Äußerste angespannt, und während er mit seiner Laterne den Boden vor sich und im Kreis um sich herum beleuchtete, war er entschlossen, nichts zu übersehen, das ihnen bei der Suche behilflich sein könnte. Der Mond stand hoch am Himmel und erleichterte sein Vorhaben, wenn er denn hinter einer Wolke hervorschaute. Es war sehr still. Das einzige Geräusch, das an Desmonds Ohren drang, waren die gelegentlichen Fußstapfen der anderen. Er konnte sie zu beiden Seiten als langsam vorrückende Lichtreihe ausmachen, die Wirkung war gespenstisch. Doch kein Ruf ertönte, der eine Entdeckung verkündete, kein Laut durchbrach die kalte Dezembernacht. Es muss bald Morgen sein, dachte er und rechnete nach, obwohl man sich einen »Morgen« unter diesen Bedingungen kaum vorstellen kann. Plötzlich kam ihm ein Gedicht von Keats in den Sinn, und zu seinem Erstaunen ertappte er sich dabei, dass er die Zeilen laut rezitierte:
»In nächtigen Winterstunden,
O du glückseliger Baum,
Ist deinem Zweig entschwunden
Sein grüner Sommertraum …«
Mitten in der zweiten Strophe verstummte er, denn ein Gegenstand rechts von ihm, der im Lichtkreis der schaukelnden Laterne aufgetaucht war, hatte seine Aufmerksamkeit erregt. Desmond bückte sich und hob ihn auf. Zu seinem Erstaunen handelte es sich um ein Stück hart gepressten Tabaks. Er steckte es in die Tasche seiner Anzughose, spürte aber bald, dass der Klumpen aufgrund seiner Größe und Härte unangenehm drückte und seine Bewegungsfreiheit behinderte, also steckte er ihn in seine Brusttasche. Bald war er an der äußeren Umfassungsmauer des Gartens angelangt, die an der Rodding Road entlangführte, und drehte sich um, damit er seine Suche ein paar Yards neben der Fährte fortsetzen konnte, die er zuvor verfolgt hatte. Doch es war vergebens. Keine Spur von Sir Eustace Vernon. Nach und nach stellten sich die übrigen Mitglieder des Suchtrupps ein. Lediglich Trentham hatte etwas Erwähnenswertes zu melden.
»Das Garagentor steht offen. Außerdem befindet sich Sir Eustace’ Wagen nicht in der Garage. Mein Auto ist da und noch ein zweites, das ich für das des Majors halte, wenn ich mir natürlich auch nicht sicher bin. Aber Sir Eustace’ Automobil ist auf jeden Fall fort.«
»Sind Sie sich dessen ganz sicher?«, fragte Father Jewell.
Morris Trentham nickte. »So sicher, wie ich nur sein kann. Ich kenne doch Vernons Wagen, es ist ein Wolseley, Saloon de Luxe. Ich bin schon viele Male mit ihm darin gefahren.«





























