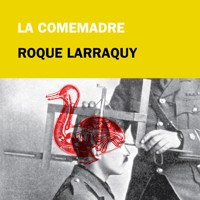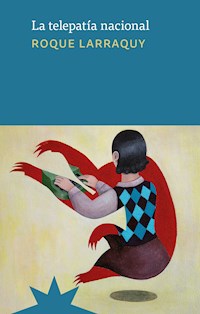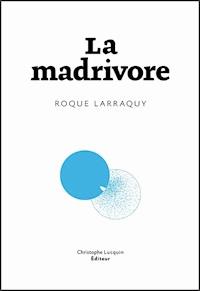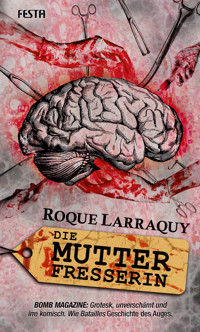
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Buenos Aires, 1907: Doktor Quintana und seine Kollegen, Ärzte einer Heilanstalt, sind auf der Suche: nach Liebe, dem Leben und vor allem nach der Antwort auf die große Frage, was auf den Tod folgt. Es wird ein grausiges Experiment arrangiert, das bereits nach kurzer Zeit völlig aus dem Ruder läuft … 100 Jahre später möchte ein gefeierter Künstler seinen eigenen Körper in ein Kunstobjekt transformieren – und der Kreis der Geschichte schließt sich. Skurril und extrem witzig – falls man einen Sinn für perversen Humor hat! Bomb Magazine: »Grotesk, unverschämt und irre komisch. Wie Batailles Geschichte des Auges.« Publishers Weekly: »Der Roman, der zwischen B-Movie-Horror und äußerst dunkler Komödie hin- und herpendelt, ist sowohl gruselig als auch lustig.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 187
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Aus dem argentinischen Spanisch von Linus Guggenberger
Impressum
Die argentinische Originalausgabe La Comemadre
erschien 2010 im Verlag Editorial Entropía.
Copyright © 2010 by Roque Larraquy
Copyright © dieser Ausgabe 2022 by Festa Verlag GmbH, Leipzig
Titelbild: AdobeStock / ynea + Parad St + thitiya
Alle Rechte vorbehalten
eISBN 978-3-98676-023-6
www.Festa-Verlag.de
Das Vorherrschende bei jeder Veränderung ist aber, dass die alte Materie weiterbesteht; die Untreue gegenüber der Vergangenheit bleibt eine bloß relative.
Ferdinand de Saussure,Grundzüge der allgemeinen Sprachwissenschaft
Die Mittelschicht wird Argentinien retten. Ihr Triumph wird in der Welt sein.
Prophetische Psychografie von
1907
1
Temperley, Provinz Buenos Aires, 1907.
Es gibt manche, die nicht existieren – oder nur ein bisschen, so wie Fräulein Menéndez. Die »Oberschwester«. In den Raum dieses Worts passt sie vollständig hinein. Die ihr unterstellten Frauen haben denselben Geruch, tragen dieselbe Kleidung und nennen uns »Herr Doktor«. Verschlechtert sich der Zustand eines Patienten durch eine Nachlässigkeit oder eine Spritze zu viel, gewinnen sie plötzlich an Präsenz: Sie existieren nur im Fehler. Menéndez hingegen versagt nie, deswegen ist sie die Oberschwester.
Ich sehe ihr zu, sooft ich kann, um irgendeine private Geste an ihr zu entdecken, ein Geheimnis, eine Unvollkommenheit.
Ich habe sie entdeckt. Es ist Menéndez’ Fünf-Minuten-Pause. Sie lehnt an der Brüstung und zündet sich eine Zigarette an. Da sie üblicherweise nicht aufblickt, bemerkt sie nicht, dass ich sie beobachte. Sie macht ein Gesicht, als dächte sie nicht, als wäre sie eine leere Flasche. Sie raucht fünf Minuten lang. In diesem Zeitraum schafft sie nicht die ganze Zigarette, bei der Hälfte hört sie auf. Ihre Verschwendung, ihr persönlicher Luxus, besteht darin, sie mit der speichelfeuchten Fingerspitze auszudrücken und in den Abfall zu werfen. So betritt sie die Welt an jedem einzelnen Tag, immer zur gleichen Zeit, und sie existiert gerade lange genug, damit ich mich in sie verliebe.
Meine Kollegen sind zahlreich, und noch immer kann ich sie nicht alle identifizieren. Da ist ein stämmiger Mann mit einem Leberfleck auf dem Kinn, der mich stets grüßt und an den ich mich nur wegen seines Leberflecks erinnere. Ich kenne weder seinen Namen noch sein Fachgebiet. Die eine Hälfte seines Gesichts hängt tiefer als die andere, und jedes Mal wenn er spricht – ich weiß nicht recht, wovon –, kneift er die Augen zusammen, als glühten sie.
Jedes Wort, das Silvia sagt, ist eine Fliege, die ihren Mund verlässt, und sie sollte lieber still sein, damit es nicht noch mehr Fliegen werden. Ich tauche sie in eiskaltes Wasser. Als ich meine Hand fortnehme, hebt sie ihren Kopf aus dem Wasser, atmet tief durch und fragt noch einmal: »Sehen Sie nicht, wie die Fliegen aus mir herauskommen?« Dass ich sie nicht sehe, beschäftigt sie mehr als die Kälte. Noch immer begreife ich nicht, weshalb man sie mir zugewiesen hat. Ich bin kein Psychiater. Ich bin recht sicher, dass das Eiswasser nichts weiter bewirkt als sie dem Risiko einer Lungenentzündung auszusetzen. Aber das Wesentliche in solchen Fällen ist die Hartnäckigkeit der Wahnvorstellung, die durch das Eiswasser eigentlich nachlassen sollte. Ich verspreche ihr ein warmes Bett. Man muss jedwede Form der Veränderung notieren: ob sie es vorzieht zu schweigen, ob sie nach ihrer Familie fragt (sie hat zwar keine Familie, aber das wäre ein gesünderer Wahn), ob es keine Fliegen mehr gibt. Sie sieht, wie sich die Fliegen an der Zimmerdecke auflösen.
Du denkst nicht über Krankenschwestersachen nach. In deinen fünf Zigarettenminuten mit diesem Nichtsgesicht, als wärst du keine Frau, sondern dein Frauenberuf, denkst du nicht über so etwas wie Katheter oder Infusionen nach, sondern über Dinge, die keine Form haben.
Da ist sie. Im Schlepptau eine Wolke aus Krankenschwestern, die um Hilfe bitten, um Rat, Patientenakten, Reinigungsmittel. Ich trage Pomade. Ich bin schon ganz nahe. Die Wolke zu vertreiben ist sehr einfach. Sie weichen mir aus, um meine Intimsphäre nicht zu verletzen. Wir Ärzte haben uns dieses Recht am eigenen Körper verdient, das die Schwestern, sonst aufseiten der Klistiere und Thermometer, bei so gut wie niemandem respektieren.
»Menéndez!«
»Ja, Doktor Quintana?«
Es ist wundervoll, sie meinen Namen sagen zu hören. Ich gebe ihr irgendeine Anweisung.
Die Heilanstalt befindet sich etwas außerhalb von Temperley, wenige Kilometer von Buenos Aires entfernt. Die größte Betriebsamkeit herrscht während des Tagesdiensts, dabei werden täglich im Durchschnitt 30 Patienten aufgenommen. Der öde Nachtdienst ist seit einem Jahr mir zugeteilt. Meine Patienten sind Männer, die in irgendeiner nahe gelegenen Kaschemme mit Messern aufeinander losgehen und uns dankbar sind für unsere Diskretion gegenüber dem Gesetz. Die Schwestern haben Angst vor ihnen. Sie verlassen die Heilanstalt über den Weg durch den Park, bevor es dunkel wird. Ich erinnere mich nicht, jemals gesehen zu haben, wie Menéndez weggeht. Sie ist immer da. Lebt sie in der Heilanstalt? Ich notiere: fragen.
Es wird Nacht, und es gibt nichts zu tun. Also lieber über die Gänge spazieren, jemanden für eine Plauderei oder ein Kartenspiel suchen, die Nacht in die Enge treiben. Eine Krankenschwester lehnt mit den Händen in den Kitteltaschen an der Wand. Ihre Kollegin schaut zu Boden.
Doktor Papini kommt auf mich zugetrabt, den Zeigefinger auf den Lippen, und bittet mich um Ruhe. Er hat Sommersprossen und die Angewohnheit, die Brüste bewusstloser alter Patientinnen zu befingern. Manchmal erzählt er mir Vertrauliches aus seinem Leben; seine absichtliche Schamlosigkeit ekelt mich ein wenig. Er führt mich in einen kleinen Raum.
»Wissen Sie, was sich im Leichenschauhaus befindet, Quintana?«
»Der Rotwein, den Sie am Dienstag dort versteckt haben.«
»Nein, der ist schon alle. Wir haben der Putzfrau ein paar Flaschen gegeben, damit sie den Mund hält. Kommen Sie mit.«
Papini öffnet eine Kiste. Er holt ein anthropometrisches Instrument heraus, das er vor einem Monat auf dem Paseo de Julio in Buenos Aires gekauft hat und das er auf Ledesmas Befehl hin in der Heilanstalt nie benutzen durfte. Er ist verschwitzt, exophthalmisch und riecht nach Zitrone. Das zeigt an, dass er glücklich ist oder glaubt, glücklich zu sein. Solche Dinge machen seine Persönlichkeit aus.
»Es geschehen merkwürdige Dinge, Quintana. Die Frauen schließen sich im Bad ein und benutzen sehr lange das Bidet. Wenn sie herauskommen, sagen sie kein Wort. Ich versichere Ihnen, bei diesem Ritual geht es weder um Hygiene noch um Selbstbefriedigung. Ich selbst habe meiner Frau die Beine auseinandergeschoben, habe an ihr gerochen, nichts. Sie sagte zu mir, sie habe sich die Zähne geputzt. Dabei habe ich sie gehört! Das Wasser im Bidet macht ein unverwechselbares Geräusch! Ich bin zu vielerlei unfähig, mein Freund, und noch unfähiger dazu, meine Ehefrau zu töten. Aber andere können das, verstehen Sie? Sie würden sie zwingen zu gestehen, denn in diesem Ritual von Wasser und Keramik liegt eine Bedrohung für uns Männer. Die Frauen schminken sich, um ihr Gesicht verschwinden zu lassen, sie zwängen sich in ein Korsett, und sie haben viele Orgasmen, wissen Sie das? Eine Menge von Orgasmen, die uns Männer völlig ausgedörrt zurückließe. Sie sind anders. Sie stammen von einem besonderen Affen ab, der vorher eine Nutria war, die vorher eine bläuliche Amphibie war oder etwas anderes mit Kiemen. Ihre Kopfform ist auch anders. Sie schließen sich ein, um das Bidet zu benutzen und dort dann nasse Dinge zu denken, die sich den Linien ihres Schädels anpassen. Die Bedrohung. Ich bin ein anständiger Mensch, ich habe nicht die Seele, um die Bedrohung abzuwenden. Aber andere schon. Die packen sie bei den Haaren und fragen sie, was sie so lange auf dem Bidet treiben. Und wenn die Frau nicht redet, dann schlitzen sie sie mit dem Messer auf. Diese Männer sind so anders als wir – wie die Frauen. Sie stammen von einem anderen Affen ab, einer minderwertigeren Stufe als unserer, aber gesund und durchsetzungsfähig. Im Leichenschauhaus ist so einer. Wir werden ihn vermessen. Ich werde Ihnen demonstrieren, dass sein Schädel genau der Beschreibung des atavistischen Typs entspricht, eines geborenen Mörders. Das muss jetzt getan werden, morgen holen sie ihn ab. Sie sind intelligent, aber ein wenig sturköpfig. Ich werde Ihnen das Maul mit Beweisen stopfen.«
»Der Kerl hat seine Frau umgebracht, weil sie ihm nicht sagen wollte, was sie auf dem Bidet gemacht hat?«
»Das ist eine Metapher, Quintana.«
Als wir auf den Gang zurückkehren, kommt mir in den Sinn, dass es in den Toilettenräumen der Heilanstalt keine Bidets gibt: Menéndez kann nichts vor mir verbergen. Weder nasse Gedanken noch Bedrohungen. Papini spricht immer schneller, während er Richtung Leichenschauhaus geht und dabei seine zitronige Duftspur hinterlässt.
»Der sogenannte qualitative Sprung, Quintana. Nachts tüfteln wir Pläne aus, so drastisch, dass sie uns völlig verändern würden, wenn wir sie in die Tat umsetzten. Aber mit Tagesanbruch verschwindet der Plan, und man ist wieder diese mittelmäßige Person, die sich hartnäckig das eigene Leben ruiniert. Geht es Ihnen nicht so? Bei diesen Männern ist das anders. Was glauben Sie, warum existieren sie immer noch, wo sie doch minderwertiger sind als wir? Es ist eine Sache der Anpassung: Sie machen. Was sie nachts planen, führen sie am nächsten Tag aus. Sie sind verdorben, das auch. Sie benutzen zu viel Pomade, stinken nach Tabak, schwitzen Galle aus, sie onanieren häufig und haben keine Moral, aber eine Ethik haben sie, die weder Sie noch ich jemals verstehen werden und die mit unserer Vernichtung zusammenhängt. Verstehen Sie?«
»Woher soll man denn wissen, ob sie zu viel Pomade benutzen?«
»Sie nehmen mich sehr wörtlich, Quintana.«
Wir betreten das Leichenschauhaus, den am besten ausgeleuchteten Ort in der gesamten Heilanstalt. Mit seinen Sommersprossen sieht Papini aus wie ein ausgezehrter Pubertierender. Wenn es diese Männer, die er mir eben beschrieben hat, wirklich gibt, dann ist er einer von ihnen. Der Körper liegt auf dem Untersuchungstisch. Menéndez darf mich niemals in diesem Licht sehen.
»Seine Zellengenossen haben ihn erhängt. Sehen Sie nicht diesen Ausdruck in seinen Augen, diese Farbe? Und da, den violetten Streifen am Hals. Schauen Sie sich die Stirn an, wie schmal die ist. Asymmetrischer Schädel, zu klein im Vergleich zum kaukasischen Durchschnitt, auffällige Wölbung in der rechten Temporoparietalgegend. Die Gedanken kommen eingedrückt bei ihm an. Wie viel Kraft man wohl braucht, um diesen Kiefer zu bewegen? Vergleichen Sie das mal, Quintana. Sie sind auch nicht das, was man schön nennt, aber bei Ihnen sind die Gesichtszüge an ihrem Platz. Bei den Eiern weiß ich’s nicht, aber das werden Sie selbst wissen, nicht wahr? Mit seinen Eiern soll jeder machen, was er will. Aber jetzt schauen Sie sich ihn hier an: Das linke Auge sitzt drei oder vier Millimeter tiefer als das rechte, riesige Ohren, untere Eckzähne entwickelter als die oberen. Dieser Mann hat nicht gekaut, er hat das Fleisch zerfetzt. Halten Sie seinen Fuß, Quintana, beugen Sie das Knie. Sehen Sie? Ein Greiffuß. Ein Mann mit einem kleinen Kopf, um sich nicht zu verstricken, stark behaart und Zähne, die uns mit einem Biss den Oberschenkel auseinanderreißen könnten … Begreifen Sie? In ein paar Jahren werden wir diese Biester identifizieren können, sobald sie ihren Müttern entschlüpft sind, und ihnen die Hoden leeren – bei den männlichen Exemplaren – oder den Uterus entfernen, wenn sie weiblich sind.«
»Warum tötet man sie nicht gleich?«
»Sie nehmen mich nicht ernst, Quintana.«
»Ich wollte nicht unhöflich sein, Papini. Dieser Mann ist ein Einzelfall.«
»Gut, dann vermessen wir Sie und Ihren Dickschädel. Oder wir suchen noch jemand anderen zum Vergleich.«
»Vermessen wir Fräulein Menéndez.«
Begleitet von Papini, betritt sie mein Arbeitszimmer. Sie weiß, dass ein solches Treffen nicht zu ihren Aufgaben in der Anstalt gehört. Man erkennt es an ihrem Gesicht, das nicht das ihre ist, und an ihrem nach hinten gebogenen Oberkörper.
Unsere Erklärungen sind knapp und ungenau. Sie begreift, dass es um ihren Kopf geht, aber sie weiß nicht, dass sich Papini eine Verbrecherin erhofft (oder auch nicht, jedes Resultat wäre nützlich) und ich mir eine Ehefrau. Sie setzt sich auf einen Stuhl und lässt sich vermessen. Sie hat sehr weiße Haut, helle Augen und eine leicht gebogene Nase. Ihre Schmerzreaktion (Papini pikst ihr in einen Finger) ist geringfügig.
Ich wage es nicht, etwas zu ihr zu sagen. Welcher Affe verbirgt sich in Fräulein Menéndez? Keiner, glaube ich. Ich traue ihr eine amphibische Vergangenheit zu, aber mehr nicht.
Ich schaue aus dem Fenster. Eine Reihe von Ameisen krabbelt aus einem Riss in der Wand. Sie bewegen sich vorwärts und beschreiben dabei einen weiten Kreis. Die ersten verharren am Rand, der Rest füllt den leeren Raum im Kreisinnern, bis es an der Wand weder Spalte noch Ameisen gibt, nur einen Fleck aus Chinin und knackenden Beinchen. Ich nehme an, in dieser Kreisförmigkeit besteht ihre Vorstellung von der Welt.
Ich finde Silvia auf dem Bett sitzend vor. Sie bittet mich, das Fenster zu öffnen, und fragt nach dem Wetter. Es ist kalt. Die Nachricht macht sie froh: Die Fliegen meiden die Kälte. Sie redet weiter von den Fliegen. Ich denke, in Klammern, an Menéndez. Nach und nach schließen sich die beiden krummen Linien um meinen Kopf. Und so ist Menéndez in meinem Kopf eingeschlossen und mein Kopf im Klammergriff …
Sollte ich diese Unterbrechungen, diese Fantasien zulassen? Ist das gesund? Ich kenne nicht einmal ihren Vornamen. Warum erröte ich? Schäme ich mich nicht?
Man muss seinen Affen wechseln. Am Tag tun, was man nachts geplant hat.
»Hast du dich schon einmal verliebt, Silvia?«
Sie redet gerade davon, wie man sich mit Fliegen zudeckt, aber sie akzeptiert die Abschweifung ganz selbstverständlich.
»Ja, ich hab mich verliebt.«
»In wen?«
»Das möchte ich Ihnen lieber nicht erzählen, Doktor.«
»Wurde die Liebe erwidert?«
»Ja.«
»Und wie hat es dieser Mann angestellt, dir zu sagen, dass er dich liebt?«
»Er hat zu mir gesagt: ›Ich denke an Sie, Silvia.‹«
»Er hat dich belogen.«
Wo ist sie?
Es muss jetzt geschehen. Bevor ich nicht mehr weiß, was ich ihr sagen will. Nicht dass ich es jetzt wüsste, aber der Drang ist da. Der Arzt mit dem Leberfleck sagt mir, dass Menéndez in der Heilanstalt sei, aber er wisse nicht, wo, und dass ich sie, wenn sie in ihrem Zimmer sei, lieber nicht stören solle.
Wie kann sie in einer Heilanstalt leben?
Ich sehe, wie sie das Arbeitszimmer von Ledesma betreten will, und magnetisch angezogen marschiere ich auf sie zu, damit irgendeine respektlose Person dort drinnen – oder sie selbst – mir die Tür vor der Nase zuschlägt.
Man weist mich darauf hin, dass eine außerordentliche Versammlung anberaumt wurde. Wir drängen uns vor der Tür zu Ledesmas Büro. Ich muss warten, genau wie der Rest. Meine Trauben bildenden Kollegen. Doktor Gigena ist ein Enthusiast, trägt Brille, und man sagt, er sei bei den Patienten am beliebtesten, weil er sie während der Injektionen mit Scherzen ablenkt. Doktor Gurian und Doktor Sisman sind der Ansicht, dass Gigenas beharrlicher Versuch, sich wie der lustige Onkel der Patienten aufzuführen, seine Arbeit als Arzt diskreditiere. Papini macht einen Scherz darüber.
Es kommen noch mehr Ärzte. Unsere Bäuche berühren sich, Knöpfe verhaken sich, Schnauzbärte stellen sich elektrisch geladen auf. Wir würden so weitermachen, verstohlene Fummeleien, um der bloßen Warterei ein paar Schattierungen abzugewinnen, aber das Auftauchen von Mr. Allomby, von dem unser Lohn abhängt, lässt uns strammstehen. Es kommt nicht häufig vor, dass man ihn in der Anstalt sieht. Die Versammlung ist wohl wichtiger, als wir dachten. Zeit, die Leichen aus dem Keller zu holen und einen Galgen aufzustellen.
Jemand begrüßt ihn auf Englisch – mit sehr schlechter Aussprache. Voller Angst, seine Aura zu beschmutzen, ziehen wir die Bauchnabel ein und drängen uns noch weiter zusammen. Diesmal allerdings nicht gleichzeitig, sodass irgendein Nachzügler über die Füße eines anderen stolpert und gegen die Tür des Arbeitszimmers stürzt. Die Tür gibt nach.
Wir sehen Ledesma auf allen vieren unter seinem Schreibtisch. Manche von uns sind der Ansicht, es sei vielleicht tadelnswert, auf allen vieren auf einem Bahnhof herumzukriechen, aber dass für einen rechtschaffenen Mann nichts dabei sei, es allein in seinem eigenen Arbeitszimmer zu tun. Andere hingegen erwägen die Möglichkeit, ihm einen Spitznamen zu verpassen, sich seinen Anweisungen zu verweigern und ihn zu bitten, seinen Posten wegen ungebührlichen Verhaltens niederzulegen. Diese Meinungsverschiedenheit in der Bewertung der Szene sorgt für Unbehagen. Wir halten den Atem an, bis Ledesma sich beobachtet fühlt. Er wendet den Kopf und sieht uns an.
Mr. Allomby schließt die Tür. »Noch nicht der richtige Zeit.«
Ledesma und Mr. Allomby sitzen am Kopf des Schreibtischs. Die demütigsten, die Körper auf der Suche nach Schutz und Zustimmung gebeugt, nehmen in der Nähe dieses Brennpunkts der Autorität Platz. Wir anderen: sicher, die Körper selbstbeherrscht, mit stolzgeschwelltem Bauch.
»Konnten Sie sie einfangen, Menéndez?«, fragt Ledesma laut.
Menéndez betritt den Raum mit einer lärmenden Ente in den Händen. Es ist ein wirkungsvoller Auftritt. Viele meiner Kollegen sehen sie zum ersten Mal – lange – an. Sie existiert auf Geheiß des Direktors.
»Setzen Sie sie dort auf das Tischchen«, sagt Ledesma.
Die Glasplatte des Tischchens bringt die Ente ins Wanken. Als sie das Gleichgewicht wiedergewinnt, findet sie zurück zu der Neutralität, die für ihre Spezies so charakteristisch ist. Neben ihr steht eine Holzkiste von mittlerer Größe. Der obere Deckel, der sich in zwei Hälften öffnen lässt, hat in der Mitte eine große kreisförmige Öffnung, umgeben von dem Wort ergo in eingeschnitzten lateinischen Buchstaben. Unter dem Deckel befindet sich eine Klinge, die mit der Wucht und Geschwindigkeit einer Armbrust waagerecht nach vorn schnellt. An den Seiten, verziert mit Reliefporträts von Louis XVI. und Marie Antoinette, liest man cogito beziehungsweise sum. Es ist klar, dass die Worte und Bildmotive in allegorischer Absicht angebracht sind, was die Schönheit des Ganzen etwas stört.
Ledesma lächelt. »Unsere arme kartesianische Ente.«
Durch eine Klapptür im unteren Teil der Kiste schiebt er die Ente in die Guillotine hinein und passt ihren Kopf in die Öffnung ein. Ohne Weiteres löst er den Mechanismus aus. Die Klinge schneidet mit einer solchen Geschwindigkeit, dass nicht ein Tropfen Blut vergossen wird. Der Kopf der Ente bleibt auf ergo liegen. Er scheint nichts gemerkt zu haben. Sieht uns an. Oder denkt Entensachen. Er verharrt einige Sekunden in dieser Stellung und quakt ein paarmal, bis die Augen sich schließen und die Ente damit ihren Streifzug durch die Welt beschließt.
Es gelingt mir nicht, zu sehen, ob Menéndez aufmerksam hin- oder lieber zur Seite schaut, doch auf jeden Fall ist sie es, die den Entenkörper wegnimmt und in ein sauberes Tuch wickelt, bevor sie hinausgeht.
»Schön saftig, bitte«, ruft ihr Ledesma nach.
Wir warten auf eine Erklärung.
»Fassen Sie das als Beispiel auf«, sagt Ledesma.
»Was wollen Sie uns damit sagen? Suchen Sie die lahme Ente unter uns? Gibt es personelle Einschnitte? Werden Köpfe rollen? Wollen Sie das sagen?«
»Nein, Papini«, erwidert Ledesma. »Der Grund für diese Art der Einführung, die Sie, so hoffe ich, als träumerisch und atypisch erlebt haben, liegt in diesen Papieren, die ich Ihnen nun vorlesen werde.
Vor der Guillotine war die Todesstrafe ein öffentliches Spektakel mit fester Besetzung: Henker, Verurteilter und Pöbel. Das unveränderliche Ende schmälerte nicht die kathartische und zugleich didaktische Wirkung der Vorstellung.
Die Erfindung der Guillotine verwandelt die Todesstrafe in bloße Technik. Die Rolle des Henkers schrumpft auf ihren kleinstmöglichen Ausdruck, den Arbeiter, der eine Maschine bedient. Die strenge Funktionalität der neuen Methode lässt für Stil keinen Raum.
Trotzdem weigern sich die Henker, ihre charakteristische rituelle Geste aufzugeben: den Kopf des Enthaupteten nach Vollendung ihrer Aufgabe in die Höhe zu recken, um ihn dem Pöbel vorzuführen.
a) Der Henker zeigt den Hauptbeweis seiner tadellosen Arbeit vor, nicht etwa aus persönlichem Stolz, sondern aus dem Wunsch nach Anerkennung und Belohnung.
b) Der Pöbel empfindet besondere Hingabe zu einfachen, unmissverständlichen Aussagen. Der Kopf ist ein Schlusspunkt, der alle zufrieden zurücklässt. Der Henker als Aphoristiker.
Die möglichen Erklärungen der Handlung scheinen sich in »a« und »b« zu erschöpfen. Aber der Henker kennt das Alphabet des Todes von Anfang bis Ende. Nach »c« und fürderhin gibt es intimere Gründe, die auch einen Gefallen oder eine Konzession gegenüber dem Verurteilten miteinschließen. Darin liegt die heimliche Rebellion des Henkers.
Ein für diejenigen, die dieses Amt nicht ausüben, unbekannter Umstand ist, dass der vom Rumpf getrennte Kopf für neun Sekunden bei Bewusstsein und im Vollbesitz seiner Kräfte bleibt.
Wenn er den Kopf in die Höhe reckt, schenkt der Henker seinem Opfer einen letzten, erlöschenden Blick auf die Welt. Damit widerspricht er nicht nur der Idee der Strafe selbst, sondern er verwandelt auch das Publikum in das eigentliche Spektakel.
Damit der Enthauptete bei Sinnen bleibt, muss eine Reihe von Regeln erfüllt werden.
a) Die Verurteilten müssen im Augenblick ihrer Enthauptung wach sein. Die Erfüllung von »a« steht in unmittelbarer proportionaler Abhängigkeit vom Mut der Verurteilten.
b) Sie müssen der Schneide des Messers beziehungsweise dem Himmel entgegenblicken. Das ist keineMetapher für eine Wiederbegegnung mit dem Glauben, sondern eine rein praktische Bestimmung. Diejenigen, die das Messer im Nacken trifft, werden durch den Schlag ohnmächtig.
c) Die Schnittposition. Bei Männern unterhalb des Adamsapfels. Bei Frauen auf Höhe des Rosenkranzabdrucks. Schräge Schnitte sind zu vermeiden.
d) Ein aufgeheiztes Publikum, das die Sinne des zu Enthauptenden anregt, ist zu bevorzugen.
Diese und andere Regeln von subtilerer Natur (bei einer Frau ist der Blick von der Menschenmenge weg auszurichten) werden von den Henkern an die eigenen Kinder weitergegeben, als eine Art Unterweisung in ihrer künftigen Tätigkeit. Das Geheimnis vereint sie in liebevoller Komplizenschaft und bleibt von Generation zu Generation bestehen wie der schwarze Habit.«
Die Ente und das Vorlesen bringen uns zum Verstummen. Ledesma erklärt, dass es sich um eine Studie aus Frankreich handele, verfasst von einem herausragenden Gerichtsmediziner, die Übersetzung ins Spanische gehe auf eine englische, von Mr. Allomby höchstpersönlich hergestellte Übertragung des französischen Originals zurück.
Menéndez händigt jedem von uns eine maschinengeschriebene Kopie aus, am Rand ist jeweils der Name vermerkt. Mein Nachname ist falsch geschrieben: Qintana, ohne u.
»Ich gebe zu«, fügt Ledesma an, »dass ich die Studie, als ich sie in die Hände bekam, ohne besondere Lust gelesen habe. Mr. Allomby hatte sie mir gezeigt, um zu erfahren, ob sich Ihre Hypothese mit wissenschaftlichen Methoden beweisen lasse.«
»Welche Hypothese?«, fragt Gurian. »Die neun Sekunden bei Bewusstsein? Das, was der Kopf noch wahrnimmt? Welche Hypothese?«
»Ersteres ist sehr leicht zu überprüfen. Da haben Sie ja unsere Ente. Natürlich ging es mir um Letzteres. Konkret gesagt: Mr. Allomby hat mich um einen Gefallen gebeten, und dem konnte ich mich nicht entziehen, auch wenn die Skepsis bei mir überwog. Ich habe ein ganzes Jahr an der Sache gearbeitet. Und sehen Sie, meine Herren, welch angenehme Überraschung, ich habe herausgefunden, dass sich die Hypothese tatsächlich belegen lässt.«
Irgendein Kriecher fragt, auf welche Weise.
»Bevor wir dazu kommen, möchte ich, dass Sie Ihre Zweifel vortragen. Von links nach rechts bitte.«
»Es fehlt an Referenzdaten. Worauf gründet der Franzose das, was er behauptet?«, fragt Gigena.
»Der betreffende Doktor ist eine Eminenz der europäischen Gerichtsmedizin.«
»Schön für ihn«, erwidert Gigena.