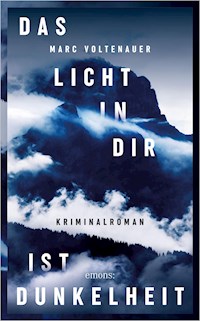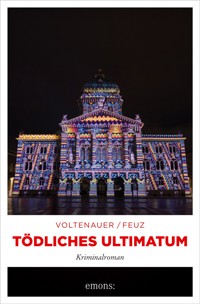Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Andreas Auer
- Sprache: Deutsch
Andreas Auer ermittelt in seinem Heimatland Schweden – Fesselnd, rasant und hochspannend! Ein erschütterndes Familiengeheimnis bringt Andreas Auers Welt ins Wanken. Auf den Spuren seiner Vergangenheit reist er von Gryon nach Gotland, wo er aufgewachsen ist, und landet in einem Alptraum: Bei seinen Recherchen stößt er auf den ungeklärten Fall einer sechsköpfigen Familie, die in den siebziger Jahren brutal ermordet wurde. Die Inszenierung der Tat deutet auf ein altes Wikingerritual hin. Andreas setzt alles daran herauszufinden, wer die bestialischen Morde begangen hat – bevor der Täter zurückkehrt, um sein Werk zu vollenden. Denn ein Kind der Familie hat überlebt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 680
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Beliebtheit
Ähnliche
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind mit wenigen Ausnahmen, die in der Danksagung erläutert werden, frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Da in Schweden seit der Du-Reform in den sechziger Jahren das Du als Anredeform (mit Ausnahme des Königshauses) allgegenwärtig ist, wird im vorliegenden Text auf das den deutschen Gepflogenheiten entsprechende Siezen verzichtet.
Die Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel »L’Aigle de sang« bei Slatkine & Cie.
© 2024 Marc Voltenauer
© 2019 Slatkine & Cie
© der deutschsprachigen Ausgabe: Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: mauritius images/Santiago vidal vallejo/Alamy/Alamy Stock Photos
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-138-6
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß §44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Meinem Vater Dieter gewidmet,
PROLOG
Andreas streckte die Hand aus und strich mit den Fingerspitzen über jeden einzelnen Buchstaben, der für die Ewigkeit in den Granit gemeißelt worden war. Er schloss die Augen und öffnete sie dann wieder, als müsse er sich der Realität dieses Augenblicks vergewissern. Eine Träne war seine Wange hinuntergelaufen, am Rand seiner Oberlippe abgeperlt und in seinen Mund geflossen. Sie schmeckte bitter. Andreas starrte auf die Grabinschrift:
Viel zu früh gegangen …
Das alles schien so unwirklich.
Erinnerungen tauchten auf und zogen wie Bilder in einer Diaschau vorbei. Er meinte, das leise, trockene Klackern zu hören, mit dem sie im Kodak-Diaprojektor, den sein Vater an langen Winterabenden hervorholte, weitertransportiert wurden. Die Mechanik des Projektors schob ein Dia hinter das Objektiv, und das Magazin glitt weiter vor. Schnappschüsse in kontrastreichen, satten Farben. Schklick.
Jessica und er im apfelgrünen Plastiksandkasten im Garten des Hauses auf der Insel Gotland. Schklick. Er mit dem Ranzen auf dem Rücken und einer riesigen orangefarbenen, mit einer lila Schleife verzierten und mit Süßigkeiten gefüllten Schultüte im Arm, die er von seinen Eltern zu seinem ersten Schultag bekommen hat. Schklick. In Fußballerpose mit aufgeschürften Knien, im roten Trikot mit der Nummer neun. Schklick. Triumphierend grinsend mit seinem ersten Moped, einer blauschwarzen Piaggio Ciao mit verchromtem Auspuff, an seinem vierzehnten Geburtstag. Schklick. In dunklem Anzug bei seiner Vereidigung, innerlich jubilierend, umringt von seinen Kameraden. Schklick. Mikaël und er beim ersten Kuss. Schklick.
Ein Wendepunkt in seinem Leben. Seine Schwester Jessica, eingesperrt in einem schaurigen Keller. Schklick. Ein kantiges Gesicht, der rasierte Schädel, stechende eisblaue Augen. Der Mann, der Mikaël eine Kugel in den Kopf schießt. Schklick. Er mit einer Waffe in der Hand vor dem auf dem Boden des Chalets liegenden Individuum. Schklick. Mikaël auf der Intensivstation, durch Schläuche mit einer Maschine verbunden. Schklick. Er, von seiner Vorgesetzten suspendiert, allein zu Hause, Whisky trinkend. Schklick. Jessica, in Tränen aufgelöst auf dem Weihnachtsmarkt, und er, von den Enthüllungen, die sein Leben verändert haben, erschüttert. Schklick. Das Krankenhauszimmer, das EKG, das aus dem Ruder läuft, die Ärzte, die Mikaël mitnehmen. Schklick! Schklick! Schklick.
1
Ostsee
Mittwoch, 4. Oktober 1944
Der Mann saß an die Reling gelehnt auf dem Boden eines wackeligen Holzbootes, das von den Wellen hin und her geworfen wurde. Unter den gut dreißig weiteren Personen an Bord befand sich auch sein Freund Roopi mit seiner Frau und ihrem Baby. Trotz des rauen Seegangs hatten am Vortag mehrere Boote die Insel Saaremaa verlassen. Die Zeit drängte. Am 22. September hatte die Rote Armee Tallinn eingenommen und setzte seitdem die Rückeroberung Estlands fort. Am Tag zuvor erst hatten die Russen Hiiumaa in Besitz genommen, daher würde es sicherlich nicht lange dauern, bis sie auch die Nachbarinsel Saaremaa erobern würden.
Als sie gegen achtzehn Uhr abgelegt hatten, hatte eine alte Frau die Hände gefaltet und inbrünstig »Jumal meiega!« – »Gott sei mit uns!« – ausgerufen. Der Kapitän, ein estnischer Fischer, besaß lediglich eine einfache Seekarte und einen Kompass, um sie durch die schwarze Nacht zu navigieren. Unheilvolle Wolken ließen den Mond und den Sternenhimmel hinter einem undurchsichtigen Vorhang verschwinden.
Der Mann hatte sich warm angezogen, doch seine Kleidung war durch die Wellen, die sich an dem Boot brachen, durchnässt. Seine Muskeln zogen sich zusammen, und seine Glieder wurden durch die Kälte ganz steif. Die Frauen und Kinder hatte man notdürftig in Militärdecken gewickelt. Niemand hatte eine Rettungsweste.
Plötzlich vernahmen sie das dumpfe Geräusch von Propellern. Der Kapitän schaltete den Außenbordmotor aus. Auf jeder Seite des Kahns begannen zwei Leute zu rudern. Der Mann hatte sich freiwillig gemeldet. Die Lichter am Himmel ließen zwei Kampfflugzeuge vermuten. Flugzeuge des Typs Iljuschin II-2 »Schturmowik«, die auch »Schwarzer Tod« genannt wurden. Alle hielten den Atem an. Auf einmal waren das schrille Geräusch eines Sturzfluges und eine Maschinengewehrsalve zu hören. Geschrei gellte durch die Dunkelheit. Eine weitere Salve, eine Explosion in der Nähe, Schreie und dann wieder Totenstille.
Nach mehreren Angriffen drehten die Flugzeuge ab, und es wurde wieder ruhig. Der Mann wusste nicht, wie viele Boote gesunken waren und wie viele Menschen ihr Leben verloren hatten. Der Kapitän entschied, noch eine Zeit lang ohne Motor weiterzufahren, und befahl, die Ruder wieder aufzunehmen. Das aufgewühlte Meer gönnte ihnen keine Atempause. Schließlich gab der Mann das Ruder ab und nickte erschöpft zwischen zwei anderen Passagieren hockend ein.
Eine riesige Welle riss ihn aus seinem Dämmerschlaf. Sie brach sich über dem Schiffsrumpf und überflutete das Boot. Die Menschen schrien, das Boot drohte zu kentern. Hektisch begannen sie das Wasser herauszuschöpfen. Die schmerzenden Glieder des Mannes behinderten seine Bewegungen. Eine zweite Sturzwelle würden sie nicht überstehen, aber das Meer verschonte sie. Es gelang ihnen, das Wasser aus dem Inneren des Bootes zu entfernen, doch sie waren bis auf die Knochen durchnässt und starr vor Kälte. So kurz vor dem Ziel aufzugeben kam nicht in Frage. Der Kapitän entschied, den Motor wieder anzulassen.
In den frühen Morgenstunden fielen die ersten zarten Sonnenstrahlen auf das Gesicht des Mannes. Die See war wieder ruhig, aber der Motor hatte seinen Geist aufgegeben. Die Ruderer wechselten sich ab und legten sich in die Riemen. Ein paar Stunden später erblickte der Mann am Himmel Rauch, der aus einem Schornstein quoll. Die Küste der Insel Gotland war in Sicht. Bevor das Boot anlegte, zog er den Ring vom linken Ringfinger und warf ihn über Bord.
2
Barshalder, Gotland
Donnerstag, 21. Dezember 1978
In der längsten Nacht des Jahres stand Jarl Dvalin, Anführer des Clans Freyjas Kinder, aufrecht und regungslos inmitten einer Steinformation, die seine Vorfahren in der Bronzezeit kunstvoll angeordnet hatten, um die Form eines Wikingerschiffs nachzuahmen. Die Schiffssetzung befand sich auf einer ruhigen Lichtung inmitten des Waldes von Barshalder auf der Insel Gotland. Der Mann, den man dort vor fast dreitausend Jahren bestattet hatte, war mit Hilfe des steinernen Drakkars höchstwahrscheinlich nach Helheim gelangt, eine der neun Welten der nordischen Mythologie, in der die Toten in einem eisigen und undurchdringlichen Nebel leben.
Der Jarl stellte sich den brennenden Scheiterhaufen vor, den verkohlten Leichnam, die gesäuberten und zermahlenen Knochen und die Urne aus gebranntem Ton, die in der Mitte des schiffsförmigen Steinkreises vergraben worden war. Er spürte, welch einzigartige Energie dieser von den Wikingern geschaffene Ort verströmte. Schnee bedeckte den Boden. Die Clanmitglieder hatten die Steine für die Zeremonie freigeschaufelt. Schweigend betrachtete Jarl Dvalin die Szenerie. Um die gesamte Schiffssetzung brannten Fackeln aus mit Wachs getränktem Tuch. Die innen blau und außen orangerot züngelnden Flammen knisterten im eisigen Wind. Für den Vorsitz des Julfests hatte Jarl Dvalin sein Prunkgewand angezogen. Er trug einen geschwärzten Eisenhelm mit einer silbernen, fein ziselierten, kreuzförmigen Verstärkung auf der abgerundeten Kalotte, an der eine schulterlange Kettenbrünne zum Schutz von Nacken, Hals und der unteren Gesichtspartie angebracht war. Das eherne brillenförmige Visier, das an den Helm genietet war, verlieh ihm ein wölfisches Antlitz, denn es bedeckte Gesicht und Nase, betonte dadurch aber seine verschiedenfarbigen Augen – eines strahlend azurblau und eines grün, in der Farbe der aufgewühlten See, wenn die Algen an die Wasseroberfläche treiben. Die Schultern des Jarls waren von einem Valshamr genannten Umhang aus Falkenfedern bedeckt. Darunter trug er eine weiße Tunika, die mit aus Goldfäden gewebten Borten verziert war. Seinen Hals schmückte eine Kette mit einem silbernen Anhänger, in den eine Kugel aus kristallblauem Cordierit eingearbeitet war.
Um den Jarl herum standen zwölf ähnlich gekleidete Gestalten. Sie trugen schwarze, am Halsausschnitt mit bestickten Borten verzierte Baumwollhemden. Die gerade geschnittenen Ärmel reichten bis zu den weiten braunen Pluderhosen, die unter den Knien mit Bändern eng um die Waden geschnürt worden waren. Die aus Messing gearbeiteten Schnallen ihrer Ledergürtel hatten die Form der Weltenesche Yggdrasil, des immergrünen Baums, mit dem die neun Welten verbunden sind. Auf ihren Brüsten prangte wie ein fremder Buchstabe der Runenname der Göttin Freyja, das Fehu, das Reichtum, Fruchtbarkeit und Überfluss, aber auch Feuer, Stärke und Macht symbolisiert. Daneben befand sich jeweils eine zweite Rune, die für den Anfangsbuchstaben ihres Wikingervornamens stand. Als unverwechselbares Zeichen ihres Clans schmückten ihre Hälse die gleichen Kettenanhänger, die auch der Jarl trug. Um sich vor der Kälte zu schützen, trugen sie purpurfarbene, mit Schafspelz besetzte Umhänge, die an den Schultern durch ringförmige Eisenspangen in Form des Omegas geschlossen wurden. Ihre Helme glichen dem ihres Anführers, lediglich die Visiere unterschieden sich. Während das des Jarls bronzefarben war, waren ihre versilbert.
Jarl Dvalin erhob den Gandr, einen Runenstab. Sein gebieterischer Ton durchbrach die Stille: »Wir sind heute hier zusammengekommen, um die Wintersonnenwende mit dem Julfest zu begehen und der Göttin Freyja unsere Opfergaben darzubringen.« Dann sprach er ein Gebet:
Freyja, Göttin der Leidenschaft, verbünde dich mit uns.
Freyja, Mutter der Natur, verbünde dich mit uns.
Freyja, deine Kinder rufen dich an!
Komm zu uns in diesem Augenblick.
Die dreizehn Mitglieder des Clans wiederholten die Bitte mehrere Male unisono in Form einer Litanei:
Freyja, komm zu uns!
Freyja, komm zu uns!
Freyja, komm zu uns …
Der Jarl ging zu einem Stein, der ihnen als Altar diente, und packte mit beiden Händen einen großen Bronzehammer mit kurzem Griff.
»Der Mjölnir ist die mächtigste Waffe der Götter«, psalmodierte er. »Der Thorhammer beschützt das Universum gegen die Mächte des Chaos.«
Er führte ihn an seine Stirn und sprach feierlich: »Odin!«
Er drückte ihn gegen seine Brust und rief: »Baldur!«
Dann berührte er seine linke Schulter damit. »Freyja!«
Und schließlich seine rechte Schulter. »Thor!«
Anschließend streckte er seine Arme aus. »Der Thorhammer ist geweiht!«
Goði Berling trat näher, hob seine Arme gen Himmel. »O flammende Freyja, wir danken dir für dein Licht auf unserem Weg.«
Unisono sprachen die dreizehn Mitglieder: »Freyja, wir danken dir!«
Goði Alfrigg nahm eine Öllampe, schwenkte sie und rief: »O ihr Götter, seht das brennende Feuer, die heilige rote Flamme, die uns auf unserem Weg leitet.«
Dann schritt er mit der Lampe am ausgestreckten Arm dreimal den Kreis ab, an allen Gestalten vorbei, die im Chor wiederholten: »Rein ist sein Leuchten. Gegen die Dunkelheit.«
Jarl Dvalin ergriff erneut das Wort: »Wir, Freyjas Kinder, bieten nunmehr unsere Opfergaben dar. Freyja, unser aller Mutter, wir bringen dir diese Geschenke und erbitten Wohlstand für uns.«
Sie nahmen die mitgebrachten Gaben und legten sie auf den Stein in der Mitte. Stoffbänder wurden an die Bäume gebunden, und der Rest, vor allem das Fleisch, wurde in den dafür vorbereiteten Löchern vergraben.
Anschließend stellten sich die Clanmitglieder wieder auf ihre Plätze, und der Jarl fuhr fort: »Die Opfergabe ist geweiht!
Goði Alfrigg kam mit einem Lamm zurück, das man, vor den Blicken geschützt, an einen Baumstamm in der Nähe angebunden hatte. Er hatte Mühe, das widerspenstige blökende Tier hinter sich herzuziehen. Goði Berling eilte ihm zur Hilfe, um die Beine des Tiers zusammenzubinden und es auf den Stein zu hieven. Das Schaf stieß gellende Schreie aus.
Jarl Dvalin stimmte eine eingängige altnordische Melodie an. Goði Berling nahm eine Hippe und schnitt dem Schaf mit der scharfen Klinge die Kehle durch. Goði Alfrigg hielt eine Schale unter den Hals des Tieres, die sich schnell mit Blut füllte. Er stellte sie auf den Stein. Das Blut floss weiter und färbte den Schnee dunkelrot.
Der Kadaver des Lamms wurde etwas abseits auf einen Scheiterhaufen gelegt, den der Jarl mit Hilfe einer Fackel anzündete. Riesige Flammen schlugen empor. Innerhalb von wenigen Sekunden roch es nach verkohltem Fleisch und brennendem Fett. Während das Tier verbrannt wurde, ließ der Jarl weiter seinen einlullenden Singsang ertönen.
Lögsögumaður Grer stimmte mit ein, während Goði Alfrigg den Takt auf einer mit Hirschhaut bespannten Trommel schlug. Begleitet wurden sie vom vollen Klang einer Jouhikko, einer dreiseitigen Leier, die mit einem Bogen gestrichen wurde, einem Nebelhorn und einer Hardangerfidel.
Als das Feuer niedergebrannt war, schnitt Goði Alfrigg mit einem Messer ein Stück Fleisch ab und teilte es in kleine Bissen.
Jarl Dvalin hob die Schale gen Himmel und sprach: »Freyja, wir weihen dir diese Opfergabe. Schenke du uns heute und für alle Tage Wohlstand. Freyjas Kinder, ich erhebe dieses Horn zu Ehren der Götter. Horn des Odin, wir danken dir für unsere Vergangenheit und unsere Vorfahren. Horn des Thor, wir danken dir für unsere Gegenwart und für uns, die wir uns hier versammelt haben. Horn der Freyja, wir danken dir für die Zukunft und unsere Nachkommen. Indem wir uns dieses Blut einverleiben, ehren wir all jene, die waren, die sind und die sein werden.«
Goði Berling nahm die Schale und füllte das mit Greifvogel- und Schlangenmotiven gravierte Widderhorn des Jarls. Dann goss er in die Hörner jedes Mitglieds etwas Blut. Der Jarl erhob seines über seinen Kopf, und die anderen taten es ihm gleich. Er atmete tief ein, hob die Brünne an, führte das Horn an seine Lippen und trank einen Schluck. Ein metallischer Geschmack breitete sich in seinem Mund aus. Er schluckte die zähflüssige Flüssigkeit hinunter.
Der Jarl stellte sein Horn ab, nahm die Fleischplatte mit beiden Händen und hob sie zum Himmel empor. »Wir nehmen das geweihte Fleisch zu uns, um unsere Gemeinschaft und unsere Vereinigung mit den Göttern zu besiegeln.«
Er reichte Goði Alfrigg die nach verkohltem Fleisch stinkende Platte, der jedem ein Stück austeilte. Der Jarl hob das Fleischstück gen Himmel, und die anderen taten es ihm nach. Dann aßen sie den Fleischbissen.
Anschließend ergriff der Jarl die erneut mit Blut aufgefüllte Schale, brach einen kleinen Birkenzweig ab, tauchte ihn in die leuchtend rote Flüssigkeit und besprengte damit ein Clanmitglied nach dem anderen. Bevor er die Zeremonie beendete, sprach er ein weiteres Mal das Segensgebet für Freyja.
3
Samstag, 25. Juni
Bedrohliche Wolkenberge verdunkelten den Himmel, Greifvögel flogen schrille Rufe ausstoßend über das einsam gelegene Haus hinweg. Andreas konnte nicht erkennen, ob er selbst einer der schwarzen Vögel war, die durch das dunkle Gewölbe schossen, oder ob er lediglich ein in der Luft schwebender Zuschauer war. Plötzlich, von einem lang anhaltenden und unergründlichen Sog erfasst, befand er sich in einem der Zimmer des Hauses. Er hörte, wie sein Herz klopfte. Der Raum schien leer, gleichzeitig spürte er eine Präsenz und meinte, langsame und tiefe Atemzüge zu hören. Eine Art weit entferntes Summen drang an seine Ohren. Mehr oder weniger kontinuierliche gedämpfte und pulsierende Töne. Ein Blitz erhellte das Zimmer, gefolgt von einem ohrenbetäubenden Donnerhall. Geblendet nahm Andreas zunächst ein Bett, dann eine Kommode, eine Nachttischlampe und einen Bilderrahmen mit einem Foto darin wahr, auf dem ein hellblondes Mädchen mit Pferdeschwanz mit einem Kreisel spielte.
Dann wurde das Zimmer wieder dunkel, doch seine Augen gewöhnten sich allmählich an das fehlende Licht. Vor ihm tauchten unheimliche Gestalten auf, von denen er lediglich die Umrisse erkannte. Sein Herzschlag beschleunigte sich. Er drehte sich um, stolperte und fiel bäuchlings in eine klebrige rötlich braune Pfütze. Als er sich erhob, sah er zwei riesige, mit ausgebreiteten Schwingen auf dem Bett liegende Vögel. Er konnte sie deutlich erkennen, denn sie waren weiß wie Schnee. Er beobachtete, wie sie mit den Flügeln schlugen, ohne davonfliegen zu können. Das Geräusch ihrer flatternden Schwingen wurde leiser und erstarb schließlich. Ein weiterer Blitz erhellte für den Bruchteil einer Sekunde erneut die Szenerie. Die beiden weißen Adler badeten in einer riesigen Blutlache. Andreas bemerkte, dass ihre Flügel viel zu kurz waren, um damit fliegen zu können. Ein merkwürdiges Detail erregte seine Aufmerksamkeit: Die Vögel hatten keine Schnäbel, sondern menschliche Gesichter. Das eine war verschwommen und nicht zu erkennen. Das andere konnte er trotz des tiefen Lochs in der Stirn identifizieren.
Schweißgebadet wachte Andreas auf. Er brauchte einen Moment, um zu verstehen, dass er sich zu Hause in seinem Schlafzimmer in Gryon befand. Der Wecker zeigte vier Uhr dreißig an. Er fühlte sich, als sei er die ganze Zeit wach gewesen und als hätte sein Gehirn ununterbrochen beunruhigende, angsteinflößende Bilder abgespult. Seinem Psychoanalytiker zufolge waren die Träume eventuell die Folge einer posttraumatischen Belastungsstörung. In den letzten Jahren hatte er eine Reihe bedrückender und schmerzhafter Ereignisse erlebt, die seine Alpträume befeuerten. Häufig ahnte er, woher sie rührten, doch dieser gerade durchlebte Traum blieb rätselhaft. Er kehrte in regelmäßigen Abständen zurück. Manchmal unterschied er sich in Details, oder es kamen neue Elemente hinzu. Mal handelte es sich bei den Vögeln um weiße Adler, mal um finstere schwarze Raben. Heute Nacht hatten die Vögel zum ersten Mal menschliche Gesichter gehabt. Eines von ihnen glich dem von Mikaël.
Im Laufe der Zeit hatte Andreas den Eindruck gewonnen, dass sein Traum nicht nur Symbolcharakter hatte, sondern dass er ein sehr reales Ereignis widerspiegelte. Sein Unterbewusstsein versuchte zweifellos nicht nur irgendwelche Wahnbilder, sondern vielmehr eine greifbare Erinnerung an die Oberfläche zurückzuholen. Seit ihm Jessica ihr Geheimnis verraten hatte, war er sich dessen noch sicherer.
Andreas ging unter die Dusche und stellte die Mischbatterie auf kalt. Das eisige Wasser hatte eine stimulierende Wirkung. Er spürte, wie das Blut unter der Haut in Wallung kam. Die Müdigkeit und die nächtliche Anspannung perlten mit dem Wasser von ihm ab. Er schloss die Augen, legte den Kopf in den Nacken und ließ den Wasserstrahl über sein Gesicht laufen. Seine Gedanken wanderten drei Jahre zurück. Er hatte den Eindruck, all die Momente dieses Tages, die sich tief in ihn eingebrannt hatten, erneut zu erleben. Es war Freitag, der 5. April gewesen. Er sah alles wie in einem Film.
Atemlos rennt er die Flure auf der Intensivstation bis zu Mikaëls Zimmer entlang. Er erblickt Luca, den Arzt. Er kennt ihn, denn er ist der Liebhaber von Karine, seiner Kollegin bei der Kriminalpolizei. Mikaëls Eltern, Jocelyne und Jean, sind bereits da. Ihre Gegenwart überrascht ihn. Er nickt ihnen zur Begrüßung zu. Ihre Blicke sind eisig. Er geht zu seinem Lebensgefährten, der mit immer noch geschlossenen Augen, den Körper mit Schläuchen verbunden, auf dem Bett liegt. Der Monitor zeigt einen regelmäßigen Herzrhythmus an. Am Telefon hatte Luca ihm von einer Komplikation berichtet. Luca führt ihn in einen leeren Raum, den er mit seiner Schlüsselkarte öffnet.
»Andreas, ich will dir nichts vormachen. Mikaël befindet sich in einem kritischen Zustand. Es bildet sich ein neues Ödem, das den intrakraniellen Druck erhöht. Wenn wir nichts unternehmen, steigt das Risiko einer zerebralen Herniation beträchtlich.«
»Und das heißt?«
»Er könnte sterben …«
»Welche Möglichkeiten gibt es?«
»Gar keine. Mikaëls Eltern lehnen eine Operation ab. Mikaël und du, ihr habt keine eingetragene Partnerschaft. Daher steht den Eltern das Recht der Entscheidung zu. Es sei denn, ihr hättet eine Patientenverfügung aufgesetzt.«
»Mikaël hatte sich erst kürzlich mit der Frage beschäftigt und wollte, dass wir darüber reden. Er hatte diesbezüglich mit unserem Arzt gesprochen, aber … ich war so beschäftigt, dass wir die Dokumente noch nicht unterschrieben haben.« Seine Welt bricht zusammen. »Ich werde mit ihnen reden …«
Er öffnet die Tür, aber Luca hielt ihn am Arm zurück. »Warte. Es gibt zwei Möglichkeiten: Entweder legen wir eine Drainage, um die Zerebrospinalflüssigkeit nach außen abzuleiten, und hoffen, dass der Druck dadurch ausreichend sinkt, oder wir öffnen operativ einen Teil der Schädeldecke, um den Druck abzubauen. Ein chirurgischer Eingriff stellt in seinem Zustand ein enormes Risiko dar, wäre aber sicherlich die effektivere Therapie des Ödems.«
»Was ist deine Meinung?«
»Ich denke, dass wir sofort handeln müssen. Andernfalls könnte er gravierende Spätfolgen erleiden.«
Entschlossenen Schrittes eilt Andreas zu Mikaëls Zimmer. Als Jocelyne ihn sieht, ergreift sie das Wort: »Andreas, du weißt, dass wir unseren Sohn lieben.«
»Ich liebe ihn auch! Und ich möchte, dass er gerettet wird, statt ihm beim Sterben zuzuschauen.«
»Es ist deine Schuld, dass er in diesem Zustand ist!«, fährt ihn Jean an.
Andreas ist so wütend, dass er ihm am liebsten mit der Faust ins Gesicht schlagen würde. Doch er beherrscht sich.
»Ich will nicht, dass wir uns bekämpfen. Er ist so oder so verloren … Ich möchte nicht, dass er weiter leidet. Wir sollten ihn gehen lassen. Es ist Gottes Wille!«, sagt Jean.
»Es ist nicht der Gott, an den Mikaël glaubt …«
»Raus! Ich bin sein Vater. Für mich bist du ein Nichts!«
»Hör auf, Jean!«, ruft Jocelyne. »Beruhige dich!«
Während Andreas mit seinem Schwiegervater streitet, bekommt Mikaël plötzlich epileptische Krampfanfälle, und sein Herzrhythmus spielt verrückt. Er hat Herzflimmern. Luca stürzt herbei. »Beiseite, wir müssen ihn sofort operieren!«
4
Burgsvik, Gotland
Freitag, 22. Dezember 1978
Bengt Roslund schwang sich auf seine hellblaue verchromte Monark. Das charakteristische Geräusch des Sachs-Motors hallte in der zu dieser frühen Stunde menschenleeren Straße wider. Es war der Tag nach der Wintersonnenwende. Sobald es die Wetterbedingungen zuließen, würde er vor der Arbeit wieder im Meer schwimmen gehen. Im letzten Jahr hatte er bereits Ende Januar damit begonnen, doch momentan war die Ostsee einfach noch viel zu kalt. Trotz der dünnen Schneedecke erreichte Bengt mühelos seine Werkstatt, die sich hinter seinem Ladenlokal im Herzen des kleinen Ortes Burgsvik befand. Er hoffte, die von ihm entworfene Halskette noch fertig zu bekommen, bevor die Kunden, die in letzter Minute ein Weihnachtsgeschenk suchten, sein Geschäft stürmen würden. In zwei Stunden würde er es öffnen.
Bengt schaltete das Licht und dann seinen Boombox-Radiokassettenrekorder ein, da er bei der Arbeit gerne Musik hörte. Er wählte das vor wenigen Wochen erschienene Live-Album »If You Want Blood You’ve Got It« von AC/DC aus seiner Sammlung aus – ein absolutes Meisterwerk. Auf dem Cover hat sich Angus Young seine Gitarre in den Bauch gerammt, und Blut fließt aus seinem Unterleib. Die frenetische Kraft der australischen Band half ihm, sich auf seine Kreationen zu konzentrieren. Bengt öffnete seinen Tresor und holte eine Replik der Brisingamen-Kette der Göttin Freyja heraus, die er gerade fertigte. Bevor er sich an seine Werkbank setzte, nahm er die erste Dosis Nikotin des Tages in Form eines speziellen, Snus genannten Tabaks ein, den man sich unter die Oberlippe schob.
Vor einigen Monaten hatte Bengt das Geschäft übernommen. Sein Vater hatte wegen seiner fortschreitenden Multiple-Sklerose-Erkrankung aufhören müssen. Mit sechsundzwanzig Jahren wohnte Bengt immer noch bei seinen Eltern und seiner Schwester, war aber gerade dabei, in eine Wohnung über dem Ladenlokal umzuziehen. In ein paar Wochen würde er endlich unabhängig sein.
Bengts Reproduktionen von Schmuck aus der Wikingerzeit waren in der ganzen Region bekannt. Schon seit Langem hegte er die Idee, das nordische Heidentum wiederauferstehen zu lassen. Das Zeitalter, in dem Mystizismus, Traumwelten und heilige Rituale verschmolzen, faszinierte ihn. Er hatte seine Jugendfreundin Svea, die Religionsgeschichte mit Schwerpunkt auf den nordischen Glaubenslehren studiert hatte, mit seiner Begeisterung angesteckt. Allerdings hatte sie ihr Studium in Stockholm abgebrochen. Nachdem sie überstürzt und unerwartet nach Gotland zurückgekehrt war, hatten sie endlich ihren Traum verwirklichen können. Der Clan, den sie gegründet hatten, hieß Freyjas Kinder, zu Ehren ihrer Lieblingsgöttin.
Zusammen mit seiner Freundin Johanna und David, einem Freund von Svea, hatten sie rasch das Gründungsteam ihres Clans gebildet. Anfangs hatten sie sich mehrfach getroffen, um über die Zeremonien, die sie begehen, die Riten, die sie praktizieren, und die Götter, die sie ehren wollten, zu sprechen. Sie hatten sogar über die Orte, an denen sie sich treffen würden, und über die Handhabung der Organisation diskutiert. Sie hatten sich ein wenig an einer neu gegründeten neoheidnischen Religionsgemeinschaft aus Island, aber auch an alten Schriften orientiert und hatten für ihre Struktur einige der sozialen Statuten der Wikinger übernommen. Dabei hatte das Quartett die höchsten Ämter unter sich aufgeteilt: das Amt des Jarls – des Anführers des Clans – sowie die Ämter der beiden Goði genannten Priester, die für die sakralen Rituale zuständig waren. Außerdem wurde das Amt des Lögsögumaðurs vergeben, der als Gesetzessprecher fungierte und Vorsteher auf dem Thing war, der Volksversammlung der freien Männer und Frauen, die Bóndi genannt wurden.
Bengt hatte die Wikingerhelme und den Schmuck gefertigt und sich dabei von einem Helm mit Brillenvisier aus der der Wikingerepoche vorangegangenen Vendelzeit inspirieren lassen, den man bei Ausgrabungen in Valsgärde in der Nähe von Uppsala gefunden hatte. Im Gegensatz zu der Vorlage hatte Bengt im an die Kalotte genieteten Visier nur schmale Schlitze eingearbeitet, um das Gesicht dahinter so gut wie möglich zu verbergen. Außerdem hatte er eine Helmbrünne aus Kettengeflecht am Helm befestigt, die den Hals und die untere Gesichtspartie bedeckte.
Zwar hatten die Wikinger während ihrer Zeremonien nie Helme getragen, aber da die vier ihren Clan als geheime Gesellschaft führen wollten, waren sie übereingekommen, dass sich die Mitglieder untereinander nicht erkennen sollten. Nur ihnen selbst waren die Identitäten der anderen bekannt. Die Aufnahme erfolgte über eine nachträgliche Hinzuwahl auf Vorschlag eines Clanmitglieds. Bengt hatte zwei Personen vorgeschlagen, darunter eine Freundin aus der Schulzeit, die nach ihrer Aufnahme wiederum eine ihrer Cousinen empfohlen hatte. Auf diese Weise waren sie auf dreizehn Mitglieder angewachsen, die Zahl, die Svea vorgeschlagen hatte. Die Dreizehn spielte im Aberglauben eine große Rolle und war eine ungerade Zahl, doch Svea hatte sie vor allem ausgewählt, um das Christentum zu verhöhnen. Schließlich hatten die Christen Freyja als Hexe dargestellt, obwohl sie die Königin der Götter war. Die Geschichte besagt, dass Freyja verbannt worden ist, sich auf einen Berggipfel geflüchtet und dort den Teufel und elf Hexen um sich geschart hat, um gegen die Menschen zu wüten und sie zu verwünschen. Dreizehn bedeutete zwölf Mitglieder, die Zahl der Vollkommenheit, plus der Jarl als ihr Anführer. Gemeinsam würden sie die Göttin Freyja als Herrscherin der Erde rehabilitieren.
Als sie komplett waren, war ein Thing abgehalten worden. Bei dieser Versammlung hatte das Quartett die Organisation und die Struktur des Clans vorgestellt, Gesetze vorgelegt, die die Funktionsweise des Clans regelten, hatte über die Orte für die verschiedenen Aktivitäten des Clans informiert und dargestellt, wie die Rituale begangen werden sollten. Danach hatten sie gemeinsam die Höhe des Mitgliedsbeitrags, den jeder zahlen musste, festgelegt. Die vier Gründer hatten noch einmal betont, wie wichtig es sei, die Anonymität zu respektieren, und welch enormen Stellenwert die aufgestellten Regeln hätten. Eine der wichtigsten Regeln lautete, niemandem etwas von der Existenz ihrer Gruppe zu erzählen.
Nachdem Bengt mit der Fertigung der Halskette gut vorangekommen war, beschloss er eine Pause zu machen. Das Schmuckgeschäft befand sich gegenüber eines Cafés, in dem er Stammgast war. Es war der einzige Ort im Dorf, wo man das ganze Jahr über etwas essen konnte und der als Mischung aus Restaurant, Bar und Bäckerei einen Treffpunkt für die Einheimischen darstellte. Bevor er das Fiket betrat, spuckte er seinen Snus aus, den er immer noch im Mund gehabt hatte. Zum Kaffee bestellte er ein Dammsugare, da er für dieses Gebäck – Rollen aus grün gefärbtem Marzipan, gefüllt mit Kuchenkrümeln, Butter und mit Alkohol getränktem Kakao – eine absolute Schwäche hatte. Weil die Enden der Marzipanrolle mit Schokolade überzogen sind, ähneln sie einem alten Staubsaugermodell aus den 1920er Jahren, was ihren Namen Dammsugare, »Staubsauger«, erklärt.
Der Aufbau des Clans war eine intensive und anstrengende Zeit gewesen, aber er war mit dem Ergebnis zufrieden. Die erste Opferfeier, das Blót, war drei Monate her. Gemeinsam hatten sie zu diesem Anlass eine Mischung aus heidnischen Bräuchen und rituellen Gesängen praktiziert. Jedes Mitglied hatte eine kleine Kugel aus Cordierit bekommen, eingefasst in einen silbernen Kettenanhänger mit Perlmuster, dessen Form an eine fleischfressende Pflanze erinnerte, die ihr Opfer festhält. Bengt hatte nächtelang daran arbeiten müssen, aber der Anblick der Anhänger am Hals der Clanmitglieder hatte ihn mit Stolz erfüllt.
Durch das Opfern eines Lamms war die gestrige Zeremonie noch außergewöhnlicher gewesen als die vorangegangenen. Zuvor hatten sie sich auf Votivgaben, vor allem in Form von Nahrungsmitteln, beschränkt, und er selbst hatte Bernstein und Honig mitgebracht. Allerdings wusste er, dass Blut fließen musste, wenn die Götter noch günstiger gestimmt werden sollten.
Zurück in der Werkstatt schob sich Bengt eine neue Portion Snus in den Mund, setzte sich an die Werkbank und betrachtete aufmerksam das Schmuckstück aus massivem Silber, das er ziseliert hatte. Der Reif verjüngte sich zu den Enden hin, um sich gut um den Hals zu schmiegen. Jetzt musste er nur noch den Bernstein fassen, den er dafür ausgesucht hatte. Während er die Steine bearbeitete und polierte, stieg ihm ein betörender Weihrauchgeruch in die Nase. Durch das Formen der Schmucksteine trat ihre Wärme und ihre Sinnlichkeit zutage. Im Gegensatz zu Dominikanischem Bernstein enthielt Baltischer Bernstein niemals fossile Einschlüsse wie Insekten, die schon seit Millionen von Jahren im Harz gefangen waren. Er war weniger durchscheinend, sondern eher opak, mit einem Farbenspektrum von Cremeweiß, über Gelb- und Karamelltöne bis hin zu Dunkelbraun. Bernstein gehörte zu den Materialien, mit denen Bengt am liebsten arbeitete, denn er empfand ihn als ausdrucksstark und lebendig. Anstatt die Oberfläche komplett glatt zu schleifen, entschied er sich dafür, ein paar natürliche Unebenheiten zu belassen.
Wie die anderen Clanmitglieder trug der Jarl den Kettenanhänger mit der Cordieritkugel, deren Farbe Bengt an Johannas Augen erinnerte. Er liebte seine Freundin über alle Maßen. Ein Jarl verdiente jedoch einen besonderen und andersartigen Schmuck für die Zeremonien. Bengt legte sich den Halsreif an und betrachtete sich zufrieden im Spiegel.
5
Andreas betrachtete sich im Badezimmerspiegel. Was ihm seine Schwester vor ein paar Monaten enthüllt hatte, warf viele Fragen auf. Jetzt musste er noch den fehlenden Teil seiner Vergangenheit finden, um das gesamte Puzzle seiner Biografie lückenlos zusammenzusetzen.
Er ging hinunter in die Küche, wo er schon von Minus und Lillan erwartet wurde. Bevor er sich einen Kaffee machte, füllte er die Näpfe des Bernhardiners und der kleinen schwarzen Katze mit den weißen Pfoten mit Trockenfutter auf. Es war ein bisschen wie bei David gegen Goliath, aber diese beiden Gegner von so unterschiedlicher Kraft und Größe waren einander sehr zugetan. Während Andreas beobachtete, wie sie beide gierig ihr Futter hinunterschlangen, dachte er darüber nach, wie falsch der Ausdruck »wie Hund und Katze sein« war. Er liebte es, die beiden zu beobachten, wie sie miteinander spielten und sich neckten. Minus war zwar viel größer und schwerer, doch Lillan gewann aufgrund ihrer Wendigkeit und ihrer Lebhaftigkeit trotzdem oft die Oberhand.
Andreas hatte sich mit seiner Tasse mit dem Elchmotiv, in der er zwei Löffel löslichen Kaffee in zwei Dritteln heißem Wasser und einem Drittel heißer Milch aufgelöst hatte, auf einen Barhocker in der Küche gesetzt und betrachtete durch das Fenster die Silhouette der imposanten Esche, die in skandinavischen Mythen als Symbol der Unsterblichkeit galt. Als er daran dachte, wie Mikaël mit Minus um die Wette gerannt war, musste er lächeln. Andreas war völlig in seine Innenwelt versunken. Erinnerungen tauchten darin auf und überschlugen sich. Eine Mischung aus Glück und Melancholie kam zeitweise aus der Tiefe seiner Alpträume an die Oberfläche. Seine Erinnerungen stockten. Als guter Polizist hatte er gelernt, sich in die Gedanken der Kriminellen hineinzuversetzen, ihre Persönlichkeit einzuschätzen und ihre Vorgehensweisen zu verstehen. In seinen eigenen Kopf vorzudringen war jedoch eine ganz andere Geschichte.
Andreas hatte sich immer gefragt, wie und warum ein Mensch die berühmte unsichtbare Linie überschreitet, die ihn zum Töten verleitet. Auf die Frage, ob tatsächlich jeder Mensch potenziell in der Lage sei, eine nicht wiedergutzumachende Tat zu begehen, würde er mit Ja antworten. Natürlich durfte man einen Serienmörder, der perfide Verbrechen plante und ausführte, nicht mit einem Menschen gleichsetzen, der jemand anderem unter besonderen Umständen, in einer absoluten emotionalen Ausnahmesituation, das Leben nahm. Vor Gericht wird zwischen Mord und Totschlag unterschieden, doch der Anklagepunkt der vorsätzlichen Tötung ist der gleiche. Während der Erste jemanden mit Vorsatz umbringt, tötet der Zweite im Affekt. Beiden ist jedoch ihr Unrecht bewusst.
Andreas war zum Mörder geworden. Damit würde er bis ans Ende seiner Tage leben müssen. Er hätte damit zufrieden sein können, den Mann, den er vor drei Jahren getötet hatte, einfach festzunehmen. In jenem Moment hatte jedoch sein animalischer Instinkt über seinen Verstand gesiegt. Er bereute seine Tat nicht und war zumindest in den Tiefen seines Gewissens bereit, dafür einzustehen, allerdings war er nicht gewillt, ins Gefängnis zu gehen, und schon gar nicht, seinen Job zu verlieren. Seine Arbeit war sein Leben. Würde ihm die Möglichkeit genommen, Verbrecher zu jagen, verfiele er mit Sicherheit in tiefe Depressionen. Um seinen Posten bei der Kriminalpolizei zu behalten, hatte er seine Kollegen, seine Vorgesetzten und den Staatsanwalt anlügen müssen.
Der Staatsanwalt hatte ein Ermittlungsverfahren gegen ihn eröffnet, was dem normalen Prozedere entsprach, wenn jemand bei einem Polizeieinsatz zu Tode kam. Der Polizeidirektor hatte die Untersuchungskommission, bis die Ergebnisse der strafrechtlichen Ermittlung vorlagen, ausgesetzt. Andreas’ Situation war prekär gewesen. Auf dem Papier hatte er jeden Grund der Welt gehabt, denjenigen zu töten, der auf seinen Lebensgefährten geschossen hatte. Und die Tatsache, dass er allein und ohne behördliche Genehmigung in das Chalet eingedrungen war, um den Verdächtigen festzunehmen, hatte bei seiner Vorgesetzten natürlich Zweifel geweckt, ob er nicht aus persönlichen Gründen gehandelt hatte. Bis zu den Schlussanträgen des Staatsanwalts war Andreas daher vom Dienst suspendiert worden.
Im Laufe der Ermittlungen hatte Andreas eine Reihe von Verstößen gegen die Dienstvorschriften begangen. Er hatte sich schuldig bekannt, erklärt, es sei Gefahr in Verzug gewesen und dass er den Täter habe verhaften wollen, bevor er ihnen für immer durch die Lappen gegangen wäre. Für alles, oder zumindest für fast alles, hatte er eine Erklärung gehabt. Nur eine Frage konnte nicht ausgeräumt werden: Woher hatte er gewusst, dass sich der gesuchte Mörder in dem Chalet versteckte?
Der Staatsanwalt verdächtigte Andreas, sich unerlaubt und gewaltsam Zutritt zu der Immobilienagentur verschafft zu haben, um dort an Informationen zu gelangen. Hätte er dies beweisen können, wäre Andreas unter Anklage gestellt und aus dem Polizeidienst entlassen worden. Sein Kollege Christophe hatte ihm aus der Patsche geholfen, indem er erklärt hatte, die Verbindung zwischen dem Chalet und dem Auftragskiller entdeckt und diese Information an Andreas weitergegeben zu haben. Damit hatte Christophe ein großes Risiko auf sich genommen, doch er schätzte Andreas als seinen Vorgesetzten und wollte ihn als solchen gerne behalten. Wahrscheinlich dachte er insgeheim ebenfalls, dass der Killer den Tod verdient hatte.
Danach war alles nach und nach wieder ins Lot gekommen. Nach einem wochenlangen Ermittlungsverfahren musste der Staatsanwalt, der von Andreas’ Schuld überzeugt war und versucht hatte, ihm vorsätzliche Tötung nachzuweisen, schließlich aus Mangel an Beweisen auf Notwehr plädieren. Es hatte sich einfach keine Verbindung zwischen Andreas und dem Einbruch in die Immobilienagentur herstellen lassen, daher waren die Ermittlungsakten in die Schublade der ungelösten Fälle gewandert.
Übrig geblieben war nur Andreas’ schwerer Fehler, den Kriminellen allein und ohne vorherige Genehmigung des Staatsanwalts aufgesucht zu haben. Der Polizeidirektor hatte Andreas eine Rüge erteilt und ihn für drei Monate ohne Lohnfortzahlung suspendiert. Er hatte sich nicht täuschen lassen und das auch offen gegenüber Andreas geäußert. Er war sich sicher, dass man ihm einen Teil der Wahrheit vorenthielt, vor allem in Bezug darauf, wie der flüchtige Täter hatte gefunden werden können. Allerdings zog der Polizeidirektor es vor, so zu tun, als glaube er der Lügengeschichte, die Andreas und Christophe ihm aufgetischt hatten, anstatt sich an einem medienwirksamen Rufmord zu beteiligen und einen Skandal in den eigenen Reihen zu befeuern.
6
Fide, Gotland
Sonntag, 31. Dezember 1978
Jacob tätschelte seiner Lieblingskuh Maja liebevoll den Rücken. Bis auf ein paar weiße Flecken an den Beinen war das Tier völlig schwarz. Inzwischen waren beinah zehn Jahre vergangen, seit sie hier auf dem Bauernhof zur Welt gekommen war. Eben hatte er den Schafen, die den Winter draußen verbrachten, Heu gebracht. Anschließend hatte er die Hühner und zwei Schweine gefüttert. Während er mit Maja sprach, setzte er sich auf seinen Melkschemel und säuberte ihre Zitzen.
Beim Melken dachte er über das letzte Treffen des Clans nach. Die Idee, Teil dieser Gruppe zu werden, die überlieferte heidnische Glaubenstraditionen wieder aufleben ließen, indem sie den Göttern von Asgard huldigten, hatte ihn zunächst sehr interessiert. Er war ein Geschichtsfanatiker, und in den langen Winternächten las er viel. Ganz besonders begeisterte er sich für die Geschichte seiner Insel Gotland, die von der Wikingerkultur und dem Glauben an die heidnische Götterwelt geprägt war. Die christliche Religion langweilte ihn dagegen, ihm fehlte die mystische Dimension, und es fiel ihm schwer, die dunkle Vergangenheit, vor allem die erzwungene Assimilation vieler Völker, zu akzeptieren. Auch die Skandinavier waren nicht davon verschont geblieben. Natürlich hatten die Wikinger die Welt mit dem Ziel durchstreift, Dörfer zu plündern und Sklaven mit nach Hause zu bringen, doch zumindest waren sie nicht so scheinheilig wie die Christen, die sich auf eine transzendentale Mission beriefen. Und natürlich waren es die christlichen Mönche gewesen, die überall das negative Image der Wikinger, die in erster Linie Händler und exzellente Seefahrer gewesen waren, verbreitet hatten. Jacob war davon überzeugt, dass die Kirche wie ein Krebsgeschwür für sein Land gewesen war: Zu Beginn hatten sich die Schweden anderen Gottheiten und Glaubensrichtungen gegenüber offen gezeigt, aber dann war alles aus dem Ruder gelaufen. Der Bürgerkrieg war an dem Tag ausgebrochen, als einige der großen Anführer der Clans zum Christentum übergetreten waren, weil sie darin eine Chance sahen, ihre Macht auszubauen. Die alten Traditionen waren ausgelöscht und die heidnischen Götter gewaltsam verbannt worden. All jene, die den alleinigen Gott nicht anerkannten, waren vertrieben oder misshandelt worden. Hände wurden abgehackt, Augen ausgestochen. Einige wurden erhängt, andere geköpft. Eine Opposition formierte sich: Man zündete Kirchen an und tötete die Priester … Jacob kannte das alles auswendig.
»Hier byrias lagh guta oc segia so at fyrstum þitta ir fyrst upphaf i lagum orum þet wir sculum naicca haiþnu oc iatta crisnu. Oc troa allir aann guþ alzvaldanda«, rezitierte Jacob laut die ersten Zeilen des zu Beginn des 13. Jahrhunderts erlassenen gotländischen Gesetzes. »Wir müssen Nein sagen zum Heidentum, Ja sagen zum Christentum und an den allmächtigen Gott glauben.« Dieses Gesetz verbot jegliche Opfergaben in Form von Speisen und Getränken zu Ehren heidnischer Götter. Was für eine Hypokrisie! Und Jesus am Kreuz? War das nicht ein Menschenopfer? Und das Mahl Christi, bei dem die Gläubigen seinen Leib und sein Blut zu sich nehmen?
Als Linda ihnen von Freyjas Kindern erzählt hatte, hatte Jacob nicht gezögert. Es war an der Zeit, die alten Götter zu rehabilitieren. Während der ersten beiden Zeremonien hatten sie einfache Votivgaben dargebracht, Nahrungsmittel, Kleidung, Dinge aus dem Haushalt, Gebasteltes und Schmuck im Austausch für eine gute Ernte, Gesundheit oder Fruchtbarkeit. Ein Tier zu opfern war bei der Gründung des Clans jedoch niemals vorgesehen gewesen. Jacob beschlichen Zweifel. Ein schädlicher Nebel schien sich einzuschleichen und drohte die Ehrenhaftigkeit des Clans zu zerstören.
Jacob ging unter die Dusche und zog sich für den Abend um. Seine Frau Vilhelmina und seine Mutter Inga hatten den ganzen Nachmittag damit verbracht, das Festessen vorzubereiten.
Bevor sie sich zu Tisch begaben, schauten sie noch wie jeden Silvesterabend »Dinner for One« im Fernsehen an. Same procedure as last year, genau wie bei der neunzigjährigen Miss Sophie, die alljährlich ihre – verstorbenen – Freunde zur Feier ihres Geburtstages einlud. Wie jedes Jahr lachten alle aus vollem Hals darüber.
Das Essen wurde in der guten Stube eingenommen, die sie nur zu Geburtstagen und an Feiertagen benutzten. Der Tisch war entsprechend eingedeckt worden: mit einer weißen Tischdecke, Kerzenständern aus Zinn, Silberbesteck und dem Porzellan mit dem Blumenmotiv, das von Jacobs Großeltern stammte. Im letzten Herbst hatten Jacob und Claes, sein Vater, geschlachtet und dabei ein Viertel des Tiers für sich behalten und den Rest verkauft. Inga hatte einen Braten mit brauner Soße und Karotten und Kartoffeln aus dem Garten zubereitet. Für den Nachtisch hatte Vilhelmina eine Hagebuttensuppe gekocht, zu der sie Vanilleeis reichte.
Nach dem Essen war Vilhelmina mit den Kindern nach oben gegangen, um ihnen eine Geschichte vorzulesen. Noch vor dem Ende baten die Kinder darum, gemeinsam das Lied »Bä, Bä, vita lamm« – »Bäh, bäh, weißes Lamm« – zu singen. Danach schickte Vilhelmina sie ins Bett, gab jedem Kind in seinem Zimmer noch einmal einen Kuss und ging dann wieder nach unten zu den anderen.
Bei der Erwähnung des weißen Lamms im Lied musste Vilhelmina unwillkürlich an die letzte Zeremonie denken. Sie war fassungslos gewesen. Sie hatte ihr Trinkhorn hingehalten. Goði Berling hatte Blut hineingegossen. Alle anderen hatten es getrunken. Beim Mal zuvor war es Gotlandsdricka, eine Art lokales Bier, gewesen. An jenem Abend jedoch hatte sie vor dem ersten Schluck tief Luft holen müssen. Dann hatte Goði Alfrigg die verkohlt riechende Fleischplatte präsentiert. Der Fleischwürfel war zu groß gewesen, um ihn einfach hinunterzuschlucken. Sie hatte lange darauf kauen müssen. Der anhaltende Nachgeschmack von Blut hatte ihr Übelkeit verursacht.
Jacob und Vilhelmina ließen den Abend allein ausklingen. Jacob hatte den Kamin im Wohnzimmer angemacht und eine Flasche Sekt geöffnet. Als es zwölf schlug, stießen sie an. Jacob betrachtete seine Frau zärtlich. Sie war wunderschön, und sie hatte ihm zwei großartige Kinder geschenkt.
7
Minus wartete schon darauf, dass Andreas ihm die Tür öffnete, damit sie zum gemeinsamen Spaziergang entlang des Avançon aufbrechen konnten. Andreas liebte diese morgendlichen Spaziergänge mit seinem Bernhardiner, der stets die Gelegenheit nutzte, sich die Pfoten nass zu machen und mit sämtlichen Stöckchen zu spielen, die er fand. In solchen Momenten konnte Andreas seine Gedanken schweifen lassen. Meist, um bei laufenden Ermittlungen Bilanz zu ziehen, doch an diesem Tag gingen ihm ganz andere Dinge durch den Kopf.
Am Flussufer angekommen setzte er sich auf einen Stein, während Minus im Wasser herumtollte. Der sanfte Sprühregen hatte sich in dicke Regentropfen verwandelt, die auf sein Gesicht fielen, ihm über die Haut liefen und ihn seinen eigenen Körper spüren ließen. Er war hier, doch sein Geist führte ihn woandershin.
Jessicas Enthüllung hatte zweifellos einen Teil seiner Biografie erhellt, dennoch wurde Andreas weiterhin von einem Gefühl des Verrats verfolgt, das sich tief in seinem Innersten eingenistet hatte. Seine Eltern hatten ihm wissentlich die Wahrheit verschwiegen. Er schloss die Augen, als wolle er Augenblicke aus seiner Vergangenheit wieder aufleben lassen. Die gleiche Technik benutzte er auch bei seinen Ermittlungen. Häufig brannten sich die Tatorte regelrecht in sein Gedächtnis ein: Bilder, Empfindungen, Gerüche, Worte. Manche dieser Details speicherte er sogar unbewusst für immer in seiner Erinnerung. Andreas wandte diese Methode an, wenn er das Gefühl hatte, etwas übersehen zu haben. Wieder in jene Momente einzutauchen und sie noch einmal, quasi im Augmented-Reality-Modus, zu durchleben half ihm, gewisse Elemente an die Oberfläche zu holen, die seinem Bewusstsein entgangen waren.
Indem er die Augen schloss, versetzte er sich in jenen Dezember im vergangenen Jahr zurück. Jessica hatte vorgeschlagen, ein traditionelles Weihnachtsessen auszurichten. Er hatte sie auf den Lausanner Weihnachtsmarkt begleitet, der alljährlich von der schwedischen Gemeinde im Pfarrsaal von Ouchy organisiert wurde, um dort die dafür nötigen Zutaten zu kaufen. Schon beim Betreten des Saals hatte ihn eine Welle der Nostalgie erfasst, denn in ihrer Kindheit hatten sie diesen Markt jedes Jahr mit ihren Eltern besucht. Während die Eltern ihre Einkäufe erledigten, hatten Jessica und er dort mit dem Weihnachtsmann gebastelt. Danach fand das traditionelle Santa-Lucia-Lichterfest statt, das normalerweise am 13. Dezember gefeiert wurde. Angeführt von Lucia mit ihrer mit Kerzen besetzten Krone zog dann eine Prozession von in weiße Roben gekleideten jungen Frauen mit Kerzen in den Händen ein, die ein Lied vom Sieg des Lichts über die Dunkelheit sangen. An jenem Sonntag waren sie jedoch zu spät gekommen, um dabei zu sein. Jessica und er hatten sich hingesetzt, um einen Glögg, die nordische Version eines Glühweins, zu trinken. Andreas sah diese Szene wieder genau vor sich.
Sie essen einen Pepparkaka, und er genießt die intensiven Aromen dieses Gewürzkekses. Sofort hat er vor Augen, wie seine Mutter in der Küche diese Pfefferkuchen buk und der Duft durchs ganze Haus zog. Bei dem Gedanken an die vielen positiven Momente ihrer Kindheit muss Andreas lächeln. Doch Jessica lächelt nicht.
»Was ist los? Warum weinst du?«
»Letztes Jahr habe ich dem Tod ins Auge gesehen. Ich hatte mehr Glück als Mikaël. Ich bin unbeschadet aus der Sache rausgekommen. Im Angesicht des Todes hatte ich jedoch Gewissensbisse wegen eines Geheimnisses, das ich schon viel zu lange mit mir herumgetragen habe. Ein Geheimnis, das ich dir nicht verraten durfte. Ich hatte vor, es dir im Krankenhaus zu sagen, aber wegen Mikaëls Zustand habe ich es einfach nicht übers Herz gebracht. Ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen. Für dich und für mich.«
Jessica schluchzt. Tränen der Erleichterung, denn eine Last scheint von ihr abzufallen.
»Ein Geheimnis?«
»Das deine Kindheit betrifft …«
Jessicas Stimme klingt zögerlich. Sie senkt den Kopf, um Andreas nicht in die Augen schauen zu müssen.
»Andreas, du bist nicht mein Bruder.«
Überrascht mustert Andreas seine verstummte Schwester. Er wartet darauf, dass sie fortfährt. Ihre sonst unerschütterliche Vertrautheit im Umgang mit ihm ist einer spürbaren Anspannung gewichen. Sie holt ein Taschentuch hervor, tupft sich damit die feuchten Wangen ab, zerknüllt es und steckt es zurück in die Handtasche. Dann schaut sie Andreas mit Tränen in den Augen an.
»Du bist … adoptiert worden.« Sie schweigt kurz und atmet hörbar aus. »Und deine richtigen Eltern sind tot.«
8
Sundre, Gotland
Sonntag, 7. Januar 1979
Ohne anzuklopfen, öffnete Vera Jakobsson die Zimmertür.
»Es ist Zeit aufzustehen. Dein Frühstück ist fertig.«
Die näselnde Stimme ihrer Mutter machte sie aggressiv. Svea war bereits wach. Sie liebte es, vor dem Aufstehen noch etwas im Bett herumzulungern und die Grenzen zwischen Traum und Bewusstsein auszukosten, bevor sie sich der Realität stellen musste. In den letzten Wochen hatte sie eine ungewöhnliche Müdigkeit verspürt und sich von Mattigkeit und Mutlosigkeit überwältigen lassen.
Seit Svea nach Gotland zurückgekehrt war, meinte sie manchmal, dass ihre Eltern ihr fremd geworden waren. Sie waren zwar da und greifbar, aber sie erschienen ihr lediglich wie animierte Figuren, die sie nicht mehr verstehen konnte. Außerdem empfand sie ihre Gegenwart als unerlaubtes Eindringen in ihre Privatsphäre. Ihre Mutter nervte sie, denn sie konnte es nicht lassen, sie wie ein kleines Mädchen zu behandeln. Mit siebenundzwanzig Jahren zu ihren Eltern zurückzukehren war keine freiwillige Entscheidung gewesen. Sie war in der Hauptstadt gescheitert und nun ohne Diplom und ohne Job auf die Insel zurückgekommen.
Viele junge Leute auf Gotland träumten davon, diesem gottverlassenen Nest zu entfliehen und in die Hauptstadt zu ziehen. In Stockholm hatte Svea sich drei Jahre lang abgerackert, bevor sie sich an der Universität einschreiben konnte. Sie war quasi mittellos losgezogen und hatte sich mit kleinen Aushilfsjobs über Wasser gehalten, um die Miete für ihr Zimmer zu bezahlen. Einen Kredit aufzunehmen war für sie nicht in Frage gekommen. Jeden Monat legte sie ein wenig Geld für ihr Studium beiseite. Sie erlaubte sich kaum ein Vergnügen, um kein unnötiges Geld auszugeben. In ihrer Freizeit sang sie und spielte Klavier. Sie war in einem Kirchenchor aufgenommen worden, und der Pfarrer hatte ihr erlaubt, wann immer sie wollte, den Flügel im Pfarrheim zu benutzen. Davon abgesehen las sie sehr viel. Sie hatte alle Bücher über die Wikingerzeit, die sie auftreiben konnte, verschlungen.
Im August 1976 hatte sie mit dem Studium der Religionsgeschichte beginnen können. Gleich am ersten Tag hatte sie das Wort ergriffen und eine Frage gestellt. Als der Professor sich über ihren gotländischen Akzent lustig machte, hatte der ganze Hörsaal gekichert. Obwohl sie Fernsehen schaute und den nationalen Radiosender P1 hörte, war ihr nie bewusst gewesen, dass sie einen Dialekt sprach, der sich sehr von der schwedischen Umgangssprache unterschied und den die Menschen in der Stadt als hinterwäldlerisch betrachteten. Ihre Eltern hatten sie Gotländisch gelehrt, einen Regionaldialekt, der für die Menschen vom schwedischen Festland nur schwer zu verstehen war. Im Gotländischen gab es weder genaue Grammatikregeln noch eine einheitliche Rechtschreibung. In der Schule wurde Svea zwar auf Schwedisch unterrichtet, aber zu Hause sprachen sie diesen klangvollen, melodischen Dialekt, der mit archaischen Wörtern germanischen Ursprungs durchsetzt war.
Mit etwas Beharrlichkeit und trotz der Vorurteile, die ihr entgegenschlugen, hatte Svea schnell Freunde gefunden. Nach ein paar Monaten hatte sie einen Mann namens David kennengelernt, der, wie sie glaubte, ihren Dialekt und die Offenheit der gotländischen Inselbewohner sehr charmant fand. Svea und David waren gleich alt und hatten später als der Durchschnitt mit dem Studium begonnen, was vielleicht ihre Vertrautheit erklärte. Sie fühlte sich wohler mit ihm zusammen und glaubte, sie sei verliebt. Seine grünen Augen verwirrten sie. Sie hatten sich bereits ein paarmal geküsst, bevor David sich outete. Dennoch blieben sie sich nahe, trafen sich regelmäßig und knüpften eine enge Freundschaft.
Im Juni 1977 hatte Svea ihre Prüfungen bestanden und war für die Sommerferien nach Gotland zurückgekehrt. Während dieser Wochen hatte sie sich von der Außenwelt zurückgezogen. Sie hatte ihren Eltern auf dem Feld, im Garten und in der Küche geholfen. Nach einem blöden Haushaltsunfall hatte sie sich, aus Angst, man würde sie nur bemitleiden, mit dem Verband im Gesicht nicht ihren Freunden zeigen wollen. Der einzige Mensch, den sie hin und wieder sah, war Bengt, ein Freund aus Kindertagen. Sie trafen sich auf dem Leuchtturmhügel, wo sie die meiste Zeit ihrer Rekonvaleszenz verbracht hatte, schauten in die Ferne und dachten über ihr gemeinsames Projekt nach. Bengt hatte ihr anvertraut, dass er einen Wikingerclan ins Leben rufen und auf der Insel das nordische Heidentum wiederbeleben wollte. Unter strengster Geheimhaltung hatten sie begonnen, ihren Plan grob zu skizzieren.
Als sie zu Beginn des zweiten Studienjahres wieder nach Stockholm zurückkehrte, hatte sie das Gefühl, dass ihre Freunde sie mieden. Oder war es etwa umgekehrt? An manchen gemeinsamen Abenden stellte sie sich vor, dass sie außerhalb ihres Körpers stand und die Menschen um sich herum beobachtete. Wenn sie lachten, verstand sie den Grund dafür nicht. Es gelang ihr nicht mehr, einen Kontakt zu ihnen herzustellen. Sie war da und gleichzeitig abwesend. Sie kam sich vor wie ein gefühlloser Roboter. Je mehr Zeit verstrich, desto öfter hatte sie den Eindruck, sich von den anderen zu entfernen und sich auch selbst fremd zu sein.
Bengt hatte ihr im vergangenen Jahr anlässlich des Johannistags, an dem in ganz Schweden das Fest der Sommersonnenwende gefeiert wurde, einen kurzen Besuch abgestattet. An dem beliebtesten Feiertag des Jahres war auch Bengts Ladenlokal geschlossen. Seine Freundin Johanna war bei ihrer Familie auf Gotland geblieben, aber Bengt war schon am Vorabend angereist, um zwei Tage in Stockholm zu verbringen. Svea hatte vor, bald auf die Insel zurückzukehren. Das Semester war vorbei, aber sie hatte bleiben wollen, um noch ein wenig in der Bibliothek zu arbeiten. Am Freitag waren sie durch Gamla Stan, die Altstadt von Stockholm, flaniert und hatten dabei lange über ihr Clanprojekt diskutiert. Bengt hatte bereits die Kettenanhänger gefertigt, über die sie gesprochen hatten. Er zeigte ihr ein Exemplar. Svea war beeindruckt von der feinen Goldschmiedearbeit und von der Schönheit des Cordierits, des berühmten Steins, mit dessen Hilfe die Wikinger auch bei bedecktem Himmel den Sonnenstand bestimmt hatten, um sich auf hoher See zu orientieren.
Am Abend hatten Svea und Bengt David zu einem Studentenabend begleitet. Die Party hatte auf einer der Inseln im Stockholmer Schärengarten bei einem verwöhnten Sohn reicher Eltern stattgefunden. Sie fragte sich, ob die Tatsache, dass sie keinen Alkohol trank, sie nicht nach und nach ins Abseits gedrängt hatte. Die beruhigende Gegenwart ihrer Freunde hatte sie an jenem Abend wohl auch ihrer Hemmungen beraubt. Ihr Versuch, wie die anderen zu sein und sich zu integrieren, indem sie riesige Mengen Alkohol in sich hineinschüttete, hatte in einer gewaltigen Blamage geendet. Sie hatte sich übergeben und war mitten im Wohnzimmer zusammengebrochen. Am nächsten Morgen war Svea in einem ihr unbekannten Bett aufgewacht. Sie hatte gespürt, wie kühler Wind ihre Haut streichelte. Das Fenster stand offen. Dann erst hatte sie begriffen, dass sie nackt war. Sie hatte keinerlei Erinnerungen an den Abend, aber sie spürte einen dauerhaften Schmerz zwischen ihren Schenkeln. Die weißen Bettlaken waren blutverschmiert.
Als sie schließlich in den Salon hinuntergegangen war, empfing sie ein trostloser Anblick. Überall standen leere Flaschen und zerbrochene Gläser herum. Die Aschenbecher auf dem Tisch quollen über. Der Teppich war übersät von Chipskrümeln und zertretenen Erdnüssen. David, Bengt und die anderen jungen Leute lagen noch auf dem Sofa. Sie hatte stechende Kopfschmerzen und konnte sich nur mit Mühe auf den Beinen halten. Sie war in die Küche gegangen, um ein Glas Wasser zu trinken. Der Geruch der Speisereste verursachte ihr Übelkeit. Angewidert übergab sie sich ins Spülbecken.
Gemeinsam hatten sie schließlich das Boot zurück nach Stockholm genommen. Keiner hatte Lust verspürt zu reden. Bei der Überfahrt hatte David seinen Mageninhalt über das Deck ergossen, während Bengt schnarchend auf einer Bank gelegen hatte. Svea hatte die Abscheu gegenüber ihrem eigenen Körper nicht abschütteln können. Sie hatte nur noch nach Hause gehen und stundenlang duschen wollen, um sich von diesem Schmutz zu reinigen.
Nach diesem Erlebnis hatte Svea angefangen, sich zu schämen und die Blicke der anderen zu fürchten. Unter Menschen zu sein wurde für sie zum Martyrium. Sie flüchtete sich in die Bibliothek, ohne dort mit irgendwem in Kontakt zu treten. Bis zu ihrer Heimfahrt musste sie nur noch ein paar Tage durchhalten. Selbst das stille Arbeiten inmitten der anderen Studenten war ihr eine Qual. Ein wachsendes Gefühl der Beklommenheit marterte sie. Eines Tages hatte eine Panikattacke das Ende ihrer Zeit in Stockholm eingeläutet. Sie hatte geschwitzt und feuchte Hände bekommen. Es hatte sich angefühlt, als würden sie alle mustern. Die Menschen um sie herum verwandelten sich plötzlich in Trolle, in jene düsteren Schattengestalten mit wirrem Haar, langen Nasen, knorrigen Armen und Beinen, hervorstehenden Augen und bösem Blick. Eine Hitzewelle erfasste sie, und ihr Herz schlug, als würde es jeden Moment explodieren. Hastig hatte sie daraufhin ihre Bücher zusammengesucht, war aufgestanden und hatte den Lesesaal verlassen. Am nächsten Tag hatte sie sich zu Hause verbarrikadiert, ihre Koffer gepackt und war ohne jede Ankündigung nach Gotland zurückgekehrt. Nicht einmal David hatte sie Bescheid gesagt.
Im September 1978 hatten Freyjas Kinder begonnen, sich zu treffen. Svea fühlte sich in ihrem Element. Am 20. September hatten sie das Höstblót gefeiert, die Zeremonie der herbstlichen Tag-und-Nacht-Gleiche. Sie hatten sich von Sól verabschiedet, jener Göttin, die den von den Pferden Árvak und Alsvid gezogenen Sonnenwagen lenkte, und hatten die Riesin Skaði, die Göttin der Jagd und des Winters, begrüßt. Anfang November hatten sie sich zum Álfablót getroffen, dem heidnischen Opfer für die Elfen und die Seelen der Verstorbenen. Sie hatten Scheiterhaufen errichtet und entzündet, um mit dem Licht inmitten der Nacht den Toten die Möglichkeit zu geben, sie zu besuchen.
Die Feierlichkeiten der Wintersonnenwende übertrafen ihre Erwartungen. Die Riten und Gesänge hatten in der Praxis noch mehr an Bedeutung gewonnen. Außerdem hatten sie zum ersten Mal ein Tier geopfert. Diesen Praktiken neues Leben einzuhauchen war für Svea eine notwendige Rückkehr zu den eigenen Wurzeln. Sie war in einem sehr christlich geprägten Umfeld groß geworden, ohne eine Verbindung zwischen Kirche und Welt gespürt zu haben. Sie liebte die Natur. Indem sie an die Götter der Wikinger glaubte, erweckte sie den ursprünglichen Pantheismus und den Glauben, dass allen Dingen eine Seele innewohnte, wieder zum Leben. Wenn es am Himmel donnerte, war Thor mit seinem Streitwagen unterwegs und erzeugte Blitze mit seinem Hammer, um die Menschheit vor bösen Ungeheuern zu schützen. Regnete es, verdankte man dies Freyr, der damit den Bauern half, ihre Saat gedeihen zu lassen. Die Götter waren Teil der Schöpfung. Sie waren weder unsterblich noch furchteinflößend, und man musste sich ihnen nicht unterwerfen. Vielmehr waren sie so etwas wie Freunde, die man um Hilfe anrufen oder um einen Gefallen bitten konnte.
Für ihr Studium hatte sich Svea eingehend mit zwei isländischen Manuskripten des 13. Jahrhunderts beschäftigt: der Snorra-Edda und dem Codex Regius. Ersteres war ein Handbuch des nordischen Heidentums, Letzteres eine Textsammlung epischer Lieder. Beide Handschriften hatten ihre Phantasie angeregt und ihr eine wunderbare mystische Traumwelt eröffnet.
Als Svea auf Gotland wieder dem geregelten Inselleben folgte, verflüchtigten sich ihre Angstzustände. Doch etwas in ihr hatte sich tiefgreifend verändert. Sie war zu einer Einzelgängerin geworden, ihre Beziehung zu anderen war komplizierter, vor allem, wenn mehrere Personen beisammen waren. Mittlerweile fand sie es einfacher, sich mit den Göttern zu unterhalten als mit den Menschen.
Anfangs hatte sie die Vorstellung gefürchtet, bei den Opferzeremonien oder Clantreffen mit anderen in Kontakt treten zu müssen, da jedoch alle einen Helm mit einem Visier trugen, der das Gesicht verdeckte, musste sie nur die anonymen und verborgenen Blicke ihrer Gleichgesinnten aushalten. Sie kannte ihre Identitäten, doch die Masken und Kostüme schafften eine Distanz. Und außer den drei anderen Mitbegründern wusste niemand, wer sie war. Tatsächlich war sie es gewesen, die gleich zu Beginn diese Anonymität gefordert hatte, die ihr Sicherheit verlieh.
Im Halbschlaf durchlebte Svea noch einmal die letzte Feier, als sie hörte, wie ihre Mutter unten vor sich hin redete. Sie beschloss aufzustehen, sich anzuziehen und hinunterzugehen, um in der Küche zu frühstücken.
Svea schenkte sich einen Kaffee ein und mischte in einer großen Schale Filmjölk, eine sämige Dickmilch, mit verschiedenen Körnern, Getreideflocken und Marmelade. Dann schnitt sie sich mehrere Scheiben Gotlandslimpa ab, ein traditionelles Roggenbrot mit Melasse. Eine der Scheiben bestrich sie mit Messmör, einem bräunlichen Brotaufstrich aus Molke, eine andere mit Geflügelleberpastete.
»Merkst du überhaupt, was du da isst? Kein Wunder, dass du Fett ansetzt!«
»Findest du, dass ich dicker geworden bin?«
»Ja, merkst du das denn nicht?«
»Ich habe einfach einen gesunden Appetit, das ist alles.«
»Seit deiner Rückkehr bläst du den ganzen Tag Trübsal. Ich glaube, es liegt an deiner Depression, dass du so zunimmst.«
Die Tür ging auf, und Sveas Vater Ragnar, der bis eben im Stall gewesen war, setzte sich seiner Tochter gegenüber an den Tisch. Er fühlte sich schon seit Monaten mutlos. Neben der Arbeit in seinem landwirtschaftlichen Betrieb war er einer der Leuchtturmwärter von Hoburgen gewesen, die sich alle vier Stunden ablösten. Er liebte es, abends dort ganz allein zu sein, die Leuchtfeuer einzuschalten und mit dem Fernglas den Horizont abzusuchen. Doch der Leuchtturm war gerade automatisiert worden. Vor ihm hatten sich schon sein Vater und sein Großvater voller Stolz um diese Aufgabe gekümmert. Jetzt war Schluss damit.
»Schenk mir einen Kaffee ein!«
»Warum schwitzt du so?«, fragte Vera. »Du bist ja ganz blass.«
Ragnar wurde plötzlich schwindelig. Gleichzeitig spürte er einen Druck auf seiner Brust. Er hatte das Gefühl, dass sich sein Brustkorb verengte und sämtliche Organe zusammengedrückt wurden. Er bekam keine Luft mehr. Er versuchte aufzustehen und sank schwer auf den Küchenboden.
Ihre Mutter fiel auf die Knie. »Ragnar, hörst du mich?« Sie legte ihm eine Hand auf den Bauch, doch dieser hob sich nicht. »Svea, er atmet nicht mehr!«
Svea saß immer noch regungslos am Tisch.
»Großer Gott, tu doch was. Ruf den Krankenwagen!«
Teilnahmslos kaute Svea auf ihrem Brot herum. Ihr Blick war so leer, dass sie ihre Mutter, die über den leblosen Körper des Vaters zusammengesunken war, überhaupt nicht wahrnahm.
9
Nachdem Andreas zum Abschluss seines Spaziergangs einen kleinen Abstecher in die Bäckerei am Barboleuse-Platz gemacht hatte, um Brot und Croissants zu kaufen, wischte er nun sorgfältig Minus’ Pfoten ab, bevor dieser ins Haus durfte. Sein Fell triefte immer noch vom Regen.
»Minus, ab ins Körbchen.«
Gehorsam rollte sich der Hund auf seinem Stammplatz neben dem Sofa zusammen. Andreas fing an, das Frühstück vorzubereiten. Seine Gedanken kreisten unablässig in der Vergangenheit, in seiner eigenen, der er sich stellen musste, aber vor allem drehten sie sich um die jüngsten Ereignisse, die seine Gegenwart grundlegend verändert hatten. Wie so oft spulte er den Film aus dem Krankenhaus ab.
Die Auseinandersetzung mit seinen Schwiegereltern ist noch nicht lange vorbei. Er sitzt auf einem der unbequemen Stühle im Wartebereich des Krankenhauses. Mikaël liegt seit beinah drei Stunden auf dem OP-Tisch. Andreas’ Kollegin Karine ist gekommen, um ihm schweigend Beistand zu leisten. Eine der Krankenschwestern nähert sich und reicht ihm ein Blatt Papier. Luca hat mit dem Hausarzt gesprochen, der ihm noch vor der Operation die Patientenverfügung gefaxt hat. Mikaël hat die Papiere unterschrieben, aber vergessen, es Andreas zu sagen, den er zu seinem Bevollmächtigten ernannt hat. Alles ist geregelt. Eine Tür geht auf. Luca kommt aus dem OP-Saal. Er sieht müde aus. Er kommt auf ihn zu. Andreas blickt ihm entgegen. Er versucht aus dem Blick des Chirurgen herauszulesen, was dieser ihm gleich verkünden wird.
»Andreas …«
Andreas fuhr aus seinen Gedanken auf und drehte sich abrupt um.
»Alles in Ordnung? Habe ich dich erschreckt?«
»Ich habe dich nicht kommen gehört.«
Andreas betrachtete seinen Lebensgefährten Mikaël. Die Narbe auf der linken Schädelseite würde ihn für immer an einen der schlimmsten Momente seines Lebens erinnern, als er glaubte, ihn verloren zu haben. Er ging zu ihm und küsste ihn zärtlich.
»Hast du gut geschlafen?«
»Ja, ganz okay, aber ich habe bisschen Kopfschmerzen«, antwortete Mikaël etwas abgehackt.
»Das Frühstück ist fast fertig.«
»Ich komme. Ich werde erst noch meine Medikamente nehmen.«
»Lass dir Zeit. Ich muss noch deinen Orangensaft pressen.«