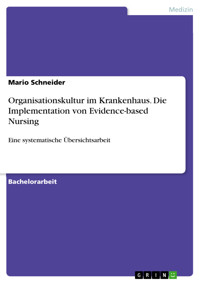Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mitteldeutscher Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ella und René sind jung und frisch verliebt. Sie kommen aus Ostdeutschland und verbringen, kaum dass die Mauer gefallen ist, ihren ersten gemeinsamen Urlaub in Südfrankreich. Dabei geraten sie auf das heruntergekommene Weinschloss der Madame de Violet. Als deren Sohn Alain auftaucht, ein aalglatter Geschäftsmann, stoßen drei Weltanschauungen aufeinander. Die Situation eskaliert. Am kommenden Morgen ist nichts mehr wie es war. René fährt mit Alain nach Paris und wird von ihm in die High Society eingeführt. Ella bleibt zurück auf dem Schloss und taucht immer tiefer in die Welt von Madame de Violet und ihrem verschwiegenen Diener ein. Niemand weiß, dass die Gräfin mit dem Leben abgeschlossen hat und nur noch auf den passenden Moment wartet, sich von der Welt zu verabschieden. In „Die Paradiese von gestern“ treffen drei Gesellschaftsordnungen aufeinander: die des gescheiterten Sozialismus, der für das junge Paar überwältigende Kapitalismus und Vorstellungen von Stolz und Würde eines längst überkommenen Adels. Mario Schneiders erster Roman erzählt meisterhaft von der Liebe, dem Tod und den Verlockungen unserer neuen Zeit.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 776
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorspiel Hôtel du Palais, 1960
Die schönsten Erinnerungen an ihre Kindheit verband Charlotte mit Biarritz, der hellen Stadt am gleißenden Strand. Ihre Eltern hatten mit ihr und ihrem Bruder dort die Sommer verbracht. Es waren Promenadensommer an der Hand des Vaters, mit ihren hübschesten Kleidchen, Eis und Limonaden, Strandsommer mit Burgen aus Sand und Sand in den Betten und zwischen den Zähnen, Kindersommer mit fremden, sonnengeölten Jungen und Mädchen und hohen, kalten Wellen, und Geheimnissommer mit nächtlichen Wanderungen am Meer und dem regelmäßigen Schlag des Leuchtfeuers in die Schatten ihrer Suite des Hôtel du Palais. Seit zwanzig Jahren war sie nicht mehr dort gewesen. Dass Henri, ihr Mann, nicht mitfahren würde, machte Charlotte nichts aus, im Gegenteil, es wäre gut, allein zu sein, ohne ihn, der jederzeit seine Geliebte im Herzen mit sich herumtrug, so viel ahnte Charlotte, dass sie wohl mit ihrem Mann noch einsamer wäre als ohne ihn. Was die Anwesenheit ihres Sohnes betraf, wich die anfängliche Freude über ihre gemeinsamen Tage allmählich der Befürchtung, dass sie am Ende nicht wissen könne, was sie mit ihm anfangen sollte. Aber dafür würde ja Thérèse, das Kindermädchen, da sein. Also reisten sie ab, ein kleiner Tross, und statt ihres Fahrers Paul, der mit den Masern im Bett lag, half Vincent, der Portier, aus, der eigentlich seine freien Tage hatte.
Charlotte und Thérèse saßen auf der Rückbank des geräumigen Mercedes und zwischen ihnen thronte der kleine Alain in großer Vorfreude, denn Thérèse hatte ihm ein Foto vom Meer, das ihm noch unbekannt war, gezeigt. Vincent stieg ein und sie fuhren los. Diese Autofahrt von Château Violet zum Palais Biarritz war der Beginn ungewöhnlicher Tage. Schon, dass sie kurze Zeit nach ihrer Abfahrt, nachdem Thérèse angestimmt hatte, gemeinsam Kinderlieder sangen und Alain zwischen ihnen wie ein lustiger Zwerg dirigierte, war so ungewohnt und unbeschwert, dass Charlotte die ganze Fahrt über lächelte.
Nachdem der Maître d’hôtel, Monsieur Hipette, ein Freund ihres Vaters, sie persönlich in der ehemaligen Sommerresidenz von Eugenie, der Gattin Napoleon des Dritten, begrüßt und besonders den kleinen Alain für seine strammen Schritte gelobt hatte, bezogen Charlotte und ihr Sohn die helle, seeseitige Suite, in der sie schon mit ihren Eltern gewohnt hatte. Vincent und Thérèse bekamen zwei kleine Dienstzimmer für Angestellte im rückwärtigen Untergeschoss zugeteilt. Es dauerte nicht lange, da trafen sich alle wie die Farben auf einer frisch gereinigten Malerpalette am hellen Strand, der geharkt und geglättet war, unter einem blau-weißen Pavillon, Charlotte mit einem luftigen, fliederfarbenen Kleid, Thérèse mit hellgelbem Badeanzug. Einige Meter entfernt von ihnen lag Vincent in dunkelroter Badehose auf einer der mintgrünen Sonnenliegen, und zwischen ihnen lief ein blasser Junge mit blauem Matrosenanzug umher. Die kleine, bunte Sommergesellschaft wirkte auf die Gäste des Hôtel du Palais, als richte sie sich für einen achtwöchigen Urlaub ein, und so hatte auch Charlotte, schon nach einigen Stunden am Strand, das Gefühl, als könnten diese sieben Tage tatsächlich unbeschwert und fernab der Sorgen, die sie sonst nicht losließen, verlaufen. Genau genommen war es das erste Mal, dass sie ihren dreijährigen Sohn mit den Augen einer liebenden Mutter betrachtete. Sie verfolgte jeden seiner Schritte im Sand, sah sein sonst immer etwas trauriges Gesicht aufleuchten, wenn er Thérèse anfeuerte, ihn zu fangen oder wenn er sich ängstlich an Vincent heranschlich, bis der nur seine Augen öffnete, um dann erschrocken und quiekend davonzulaufen. Besonders rührend empfand sie Alains Annäherungsversuche an sie selbst, denn sie spürte bei jedem Heraufklettern auf ihren Schoß oder wenn er ihre Hand griff, um sie vergeblich dazu zu überreden, mit ihm ins Wasser zu kommen, wie sehr er sie mochte und wie sehr er wollte, dass sie ihm entgegenlächelte und ihn in die Arme nahm, wie eine richtige Mutter. Sie hatte noch nicht die Geduld gehabt und wohl auch noch keine Gelegenheit, diesen neuen Menschen zu lieben, vielleicht, weil es ihr versagt gewesen war, ihr Kind stillen zu können, vielleicht aber auch, weil sich Thérèse die meiste Zeit um ihn kümmerte oder weil Charlotte es überhaupt nicht begreifen konnte, dass sie Mutter war. Sie hatte dieses Kind selten zu Gesicht bekommen und war nicht darum bemüht, es öfter zu sehen, weil sie ihre eigene Befangenheit ihm gegenüber fürchtete. Dieser Junge war da, das wusste sie, aber wer war er wirklich und was hatte er mit ihr zu tun? Da er quer in ihrem Bauch gelegen hatte, war Charlotte bewusstlos, als sie ihn aus ihr und sie von ihm befreit hatten. Als könne sie es anzweifeln, ja, als bestünde beinahe eine Pflicht darin, zu entscheiden, ob dieses Wesen ihr Sohn war, zeigte man ihr, als sie einige Stunden später aufgewacht war, ein Kind. Doch ohne ihre Antwort abzuwarten, legte man es ihr, als wäre es die normalste Sache der Welt, neben das Kopfkissen. Es dauerte lange, bis Charlotte zwischen diesem Kind und sich selbst einen Zusammenhang herstellen konnte.
Erst an diesem Wochenende, erst im heißen Sand vor dem Hôtel du Palais Biarritz bemerkte sie an ihm und vor allem an sich selbst, dass er auf eine anrührende Weise zu ihr gehörte. Den Menschen in ihm, der er einmal sein würde, den Erben, den letzten zarten Trieb des schon totgeglaubten Stammbaumes der Violets, sah sie, als hätte er sich ihr bewiesen, als die Hoffnung, die er von nun an sein würde. Und mit einem Mal floss in seinem Körper nicht mehr sein eigenes Blut, sondern das seiner Vorfahren, seines Groß- und Urgroßvaters, das von Louis und Artus, den Thibauts, den Jeans, Antoines und zuletzt auch das von Charlotte. Sie war überglücklich über diese Einsicht, und von da an sah sie Alain nicht mehr als verstörende Last, sondern als einzig triftigen Grund ihrer Existenz, und sie war froh darüber, diese Rechtfertigung zum ersten Mal in ihrem Leben zu empfinden.
Ein Kind ist in der Lage, die Schranken zwischen vollkommen fremden Menschen oder – wie in diesem Fall – zwischen den Bediensteten und ihrer Herrschaft aufzulösen. Wie schon der Gesang auf der Fahrt, ließ jetzt Alains ständiges Hin und Her von Vincent zu Thérèse und von Thérèse zu Charlotte aus diesen vier Menschen eine Gruppe werden, in der jeder Einzelne zu vergessen begann, dass der andere einem eigentlich fremd ist. Die ausgelassenen Spiele im Sand, bei denen Thérèse ihn zurückhielt, wenn er zu übermütig wurde und seine Mutter zu sehr bedrängte, das Herumtollen in den sich überschlagenden Wellen unter Vincents verlässlichem Griff, aber vor allem die dankbaren und beinahe liebevollen Blicke Charlottes an ihre beiden Helfer ließen aus der Reisegesellschaft, wie es so oft auch mit Wildfremden an den entlegensten Orten geschieht, eine Familie werden.
Besonders gern sah Charlotte, wie Vincent mit Alain spielte. Es war eine Natürlichkeit, wie es sie nur zwischen Männern geben kann – die Bewunderung Alains für ein ausgewachsenes Exemplar seiner selbst, das Staunen über die fremde Männlichkeit, ist einem Jungen doch die Mutter und damit auch jede andere Frau näher als das noch unbewusste, eigene Geschlecht. Unter hellem Aufschrei geworfen und sicher wieder gefangen, etwas das Henri zum Beispiel nie mit ihm tat, dieses in die Lüfte werfen – fühlte Vincent wohl den immer mit der Gefahr spielenden Übermut eines enthusiastischen Vaters, dem es Freude bereitet, sein Kind einer kleinen, aufregenden Ferne auszusetzen, nur um ihn kurz darauf durch das geschickte Fangen mit umso größerer Nähe und Geborgenheit zu belohnen.
Seltsam, dachte Charlotte, hatte Henri ihn so wenig als seinen Sohn betrachtet, wie sie selbst? War Alain auch für seinen Vater ein fremdes Wesen, vielleicht weil es einen fremden Namen trug und nicht den seinen oder weil er schon lange ahnte, dass er fortgehen würde und dass er diesen Jungen niemals mitnehmen dürfe? Er spielte Alain den Vater nur vor, und Charlotte ekelte sich beinahe vor den ungelenken und meist erfolglosen Bemühungen ihres Mannes, sein Kind aufzuheitern. Kinder fühlen sich zu sorglosen, glücklichen, sogar traurigen Menschen hingezogen, wenn sie nur wahrhaft glücklich oder wahrhaft traurig sind. Sie spüren, als wäre es ihr alles bestimmender Sinn, jede Verklemmung oder Verstellung und nehmen Reißaus, und wenn man sich ihnen in den Weg stellt, laufen sie um einen herum, als wäre man ein Baum oder sonst irgendein Hindernis. Man kann sie nicht davon überzeugen, dass man sie liebt, egal ob man es tut oder nicht.
Charlotte sollte sich später darüber ärgern, dass es keine Beweise ihres Glücks dieser Tage gab, keine Fotos oder Andenken. Am liebsten hätte sie eine Fotografie besessen, von Alain, Thérèse, Vincent und ihr unter dem blau-weißen Baldachin ihres Pavillons am Meer. Nur Alain besaß ein Souvenir, von dem er allerdings längst vergessen hatte, woran es ihn hätte erinnern können, einen Stein, den er im Wasser gefunden hatte und mit dem er aufgeregt zu ihnen gelaufen kam. Charlotte und Vincent beugten sich über den kleinen Schatz, den Alain ihnen entgegenhielt und der, rund und grau, nicht mehr als ein gewöhnlicher Stein war, doch zum ersten Mal kam es bei dieser Gelegenheit zu einem Kontakt zwischen Charlotte und Vincent, noch zaghaft und unschuldig. Ihre nackten Schultern stießen leicht aneinander, und während Vincent nicht zu bemerken schien, dass sie sich immer wieder streiften, fühlte Charlotte in ihre kleinen Berührungen hinein, als wäre jede von ihnen ein Kuss. Der Moment war so kurz und aufregend gewesen, dass sie sich wünschte, Alain würde einen Stein nach dem anderen aus dem Wasser holen. Aber die Besonderheit des Steines bestand darin, dass er der Einzige war, denn es gab eigentlich keine Steine an diesem Strand.
Wenn Charlotte an diese Tage im Sommer 1960 zurückdachte, was sie in letzter Zeit oft tat, dann sah sie ihrem früheren Ich und diesem fremden Mann lächelnd zu, wie sie sich annäherten. Sie sah, wie jung diese Menschen waren, wie verschieden von denen, die sie später sein würden, und sie erfreute sich, aufrichtig und voller Sehnsucht, an ihrem Glück.
An diesem ersten Abend brachten Charlotte und Thérèse Alain gemeinsam ins Bett. Anfangs war er noch sehr aufgedreht, sprang, wie auf einem Trampolin, auf der Matratze herum, warf sich aber dann, nachdem er immer wieder aufgesprungen war, endgültig in die Kissen und wurde schnell müde. Während Thérèse ihm aus dem Kleinen Däumling vorlas, streichelte Charlotte seinen Arm, wobei sie darauf achtete, dass er es nicht bemerkte, damit er ihn nicht womöglich noch wegzog. Sie streichelte ihn in den Schlaf und als Thérèse gegangen war, flüsterte sie dem schon Träumenden ins Ohr: »Das war ein schöner Tag.«
Am liebsten hätte sie sich neben ihn gelegt, da sie keine Lust hatte, nach unten zu gehen und allein in der Hotelbar zu sitzen auf die Gefahr hin, dort von irgendjemandem aus der Gesellschaft entdeckt zu werden oder in einem Sessel vor dem Kamin so zu tun, als könne sie bei dem nächtlichen Trubel ein Buch lesen. Vor allem aber wollte sie keine Gespräche über ihr Hotel oder das Weingut führen, so wie vorhin erst, als sie beim Dîner von Madame Saubrousse mit »Wie geht es Ihnen und Ihrem Château?« angesprochen wurde, womit nur der Wein und weder sie selbst noch das Haus gemeint war. »Hat er sich erholt? Sie haben noch nicht neu gepflanzt? Das wundert mich aber. Ihr Wein ist der Beste, wenn man ihn doch nur bekommen könnte. Na ja, ich muss bei Ihnen vorbeischauen, dann kommt man ja in den Genuss, den Neunzehnhunderter zu trinken. Haben Sie davon überhaupt noch? Es wäre wirklich schade, wenn er aus wäre. Ein Jahrhundertwein, und Ihrer ist der Beste. Ich habe gehört, das Hotel läuft gut? Ich habe gehört, dass Sie wohl bald zu den Besten des Landes zählen? Im Sommer ist ja wohl bei Ihnen kein Zimmer zu bekommen? Wo ist denn eigentlich Henri? Ach, Paris–Marseille, das Rennen, ja, das ist ein Spaß, aber nicht für Frauen, das verstehe ich. Und Sie bleiben wirklich nur eine Woche? Das ist schade. Aber wann treffen wir Sie denn dann wenigstens in Paris? Sie waren schon so lange nicht in unserem kleinen Kreis.« Bei all diesen Interessensbekundungen wusste Charlotte, dass die, die so mit ihr sprachen, besser informiert waren, als sie vorgaben zu sein, und eigentlich dachten sie ja: »Warum verkauft sie nicht? Das mit dem Hotel wird ein schlimmes Ende nehmen, und Wein pflanzen, vierzig Hektar? Dazu braucht man Geld, und das hat sie nicht und offensichtlich gibt ihr keiner Kredit. Dann ist es nur noch eine Frage der Zeit. Und ihr Mann ist in Marseille, die Arme. Ja, man kann seinem Schicksal nicht entgehen. Traurig, was aus dieser Familie geworden ist. Man möchte sie umarmen und ihr Mut zusprechen. Aber ein Glück, ihr Vater muss das nicht mehr mit ansehen.«
Das war es, was ihrer Meinung nach in der Gesellschaft über sie gedacht wurde, und alle schienen in ihren Erkundigungen darum bemüht, nicht einmal in die Nähe der Wahrheit zu geraten, ja die Wahrheit war das Einzige, worüber nicht gesprochen wurde. Von der Saubrousse wollte sie jetzt auf keinen Fall gefunden werden. Überhaupt gab es wohl kaum eine Person, die sie sich weniger in ihr Hotel gewünscht hätte. Eine Begegnung mit den Brichots war ihr zum Glück vorerst erspart geblieben. Als sie heute Nachmittag das Hotel betreten hatte, war Monsieur de Brichot an ihr vorbeigegangen, ohne sie zu bemerken. Diese Leute, mit denen ihr Vater und Großvater noch befreundet gewesen war und die wenigstens noch den Anstand besaßen, jegliches Aufeinandertreffen – ohne dabei unhöflich zu werden – zu umgehen, waren ihr immer noch die Liebsten. Es war zu dem Versteckspiel gekommen, vor dem die Violets über Jahrhunderte hinweg sicher gewesen waren. Dass man an ihnen vorbeiging, als hätte man sie nicht erkannt oder gar nicht erst gesehen, beruhte meist auf einer gesteigerten Form des Respekts, der sie davor bewahrte, eben diese unvermeidlichen Fragen stellen zu müssen und so die Gefallenen aus der Gesellschaft immer aufs Neue damit zu konfrontieren, dass sie gefallen waren.
Also, wenn sie derlei unangenehmen Begegnungen entgehen, aber auch nicht in der Suite bleiben wollte, blieb nur der Strand und auch dort nur die dunklen Abschnitte rechts und links vom Hotel, die nicht illuminiert waren. Sie bat Thérèse, zu kommen und vor Alains Zimmer Wache zu halten, und verließ das Hotel über den linken Seitenausgang.
Sie wusste später nicht, ob sie es einen Zufall nennen konnte, dass sie Vincent am Strand traf oder ob es eine Zwangsläufigkeit gewesen war. Auf die Idee, dass er den Strand aufsuchen könne, um dort ein Bier zu trinken, weil er sich die überteuerten Bars der Stadt nicht leisten konnte und vor allem nicht wollte, war Charlotte nicht gekommen, auch wenn ihr Unterbewusstsein sie dorthin geführt haben musste, denn es gab im Palais und auch am Hotelstrand durchaus Verstecke, die allemal geeignet waren, der Saubrousse und den Brichots zu entgehen. Erst als sie Vincent sah, wurde ihr klar, dass sie ihn gesucht hatte.
Wie begegnen sich zwei so unterschiedliche Menschen wie die Comtesse Charlotte Louise de Violet-Hascardin und der Portier Vincent Labotte an einem Strand? Es war so unspektakulär wie rührend.
»Ach, guten Abend Monsieur Labotte, ich hätte gedacht, Sie sind in der Stadt und feiern das Nachtleben«, sagte Charlotte so natürlich wie möglich und Vincent antwortete: »Nein, nein, wenn ich schon einmal am Meer bin, dann bekommt man mich nur schwer davon weg.«
»Das verstehe ich«, erwiderte Charlotte, und sie gingen stumm ein paar Schritte nebeneinander her. Dann blieb sie stehen und sagte: »Es tut mir leid, dass Alain Sie so sehr in Beschlag nimmt, es ist ja nicht Ihre Aufgabe, sich um ihn zu kümmern.«
»Das ist aber kein Problem für mich«, antwortete Vincent. »Ich mache das gern und bin es außerdem gewohnt, meine Schwester ist jünger als ich, und da wurde ich schon recht früh in die Verantwortung genommen. Also, es macht mir wirklich nichts aus, und ansonsten hätte ich ja nichts zu tun, und dann wäre es wohl besser, wenn ich zurückfahren und Sie dann wieder abholen würde.«
»Ach, das wäre ja vollkommen sinnlos, die ganze Strecke zurück und dann wieder hierher, nein, das ist schon gut so, dass Sie hier sind, dann könnten wir auch einmal einen kleinen Ausflug machen. Und Alain freut sich sowieso, dass Sie mitgekommen sind. Vorhin beim Zubettgehen hat er gesagt, dass er schnell einschlafen will, damit die Nacht vergeht, und er morgen wieder mit Ihnen baden kann. Er ist sehr glücklich gerade.«
»Das freut mich«, erwiderte Vincent, der am liebsten gefragt hätte, ob sie denn auch glücklich sei. Aber er tat es nicht und deshalb sagte sie: »Ich habe mich schon sehr lange nicht so wohl gefühlt. Ein Tag am Strand hat eine schöne Ruhe. Und ich liebe das Wasser, also zum Baden ist es mir zu kalt, aber ich liebe, wie es klingt.«
Vincent schmunzelte. »Also meiner Meinung nach ist es nicht kalt. Man muss sich nur daran gewöhnen, und ich denke, Alain würde sich freuen, wenn Sie mit ihm baden gehen würden.«
»Der Körper einer Frau, junger Mann, ist für so etwas nicht geeignet, wir frieren nicht nur im Winter, wir frieren auch im Sommer«, und beinahe hätte sie noch »sogar jetzt friere ich« gesagt. Charlotte spürte eine Veränderung in sich, es war ein Gefühl der Leichtigkeit, als könne sie ihr bisheriges Leben ablegen, ausziehen wie ein Kleid, das man am Strand zurücklässt, weil es einem nicht mehr passt. Sie erfreute sich an ihrem eigenen Übermut, ja, und damals war es wirklich so, dass sie, hätte er sie aufgefordert, mit ihm zu tanzen, sie hätte es getan, am Strand und ohne Musik.
»Waren Sie überhaupt schon einmal in Biarritz?«, fragte sie ihn, als sie sich wieder langsam in Bewegung gesetzt hatten.
»Nein, das konnten wir uns – denke ich – nicht leisten.«
»Ach, das finde ich fürchterlich«, sagte Charlotte, »dass manche Menschen bestimmte Dinge einfach nicht tun können, bloß weil sie nicht genug Geld verdienen. Wenn Sie mich fragen, ich finde das ungerecht, aber ich habe gut reden.«
»So schlimm war es nicht. Ich kann mich, was meine Kindheit betrifft, nicht beklagen. Und dann waren wir ja auch lange in England, und da ging es uns allemal besser als den meisten hier.«
»Was haben Sie denn in England gemacht?«
Dieser seltsame Mensch, der ihr seit über einem Jahr die große Eingangstür aufhielt und ihr in den Wagen hinein und aus ihm heraus half, interessierte sie. Er war ihr ein Phänomen. Sie wusste bei seiner ersten Anstellung nicht einmal, wer er war und was er für Referenzen oder überhaupt welche Ausbildung er hatte, weil er damals von Robert, der zu dieser Zeit noch Weinbergsaufseher war, als Saisonarbeiter in der Rebschule eingestellt wurde. Charlotte hatte Vincent zu dieser Zeit nur selten zu Gesicht bekommen, und wenn sie ihn sah, bewies ihr seine kräftige Statur und Haltung, dass er der richtige Mann für diese Arbeit war. Nach dem großen Frost mussten sie die gesamte Belegschaft des Weingeschäftes entlassen und so verschwand auch Vincent. Wie erstaunt war sie dann, als sich dieser Bauer vor einem Jahr für die Stelle des Portiers bewarb. Charlotte musste, während sie damals sein ordentliches Bewerbungsschreiben in den Händen hielt, unwillkürlich an eine frühere Szene denken, in der dieser Landarbeiter mit sicheren Handgriffen beim Beschlagen eines Pferdes half. Sie konnte sich nicht vorstellen, wie es diesem Menschen, der eben noch die Hufe eines Ackergaules gehalten hatte, jetzt gelingen sollte, einem Gast die Tür zu öffnen und ihn hereinzubitten, geschweige denn, wie er auf eine Frage antworten sollte.
Charlotte und Vincent stiegen die Treppen zur Felsenbrücke hinauf und er erzählte ihr, wie es ihm seit Beginn des Krieges ergangen war.
Die Biografien der Menschen, ob arm oder reich, werden durch einen Krieg durcheinandergebracht, weil er sich in alles einmischt und nichts unberührt lässt, als würde eine übermächtige Hand einen gewaltigen Würfelbecher mit Millionen von Menschen darin schütteln, in die Lüfte heben und irgendwo entfernt der Heimat niedersausen lassen und alle über das Land verstreuen. Der Krieg ist wie eine Krankheit, eine Epidemie, die sich weit vom eigentlichen Epizentrum der Front, hinein in die noch so entlegensten Ecken des Landes ausbreitet. So mussten Vincents Eltern, als die Deutschen das Land überfielen, aufgrund der jüdischen Abstammung seiner Mutter mit ihm und seiner Schwester fliehen, bevor die Krankheit das kleine Dörfchen Verac erreichen würde, in dem sie recht einträglich von den Einkünften einer Parzelle und einer kleinen Weinhandlung gelebt hatten. Sie buchten von Bordeaux aus eine Passage mit einem Frachtschiff, das sie wenigstens über den Kanal bringen sollte und wollten zurückkehren, sobald die Boches wieder vertrieben wären. Aber da der Krieg zu lange dauerte und die Boches nicht vertrieben wurden, blieben sie, wo sie angelandet waren, in England, bei Verwandten von seinem Vater in Surrey. Vincent begann dort eine Ausbildung als Koch, zusätzlich besuchte er die Butlerschule in Ealing, etwas außerhalb von London, was ihm alle Freizeit raubte. Als es drei Jahre später so aussah, dass die Engländer in den Krieg einsteigen würden, brach er sofort seine Lehre ab und er und seine Schwester, die gerade eine Ausbildung zur Hebamme begonnen hatte, meldeten sich freiwillig. Kurz darauf war er einer von den Tausenden, die als Erste in der Normandie anlandeten und eine Chance von eins zu eins hatten, während seine Schwester in einem Militärkrankenhaus auf der Insel versuchte, aus Sterbenden Lebende zu machen. Er kämpfte, wurde verwundet, kam ins Lazarett, wurde gesund, nur eine Narbe sollte ihm bleiben, von einer Wunde, die ihm allerdings, durch das Gesicht hindurch, noch in einem Teil seiner Seele klaffte. Nach dem Krieg schlug er sich lange Zeit als Kohlenschipper und Landarbeiter durch. Da er seine Lehre und die Butlerschule abgebrochen hatte, fand er weder als Koch noch im Hotelgewerbe eine Anstellung, wohingegen die wenigen gesunden Männer, zu denen er gehörte, für jede körperlich schwere Arbeit gesucht und einigermaßen gut bezahlt wurden. Vincent erklärte Charlotte, dass ihm eigentlich jede Arbeit Spaß mache, und dass er sich mit den verschiedensten Tätigkeiten anfreunden konnte. Das hätte ihn außerdem lange Zeit über Wasser gehalten.
Charlotte fragte ihn, weil sie hinter seiner angeblichen Freude an jeder Art von Arbeit eher einen ausgeprägten Zweckoptimismus sah, was er denn im besten Falle tun würde, was die schönste Aufgabe für ihn wäre, und Vincent antwortete zu ihrem Erstaunen: »Ich habe im Krieg zu viel gehofft und gewünscht, ich glaube, ich habe alle Wünsche verbraucht, ich habe das Grauen gesehen und grauenvolle Dinge getan, glauben Sie mir, ich habe keine Wünsche mehr, wenigstens nicht für mich. Ich bin da lebend herausgekommen und ich schäme mich, weil es keinerlei Rechtfertigung für den Tod der anderen oder das Leben für mich gibt.« Er entschuldigte sich augenblicklich, dass es wohl recht pathetisch sei und dass er nicht den Eindruck machen wolle, als müsse man ihn bemitleiden, im Gegenteil. »Der Krieg ist jetzt fünfzehn Jahre her«, sagte er, »und ich bin dankbar, dass ich noch lebe. Aber das ist auch schon alles. Das reicht mir. Sie können das sicher nicht verstehen.«
Er hatte recht, Charlotte verstand es nicht, sie ahnte es nur. Das eine Mysterium erklärte ihr das andere, seine Metamorphose vom Stallburschen zum Portier. Die Stärke, die sie in ihm entdeckt hatte, war also wesentlich tiefgründiger. Sie bewies sich nicht nur in der Aufrechterhaltung einer höflichen und zuvorkommenden Fassade, nein, sie verlieh offensichtlich seinem ganzen Wesen eine generelle Fähigkeit zur Demut und damit wohl auch zu einer besonderen Form von Glück. Sie hatte nicht den Eindruck, dass er ihr etwas vormachte, auch wenn sie das eine oder andere Mal die Vermutung hatte, er wäre ein zu reiner Mensch, ein Mensch, den es eigentlich nicht geben konnte.
Sie standen auf dem Rocher du Basta an der Brüstung zum Meer. Hinter ihnen leuchtete die Stadt und vor ihnen lag über dem schwarzen Atlantik die Nacht, die durch die weiß schäumenden Wellen, die sich draußen an den kleinen Riffs brachen, streifenweise erhellt wurde. Vincent hatte sich auf die Mauer gestützt. Sie sprachen nicht mehr. Charlotte legte ihre weiße Hand auf die seine. Er zog sie nicht zurück. Sie sah sein Gesicht und hatte den Wunsch, ihm die Narbe zu küssen. Ein Glück ist umso größer, je unwahrscheinlicher es ist.
Die Tage in Biarritz waren für Charlotte wie eine Zeit, die nicht zu ihrem Leben gehörte, sie existierte außerhalb von ihr, wie wenn man mit einer Taucherflasche auf dem Grund des Meeres herumläuft und dort Dinge sieht, die man noch nie gesehen hat; sogar den eigenen Atem, dessen kristallene Bläschen einem fremd sind und der einen deutlich fühlen lässt, dass man lebendig ist. Charlotte hatte sich vom ersten Moment an, seit sie auf der Fahrt gesungen hatten, dazu entschlossen, keines ihrer Gefühle zu überwachen und alles zuzulassen, was ihr möglich und unmöglich schien. Sie hatte diese sieben Tage mehr und mehr dazu auserkoren, ihr gesamtes restliches Dasein zu ersetzen. Kurzum, sie hatte beschlossen, sich fallen zu lassen. Und dieses Fallen war dann doch kein Fall, sondern etwas so Reales, etwas, das weit entfernt von einem Traum, einer Träumerei war, dass es sie umso mehr erschreckte, als hätte sie an sich einen zweiten Typus Mensch entdeckt, der in ihr wohnte, eine Gefangene, der man sieben Tage Ausgang gewährt.
Die Abreise stand bevor. Alain weinte wegen irgendeiner Kleinigkeit und Charlotte wusste, er weint, weil er ahnt, dass auch für ihn etwas zu Ende geht, das er nicht wieder erleben würde. Vincent trug die Koffer aus der Suite und als Charlotte ihn so von hinten sah, mit den Koffern in beiden Händen, erkannte sie den Portier, den sie eine Woche lang nicht gesehen hatte und der ihr jetzt fremd war.
Auf der Rückfahrt wurde weder gesungen noch gelacht. Es sind diese schrecklichen Autofahrten, die man einfach nur hinter sich lassen möchte, weil sie einen zurückbringen an die gewöhnlichen Orte des Lebens. So erging es auch der kleinen Reisegesellschaft. Sie sprachen kaum und jeder war in sich selbst versunken. Die Landschaft erschien Charlotte jetzt flach und öde, ab und zu ein Wald, dann wieder, als hätte man mit einem Lineal zwei aufeinanderstoßende Linien gezogen, der Horizont und die Straße. Sie waren schon zwei Stunden gefahren, da erkannte Charlotte, nur aus dem Augenwinkel heraus, einen Wegweiser, der an ihnen vorbeizog.
»Wollen wir noch auf die Düne fahren?«, fragte sie und blickte ihren Sohn dabei an.
»Oh, ja, Mama. Bitte, Mama«, rief Alain begeistert.
»Ja, die ist schön«, warf Thérèse dazwischen. »Wir haben doch noch etwas Zeit. Dann machen wir einen kleinen Abstecher.«
»Wie weit ist es denn?«, fragte Charlotte und schaute Vincent in dem kleinen Rechteck des Spiegels in die Augen: »Nicht weit, eine Viertelstunde«, antwortete er.
»Gut«, sagte Charlotte, »dann ist es beschlossen!«
Sie kehrten um und bogen, dem Wegweiser folgend, Richtung Arcachon ab.
Thérèse und Alain lebten noch einmal, wie schon auf der Hinfahrt, auf und begannen sofort zu singen: »Mardi gras, ne t’en va pas, Je ferai des crêpes. Mardi gras, ne t’en va pas, Je ferai des crêpes et puis voilà.«
Als sie die riesige Düne von Pilat erreicht hatten, parkten sie den Wagen und stiegen die Leitern, die man aufgrund der Steilheit der Hänge auf den Sand gelegt hatte, hinauf auf das Plateau, von dem aus man das Meer mit dem hellen Streifen einer vorgelagerten Düneninsel, die dem Ganzen einen karibischen Anschein verlieh, überblicken konnte. Alain war nicht begeistert. Er wollte an den Strand, der einige hundert Meter entfernt lag.
»Geht ihr nur, ich bleibe hier und warte auf euch«, sagte Charlotte. Alain rannte augenblicklich los und Thérèse hatte Mühe, ihn auf dem zum Meer hin flach abfallenden Hang der Düne einzuholen. Sie rannten davon. Der Sand stieb von ihren Füßen, bis zuerst Alain, dann Thérèse stürzte und sie sich wieder aufrappelten und weiterliefen.
Vincent saß neben Charlotte und beide beobachteten das Geschehen aus der Ferne, wie zwei Großeltern das Spiel ihrer Enkel. Sie sahen, dass Alain Thérèse hinter sich her ins Wasser ziehen wollte und wie sie ihn zurückhielt und mühevoll auszog und wie er sich – ein kleiner, strammer Ringer – befreite, selbst in seine Badehose zwängte und sofort und auf einem Bein in die erste Welle hüpfte. Es war ein trauriger Anblick, so traurig, dass Charlotte die Tränen in den Augen standen und Vincent den Blick vor sich im Sand versenkte. Sie schwiegen eine Weile, dann sagte Charlotte mit fester Stimme: »Es war schön.«
»Ja, das war es«, antwortete Vincent.
»Du weißt, dass es nicht geht?«
»Natürlich.«
»Hast du eine Frage?«
»Nein.«
»Wenn wir traurig sind, dürfen wir es jetzt noch sein, aber nachher ist das nicht mehr von Bedeutung.«
»Ich weiß«, antwortete Vincent, der ihre Hand nahm. Charlotte sah diese beiden Hände, die wie eins waren, wie eine Muschel im Sand.
»Ich verstehe, wenn du uns verlassen willst, das würde ich vollkommen verstehen.«
Vincent schwieg.
»Wenn du bleibst, freue ich mich, was aber nichts zu bedeuten hat. Meine Freude oder meine Trauer sind für dich ab sofort bedeutungslos. Und du musst mir versprechen, dass sie das auch für dich sein werden, nur so wird es gehen. Wenn du mir das versprichst, kannst du bleiben.«
Vincent schwieg noch immer.
»Versprichst du es mir?«
Sie sahen, wie Thérèse Alain in ein Handtuch wickelte und trockenrubbelte. Sie wussten, dass sie gleich zu ihnen kommen und damit entweder das Versprechen oder Vincents Abschied besiegeln würden. Es war nicht mehr viel Zeit. Alain schaute schon zu ihnen nach oben auf die Düne. Es war ein seltsamer Blick, und Charlotte hatte das Gefühl, dass er aus hundert Meter Entfernung wusste, worüber sie sprachen. Noch einmal warf Thérèse das Handtuch über ihn und trocknete seine Haare. Schon hörten sie Alain von Weitem, wie er nach ihnen rief, zuerst nach seiner Mutter und dann nach Vincent, als würde noch irgendein Zusammenhang zwischen ihnen beiden bestehen.
»Ich verspreche es«, sagte er.
Die Düne von Pilat, 1990
Das Gewitter zog heran und verdunkelte die See. Die Sonne war dahinter schon fast untergegangen. Die große Düne von Pilat lag an der Küste wie eine mächtige weiße Frau, und die kleinen Franzosen auf ihr fingen an, hastig ihre Sachen zusammenzusuchen und die langen, schräg auf den Sand gelegten, hölzernen Leitern hinab zu steigen. Sie sprangen in ihre Autos und fuhren davon. Schon zuckten die ersten Blitze ins Meer und der Regen begann.
Ella lag auf der Seite, den Kopf auf ihren Arm gelegt und beobachtete, wie die vereinzelten Tropfen kleine Krater in den Sand schlugen.
»Wir werden vom Blitz getroffen«, sagte sie.
Neben ihr lag René, seine kräftigen Arme hinter dem Kopf verschränkt und schaute hinauf in den Himmel. Ab und zu musste er von den Tropfen, die ihm in die Augen fielen, blinzeln.
Sie wiederholte noch einmal: »Wir werden ganz sicher vom Blitz getroffen.«
Er drehte sich zu ihr, nahm etwas Sand und ließ ihn durch seine Finger auf ihre Schultern rieseln.
»Hörst du, was ich sage. Wir sind die Einzigen hier oben. Das ist doch gefährlich, oder?«
»Ganz unmöglich ist das«, sagte René gelassen.
»Na, ganz unmöglich würde ich nicht sagen«, erwiderte sie und dann er: »Und wenn es passiert, dann will Er uns nicht.«
Zuerst schaute sie ihn fragend an, dann lächelte sie, wandte sich zu ihm um und schmiegte sich an ihn. »Meinst du, Er will uns?«
René drehte sich wieder auf den Rücken und spürte den warmen Regen auf seinem Gesicht. »Wenn Er uns nicht will, wen soll Er dann wollen?«
»Ich glaub auch, dass Er uns will«, sagte sie, schaute ihn von der Seite an und streichelte seine Nase. Dann nahm sie Schwung und rutschte, wie ein Skispringer auf der Schanze, mit zwei Fingern an ihr herunter. »Schhhhhhhhht.« Ihre Hand machte einen weiten Bogen und landete auf seinem nackten Bauch. Sie fuhr etwas aus und kam bei seinem Gürtel zum Stehen.
»Und wie Er uns will.«
Sie öffnete den Gürtel, dann den Knopf seiner Hose. Um sie herum wurde es dunkler. Blitze schlugen ins Land und in die See. Ihre nackten Körper wurden mit zuckenden Lichtern erhellt, und Ella fühlte, dass sie einmalig auf dieser Welt war und sie wusste, dass er sie haben will, so wie sie jetzt gerade waren, ja, als hätte er sie nur für diesen Augenblick gemacht. Dann irgendwann richtete sie sich von René auf, riss die Arme in die Luft und rief laut in die finsteren Wolken hinein: »Eins! Un! Uno!« René nahm sie zurück zu sich, drehte sich auf dem feuchten Sand und war schon über ihr. Von Weitem konnte man durch das Krachen des Donners hindurch Ellas heisere Rufe hören: »Zwei! Deux! Dos!«
Weder Ella noch René hatte bisher den Atlantik gesehen, denn der Eiserne Vorhang, die Mauer, die Ost und West voneinander trennte, war gerade erst gefallen. Es war der Sommer 1990. Ihre erste Reise in die neue Welt führte Ella und René, ohne dass sie darüber hätten lange beraten müssen, nach Frankreich, in das Land ihrer Träume.
Sie wollten nicht, wie viele ihrer Landsleute, den Glanz des goldenen Westens mit seinen neuen Gerüchen, Farben und Geschwindigkeiten bestaunen, nein, sie waren auf der Suche nach einem Frankreich, das es seit über hundert Jahren nicht mehr gab und das sie aus Romanen von Balzac, Flaubert und Maupassant kannten. Sie fuhren in eine neue Welt, um eine alte darin zu finden, und dabei folgten sie ausschließlich ihren romantischen Vorstellungen. Sie hatten in der ersten Woche ihrer Reise vieles erlebt. Sie hatten Drehorgelspieler, denen kleine Äffchen auf der Schulter tanzten, gesehen und mächtige Fische im klaren Wasser der Ardèche. Sie hatten in die großen, goldverspiegelten Fenster der Casinos in Monte Carlo geschaut und nur sich selbst darin erblickt. Sie hatten Saint Tropez, Marseille und Avignon gesehen und die Flamingos, die einbeinig in der salzigen Lauge der Camargue standen. Sie waren bei Sonnenuntergang auf den rot leuchtenden Mauern der Festungsstadt Carcassonne entlanggelaufen, bis die Landschaft vor ihnen im Dunkel verschwand und die letzten Kutschen die Touristen klappernd aus den Toren hinausfuhren. Sie waren quer durch die Pyrenäen gefahren und jetzt hier an der großen Düne, dem herbeigewehten Wüstensand aus Afrika, gelandet. Auch wenn es ihnen nur selten gelang, zu finden, wonach sie suchten, so fühlten sie doch in allem, was ihnen begegnete, den Gewinn dieser anderen, dieser neuen Hälfte der Welt, die jetzt ihnen gehörte.
Das Schloss
Das Gewitter war vorüber. Barfuß, immer schneller werdend, liefen sie die Düne hinunter, bis sie schließlich stürzten und sich nebeneinander, kreischend, hinabrollen ließen. Unten schüttelten sie sich auf allen vieren, wie zwei junge Hunde, den feuchten Sand aus dem Fell und bellten noch dazu. Dann kletterten sie in seinen taubenblauen Wartburg und fuhren, aus den geöffneten Fenstern hinaus jaulend, davon.
Es war fast Mitternacht, als sie die Küste in Richtung Bordeaux verließen. Die Reiseroute quer durch Frankreich war ausschließlich entlang ihrer Lust verlaufen. So hatten sie auch für diesen Abend, wie so oft auf ihrer Reise, noch keine Bleibe. Alles würde sich finden, wie sich für zwei Liebende immer alles und meist noch zum Besten findet.
Die Straße war abgelegen und schlängelte sich durch einen hageren Wald. So sehr der Chopin, den sie von Kassette abspielten, tagsüber aus den Sonnenblumenfeldern und den sanften Hügeln einen ganzen Sommer machte, so tauchte er nun die Nacht draußen, das schwach beleuchtete Innere des Wagens und die beiden selbst in eine fremde Traurigkeit, die ihnen gefiel und nach der sie sich manchmal sehnten.
Nach einer Stunde Fahrt durch diesen sich endlos ziehenden Wald, an vereinzelten Dörfern und Gehöften vorbei, von denen sie nicht wussten, ob sie bewohnt oder verlassen waren, wurde Ella so müde, dass sie immer wieder einnickte und so erschien ihr die Fahrt wie ein Flug durch eine unendliche Nacht, in der sich unter dem ständigen Dröhnen des Motors finstere Täler, dämmrige Hügel und vorbeihuschende Kiefern einander abwechselten. Sie erzählte René wie in Trance von ihrer Kindheit, wie sie mit dem Lada in den Urlaub gefahren waren und dem einzigartigen Geruch im Auto ihrer Eltern. Der Zigarettenrauch des Vaters, das Parfüm der Mutter und der ölgetränkte Lappen zu ihren Füßen hinter dem Fahrersitz, alles vermischte sich zu einem Duft, der für Ella Glück bedeutete. Alles war für sie darin enthalten, ihre Eltern, die Reise und die Entfernung zu der von ihr so verhassten Hauptstadt. Sie erzählte halb schlafend und wie von einem Traum, dass dieser Geruch sie ihr ganzes Leben begleitet hatte, denn die Fahrten waren das Schönste, woran sie sich erinnern konnte. Sehr selten hatte sie ihre Eltern so für sich allein gehabt. Sie konnten ja nicht weg, sie saßen auf ihren Sitzen angeschnallt und Ella konnte sie berühren, wann immer sie wollte, und sie mussten ihr zuhören, ihr antworten, wenn sie mit ihnen sprach, ja manchmal stand sie auf, stellte sich zwischen die Sitze und küsste die Wange der Mutter oder des Vaters. Sie waren eine Familie, nur auf diesen Fahrten waren sie eine Familie, und draußen flogen die Landschaften an ihnen vorbei, so wie jetzt.
»Bitte zünde dir eine Zigarette an«, bat sie René. Und während er aus dem halb geöffneten Fenster hinaus rauchte und die Scheinwerfer den Weg durch die Nacht suchten, lehnte sie sich an ihn und schlief an seiner Schulter ein.
Als Ella aufwachte, stand der Wagen still, der Motor lief noch. Sie beobachtete René dabei, wie er sich nach links und rechts umblickte.
»Was ist? Hast du dich verfahren?«, fragte sie. Die Scheinwerfer erhellten einen schmalen Feldweg vor ihnen, und aus ihrem Beifahrerfenster heraus konnte sie die Reste einer Feldsteinmauer erkennen.
»Verfahren, Liebste, kann man sich nur, wenn man überhaupt weiß, wo man hinwill. Die Straße ist hier zu Ende«, sagte René, legte den Gang ein, schaute sich nach hinten um und fuhr einige Meter zurück. »Hier soll irgendwo ein Hotel sein. Aber das war wohl nichts. Stockfinster ist das hier. Wenn du was siehst, schreist du.«
Er musste mit dem Wagen ein ganzes Stück zurücksetzen, denn der Weg war so schmal, dass man auf ihm nicht wenden konnte. Er befürchtete schon, dass er bis zur Hauptstraße zurückfahren musste, da entdeckte er eine kleine Einfahrt, die er offensichtlich vorher übersehen hatte. Im selben Moment erfüllte das Innere des Wagens, wie das jähe Anfahren einer Stahlsäge, ein gellender Schrei. Er sah noch in Ellas entstelltes Gesicht und trat so sehr auf die Bremse, dass sie beide in die Sitze geworfen wurden. Als der Wagen stillstand, stieg eine feine Staubwolke an den Scheiben auf.
»Mann, hast du mich erschreckt. Was ist denn?«
»Ich sollte doch schreien, wenn ich was sehe. Und hier ist was.«
»Du bringst mich noch um!«
Ella beugte sich zu ihm, sagte leise »Entschuldigung« und küsste ihn auf die Wange. Dann klappte sie das Handschuhfach auf, nahm eine Taschenlampe heraus und leuchtete nach draußen auf ein altes Emailleschild, dessen gusseiserne Einfassung verrottet war. Sie las vor: »Château Violet.« Darunter stand groß und mit blassblauer Farbe »Hôtel«. Die vier verblichenen roten Sterne darüber waren kaum zu erkennen. Erst jetzt bemerkten die beiden die von dem Weg etwas zurückgesetzten Überreste eines Portals und dazwischen einen schmalen Weg, der in das Dunkel eines Waldes oder Parks führte. Das verrostete Gittertor stand offen und war fast vollständig von wildem Wein überwuchert.
»Na dann mal los«, sagte Ella kurz entschlossen. René, dessen Herz sich von Ellas Aufschrei noch nicht erholt hatte und immer noch heftig schlug, hielt diese Unternehmung für vollkommen sinnlos.
»Liebste, seit einer halben Stunde ist uns keiner entgegengekommen, das ist eine Sackgasse«, sagte er.
»Ach, ich bin müde«, widersprach Ella. »Nun mach schon. Wir werden ja sehen. Und wenn das Château da eine Ruine ist, bauen wir daneben unser Zelt auf. Nun biegen Sie schon ab, Sie Kretin!«
René lenkte den Wagen herum in die Einfahrt. Sie fuhren auf einem links und rechts mit Sträuchern zugewachsenen Kiesweg. Über ihnen schlossen sich die Baumkronen, sodass sie jetzt wie durch einen Tunnel fuhren. Dann verschwanden die Sträucher, das Blätterdach wurde lichter, und Ella konnte aus ihrem Fenster heraus die Sterne sehen. René hielt den Wagen an.
»Also, da ist nichts«, sagte er, schon etwas gereizt. »Lass uns umdrehen.«
Doch Ella wollte noch nicht aufgeben und sagte, er solle doch einmal das Licht ausmachen. René schaltete die Scheinwerfer ab und tatsächlich, nachdem sich ihre Augen etwas an die Dunkelheit gewöhnt hatten, sahen sie in der Ferne auf einer Anhöhe ein schwaches, flackerndes Lämpchen.
»Siehst du«, sagte Ella, und dann sang sie: »Ein Licht, ein Licht, ein Licht, das brennt.«
Sie fuhren um einen Hügel herum, und dann erkannten sie eine einzelne Laterne vor dem Eingang eines mächtigen Gebäudes. Je näher sie kamen, umso klarer wurden die Konturen eines Schlosses, das sich mit seinen beiden Türmen schwarz gegen den nächtlichen Himmel vor ihnen erhob. René fuhr im Schritttempo auf den kleinen runden Platz vor das Haus, und sie hörten das leise Knacken der Kiesel unter den Rädern. Er stoppte den Wagen und schaltete den Motor aus. Die beiden saßen ganz unschlüssig, ob sie nun aussteigen sollten oder nicht, stumm nebeneinander und betrachteten durch die Frontscheibe den imposanten Bau. Erst jetzt bemerkten sie hinter einem der unteren Fenster ein zweites, schwach grünes Licht.
»Ist wohl doch jemand da«, sagte Ella.
»Das kostet ein Vermögen, so viel ist mal klar«, sagte René. »Wahrscheinlich kommt gleich jemand und schießt uns über den Haufen. Die schlafen doch sicher schon.«
»Irgendwie romantisch«, sagte Ella. »Wie viel Geld haben wir noch?«
»Auf jeden Fall nicht genug für so was hier«, entgegnete René.
Sie schlug ihm mit der flachen Hand auf den Oberschenkel, was sie sehr gern tat, um ihn zu necken und sagte: »Ich klingle mal und du wartest hier und lässt den Motor laufen. O. k.?« René lachte, als sie ausstieg, und dann stieg auch er gähnend aus und folgte ihr. Sie liefen Hand in Hand über den Vorplatz, stiegen drei Stufen zum Eingangsportal hinauf und blieben zunächst unschlüssig davor stehen. Sie lauschten an der wuchtigen Tür. Noch bevor René die Chance hatte, mit Ella irgendeine Art Strategie zu besprechen, drückte sie schon einen großen silbernen Knopf in die Schale einer steinernen Muschel. Die Klingel schlug leise, wie eine Spieluhr, irgendwo tief im Inneren des alten Hauses an. Es dauerte sehr lange, bis sich drinnen etwas regte. Schritte näherten sich. Ein Schlüssel drehte sich mit lautem Klacken. Die rechte Hälfte der riesigen Flügeltür öffnete sich einen Spalt und ein großer Mann tauchte im Halbschatten der Laterne vor ihnen auf. Sie konnten sein Gesicht nicht genau erkennen. Die Stimme des Mannes war sanft und tief. Er fragte die beiden etwas auf Französisch, doch sie verstanden ihn nicht, obwohl er sehr deutlich sprach. Ella schickte René mit einem kurzen Stoß gegen seinen Ellenbogen vor, und der erklärte umständlich, dass sie ein Zimmer suchten und fragen wollten, was es kostet, wenn es nicht sowieso schon zu spät dafür wäre.
Der Mann beugte sich nach vorn und sein Gesicht tauchte in das Licht der Laterne. Ein altes Adlergesicht mit dunklen, fast schwarzen Augen, die René ruhig musterten. Er schaute die beiden an und bat sie um einen Moment Geduld, er müsse erst nachsehen gehen. Daraufhin zog er seinen Kopf zurück und schloss die Tür, bevor die beiden noch einmal nach dem Preis fragen konnten.
Sie schauten sich an, zuckten mit den Schultern und lachten. »Das wird nichts«, sagte René. Doch Ella schlang ihre Arme um seinen Hals, sagte »Damit du dich nicht langweilst« und küsste ihn fest auf den Mund. Als hätten sie sich abgesprochen, versuchten sie, den Kuss bis zur Rückkehr des Alten auszukosten, doch es mochten schon an die zehn Minuten vergangen sein, da löste sich Ella von René und sagte: »Das ist nicht fair. Wo bleibt er denn?« René hielt sein rechtes Ohr an die Tür und horchte. »Ich glaub, er kommt.«
Tatsächlich öffnete sich kurz darauf der rechte Flügel der Tür, wobei der Diener sie diesmal ganz aufschlug, als wolle er sie bitten, hereinzukommen. Er erklärte ihnen, und er sprach langsam und deutlich, dass er ihnen ein Zimmer in der bel étage mit Balkon und Blick auf den Park anbieten könne. René bedankte und entschuldigte sich für die späte Störung, aber er glaube nicht, dass sie sich ein solches Zimmer in so einem Haus leisten könnten. Sie würden schon etwas anderes finden oder irgendwo ihr Zelt aufschlagen.
Doch der Diener fragte, als hätte er nicht zugehört: »Wo kommen Sie denn her? Deutschland?«
Dabei tauchte sein Gesicht wieder im Schein der Lampe auf. Seine kräftige Nase und die schmale Narbe, die unter seinem Auge verlief, als hätte ihn ein Komet gestreift, verlieh ihm etwas Verwegenes; etwas, das sich kaum mit seiner steifen und höflichen Art vereinen ließ.
»Aus der DDR. Also, ja, aus Deutschland«, antwortete René.
Scheinbar ohne jeden Zusammenhang fragte der Alte, wie viel sie denn für ein Zimmer ausgeben würden. Das Paar wechselte kurz überraschte Blicke, dann sagte René, dass er das nicht wüsste, dass es bisher immer unterschiedlich gewesen sei und sie sowieso meistens gezeltet hätten. Die beiden hatten ihre gesamten Ersparnisse, alles, was sie an Ostmark entbehren konnten, für diesen Urlaub in Francs umgetauscht, und davon war nicht mehr viel übrig. Also jetzt in so einem Hotel zu übernachten, kam René vollkommen unsinnig vor. Es schien ihm unmöglich, irgendeine Zahl zu nennen. Er wusste, dass – egal, was er sagen würde – es auf jeden Fall zu wenig wäre. Also sagte er, weil sie sich das gerade noch leisten konnten: »So zwischen achtzig und einhundertzwanzig Francs«, und fügte noch hinzu: »Aber das wird ja sicher nicht reichen.«
Einen Augenblick schien der Diener darüber nachzudenken, dann sagte er kurz entschlossen: »Gut. Sie könnten sich das Zimmer anschauen und wenn es Ihnen gefällt, können Sie es für hundertzwanzig Francs bekommen.«
Ella schaute abwechselnd den Diener und René an. Der fasste sich, sagte: »Gut, wir nehmen das Zimmer«, und spielte ihr den Millionär vor, den er auf ihrer Reise schon einige Male unter ihrer Anleitung geübt hatte. Er reichte ihr dazu seinen Arm, den er übertrieben im rechten Winkel vom Körper abspreizte und sagte: »Nach Ihnen, Madame.«
Für die beiden war es ein Zeichen von Luxus gewesen, wenn ein Hotel Sterne hatte – und nun sogar ein Schloss mit Dienerschaft und allem Prunk, der sich denken ließ. René bat den Alten, mit leicht gehobener Stimme und Ella zuzwinkernd, ihnen jetzt das Zimmer zu zeigen; schon wollte er über die Schwelle treten, da blieb der Diener unbeweglich hinter dem Spalt stehen. Während René nun unbequem auf der obersten Stufe dicht an der Tür stand, sagte der Alte, dass es eine Bedingung gäbe, eine kleine Einschränkung. Sie müssten das Zimmer, vorausgesetzt es gefiele ihnen, für zwei Nächte mieten. Er sagte noch einmal, und dies kam den beiden seltsam vor: »Wenn es Ihnen keine Umstände macht, für zwei Nächte zu bleiben, kann ich Ihnen die Suite jetzt zeigen.« Dann fügte er noch hinzu, da diese Nacht ja schon beinahe vorbei sei, müssten sie auch nur eine Nacht zahlen.
René schaute Ella an, die ihre Freude nicht mehr zu verbergen suchte, dann sagte er, dass sie sich ja am kommenden Tag die Gegend etwas anschauen könnten, und es kam ihm in diesem Moment wirklich so vor, als würden sie am nächsten Morgen mit ihrem Rolls Royce und offenem Verdeck durch die Sommerhügel fahren und ein Picknick machen an einem kühlen, steinigen Fluss. Als sich der Flügel der Tür jetzt ganz öffnete und die beiden in die Eingangshalle traten, fassten sie sich wie zwei vorfreudige Kinder fest bei den Händen. Eine kleine Tischlampe neben der Tür spendete das karge grüne Licht und überließ die große quadratische Eingangshalle einer schattenhaften Dunkelheit. Sie folgten dem Diener wie in einen Traum, quer durch die Halle, über einen Mosaikfußboden, der in einem seltsam verschachtelten Rhythmus aus kleinen und großen Würfeln in alle Ecken und hinter die weit geschwungene steinerne Treppe, die in die obere Etage führte, verschwand. Sie passierten einen ovalen Tisch, auf dessen dunkler Platte eine Vase mit einem ausladenden Blumenstrauß stand, dessen Farben in dem halben Licht allerdings untergegangen waren und der das ganze Haus durch seine fahle und tote Erscheinung in eine düstere Melancholie tauchte. Ella kniff René mit ihren Fingerspitzen in den Handrücken und er wusste, dass sie begeistert war.
Sie liefen dem Diener stumm und unauffällig hinterher, scheuten jeden ihrer Tritte auf dem schallenden Marmorboden, denn sie fürchteten, der Alte könne es sich anders überlegen und sie doch noch wegschicken. Es schien keine Rezeption zu geben. Lediglich ein altes Klavier an der Wand am Fuß der Treppe diente als Schlüsselaufbewahrung. Der Diener klappte den Deckel nach oben: Dort, wo die Elfenbeintasten hätten sein müssen, lagen Dutzende von silbernen und goldenen Schlüsseln, alle in unterschiedlicher Größe und Form. An ihnen hing je ein kleines Schildchen mit eingeprägter Nummer. Er nahm einen besonders großen und abgenutzten Schlüssel aus der Mitte heraus, klappte den Deckel wieder zu und ging, sie auffordernd ihm zu folgen, die breite Treppe ins Obergeschoss hinauf.
Die Augen einer feinen Dame in blauem Gewand folgten ihnen und dann, aus einem prunkvollen goldenen Rahmen heraus, ein schicker Herr mit einem Strohhut. Noch nicht ganz oben angekommen, blieb der Diener stehen.
»Vorsicht hier«, sagte er und führte die beiden an einer schadhaften Stufe, deren rechte Hälfte am Rand abgebrochen war, vorbei, und dann standen sie am oberen Absatz der Treppe. Ein Gang mit einem schon etwas zerschlissenen Läufer verlief sich auf beiden Seiten im Dunkel.
Der Diener ging geradeaus auf eine hohe Flügeltür zu, steckte den Schlüssel hinein und drehte ihn. Der schwere Schlag des Schlosses hallte im Haus wider. Als er die Tür zur Suite geöffnet hatte und sich nach seinem kurzen Verschwinden das große, ovale Zimmer wie ein Bühnenbild erhellte, verschlug es den beiden Liebenden die Sprache. Ella konnte ihre Begeisterung nicht im Zaum halten. Sie juchzte laut auf und umarmte René heftig, der nur zögernd in ihr Lachen einstimmte. Er versuchte noch, dem Diener gegenüber Haltung zu bewahren, doch das gelang ihm nicht, denn Ella wiegte sich schon in seinen Armen und zwang ihn in eine Art Tanz. Dann fragte sie, während sie sich beide schon auf dem Parkett drehten, laut in den Raum hinein: »Ist das Napoleons Zimmer? Hat hier Napoleon geschlafen?«
René konnte über Ellas Schulter hinweg den Diener sehen und beobachten, wie er leise lächelte: »Nein, das nicht. Napoleon nicht«, sagte er. Dann verschwand das Lächeln und mündete in sein grundernstes Willkommensgesicht. Er fragte: »Wann möchten Sie morgen frühstücken?«
René schaute Ella an, die lachte und rief: »Um zehn.«
»Sehr wohl«, antwortete der Diener. »Soll ich Ihnen noch mit Ihrem Gepäck helfen?«
René schüttelte den Kopf, verneinte kurz und bedankte sich. Auch Ella rief dem Alten ein überschwängliches »Dankeschön!« und »Vielen Dank!« zu.
Der Diener entfernte sich unauffällig, sagte noch, während er langsam die Tür zur Suite zuzog: »Sie können sich morgen in unser Buch eintragen und das Finanzielle mit Madame klären. Gute Nacht.« Dann war er verschwunden.
Diem non perdidi
Ella hatte sich von René losgerissen und war jetzt vollends aus dem Häuschen. Sie warf die Arme in die Luft und zog René wieder zu sich. »Komm her, mein Kretin.«
Sie tanzten durch den Raum, zogen sich noch halb im Drehen gegenseitig aus und warfen sich nackt aufs große Bett und in die weichen Kissen. Ella sprang unvermittelt auf, stürzte sich auf René, und sie rollten sich hin und her, von der einen Ecke des Bettes zur anderen und wurden über diese Rauferei ganz müde. Bald lagen sie still da, bestaunten sich selbst und die prunkvolle Epoche, in die sie geraten waren.
»Diem non perdidi«, las Ella von einer in den Stuck über der Tür eingelassenen Tafel ab. Sie hatten beide Latein in der erweiterten Oberschule gehabt, aber die Bedeutung wollte ihnen nicht einfallen. Lediglich an den »Tag« und das bekannte »Carpe diem« konnten sie sich erinnern und so rätselten sie eine Weile und beschlossen dann, dass es heißen müsse: »Tag ohne Wiederkehr«. Auch wenn sie sich nicht sicher waren, spürten sie, wie sehr die Worte zu den Erlebnissen dieses Nachmittages und dem Schloss, das ihnen wie eine Illusion vorkam, passten. Ihr Zimmer roch nach dem alten Holz der mit Weinranken bemalten Wandvertäfelung, und ab und zu streifte die beiden ein kühler Hauch von Lavendel und Rosen, der durch die geöffneten Fenster hereinwehte. Draußen rieb sich eine Grille die Flügel und ein Hund jaulte unterdrückt, wohl in einem der Pferdeställe. Ein ferner, dumpfer Schlag ging durch das Haus, als fiele irgendwo in einem der Flügel des Schlosses eine Tür zu. René und Ella verkrochen sich unter die dünnen, seidigen Bettlaken und hörten ihr leises Rascheln.
»Ich glaube, wir sind jetzt allein«, flüsterte sie. »Man hat uns hier vergessen. Wäre das nicht schön? Wir reisen von einer alten Zeit in die andere.« Sie streckte ihren nackten, schlanken Arm unter dem Laken hervor und zeigte auf die farbigen Fresken, die das gesamte Oval der Decke einnahmen, und ihre weiße Hand schien den glänzenden Schild des Zeus zu berühren, der dort oben saß, mitten im Himmel, über allem, die kräftigen Arme auf eine hellblaue Wolke gestützt. »Ich hasse die Elektrotechnik«, sagte Ella leise und ihr Finger wanderte, dem Blick des Gottes folgend, hinunter zu den Greifvögeln, die unter ihm kreisten. Dann von ihrem spähenden Flug tiefer zum Rand der gewölbten Decke. Dort saßen kleine, bunte Vögel auf eisernen Stangen, und zwischen ihnen öffnete ein Kranich sein schwarz-weißes Gefieder.
»Ich hasse Plaste«, sagte sie und schmiegte sich eng an René.
»Das heißt Plastik«, sagte er. »Soll ich unsere Sachen noch aus dem Auto holen?«
»Ach, du Klotz …« Sie schlug ihm mit der Faust in die Seite. »Nein, jetzt nicht. Wir liegen grad so schön. Morgen putzen wir dann Zähne, ja?«
»Wie Sie wollen, Mademoiselle, wenn Sie es befehlen, wird im ganzen Reich kein Zahn geputzt.«
Ein untrügliches Zeichen der Liebe ist wohl, dass es den Liebenden möglich ist, einander anzuschauen, ohne auch nur in die geringste Verlegenheit zu geraten. Ihr Blick ist dann gespannt und voller Freude, als zeige das Gesicht des anderen das eigene Glück und steigere es dadurch ins schier Unmögliche. So spiegeln zwei sich ihre Liebe hin und her, so lange, bis sich kaum ein Unterschied zwischen ihnen ausmachen lässt, als wären sie ein neu geschaffenes Wesen, als wären sie die Schönheit selbst.
Als René Ella das erste Mal gesehen hatte, konnte er nicht glauben, dass es ein Mädchen wie sie gab, ein Mädchen, das ihm vom ersten Augenblick an wie von einer anderen Sorte schien, und als er später seinem besten Freund dieses Mädchen beschreiben wollte, musste er nach einigen unzureichenden Versuchen aufgeben. Sie war nicht zu beschreiben, bis auf eine offensichtliche Eigenart, dass sie lebendiger war, und damit meinte er nicht überdrehter als die anderen, nein, ihr ganzes Wesen war lebendig und schien mit allen Sinnen die Welt abzuschmecken. Was er seinem Freund sagen wollte, war, dass nicht ihre äußerliche, körperliche Schönheit ihm sofort aufgefallen sei, sondern – ach, wenn er es doch nur besser erklären könnte – ihre innere Schönheit, welche die äußere überstrahlte.
Jetzt schauten sich Ella und René in die Augen, die, als hätten sie sich zu einer gemeinsamen Farbe vermischt, blau und einander ähnlich waren. Sie schauten sich jetzt an, um wie so oft herauszufinden, wer dieser Mensch denn eigentlich ist, den sie so sehr liebten.
René konnte Ellas Augen nur selten betrachten, denn in der Zeit, die sie bisher zusammen waren, wenn sie sich unterhielten oder Ella mit jemand anderem sprach oder sie einfach nur irgendwo stand und ihm zuzwinkerte, so war es ihr Mund gewesen, der alle Aufmerksamkeit auf sich zog. Ihr Mund war groß und schön, von frecher Eleganz. Die regelmäßigen Zähne, alle zu sehen, wenn sie lachte, weiß wie Schnee. Ihre vollen Lippen, deren feine Ränder sich ein wenig wölbten und für René das Schönste und auch Begehrenswerteste an ihr waren, und – wenn Ella lächelte – noch unterstützt wurden durch ein längliches Grübchen im linken Mundwinkel, weckten dann in ihm unweigerlich das Verlangen, sie zu küssen oder vorsichtig zu berühren, wie man die zarten Blätter einer Blüte berührt, immer noch und immer wieder voll Erstaunen darüber, dass sie tatsächlich echt und erreichbar für ihn waren. Wenn sie weinte und sich ihre Tränen an dem zarten Rand ihrer Lippen, wie in einer kleinen Senke, sammelten, dann schmiegte er seine Wange an die ihre und kostete ihre salzig-süße Traurigkeit.
René hingegen war auf eine andere, plumpere Weise schön. Er gehörte zu den Menschen, die nicht wissen, dass sie attraktiv und begehrenswert für andere sind. An seiner äußeren Schönheit änderte auch sein Oberlippenbart, ein Überbleibsel seiner Kennung als bereits entlassener Soldat, nichts. Im Gegenteil, Ella mochte dieses eigenartige Zubehör, das genau genommen nicht zu seinem griechischen Kopf mit der starken, etwas breiten Nase und dem schmalen Mund, seiner blass-zarten Haut, den blonden schulterlangen Haaren und schon gar nicht zu den Sommersprossen, die wiederum Ella besonders an ihm mochte und die ihm das Aussehen eines kleinen Jungen gaben, passte. Aber vielleicht mochte sie diesen beinahe blonden Schnauzer gerade deswegen. Am liebsten, so auch jetzt, fuhr sie zärtlich mit ihrem Zeigefinger, einmal rechts, einmal links, über seine »Feder«, wie sie es nannte.
Renés Körper war der eines Schwimmers, auch wenn das Schwimmen nicht seine Sache war. Er war nicht viel größer als Ella, doch seine muskulösen Schultern, Arme, Oberschenkel gaben ihm den Anschein, als könne er seine Freundin und eigentlich jeden anderen auch mühelos in die Höhe heben. Früher, während seiner Schulzeit und auch bei der Armee, musste er sich nie Gedanken darüber machen, wie man einer Prügelei aus dem Wege geht. Die anderen Jungen waren ihm aus dem Weg gegangen, ohne dass er es bemerkt hätte. Und so war es auch mit seinem Körper, nie hatte er auch nur einen Gedanken an ihn verschwendet, er selbst nahm ihn nicht wahr, nicht einmal als ein Geschenk konnte er ihn begreifen. Als Ella ihn zum ersten Mal nackt gesehen hatte, war sie begeistert. Sie hatte gesagt, er sehe zwar nicht aus wie ein Gladiator, dafür wäre er zu klein, aber sein fester Körper fühle sich an, als könne ihm nichts zustoßen, als würde alles von ihm abprallen, eine noch so spitze Lanze oder der Kugelhagel eines Maschinengewehrs. Dann fasste sie seinen Oberarm und er musste ihn anspannen, und sie liebte es, wenn er das tat, und es erregte ihn, wenn sie mit ihrer zarten Hand seinen Muskel fühlte.
René griff neben dem zusammengebundenen Bettvorhang nach dem Schalter aus Porzellan und drehte ihn. Klack. Das goldene Licht des Kronleuchters erlosch und wich den weichen Schatten des Mondes auf dem Parkett und den Möbeln. Im Schloss war es still, nur ab und zu vernahmen die beiden, die nebeneinander, ihre Hände haltend, unter dem feinen Tuch lagen und hinaus in die Nacht hörten, das dumpfe Schlagen, und sie stellten sich vor, wie in einem der anderen Zimmer der große Kaiser, erschöpft von der Schlacht, mit letzten Kräften über seine Mätresse herfällt. Eine Weile sprachen sie nicht. René spürte eine seltsame Spannung im Raum, aber er war zu müde, um ihr nachzugehen.
Plötzlich fragte Ella: »Wie lange sind wir jetzt zusammen?« Sie klang verändert – war sie traurig? Ja, René war sich sicher, dass sie traurig war. Er kannte diese Stimmungswechsel von ihr, es konnte innerhalb einer Minute geschehen, dass sie eben noch lachte oder einen ihrer Witze losließ und einen Moment später in Tränen aufgelöst vor ihm stand.
Er sagte leise: »Über ein halbes Jahr. Wieso?«
»Ach, nur so«, erwiderte Ella.
»Was ist, bist du traurig?«
»Nein, nein, schon gut.«
Da René dachte, dass er sich geirrt hatte, wobei er es mehr hoffte, als er es wusste, gab er Ella einen Kuss und sagte: »Schlaf gut, mein liebes Lottchen.« Er schmiegte sich eng an sie, doch sie lag immer noch auf dem Rücken und schien an die Decke zu starren. Im Halbdunkel sah er die Silhouette ihres schönen Gesichts, ihre leicht geschwungene Nase, die Konturen ihrer feinen Lippen, die langen Wimpern, die, wie die Flügel eines schwarzen Falters, langsam auf- und zuschlugen.
»Wenn du das so sagst: ›Über ein halbes Jahr‹, dann könnten es auch zehn sein.«
René zuckte zusammen. Er dachte, er hätte schon kurz geschlafen, er musste sich ihre Frage noch einmal wiederholen, und als er verstanden hatte, dass es eigentlich keine Frage war, erwiderte er: »Und, wäre das so schlimm?«
»Ja, natürlich wäre das schlimm. Ich finde, so wie es gerade ist, ist es wunderschön, es gibt nichts Schöneres. Es ist so neu und frisch.«
Ihre Stimme klang müde und hoffnungslos.
»Und das ist in zehn Jahren nicht mehr so?«
»Nein, natürlich nicht. René, nein, das ist in zehn Jahren niemals so wie jetzt.«
»Dann wird es halt anders sein.«
»Ja, aber es soll nie anders sein. Du hast gesagt, dass Er uns haben will, heute auf der Düne, so wie wir jetzt sind. Hast du das ernst gemeint?«
»Natürlich«, sagte René.