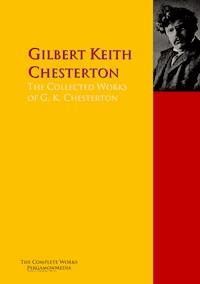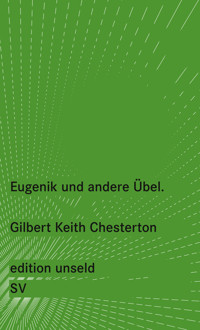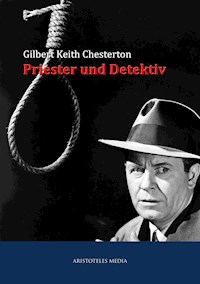14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: AB - Die Andere Bibliothek
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Andere Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Cape und zerdrückter Hut, Stockdegen und Zigarre.*Er war ein Mann mit Stil.*Und natürlich exzentrisch.*In den letzten Monaten seines Lebens veröffentlichte Gilbert Keith Chesterton monatlich eine Kriminalnovelle im »Storyteller« – ihr Held ist ein seltsamer Regierungsbeamter namens Mr. Pond.*Die Sammlung dieser acht scharfsinnigen Geschichten »Die Paradoxe des Mr. Pond« erschien erst ein Jahr nach Chestertons Tod. Es ist sein letzter literarischer Coup und wir wissen: nur in schlechten Detektivgeschichten ist die Lösung materieller Natur.*Ein Jahrzehnt zuvor erschienen die »Geschichten vom überspannten Bogen« mit Helden, die in bizarre Abenteuer geraten; geschrieben mit diebischer Freude am Paradoxen, Märchenhaften und Surrealen, handelt doch jede Geschichte vom Umsetzen eines englischen Sprichworts in die Wirklichkeit – und Unmögliches wird möglich.*Nun sind diese unmöglichen Geschichten nach bald neunzig Jahren endlich ins Deutsche übertragen worden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 629
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Gilbert Keith Chesterton
Die Paradoxe des Mr.Pond und andere Überspanntheiten
Deutsch von Boris Greff und Matthias Marx
Nachwort von Matthias Marx
ISBN 978-3-8477-5332-2
© für die deutschsprachige Ausgabe:
AB – Die Andere Bibliothek GmbH & Co. KG, Berlin www.die-andere-bibliothek.de
Die Originalausgabe erschien im Jahr 1937 unter dem Titel The Paradoxes of Mr. Pond.
Die Paradoxe des Mr. Pond und andere Überspanntheiten von Gilbert Keith Chesterton ist August 2012 als dreihundertzweiunddreißigster Band der Anderen Bibliothek erschienen.
Die limitierte gedruckte Ausgabe ist erhältlich im Abonnement ab-abo.de oder als Einzelband unter:
http://www.die-andere-bibliothek.de/Originalausgaben/Die-Paradoxe-des-Mr-Pond-und-andere-Ueberspanntheiten::411.htmlhttp://www.die-andere-bibliothek.de/Originalausgaben/Zwischen-den-Zeiten::648.html
Übersetzung: Boris Greff und Matthias Marx
Covergestaltung: Cornelia Feyll und Friedrich Forssman
Herausgabe: Christian Döring
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.
E-Book Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, www.le-tex.de
Umsetzung und Vertrieb des E-Book erfolgt über:
Inhaltsübersicht
Impressum
DIE ANDERE BIBLIOTHEK
DIE PARADOXE DES MR.POND
Die drei Reiter der Apokalypse
Das Verbrechen von Captain Gahagan
Wenn Ärzte einer Meinung sind
Pond als Pantalone
Der unnennbare Mann
Der Ring der Liebenden
Der Schreckliche Troubadour
Eine große Geschichte
GESCHICHTEN VOM ÜBERSPANNTEN BOGEN
Das untragbare Erscheinungsbild des Colonel Crane
Der unwahrscheinliche Erfolg von Mr.Owen Hood
Der unaufdringliche Verkehr von Captain Pierce
Der trügerische Gefährte des Pfarrers White
Der exklusive Luxus des Enoch Oates
Die unvorstellbare Theorie des Professor Green
Die beispiellose Architektur des Commander Blair
Das letzte Ultimatum der Liga vom Überspannten Bogen
Anmerkungen
Nachwort
DIE ANDERE BIBLIOTHEK
Die 1984 von Hans Magnus Enzensberger und dem Verleger und Buchgestalter Franz Greno begründete Buchreihe DIE ANDERE BIBLIOTHEK ist längst zum Bestandteil unserer deutschsprachigen Lesekultur geworden. Monat für Monat ist seit Januar 1985 ein Band erschienen – »Gepriesen und geliebt« (Frankfurter Allgemeine Zeitung). An dem Anspruch, intellektuelles und visuelles Vergnügen zu verbinden, hat sich bis zum heutigen Tag nichts geändert:
DIE ANDERE BIBLIOTHEK ist die »schönste Buchreihe der Welt« (Die Zeit).
Seit Januar 2011 wählt der Herausgeber Christian Döring monatlich sein Buch aus und gibt es im Verlag DIE ANDERE BIBLIOTHEK unter dem Dach des Aufbau Hauses am Berliner Moritzplatz heraus. In Haltung, Gestaltung und Programm hat sich am Anspruch seit drei Jahrzehnten nichts geändert: »Wir drucken nur Bücher, die wir selber lesen möchten.«
Das Programm der ANDEREN BIBLIOTHEK folgt inhaltlich seit Anbeginn nur einem Maßstab: Genre-, epochen- und kulturraumübergreifend wird entdeckt und wiederentdeckt, die branchenübliche Einteilung in Sachbuch und Literatur hat nie interessiert, der Klassiker zählt so viel wie die Neuerscheinung. Es gilt der »Kanon der Kanonlosigkeit«, nur Originalität und Qualität sollen zählen.
– Jeden Monat erscheint ein neuer Band, von den besten Buchkünstlern gestaltet.
– Die Originalausgabe erscheint in einer Auflage von 4.444 Exemplaren – limitiert und nummeriert.
– Werden Sie Abonnent, so erhalten Sie jede Originalausgabe garantiert und zum Vorzugspreis.
Die Mindestlaufzeit des Abos beträgt ein Jahr (zwölf Bände), danach können Sie jederzeit kündigen. Als persönliches Dankeschön erhalten Sie eine exklusive Abo-Prämie.
Bitte informieren Sie sich bei Ihrem Buchhändler oder direkt bei uns:
DIE ANDERE BIBLIOTHEK
030 / 639 66 26 90 oder 030 / 28 394–227
www.die-andere-bibliothek.de
www.ab-abo.de
DIE PARADOXE DES MR.POND
DIE DREI REITER DER APOKALYPSE
Der seltsame und bisweilen unheimliche Eindruck, den Mr.Pond trotz seiner allseits bekannten Höflichkeit und seiner gepflegten Manieren auf mich machte, war möglicherweise mit irgendwelchen Kindheitserinnerungen verknüpft und der vagen Assoziation, die sein Nachname hervorrief. Er war Regierungsbeamter und ein alter Freund meines Vaters; ich nehme an, daß meine kindliche Phantasie irgendwie den Namen von Mr.Pond mit dem Fischteich im Garten in Zusammenhang gebracht hatte. Wenn man genau darüber nachdachte, war er kurioserweise einem Gartenteich nicht unähnlich. Er war unter normalen Umständen genauso ruhig, gleichermaßen klar geformt und in gewisser Weise ebenso glänzend in seinen alltäglichen Reflexionen, wenn es um Himmel, Erde und das gewöhnliche Tageslicht ging. Und doch: ich wußte, daß es einige wunderliche Dinge im Gartenteich gab. In einem von hundert Fällen, etwa an einem oder zwei Tagen im Jahr, sah der Fischteich sonderbar anders aus: ein Schatten huschte vorbei, oder etwas blitzte auf unter seiner glatten, gelassenen Oberfläche, und ein Fisch, ein Frosch oder eine andere, noch groteskere Kreatur streckte den Kopf in den Himmel. Ich wußte, daß auch in Mr.Pond Monströses existierte: es gab Monster in seinen Gedanken, die nur einen Moment lang an die Oberfläche kamen und wieder hinabsanken. Sie zeigten sich in Form von ungeheuerlichen Aussprüchen, trotz seiner sonst so milden und vernünftigen Bemerkungen. Manche Menschen dachten, er sei mitten in einem höchst vernünftigen Gespräch plötzlich verrückt geworden. Aber selbst jene mußten zugeben, daß er ebenso schlagartig wieder klar im Kopf wurde.
Vielleicht wurde jene närrische, phantastische Vorstellung, um darauf zurückzukommen, deswegen in meinem jugendlichen Gemüt zu einer fixen Idee, weil Mr.Pond in gewissen Momenten selbst fast wie ein Fisch aussah. Seine Umgangsformen waren nicht nur durchaus höflich, sondern auch recht konventionell; selbst seine Gesten waren ganz gewöhnlich, abgesehen von seinem gelegentlichen Spleen, an seinem Spitzbart zu zupfen, der ihn vor allem dann überfiel, wenn er sich endlich einmal dazu gezwungen sah, ernsthaft über eine seiner seltsamen und zusammenhanglosen Aussagen zu sprechen.
In solchen Momenten starrte er wie eine Eule vor sich hin und zog an seinem Bart, was den drolligen Effekt hatte, daß er damit gleichzeitig den Mund öffnete, als wäre es der Mund einer Marionette, mit Barthaaren statt der Schnüre. Dieses merkwürdige, beiläufige Öffnen und Schließen des Mundes, ohne ein Wort zu sagen, wies eine durchaus überraschende Ähnlichkeit auf mit dem langsamen Luftschnappen und Schlucken eines Fisches. Jedoch dauerte dies nie länger als ein paar Sekunden; ich nehme an, daß er während dieser Zeit die unwillkommene Aufforderung, doch zu erklären, was um alles in der Welt er denn da meinte, hinunterschluckte.
Eines Tages redete er gerade in aller Ruhe mit Sir Hubert Wotton, dem bekannten Diplomaten; sie saßen unter buntgestreiften Sonnensegeln beziehungsweise riesigen Sonnenschirmen bei uns zu Hause im Garten und blickten zu dem Teich hinüber, den ich so fälschlich mit ihm in Verbindung gebracht hatte. Zufälligerweise sprachen sie beide gerade über einen Teil der Welt, der kaum jemandem in Westeuropa überhaupt ein Begriff war, den die beiden aber gut kannten, nämlich die riesigen Ebenen, die zu Moor- und Sumpflandschaften auslaufen und sich über Pommern, Polen und Rußland sowie einige weitere Länder erstrecken, bis hin zu den wüsten Landstrichen Sibiriens, soweit ich weiß. Mr.Pond erinnerte sich daran, daß in einem Landstrich, in dem die Sümpfe am tiefsten sind und von Wasserlöchern und träge dahinfließenden Flüssen durchzogen werden, eine einzelne Straße verläuft, auf einem hohen Damm gebaut, der abschüssig ist und zu beiden Seiten steil abfällt: ein gerader Weg, der für einen Fußgänger durchaus sicher ist, aber kaum breit genug, daß zwei Reiter nebeneinander Platz finden. Damit beginnt die Geschichte.
Sie betrifft eine Zeit, die zwar noch nicht sehr lange zurückliegt, in der man aber noch mehr Reiter benötigte als in der Gegenwart, wenn auch bereits weniger als Krieger, sondern vielmehr als Kuriere. Es soll an dieser Stelle genügen, darauf hinzuweisen, daß es in einem der Kriege war, die jenen Teil der Welt verwüstet haben – insofern man eine solche Wüstenei überhaupt verwüsten kann. Zwangsläufig ging es dabei auch um den Druck des preußischen Systems auf die polnische Nation; aber es ist nicht notwendig, an dieser Stelle noch detaillierter auf die politische Seite dieser Angelegenheit einzugehen oder darüber zu diskutieren, was daran recht oder unrecht war. Beschränken wir uns daher der Einfachheit halber auf die Feststellung, daß Mr.Pond die Gesellschaft mit einem Rätsel amüsierte.
»Ich gehe davon aus«, sagte Pond, »daß Sie sich an all die Aufregung um Paul Petrowski erinnern, den Dichter aus Krakau, der zwei Dinge tat, die damals recht gefährlich waren: er zog aus Krakau weg, um in Posen zu leben, und er versuchte, gleichzeitig Poet und Patriot zu sein. Die Stadt, in der er lebte, war zu jener Zeit von den Preußen besetzt; sie lag genau am östlichen Ende des langen Weges, der über den Damm führte. Die preußischen Kommandanten hatten natürlich darauf geachtet, den Brückenkopf der einzigen Brücke, die über ein solches Meer von Sümpfen führte, unter Kontrolle zu bekommen. Aber die Ausgangsbasis für jene besondere Operation lag am westlichen Ende des Dammes. Der gefeierte Marschall von Grock hatte den Oberbefehl, und wie der Zufall es wollte, war sein eigenes, ehemaliges Regiment, die »Weißen Husaren«, das ihm immer noch am liebsten war, unmittelbar am Anfang der Deichstraße stationiert.
Natürlich war alles geschniegelt und gebügelt, bis auf das kleinste Detail der wundervollen, weißen Uniformen mit dem flammenfarbenen Wehrgehänge, das um sie geschlungen war. Das alles geschah nämlich noch vor der allgemeinen Verwendung von schlammbraun und staubgrau als Farben für alle Uniformen weltweit. Daraus kann ich niemandem einen Vorwurf machen, doch habe ich manchmal den Eindruck, daß die Epoche der Heraldik feinsinniger war als das Zeitalter der Tarnfarben, das mit der Naturwissenschaft und der Verehrung von Chamäleons und Käfern aufkam. Jedenfalls trug dieses Vorzeigeregiment der Preußischen Kavallerie immer noch seine eigene Uniform, und wie Sie sehen werden, war dies ein weiterer Bestandteil des Fiaskos. Aber es lag nicht nur an den Uniformen, sondern an der Uniformität. Die ganze Sache ging schief, weil zu gute Disziplin herrschte. Grocks Soldaten gehorchten ihm zu sehr, deshalb konnte er nichts von dem, was er wollte, in die Tat umsetzen.«
»Ich nehme an, dies ist ein Paradox«, sagte Wotton und stieß einen Seufzer aus. »Natürlich, das ist alles ganz clever und so weiter, aber in Wirklichkeit ist das doch alles Nonsens, oder? Oh, ich weiß schon, die Leute behaupten im Allgemeinen, daß es in der deutschen Armee zuviel Disziplin gibt. Aber eine Armee kann doch gar nicht zu diszipliniert sein.«
»Aber das war gar nicht allgemein gesprochen«, erwiderte Pond mit klagendem Tonfall. »Ich sage es im Besonderen, über diesen ganz speziellen Fall. Grock scheiterte, weil ihm seine Soldaten gehorchten. Völlig klar, hätte ihm nur einer seiner Soldaten gehorcht, wäre es nicht so schlimm gewesen. Aber als zwei seiner Soldaten gehorsam waren – tja, da hatte der arme alte Teufel wahrhaftig keine Chance.«
Wotton brach in ein kehliges Gelächter aus. »Ich höre Ihre neue Militärtheorie mit Vergnügen. Es ist Ihnen also genehm, wenn ein Soldat im Regiment die Befehle befolgt, aber wenn zwei Soldaten gehorchen, dann fällt Ihnen auf, daß die beiden die preußische Disziplin wohl etwas zu weit treiben.«
»Ich habe überhaupt keine militärische Theorie. Ich rede über eine militärische Tatsache«, erwiderte Pond friedfertig. »Es ist eine militärische Tatsache, Grock scheiterte, weil ihm zwei seiner Soldaten gehorchten. Es ist ebenso eine militärische Tatsache, daß er hätte Erfolg haben können, wenn einer seine Befehle mißachtet hätte. Darüber hinaus können Sie Theorien aufstellen, soviel Sie wollen.«
»Ich halte selber nicht viel von Theorien«, sagte Wotton ziemlich steif, als sei er ganz ordinär beleidigt worden.
In diesem Moment wurde die hohe Gestalt von Captain Gahagan sichtbar, der mit großen Schritten über den sonnenbeschienenen Rasen stolzierte, der so ungleiche Freund und Bewunderer des kleinen Mr.Pond. Er trug eine Blume mit flammenden Farben im Knopfloch und einen leicht schiefsitzenden Zylinderhut auf seinem rothaarigen Haupt; sein stolzierender Gang schien einem älteren Zeitalter von Dandys und sich duellierenden Männern zu entstammen, obgleich er selbst relativ jung war. Solange man nur seinen großen, breitschultrigen Umriß im Sonnenlicht wahrnahm, sah er aus wie die Fleisch gewordene Arroganz. Als er näher kam, sich dazusetzte und die Sonne auf sein Gesicht fiel, war davon nichts mehr zu erkennen, ganz im Gegenteil, seine Augen waren sehr sanft und sahen traurig und sogar ein wenig ängstlich aus. Mr.Pond unterbrach seinen Monolog und überschlug sich fast vor Entschuldigungen: »Ich fürchte, ich rede wie immer zuviel; ich war nämlich tatsächlich gerade dabei, von diesem Dichter Petrowski zu erzählen, der beinahe in Posen hingerichtet worden wäre – das ist ziemlich lange her. Die Militärbehörden vor Ort zögerten und wollten ihn schon laufen lassen, sofern sie nicht durch Marschall von Grock oder einen anderen Vorgesetzten direkte Befehle erhielten; Marschall von Grock aber war wild entschlossen, daß der Poet sterben sollte, und ließ noch am selben Abend den Befehl übermitteln, ihn zu exekutieren. Danach wurde ein Begnadigungsschreiben hinterhergeschickt, um ihn zu retten; aber da der Mann mit der Begnadigung unterwegs starb, wurde der Gefangene schließlich freigelassen.«
»Aber da –« wiederholte Wotton mechanisch.
»Der Mann, der die Begnadigung bei sich hatte«, fügte Gahagan ein wenig sarkastisch hinzu.
»Unterwegs starb«, murmelte Wotton.
»Na, was denn, natürlich wurde der Gefangene freigelassen«, stellte Gahagan mit lauter, fröhlicher Stimme fest. »Ist doch sonnenklar. Erzähl uns noch mehr von diesen Geschichten, Großväterchen.«
»Die Geschichte ist hundertprozentig wahr«, protestierte Pond, »und hat sich genauso zugetragen, wie ich es erzähle. Es geht hier nicht um ein Paradox oder derartiges. Nur müssen Sie die Geschichte natürlich kennen, um zu erfassen, wie einfach sie ist.«
»Ja«, stimmte Gahagan zu. »Ich denke auch, daß ich die Geschichte kennen sollte, bevor mir klar wird, wie einfach sie ist.«
»Dann erzählen Sie uns mal lieber Ihre Geschichte, damit wir es hinter uns bringen«, bemerkte Wotton knapp.
Paul Petrowski war einer jener ganz und gar nicht praktisch veranlagten Menschen, die in der politischen Praxis auf so wunderbare Weise wichtig sind. Seine Macht beruhte auf der Tatsache, daß er nicht nur ein national bekannter Dichter, sondern auch ein international anerkannter Sänger war. Er hatte nämlich zufällig auch eine hervorragende, machtvolle Stimme, mit der er seine eigenen patriotischen Lieder in den Konzerthallen der halben Welt vortrug. In seiner Heimat war er natürlich ein leuchtendes Vorbild mit Signalwirkung für revolutionäre Hoffnungen, besonders damals, in jenen Zeiten internationaler Krisen, in denen pragmatische Politiker verschwanden und Platz machten für Männer, die entweder noch pragmatischer waren als sie selbst – oder weitaus weniger. Denn der wahre Idealist und der wahre Realist teilen zumindest die Liebe zu konkreten Handlungen. Dabei blüht der praxisorientierte Politiker dabei auf, gegen jedwede Handlung praktische Einwände zu erheben. Die Handlungen eines Idealisten sind vielleicht undurchführbar und die eines tatkräftigen Mannes mögen skrupellos sein; aber in keinem Gewerbe kann man sich dadurch einen Namen machen, daß man gar nichts tut. Es ist sonderbar, daß sich ebendiese beiden extrem unterschiedlichen Menschentypen auf den entgegengesetzten Seiten dieses einzigen, höher gelegenen Weges durch den Morast gegenüberstanden – der polnische Poet, der in der Stadt gefangengehalten wurde, auf der einen Seite und der preußische Soldat, der die Befehlsgewalt im Militärlager auf der anderen Seite hatte. Denn Marschall von Grock war ein echter Preuße, nicht nur vollkommen praktisch denkend, sondern auch völlig prosaisch. Er selbst hatte noch nie eine Zeile Lyrik gelesen, aber er war kein Dummkopf. Er hatte den Realitätssinn, der den Soldaten eigen ist, und dieser bewahrte ihn davor, dieselben idiotischen Fehler wie die pragmatischen Politiker zu machen. Er spottete nicht über Visionen; sie waren ihm lediglich verhaßt. Und er war entschlossen: Der Dichter mußte sterben. Dies war die einzige Anerkennung, die er der Dichtung zollte; und sie war aufrichtig.
Er saß gerade in seinem Zelt am Tisch; die Pickelhaube, die er in der Öffentlichkeit immer trug, lag vor ihm; und sein massiger Schädel sah schon ziemlich glatzköpfig aus, obwohl er nur sehr kurz geschoren war. Auch das ganze Gesicht war glatt rasiert und wurde nur von ein paar sehr starken Brillengläsern verdeckt, die das einzige waren, was seinem groben, schlaffen Gesicht etwas Rätselhaftes gab. Er wandte sich an einen Leutnant, der neben ihm stand, einen von jenen Deutschen, die sich durch bleiches Haar und puddingartiges Gesicht auszeichnen; selbiger starrte mit blauen Augen so groß wie Untertassen ins Leere.
»Leutnant von Hocheimer«, sprach er, »sagten Sie, Ihre Hoheit würden heute abend im Lager eintreffen?«
»Sieben fünfundvierzig, Herr Marschall«, antwortete der Leutnant, der scheinbar nur sehr ungern überhaupt etwas sagte, wie ein großes Tier, dem man mit einem neuen Trick das Sprechen beigebracht hatte.
»Dann reicht die Zeit gerade«, sagte Grock, »um Sie mit dem Hinrichtungsbefehl loszuschicken, bevor er ankommt. Wir müssen Ihrer Hoheit in jeder Hinsicht zu Diensten sein, insbesondere im Hinblick darauf, ihm unnötigen Ärger zu ersparen. Er wird mit der Abnahme der Truppen beschäftigt genug sein; sehen Sie zu, daß alles Ihrer Hoheit zur Verfügung steht. Er wird in einer Stunde zum nächsten Außenposten aufbrechen.«
Der lange Leutnant schien teilweise wieder zum Leben zu erwachen und salutierte flüchtig. »Natürlich, Herr Marschall, wir alle müssen Hoheit gehorchen.«
»Ich sagte, wir müssen alle Ihrer Hoheit zu Diensten sein«, sagte der Marschall.
Mit einer abrupteren Bewegung als üblich setzte er seine schwere Brille ab und ließ sie polternd auf den Tisch fallen. Wenn die blaßblauen Augen des Leutnants etwas Derartiges hätten erkennen können oder wenn er sie noch weiter hätte aufreißen können, als er es ohnehin schon tat, dann wären sie ihm schier übergegangen angesichts der vollständigen Veränderung, die durch diese Geste bewirkt wurde. Es war, als hätte man eine eiserne Maske entfernt. Einen Moment zuvor hatte Marschall von Grock so ungewöhnlich ausgesehen wie ein Nashorn mit seinen schlaff herabhängenden, ledrigen Wangen und Kieferknochen. Jetzt verkörperte er eine andere Art von Monster: ein Nashorn mit Adleraugen. Das kalte Funkeln seiner alten Augen hätte wohl fast jedem verraten, daß er etwas in seinem Inneren verbarg, das mehr als nur bedrückend war; zumindest gab es einen Teil von ihm, der nicht aus Eisen, sondern aus Stahl war. Denn alle Menschen leben aus einem Geist heraus, selbst wenn es der Geist des Bösen ist beziehungsweise ein Geist, der für einen durchschnittlichen Christenmenschen so fremdartig ist, daß er kaum erkennen kann, ob er gut oder böse ist.
»Ich sagte, wir müssen alle Ihrer Hoheit zu Diensten sein«, wiederholte Grock. »Ich werde es noch deutlicher ausdrücken: ich sage, wir alle müssen Ihre Hoheit retten. Genügt es unseren Königen nicht, daß sie unsere Götter sind? Genügt es ihnen nicht, daß man ihnen dient und sie rettet? Wir sind es, die uns darum kümmern müssen, ihnen zu dienen und sie zu retten.«
Marschall von Grock redete selten, dachte sogar selten, zumindest in dem Sinne, wie Theoretiker es verstehen. Und im allgemeinen läßt sich feststellen, daß Menschen so wie er, wenn sie einmal zufällig laut denken, viel lieber mit ihren Hunden reden. Sie genießen es sogar, mit Herablassung lange Wörter und ausgefeilte Argumentationen dem Hund gegenüber zu verwenden. Es wäre ungerecht, Leutnant von Hocheimer mit einem Hund zu vergleichen. Es wäre ungerecht dem Hund gegenüber, der ein weitaus sensibleres und wachsameres Geschöpf ist. Es entspräche eher der Wahrheit zu behaupten, daß Grock, der gerade einen seiner seltenen nachdenklichen Momente hatte, sich bei seinem lauten Nachdenken so sicher und ungestört fühlte, als befände er sich in der Gegenwart einer Kuh oder eines Kohlkopfes.
»Immer wieder hat in der Geschichte unseres Königshauses der Diener seinen Herrscher gerettet«, fuhr Grock fort, »und wurde oft deswegen ein wenig mit Füßen getreten, zumindest von den Außenstehenden, die den Starken und Erfolgreichen oft mit sentimentalem Gejammer begegneten. Aber zumindest waren wir erfolgreich und stark. Sie verfluchten Bismarck dafür, daß er seinen eigenen Herrscher bezüglich der Emser Depesche getäuscht hatte; aber dadurch wurde jener Herrschende zum Herrscher über die ganze Welt. Paris wurde eingenommen, Österreich entthront, und wir waren in Sicherheit. Heute abend wird Paul Petrowski tot sein; dann werden wir uns auch wieder ganz sicher fühlen können. Aus diesem Grund sende ich Sie mit dem Todesurteil sofort los. Sind Sie sich darüber im klaren, daß Sie den Befehl für Petrowskis sofortige Hinrichtung bei sich tragen – und daß Sie so lange an Ort und Stelle bleiben müssen, bis Sie gesehen haben, daß der Befehl ausgeführt worden ist?«
Der schweigsame Hocheimer salutierte; er verstand das sehr wohl. Und letzten Endes wies er dennoch einige Qualitäten eines Hundes auf: er war so tapfer wie eine Bulldogge und treu ergeben bis in den Tod.
»Sie müssen sofort das Pferd satteln und losreiten«, fuhr Grock fort, »und lassen Sie sich durch nichts aufhalten oder vom Weg abbringen. Ich weiß ganz sicher, daß dieser Narr Arnheim Petrowski heute abend freilassen wird, sofern keine Nachricht eintrifft. Beeilen Sie sich, so schnell wie möglich.«
Der Leutnant salutierte erneut und ging in die Nacht hinaus, bestieg eines der prachtvollen, weißen Schlachtrösser, die dieser glanzvollen Einheit noch zusätzlichen Glanz verliehen, und begann seinen Ritt über die hochgelegene, enge Straße, die den Damm entlang verlief, fast wie auf einer Mauer, von der aus man den dunklen Horizont, die dämmrigen Muster und verblassenden Farben dieser mächtigen Marschlandschaft überblicken konnte.
Als der letzte Nachhall des Hufschlages beinahe ganz verklungen war, erhob sich von Grock, setzte seinen Helm und seine Brille auf und näherte sich dem Ausgang seines Zeltes; aber aus einem anderen Grund. Die wichtigsten Männer seiner Einheit kamen bereits, in vollem Ornat, auf ihn zu; in den etwas weiter entfernteren Reihen erschollen bereits die Klänge des feierlichen Saluts, und es wurden Befehle gebrüllt. Seine Hoheit der Prinz war angekommen.
Seine Hoheit der Prinz stand, zumindest äußerlich, in ziemlichem Kontrast zu den ihn umgebenden Männern; und auch in anderer Hinsicht war er so etwas wie eine Ausnahmeerscheinung in seinem Umfeld. Er trug ebenfalls eine Pickelhaube, aber die eines anderen Regiments, ganz schwarz und mit funkelnden, blauen Stahlbeschlägen; und es wirkte einerseits unpassend, andererseits mit etwas Phantasie doch wieder auf eine gewisse altertümliche Weise angemessen, den Helm mit dem langen, dunklen, wallenden Bart zu kombinieren, inmitten all dieser glattrasierten Preußen. Quasi als Gegenstück zu dem langen, dunklen, wallenden Bart trug er einen langen, dunklen, wallenden Mantel von blauer Farbe, dekoriert mit einem leuchtenden Stern, dem höchsten königlichen Orden, und unter dem blauen Mantel trug er eine schwarze Uniform. Obwohl er genauso deutsch war wie jeder der anderen Männer, war er eine ganz andere Art Deutscher; und es lag etwas in seinem stolzen, aber abwesend wirkenden Gesicht, das zu der Legende paßte, die einzig wahre Leidenschaft in seinem Leben sei die Musik.
Tatsächlich war der grummelnde Grock geneigt, mit dieser leicht exzentrischen Art die für ihn höchst unerfreuliche und verbitternde Tatsache zu begründen, daß der Prinz nicht unverzüglich dazu überging, die Truppe gründlich zu inspizieren und sich von den Soldaten begrüßen zu lassen, die bereits gemäß der Militäretikette ihres Landes zu einer labyrinthförmigen Parade aufgestellt waren, sondern sich sofort ungeduldig auf das Thema stürzte, das Grock am liebsten vermieden hätte: die Angelegenheit mit diesem teuflischen Polen, seiner Popularität und seiner Gefährdung, denn er hatte einige Lieder dieses Mannes gehört, die in jedem zweiten europäischen Opernhaus gesungen wurden.
»Es ist Wahnsinn, davon zu reden, einen Mann wie ihn umzubringen«, sagte der Prinz und machte unter seinem Helm ein finsteres Gesicht. »Er ist kein gewöhnlicher Pole. Er ist eine Institution in Europa. Er würde von unseren Verbündeten, unseren Freunden, sogar von unseren deutschen Mitbürgern beweint und vergöttert werden. Möchten Sie etwa wie diese wahnsinnigen Frauen sein, die Orpheus umbrachten?«
»Hoheit«, sagte der Marschall, »man würde um ihn weinen, aber er wäre tot. Man würde ihn vergöttern, aber er wäre tot. Was auch immer er im Schilde führt, er würde es nie mehr tun können. Was auch immer er gerade tut, er würde damit aufhören. Der Tod ist die oberste aller Tatsachen, und ich schaffe gerne Fakten.«
»Haben Sie überhaupt keine Ahnung, was in der Welt vor sich geht?« fragte der Prinz.
»Die Welt«, entgegnete Grock, »hinter den äußersten schwarz-weißen Grenzpfosten unseres Heimatlandes kümmert mich nicht.«
»Gott im Himmel«, rief Seine Hoheit aus, »Sie hätten Goethe wegen eines Streits mit der Obrigkeit in Weimar aufgeknüpft!«
»Für die Sicherheit Eures königlichen Hauses, ohne auch nur einen Moment zu zögern«, antwortete Grock.
Es trat eine kurze Stille ein, bis der Prinz abrupt in scharfem Ton sagte: »Was soll das heißen?«
»Das heißt, daß ich nicht einen Augenblick lang gezögert habe«, erwiderte der Marschall fest. »Ich habe bereits selbst jemand mit dem Befehl zur Hinrichtung Petrowskis losgeschickt.«
Der Prinz erhob sich wie ein großer dunkler Adler, wobei sein wirbelnder Mantel an den Schlag mächtiger Schwingen erinnerte; und alle Anwesenden wußten, daß ihn sein Zorn, der gar nicht in Worte zu fassen war, zu einem Mann der Tat werden ließ.
Er sprach noch nicht einmal mehr mit von Grock; er redete über ihn hinweg, mit sehr lauter Stimme, und rief nach dem stellvertretenden Befehlshaber, General von Voglen, einem untersetzten Mann mit quadratischem Schädel, der sich bislang reglos wie ein Stein im Hintergrund gehalten hatte.
»Wer hat das beste Pferd in Ihrem Kavallerieregiment, General? Wer ist der beste Reiter?«
»Arnold von Schacht hat ein Pferd, das selbst ein Rennpferd schlagen könnte«, antwortete der General prompt. »Und er reitet es wie ein Jockey beim Pferderennen. Er gehört zu den Weißen Husaren.«
»Sehr gut«, sagte der Prinz, mit jenem neuen, metallischen Ton in seiner Stimme. »Lassen Sie ihn sofort dem anderen Mann mit der verrückten Nachricht hinterherreiten und ihn aufhalten. Ich werde ihm eine Vollmacht geben, die unser hervorragender Marschall, wie ich denke, nicht in Frage stellen wird. Bringen Sie mir Feder und Tinte.«
Er setzte sich nieder, schüttelte seinen Mantel aus, und man brachte ihm Schreibutensilien. Er schrieb mit fester Hand und allerlei Schnörkeln den Befehl, der alle anderen Befehle außer Kraft setzen sollte, um Petrowski den Polen zu begnadigen und freizulassen. Während eine tödliche Stille eintrat, stürzte er aus dem Raum, seinen Mantel und Säbel hinter sich herschleifend; inmitten dieser Stille starrte der alte Grock ohne zu blinzeln vor sich hin, wie ein steinernes Götzenbild aus einer prähistorischen Epoche. Sein Verdruß war so gewaltig, daß keiner der Männer es wagte, ihn an die offizielle Truppenabnahme zu erinnern. Aber Arnold von Schacht, ein tatkräftiger Jüngling mit gelocktem Haar, der sehr jungenhaft wirkte, aber mehr als eine Medaille auf seiner weißen Husarenuniform trug, schlug die Hacken zusammen und erhielt von dem Prinzen das zusammengefaltete Schreiben; dann verließ er den Raum mit langen Schritten, sprang auf sein Pferd und flog den schmalen, hohen Weg entlang wie ein silberner Pfeil, wie eine Sternschnuppe.
Der alte Marschall ging langsam und bedächtig zu seinem Zelt zurück, nahm langsam und bedächtig seine Pickelhaube und seine Brille ab, und legte sie wie vorher auf den Tisch. Dann rief er einen Ordonnanzoffizier zu sich, der sich direkt vor dem Zelt befand, und befahl ihm, unverzüglich Feldwebel Schwartz von den Weißen Husaren holen zu gehen.
Eine Minute später erschien vor dem Marschall ein hagerer, drahtiger Mann mit einer großen Narbe auf seinem Kieferknochen; er wirkte ziemlich dunkel für einen Deutschen, sofern nicht die Jahre voll Rauch, Sturm und Unwetter seine Hautfarbe geändert hatten. Er salutierte und stand steif in Bereitschaftshaltung, als der Marschall langsam seinen Blick zu ihm erhob. Aber so unermeßlich groß die Kluft zwischen dem Kaiserlichen Marschall, der Generäle befehligte, und jenem im Krieg verletzten Unteroffizier auch war, verhielt es sich dennoch so, daß in Wahrheit von allen Personen, die in dieser Geschichte miteinander redeten, lediglich diese beiden Männer in der Lage waren, sich anzuschauen und ohne Worte zu verstehen.
»Feldwebel«, sagte der Marschall kurz angebunden, »ich habe Sie bisher zweimal zu Gesicht bekommen. Einmal, wenn ich mich recht entsinne, als Sie eine Auszeichnung als treffsicherster Gewehrschütze der ganzen Armee bekommen haben.«
Der Feldwebel salutierte wortlos.
»Und dann noch einmal«, fuhr Grock fort, »als Sie verhört wurden, nachdem Sie dieses verdammte alte Weib erschossen haben, die uns keine Informationen über den Hinterhalt geben wollte. Der Zwischenfall erregte zu seiner Zeit einiges Aufsehen, sogar in manchen unserer Kreise. Jemand hat jedoch seinen Einfluß für Sie geltend gemacht. Dieser Jemand war ich.«
Der Feldwebel salutierte erneut und sagte immer noch kein Wort. Der Marschall sprach monoton, aber seltsam freimütig weiter.
»Seine Hoheit der Prinz wurde in einer Angelegenheit, die wesentlich für seine eigene Sicherheit und die des Vaterlandes ist, falsch informiert und getäuscht. Durch diesen Fehler hat er eilends ein Begnadigungsschreiben für den Polen Petrowski losgeschickt, der heute nacht hingerichtet werden soll. Ich wiederhole: der heute nacht hingerichtet werden soll. Sie müssen sofort von Schacht nachreiten, der die Begnadigung überbringen soll, und ihn aufhalten.«
»Ich kann kaum hoffen, ihn zu überholen, Herr Marschall«, sagte Feldwebel Schwartz. »Er hat das schnellste Pferd im Regiment und ist der beste Reiter.«
»Ich habe Ihnen nicht gesagt, daß Sie ihn überholen sollen. Ich befahl Ihnen, ihn aufzuhalten«, sagte Grock. Dann sprach er langsamer: »Ein Mann kann durch verschiedene Signale aufgehalten oder zurückgerufen werden: durch einen Ruf oder einen Schuß.« Nachdenklich sprach er noch langsamer, aber ohne innezuhalten weiter. »Der Schuß eines Karabiners könnte seine Aufmerksamkeit erregen.«
Da salutierte der dunkle Feldwebel zum dritten Mal, und seine grimmigen Lippen waren eng aufeinandergepreßt.
»Man ändert die Welt«, rief Grock, »nicht durch das, was man sagt, verurteilt oder lobt, sondern durch Taten. Die Welt kann das, was getan wird, nicht ungeschehen machen. In diesem Moment ist der Tod eines Mannes eine Notwendigkeit.« Er richtete abrupt und blitzartig seine leuchtenden, stählernen Augen auf sein Gegenüber und fügte hinzu: »Damit meine ich natürlich Petrowski.«
Und Feldwebel Schwartz lächelte noch grimmiger; er hob die Plane am Eingang des Zeltes an, um ebenfalls in die Dunkelheit hinauszugehen, sein Pferd zu besteigen und loszureiten.
Beim letzten Reiter war es noch weniger wahrscheinlich als beim ersten, daß er unnützen Ideen und Vorstellungen nachhängen würde. Da er aber auch ein Mensch war, wenn auch nur ein recht unvollkommener, fühlte er unweigerlich, bei einem solchen Auftrag in einer solchen Nacht, wie bedrückend diese menschenfeindliche Landschaft war. Während er über diesen jäh abfallenden Grat ritt, breitete sich um ihn herum scheinbar unendlich weit etwas aus, das in milliardenfacher Weise noch unmenschlicher war als der Ozean. Denn man konnte darin nicht schwimmen, oder mit dem Boot darauf fahren, oder sonst irgendeine menschliche Tätigkeit darin ausführen; man konnte nur, praktisch völlig wehrlos, darin versinken. Der Feldwebel fühlte die vage Präsenz eines Urschlamms, der weder fest noch flüssig war oder irgendeine Form annehmen konnte; und er fühlte, daß er hinter der Formvielfalt aller Dinge lauerte.
Er war Atheist, wie so viele Tausende törichter, kluger Menschen in Norddeutschland; aber er gehörte nicht jener glücklicheren Sorte nichtgläubiger Menschen an, die im Fortschritt des Menschen ein ganz natürliches Aufblühen der Welt sehen. Die Welt, die er vor sich sah, war kein Feld, in dem etwas Grünes oder Lebendiges der Erde entsproß, sich entwickelte und Früchte trug; sie war nur ein Abgrund, in den alles Lebendige für immer in bodenlose Tiefe hinabsinken würde, und dieser Gedanke verhärtete ihn angesichts all der seltsamen Pflichten, denen er in solch einer haßerfüllten Welt nachkommen mußte. Die graugrünen Flecken der niedrigen Vegetation, die von oben gesehen den Eindruck einer ausgebreiteten Landkarte machten, ließen mehr an Fieberkurven denken als an eine geradlinige Entwicklung, und die von Erdreich umgebenen Sumpflöcher schienen eher Gift als Wasser zu enthalten. Er erinnerte sich an humanitäres oder sonstiges Gerede über vergiftete Wasserlöcher.
Aber die Überlegungen des Feldwebels hatten, wie es bei den Erwägungen von Leuten, die normalerweise nicht viel nachdenken, meistens üblich ist, ihre Wurzel in dem unterbewußten Druck, der auf seinem Nervenkostüm und seiner praktischen Vernunft lastete. Tatsächlich erschien ihm die gerade Straße vor ihm nicht nur trostlos, sondern auch endlos. Er hätte nie geglaubt, so weit reiten zu können, ohne den Mann, den er verfolgte, auch nur aus der Ferne erspähen zu können. Von Schacht mußte wirklich das schnellste aller Pferde besitzen, um bereits einen so großen Vorsprung zu haben, denn schließlich war er, egal wie schnell, erst vor relativ kurzer Zeit aufgebrochen. Wie Schwartz es gesagt hatte, er erwartete kaum, ihn einholen zu können, aber sein reales Gefühl für Distanzen sagte ihm, daß der andere sehr bald in Sichtweite kommen müßte. Und dann, als sich schon allmählich Verzweiflung über die leere Landschaft legte und unmerklich weiter ausbreitete, bemerkte er ihn endlich.
Ein weißer Fleck, der langsam und allmählich zu etwas wie einer weißen Gestalt anwuchs, erschien weit vor ihm in wildem Galopp. Er wurde so groß, daß Schwartz seinerseits in der Lage war, einen Zwischenspurt einzulegen, jedenfalls war er groß genug, um schwach den orangenen Streifen über der weißen Uniform erkennen zu lassen, der für das Husarenregiment charakteristisch war. Der Träger der Auszeichnung des besten Schützen in der Armee hatte schon bei kleineren Zielscheiben ins Schwarze getroffen. Er nahm den Karabiner zur Hand, den er umgehängt hatte, und erschreckt durch ein unnatürliches Geräusch, wurden meilenweit alle Wildvögel in der stillen morastigen Landschaft aufgeschreckt. Aber Feldwebel Schwartz kümmerte sich nicht um sie. Das einzige, was ihn interessierte, war, daß er selbst auf diese Distanz erkennen konnte, wie sich die aufrechte, weiße Gestalt zusammenkrümmte und ihre Haltung verlor, als sei sie plötzlich erschlafft. Er hing sackartig über dem Sattel, und Schwartz war dank seines scharfen Auges und seiner langen Erfahrung sicher, daß die Kugel den Körper des Opfers durchschlagen hatte; und er war sich sogar fast sicher, daß er ihm durchs Herz geschossen hatte. Dann streckte er das Pferd mit einem zweiten Schuß nieder, und der Reiter und sein Pferd überschlugen sich, rutschten, glitten und verschwanden nach einem letzten weißen Aufblitzen im dunklen Morast unter ihnen.
Der nüchterne Feldwebel war sich sicher, daß seine Arbeit erledigt war. Nüchterne Männer wie er sind normalerweise sehr präzise bei allem, was sie tun; deswegen machen sie auch so oft Fehler bei dem, was sie tun. Er hatte gegen die Kameradschaft gefrevelt, die jede Armee beseelt; er hatte einen beherzten Offizier getötet, der gerade seine Pflicht erfüllte; er hatte seinen obersten Befehlshaber getäuscht, ihn herausgefordert und einen gemeinen Mord begangen, ohne sich mit persönlichen Streitigkeiten herausreden zu können; aber er hatte einem höheren Offizier gehorcht und dabei geholfen, einen Polen umzubringen. Diese beiden letzten Tatsachen erfüllten im Moment seine Gedanken; er ritt nachdenklich wieder zurück, um Marschall von Grock Meldung zu machen. Er hegte keinen Zweifel daran, daß er seine Arbeit gründlich erledigt hatte. Der Mann mit dem Begnadigungsschreiben war ganz sicher tot; und selbst wenn er wie durch ein Wunder noch nicht ganz tot gewesen sein sollte, hätte er unmöglich mit seinem sterbenden oder halbtoten Pferd rechtzeitig in die Stadt reiten können, um die Hinrichtung zu verhindern. Nein, alles in allem war es viel praktischer und klüger, sich unter den schützenden Arm seines Protektors zu begeben, des Urhebers dieser verzweifelten Unternehmung. Seine ganze Kraft bezog er aus der Macht des großen Marschalls.
Und tatsächlich umgab den großen Marschall ein Hauch von Größe; nach der monströsen Tat, die er verübt beziehungsweise veranlaßt hatte, kam es für ihn gar nicht in Frage, Angst davor zu zeigen, daß man ihn direkt mit den Tatsachen konfrontieren könnte, oder Furcht davor, kompromittiert zu werden, sollte er im Kontakt mit seinem Werkzeug bleiben. Tatsächlich ritten er und der Feldwebel etwa eine Stunde später den schmalen Weg entlang, bis sie einen besonderen Ort erreichten, an dem der Marschall abstieg, seinem Begleiter jedoch befahl weiterzureiten. Er wollte, daß der Feldwebel das ursprüngliche Ziel der Reiter aufsuchte, um festzustellen, ob in der Stadt nach der Hinrichtung alles ruhig war oder ob noch Gefahr bestand durch Unruhen im Volk.
»Ist es denn hier, Herr Marschall?« fragte der Feldwebel mit leiser Stimme. »Ich dachte, es sei noch weiter gewesen, aber es stimmt tatsächlich, man hatte den Eindruck, daß dieser verteufelte Weg wie in einem Alptraum immer länger wurde.«
»Es ist hier«, entgegnete Grock und schwang sich schwerfällig aus Sattel und Steigbügeln; dann ging er zum Rande des Dammes und blickte hinunter.
Der Mond war über den Sümpfen aufgegangen, immer stärker strahlend, gleißend auf dunklen Wassern und grünem Schaum; und im nächstgelegenen Schilfbüschel lag, am Fuße der Böschung, wie ein lichtdurchflutetes, strahlendes, zerstörtes Wrack, alles, was von einem jener phantastischen weißen Pferde und seinem weißen Reiter aus seiner alten Brigade übrig war. Auch an der Identität gab es keinen Zweifel: der Mond erzeugte fast so etwas wie einen Heiligenschein, der das goldgelockte Haar des jungen Arnold umgab, den zweiten Reiter, der den Begnadigungsbefehl bei sich trug. Derselbe mystische Mondschein tauchte nicht nur das Wehrgehänge und die Knöpfe in gleißendes Licht, sondern auch die besonderen Auszeichnungen des jungen Soldaten sowie die Streifen und Abzeichen seines Ranges. Im glanzvollen Schleier dieses Lichtes sah es fast so aus, als steckte er in der weißen Rüstung von Sir Galahad, und man kann sich kaum einen gräßlicheren Gegensatz vorstellen als die niedergestreckte Jugend und Anmut, die unten lag, und die wie versteinert dastehende, groteske Gestalt, die von oben hinabschaute. Grock hatte seinen Helm abermals abgenommen, und wenn es auch durchaus möglich ist, daß dies der undeutliche Abglanz einer Ehrerbietung am Grab sein sollte, bestand der sichtbare Effekt darin, daß der eigenartige, nackte Kopf und der Hals wie bei einem Dickhäuter im Mond glänzten, als seien sie aus Stein, so wie der haarlose Kopf und Hals eines Monsters aus der Steinzeit. Der Kupferstecher Rops oder ein ähnlicher Vertreter der dunklen, phantastischen deutschen Schule hätte ein solches Bild zeichnen können: ein riesiges Biest, so wenig menschlich wie ein Käfer, der auf die zerbrochenen Schwingen und die weiß-goldene Rüstung eines besiegten Anführers der Cherubim hinabblickt.
Grock sprach kein Gebet und äußerte kein Mitleid, aber irgendwie war sein Gemüt auf unerklärliche Weise bewegt, wie sich selbst die dunklen und mächtigen Sümpfe manchmal bewegen, als seien sie lebendig. Und wie es solche Menschen gewöhnlich tun, wenn sie sich zum ersten Mal ein wenig in die Defensive gedrängt fühlen durch etwas, das sie gar nicht verstehen, versuchte er, sein einziges Glaubensbekenntnis zu formulieren und es dem dunklen Universum und dem herabstarrenden Mond entgegenzustellen.
»Ob vor oder nach der Tat, der deutsche Wille ist immer der gleiche. Er kann nicht durch Veränderungen oder die Zeit gebrochen werden, so wie der Wille der Reumütigen. Er steht außerhalb der Zeit, wie aus Stein gemeißelt, und schaut mit dem gleichen Antlitz nach vorne und zurück.«
Die darauffolgende Stille währte lange genug, um seiner kalten selbstgefälligen Eitelkeit auch einen gewissen Beigeschmack von Apokalypse zu verleihen, als habe ein Monument aus Stein in einem Tal der Stille die Stimme erhoben. Aber diese Stille wurde aufs neue durch ein leises, fernes Beben erschüttert, nämlich durch den schwachen Hufschlag eines Pferdes; und kurz darauf kam der Feldwebel herangaloppiert, oder vielmehr raste er herbei, über den erhöhten Weg, und sein dunkelhäutiges, vernarbtes Gesicht wirkte nicht mehr nur grimmig, sondern gespenstisch im Mondschein.
»Herr Marschall«, sagte er, seltsam steif salutierend, »ich habe den Polen Petrowski gesehen!«
»Haben sie ihn noch nicht begraben?« fragte der Marschall, der immer noch abwesend nach unten starrte.
»Falls sie das getan haben«, sagte Schwartz, »hat er den Stein weggerollt und ist von den Toten auferstanden.«
Er starrte auf die Sumpflandschaft und den Mond vor sich; jedoch waren es in Wirklichkeit nicht diese Dinge, die er sah, und obwohl er alles andere als ein Visionär war, stand ihm das vor Augen, was er vor kurzem erst erblickt hatte. Er hatte tatsächlich Paul Petrowski erblickt, der lebendig und putzmunter durch die hellerleuchtete Hauptstraße der polnischen Stadt direkt zum Anfang des Weges gegangen war; die schlanke Gestalt mit den Haarbüscheln und dem französisch anmutenden Spitzbart, die in so vielen privaten Alben und Illustrierten abgebildet wurde, war unverkennbar. Und hinter ihm hatte er die polnische Stadt gesehen, die ganz entflammt zu sein schien, mit Flaggen und Fackeln, die Einwohner waren voll triumphaler, heißer Heldenverehrung und vielleicht sogar etwas weniger feindlich der Regierung gegenüber eingestellt, als man hätte erwarten können, feierten sie doch freudig die Freilassung ihres Volkshelden.
»Soll das vielleicht heißen«, rief Grock, dessen brüchige Stimme auf einmal einen schneidenden Klang hatte, »daß sie es gewagt haben, ihn trotz meiner Botschaft freizulassen?«
Schwartz salutierte erneut und sagte:
»Man hatte ihn bereits freigelassen und hatte auch keine Nachricht erhalten.«
»Verlangen Sie etwa von mir, nach alledem«, sagte Grock, »daß ich glauben soll, daß überhaupt keiner der Boten aus unserem Lager angekommen ist?«
»Überhaupt kein Bote«, sagte der Feldwebel.
Es trat eine noch viel längere Stille ein, bis Grock heiser sagte: »Was zur Hölle ist passiert? Haben Sie eine Erklärung für all das?«
»Ich habe etwas gesehen«, sagte der Feldwebel, »das, wie ich glaube, alles erklären kann.«
Als Mr.Pond die Geschichte bis zu dieser Stelle erzählt hatte, hielt er mit provozierend ausdruckslosem Gesicht inne.
»Nun«, sagte Gahagan ungeduldig, »und wissen Sie, womit man alles erklären kann?«
»Na ja, ich glaube schon«, erwiderte Mr.Pond sanft. »Wissen Sie, ich mußte mir selbst den Kopf zerbrechen, um es herauszufinden, als der Bericht in meiner Abteilung landete. Es kam zu alledem durch ein Übermaß an preußischem Gehorsam. Und es kam auch durch das Übermaß einer weiteren preußischen Schwäche zustande: der Verachtung. Und von allen Leidenschaften, die den Menschen blenden, in den Wahnsinn treiben und in die Irre führen, ist die schlimmste gleichzeitig die kälteste: die Verachtung.
Grock hatte viel zu ungezwungen in Gegenwart der Kuh gesprochen, und viel zu vertrauensselig in Anwesenheit des Kohlkopfes. Er konnte dumme Menschen selbst in seiner eigenen Truppe nicht ausstehen und behandelte von Hocheimer, den ersten Boten, wie ein Möbelstück, bloß weil er wie ein Dummkopf aussah; aber der Leutnant war gar nicht so dumm, wie er aussah. Er verstand auch genauso gut wie der zynische Feldwebel, was der große Marschall meinte, der sein ganzes Leben solch schmutzige Aufträge ausgeführt hatte. Hocheimer verstand auch die eigentümliche Moralphilosophie des Marschalls: daß man einer Tat nichts mehr entgegensetzen kann, selbst wenn sie unverantwortlich ist. Er wußte, daß sein Befehlshaber einfach nur Petrowskis Leiche haben wollte; daß er sie haben wollte, egal wie, selbst um den Preis, dafür Prinzen zu betrügen oder Soldaten opfern zu müssen.
Und als er einen schnelleren Reiter hinter sich bemerkte, der an ihm vorbeireiten wollte, wußte er genauso gut wie Grock selbst, daß der neue Bote den Befehl des Prinzen zur Begnadigung bei sich haben mußte. Von Schacht, der blutjunge, aber tapfere Offizier, der wie die Verkörperung all jener großzügigeren deutschen Traditionen aussah, die in dieser Geschichte viel zu kurz gekommen sind, war dieses Zufalls würdig, der ihn zur Lichtgestalt einer großzügigeren Politik werden ließ. Er kam mit der Geschwindigkeit jener noblen Reitertradition, die in Europa den Namen »Ritter« hinterlassen hat, und er rief den anderen Reiter mit der Stimme einer Heroldstrompete, um ihn zum Anhalten, Stillstehen und Umwenden zu veranlassen. Und von Hocheimer gehorchte. Er hielt an, zügelte sein Pferd, wandte sich im Sattel um, aber er hielt den Karabiner wie eine Pistole in der Hand und schoß dem Jungen zwischen die Augen.
Dann drehte er sich um und ritt mit dem Todesurteil für den Polen weiter. Hinter ihm waren Roß und Reiter über den Rand des Dammes gestürzt, so daß der ganze Weg frei war. Und über diese offene und freie Straße ritt wiederum verbissen der dritte Bote und wunderte sich über die Länge des Weges, der gar nicht enden wollte, bis er endlich die unverkennbare, weiße Husarenuniform wie einen weißen Stern in der Ferne verschwinden sah. Und er schoß ebenfalls. Er tötete jedoch nicht den zweiten Boten, sondern den ersten.
Deshalb traf kein Bote lebend in dieser Nacht in der polnischen Stadt ein. Deswegen kam der Gefangene lebend aus dem Gefängnis. Glauben Sie, daß ich unrecht hatte, als ich behauptete, daß von Grock zwei treu ergebene Diener hatte, allerdings einen zu viel?«
DAS VERBRECHEN VON CAPTAIN GAHAGAN
Man muß zugeben, daß manche Menschen Mr.Pond für einen Langweiler hielten. Er hatte eine Schwäche für lange Reden, nicht aus Selbstgefälligkeit, sondern weil er einen altmodischen literarischen Geschmack besaß und unbewußt diese Gewohnheit von Gibbon oder Butler oder auch Burke übernommen hatte. Selbst seine Paradoxe konnte man nicht gerade als brillant bezeichnen. Das Wort »brillant« war lange Zeit die furchtbarste Waffe der Kritiker; jedoch ließ Pond sich nicht von dieser Breitseite der Brillanz erschüttern, geschweige denn vernichten. Als Pond also in dem Fall, um den es sich hier handelt, sagte: »Sie gehen so schnell, daß Sie nicht weiterkommen« (wobei er sich, wie ich zu meinem tiefen Bedauern feststellen muß, auf den größeren Teil des weiblichen Geschlechts bezog, zumindest in seiner modernsten Ausprägung), dann sollte das kein Epigramm sein. Und irgendwie klang es auch gar nicht nach einem Epigramm, sondern nur seltsam und rätselhaft. Und die Damen, denen er es mitteilte, insbesondere die ehrenwerte Dame Violet Varney, sahen keinen Sinn darin. Sie empfanden Mr.Pond, wenn er einmal nicht langweilig war, als zutiefst verstörend. Wie auch immer, bisweilen erging sich Mr.Pond in langen Reden. Daher bedeutete es für jeden, der Mr.Pond erfolgreich davon abhalten konnte, lange Reden zu halten, einen Triumph und eine große Ehre, und mit diesem Lorbeerzweig muß man das Haupt von Miss Artemis Asa-Smith aus Pentapolis in Pennsylvania bekränzen. Sie war gekommen, um Mr.Pond für zu interviewen und seine Vermutungen im mysteriösen Haggis-Fall anzusprechen, und ließ ihn dabei überhaupt nicht zu Wort kommen.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!