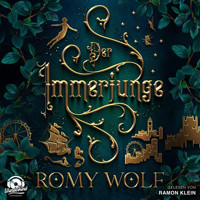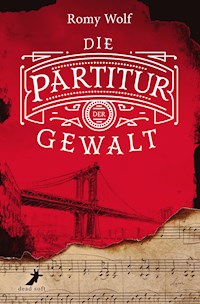
4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dead soft verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In der Zeit der Weltwirtschaftskrise kämpft Tommy ums nackte Überleben. Auch vor New York, der Stadt, die niemals schläft, hat das Leid nicht haltgemacht. Auf der Suche nach Arbeit gerät er in finstere Kreise, nur um ausgerechnet dort Mischa kennenzulernen, einen begnadeten Pianisten, der aus seinem Interesse an Tommy keinen Hehl macht. Doch ihre zarte Liaison steht unter keinem guten Stern: Tommy gerät in den Sog des mächtigsten Manns von Hell's Kitchen, und bald ist nicht nur sein Leben, sondern auch das von Mischa in Gefahr. Eine Reise durch das New York der 30er Jahre, erfüllt vom verruchten Flair der Prohibitionszeit und seelenvoller Musik.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 401
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Die Partitur der Gewalt
Impressum
© dead soft verlag, Mettingen 2017
http://www.deadsoft.de
© Romy Wolf
Coverdesign: Casandra Krammer
Lektorat: Kira Wolf-Marz
Korrektorat: Stefanie Rick
1. Auflage
ISBN 978-3-96089-096-6
ISBN 978-3-96089-097-3 (epub)
Klappentext:
In der Zeit der Weltwirtschaftskrise kämpft Tommy ums nackte Überleben. Auch vor New York, der Stadt, die niemals schläft, hat das Leid nicht haltgemacht. Auf der Suche nach Arbeit gerät er in finstere Kreise, nur um ausgerechnet dort Mischa kennenzulernen, einen begnadeten Pianisten, der aus seinem Interesse an Tommy keinen Hehl macht.
Doch ihre zarte Liaison steht unter keinem guten Stern: Tommy gerät in den Sog des mächtigsten Manns von Hell’s Kitchen, und bald ist nicht nur sein Leben, sondern auch das von Mischa in Gefähr.
„Für meinen Bruder,
der immer gewusst hat,
Thousands are sailing
Again across the ocean
Where the hand of opportunity
Draws tickets in a lottery
Postcards we're mailing
Of sky-blue skies and oceans
From rooms the daylight never sees
Where lights don't glow on Christmas trees
But we dance to the music
And we dance
Thousands are sailing
Across the western ocean
Where the hand of opportunity
Draws tickets in a lottery
Where e'er we go, we celebrate
The land that makes us refugees
From fear of priests with empty plates
From guilt and weeping effigies
And we dance
PROLOG
Er hätte die Waffe in den Hudson werfen sollen.
Stattdessen hielt er sie fest umklammert, und obwohl er sie unter die Jacke geschoben hatte, mussten doch alleine sein erschrockenes Gesicht und seine merkwürdige Körperhaltung jedem Copper auf zehn Meter Entfernung verdächtig vorkommen.
Zum Glück waren die meisten Uniformierten in der Gegend geschmiert und schauten weg, wenn es für das Geschäft einträglich und ihnen ihr Kopf lieb war. Aber hin und wieder wagte sich doch ein aufrechter Geselle in diese Gegend.
Doch selbst der grimmigste Polizist konnte ihm nicht so viel Angst einjagen wie die Vorstellung von dem, was ihm drohte, sobald Lucky Brian von Tommys Verrat erfuhr. Höchstwahrscheinlich würde man seine Leiche übermorgen aus dem Fluss fischen, wenn er überhaupt noch so lange lebte und Lucky Brian seinen Handlangern nicht befahl, ihn in Stücke zu zerlegen und quer durch Hell's Kitchen zu verteilen. Als Warnung an alle anderen, Lucky Brian niemals zu enttäuschen.
Tommy rannte durch den Regen. Es goss schon seit Stunden aus fast schwarzen, tief hängenden Wolken, die der Atlantik über die Stadt getrieben hatte. Seine Wollhose und Jacke waren vollgesogen und zogen schwer an seinen Schultern, und von der Schlägermütze rann ihm ein kleines, kaltes Bächlein erst den Nacken und dann den Rücken hinab.
Er bog in eine Seitengasse ab und blieb keuchend stehen. Über ihm türmte sich ein Labyrinth aus Feuerleitern in den Himmel, das in der Spiegelung der Straßenlaternen schimmerte.
Tommy atmete tief durch, die Waffe immer noch an seiner Brust. Seine Hand hatte sich mittlerweile so verkrampft, dass er ernsthaft Sorgen bekam, er würde den Griff nie wieder lösen können.
Schreie, dumpfes Rufen. Schuhe, die in Pfützen traten. Wasser spritzte. Dann wieder Rufe.
Tommy drückte sich enger an die Hauswand, tief in den Schatten.
War es sein Name, der gebrüllt wurde? Waren das Lucky Brians Männer, die nach dem Verräter suchten? Oder hatte Lucky Brian vielleicht noch gar nicht von der Sache erfahren?
Tommy konnte nicht sagen, ob erst Minuten oder schon Stunden vergangen waren, seit er seinen Auftrag verbockt hatte. Beinahe wünschte er sich, er hätte den Mut gefunden, den verdammten Kerl einfach zu erschießen. Überhaupt: Machte es einen Unterschied, ob man ihn jetzt oder später im Hudson versenkte?
Er zwang sich, tief durchzuatmen und schloss für einen Moment die Augen. Was sollte er tun?
Ins Ulysses zurückzukehren und um Entschuldigung zu bitten, hatte keinen Zweck – Tommy hatte zu viele Männer zu Kreuze kriechen und um Vergebung betteln sehen. Lucky Brian hatte sie alle mit einem verständnisvollen Lächeln nach Hause geschickt und versprochen, sie könnten ruhig schlafen.
Einige ihrer Leichen hatte die Polizei später gefunden. Die meisten blieben verschwunden.
Sein Herz begann zu rasen. Oh Gott, wo sollte er hin? Er war eine verlorene Seele geworden, so wie Schwester Agnes gesagt hatte. Wie um Himmels willen war er in diesen Schlamassel geraten? Er hätte auf Mischa hören sollen.
Mischa.
Tommy steckte zaghaft die linke Hand in die Jackentasche und suchte nach dem Foto, das er vor ein paar Monaten geschossen hatte. Es schien Jahre her zu sein.
Er nahm das Bild heraus und betrachtete es. Mischa am Battery Park, hinter ihm die Hudson Bay. Er lachte, in der Hand hielt er eine Zigarette, der Wind wirbelte sein schwarzes Haar auf. Tommy erinnerte sich gut an den Tag, an dem das Foto entstanden war. Kurz danach hatte das Kartenhaus begonnen, langsam in sich zusammenzufallen.
Der Regen, der noch immer auf ihn herabprasselte, drohte, das Papier zu durchweichen und so steckte Tommy das Foto eilig weg, schlug den Kragen seiner Jacke hoch und schob die Mütze tiefer ins Gesicht.
Er dachte kurz darüber nach, die Waffe hier zurückzulassen, und überlegte es sich dann anders. Vielleicht würde er sie heute Abend noch brauchen. Er spähte hinaus auf die Hauptstraße. Sie war leer. Von den aufgeregten Rufen war nichts mehr zu hören.
Tommy holte ein weiteres Mal tief Luft, die Waffe noch immer fest umklammert. Er hatte keine Ahnung, was er tun, wohin er gehen sollte. Ein Teil von ihm riet ihm, den erstbesten Zug zu nehmen und wegzufahren, egal wohin, aber er war müde. Er wollte nur noch, dass es vorbei war.
Jemand packte ihn am Arm.
Tommy fuhr herum, hob die Waffe, die er doch niemals hätte abfeuern können, und starrte ins Dunkel.
Doch anstelle von Dodge oder einem der anderen Männer Lucky Brians stand da Rose. Sie hatte sich eine Decke um die Schultern geschlungen und blickte bleich und erschrocken zu Tommy hoch.
Wie zum Teufel hatte sie ihn gefunden?
„Ich muss dir was sagen“, begann sie leise. „Es geht um Mischa.“
KAPITEL 1
New York City, Januar 1931
Der Lärm war bis auf die Straße zu hören. Das Weinen von Kindern, Schreien von Frauen und Diskutieren der Männer.
Tommy blieb vor dem Eingang des Hauses stehen und blickte die rote Fassade hoch, zu den Fenstern, über denen jemand hastig ein Schild angebracht hatte: Nothilfe. Gefolgt vom Namen der Gesellschaft, aus deren Kasse die Sofortmaßnahmen bezahlt wurden. Schuhe, Miete, was auch immer gebraucht wurde. Tommy allerdings war wegen der Arbeit hier.
Er schloss die Augen und atmete durch, bereitete sich innerlich auf die überfüllten Räume und die vielen Menschen vor.
Kein Ort, den er normalerweise besucht hätte. Doch nun blieb ihm nichts anderes übrig.
Das Treppenhaus war dunkel und roch muffig, und die Menschenschlange reichte bis weit aus den Büros die Stufen hinab.
Ein Mädchen, das kaum älter als dreizehn sein konnte, saß auf dem Treppenabsatz und hatte einen schmächtigen Jungen auf den Schoß gezogen, vermutlich ihren Bruder. Der Kleine drückte sich ängstlich an sie und nuckelte an einem Stofffetzen. Das Mädchen streichelte ihm abwesend über den Kopf, der Ausdruck in den Augen leer. Wo wohl ihre Eltern sein mochten?
Die Schlange bewegte sich nur langsam vorwärts, und ständig kamen neue Hilfesuchende dazu, die sich ebenfalls mit der Hoffnung auf Arbeit oder Unterstützung anstellten. Bald schon war Tommy zu einem Teil der dunklen, verworrenen Masse geworden, die hungernd ihre Hände nach Brot ausstreckte.
Erst vor Kurzem hatte diese Organisation ihre Pforten geöffnet, gegründet und finanziert von einem wohlhabenden Mann, dessen Name Tommy nichts sagte und der ihn auch nicht interessierte. Je neuer die Nothilfe war, desto größer die Chance, dass die finanziellen Mittel noch nicht verbraucht und die Arbeitsplätze noch nicht besetzt waren.
Auf dem Weg nach New York hatte Tommy davon in der Zeitung gelesen, und anderen schien es ähnlich gegangen zu sein.
„Das ist das fünfte Büro, zu dem ich gehe“, sagte ein Mann neben ihm, der einen Zigarettenstummel aufgesammelt und angezündet hatte. „Entweder fühlt sich keiner zuständig oder sie können dir nicht helfen.“
„Verdammte Regierung“, stimmte jemand knurrend zu. „Jede Wette: Die haben das Geld, um zu helfen. Ist doch unser Recht, die Kohle zu bekommen, wo wir uns jahrelang für Amerika den Buckel krumm geschuftet haben.“
Tommy schob seine Mütze zurecht und schloss die Augen. In der Nacht hatte er keinen Schlaf gefunden, weil die Temperatur auch in den unbeheizten Güterwaggons weit unter den Gefrierpunkt gefallen war und er nicht gewagt hatte, einzudösen. Noch jetzt lugten seine Finger tiefrot aus den fingerlosen Handschuhen heraus.
Alle paar Minuten ging ein Ruck durch die Menge, und Tommy erklomm eine weitere Stufe.
Er wollte nichts als Arbeit. Deshalb war er hier, deswegen waren die meisten hier. Wie ein riesiger Chor, der monoton rief: „Arbeit. Arbeit.“
Am späten Nachmittag wurde Tommy als einer der Letzten zu einer Sachbearbeiterin durchgelassen. Die Schlange hinter ihm begehrte unwillig auf, den ganzen Tag hätten sie sich die Beine in den Bauch gestanden, für nichts.
„Bitte kommen Sie morgen wieder“, wies eine hagere Frau die Wartenden an. Sie war blass, mit dunklen Ringen um die Augen, als hätte auch sie seit Wochen nicht genug Schlaf bekommen. „Es tut mir leid“, fügte sie hastig hinzu und klang dabei wirklich, als hätte sie am liebsten noch mindestens zwanzig andere durchgelassen.
Doch draußen war es bereits seit über einer Stunde stockfinster, und im Wartebereich saßen noch gut zwei Dutzend Hilfesuchende. Das Mädchen und ihr Bruder waren auch dabei. Immerhin war es in den Räumlichkeiten nicht so kalt und zugig wie im Treppenhaus.
Die Frau, die Tommy schließlich gegenübersaß und hinter einem Turm von Formularen und Papierkram zu verschwinden drohte, wirkte ebenso müde wie ihre Kollegin. Ihr Lippenstift war über den Tag verblasst, als hätte sie keine Zeit gefunden, ihn frisch aufzutragen. Auf dem Schreibtisch stand ein schwarzes Namensschild: Mrs. E. Friedrichs.
„Was kann ich für Sie tun, Mr. Kennedy?“
Tommy trug sein Anliegen vor. Arbeit, er sei wegen Arbeit nach New York gekommen.
Müde rieb sich Mrs. Friedrichs über die Stirn.
„Diese verdammten Zeitungen“, murrte sie. „Ständig berichten sie es, wenn irgendwo ein reicher Mann oder die Kirche beschließt, ein paar Mittel zur Verfügung zu stellen. Als ob wir endlos davon hätten. Jetzt müssen wir nicht nur die Leute aus New York versorgen, sondern auch noch die, die durch solche Meldungen angelockt werden.“ Sie sah zu ihm hoch. „Sie sind heute mindestens der dreißigste mit dieser Geschichte.“
„Ich will kein Geld“, wagte Tommy klarzustellen. Er konnte nicht verhindern, dass seine Hände nervös mit der Mütze in seinem Schoß spielten. „Ich will bloß irgendeine Anstellung.“
Mrs. Friedrichs seufzte schwer. „Wo keine Arbeit ist, kann man auch keine vermitteln. Wir sind keine Stelle für Beschäftigungslose. Wir bieten den Mittellosen Hilfe an.“ Dann setzte sie nachdrücklich hinterher: „Den Familien.“
Tommy schluckte. „Ich habe nichts. Kein Geld. Kein Essen. Keine Bleibe. Ich brauche Arbeit.“
„Mr. Kennedy“, setzte sie an. „Ich verstehe das. Aber haben Sie die Schlange da draußen gesehen? Wissen Sie, wie viele von den Leuten da draußen Familien zu versorgen haben? Heute waren sechs Mütter hier, die mich unter Tränen baten, ihren Kindern einen Platz im Waisenhaus zu besorgen, weil sie die Kleinen nicht mehr ernähren können. Viele der Männer berichteten mir, dass sie mit zwei oder drei anderen Familien in kalten, winzigen Wohnungen leben, weil sie eine eigene Unterkunft nicht mehr bezahlen können. Ganze Familien sind krank, weil Nahrung und medizinische Versorgung fehlen. Ich habe großes Mitgefühl für Ihre Situation, aber unsere Ressourcen sind begrenzt, und die Not ist groß. Wir müssen Prioritäten setzen, und das sind die Familien.“
Benommen nickte Tommy, während die Worte noch in seinen Ohren widerhallten. Keine Arbeit. Nicht einmal hier, in New York.
„Und nun?“, brachte er hervor.
Mrs. Friedrichs legte den Kopf schief und bedachte ihn mit einem langen, nachdenklichen Blick. Dann zog sie ein Blatt Papier hervor, schrieb etwas darauf und reichte Tommy die Notiz.
„Das ist die Adresse der städtischen Notunterkunft. Dort finden Sie einen warmen Platz für die Nacht. Ich kann Ihnen auch ein wenig Geld geben, damit Sie die nächsten Tage über die Runden kommen, aber mehr ist nicht möglich.“
Er räusperte sich und nickte noch einmal, während er den Zettel wegsteckte. Eine Massenunterkunft. Alleine der Gedanke daran ließ ihn sich schütteln. Er stand auf und zwang sich zu einem schmalen Lächeln. „Danke sehr.“
„Ich wünschte, ich könnte mehr tun“, sagte Mrs Friedrichs noch.
Tommy glaubte ihr.
Die Stadt hatte sich kaum und zugleich völlig verändert.
Das war der erste Gedanke, der Tommy auf dem Weg zu der Notunterkunft überkam. Noch immer schlängelten sich der Hudson und der East River um die Insel von Manhattan. Noch immer überragte die imposante Brooklyn Bridge, die dem Big Apple wie ein großes Tor vorgelagert war, die umliegenden Häuser.
Noch immer liefen Musicals und Theaterstücke am Broadway. Noch immer versuchten die Theater, mit großen Werbetafeln Zuschauer anzulocken. Das National Theatre zeigte A Farewell to Arms, das Theatre Republic Frankie and Johnnie und das Maxine Elliott‘s Theatre versuchte es mit dem Shakespeare-Klassiker Twelfth Night. In New York, so schien es, gab es mehr Theater als Einwohner.
Der Times Square war belebt wie eh und je, an jeder Straßenecke hupte ein Automobil. Die liebevoll polierten, geschwungenen Karosserien blitzten im Licht der Theaterreklamen. Auf den Rückbänken saßen vornehme Damen mit in Wellen gelegten Haaren und Männer mit grauen oder schwarzen Hüten, lässig einen Arm um die Schultern ihrer Begleitung gelegt. Und da, wo kein Automobil fuhr, bahnte sich die Tram ihren Weg durch das Getümmel. Fußgänger überquerten lachend die Straße, ohne auf den Verkehr zu achten. Es glich einem Wunder, das nicht ständig jemand überfahren wurde.
Die Gebäude waren noch größer geworden, noch höher, seit Tommy zum letzten Mal durch die Straßen gestromert war. Fast schien New York wie die Stadt aus seiner Erinnerung, immer in Bewegung, immer in Veränderung, der Ort, an dem Träume wahr werden konnten.
Aber die Wirtschaftskrise war nicht spurlos an der Stadt vorbeigezogen. Auf dem Weg hierher hatte Tommy in den Vororten die leeren Häuser gesehen, deren Besitzer die Hypotheken nicht länger hatten zahlen können und weggezogen waren.
Weniger Besucher strömten zum Broadway. An jeder Straßenecke versuchten die Arbeitslosen, für ein paar Cents Äpfel zu verkaufen. Und überall waren Lager aus behelfsmäßigen Unterkünften entstanden. Aus Pappe und Holz, Wellblech und Planen waren kleine Siedlungen aus dem Boden geschossen, Stadtteile in Stadtteilen. Sie bildeten die letzte Zuflucht für diejenigen, die unter die Räder des amerikanischen Traumes geraten waren.
So wie Tommy.
Ein paar Jahre lang hatte er im mittleren Westen als Erntehelfer Kartoffeln gesammelt, hatte auf Ranches nach dem Viehtrieb Rinder gezählt und beim Einlagern von Heu geholfen. Er hatte in kleinen, stickigen Hütten geschlafen und in Ställen übernachtet und ein paar Mal sein Lager unter freiem Himmel aufgeschlagen. Jetzt, mit zweiundzwanzig Jahren, war er wieder von Hochhausschluchten eingekesselt.
Tommy mochte das weite Land und die Prärie, die bis zum Himmel reichten. Aber die Wirtschaftskrise hatte die Landbevölkerung genauso hart getroffen wie die Städte, wenn nicht noch schlimmer, und so war ihm die Rückkehr nach New York als einzige Lösung erschienen, wenn er wieder auf die Beine kommen wollte. Hier gab es wenigstens einige privat organisierte Einrichtungen, die den Armen halfen.
Dabei gefiel ihm New York nicht einmal besonders. Er konnte nur hoffen, dass die Politiker die Notlage der Nation schnell in den Griff bekamen. Dann würde er zurückgehen. In die Weite des mittleren Westens, wo sich niemand an seiner Einsilbigkeit störte und es leicht war, mit dem Himmel und dem Land zu verschmelzen und so zu tun, als existiere man gar nicht.
Mit dem Zettel und ein paar Dollar in der Tasche erreichte Tommy schließlich die städtische Notunterkunft. Ein schmuckloses, mehrstöckiges Gebäude, vor dem sich ein paar Männer tummelten. Zu den freien Mahlzeiten, hatte Tommy gehört, nahm die Schlange vor dem Haus kein Ende.
Hinter einigen der Fenster brannte Licht, aber besonders einladend wirkte das Gebäude trotzdem nicht. Eher wie der Vorhof zur Hölle. Mit dem kannte Tommy sich aus.
Langsam setzte er sich in Bewegung. Bei den Temperaturen konnte er unmöglich draußen schlafen, und vielleicht würde es ja nicht so schlimm werden.
Du kennst das doch, machte er sich Mut. Es ist nur für ein paar Tage. Bis du Arbeit findest.
Mit gesenktem Kopf und den Händen in den Hosentaschen schlenderte er an den anderen Männern vorbei, die heimlich einen Flachmann mit vermutlich Schwarzgebranntem herumreichten und sich darüber unterhielten, ob die Lage in einer anderen Stadt vielleicht besser sei.
Direkt hinter der Eingangstür befand sich die Anmeldung, eine Art Verschlag, in dem hinter einem Schiebefenster ein älterer Mann saß und Zeitung las. Als er Tommy bemerkte, legte er die Zeitung zur Seite und schob das Fenster auf.
„Die nächste Mahlzeit gibt es morgen früh. Oder bist du wegen eines Betts hier?“
„Ich …“ Tommy leckte sich über die Lippen und nickte, legte dann einen Vierteldollar auf den Tresen.
„Mhm“, brummte der Mann und nahm das Geldstück an sich. „Eine Handvoll Betten ist noch frei. Kannst dir das beste aussuchen. Drei Regeln: kein Alkohol, keine Schlägereien und kein Damenbesuch. Kapisch?“
„Ja, Sir.“
Die Anrede schien dem Mann zu gefallen. Er legte den Kopf schief. „Als Erstes musst du dich auf der Krankenstation untersuchen lassen. Geradeaus und am Ende des Gangs rechts. Flöhe oder ansteckende Krankheiten können wir hier nicht gebrauchen. Deine Sachen kannst du hier anschließend auch waschen lassen. Du bezahlst pro Nacht.“
Ohne ein weiteres Wort zu verschwenden, zog der Mann das Fenster wieder zu und widmete sich seiner Zeitung. Tommy hingegen blickte hinab auf seinen alten Seesack, der alles beinhaltete, was er besaß. Ein paar abgetragene Hemden und eine zweite Hose. Er war sich nicht einmal sicher, ob sie eine Wäsche überstehen würden.
Zögernd machte er sich auf den Weg. Bei der Vorstellung, sich einer Untersuchung unterziehen zu müssen, wurde ihm ganz anders. Fremde Menschen, die ihn begutachteten wie ein Stück Fleisch. Die ihn anfassten. Und was würde geschehen, wenn sie tatsächlich feststellten, dass er krank war? Er konnte sich weder einen Arzt noch Medikamente leisten. Da war es ihm lieber, wenn er erst gar nichts davon erfuhr.
Einige der Türen, die von dem langen Flur abgingen, standen offen und gewährten Einblick in die Räume dahinter.
Ein kleiner Gemeinschaftsraum, in dem ein paar Männer zusammensaßen. Einige lasen, einer lauschte gebannt dem Radio. Ihre Kleidung war abgetragen, aber sauber, und alle waren rasiert und die Haare zumindest gekämmt. Ein bisschen wie er selbst, fand er.
Dann entdeckte er den Schlafsaal – oder zumindest einen davon.
Der Raum schien ihm riesig, mit zwei endlos langen Reihen von Hochbetten, die dicht an dicht nebeneinanderstanden. Die Wände waren kahl, und außer den Betten befanden sich keine Möbel in dem Zimmer.
Auf einigen wenigen lagen Männer, dösten oder lasen, einer betrachtete andächtig eine Fotografie in seinen Händen. Auf den meisten Matratzen lagen Taschen oder ordentlich gefaltete Kleidungsstücke, und plötzlich packte Tommy das kalte Entsetzen.
Das Geräusch von weinenden Kindern kämpfte sich aus den Untiefen seiner Erinnerungen nach vorne, das Knallen eines Rohrstocks, der auf nackte Haut prallte. Der scharfe Geruch von Urin, den auch die stärkste Kernseife nicht völlig aus den Laken hatte bannen können.
Benommen tastete Tommy nach der Wand, schüttelte den Kopf. Das war albern, völlig albern. Aber das Gefühl einer Hand um seine Kehle, die beständig zudrückte, wollte nicht verschwinden. Schweiß trat ihm auf die Stirn. Auf einmal war ihm unerträglich heiß, dann überkam ihn ein eisiger Schauer.
Er wollte die Erinnerungen wegblinzeln, aber es ging nicht. Noch einmal atmete er durch, dann nahm er seine Sachen und rannte nach draußen.
In einem Café, das die ganze Nacht geöffnet hatte, bestellte er sich einen Kaffee und hoffte, er würde eine zweite Nacht ohne Schlaf durchstehen. Er holte die Münzen, die er noch besaß, aus der Hosentasche und breitete sie vor sich auf dem Tisch aus. Das Geld von der Nothilfestelle würde kaum für eine Mahlzeit reichen, vor allem, da Tommy schon für eine Übernachtungsmöglichkeit gezahlt hatte, die er nicht benutzen würde.
Gähnend fuhr er sich mit den Händen durch die Haare und schaffte es nur mit Mühe, nicht einzuschlafen. Er hatte keine Ahnung, wie es weitergehen sollte. Blieb nur zu hoffen, dass die Tasse Kaffee ihm genug Grund geben würde, zumindest ein paar Stunden im warmen Café sitzen zu bleiben. Danach musste er weitersehen.
Er schloss die Augen und ignorierte seinen Magen, der vor Hunger verkrampft war. Das letzte Mal hatte er am Vortag etwas Essbares in den Händen gehalten.
Am Ende musste er doch weggenickt sein, denn plötzlich stand jemand neben ihm und schüttelte ihn am Arm.
„Hey, Junge.“
Tommy schreckte hoch und blinzelte zu der Gestalt über ihm. Da stand eine ältere Kellnerin in der mintgrünen Uniform des Cafés und musterte ihn nachdenklich, aber nicht unfreundlich. Auf ihrem leicht gebräunten Gesicht zeichneten sich Falten ab, und ihre grauen Haare waren zu einem Dutt zusammengesteckt.
Unwillkürlich fragte Tommy sich, wie alt sie wohl war – Zeiten wie diese ließen die Menschen vor ihrer Zeit alt werden.
„Harter Tag?“, fragte die Frau. Ihr Akzent war eindeutig spanisch, vermutlich stammte sie aus Puerto Rico oder Mexiko. Sie trug ein Namensschild an der Brust. „Alma“ stand darauf. In ihrer Hand hielt sie eine Kaffeekanne.
„Mhm“, machte Tommy bloß. Ein Blick auf die Uhr verriet ihm, dass es schon elf war. Aber noch lag eine ganze Nacht vor ihm.
„Hör mal, Junge“, sagte sie und lächelte. „Du musst dich nicht an deinen Kaffee klammern, um nicht in die Kälte zu müssen. Da würde ich nicht einmal einen Hund hinausschicken. Heute ist wenig los.“ Sie deutete zu den leeren Sitzbänken. „Leg dich hin. Du siehst aus, als ob du dringend Schlaf brauchst. Ich habe bis morgen früh Schicht. Ich passe auf, dass niemand deine Sachen nimmt, ja?“
Sprachlos starrte Tommy sie an. „Wirklich?“, stieß er hervor.
Sie lächelte traurig. „Mein Sohn ist in deinem Alter. Er ist irgendwo in Arizona und sucht nach Arbeit. Ich hoffe, dass ihm auch jemand einen Platz für die Nacht gibt.“
„Das hoffe ich auch“, erwiderte er und schluckte. „Danke. Gracias.“
Er streckte sich auf der Bank aus, schob seinen Seesack als Kissen unter den Kopf und war innerhalb von Augenblicken eingeschlafen.
In der Nacht kam es zu einer Schießerei. Reifen quietschten, Schreie hallten dumpf durch die Straßen.
Beim ersten Mal lag Tommy lange und lautlos wach und wagte kaum zu atmen. Er hörte sein Herz laut gegen seine Brust hämmern und spürte, wie sich seine Hände zu Fäusten ballten. Aber Alma war da, putzte unbeeindruckt die Theke, und das war so beruhigend, dass Tommy die Furcht beiseite drängte und wieder in den Schlaf fand.
Es fielen noch weitere Schüsse, und Tommy wusste, dass am nächsten Morgen wieder Tote an die Piers der Docks gespült werden würden.
Damals, im Waisenhaus, hatte er die Schüsse nicht einmal mehr gehört, sondern friedlich weiter geschlummert. Sie hatten zu seinem Leben gehört wie das Morgengebet und der ewige Haferschleim, den es zum Frühstück gab. War er wirklich schon so lange aus der Stadt fort, dass ihn die Geräusche der Nacht aufschreckten wie ein scheues Wildpferd?
Alma weckte ihn, bevor sie ging. Sie hätte noch zwei kleine Kinder zu Hause, ihre Schicht sei zu Ende. Ein Sandwich hatte sie ihm hingestellt, das Tommy so eilig hinunterschlang, dass er davon Magenschmerzen bekam. Als er fertig war, schulterte er seinen Seesack und machte sich auf den Weg. Wohin genau, das konnte er selbst nicht sagen.
Der Tag brachte ihm außer Müdigkeit und Schnee nichts ein. Hatte der Morgen auch mit Sonnenschein begonnen, so zogen gegen Nachmittag dunkle Sturmwolken auf, und als es Abend wurde, ließen sie ihre weiße Fracht über New York fallen und bedeckten die Stadt mit dicken, weißen Flocken. Zeitweise konnte Tommy nur ein paar Schritte weit sehen. Binnen Minuten war er bis auf die Knochen durchnässt.
Niemand hatte Arbeit anzubieten, zumindest nicht für einen fremden Landstreicher. Manche hatten schon abgewinkt, bevor Tommy dazu gekommen war, sein Anliegen vorzutragen.
„Wir haben nichts“, hatten sie gesagt. „Die Zeiten sind hart. Versuch es woanders.“
Vielleicht lag es auch an seiner Statur. Die Arbeit auf dem Land hatte ihm zwar gutgetan, ihn muskulös und zäh gemacht, aber seit er arbeitslos war und kaum noch etwas in den Magen bekam, hatte er an Gewicht verloren. Die Kleidung schlackerte ihm um den Körper, als habe er sie aus zweiter Hand von einem Riesen bekommen. Seine Arme waren dürr, das Gesicht eingefallen.
Manchmal, wenn er in einem Fenster einen Blick auf sein Spiegelbild erhaschte, erschrak er vor sich selbst. Unter seinem roten Schopf sah er aus wie Gevatter Tod persönlich.
Ausgerechnet die roten Haare hatte er von seinem Vater erben müssen, als ob es in diesem Land nicht schon schlimm genug war, einen irischen Namen zu haben. Damit entsprach er dem gängigen Klischee eines irischen Bauerntölpels – und dass, obwohl die meisten Iren in Wirklichkeit dunkle Haare hatten.
Tommy hatte Irland noch nie gesehen. Er war in Brooklyn geboren worden, später waren seine Eltern nach Hell’s Kitchen gezogen. Ursprünglich stammten sie aus Connemara und waren um die Jahrhundertwende mit einem Ozeandampfer nach New York gekommen.
Tommy war das jüngste Kind der Familie gewesen und das einzige, das noch am Leben war. Seine Mutter hatte oft von Irland gesprochen, der Heimat. Er erinnerte sich an die traurigen Volkslieder, die sie gesungen hatte. Damals, als sie für kurze Zeit eine Familie gewesen waren. Dann wurde Thomas Kennedy Senior auf offener Straße erschossen. Seine Frau starb wenige Monate später an Tuberkulose, und der Staat gab Tommy in die Obhut des Blessed Virgin Mary.
Die Nonnen dort gaben sich größte Mühe, ihm die „Bauernsprache“ auszutreiben. Doch alle Versuche scheiterten. Je öfter die Nonnen zum Rohrstock griffen oder ihn ohne Wasser und Brot in einen Kellerraum sperrten, desto mehr klammerte sich Tommy an seinen Akzent. Er war das Einzige, das ihm von seiner Familie geblieben war.
Erst in den vergangenen Jahren im mittleren Westen war der irische Klang aus seinen Worten verschwunden, verwässert, und nun kaum noch zu erahnen. Nur die roten Haare waren ihm geblieben. Das und Wurzeln im mysteriösen Connemara, das ebenso gut in Afrika hätte liegen können.
Tommy hatte das Gefühl, jeden Augenblick einfach vornüber zu kippen und auf dem Weg liegen zu bleiben. Seine Zehen waren taub vor Nässe und Kälte. Sein Magen hatte sich in einen einzigen großen Knoten verkrampft. Hinter den Schläfen hämmerte es immer noch. Die Kleidung klebte ihm nass und eisig am Körper und machte keine Anstalten zu trocknen. Die Wechselkleidung, die Tommy in dem Seesack mit sich herumtrug, hatte dem Regenguss ebenfalls nicht standgehalten.
Er kam an dem Café vorbei, doch statt Alma bediente eine andere Kellnerin, und er wagte nicht, hineinzugehen, weil er kein Geld mehr besaß, um sich etwas zu bestellen.
Stattdessen wanderte er weiter, bis er zur Grand-Central-Station an der East 42nd Street kam.
Der große Bahnhof in Manhattan war ein beeindruckender Anblick. Eingekesselt von Hochhäusern stach das gewaltige Gebäude durch seine Wuchtigkeit heraus. Die riesigen Fenster schienen aus einer anderen Welt zu stammen, als hätten Giganten aus einer irischen Legende sie eingesetzt. Die Automobile und Trams, die davor hielten, wirkten verschwindend klein, unbedeutend im Angesicht der erhabenen Architektur.
Von innen war die Grand-Central-Station nicht minder beeindruckend. Mit ihrer hohen Decke und den breiten Treppen haftete der Eingangshalle etwas Sakrales an.
Tommy sah eine jüngere Version von sich die Treppen zu den Bahngleisen nehmen, die Schritte damals beschwingt, voller Vorfreude, weil er das Waisenhaus endlich hinter sich lassen konnte und das weite Land vor ihm lag.
Ein Geist aus vergangenen Zeiten.
Um diese Zeit war der Bahnhof leerer als am Tag, aber mitnichten verlassen. Noch immer kamen Reisende von den Bahnsteigen und eilten zu den Taxen.
Tommy hingegen machte sich auf den Weg zum Wartesaal. Wenn er Glück hatte, würde er dort ein paar Stunden Schlaf bekommen, bevor ihn einer der Sicherheitsleute verscheuchte. Zwar war es auch im Wartesaal kalt, aber immerhin bot er ein Dach über dem Kopf.
Tommy rollte sich auf einer der dunklen Holzbänke zusammen. Seine Knie schmerzten, seine Zähne klapperten vor Hunger und Kälte, und die Feuchtigkeit aus Hemd und Hose kroch langsam und unerbittlich in jede Faser seines Körpers.
New York City. Nirgendwo ging man so schnell vor die Hunde wie hier.
Was hätte er nicht für ein eigenes Dach über dem Kopf gegeben. Für eine warme Mahlzeit, die nicht als Almosen des Staates ausgegeben wurde, für ein Bett und einen Satz passender, neuer Schuhe.
In der Nacht fielen wieder Schüsse, doch Tommy ignorierte sie. Er war zu erschöpft und durchgefroren, um sich um irgendetwas zu scheren.
Nie zuvor hatte er sich so verlassen gefühlt.
Er wartete auf den Morgen. Und darauf, dass sich das Blatt für ihn wendete.
In den frühen Morgenstunden entdeckte ihn ein Copper und ermahnte ihn, den Wartesaal nie wieder als Schlafplatz zu missbrauchen. Seine Worte klangen halbherzig, und vermutlich schickte er ihn nur davon, weil es der Anordnung seiner Vorgesetzten entsprach. Doch am Ergebnis änderte das nichts.
Es war vier Uhr morgens, als Tommy bei Eiseskälte durch Midtown streifte und sich wünschte, er wäre niemals hergekommen.
Seine Gedanken schweiften zu den Zelten und Holzhütten ab, die er entlang der Bundesstraßen und in den Vororten größerer Städte gesehen hatte. Hin und wieder hatte man ihm auf seiner Wanderung sogar einen Platz für die Nacht angeboten. Wenn die Einwohner Glück hatten, füllten ihre Besitztümer die Ladefläche eines Pick-ups. Oft war es weniger. Selbst im Central Park begannen die Leute angeblich bereits, sich solche Unterkünfte zu bauen.
Tommy erinnerte sich daran, wie sehr er den Park als Kind bewundert hatte, dieses Paradies mitten in der Stadt, das wie eine eigene Welt schien, wie das Tor nach Oz. Erinnerte sich daran, mit zu engen Schuhen in Zweierreihen über den Weg zu laufen und sich zu wünschen, über die endlosen grünen Wiesen zu rennen, bis er vor Müdigkeit umfiel.
Aber die Nonnen des Blessed Virgin Mary Waisenhauses hielten nichts von ausgedehnten Spielzeiten. Der Spaziergang durch den Central Park war das höchste der Gefühle, seit der Arzt angeordnet hatte, dass die Kinder häufiger ins Freie sollten.
Tommy erinnerte sich an Damen mit kurz geschnittenen Haaren in formlosen Pelzmänteln, die Arm in Arm mit anderen Frauen oder Männern durch den Park spazierten. Ob der Börsenabsturz sie auch so hart getroffen hatte? Wo mochten sie jetzt wohl sein?
Das Waisenhaus, so viel wusste Tommy immerhin, war mittlerweile geschlossen. Er dachte kurz darüber nach, dem nun leer stehenden Haus einen Besuch abzustatten, entschied sich aber dann dagegen. Es war besser, wenn die Erinnerungen an die kalten, dunklen Flure und das Weinen der anderen Kinder für immer in ihm vergraben blieben.
Tommy rieb sich über das Gesicht und seufzte schwer. Seine Schuhe waren schon seit Wochen durchgelaufen. Seine Haare hatten einen Barbierbesuch nötig, seine Hose war mehrmals geflickt und an der Jacke löste sich der Saum. Es war unwahrscheinlich, dass seine Kleidung noch einen Winter überstehen würde.
Er setzte einen Fuß vor den anderen. Und dann noch einen und noch einen. Er war des Wanderns müde, des Herumsuchens, des Nichtfindens. New York City war sein letztes Pferd im Stall, sein Notfallplan. Wenn er es hier nicht schaffte, dann würde er es nirgendwo schaffen.
Niemand hatte etwas zu verschenken. Schon gar keine Arbeit.
Am dritten Tag in New York reihte Tommy sich in die Schlange der Hungrigen vor der Suppenküche ein und kam sich vor wie ein Bettler. Er bekam eine Kelle voll Eintopf, dem es an jeglichem Geschmack fehlte, aber immerhin seinen Magen für den Rest des Tages mit wohliger Wärme füllte und den Hunger für ein paar Stunden zur Seite schob.
Um ihn herum wurden Neuigkeiten ausgetauscht: wo es angeblich noch Arbeit gab, wo es definitiv keine Arbeit mehr gab, welches Geschäft in welchem Block nun auch noch pleitegegangen war, welche Nachbarn die Miete nicht mehr hatten bezahlen können und vor die Tür gesetzt worden waren.
Tommy hörte schweigend zu, während er den Eintopf löffelte. Gute Nachrichten, so schien es, gab es entweder nicht oder sie waren an einer anderen Suppenküche versammelt.
Er seufzte innerlich. Machte es überhaupt Sinn, weiter nach Arbeit zu suchen? Vielleicht war es das Beste, wenn er sich unter eine Brücke legte und darauf wartete, dass der Frost kam und er friedlich erfror.
Zwei Wochen später schlief er noch immer dort, wo man ihn gerade duldete. Wenn Alma im Café war, dann winkte sie ihn hinein, setzte ihm einen Kaffee und ein Sandwich vor die Nase und ließ ihn auf der Bank schlafen.
Mittlerweile wusste Tommy, dass sie mit Nachnamen Cortez hieß, ihr Mann sie vor vier Jahren sitzengelassen hatte und sie sich ihre Wohnung mit einer anderen Familie teilte, damit ihre Kinder überhaupt ein Dach über dem Kopf hatten. Wenn Alma nicht da war, dann schlief Tommy im Bahnhof, wo man ihn immer wieder vertrieb und einmal festnahm und über Nacht ins Gefängnis steckte. Immerhin war es dort warm.
Zweimal verbrachte er sogar die Nacht im Freien, zugedeckt mit Zeitungen und Pappe, und zu erschöpft, um sich vor dem Kältetod zu fürchten. Einmal wachte er auf - überrascht, noch am Leben zu sein – und war von einer kleinen Schneeschicht bedeckt.
Die Feuchtigkeit wollte nicht mehr aus seiner Kleidung weichen, und er hatte das sichere Gefühl, dass er sich früher oder später eine Lungenentzündung einfangen würde.
Tagsüber zog er rastlos durch die Straßen. Er sah den Kindern beim Spielen zu, die sich selbst von knurrenden Mägen und eisigen Winden nicht die Laune verderben ließen.
Er dachte an seine Tage im Waisenhaus zurück, an seine Freunde damals, die nun in alle Winde verstreut waren. Tommy hatte keine Ahnung, wohin es sie verschlagen hatte. Wie viele von ihnen hatten es geschafft? Wie viele wanderten jetzt wie er hungrig und ohne Bleibe durch die Straßen, wie viele hatte der Tod schon dahingerafft?
Er wünschte, es hätte einen Ort gegeben, von dem er hätte träumen können. Einen Ort der Hoffnung, auf den er bauen konnte, an den er sich klammern konnte, wenn die Nächte eisig wurden. Doch New York hatte diesen Platz in seinem Innern bisher ausgefüllt.
New York City war die Endstation für all jene, die der Hudson in den Hafen trieb.
Die Nonnen hatten ihn vor Hell’s Kitchen gewarnt. Was angesichts der Tatsache, dass Blessed Virgin Mary mitten in diesem Viertel lag, einiges aussagte.
„Geht von hier weg, Kinder“, hatte Schwester Agnes mit strengem Blick und so viel Bestimmtheit, wie ihre dünne Stimme es zuließ, gepredigt. „Hier gibt es nur Verderben und Sünde. Jede Seele hier ist verloren. Ihr wollt doch keine verlorenen Seelen werden?“
Hin und wieder hatte sie ihre Warnungen mit blumigen Bildern untermalt, und noch heute löste die Erinnerung an ihre Worte ein unterschwelliges Gefühl von Bedrohung in Tommy aus.
Hell‘s Kitchen war Gangland und trug nicht umsonst das Wort Hölle in seinem Namen. Davon abgesehen war Hell’s Kitchen der Ort, an dem Tommy innerhalb der abgeschotteten Welt des Waisenhauses aufgewachsen war, und für den er daher wenig Zuneigung empfand.
An jenem Tag im Januar 1931 schließlich trieben der Hunger und die Suche nach Arbeit ihn doch in das verrufene Viertel.
Was auch immer er erwartet hatte, Hell‘s Kitchen gab sich Mühe, seine Vorstellungen nicht zu erfüllen. Wahrscheinlich hatte ein kindlicher Teil von ihm geglaubt, Bürgersteige voll blutiger Leichen zu sehen und leblose Körper, die von den Laternenpfosten baumelten und im Wind tanzten. Automobile, deren Insassen mit der Maschinenpistole im Anschlag in den Straßen patrouillierten und sich im Vorbeifahren gegenseitig Gefechte auf offener Straße lieferten.
Irgendwo tief in seinem Innern musste Tommy überzeugt gewesen sein, es gäbe hier nur Gangster mit langen Mänteln, Schlapphüten und einer Zigarre im Mundwinkel.
Stattdessen wirkte das Viertel auf den ersten Blick ziemlich unverdächtig. Die Straßen schienen nicht verlotterter als in anderen Teilen Manhattans, und auch die Bewohner hatten nichts Andersartiges an sich.
Er konnte nicht sagen, ob Erleichterung oder Verwunderung in ihm überwogen.
Männer saßen trotz des Schnees vor den Pubs, unterhielten sich und schenkten Tommy keine weitere Beachtung, als er an ihnen vorüberging. Über die Gassen hinweg riefen sich Frauen etwas zu, während sie Hemden und Hosen an die quer gespannten Wäscheleinen hängten. Aus manchen Fenstern drang Lachen, aus anderen Schreie, aus manchen Kinderweinen und ganz selten konnte Tommy ein wenig Musik erhaschen, während er sich in südwestlicher Richtung durch das Viertel vorarbeitete.
Aus einem der Pubs dröhnte der Klang eines Radios, und als Tommy hineinspähte, sah er eine Gruppe Männer, die um den Empfänger saßen und andächtig der Stimme lauschten, die ein Baseballspiel kommentierte.
Tommy hatte gerne Baseball gespielt, damals als Kind. In den letzten Jahren hatte er noch hin und wieder gespielt. Auf dem Land hatte es neben den Amateurspielen nicht viel andere Unterhaltung gegeben. Für die Profiliga hatte es jedoch nie gereicht.
Tommy musste unwillkürlich lächeln. Er war der langsamste Junge im ganzen Heim gewesen, und auch später noch als junger Erwachsener war er der schlechteste Läufer geblieben. Zumindest von denen, die zwei gesunde Beine besaßen.
Auf der Straße war eine Gruppe Mädchen so ins Seilhüpfen vertieft, dass sie Tommy keines Blickes würdigten. Gegenüber spielten ein paar Jungen mit einer Konservenbüchse Fußball und riefen sich in einer Sprache, die er nicht verstand, etwas zu. Sie lachten.
Tommy fragte sich, was die Nonnen wohl dazu gesagt hätten. Die Ausgeburt der Hölle hatten sie sich sicherlich anders vorgestellt.
KAPITEL 2
Präsident Hoover hielt es nicht für nötig, den Hungernden und Obdachlosen Hilfe zukommen zu lassen – die Sache würde sich schon selbst wieder einrenken. Wenn der Präsident die verdorrten Felder im mittleren Westen, die Geisterstädte, das Elend in den Siedlungen mit eigenen Augen gesehen hätte, dann hätte er seine Meinung vielleicht geändert.
Auf dem Weg zur Suppenküche kam Tommy an einem Zeitungsstand vorbei, wo die neueste Ausgabe der Tageszeitung auf den Titelseiten Durchhalteparolen propagierte und verkündete, die Amerikaner hätten sich schon immer selbst zu helfen gewusst. Eine Einmischung der Regierung sei nicht notwendig.
Tommys Blick streifte die Schlagzeile nur kurz. Länger konnte er diesen Unsinn nicht ertragen.
Der Weg zum Nebengebäude der Pfarrei von Holy Innocents führte an geschlossenen Ladenlokalen vorbei, an Hinweisschildern in Schaufenstern, dass man gerade keine Arbeit zu vergeben habe, und Barbieren und Händlern, die trotz der Kälte vor ihren Geschäften hockten und auf Kundschaft hofften. Sie schenkten Tommy keine Beachtung, als er sie passierte, die Hände in die Jackentaschen geschoben – er war einer von vielen, von Tausenden, ein weiterer gescheiterter amerikanischer Traum.
Holy Innocents war eine kleine Kirche, aus grobem grauen Stein gehauen und im gotischen Stil erbaut, der das Gebäude älter wirken lassen sollte, als es eigentlich war. Ein paar Stufen führten hoch zur Eingangspforte, einer massiven Tür aus dunklem Holz, über der ein rundes Fenster eingelassen war, das die Kreuzigung Jesu zeigte. Dahinter verbarg sich, im Keller eines niedrigen Häuschens, die Armenspeisung.
Wie alle Suppenküchen im Land finanzierte sich auch diese durch Spenden mildtätiger Geber, die durch den Börsencrash im Vorjahr nicht völlig ruiniert worden waren. Tommy hasste es, auf die Almosen anderer angewiesen zu sein, aber noch mehr hasste er es zu hungern.
Im Haus war es warm, der Geruch einer unbestimmbaren Speise hing in der Luft.
„Guten Tag“, begrüßte ihn eine Frau mittleren Alters und mittlerer Haarfarbe, die oben an der Tür saß. „Schön, dich wiederzusehen.“ Sie drückte Tommy zwei kleine gelbe Zettel in die Hand. Essensmarken für jeweils einen Teller Suppe.
Er verzog den Mund zu einem halben Lächeln. Patty hieß sie, so viel hatte Tommy den Gesprächen an den anderen Tischen entnommen, und sie begrüßte jeden mit einem freundlichen Wort und einem Funkeln in den Augen.
Ob ihr Enthusiasmus der Nächstenliebe geschuldet war oder ob die sich einfach freute, dass die Armut die Schäfchen zurück in den Schoß der Kirche trieb, konnte Tommy nicht sagen. Irgendwie erschienen ihm ihre Worte heuchlerisch. Wäre es nicht viel schöner gewesen, ihn nicht noch einmal zu sehen, weil er wieder auf eigenen Beinen stand?
Er umschloss die Zettel mit der Hand und wandte sich nach rechts, ging einen kurzen Flur entlang, der mit Schwarz-Weiß-Fotos geschmückt war, und stieg dann die wenigen breiten Stufen in den Keller hinab.
Unten empfingen ihn das Klappern von Geschirr, der Duft von Tabak und das gedämpfte Surren von leise geführten Unterhaltungen. Zwei Dutzend Männer saßen an einfachen Holztischen, die man aneinandergeschoben hatte.
An der langen Seite des Raumes fiel Licht von der Straßenseite durch die Kellerfenster. In unregelmäßigen Abständen konnte man die Schuhe der Vorbeieilenden sehen. An der kurzen Seite, zu Tommys Rechten, standen schmale Tische nebeneinander, an denen die Essensausgabe stattfand. Hinter den mächtigen, gusseisernen Töpfen sorgten zwei Frauen dafür, dass jeder nur so viel bekam, wie ihm zustand. Beide waren hager gewachsen – die eine blond, die andere brünett – und konnten die vierzig noch nicht erreicht haben. Ihre Kleider waren ausgebleicht und an einigen Stellen ausgebessert. Dennoch waren beide Frauen tadellos frisiert und hatten roten Lippenstift aufgetragen. Manche Leute ertrugen Armut mit Würde.
Die Blondine nahm einen der gelben Zettel von Tommy entgegen und nahm einen Teller vom Stapel, der neben den Töpfen aufgebaut war.
„Noch immer nichts gefunden?“, fragte sie freundlich.
Stumm schüttelte Tommy den Kopf. Small Talk gehörte nicht zu seiner Stärke. Oder überhaupt das Reden.
Manchmal glaubte er, dass er deswegen damals New York hinter sich gelassen hatte. Der Westen war weit, die Felder endlos, die Arbeit schlicht und vor allem zu anstrengend, um sich dabei zu unterhalten. Die Einsamkeit der Landschaft fehlte ihm.
„Es kommen wieder bessere Zeiten“, behauptete die Blondine.
Tommy kannte ihren Namen nicht. Er hatte nie danach gefragt. Sie hob den Deckel vom Topf, füllte den Teller mit dampfender Kartoffelsuppe und reichte ihn zusammen mit einem Löffel und einem Stück Brot an Tommy weiter.
„Danke“, murmelte er. Sie schenkte ihm ein Lächeln, das er zu erwidern versuchte, dann drehte er sich um und suchte sich einen freien Platz.
Die meisten Männer saßen in kleinen Grüppchen zusammen. Fetzen ihrer Gespräche drifteten zu Tommy, während er die Männer passierte.
„Ich hab gehört, der alte Kevanagh stellt ein!“
„Kennst du Robert Lincoln? Sie haben ihn aus seiner Bleibe geschmissen, samt der sechs Kinder.“
„Wenn Hoover nicht endlich etwas tut, dann bekommen die verdammten Kommunisten noch mehr Zulauf.“
Am Ende der Tischreihe setzte Tommy sich, schälte sich aus der Jacke und rieb kurz die kalten Hände gegeneinander. Sein Magen knurrte laut und fühlte sich an, als ob ein Dämon in seinen Eingeweiden saß, der laut schreiend nach Nahrung verlangte. Tommy ließ ihn nicht länger warten.
Er musste sich zwingen, langsam zu essen. Achtsam schob er Löffel um Löffel in den Mund, biss hin und wieder vom Brot ab, bis der Teller geleert war. Dann holte er sich den Nachschlag. Es war die einzige Mahlzeit, die er bis zum nächsten Mittag bekommen würde.
Dass ihn niemand ansprach und versuchte, in eine Unterhaltung mit einzubeziehen, war Tommy nur recht. In seinem Leben hatte er die Kunst verfeinert, unsichtbar zu werden. Eine Fähigkeit, die ihm geholfen hatte, das strenge Regiment in Blessed Virgin Mary und die Jahre danach zu überstehen. Man konnte keinen Ärger anziehen, wenn der Ärger einen nicht sah.
So blickte er nicht auf, als neue Gäste dazu kamen, sich etwas zu Essen holten und an den Tisch setzten, während andere aufstanden, den Frauen einen schönen Tag wünschten und gingen.
Und dann schlug ihm jemand plötzlich kräftig auf die Schulter. Tommy zuckte zusammen – so heftig, dass ihm der Löffel aus der Hand glitt und lautstark im fast leeren Teller landete.
„Na, wen haben wir denn da.“ Eine Stimme, glatt wie ein frisch polierter Ford. Nicht dunkel, nicht hell, aber einnehmend.
Sofort war Tommy sich sicher, sie zu kennen, doch sein Kopf vermochte die Stimme nicht zuzuordnen. Er drehte sich um, langsam, spürte die Blicke der anderen Anwesenden auf sich lasten.
Über ihm ragte ein Mann empor, dessen Gesicht Tommy seit Jahren nicht mehr gesehen hatte. Ein Geist aus seiner Kindheit, plötzlich Fleisch geworden, ein Puzzleteil, das aus dem Spiel ein ganzes machte.
Tommy schluckte, konnte es nicht fassen. „Eugene“, sagte er tonlos.
Der Mann lachte vergnügt, ein Funkeln in den Augen. Sein Charisma, dem Tommy sich schon als Kind nie hatte entziehen können, war seit ihrer letzten Begegnung nur gewachsen. Er trug das Haar gescheitelt, dazu einen Hut, der locker auf dem Kopf saß. Die Kleidung war einfach, aber gepflegt, kein Vergleich zu dem Flickenteppich, den die anderen Männer trugen.
Unwillkürlich fragte Tommy sich, was Eugene eigentlich hier suchte.
„Man nennt mich inzwischen Dodge“, erwiderte er in einem Tonfall, der zugleich bedeutungsschwanger war und keinen Widerspruch duldete.
Ein Lächeln streifte Tommys Gesicht, als er den Namen hörte. „Tatsächlich.“
Er erinnerte sich nur zu gut an den älteren Jungen aus dem Waisenhaus, der schon damals der Held der Straße gewesen war. Charmant, einnehmend, wortgewandt. Ganz anders als Tommy.
Wie sehr hatte er sich gewünscht, wie Eugene sein zu können. Eugene, der sich damals gerne als „Artful Dodger“ bezeichnet hatte, wie die Figur aus dem Roman von Dickens. Sie hatten das Buch im Schulunterricht lesen müssen. Ganz sicher hatten die Nonnen nicht damit gerechnet, dass sich einer ihrer Schutzbefohlenen ausgerechnet mit dieser Figur identifizieren würde.
Dodge nickte. „Man wird nicht jünger. Wir haben uns ewig nicht mehr gesehen, was? Ich habe gehört, du wärst aufs Land gegangen, so wie die Nonnen das für uns alle vorgesehen hatten?“
Tommy zuckte die Schultern. Da vibrierte ein Hauch von Abschätzigkeit in Dodges Worten, die bis in Tommys Innerstes vordrang.
Er war auf einmal wieder acht Jahre alt, stand auf dem Innenhof des Waisenhauses, beobachtete, wie Eugene, immerhin schon vierzehn, lässig am Zaun lehnte und mit den anderen Kindern der Nachbarschaft durchs Gitter sprach, und nichts lieber wollte, als dazuzugehören. Wie Eugene eines Tages laut verkündete, er würde sich ganz sicher nicht von den Nonnen aufs Land verfrachten lassen, und von einem Tag auf den nächsten verschwunden war, eine Lücke in Tommy hinterließ, deren Ausmaß ihn erschreckte.
„Hat nicht so geklappt in der Prärie, was?“ Dodge lächelte und entblößte Zähne, so makellos, wie man sie sonst nur an Filmschauspielern in Hollywood sah.
„Die Ernten waren mies wegen der Dürre“, sagte Tommy ein wenig zu leise. Plötzlich war ihm die ganze Sache peinlich, als habe er alleine das Wetter zu verantworten. „Deswegen haben wir unsere Arbeit verloren.“
„Und jetzt bist du wieder hier.“ Lag da Genugtuung in Dodges Stimme?
Noch nie war es Tommy möglich gewesen, den anderen zu lesen, zu deuten, nicht mal in ihrer Jugend. Schon als Kind hatte Dodge seine Karten nie offengelegt, hatte Fäden gezogen und Zügel in den Händen gehalten. Die Welt war seine Manege, er der Dompteur.
Wieder keimte der alte Neid in Tommy auf, weil er wissen wollte, wie es war, sich mit solcher Selbstverständlichkeit durch die Welt zu bewegen.
„Ja.“ Er spürte, wie er unter Dodges Blick ein Stück in sich zusammensank. Lächerlich. Sein Kopf wusste das. Sein Herz nicht.
Er räusperte sich, versuchte es noch einmal. „Aus dir scheint ja was geworden zu sein.“
„Das kann man so sagen.“ Dodge legte den Kopf schief. Seine Augen wirkten in dem trüben Licht beinahe schwarz, bodenlos. „Hast du eine Stelle in Aussicht?“
Tommy schüttelte den Kopf, wandte den Blick ab. Ihm wurde schmerzlich bewusst, dass er sich in einer Suppenküche für die Ärmsten befand – weil er einer von ihnen war.
„Die Wirtschaftskrise.“ Dodge nickte verständnisvoll. „Hat uns alle hart getroffen. Na ja, fast alle.“ Eine kurze Pause. „Kann man sich immer noch auf dich verlassen, so wie früher?“
Tommy dachte an all die Nächte, in denen Dodge sich mit ein paar Jungen im Schlepptau aus dem Schlafsaal geschlichen hatte, um Kleinigkeiten aus der Küche zu klauen. Er hatte den Schlachtplan entworfen, die Expedition koordiniert. Dann hatte er die anderen vorgeschickt, um für ihn das Stehlen zu übernehmen.
Einmal war Tommy dabei erwischt worden. Eine Woche lang hatten die Nonnen ihn in ein karges Zimmer bei Wasser und Brot gesperrt, doch er hatte Dodges Namen nicht preisgegeben.
Als Tommy ihm nicht antwortete, klopfte Dodge ihm noch einmal freundschaftlich auf die Schulter. Am Rande nahm er wahr, dass die anderen Männer respektvoll den Kopf gesenkt hielten, die Gespräche verstummt waren.
„Immer noch der alte Schweiger, was? Du hast dich kein Stück verändert, Tommylein. Wie wär’'s? Ich könnte dir vielleicht Arbeit besorgen. Interesse?“
Tommy war zu perplex, um etwas anderes zu tun, als zu nicken.
„Fein. Dann komm morgen am besten um 10 Uhr zum Ulysses. Abby kann dir erklären, wo das liegt.“
Noch während er sich panisch fragte, welche der Frauen wohl Abby war, fragte Dodge: „Wo schläfst du im Moment?“