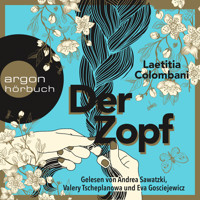8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Manchmal muss man alte Wunden öffnen, um sein Glück zu finden
Zu ihrem 18. Geburtstag bekam die Schauspielerin Tilly Beaumont 1947 eine atemberaubend schöne Halskette geschenkt. Das Schmuckstück begleitete sie durch ihre ruhmreiche Karriere hindurch und zierte ihren Hals auf den glamourösesten Partys – bis sie auf einmal spurlos verschwand. Jahre später bittet Tilly ihr Enkelin Sophia, die Kette zu finden. Sophia hat gerade schmerzlich erfahren, dass man mit gutem Aussehen und dolce vita allein keine Rechnungen bezahlen kann. Die wertvolle Perlenkette könnte nun einige ihrer Probleme lösen. Aber was sind die eigentlichen Gründe für Tillys Auftrag? Und wie soll Sophia ein Erbstück finden, das sie noch nie gesehen hat?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 689
Sammlungen
Ähnliche
Das Buch
Sophia Beaumont Brown war der Star auf jeder Party – bis die Boulevard-Presse sie fallen gelassen hat. Jetzt ist sie einsam und allein; nicht mal die eigene Familie spricht noch mit ihr. Nur ihre Großmutter Tilly hat den Glauben an sie nicht verloren. Von ihrem Krankenhauszimmer aus schickt die ehemalige Schauspielerin Sophia Briefe: Sie schreibt über ihre Vergangenheit, über die Kriegszeit in England, über Familiengeheimnisse und über das Kostbarste, was sie je besessen hat: eine atemberaubend schöne Perlenkette, die Generationen faszinierender Frauen gehört hat. Die Kette fand ihren Weg von Japan in die englische High Society der Vorkriegszeit und veränderte das Leben jeder ihrer Besitzerinnen von Grund auf. Das einzige Problem: Sie ist verloren gegangen, und niemand weiß, wo sie sich befindet. Jetzt liegt es an Sophia, sich auf die Suche nach diesem einzigartigen Schmuckstück zu machen.
Die Autorin
Katie Agnew wurde in Edinburgh geboren. Sie arbeitete lange Zeit als Journalistin für Marie Claire, Cosmopolitan, Red und die Daily Mail, bevor sie sich ganz dem Schreiben von Romanen widmete. Katie lebt mit ihrer Familie in Bath.
KATIE AGNEW
Roman
Aus dem Englischen
von Jens Plassmann
WILHELM HEYNE VERLAG
MÜNCHEN
Die Originalausgabe erschien 2016
unter dem Titel The Inheritance bei Orion.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Taschenbucherstausgabe 03/2017
Copyright © 2016 by Katie Agnew
Copyright © 2017 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Dr. Katja Bendels
Umschlaggestaltung: Eisele Grafik Design, München
unter Verwendung von Dr. PAS/depositphotos und
UrchenkoJulia/depositphotos
Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
ISBN 978-3-641-20089-3V003
www.heyne.de
TEIL I
Eintauchen
»Ich muss eine Meerjungfrau sein …
Ich habe keine Angst vor Tiefe,
aber große Angst vor einem
oberflächlichen Leben.«
– Anaïs Nin
1. Kapitel
Hackney, East London 2012
Liebste Sophia,
ich hoffe sehr, dass du mich bald einmal besuchen kommst. Ich vermisse dich fürchterlich, und es ist recht einsam hier im Krankenhaus. Natürlich sind da die Besuche deiner Eltern, dienstags und freitags, pünktlich wie die Kirchenuhr, aber ihre Gesellschaft ist nicht annähernd so unterhaltsam wie deine. Hast du meine Briefe erhalten? Mir ist bewusst, dass bei euch jungen Leuten immer viel los ist. Ich hoffe nur, die Adresse, die deine Mutter mir gegeben hat, ist korrekt. In Hackney bin ich noch nie gewesen, ist es hübsch?
Wie du weißt, bin ich eine sehr kranke alte Frau, und es würde mir gefallen, wenn irgendjemand irgendwo mit meinen Aufzeichnungen eine wahrheitsgetreue Chronik meiner Lebensgeschichte besitzt. Ich möchte, dass jemand mehr weiß, als all die Kameras aufgezeichnet oder die Reporter geschrieben haben. Hier bleibt mir nicht viel anderes übrig, als die Vergangenheit Revue passieren zu lassen und all die Dinge zu Papier zu bringen, die ansonsten mit mir begraben würden. Es gibt noch so viel zu erzählen aus der Zeit, bevor ich überhaupt im Rampenlicht stand. Und so viel Ungesagtes aus der Zeit danach. Als du noch ein kleines Mädchen warst, hast du immer mit großem Vergnügen meinen Geschichten gelauscht, daher habe ich beschlossen, dir meine Aufzeichnungen zukommen zu lassen. Du kannst damit machen, was du willst, aber sei dir bitte bewusst, dass diese Notizen alles sind, was ich hinterlassen werde über ein Leben, das alles in allem wunderschön gewesen ist.
Ich hoffe, du bist gesund und glücklich, mein Liebes.
Wie immer in aller Liebe
Deine Großmutter
»Und, wirst du die alte Dame jetzt endlich von ihrem Elend erlösen und sie besuchen?«, fragte Hugo und lehnte sich auf dem zerwühlten, mit Kaffeeflecken übersäten Bett so majestätisch zurück, als wäre es das Prunkbett in einer Suite im Savoy.
In der einen Hand hielt er den Brief von Sophias Großmutter, in der anderen eine französische Zigarette. Eigentlich ähnelte das Schreiben – das dritte dieser Art, das in den vergangenen beiden Wochen eingetroffen war – eher einer kleinen Erzählung als einem Brief. Ein richtiges Bündel handbeschriebener Seiten hielt Hugo zwischen seinen schlanken Fingern, und gab dabei selbst das perfekte Bild halbseidener Dekadenz ab. Von Natur aus eigen war ihm diese Ausstrahlung allerdings nicht, er hatte sie über Jahre hinweg sorgsam studiert und eingeübt. Lässig schnippte er die Asche seiner Zigarette in einen behelfsmäßigen Aschenbecher, der mitten in all dem Dreck und Chaos lag, und warf einen kontrollierenden Seitenblick in den Spiegel. Hätte Hugo nur einen Funken Ehrgeiz, er wäre ein ausgezeichneter Schauspieler geworden.
»Sie ist schließlich deine Großmutter«, erklärte er theatralisch. »Sie liegt quasi im Sterben und verfügt, wenn ich dich daran erinnern dürfte, über ein verdammtes Vermögen. Wie kannst du sie so einfach ignorieren?«
Er rümpfte missbilligend die Nase, was ein wenig anmaßend wirkte bei einem Typen, der keinen Job, keine Arbeitsmoral, keine Qualifikationen und keine Perspektiven besaß.
Sophia schenkte ihm keine große Beachtung, sondern suchte weiter auf dem Boden nach ihrem schwarzen BH. Zumindest tat sie so, als würde sie ihn nicht beachten. Ihre Großmutter war ihr ganz sicher nicht gleichgültig. Früher hatte sie ihr sogar sehr nahe gestanden, aber was sollte sie denn tun? Wenn sie im Krankenhaus auftauchte, würde sie damit die Büchse der Pandora öffnen.
»Hugo«, sagte Sophia schließlich. »Meine Granny war Schauspielerin. Sie hat einen Oscar gewonnen, weil sie das so gut kann. Anderen etwas vorspielen, meine ich. Kapiert? Sie ist immer noch Schauspielerin. Sie hat bloß seit Jahrzehnten nicht mehr gearbeitet. Aber so ist sie nun mal. Und darin ist sie wirklich gut. Jetzt spielt sie die Rolle der liebevollen Großmutter, weil sie mich an ihr Krankenbett locken will, um mich zu überreden, mich mit meinen Eltern zu versöhnen.«
Hatte ihre Mutter Granny vielleicht sogar darum gebeten, ihr zu schreiben? Sophia wollte und durfte nicht auf die List ihrer Großmutter hereinfallen. Also konzentrierte sie sich lieber auf ihre gegenwärtige Lage und wühlte weiter nach dem richtigen Outfit. »Ich habe für das alles jetzt gerade keinen Kopf«, ergänzte sie mit einer wegwerfenden Handbewegung in Richtung ihres Freundes und hoffte, unbeteiligter zu klingen, als sie sich fühlte. »Ich kann diesen scheiß BH nicht finden!«
»Meinst du den hier?« Hugo hob mit gespreizten Fingern etwas aus schwarzer Spitze vom Bett auf und schleuderte es Sophia vor die Füße, als wäre es eine giftige Schlange, die im nächsten Moment beißen könnte.
»Genau den.« Sophia nahm den BH und legte ihn sich um. »Danke.«
»Wie dem auch sei.« Hugo zog eine gequälte Grimasse, wandte den Blick von der halbbekleideten Sophia ab und fuhr fort: »Deine Großmutter. Sie liegt bloß einen Katzensprung von hier in Saint John’s Wood. Hier, diesmal hat sie sogar eine Karte mit ihrer Station, Zimmernummer und Direktdurchwahl beigelegt.« Er warf die Karte in Sophias Richtung. Sie schenkte ihr keine Beachtung. »Ein kurzer Abstecher nach North London, und schon kannst du dir ein hübsches kleines Vermögen sichern. Wir beide könnten hier abhauen und schön in Urlaub fahren. East London ist doch ausgelutscht. Wir brauchen endlich was Neues. Komm schon, gehen wir morgen deine Großmutter besuchen. Wir lassen uns in alle Familienskandale einweihen, und nebenbei krallen wir uns eine unverschämt fette Erbschaft. Na los, Sophe! Was hast du schon groß zu verlieren?«
In Wahrheit hatte Sophia Angst. Sie hatte Angst vor dem Sterbebett ihrer Großmutter, Angst vor einer Begegnung mit ihren Eltern, Angst vor ihrer Vergangenheit und Angst vor der Zukunft. Und ihre Großmutter wusste das. Warum sonst sollte sie versuchen, Sophia mit mysteriösen Andeutungen über Familiengeheimnisse an ihr Krankenhausbett zu locken?
»Im Moment will ich mich nur fertig machen und mich dann ein wenig amüsieren gehen.«
So ganz stimmte das nicht. Sophia schwankte heftig zwischen dem Wunsch, die Geschichten ihrer Granny zu hören, und dem Bedürfnis, sich einzubilden, ihre gesamte Familie würde überhaupt nicht existieren. Alle drei Briefe hatte sie zuerst ungeöffnet beiseitegelegt. Ein kurzer Blick auf den Poststempel und die elegante Handschrift hatte ihr bereits verraten, dass sie ihr nur Kummer bereiten würden. Und Briefe unbeachtet zu lassen, fiel nicht schwer in einer Wohnung, in der die Post allein aus Werbung, Mahnungen und Schreiben an Vormieter bestand, die längst über alle Berge waren.
Hugo war es gewesen, der sie schließlich geöffnet hatte. Vorgestern, nach dem Eingang des dritten Briefs, hatte er seine Neugier nicht länger bezwingen können. Als Sophia ins Zimmer gekommen war, hatte er sich auf dem Bett geräkelt und die Schilderungen ihrer Granny gierig verschlungen. Bei Sophias Eintreten war er aufgesprungen wie eine Katze, die beim Naschen aus dem Kochtopf erwischt worden war.
»Sind das nicht meine Briefe?«, hatte sie gefragt, obwohl sie die Antwort bereits wusste.
Hugo hatte genickt, und seine Wangen waren vor Scham rot angelaufen. Gleich darauf hatte er jedoch in den Verteidigungsmodus umgeschaltet: »Aber du hattest ja ganz offensichtlich keine Lust, sie zu öffnen, und es schien mir unhöflich, sie einfach zu ignorieren, also …«
»Also hast du dir gedacht, du könntest ja mal fremde Post öffnen und heimlich den Inhalt lesen, richtig?«, war sie ihm ins Wort gefallen. »Und das hältst du etwa nicht für unhöflich?« Es hatte eher verletzt als wütend geklungen.
»Sie sind von deiner Großmutter«, hatte er erklärt und ihr den Stapel Seiten zurückgegeben. »Ich finde, du solltest sie lesen. Sie hören sich wichtig an. Es scheint ihr nicht gut zu gehen.«
Sie hatte die Briefe entgegengenommen und gespürt, wie sich ein Kloß in ihrem Hals bildete. Natürlich war ihre Großmutter krank. Warum sonst sollte sie sich jetzt mit ihr in Verbindung setzen? Nach allem, was geschehen war?
»Willst du sie denn gar nicht lesen?« Hugos ungewöhnlich ernster Gesichtsausdruck hatte ihr bereits verraten, dass die Nachrichten schlecht sein mussten.
»Später«, hatte sie kurz angebunden erwidert.
Den ersten Brief und den ersten Teil der Memoiren ihrer Großmutter hatte Sophia an diesem Abend im Bett gelesen. Bei der Lektüre waren ihr die Tränen gekommen, woraufhin sie die Seiten schnell in die Nachttischschublade gestopft hatte. Als sie nun vergangene Nacht nicht schlafen konnte, schienen die Briefe aus der Schublade nach ihr zu rufen. Sie hatte den zweiten gelesen, Wort für Wort, bis sie sich in einen Tunnel hinabgezogen fühlte wie Alice im Wunderland, hinab in eine Parallelwelt, wo alles anders war und die Personen dennoch vertraut wirkten. Und jetzt beharrte Hugo darauf, ihr den dritten Brief aufzudrängen. Sie bemühte sich zwar verzweifelt wegzuhören, als Hugo zu lesen begann, aber irgendwie schien plötzlich alles andere in den Hintergrund zu treten.
»Mir gefallen die Sprüche von deinem Urgroßvater …« Er prustete amüsiert und hielt sich den Brief vor die Nase. »Hat er vielleicht auf Männlein wie Weiblein gestanden?«
»Schon möglich. Er ist auch in Eton zur Schule gegangen.« Sophia sah eine Chance, das Gespräch von ihrer Familie fort und auf Hugos Lieblingsthema zu lenken: ihn selbst. »Fahrt ihr ehemaligen Eton-Jungs in dieser Hinsicht nicht alle mehrgleisig?«, fügte sie mit einem wissenden Nicken in Hugos Richtung hinzu.
»Meine sexuelle Orientierung ist unerschütterlich!«, sprang Hugo sofort auf den Köder an. »Ich bin zu einhundert Prozent schwul. Das mit der Kleinen neulich war ein Fehler. Ein bescheuerter im Suff. Außerdem weißt du ja bestimmt auch noch, dass sie eher aussah wie ein Kerl. Ich schwöre!«
Sophia grinste. Volltreffer! Thema gewechselt. Und zudem genießt sie es immer, Hugo aufzuziehen. Schon seit frühesten Kindertagen zählte es zu ihren bevorzugten Freizeitvergnügen. Hugo war der Sohn der damaligen besten Freundin ihrer Mutter, und sie kannten sich bereits seit einer Ewigkeit. Zuerst hatte er sie noch genervt, dieser kleine blonde Junge, der zwei Jahre jünger war als sie und ihr ständig wie ein herrenloses Hündchen hinterherlief. Überallhin war er ihr im Garten nachgetrottet und hatte erklärt, ihr bei der Suche nach Elfen und Feen zu helfen, wenn Sophia nichts anderes gewollt hatte, als vor ihrem zornigen Vater und ihrer melancholischen Mutter zu flüchten und sich irgendwo oben in einem Baum zu verstecken. Oder er hatte sich in ihr Zimmer geschlichen, um dort ihre Puppen schick anzuziehen, ihnen die Haare zu frisieren und die Gesichter zu waschen. Konnte er nicht begreifen, dass Sophia ihre Tiny-Tears-Puppen am liebsten nackt und wild verwegen aussehend mochte?
Sie erinnerte sich, dass sie damals manchmal ziemlich ungerecht zu ihm gewesen war. Aber wie oft sie ihn auch verhöhnte, Hugo war in seiner Freundschaft zu Sophia unerschütterlich geblieben. Wenn ihr Vater sie ausschimpfte (und er schimpfte sie ständig aus), hatte Hugo sie unter seinem tief ins Gesicht fallenden Pony hervor angesehen und ihr ermutigend zugelächelt. Wenn ihre Mutter sie auf ihr Zimmer schickte, war er auf Zehenspitzen die Treppe hochgeschlichen und hatte ihr Gesellschaft geleistet. Und wenn sie auf der Straße mit einem der Nachbarkinder in Streit geriet, war er ihr sofort zu Hilfe geeilt, und das, obwohl er schmächtig und immer piekfein angezogen war und nicht die geringste Ahnung hatte, wie man die Sprüche der coolen Kids konterte.
Mit seiner hartnäckigen Verehrung gelang es Hugo nach und nach, Sophia für sich zu gewinnen. An irgendeinem Punkt ihrer Kindheit wurde aus Missfallen Toleranz, dann verwandelte sich Toleranz in wechselseitige Zuneigung, und als sie ins Teenageralter kamen, nannten ihre Familienangehörigen sie bereits The Terrible Twins. Und heute? Nun, heute war es Sophia, die Hugo anhimmelte. Ein Leben ohne ihn an ihrer Seite konnte sie sich nicht vorstellen. Sophia hatte keine Geschwister, und Hugo war für sie wie ein kleiner Bruder.
Während die Mütter von Sophia und Hugo sich schon vor langer Zeit zerstritten hatten, weil sie sich nicht einigen konnten, wem in jenem Jahr die Endspieltickets für Wimbledon zustanden, hielten Hugo und Sophia weiter zusammen wie Pech und Schwefel. Und wenn ihnen beiden zur selben Zeit der elterliche Zuschuss gestrichen wurde, dann drehten sie auch schon mal krumme Dinger. Glücklicherweise war derzeit nur Sophia in Ungnade gefallen, und so lebten sie beide von dem Geld, das Hugos Familie schickte. Keiner von ihnen fand an diesem Arrangement etwas auszusetzen. Allerdings hatte auch noch keiner von ihnen jemals für seinen Lebensunterhalt arbeiten müssen. Zumindest nicht auf anständige Weise.
»Ah, hab ich dich!« Sophia fischte triumphierend einen einzelnen schwarzen Schuh aus dem Hosenbein einer Jeans. »Das muss gefeiert werden. Was gibt’s zu trinken?«
Hugo reichte ihr eine offene Flasche mit warmem Prosecco.
»Und?«, fragte er unvermittelt. Er entknotete seine langen, spindeldürren Beine und kniete sich auf das Bett.
»Und was?«, fragte Sophia zurück und zog sich den zweiten Strumpf an.
»Gehen wir nun morgen deine Großmutter besuchen?«
O Gott, sie hatte wirklich geglaubt, ihn von dem Thema abgelenkt zu haben.
»Natürlich nicht.« Sie lachte spöttisch. »Sei doch nicht albern. Wir ziehen jetzt los und gehen feiern. Und wie wir beide genau wissen, wird es ziemlich heftig werden, und die Aussichten, dass einer von uns heute Nacht zum Schlafen kommt, sind gleich null. Es gibt also gar kein Morgen, Hugo. Warum dann Pläne machen?«
Sie schlängelte sich in ihr engstes kleines Schwarzes, streifte einen riesigen rubinroten Klunker über den Finger und zog ihre Killer-Stilettos an. Ihre wirre Mähne türmte sich auf dem Kopf zu einer vagen Mischung aus Beehive und Dutt. Sophia steckte sie fest und besprühte das Resultat großzügig mit Haarspray. Zu guter Letzt trug sie noch etwas zusätzlichen schwarzen Eyeliner auf.
»Fertig«, sagte sie. »Kann losgehen.«
»Wie zum Teufel kriegst du das nur hin, Sophe?«, fragte Hugo verwundert.
»Was?«, erwiderte sie mit Unschuldsmiene.
»Na, aus einem so gewaltigen Chaos etwas so Perfektes zu kreieren.«
Sophia strahlte ihn an. Trotz aller Neckereien blieb er ja doch ihre Ein-Mann-Cheerleader-Gruppe. Sie nahm sich eine von seinen Zigaretten.
»Kommen die anderen auch mit?«, erkundigte sie sich und verwies mit einem Nicken zur Tür auf ihre Mitbewohner Ben und Amelia.
Hugo schüttelte den Kopf. »Die haben keine Lust. Sie holen sich lieber was vom Inder und sehen sich Let’s Dance an. Anscheinend werden wir alle langsam zu alt, um ständig um die Häuser zu ziehen.«
Sophia lachte, aber ein Teil von ihr stimmte dem durchaus zu. Wenn sie etwas Besseres zu tun hätte, und einen Freund, mit dem sie dieses Bessere hätte tun können, würde sie wahrscheinlich auch nicht mehr die Clubs unsicher machen.
»Ich finde, wenn du das Geld von deiner Großmutter bekommst, sollten wir uns überlegen, wieder eine Wohnung im Westen zu nehmen«, verkündete Hugo plötzlich. »Vielleicht Notting Hill. Ich meine, ist mir schon klar, dass alle das East End für die angesagteste Gegend halten, aber ich habe mich hier nie so richtig zu Hause gefühlt. Versteh mich nicht falsch. Während der Olympischen Spiele fand ich es im East End echt klasse. All die knackigen jungen Athleten, die in ihren engen Strechteilen rumlaufen. Wem würde das nicht gefallen? Aber das ist längst vorbei, alle sind wieder nach Hause, und es ist langweilig geworden, fast öde. Ich denke, hier ist Schluss mit Party, Sophes. Mir gefällt’s jedenfalls nicht mehr. Ich möchte heim. Zurück in den Westen. Bitte, lass uns doch gehen. Offen gesagt, komme ich mir hier immer vor wie ein Tourist, der aus Versehen mitten in ein Bürgerkriegsgebiet geraten ist. Es ist wie Mexiko. Sobald du die Grenzen deines Luxusresorts verlässt, läufst du Gefahr, erschossen zu werden.«
Sophia zog die mottenzerfressenen Samtvorhänge zur Seite und betrachtete den sattgrünen Victoria Park, der unter ihr im Laternenlicht schimmerte. Der Ausblick vom zweiten Stock ihres georgianischen Altbaus war herrlich. Sie befanden sich hier mitten im todschicken Hackney. Sophia war das sehr wohl bewusst. Hugo jedoch tat so, als würde er unter primitivsten Umständen im Bezirk E9 hausen.
»Ich werde von meiner Großmutter kein Geld bekommen, Hugo«, stellte sie klar, um ihn sanft in die Realität zurückzuholen. »Umziehen können wir uns nicht leisten. Wann hat Ben denn das letzte Mal daran gedacht, Miete von uns zu verlangen? Nirgendwo sonst in London werden wir so ein altes Stadthaus finden, für das wir keinen Penny zahlen müssen. Das ist ein echter Glückstreffer hier. Hat mich schon gewundert, dass Bens Eltern uns zu Olympia nicht rausgeschmissen haben. Überleg doch nur, was sie an Miete für den Laden hätten bekommen können! Da sollten wir uns glücklich schätzen, Hugo. Es mag nicht perfekt sein, aber immerhin haben wir ein Dach über dem Kopf.«
Das Haus gehörte Hugos Schulfreund Ben, einem liebenswerten Kiffer mit goldenem Herzen und dem Ehrgeiz eines Dreifinger-Faultiers. Besser gesagt, das Haus gehörte Bens Familie. Hinterlassen hatte es ihnen eine exzentrische Großtante, die aus Protest gegen den blasierten Lebensstil ihrer Verwandtschaft aus dem noblen Belgravia hierher übergesiedelt war, wo sie mit ihrer Geliebten sowie zahllosen Hunden und Katzen der verschiedensten Rassen zusammengewohnt und Gedichte geschrieben hatte, die nie gedruckt worden waren. Als sie starb, wusste die Familie nicht recht, was sie mit dem Haus anfangen sollte. Wer aus ihrem Kreis wollte schon nach Hackney ziehen? Aber da sie nicht jeden Penny zweimal umdrehen mussten, hatten sie es auch nicht eilig, das Haus zu verkaufen. Und als Ben einige Jahre später ein gewisses Interesse zeigte, überließen sie es ihm nur allzu bereitwillig, denn damit sparten sie nicht nur die Miete für seine Penthouse-Wohnung in Kensington, ihr Sohn lebte von nun an auch gut verborgen auf der anderen Seite der Stadt, sodass sie nicht mehr tagtäglich an sein Versagen erinnert wurden. Ben hatte seiner Familie versprochen, das alte Haus gemeinsam mit seinen Freunden während ihres Aufenthalts dort zu renovieren. Inzwischen jedoch waren zahlreiche Mitbewohner und durchreisende Couchsurfer gekommen und gegangen, und noch immer hatte niemand die Zeit gefunden, Wände zu streichen oder auch nur Fenster zu putzen.
Das dreigeschossige Haus war eines der wenigen in der Straße, das noch nicht in mehrere Wohneinheiten umgewandelt worden war. Und es war in der Straße ganz sicher das einzige Haus ohne Zentralheizung und mit nur einem Badezimmer, das sich alle Bewohner teilten. Mit seiner maroden Fassade bildete es einen Schandfleck für das gesamte Viertel. Die Wände im Innern waren seit fünfzig Jahren nicht mehr gestrichen worden und trugen noch immer die psychedelisch gemusterten Tapeten aus den 60er Jahren. In der schäbigen Küche gab es keine Schranktüren mehr, und in dem verdreckten Badezimmer keine Dusche, dafür wiesen beide großflächige feuchte Stellen und Schimmel auf. Sophia, Hugo, Ben und seine Freundin Amelia teilten das Haus mit Mäusen, Ameisen und gelegentlich auch mal mit einer Ratte.
Keiner von ihnen hatte einen Plan für die Zukunft. Jeder von ihnen war früher einmal von seinen Lehrern als »vielversprechend« bezeichnet worden. Aber das war schon lange her. Inzwischen strebte keiner von ihnen mehr irgendetwas an. Zum Glück verfügten sie alle über Treuhandfonds – oder hatten zumindest darüber verfügt, wie in Sophias Fall. Ihre tief enttäuschten Familien warfen ihnen von den üppig gedeckten Familientafeln genügend Brotkrumen zu, dass sie sich durchschlagen konnten, ohne arbeiten gehen zu müssen. Doch eigentlich war das nur ein Manöver, das sie davon abhalten sollte, bettelnd an den Türschwellen ihrer Elternhäuser aufzutauchen und sie vor den Augen der gut situierten Nachbarschaft zu blamieren. Manchmal schien dieses Haus in der Victoria Park Road wie ein Ort, an dem Chancen zu Grabe getragen wurden.
Abgesehen von Kindheitserinnerungen an teure Schulen, Ponys, Urlaubsreisen, große Häuser und Autos verband die Hausbewohner nur wenig. Sie waren noch jung und voller Träume gewesen, als sie sich kennengelernt hatten, doch irgendwie waren sie schließlich alle hier gelandet, tief versackt in ihrem großbürgerlichen Slum.
Sophia war der Dreh- und Angelpunkt der Gruppe. Oder war es zumindest gewesen. Sie verband alle miteinander. Amelia kannte sie aus ihrer gemeinsamen Schulzeit in Westonbirt. Mit Hugo war sie zusammen aufgewachsen. Hugo hatte Ben in Eton kennengelernt, und auf irgendeinem Festival hatte Sophia dann Ben mit Amelia bekannt gemacht. In dieser Nacht war Amelia lieber zu Ben ins Zelt gekrochen als zu Sophia, und der Rest war, wie es so schön heißt, Geschichte. Sie gaben ein tolles Paar ab, waren schwer verliebt und passten in jeder Hinsicht gut zusammen, bis hin zu ihren identischen Piercings. Dennoch hatten beide etwas Melancholisches an sich. Verlebt war das Wort, das Sophia bei ihrem Anblick häufig in den Sinn kam. Und das nicht nur wegen des Zeugs, mit dem sie sich ständig zudröhnten. In einer anderen Welt wären Ben und Amelia sich an der Uni begegnet, hätten sich ineinander verliebt, erfolgreiche Karrieren im Londoner Finanzdistrikt gestartet und wären inzwischen verheiratet, mit einem hübschen Eigenheim in Surrey und dem ersten Kind auf dem Weg. So etwas hätte Sophia sich für die beiden gewünscht. Und womöglich steckte dieser Wunsch auch noch irgendwo in ihr selbst.
Sie schluckte den Kloß hinunter, der sich in ihrem Hals gebildet hatte. Die Bilder waren völlig überraschend gekommen. In der Regel achtete sie strikt darauf, nicht daran zu denken, was geschehen wäre, wenn sie sich in ihrem Leben für andere Möglichkeiten entschieden hätte. Es kostete sie viel Energie, immer unbekümmert und gut gelaunt zu wirken, und sie hasste es, wenn Risse in der Fassade sichtbar wurden. Gewöhnlich sparte sie sich nagende Selbstzweifel für die tiefste Nacht auf, wenn sie allein war.
Sie zwang sich zu einem breiten Grinsen und sagte: »Sehe ich okay aus?«
»Du siehst umwerfend aus«, schwärmte Hugo erwartungsgemäß. »Ich würde sagen, Holly Golightly trifft Amy Whinehouse auf einer Playboy-Party.«
»Das genügt mir schon. Aber vielleicht brauche ich noch eine Halskette, falls es auf Frühstück bei Tiffany hinausläuft.«
Sophia wühlte in dem Schuhkarton, der ihr als Schmuckkasten diente. Sie besaß eine bunte Mischung aus Familienerbstücken, die sie bei diversen Gelegenheiten hatte mitgehen lassen, Flohmarktkäufen, Ramsch aus Camden-Market-Läden und Modeschmuckabklatsch teurer Designerware. Sie entschied sich für ein Perlenhalsband, das ein wenig an Audrey Hepburn erinnerte.
»Wow, sind die echt?«, fragte Hugo. »Sieht toll aus.«
»Bist du irre?«, gab Sophia zurück. »Das ist original Plastik Marke Topshop anno 2003. Wenn das Teil echt wäre, würden wir mit meinem Ferrari ins West End fahren, nicht mit der scheiß U-Bahn. Also gut, meinetwegen kann’s losgehen.«
Hugo musterte sich noch einmal im Spiegel und runzelte die Stirn. »Mit dem Hemd bin ich nicht so richtig glücklich«, erklärte er plötzlich. »Es passt nur auf gebräunte Haut.«
»Hugo!«, rief Sophia wütend und ließ sich zurück aufs Bett fallen. »Du brauchst doch ewig, bis du ein anderes Hemd gefunden hast.«
»Zwei Minuten, ich schwöre«, sagte er. »Ist doch nicht schwer, so eine Entscheidung.«
»Immerhin hast du achtundzwanzig Jahre gebraucht, um dich zu entscheiden, was du einmal werden willst, wenn du erwachsen bist«, erinnerte Sophia ihn, aber Hugo war bereits durch die Tür verschwunden.
2. Kapitel
Lower East Side, New York 2012
Dominic legte die Stirn an die kühle Scheibe des Seitenfensters, während das Taxi im Schneckentempo durch Brooklyn kroch. Zu Fuß wäre er wahrscheinlich schneller vom JFK nach Hause gekommen. Hätte er doch bloß nicht eine Kofferraum-Ladung voll schwerer Taschen und Ausrüstungsteile mitzuschleppen. Vor fast einer Stunde hatten sie den Flughafen verlassen. Eigentlich brauchte man für die Strecke etwa eine halbe Stunde, aber es herrschte abendlicher Berufsverkehr, und die Straßen von New York City waren dicht. Während das Taxi sich auf der Williamsburg Bridge Zentimeter für Zentimeter über den East River schob, spürte Dom, wie sich sein Magen in einer unangenehmen Mischung aus Erwartung und Furcht zusammenzog. Endlich war er wieder zu Hause in Manhattan. Wie sehr er diesen Ort vermisst hatte! Aber wie konnte er sich einerseits so darüber freuen, wieder zu Hause zu sein, und andererseits solch entsetzliche Angst vor dem haben, was ihn bei seiner Ankunft erwartete?
Aus dem Radio drang ein eingängiger R&B-Song, den Dominic noch nie gehört hatte. Vermutlich war es der große Sommerhit in diesem Jahr gewesen. Mitbekommen hatte er davon jedenfalls nichts. Er fragte sich, was er sonst noch alles während seiner Abwesenheit verpasst hatte. Im Grunde sah alles noch genauso aus wie bei seiner Abreise, außer dass ein bleifarbener Oktoberdunst den strahlend blauen Julihimmel abgelöst hatte. Es war schon ein sonderbar zwiespältiges Gefühl, nach so langer Zeit in seine Heimatstadt zurückzukommen, vor allem weil der Aufbruch so traumatisch gewesen war.
Dom hatte den Lärm vermisst, die vertrauten Gerüche, die stolzen Häuserreihen aus braunem Sandstein, die weit in den Himmel ragenden Hochhäuser, das Gewimmel auf den Bürgersteigen, die interessanten Leute und den permanenten Adrenalinrausch. Er hatte seinen Hund vermisst, die Kumpels, den Breitbildfernseher, seine Stammkneipe, das eiskalte Bier und das eigene Bett. Aber hatte er sein Leben als Ehemann vermisst oder seine Frau Calgary? Während der vergangenen drei Monate hatte er über kaum etwas anderes nachgedacht. Und am Ende hatte er sich in den entlegensten Tiefen des Amazonas-Regenwalds eingebildet, dass er die ganze scheiß Angelegenheit verarbeitet hatte und mit der Situation im Reinen war. Teilweise hatte er sogar so etwas wie Erleichterung und Befreiung empfunden. Ja, all die schönen Dinge mochten damit verloren sein, aber war er dafür nicht auch all die unschönen los? Und durch den großen räumlichen Abstand war ihm endlich bewusst geworden, dass seine Freunde recht gehabt hatten: Calgary hatte ein Menge Unschönes mit sich gebracht. Im Herzen des Amazonasbeckens war es ihm wie Schuppen von den Augen gefallen, und er hatte erkannt, dass seine Ehe alles andere als perfekt gewesen war.
Aber das war vor Tagen und Wochen gewesen, an einem Ort dreitausend Meilen entfernt von der Lower East Side und der Wohnung, die er drei Jahre lang mit Calgary geteilt hatte. Jetzt, da das gelbe Taxi die Delancey Street entlangkroch und ihrer – seiner – Wohnung in der Orchard Street immer näher kam, verwandelten sich die sanften Schmetterlinge in seinem Bauch zu wütenden Raubvögeln, deren Flügel wild gegen seine Eingeweide schlugen.
»Wo in der Orchard?«, erkundigte sich der Fahrer freundlich.
»Direkt hinter der Rivington«, antwortete Dominic.
»Klar doch«, erwiderte der Fahrer und grinste Dom im Rückspiegel an. »Hab ich mir schon gedacht, dass Sie das sagen. Einer von den neuen Luxusblöcken mit Eigentumswohnungen, stimmt’s?«
Dom wand sich unbehaglich in seinem Sitz.
»Wie kommen Sie darauf?«, fragte er.
Der Fahrer lachte. »Na ja, mit diesen Stiefeln an den Füßen und dem Dreitagebart machen Sie doch keinem was vor. Sie wohnen in der Lower East Side, und da versuchen Sie natürlich, viel cooler und ganz anders zu sein als all die schnöseligen Upper East Sider. Also laufen Sie rum wie ein Penner und reden betont lässig, aber man durchschaut Sie sofort, Mann. Sie tragen nämlich eine Ray Ban, Ihre Uhr ist von Tag Heuer, Ihr Rucksack ist irgend so ein angesagtes europäisches Teil und solche Filmkameras wie die da hinten schleift man nicht aus Spaß an der Freud rund um den Globus. Daher denke ich mal, Ihre Wohnung liegt eingezwängt zwischen einem Boutique-Hotel und einem Designerladen in einem dieser abgedrehten neuen Gebäude, die aussehen wie ein Jengaturm, und vermutlich kommen Sie für die Miete mit schlappen 5000 Dollar im Monat gerade mal so hin, hab ich recht?«
»Sie haben mich komplett durchschaut, mein Freund«, antwortete Dom, ohne sich seine Verlegenheit anmerken zu lassen. »Einen Häuserblock weiter. Auf der rechten Seite, direkt hinter dem Hotel.«
Der Fahrer nickte wissend und tippte sich an die Stirn, als wollte er sagen: ›Ich sehe alles von meinem Taxi aus. Keiner versteht New York City besser. Ich durchschaue sie alle, Mann.‹ Und vielleicht tat er das ja tatsächlich. Aber Dom hätte am liebsten erklärt, dass er in diesem Fall völlig danebenlag. Am liebsten hätte er gesagt: ›Hör mal zu, mein Freund. Ich stamme aus Southeast Yonkers, bin halb irisch-amerikanisch, halb italo-amerikanisch, und kein Mitglied meiner Familie hatte jemals auch nur einen Dollar auf der hohen Kante, seit die ersten den scheiß Kahn verlassen und ihren Fuß hier an Land gesetzt haben. Bei uns sind alle Malocher gewesen, die sich die Hände dreckig gemacht haben, auf der einen Familienseite bis zurück nach Cork, auf der anderen nach Neapel. Mein Vater war Mechaniker, und meine Mutter hat vierzig Jahre lang als Näherin geschuftet. Ich habe eine öffentliche Schule besucht und mich wie verrückt reingehängt, um aufs College zu kommen, das ich übrigens mit drei Jobs gleichzeitig komplett selbst bezahlt habe. Außerdem bin ich stolz auf meine Wurzeln. Aber dann bin ich eines Tages diesem Mädchen begegnet, das mehr Stil hatte als ich, cooler war als ich und hübscher war als alle Mädchen, die ich je gesehen hatte. Sie war intelligent und erfolgreich und, dreimal dürfen Sie raten, ich verliebte mich in sie. Nach unserer Heirat wollte sie hier hinziehen, und ich wollte sie glücklich machen. Daher leben wir hier. Und jetzt ist sie weg, und ich bin noch immer hier. Also finden Sie sich damit ab, weil ich es nämlich auch tun muss!‹ Doch Dominic war zu gut erzogen, um so etwas zu sagen, also hielt er den Mund, lächelte freundlich und gab dem Fahrer ein großzügiges Trinkgeld.
Dom stand vor seinem Haus auf dem Bürgersteig, neben ihm sein Gepäck und seine Ausrüstung. Es war ein kalter Herbstabend in New York. Nach dem langen Flug, dem Schlafmangel und dem starken Temperaturwechsel fror er zwar erbärmlich, dennoch konnte er sich nicht überwinden hineinzugehen. Noch nicht. Sobald er einen Fuß in das Gebäude setzte, würde dieser ganze Albtraum, der in Ecuador so weit weg gewesen war, plötzlich wieder sehr, sehr real werden. Er stampfte mit den Stiefeln auf den Boden, um wieder Gefühl in seine Zehen zu bekommen, zog seine Wollmütze tiefer über die Ohren, schloss den Reißverschluss seiner Thermojacke bis zu seinem Stoppelkinn und zündete sich eine Zigarette an. Es war eine schlechte Angewohnheit von früher, die er kürzlich wieder aufgegriffen hatte. Nein, das stimmte nicht ganz. Es war eher eine schlechte Angewohnheit von früher, die er sich seit Kurzem eingestand, nie ganz aufgegeben zu haben. In Wahrheit hatte er jahrelang bei seinen Freunden Zigaretten geschnorrt, wenn Calgary nicht dabei gewesen war, und danach hektisch Kaugummi gekaut, um den Geruch zu überdecken, bevor er nach Hause kam.
Er hatte seine Marlboro halb aufgeraucht, als ihm klar wurde, dass er auch auf der Dachterrasse hätte rauchen können, ja sogar – was für eine Todsünde – in der Wohnung selbst. Und er hätte nicht einmal die Fenster öffnen müssen. Jetzt, da Calgary weg war, konnte ihm keiner mehr Vorwürfe wegen seiner schlechten Angewohnheiten machen. Er konnte tun und lassen, was er wollte. Er konnte noch bis weit nach Mitternacht das Licht anlassen und im Bett lesen. Er konnte den Hund auf das Sofa lassen. Er konnte Fisch kochen, ohne die gesamte Wohnung anschließend deodorieren zu müssen, bevor Calgary von der Arbeit nach Hause kam. Er musste sich nicht länger jeden Tag rasieren (daher auch sein Stoppelbart). Er musste sich nicht mehr bei jedem Ausziehen für das Tattoo auf seinem rechten Arm entschuldigen. Dominic McGuire war jetzt Herrscher in seiner eigenen Burg. Warum also graute ihm so sehr davor, nach oben zu gehen? Dom holte tief Luft, sammelte seine Sachen ein und betrat mit müden Beinen und schwerem Herzen das Gebäude.
»Dominic! Dominic!«, rief Guido, der Pförtner, stürmte hinter seinem Tresen hervor und umarmte Dom herzlich. »Ich habe Sie ja so vermisst. Wie schön, dass Sie wieder zu Hause sind. Sie sehen ein wenig schmal aus. Und schrecklich müde. Sie haben wieder zu viel gearbeitet. Kommen Sie, kommen Sie, ich nehme Ihnen das ab.«
Dominic überließ Guido die leichteste der Kamerataschen. Für ihn war es weniger eine notwendige Entlastung als eine Geste der Freundlichkeit gegenüber dem Pförtner, der gerne das Gefühl hatte, gebraucht zu werden. Guido war mindestens doppelt so alt wie Dom und halb so groß. Zudem hatte Dominic sein gesamtes Gepäck ganz allein aus dem tiefsten ecuadorianischen Regenwald zurückgeschleppt, da würde es für die wenigen Schritte bis zum Aufzug auch noch reichen. Trotzdem war es schön, das vertraute Gesicht des sympathischen Pförtners wiederzusehen. Guido erinnerte Dom immer an seine italienischen Onkel daheim in Yonkers.
»Und, wie war’s in Peru?«, erkundigte sich Guido aufgeregt.
»Super, großartig, sehr interessant«, sagte Dom, obwohl er eigentlich gerade aus Ecuador zurückgekommen war. Aber er brachte es nicht übers Herz, den Alten zu korrigieren. »Allerdings kein Vergleich mit dem Trubel hier auf der Bowery.«
»Ja, ja, sicher«, sagte Guido, während er die kleine Tasche mit Mühe in den Aufzug bugsierte. »Ist auf jeden Fall schön, dass Sie wieder da sind.«
Guido lächelte Dominic freundlich zu. Das ›große Thema‹ hing über ihnen, aber keiner wollte es als Erster ansprechen.
»Tja, und … haben Sie, äh, Calgary häufig getroffen?«, fragte Dom endlich und starrte dabei auf seine Füße. »Ist sie während meiner Abwesenheit hier gewesen?«
»Nicht so oft«, erklärte Guido bedauernd. »Ich glaube nicht, dass sie noch einmal kommt. Die ist jetzt fort. Ein- oder zweimal ist sie nach Ihrer Abreise noch da gewesen. Aber seitdem nicht mehr. Sie hat mir eine Adresse in Uptown gegeben, an die ich ihr die Post nachsenden soll, falls Sie wissen wollen, wo sie wohnt.«
Dom schüttelte den Kopf und zuckte dann mit den Schultern, als wollte er sagen, dass es nicht von Bedeutung sei. Aber damit konnte er keinem etwas vormachen. Sie war also in ihr altes Revier zurückgekehrt. Keine große Überraschung. Die beiden Männer verharrten in unbehaglicher Stille, bis der Aufzug das Penthouse erreichte.
»Es tut mir ja so leid, Dominic«, sagte Guido leise. »Ich weiß, es geht mich nichts an, aber Sie sind so ein netter Mensch, und ich begreife nicht, wie Ihre Frau Ihnen so etwas antun kann. Sie schienen so ein perfektes junges Paar zu sein. Was ist da nur passiert?«
»Eigentlich ist die Sache ziemlich banal«, erklärte Dominic traurig. »Ich wollte Kinder, sie nicht. Mein Fehler, schätze ich. Sie war schon ganz auf ihre Karriere fixiert, als wir uns kennenlernten. Es war dämlich zu glauben, das könnte sich ändern.«
Guido schüttelte betrübt den Kopf.
»So eine Tragödie«, sagte er bekümmert. »Meine älteste Tochter, Isabella, sie ist Rechtsanwältin, wissen Sie?«
Dominic wusste es. Guido konnte endlos von seinen phantastischen Kindern schwärmen oder den Bewohnern des Hauses Fotos von seinem Nachwuchs zeigen. Es zählte zu den Dingen, die Dom an Guido am meisten beeindruckten – sein enormer Stolz auf die Familie.
»Inzwischen hat sie drei Kinder! Sie kommt nicht mehr zum Schlafen und ist völlig erschöpft, das arme Mädchen. Aber sie hat drei Bambinos und einen guten Job. Und sie ist glücklich. Warum macht es Calgary nicht auch so?«
Dominic wusste darauf keine Antwort. Er war sich nicht wirklich sicher, ob er selbst Calgarys Gründe verstanden hatte. Wie sollte er es einem anderen erklären, ohne sofort wie der verbitterte sitzengelassene Ex zu klingen? Und Verbitterung war nicht Doms Art.
»Mir tut es leid, Dominic«, sagte Guido. »Mehr wollte ich gar nicht sagen.«
»Danke, Guido«, antwortete Dominic, als die Türen sich im obersten Stockwerk öffneten. Und meinte das auch so.
Guido trottete hinter Dom den Flur entlang, bis sie die Wohnungstür erreichten. Während Dominic in der Hosentasche nach seinem Schlüssel suchte, räusperte Guido sich.
»Ähm, da ist noch eine Sache«, begann er zaghaft. »Als Calgary zurückgekommen ist, da hat sie … äh … eine ganze Menge Sachen mitgenommen. Sie hatte einen Transporter und ein paar Männer bei sich. Sie hat Möbel mitgenommen, Fernseher, den Kühlschrank … Es könnte sein, dass die Wohnung vielleicht …«
Dominic fand den Schlüssel und drehte ihn im Schloss.
»Vollkommen leer ist?«, beendete er den Satz für Guido.
Wo zuvor ihr geschmackvoll eingerichtetes Zuhause gewesen war, klaffte jetzt gähnende Leere. Übrig geblieben waren nur noch unzählige Quadratmeter massiver Eichendielen, weiß getünchte Wände und ein einsamer zerschlissener Ledersessel. Den hatte Dominic einst auf dem Flohmarkt ergattert, er stammte noch aus seinen Studentenzeiten. Calgary hatte ihn immer gehasst. Das Ding würde sie anwidern, und sich zudem mit den Designerstücken von Wenger, Jacobsen und Paton beißen, die sie ›gemeinsam‹ ausgesucht hätten (obwohl Dominic sich nicht daran erinnern konnte, bei der Möbelauswahl für die Wohnung jemals um seine Meinung gefragt worden zu sein). Dom hatte Calgary damit aufgezogen, dass es doch gerade total cool sei, ausgewählte »Vintage«-Stücke in die Wohnung zu integrieren, denen man ansähe, was sie mitgemacht hätten. Worauf Calgary erwidert hatte, dass in diesem Fall sie am meisten mitmachen müsse, nämlich immer dann, wenn ihre Freundinnen zu Besuch kämen und dieses verfluchte Stück Gerümpel alles verschandelte. Jetzt allerdings war Dom umso glücklicher darüber, stets darauf bestanden zu haben, seinen geliebten Ledersessel zu behalten. So hatte er heute Abend zumindest eine Sitzgelegenheit.
Und als er vorsichtig durch seine Wohnung lief und die Schritte von den nackten Wänden widerhallten, sah er, dass ihm auch seine Bücher geblieben waren. Zwar standen sie nicht länger streng nach Einbandfarbe geordnet auf einem skandinavischen Designerregal, aber sie waren alle noch da, türmten sich in einem Dutzend hoher, windschiefer Stapel auf dem Boden – die Fotografie- und Kunstbände, die naturgeschichtlichen Fachbücher, die schwedischen Thriller, seine gesammelten Werke von Hemingway, Fitzgerald und Capote. Tja, eine leidenschaftliche Leserin war Calgary noch nie gewesen. Es sei denn, es war etwas, das sie geschrieben hatte, oder natürlich eine Ausgabe von Vogue oder Wallpaper. Am liebsten betrachtete Calgary die Fotostrecken in Zeitschriften, ganz besonders, wenn sie selbst darauf zu sehen war. Dass seine Bücher auch ihr einen intellektuellen Touch verliehen, wenn Freunde zum Abendessen vorbeikamen, gefiel ihr zwar, aber sie selbst besaß kein einziges, und Dom hatte sie nie eins von seinen lesen sehen. Im Gegenteil: sie schnaufte sogar missbilligend, wenn Dom sich ein Buch zum Lesen herauszog, weil dies ihrer Meinung nach das ästhetische Gesamtbild zerstörte. Aber wozu ein Buch haben, wenn man es nicht lesen durfte?
Dominic stellte seine Taschen neben den Büchertürmen ab. Guido war ihm unaufgefordert in die Wohnung gefolgt. Für einen Pförtner mochte dieses Verhalten nicht unbedingt professionell sein, Dom aber machte es nichts aus. Der kleine Italiener setzte die Tasche ab, die er getragen hatte, und verfolgte mit offenem Mund, aber ohne einen Ton herauszubringen, wie Dominic einen Blick in die Küche warf (kein Kühlschrank, keine Waschmaschine, keine Spülmaschine), dann ins Arbeitszimmer (kein Schreibtisch, kein Stuhl, kein Computer) und schließlich ins Schlafzimmer. Es überraschte Dominic nicht, dass das Bett verschwunden war, schließlich hatte es ein Vermögen gekostet und war extra aus Deutschland importiert worden, aber immerhin war Calgary so großzügig gewesen, ihm die Matratze dazulassen, wenn auch ohne Laken oder Bettdecke. Die Kleiderschränke waren ebenfalls fort, und Doms Kleidung und Schuhe lagen in unordentlichen Stapeln auf den Dielen. Er beugte sich hinunter, hob einen alten Tennisball auf und schlenderte zurück ins Wohnzimmer.
Guido sah auf den Ball, und einen Moment lang dachte Dom schon, der alte Mann würde anfangen zu weinen.
»Nein …«, murmelte er. »Nein, nein, nein. So grausam kann sie doch nicht sein …«
Dominic sah auf den schmutzigen, angekauten Ball in seiner Hand an und lachte.
»Nein, Guido«, sagte er und klopfte ihm liebevoll auf den Rücken. »Blondie hat sie nicht mitgenommen. Das würde sie nicht wagen. Calgary weiß genau, dass ich ohne Sofa, Bett oder Plasmafernseher leben kann, aber sie wäre nie so grausam, mir meine Kleine wegzunehmen. Abgesehen davon mag sie Blondie nicht besonders. Selbst wenn die Wohnung in Flammen stünde, ich glaube nicht, dass Calgary den Hund mitnehmen würde.«
»Aber wo ist Blondie?«, fragte Guido und sah sich in der Wohnung um, als könnte sich die Hündin in irgendeiner Ecke versteckt haben. Als ob Blondie klein genug wäre, sich irgendwo zu verstecken!
»Ich habe sie bei meinem Freund Dave untergebracht. Erinnern Sie sich an Dave? Groß, rotbraune Haare, klopft ständig dumme Sprüche.«
Guido nickte. »Ich erinnere mich«, sagte er. »Lacht viel und erzählt einen Witz nach dem anderen. Ziemlich schmutzige Witze!«
»Genau, das ist er«, sagte Dom. »Mein bester Freund seit der Grundschule. Blondie ist drüben in Brooklyn bei ihm, seiner Frau und seinen beiden Kindern. Tolle Familie. Bei ihnen zu Hause ist es laut und ein wenig chaotisch, aber Blondie hat sich dort köstlich amüsiert. Den Fotos nach, die sie mir geschickt haben, scheint sie mir höchstens ein wenig fett geworden zu sein. Ellen kann prima kochen, und die Kids verwöhnen Blondie natürlich maßlos. Aber es geht ihr gut. Ich werde sie morgen früh abholen. Ich kann es kaum erwarten!«
»Sie werden also zurechtkommen?«, fragte Guido. »Hier so ganz allein heute Nacht?«
Dom nickte. »Klar doch. Ich habe einen Platz zum Sitzen und einen Platz zum Schlafen. Fernsehen kann ich auf meinem Laptop, und ich kann mir Pizza bestellen. Nach drei Monaten ohne Pizza habe ich einen Mordshunger auf eine Peperoni. Vielleicht hole ich mir noch ein paar Budweiser aus dem Laden gegenüber. Was kann sich ein alleinstehender Mann mehr wünschen?«
»Eine Frau«, sagte Guido ohne Umschweife. »Meine Alessia ist noch zu haben. Soll ich sie anrufen?«
Dominic schüttelte lächelnd den Kopf. Alessia war die jüngste von Guidos vier Kindern. Sie war zwar fraglos hübsch, aber sie ging noch aufs College und war kaum älter als Zwanzig. Dominic hatte kürzlich die Fünfunddreißig überschritten und war an minderjährigen Studentinnen nicht interessiert. Ehrlich gesagt, war er derzeit überhaupt nicht an Frauen interessiert – davon hatte Calgary ihn fürs Erste geheilt.
»Ihre Tochter ist hübsch«, sagte Dom zu Guido. »Aber sie ist viel zu jung und unschuldig für einen zynischen alten Typen wie mich. Sie sucht sich besser einen netten Collegeboy, meinen Sie nicht?«
Guido seufzte und schien enttäuscht. »Aber Sie sind doch ein so netter Mensch, Dominic. Sie sollten glücklich sein. Ein Mann braucht mehr als einen Hund.«
Dom musste über die Ermahnung lächeln und schüttelte den Kopf. Er war sich wirklich nicht sicher, ob er diesem Punkt noch zustimmen würde.
Guido verließ die Wohnung, um seinen Posten in der Eingangshalle wieder einzunehmen. Sobald die Tür hinter ihm ins Schloss gefallen war, fühlte sich die Wohnung gespenstisch still und leer an. Dominic hatte sie gar nicht so riesig in Erinnerung. Mit Möbeln, einer Frau und einem Hund hatte alles viel beschaulicher und intimer gewirkt. Jetzt dürfte die Wohnung viel zu groß für ihn sein. Zu groß (und zu teuer sowieso) war ihm das Penthouse schon vorgekommen, als Calgary es ihm unmittelbar nach der Fertigstellung des Gebäudes zum ersten Mal gezeigt hatte. Seiner Ansicht nach benötigten sie für sich nicht so viele Quadratmeter. Aber im Stillen hatte er damit gerechnet, dass es nicht lange bei einem Zweipersonenhaushalt bleiben würde, weshalb die Größe kein Problem darstellte. Sie waren frisch verheiratet, also würde die Familie den Platz bald brauchen. Da er fälschlicherweise davon ausgegangen war, dass Calgary die Sache genauso sah, hatte er glücklich den Mietvertrag unterzeichnet.
Vielleicht sollte er die Wohnung jetzt besser kündigen. Es gefiel ihm zwar hier in der Bowery, und er lebte mittlerweile schon so lange in Manhattan, dass er es als sein Zuhause betrachtete, aber der Rest von New York City gefiel ihm auch. Er konnte nach Brooklyn ziehen, wo all seine Freunde wohnten, oder womöglich zurück nach Yonkers, um in der Nähe seiner Familie zu sein. Verdammt, in jedem anderen Viertel als Manhattan könnte er sich ein Haus mit Garten leisten. Blondie wäre von so etwas begeistert. Aber würde Dom es wirklich aushalten, in Brooklyn zu leben, inmitten all dieser vor Selbstzufriedenheit strotzenden Ehepaare? Oder daheim in Yonkers, wo ihm seine Mutter ständig im Nacken sitzen und versuchen würde, ihn mit sämtlichen Töchtern ihrer Freundinnen zu verkuppeln, genau wie damals, als er noch in der High-School gewesen war? Er mochte seine Freunde und er liebte seine Mutter, aber als Single hatte es seine Vorteile, in Manhattan zu bleiben. Wie eine Fernstraße in der Wüste dehnte sich die Zukunft vor Dominic aus. Es gab keine Hinweisschilder, keine Abfahrten, nur eine lange, einsame Straße, die weiß Gott wohin führte.
3. Kapitel
Hackney, London, 2012
Sophia trank noch einen Schluck von dem billigen Schampus, zündete sich eine Zigarette an und versuchte, nicht auf die Zeilen des ellenlangen Briefes zu sehen, dessen Seiten ausgebreitet neben ihr auf dem Kissen lagen. Zögernd, fast gegen ihren Willen, nahm Sophia die Seiten in die Hand und ließ es zu, dass ihre Augen die Worte verschlangen, die sie mit aller Macht hatte ignorieren wollen.
Mayfair, London, 1938
Nie werde ich den Tag vergessen, an dem mein Vater mit mir in die Bond Street ging. Ich weiß noch, wie die Wege im Hyde Park voller Blätter lagen und Nanny mich auf unserem eiligen Gang von der U-Bahn-Station zu Papas Hotel schalt, weil ich mit meinen funkelnagelneuen Lacklederschuhen gegen die matschigen Blätterhaufen trat. Nanny sagte, ich würde mir die Schuhe ruinieren und dass dies eine Riesenschande sei, weil es sie doch so viel Arbeit gekostet hatte, mich für das Treffen mit meinem Vater herzurichten. Die Schuhe waren rot mit silbernen Schnallen. Acht Jahre alt dürfte ich damals gewesen sein.
Es war ein höchst ungewöhnlicher Tag, nicht zuletzt, weil es das erste und einzige Mal sein sollte, dass ich mit meinem Papa einkaufen ging. Die Welt stand am Rande gewaltiger Veränderungen, doch ich befand mich natürlich in glückseliger Ahnungslosigkeit der Dinge, die unmittelbar bevorstanden. Wäre mir bewusst gewesen, wie einzigartig und herrlich dieser eine kleine Tag sein würde, vielleicht hätte ich damals alles noch intensiver ausgekostet. Und dennoch muss ich irgendwie seine Bedeutung verstanden haben. Warum sonst hätte ich die Erinnerung daran so mit Zuckerguss überzogen und in Goldfolie gewickelt über all die Jahre? Die Erinnerung an diesen Tag gehört zu den köstlichsten, die ich besitze.
Ich habe meinen Papa in jener Zeit nur selten getroffen. Er war eine Randfigur in meiner Kindheit, allerdings eine überaus fesche und romantische. Auch Mama war für mich weit fort, aber auf andere Weise. Wenn ich nicht im Internat in Westonbirt war, wohnten wir im selben Haus. Beaumont House war ein weitläufiges Anwesen in Wiltshire, das seit seiner Erbauung im Jahre 1705 im Besitz von Papas Familie war. (Heute befindet sich dort meines Wissens ein Hotel.) Aber Mama war immer sehr beschäftigt. Mama – oder Lady Charlotte Beaumont, wie der Rest der Welt sie nannte – führte den Haushalt, besuchte in Bath das Theater, speiste mittags mit Freunden und spielte sehr viel Tennis. Sie war Mäzenatin der kleinen Landklinik im Ort und tat viele »gute Werke«. Zumindest erzählten mir das die Hausangestellten, wenn ich fragte, wo sie war. Wir hatten ein festangestelltes Kindermädchen, obwohl ich während der Schulzeit wochentags in meiner Privatschule untergebracht war und es keine anderen Kinder im Haus gab. Erst als ich selbst Mutter wurde, begriff ich, mit wie viel Bedacht Mama sich von mir ferngehalten hat. Aber zu diesem Zeitpunkt wusste ich bereits, dass sie dafür ihre guten Gründe gehabt hatte.
An den Wochenenden, während der Saison, ging Mama auf die Jagd. Und wenn keine Saison war, ritt sie mit Bekannten aus. Ich habe noch immer ein klares Bild von ihr vor Augen: Sie, mit einer Zigarette in der Hand gegen die Stallwand gelehnt, und irgendein Kerl daneben, der sie anhimmelte und fasziniert ihren bissigen Bemerkungen lauschte. Sie war eine wirklich atemberaubende Frau, stets würdevoll, souverän und perfekt gestylt bis zu ihrem Tod. Ja, ich sehe sie heute noch vor mir, das glänzende schwarze Haar unter ihrer Reitkappe, die langen Beine in enganliegenden weißen Jodhpurs, dazu schwarze Reitstiefel, die so auf Hochglanz poliert waren, dass sie darin ihr Spiegelbild bewundern konnte. Ein fast schon süffisantes Lächeln umspielte stets ihre tiefroten Lippen. Vielleicht habe ich ihr auch hinterherspioniert. Manchmal habe ich so etwas getan. Ich war immer darum bemüht, den Abstand zwischen uns zu schließen. Einmal habe ich sie im Sommerhaus dabei beobachtet, wie sie Aubrey küsste, einen Cousin zweiten Grades von Papa. Rückblickend muss ich sagen, dass sie schon reichlich viele Männerbekanntschaften pflegte. Andererseits war Papa natürlich auch ständig fort.
Ich war ein einsames Kind. Ein Einzelkind. Mit einer emotional distanzierten Mutter und einem räumlich distanzierten Vater. Inzwischen verstehe ich, dass ihre Ehe mehr einem geschäftlichen Arrangement glich als einer romantischen Beziehung, aber das waren auch andere Zeiten und eine andere Welt damals, daher maße ich mir kein Urteil an. Ich denke, für die beiden dürfte diese Ehe weit besser funktioniert haben, als für mich. Ich entwickelte mich zu einer entsetzlich aufgeblasenen kleinen Diva, führte andauernd irgendwelche Theaterstücke auf oder gab Gesangsvorstellungen in dem hilflosen Bemühen, damit die Aufmerksamkeit meiner Eltern zu erregen. In jenen Tagen hatte ich mit dieser Haltung keinen großen Erfolg, allerdings hat sie mir später im Leben gute Dienste erwiesen, da ich mich häufig im Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit befand.
Auch wenn mich mit meiner Nanny, meinen Hunden und meinen Ponys eine weit engere Beziehung verband, als ich sie je zu einem meiner Elternteile gehabt hatte, so bewunderte ich sie als junges Mädchen aus der Ferne doch sehr, insbesondere Papa. Ich war absolut vernarrt in meine Vorstellung von ihm, obwohl ich mir nicht sicher bin, ihn jemals gut genug gekannt zu haben, um ihn als den Mann zu lieben, der er tatsächlich gewesen war. Ich wünschte, ich hätte ihn besser gekannt. An jenem Tag in London kamen wir wohl einem freundschaftlichen Verhältnis näher als irgendwann sonst.
Papa verbrachte viel Zeit in Übersee, war immerzu »geschäftlich unterwegs«. Unserer Familie gehörten diverse Dinge – Kautschukfabriken in Indien, Teeplantagen auf Ceylon, eine Rinderfarm in Argentinien, eine Brennerei in Schottland. Keine Ahnung, wie wir zu diesen Unternehmen gekommen waren oder warum sie uns gehörten. Es war einfach so. Seit Jahrhunderten gehörten Familien wie der unseren große Landstriche des Commonwealth. Und dann verloren wir sie sehr schnell wieder. Aber das ist eine andere Geschichte.
Papa war wieder eine ganze Weile in Übersee gewesen, aber nun hatte er eine Stippvisite in London eingelegt und mich dorthin beordert, um ihn zu besuchen. Wenn Papa jemanden zu sich beorderte, dann kam derjenige sofort. Papa war schließlich ein Marquess, und als solcher war er es gewohnt, seinen Willen zu bekommen. Meine Privatschule muss klug genug gewesen sein, dies zu verstehen, denn Nanny durfte mich mitten aus dem Vormittagsunterricht herausholen, mitten in der Woche, mitten im Schuljahr, und in einen Wagen mit Chauffeur verfrachten.
Überraschende Besuche meiner Nanny waren stets ein freudiges Ereignis. Vermutlich empfand ich für sie, was die meisten jungen Mädchen für ihre Mutter empfanden. Sie war etwa im gleichen Alter wie Mama, und obwohl sie nicht annähernd so kultiviert, glamourös und elegant war wie meine Mutter, fand ich sie doch ebenso schön. Nanny Miller war klein, kurvenreich, mit einer Wespentaille und einem kurzgeschnittenen blonden Lockenkopf. Ihre Wangen waren immer ein wenig gerötet, als würde sie jeden Moment vor Verlegenheit puterrot anlaufen, und die Knöpfe ihrer Bluse schienen einen ewigen aussichtslosen Kampf gegen ihre ausladenden Brüste zu führen. Einmal hörte ich, wie Mama meine Nanny als »billiges Pin-up-Girl« bezeichnete (was ich mir dann von Tony, dem Sohn des Gärtners, erklären ließ), aber ich habe sie eher als das Ebenbild von Betty Grable in Erinnerung.
Ich muss gestehen, dass ich mir manchmal vorstellte, Nanny wäre meine eigentliche Mutter. In ihrer Gegenwart fühlte ich mich beschützt, geliebt und wie etwas ganz Besonderes. Sie schimpfte zwar regelmäßig mit mir, viel häufiger aber schloss sie mich in die Arme. Und ebenso großzügig wie mit ihren Umarmungen war sie mit freundlichen Worten. Sie nannte mich immer »mein kleiner Liebling«, selbst als ich schon erwachsen war und einen guten Kopf größer als sie. Nanny war ein typisches Landmädchen aus dem Südwesten Englands, besonnen und geradlinig. Allerdings wurde sie leicht nervös, wenn sie unter Zeitdruck geriet. Ich weiß noch, wie ich mich im Bahnhof Bath Spa in der Ecke eines zugigen Warteraums auf dem Bahnsteig umziehen musste, um noch vor der Ankunft des Zugs nach Paddington von meiner Schuluniform in meine besten Sachen zu wechseln. Nanny meinte, wir hätten keine Zeit mehr, dafür auf die Damentoilette zu gehen. Dabei schien es anschließend noch eine Ewigkeit zu dauern, bis der Zug aus Bristol mit seiner dunkelgrünen Dampflok in den Bahnhof einfuhr.
Als Kind liebte ich es, mit dem Zug zu fahren. Ich war schon mit dem Flying Scotsman und mit dem Cornish Riviera Express unterwegs. Erster Klasse, versteht sich. Aber an diesem Tag konnte mir die Fahrt gar nicht schnell genug gehen. Ich drückte die Stirn gegen die kalte Fensterscheibe und starrte auf die Gleise, bis mir schwindlig wurde und ich nicht mehr wusste, ob wir uns nun vorwärts bewegten oder rückwärts. Anhand des Plans, der auf der Rückseite der Abteiltür hing, prägte ich mir unsere Fahrtroute ein und beschwor jede Haltestelle, rasch vorüberzugehen – Chippenham, Swindon, Reading. Endlich wurden die Felder, Hecken, Seen und Wälder des ländlichen Englands von endlosen Zeilen schmuddeliger Reihenhäuser aus rotem Backstein abgelöst, und der hellblaue Himmel wurde immer trüber und grauer. Ich sah riesige Fabriken, aus deren Schloten schwarzer Rauch quoll, und Straßen, auf denen ein solcher Verkehr herrschte, dass ich mich fragte, wie die Menschen es vermieden, ineinanderzukrachen.
Wir legten einen unplanmäßigen Halt in Ealing Broadway ein. Während ich ungeduldig aus dem Fenster starrte, begegnete ich dem Blick eines Mädchens etwa in meinem Alter, das mit ihrer Mutter auf dem Bahnsteig saß. Sie saßen direkt auf dem schmutzigen Boden, lehnten mit den Rücken gegen die Bahnhofsmauer und hatten einen umgestülpten Hut vor sich abgestellt. Das Mädchen war bleich und dünn, ihr Kleid und ihre Strickjacke abgetragen und zerschlissen; am meisten jedoch schockierte es mich, dass sie überhaupt keine Schuhe trug. Nicht einmal Strümpfe! Ihre Füße waren splitternackt und fast schwarz vor Dreck. Ich lächelte sie an und begriff nicht, warum sie so finster zurückstarrte.
»Was sitzen die da einfach so rum?«, fragte ich Nanny verdutzt.
»Sie betteln, mein kleiner Liebling«, erwiderte sie betrübt. »Manche Menschen haben so wenig, dass sie betteln müssen, nur um sich etwas zu essen kaufen zu können.«
»Sie haben nicht einmal etwas zu essen?«, rief ich aus. »Das arme Mädchen. Kein Wunder, dass sie so traurig ist. Sie hat noch nicht einmal Strümpfe an, und dabei ist es entsetzlich kalt heute. Ich wünschte, ich könnte ihr aus dem Fenster meine neuen Schuhe zuwerfen. Daddy hätte bestimmt nichts dagegen. Er hat die Armen schrecklich gern.«
Ich sah zu Nanny auf und konnte sehen, wie sie mich kopfschüttelnd musterte, als hätte ich den Verstand verloren. Ich behielt meine Schuhe also schön an den Füßen und schmollte, bis der Zug sich wieder in Bewegung setzte und langsam aus dem Bahnhof rollte. Ich drehte mich noch einmal rasch zu dem bettelnden Mädchen um und warf ihr ein letztes Lächeln zu, um sie aufzuheitern. Doch zu meinem Entsetzen streckte sie mir die Zunge raus. Fassungslos starrte ich sie an, bis sie außer Sichtweite war, während sie weiter mit der Zunge in meine Richtung wackelte. Ich weiß noch, dass ich dachte, wenn sie so unmögliche Manieren besaß, dann hatte sie es verdient, arm und hungrig zu sein!
Endlich erreichten wir Paddington. Von dort aus nahmen wir die U-Bahn. Nanny sagte, bei all den umherrasenden Autos in den Londoner Straßen sei es zu gefährlich, ein Taxi zu nehmen. Allerdings wirkte der Stadtplan furchtbar kompliziert, und Nanny, die nur selten in London war, verlor ein wenig die Orientierung. Am Ende nahmen wir einfach den erstbesten Zug, der auf dem erstbesten Bahnsteig einfuhr.
»Ich glaube nicht, dass das die Bakerloo Line ist«, flüsterte sie, als wir im Tunnel verschwanden. »Hoffentlich kommen wir nicht zu spät.«
Wie sich herausstellte, befanden wir uns auf der Circle Line. Nanny geriet allmählich in Panik, während sie versuchte, den Plan in dem Waggon zu entschlüsseln. Ihre Wangen liefen rosarot an, und ihre vorstehende Unterlippe begann zu zittern. Zum Glück bekam ein freundlicher junger Mann in einem eleganten Anzug Mitleid mit uns und bewahrte uns davor, den Rest des Tages im Kreis zu fahren. Mir war schon früher aufgefallen, dass freundliche Männer – junge wie alte – Nanny regelmäßig zur Hilfe eilten. Nach einer Weile stiegen wir am Sloane Square aus der Bahn, und Nanny fragte einen anderen Gentleman nach dem Weg. Dann liefen wir durch den Hyde Park, wo ich mir die Schuhe dreckig machte, überquerten die Park Lane und erreichten das Zentrum von Mayfair. Nanny murmelte unablässig vor sich hin: »Wir kommen zu spät, wir kommen zu spät …« Und ich machte die Sache nur noch schlimmer, indem ich jedes Mal sang: »O seht, o seht, ich komme viel zu spät …« Schließlich war ich erst acht Jahre alt, und Alice im Wunderland war meine absolute Lieblings-Gutenachtgeschichte. In gewisser Weise ist sie es noch heute.
Endlich trafen wir am Claridge’s in der Brook Street ein, Papas bevorzugtem Hotel in London, und ich konnte spüren, wie der letzte Rest von Nannys angeschlagenem Selbstbewusstsein verpuffte, als wir die imposante Eingangshalle mit dem glänzenden schwarz-weißen Marmorboden betraten. Das Claridge’s war seinerzeit der angesagteste Ort, wenn es darum ging, zu sehen und gesehen zu werden, und es drängte sich darin die feine Londoner Gesellschaft. Mit jedem Schritt, den die arme Nanny auf den Empfangstresen zu machte, schien sie ein Stück zu schrumpfen, und ich verstand sogar schon mit acht, dass dies hier meine Welt war, nicht ihre. Daher drückte ich ihre Hand fester, um ihr Sicherheit zu geben und ihr klarzumachen, dass sie wunderhübsch aussah. Was auch der Wahrheit entsprach. Ich erinnere mich noch genau, dass sie ihren besten Kamelhaarmantel über der Uniform trug und ein blauer Glockenhut ihre blonden Locken bedeckte. Selbst in diesen jungen Jahren war ich bereits daran gewöhnt, in vornehme Hotels mitgenommen zu werden, und so fühlte ich mich völlig vertraut mit ihren herausgeputzten Gästen, funkelnden Kronleuchtern und spiegelnden Marmorböden.
Es tat mir weh zu sehen, wie unterwürfig Nanny dem Mann an der Rezeption erklärte, dass wir mit Lord Beaumont verabredet seien. Der Mann war doch bloß ein Angestellter des Hotels und, wie ich an seinem Ansteckschildchen ablesen konnte, nicht einmal der verantwortliche Portier. Warum war sie so eingeschüchtert? Und es ärgerte mich noch mehr, als der Page nicht Nanny, sondern mir Auskunft gab, obwohl sie doch diejenige gewesen war, die ihn angesprochen hatte, und ich noch so klein war, dass ich kaum über den Tresen sehen konnte. An diesem Tag wurde mir zum ersten Mal bewusst, wie ungeheuer jung Nanny noch war. Als dieser Hoteldiener sie einfach ignorierte, wirkte sie beinahe kindlicher als ich.
»Ah, Sie müssen Lady Matilda sein«, sagte der Hoteldiener lächelnd und zog seinen Hut. »Wir haben Sie bereits erwartet. Ihre Lordschaft befindet sich im Lesesaal. Bitte, warten Sie doch hier. Der Hoteldirektor wird jeden Augenblick kommen und Sie zum Tisch Ihres Vaters führen.«