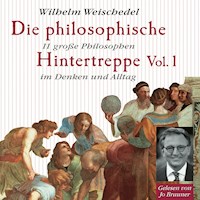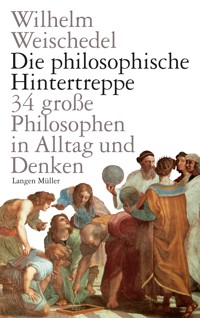7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Die großen Philosophen in Alltag und Denken »Wie fände sich ohne Studium, ohne wissenschaftlich geschultes Denken und Lesen der Zugang zu Aristoteles, Descartes, Kant oder Hegel und deren weltbewegenden Erkenntnissen? Wie wollte man seinem noch minderjährigen Sohn die vertrackten Seinsreflexionen eines Heidegger, seinem kaufmännischen Freund Russells »Zweifel an den Prämissen« oder einem Ingenieur der Industrie Wittgensteins »Tractatus« und die Ergebnisse der Philosophischen Untersuchungen etwa plausibel machen, und zwar so, daß ein zu eigenen Fragen und Reflexionen befähigendes Verständnis vermittelt wird? Wilhelm Weischedel [...] hat die Masse gelehrter, aber schwer verständlicher Literatur beiseite geschoben und in vierunddreißig Aufsätzen die Quintessenz des Denkens und Lebenswerkes ebenso vieler Philosophen in unkonventioneller Weise so dargestellt, daß die jeweilige Kernproblematik und Kernantwort leicht verständlich ist, ohne daß gefährliche Verkürzungen zu verschmerzen wären. Die philosophische Hintertreppe wird zur sozialen Einrichtung, sie führt über nur geringe Umwege der anekdotischen Einführung in das Zentrum des jeweiligen Denkens, ohne beim Leser auch nur die geringste Vorkenntnis vorauszusetzen. Der Stoff von zweieinhalbtausend Jahren Philosophiegeschichte von Thaies, dem philosophierenden Handelsmann aus Milet, bis hin zu Ludwig Wittgenstein, dem modernen Künder des Untergangs der Philosophie, wird hier ohne wissenschaftliche Arroganz und lehrmeisterhafte Attitüde erzählt, mit allen Mitteln dieser Kunst.« Rheinischer Merkur
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 549
Ähnliche
Wilhelm Weischedel
Die philosophische Hintertreppe
Die großen Philosophen in Alltag und Denken
Deutscher Taschenbuch Verlag
Ungekürzte Ausgabe 2014
Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. KG, München
Lizenzausgabe mit Genehmigung der Nymphenburger Verlagshandlung GmbH
© 1966, 1973 Nymphenburger Verlagshandlung GmbH, München
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlags zulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Rechtlicher Hinweis §44 UrhG: Wir behalten uns eine Nutzung der von uns veröffentlichten Werke für Text und Data Mining im Sinne von §44 UrhG ausdrücklich vor.
Konvertierung Koch, Neff & Volckmar GmbH,
KN digital – die digitale Verlagsauslieferung, Stuttgart
eBook ISBN 978-3-423-42400-4 (epub)
ISBN der gedruckten Ausgabe 978-3-423-30020-9
Ausführliche Informationen über unsere Autoren und Bücher finden Sie auf unserer Website
www.dtv.de/ebooks
Den Enkeln: Katharina
Constanze
Annette
Sebastian
PrologoderDie zwei Aufgänge zur Philosophie
Die Hintertreppe ist nicht der übliche Zugang zu einer Wohnung. Sie ist nicht hell und geputzt und feierlich wie die Vordertreppe. Sie ist nüchtern und kahl und manchmal ein wenig vernachlässigt. Aber dafür braucht man sich für den Aufstieg auch nicht besonders vornehm zu kleiden. Man kommt, wie man ist, und man gibt sich, wie man ist. Und doch gelangt man auch über die Hintertreppe zum selben Ziel wie über die Vordertreppe: zu den Leuten, die oben wohnen.
Auch den Philosophen kann man sich feierlich nähern: über gepflegte Läufer und an blank geputztem Geländer entlang. Aber es gibt auch eine philosophische Hintertreppe. Auch für den Besuch bei den Denkern gibt es ein »man kommt, wie man ist« und ein »man gibt sich, wie man ist«. Und wenn man Glück hat, trifft man auch die Philosophen selber so an, wie sie sind, wenn sie nicht gerade am oberen Ende der Vordertreppe einen respektablen Gast erwarten; man trifft sie über die Hintertreppe ohne festliches Gepränge und ohne vornehmes Getue an. Vielleicht begegnet man ihnen da als den Menschen, die sie sind: mit ihren Menschlichkeiten und zugleich mit ihren großartigen und ein wenig rührenden Versuchen, über das bloß Menschliche hinauszugelangen. Wenn das geschieht, dann freilich ist die Unverbindlichkeit des Aufstiegs über die Hintertreppe vorbei. Dann gilt es, zu einem ernstlichen Gespräch mit den Philosophen bereit zu sein.
Vermutlich wird es nicht wenige Verkünder eines »vornehmen Tones in der Philosophie« geben, die das Unternehmen des Verfassers aufs Strengste verdammen werden, wenn sie es nicht überhaupt für unter ihrer Würde halten, davon Kenntnis zu nehmen. Ihnen sei es unbenommen, den Vorderaufgang zur Philosophie zu benutzen; auch der Verfasser hat dies in einigen seiner bisherigen Veröffentlichungen getan. Wenn er für diesmal die Hintertreppe benutzt, so auch deshalb, weil hier eine Gefahr ausbleibt, die der Vordertreppe eigentümlich ist: dass man nämlich unversehens, statt in die Wohnung der Philosophen zu gelangen, bei den Kandelabern, bei den Atlanten und Karyatiden verweilt, die das Portal, das Vestibül und den Treppenaufgang schmücken. Die Hintertreppe ist schmucklos und ohne jede Ablenkung. Zuweilen führt sie deshalb umso eher zum Ziel.
ThalesoderDie Geburt der Philosophie
Wer alt geworden ist und sein Ende nahen fühlt, dem mag es wohl geschehen, dass er in einer ruhigen Stunde an die Anfänge seines Lebens zurückdenkt. Das widerfährt auch der Philosophie. Sie ist nun zweieinhalb Jahrtausende alt; es gibt nicht wenige, die ihr einen baldigen Tod prophezeien, und wer heute Philosophie betreibt, den mag wohl manchmal das Gefühl beschleichen, es sei eine müde und ein wenig klapprig gewordene Sache, mit der er sich abgibt. Aus dieser Empfindung kann das Bedürfnis erwachsen, sich in die Vergangenheit zurückzuversetzen und nach den Anfängen zu suchen, in denen die Philosophie noch frisch und mit jungen Kräften im Dasein stand.
Doch wer so der Stunde ihrer Geburt nachforscht, gerät in Verlegenheit. Es gibt ja kein Standesamt für geistige Geschehnisse, dessen Register so weit zurückreichte, dass sich die Eintragung jenes Geburtstages in ihm fände. Wann die Philosophie eigentlich ins Leben getreten ist, weiß keiner mit Sicherheit; ihr Anfang verliert sich im Dunkel früher Zeiten.
Nun sagt eine alte Tradition, die Philosophie habe mit Thales begonnen, einem klugen Manne aus der Handelsstadt Milet im griechischen Kleinasien. Der habe dort im sechsten Jahrhundert v. Chr. gelebt und als Erster unter allen Menschen philosophiert. Doch dem stimmt keineswegs der ganze Chor der Gelehrten zu. Einige weisen darauf hin, dass sich doch auch schon bei den frühen Dichtern der Griechen philosophische Ideen finden; so machen sie Hesiod oder gar Homer zu Urvätern der Philosophie. Andere gehen noch weiter zurück und behaupten, es habe auch schon bei den orientalischen Völkern eine Art von Philosophie gegeben, längst ehe das Volk der Griechen in das Licht der Geschichte getreten sei.
Weit radikaler noch ist ein Gelehrter aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts, Mitglied der Berliner Akademie der Wissenschaften, Jakob Brucker, oder, wie er sich, der Sitte der Zeit entsprechend, nennt: Jacobus Bruckerus. Er verfasst ein dickleibiges lateinisches Opus mit dem Titel ›Kritische Geschichte der Philosophie, von der Wiege der Welt an bis zu unserem Zeitalter‹. Der Beginn der Philosophie reicht also, wenn man diesem Gelehrten trauen will, zurück bis in die allerersten Anfänge, bis zu der Wiege oder, wie man das lateinische Wort auch übersetzen kann, bis zu den Windeln der Menschheit. So findet sich denn auch auf dem Titelblatt des 1. Bandes ein Bild einer vorzeitlichen Landschaft, mit einem urwelthaften Bären, der versunken an seiner linken Klaue kaut. Darüber steht die Inschrift: »ipse alimenta sibi«, zu Deutsch: »er ist selber seine eigene Speise«, was denn wohl heißen soll: Die Philosophie bedarf keiner fremden Nahrung, keiner vorhergehenden Wissenschaft oder Kunst, sondern sie ist sich selbst genug; kurz: Die Philosophie entspringt aus sich selber, und zwar eben zu der Zeit, als die Menschheit noch in ihren Windeln liegt.
Daher muss Jacobus Bruckerus in seiner Suche nach den Anfängen der Philosophie weiter und weiter zurückgehen: hinter die Griechen und hinter die Ägypter und Babylonier, ja noch hinter die Sintflut, bis in jene Zeit zwischen Adam und Noah, in der die Menschheit ihre ersten Schritte tut. Darum heißt der erste Teil seines voluminösen Werkes: ›Vorsintflutliche Philosophie‹. Doch auch hier hält Bruckerus noch nicht inne; er erörtert sogar die Frage, ob es nicht vielleicht schon vor Beginn der Menschheit, unter den Engeln und Dämonen, Philosophen gebe. Hier kommt er nun freilich nach scharfsinniger Untersuchung zu dem Ergebnis: Weder Engel noch Dämonen sind Philosophen. Auch Adam und seine Söhne und Enkel werden ihm, wie er sie genauer betrachtet, fragwürdig. Zwar kann er bei ihnen Spuren philosophischer Reflexion entdecken; aber diese reichen doch nicht aus, um jene mit dem Mantel des Philosophen zu umhüllen. Adam etwa, so meint Bruckerus, habe ja gar keine Zeit für philosophische Spekulationen gehabt. Denn wer sich den ganzen Tag um seines Leibes Notdurft kümmern müsse, wer, wie die Bibel sagt, im Schweiße seines Angesichts sein Brot essen müsse, der habe am Abend keinen Kopf mehr für tiefsinnige Gedanken.
So ähnlich denkt übrigens auch der erste Geschichtsschreiber der Philosophie, der große Aristoteles. Wissenschaft und Philosophie, so etwa sagt er, hätten erst dann beginnen können, als die äußere Notdurft einigermaßen gestillt war und die Menschen für andere Dinge Muße hatten. Das nun sei zum ersten Mal in Ägypten der Fall gewesen, nämlich bei den Priestern dieses Landes; diese hätten darum Mathematik und Astronomie erfunden. Die Philosophie im eigentlichen Sinne aber sei erst bei den Griechen entstanden, und zwar in der Muße, die sich ein großer Handelsherr in der reichen Stadt Milet leisten konnte. So also kommt Aristoteles an den Punkt, an den man seitdem immer wieder den Anfang der Philosophie verlegt: eben zu dem Philosophen Thales aus Milet.
Von seinem Leben und Wesen weiß man allerdings nicht viel. Aristoteles stellt ihn als einen klugen, fast möchte man sagen gerissenen Geschäftsmann dar. Als er nämlich eines Tages bemerkt, dass die Olivenernte besonders reichlich zu werden verspricht, kauft er sämtliche Ölpressen auf und vermietet sie zu hohem Zinse weiter. Ob diese Geschichte stimmt, ist freilich unsicher. Gewiss ist dagegen, dass Thales sich mit politischen Dingen befasst und sich dann der Mathematik und der Astronomie zuwendet. Auf diesem Felde wird er ein berühmter Mann; es gelingt ihm, eine Sonnenfinsternis exakt vorauszuberechnen, und der Himmel tut ihm den Gefallen, an dem vorhergesagten Tage auch tatsächlich die Sonne sich verdunkeln zu lassen.
Diese Tatsache nimmt übrigens ein gegenwärtiger Geschichtsschreiber zum Anlass, um die Geburtsstunde der Philosophie exakt anzugeben; er schreibt den lapidaren Satz: »Die Philosophie der Griechen beginnt mit dem 28. Mai 585«; denn das eben ist der Tag jener vorausverkündeten Sonnenfinsternis. Man fragt sich freilich, was denn die Philosophie mit Sonnenfinsternissen zu tun habe, es sei denn, die Geschichte der Philosophie sei selber eine Folge nicht von Erleuchtungen, sondern von Finsternissen.
Im Übrigen ist Thales allem Vermuten nach ein echter Weiser: ein Mann nämlich, der nicht nur tief nachdenkt, sondern auch das Leben und seine Absonderlichkeiten kennt. Das wird von antiken Gewährsmännern in hübschen Anekdoten illustriert. Seine Mutter will ihn überreden zu heiraten; er aber antwortet: »Noch ist es nicht Zeit dazu.« Als er dann älter wird und die Mutter ihn immer eindringlicher bestürmt, erwidert er: »Nun ist die Zeit dazu vorüber.« Tiefsinniger noch ist eine andere Geschichte: Auf die Frage, warum er keine Kinder zeugen wolle, antwortet er: »Aus Liebe zu den Kindern.«
Nun mag man die Vorsicht in ehelichen und väterlichen Dingen für eine lobenswerte Eigenschaft halten: Sie reicht doch nicht aus, um einen Menschen zum Philosophen zu machen. Was Platon berichtet, ist aber echt philosophisch: »Als Thales die Sterne beobachtete und nach oben blickte und als er dabei in einen Brunnen fiel, soll eine witzige und geistreiche thrakische Magd ihn verspottet haben: Er wolle wissen, was am Himmel sei, aber es bleibe ihm verborgen, was vor ihm und zu seinen Füßen liege.« Der Philosoph im Brunnen ist allerdings eine kuriose Erscheinung. Platon aber gibt dieser Geschichte eine ernsthafte Wendung. »Der gleiche Spott trifft alle, die in der Philosophie leben. Denn in Wahrheit bleibt einem solchen der Nächste und der Nachbar verborgen, nicht nur in dem, was er tut, sondern fast auch darin, ob er ein Mensch ist oder irgendein anderes Lebewesen … Wenn er vor Gericht oder irgendwo anders über das reden muss, was zu seinen Füßen oder vor seinen Augen liegt, ruft er Gelächter hervor, nicht nur bei Thrakerinnen, sondern auch beim übrigen Volk; aus Unerfahrenheit fällt er in Brunnen und in jegliche Verlegenheit; seine Ungeschicklichkeit ist entsetzlich und erweckt den Anschein der Einfältigkeit.« Doch nun kommt das Entscheidende: »Was aber der Mensch ist, und was zu tun und zu erleiden einem solchen Wesen im Unterschied von den anderen zukommt, danach sucht er und das zu erforschen müht er sich.« Jetzt also kehrt sich die Sache um. Platon will sagen: Wenn es um das Wesen der Gerechtigkeit und um andere wesentliche Fragen geht, dann wissen die andern nicht aus noch ein und machen sich lächerlich; dann aber ist die Stunde des Philosophen gekommen.
Jetzt versteht man, weshalb Platon, Aristoteles und viele andere nach ihnen gerade diesen Thales aus Milet als den ersten Philosophen bezeichnen. Es geht ihm nicht um die Dinge, sondern um das Wesen der Dinge. Er will dahinterkommen, was es in Wahrheit mit dem auf sich hat, was sich in so vielfältigen Gestalten in der Welt findet: mit den Bergen, den Tieren und den Pflanzen, mit dem Wind und den Sternen, mit dem Menschen, seinem Tun und seinem Denken. Was ist das Wesen von alledem, fragt Thales. Und weiter: Woher kommt, woraus entspringt das alles? Was ist der Ursprung von allem? Was ist das Eine, alles Umfassende, das Prinzip, das macht, dass das alles wird und ist und besteht? Das sind, wenn auch von ihm selber nicht so ausgesprochen, die Grundfragen des Thales, und indem er sie als Erster stellt, wird er zum Anfänger der Philosophie. Denn nach dem Wesen und nach dem Grunde zu fragen, ist seitdem und bis heute das zentrale philosophische Anliegen.
Die Antwort freilich, die Thales auf diese Frage gibt, ist seltsam. Er behauptet nämlich, so wird berichtet, das Wasser sei der Ursprung von allem. Wie? All das, was wir als Fülle der Weltgestalten vor Augen haben, jene Berge, Sterne und Tiere, wir selber und der Geist, der in uns wohnt, all das soll aus dem Wasser stammen, soll seinem innersten Wesen nach nichts als Wasser sein? Eine wunderliche Philosophie, diese Philosophie im Anfang.
Offenbar muss man Thales um dieses seines Grundgedankens willen als einen ausgesprochenen Materialisten ansehen. Das Wasser, ein materieller Stoff, wird zum Urprinzip gemacht; aus Materiellem also will dieser Philosoph alles ableiten. So kann man es in manchen Lehrbüchern der Geschichte der Philosophie lesen. Freilich, so wird hinzugefügt, Thales ist noch ein recht primitiver Materialist. Denn die Forschung nach den Urbestandteilen der Wirklichkeit hat seine These keineswegs bestätigt; die Frage nach den ursprünglichsten Konstituenzien der Welt ist viel zu kompliziert, als dass sie mit der einfachen Annahme beantwortet werden könnte, das Wasser sei das Urprinzip. Thales ist also ein Materialist; aber man braucht ihn mit seiner überholten Annahme nicht mehr ernst zu nehmen.
Aber die darin liegende Verachtung des Anfangs der Philosophie sollte doch zu denken geben. Hat man denn jenen Satz vom Wasser als dem Urprinzip richtig verstanden, wenn man ihn so ohne Weiteres als Ausdruck eines philosophischen Materialismus deutet? Das Bedenken wird noch verstärkt, wenn man hinzunimmt, dass von Thales ein zweiter Satz überliefert wird, der nun ganz und gar nicht zu der materialistischen Deutung passen will. Er lautet: »Alles ist voll von Göttern.« Jetzt geht es offenbar nicht darum, dass alle Wirklichkeit aus einem Urstoff erklärt wird. Jetzt wird vielmehr gesagt: Was wir vor uns sehen, diese ganz sichtbare Welt, ist die Stätte der Anwesenheit von Göttern. Der Mensch begreift die Welt nicht richtig, wenn er meint, was er um sich sieht, seien einfachhin vorhandene Dinge; er muss einsehen: Es ist das Wesen der Dinge, dass in ihnen Göttliches waltet.
Hat also Thales, in seinen beiden Sätzen vom Wasser und von den Göttern, zwei einander widerstreitende Behauptungen aufgestellt? Denn dies beides steht doch offenbar zueinander im Gegensatz: Entweder ist die Wirklichkeit bloßer Stoff, oder sie ist göttlichen Lebens voll. Wenn aber hier ein schroffes Entweder- oder herrscht, auf welcher Seite liegt dann die Wahrheit? Diese Frage reicht bis in den Grund der Weltdeutung, und sie ist bis heute nicht zu Ende gekommen. Noch in der Gegenwart geht es in den philosophischen Diskussionen entscheidend darum, ob die Welt von einem rein materiellen Prinzip her zu verstehen ist, oder ob wir annehmen sollen, die Dinge seien sichtbare Zeichen eines Tieferen, die Welt sei Ausdruck eines in ihr waltenden göttlichen Prinzips, vielleicht gar das Geschöpf eines schaffenden Gottes.
Doch wie steht es eigentlich in dieser Hinsicht mit Thales, dem anfänglichen Philosophen? Hat er tatsächlich, wie es bis jetzt den Anschein hat, das Widerstreitende unverbunden nebeneinandergestellt, das Unversöhnliche gelehrt, ohne den Widerspruch zu merken? Oder steht etwa seine Behauptung, alles sei aus dem Wasser entsprungen, doch mit der anderen in Verbindung, dass alles voll von Göttern sei? Erwächst vielleicht die Unvereinbarkeit nur daraus, dass man die These vom Ursprung aus dem Wasser im modernen naturwissenschaftlichen Sinne deutet, als eine Hypothese über den materiellen Urstoff, und dass man sie damit nicht in ihrem wahren, zeitgenössischen Sinne versteht? Denn es ist doch sehr die Frage, ob eine solche naturwissenschaftliche Theorie der Weltsicht entspricht, wie sie die Menschen des sechsten Jahrhunderts v. Chr. besitzen. So gilt es, noch einmal zu überlegen, was es heißen will, wenn Thales sagt: Ursprung von allem ist das Wasser.
Da hilft nun weiter, was Aristoteles über Thales berichtet. Er weiß zwar selber nicht mehr genau, was jener Urvater der Philosophie eigentlich sagen will; immerhin sind ja bis auf seine Tage fast drei Jahrhunderte verflossen. Aber wie Aristoteles an dem dunklen Spruch vom Wasser herumrätselt, meint er, Thales denke dabei wohl an den Okeanos, jenen Urstrom, der nach alter Sage die Erde umfließt und als Vater des Entstehens von allem gilt. Vielleicht auch sei dem Thales gegenwärtig, dass von alters her erzählt wird: Wenn die Götter einen Schwur leisten, rufen sie den Styx an, den Totenfluss, der das Reich der Lebendigen vom Reich der Schatten trennt; der Eid aber, fährt Aristoteles fort, ist das Heiligste von allem. Uraltes mythisches Wissen also beschwört Aristoteles herauf, wenn er sich an die Deutung des Satzes des Thales macht: den Gedanken an den Okeanos und den Styx, die mythischen Urströme, und an die magische Heiligkeit des Eides. Und jetzt ist deutlich, wohin Aristoteles weisen will. Wenn Thales vom Wasser redet, dann denkt er nicht an einen materiellen Urstoff, sondern an die mythische Mächtigkeit des Ursprünglichen, an die Göttlichkeit des Ursprungs. Dazu nun fügt sich bruchlos jener zweite Satz des Thales, wonach alles voll von Göttern ist. Das heißt dann nicht: Da ist ein Stück Apollon und dort ein Stück Zeus. Sondern das besagt: Alles, was ist, ist von göttlichen Kräften durchwaltet. Wo wir philosophieren, dürfen wir die Welt nicht einfach so betrachten, als bestünde sie aus einer Fülle nebeneinanderliegender Dinge. In der Welt waltet vielmehr ein einheitliches Prinzip, ein mächtig Göttliches, und aus ihm hat alles, was ist, Ursprung und Bestehen.
Warum ist es aber gerade das Wasser, in dessen Bild Thales die Göttlichkeit des Ursprungs erblickt? Das hat, wie Aristoteles vermutet, darin seinen Grund, dass alles Lebendige in der Welt dadurch ins Leben kommt und sich im Leben erhält, dass es vom Wasser getränkt wird. Wie dieses in den Dingen die Lebendigkeit schafft, so steht es auch mit dem göttlichen Urgrund: Er belebt alles, indem er alles durchdringt. So will denn der Satz des Thales, alles sei aus dem Wasser entsprungen, dies besagen: In allem Wirklichen waltet ein göttlich Wirksames, von ursprünglicher Mächtigkeit wie die Urströme des Mythos und alles durchdringend wie das lebenserhaltende Wasser.
Damit aber ist Entscheidendes für das Verständnis des anfänglichen Wesens der Philosophie gewonnen. Diese beginnt nicht mit primitiven naturwissenschaftlichen Fragestellungen und Theorien. Es geht ihr vielmehr darum, in einer Zeit, in der die Kraft des Mythos zu verblassen beginnt, doch das zu bewahren, worum der Mythos weiß: zu bewahren freilich in einer gewandelten Form, nämlich in der des ausdrücklichen Fragens nach dem Ursprünglichen und Göttlichen.
Was aber ist es, was das Philosophieren in seinem Beginn aus dem Mythos übernehmen kann? Eben das, was Thales mit seinen rätselhaften Worten ausdrücken will: dass nämlich die Welt eine Tiefe besitzt. Jene uralten Mythen der Griechen wären ja allzu oberflächlich verstanden, wollte man sie nur als kuriose Geschichten von irgendwelchen Fabelwesen, Götter genannt, nehmen. Wenn die Griechen von ihren Göttern sprechen, dann meinen sie damit vielmehr die hintergründige Tiefe der Wirklichkeit. Sie erfahren die Wirklichkeit des Streites, der alle Bereiche der Welt durchzieht, und benennen sie mit dem Namen des Gottes Ares. Sie erfahren die dämonische Stille des Mittags und geben ihr den Namen des Gottes Pan. Sie wollen damit sagen: Alles Wirkliche gründet im Göttlichen; dessen Anwesenheit ist das eigentlich Wirkliche der Wirklichkeit.
Hier nun knüpft die beginnende Philosophie an. Sie kann zwar nicht mehr in der Unmittelbarkeit der mythischen Geschichten übernehmen, was dort gesagt wird. Sie beginnt in einer Zeit, in der dem Menschen die religiösen Vorstellungen fragwürdig geworden sind und in der er entdeckt, dass er selber fragen und selber nachdenken muss. Aber nun müht sich die Philosophie darum, dass ihr in solchem Fragen und in solchem Nachdenken das nicht verloren gehe, was im mythischen und religiösen Wissen als das eigentlich Wahre verborgen ist. Dabei entdeckt sie: Die alte und bleibende Wahrheit ist, dass alles Wirkliche nicht nur ein vordergründiges Gesicht trägt, sondern hintergründig von einem Tieferen durchwaltet ist.
Dem nachzuforschen ist seitdem die Leidenschaft des philosophischen Fragens. Denn noch heute ist die Philosophie in keiner anderen Situation als damals in ihren Anfängen. Auch heute noch steht sie in der Auseinandersetzung mit dem religiösen Wissen. Auch heute noch, und gerade heute, besteht die Gefahr, dass sie in dieser ihrer Abwehrhaltung zu einer rein diesseitigen Weltdeutung kommt, für die es nichts als materielle Dinge gibt. Aber wenn sie sich darauf einließe, dann verlöre sie, was sie im Anfang besessen hat: die Eindringlichkeit des Hinabfragens in die Tiefe und in die Urgründe. Dies sich zu bewahren und sich doch nicht einem bloßen Glauben auszuliefern, sondern fragendes Ergründen des Ursprungs zu bleiben, ist auch heute noch die Aufgabe.
Das ist freilich eine große und schwere Aufgabe. Denn dem ersten Blick zeigt die Welt nichts von einem Ursprung aus dem Göttlichen. Was wir zunächst beobachten, ist vielmehr ein tragisches Widerspiel von Geburt und Tod, von Entstehen und Vergehen. Wie soll man annehmen können, die solcherart zerrissene Wirklichkeit gründe im Göttlichen, das wir uns doch als ewig und dem Widerstreit des Entstehens und Vergehens enthoben denken? Wie kann das Ewige Grund des Vergänglichen sein?
Hier setzt das philosophische Fragen ein, und dies schon in seinen Anfängen. Es ist die griechische Grunderfahrung und zugleich das tiefere Leiden des griechischen Menschen an der Welt, dass das Wirkliche in all seiner Schönheit unter der ständigen Drohung des Todes und der Nichtigkeit steht. Aber der griechische Geist verharrt nicht in stummer Resignation vor diesem Anblick der Welt; er unternimmt den leidenschaftlichen Versuch, die Unheimlichkeit der vergänglichen Welt unter dem Aspekt des Göttlichen tiefer zu begreifen.
Eben das geschieht im anfänglichen griechischen Philosophieren. Wenn Thales den göttlichen Ursprung der Welt im Bilde des Wassers erblickt, dann will er damit die Frage nach der Herkunft des Vergänglichen aus dem Ewigen beantworten. Denn mag das Wasser auch immer bleiben, was es ist, nämlich Wasser, so zeigt es sich doch in stets anderer Gestalt: bald als Dampf, bald als Eis und Schnee, bald als Bach und Meer. Sich verwandelnd in die verschiedenen Weisen seines Erscheinens, bleibt es doch das eine und selbe. So steht es auch mit dem Göttlichen. Es ist ewig und immer sich selber gleich, und doch wandelt es sich, und eben darum vermag es Ursprung dessen zu sein, was immerzu entsteht und vergeht: der wirklichen Welt.
Dem denkt der große Schüler des Thales, Anaximander, eindringlicher nach. Wenn wir aus den wenigen Nachrichten, die von ihm erhalten sind, schließen dürfen, dann ist eben das Entstehen und Vergehen der Ausgangspunkt seines Philosophierens: dass ein Ding ins Dasein tritt und wieder verschwindet, dass wir selber werden und untergehen, dass die ganze Welt ein ungeheurer Schauplatz von Geburt und Tod ist. Wie soll man das begreifen und doch daran festhalten, dass das Wirkliche im Ewigen und Göttlichen gründet?
Wie Anaximander dem weiter nachsinnt, kommt er zu einer großartigen Deutung der Wirklichkeit. Dass ein Ding untergeht, meint er, ist kein zufälliges Geschehen; es ist Buße und Sühne für ein Vergehen; Sterben heißt Abbüßen einer Schuld. Doch worin besteht diese Schuld? Darin, dass ein jegliches Ding den Drang hat, über das ihm gesetzte Maß hinaus im Dasein zu verharren. Damit aber wird es schuldig an anderen Dingen; denn es versperrt ihnen den Raum und benimmt ihnen so die Möglichkeit, ins Dasein zu treten. Die ganze Welt ist in der Sicht des Anaximander ein großer Kampf um das Sein; das Beharrende hindert das Ankommende daran, ins Dasein zu gelangen; aber weil es sich damit an ihm verschuldet, bereitet ihm die große Notwendigkeit den Untergang und schafft so Raum für den Aufgang neuer Dinge.
So steht es mit der Welt. Doch es gibt für Anaximander noch einen tieferen Aspekt. Letztlich nämlich geht es nicht so sehr um eine Schuld des einen Dinges gegen das andere als vielmehr um ein Vergehen gegen den göttlichen Ursprung selber. Dieser muss, wenn alles Wirkliche ihm sein Entstehen verdankt, als ein Prinzip unaufhörlicher, schöpferischer Lebendigkeit verstanden werden, als das Grenzenlose oder Unendliche, wie Anaximander es nennt. Würden nun die Dinge im Dasein beharren und so andere Dinge daran hindern, ins Dasein zu treten, so hieße das, das Unendliche könnte nicht mehr sein, was es doch vom Wesen her ist: schöpferische, immer Neues aus sich gebärende Lebendigkeit; es würde selber starr und tot. So ist der Untergang der Dinge, dieses Befremdliche der Wirklichkeit, zuletzt vom Göttlichen her gerechtfertigt. Die Dinge, die sich ins Beharren versteifen, müssen sterben, damit das Unendliche seine Lebendigkeit bewahren kann. Die Vergänglichkeit, das große Rätsel für das Philosophieren und für den Menschen, erhält ihren Sinn von der Unvergänglichkeit der göttlichen Lebendigkeit her. Das ist der tiefsinnige Gedanke des Anaximander. Ihn spricht er in dem einzigen größeren Fragment, das von ihm erhalten ist, aus: »Ursprung der Dinge ist das Unendliche. Woraus aber den Dingen das Entstehen kommt, dahinein geschieht ihnen auch der Untergang nach der Notwendigkeit. Denn sie zahlen einander Sühne und Buße für ihr Unrecht nach der Ordnung der Zeit.«
Die Philosophie versteht freilich in ihrer weiteren Geschichte die Deutungen, die Thales und Anaximander geben, nicht als die einzige und gültige Antwort auf ihre Fragen; vielfältig versucht sie neue Lösungen des Problems. Aber die anfängliche Frage bleibt. Darum auch besinnt sich die Philosophie immer wieder an den entscheidenden Wendepunkten ihrer Geschichte auf ihren Beginn und stellt in neuer Unmittelbarkeit das Problem des absoluten Grundes der Wirklichkeit und des Hervorgangs des Vergänglichen aus dem Unvergänglichen. Denn das ist und bleibt die große Grundfrage aller Philosophie. Diese betrachtet wohl die Welt, die Dinge und den Menschen. Wonach sie aber letztlich fragt, ist die Tiefe der Welt.
Wenn man bedenkt, dass das Denken der Philosophen, seit Thales, jenem ersten Metaphysiker, unablässig um den Ursprung von allem kreist, dann wird man es nicht mehr verwunderlich finden, dass Menschen von solcher Art manchmal den Dingen dieser Welt nicht die volle und ungeteilte Aufmerksamkeit zuwenden können. So kann ihnen passieren, was Thales geschieht: dass sie die Grube nicht sehen, die doch vor ihren Augen liegt, dass sie in sie hinabstürzen. Vielleicht muss es sogar so sein, dass, wer nach der Tiefe der Welt forscht, den Boden unter den Füßen verliert. Die thrakischen Mägde mögen darüber lachen. Aber wer es nicht riskiert, den Grund, auf dem er steht, zu verlieren, in der verwegenen Hoffnung, einen tieferen und sichereren Grund zu erlangen, der wird nie wissen, was das Philosophieren seit seinen ersten Anfängen bedeutet.
Parmenides und HeraklitoderDie gegensätzlichen Zwillinge
Schon in den Beginn der Geschichte der Philosophie pflegt man einen großen Gegensatz zu verlegen, der dann – so wird gesagt – ihre ganze weitere Entwicklung beherrscht: den Gegensatz von Sein und Werden. Man teilt diesen sodann unter zwei anfängliche Denker auf: Parmenides und Heraklit. Jener hat danach das ewige Sein gelehrt, dieser dagegen das ewige Werden. Sollte man aber die beiden Philosophen so starr in Rubriken einfangen? Beginnt die Philosophie wirklich mit Schlagworten?
Wer sind überhaupt diese beiden Philosophen? Man weiß nicht viel von ihnen. Am wenigsten von Parmenides. Als mutmaßlicher Lehrer gilt Xenophanes, der als herumziehender Barde bis ins hohe Alter am Herd der Großen philosophische Gesänge vorgetragen hat. Im Übrigen wissen wir fast nur dies, dass Parmenides im sechsten Jahrhundert vor Christus in Elea in Unteritalien gelebt hat und vermutlich auch dort gestorben ist. Er stammte aus einem reichen und glänzenden Hause, war jedoch, wie ein antiker Gewährsmann versöhnlich hinzufügt, mit einem »armen, aber ganz vortrefflichen Manne« befreundet. Auch Gesetzgeber und Politiker soll er gewesen sein; aber eine genaue Nachricht darüber haben wir nicht. Noch ungewisser ist, ob Parmenides wirklich, wie behauptet wird, in Ägypten gewesen ist, um Logik und Astronomie zu lernen. Schon wahrscheinlicher ist, dass er sich einmal nach Athen begeben hat; dort soll er, wie Platon berichtet, mit dem jungen Sokrates disputiert haben. Sicher ist dagegen, dass er tüchtige Schüler gehabt hat. Das ist dann auch schon alles. Doch vielleicht ist diese Spärlichkeit der biografischen Notizen für einen Philosophen charakteristisch, dem – man wird es noch sehen – die Wirklichkeit im reinen Sein untergeht. Aber eben darin liegt seine Bedeutung für die künftige Philosophie; den »Großen« hat ihn deshalb Platon genannt, einen Denker von einer »ganz und gar ursprünglichen Tiefe«.
Ein wenig mehr als von Parmenides wissen wir von dem anderen der anfänglichen Philosophen, von Heraklit. Er lebte, wenig jünger als Parmenides, in Ephesos in Kleinasien. Er nun hat sich ausdrücklich politisch geäußert. Man erzählte sich im Altertum, er habe sogar mit dem Perserkönig Dareios korrespondiert. Wie von Herkunft war er auch von Gesinnung ein vornehmer Mann. Die Würde eines Opferkönigs, die in seiner Familie erblich war, soll er zwar ausgeschlagen haben. Aber er blieb aristokratisch gesinnt, vor allem, nachdem sein politischer Freund Hermodoros aus der Stadt Ephesos verbannt worden war. In seiner Ablehnung der Demokratie war er übrigens äußerst hochfahrend. Als probates Mittel gegen die verfahrene politische Situation empfahl er, alle Mitbürger sollten sich aufhängen. So war es denn auch nur konsequent, dass er der Beschäftigung mit politischen Dingen im demokratischen Staat das Würfelspiel mit Knaben im Tempel der Artemis vorzog. Schließlich soll er sich aus Überdruss an den Menschen ins Gebirge zurückgezogen und sich dort von Gras und Kräutern ernährt haben. Das bekam ihm freilich schlecht, denn er soll sich dadurch die Wassersucht zugezogen haben. Als die Ärzte ihm dabei nicht helfen konnten, soll er versucht haben, die Krankheit nach eigenem Rezept zu bekämpfen: mit Rindermist. Und nun gabelt sich die Überlieferung. Die einen behaupten, er habe sich mistbedeckt in die Sonne gelegt und sei an dieser Gewaltkur jämmerlich zugrunde gegangen. Abenteuerlicher noch ist eine andere Version: Unverständige Hunde hätten ihn, wie er so, in Mist eingepackt, dagelegen habe, für einen Kadaver gehalten und ihn mit Haut und Haaren aufgefressen. Aber das alles ist nicht sicher. Fest steht nur, dass Heraklit mit etwa 60 Jahren gestorben ist. Übrigens betonen antike Gewährsmänner nachdrücklich, man dürfe ihn nicht mit einem Mann gleichen Namens, einem gewerbsmäßigen Clown, verwechseln.
Parmenides – um auf ihn zurückzukommen – war eigentlich ein Dichter. Wenigstens hat er seine philosophischen Gedanken in Versen vorgetragen. Auch dichterisch-philosophische Visionen hat er gehabt. So beginnt sein großes Lehrgedicht mit der Geschichte eines »wissenden Mannes«, der aus dem »Haus der Nacht« ausfährt, »abseits von dem Wege der Menschen«, auf einem Wagen, den die »Sonnenmädchen« geleiten. Ihm nun öffnet sich das »Tor der Wege von Tag und Nacht«, dessen Schlüssel Dike, die Göttin der Gerechtigkeit, verwahrt. Endlich gelangt er zu einer »Göttin«, die ihm kundtut, was Wahrheit und was Schein ist. Was da in Versen und im dichterischen Gesicht dargestellt wird, ist offensichtlich die Geschichte des Philosophierenden. Er kommt aus der Nacht der Unwissenheit, er geht seinen Weg, einsam unter den Menschen, er fährt aus nach der Wahrheit, er überwindet die Schwierigkeiten des geschlossenen Tores, und was die Wahrheit angeht, so erfindet er sie nicht selber, sondern sie wird ihm aus göttlichem Munde gesagt. Das eben ist die griechische Grunderfahrung vom Philosophieren. Es findet die Wahrheit nicht im noch so bemühten Ergrübeln. Die Wahrheit gibt sich selber, sie erscheint in ihrem eigenen Licht, und die Aufgabe des Menschen ist nur, sich nach ihr aufzumachen und sie dann im Schauen und Hören entgegenzunehmen.
Aber was ist diese philosophische Wahrheit? Parmenides bringt sie dadurch zum Vorschein, dass er sie der »Meinung« entgegensetzt, der Art nämlich, wie der Mensch alltäglich die Wirklichkeit sieht, oder seinem gängigen Weltbild. Da nun meint der Mensch erstens, das einzelne Ding in seiner Besonderheit sei das wahrhaft Wirkliche, und er achtet nicht auf das Ganze, in dem gehalten das Einzelne doch allein existieren kann. Da meint er zweitens, die Welt sei ein Streit von Gegensätzen, und er vergisst, dass es in allem Streit eine Einheit gibt, auf deren Grunde allererst die Gegensätze sich erheben können. Übrigens führt Parmenides – immer im Sinne der Meinung – die Gegensätzlichkeiten in der Weltwirklichkeit auf einen Grundgegensatz zurück: den Zwiespalt von Feuer und Nacht oder von Licht und Finsternis, worauf er dann das Feurige und Lichthafte den Frauen, das Nächtige den Männern zuspricht. Weniger galant wird später Empedokles sein, der den Parmenides dahin berichtigt, dass das Lichthafte doch sinnvollerweise den Männern zukommen müsse. Drittens schließlich hält die alltägliche Meinung das Vergängliche, das, was wird und untergeht, für das eigentlich Seiende, ohne zu merken, dass darin ja das Nichtsein mit inbegriffen ist. Diese Einmischung des Nichtseins aber gilt in allen drei Hinsichten; überall ist das vermeintlich Wirkliche eine Verbindung von Sein und Nichts. Das Einzelne ist, was es ist, nur, weil es nicht ein anderes Einzelnes ist. Im Streit negieren sich die Dinge; das Vergängliche ist das, was einst nicht war und einmal nicht mehr sein wird. So ist die alltägliche Meinung, auf Sein und Nichtsein blickend, in sich zerrissen und zwiespältig. Eben darum kann, was sie das Seiende nennt, nicht die wahre Wirklichkeit sein, sondern nur Schein. Der Philosoph aber muss diesen Schein durchschauen und hat danach zu trachten, die Wahrheit der Wirklichkeit zu erspähen.
Dabei befindet er sich wie Herakles am Scheideweg, und es eröffnen sich ihm drei Pfade. Auf dem ersten kann er weiterhin in der Richtung auf die zwiespältige Wahrheit der Meinung gehen; es ist der Weg, auf dem »die nichts wissenden Sterblichen einherschwanken«. Der Philosoph aber kann den Widerspruch von Sein und Nichtsein nicht übersehen; er kann nicht zugeben, dass, was zum Teil nichtseiend ist, das wahre Sein sei. Parmenides warnt deshalb vor dieser Ausflucht: »Halte von diesem Weg des Suchens den Gedanken fern, und es soll dich nicht vielerfahrene Gewohnheit auf diesen Weg zwingen, walten zu lassen das blicklose Auge und das dröhnende Gehör und die Zunge.« Wer diese Warnung befolgt, der ist hinaus über den Zwiespalt von Sein und Nichtsein, für den ist »Entstehen verloschen und Vergehen verschollen«.
Der zweite Weg müsste dahin führen, dass man sich im Zwiespalt von Sein und Nichtsein auf die Seite des Nichts schlüge, dass man also behauptete, das Nichtseiende sei. Spätere Denker werden diese Richtung einschlagen. Parmenides dagegen hält das für unmöglich; denn das Nichts ist unerkennbar, unaussprechbar und also nicht wahr. Darum warnt er auch hier: »Halte deinen Geist von diesem Wege des Nachspürens fern.«
Nach der Abweisung der beiden ersten Wege bleibt für ein besonnenes Philosophieren nur noch der dritte offen: dass man sich auf die Suche nach dem Sein begebe. »So bleibt nur noch Kunde von dem Wege, dass das Sein ist.« Demgemäß ist die wesentliche philosophische Aussage des Parmenides: »Das Sein ist.« Das klingt freilich recht formal. Gemeint ist aber mehr. Gemeint ist unter dem Begriff des Seins das, was bleibt, wenn das zweideutige Seiende, also die Dinge, ins Nichts hinabsinken. Gemeint ist das, was dann, wenn das uneigentliche Seiende, an das sich die Meinung hält, untergeht, als das Eigentliche Bestand hat. Gemeint ist das, was die einzige und alleinige, die wahre Wirklichkeit ist.
Und nun macht sich Parmenides daran, dieses Sein, das allein in Wahrheit ist, zu kennzeichnen; er weist seine »Merkzeichen« auf. Dazu gehört, dass es nicht, wie das endliche Seiende, zerspalten in lauter Einzelnes ist, sondern dass es Eines ist, dass in ihm alles mit allem zusammenhängt. Dazu gehört weiter, dass es nicht Gegensätzlichkeit und Streit kennt, sondern dass ihm Ganzheit, Unteilbarkeit, Gleichartigkeit mit sich selbst zukommen. Dazu gehört schließlich, dass es nicht durch Vergänglichkeit und ständige Bewegtheit gekennzeichnet ist, sondern dass ihm Unbewegtheit und Ewigkeit eignen. Damit bahnt sich in Parmenides eine für die ganze weitere Geschichte der Philosophie folgenschwere Entwicklung an. Denn nun ist mit aller Deutlichkeit gesagt: Wer danach fragt, was das wahrhaft Seiende ist, der darf sich nicht an die uns umgebende Wirklichkeit halten und auf diese starren; er darf sich nicht an die vergänglichen Dinge halten. Er muss vielmehr auf das Ewige und Immerseiende blicken, das über aller Wirklichkeit steht, ja, das in all unserer Wirklichkeit das einzige wahrhaft Wirkliche ist. Dass Parmenides diesen Gedanken mit aller Schroffheit ausspricht, macht die eigentümliche Größe dieses frühen Denkers aus.
Freilich: Die großartige Einseitigkeit dieses philosophischen Standpunktes wird sich auf die Dauer nicht halten lassen. Die konkrete Wirklichkeit, die durch einen Gewaltstreich beseitigt und um des reinen Seins willen in den Abgrund des Nichts geworfen wird, wird wieder ihr Recht geltend machen. Der Weltverlust kann nicht das letzte Wort der Philosophie sein. Das zeigt sich schon bei dem großen Zeitgenossen des Parmenides, bei Heraklit.
Schon im Altertum nennt man Heraklit den »Dunklen«. Sokrates, der sein Buch von Euripides ausleiht, sagt, es bedürfe eines delischen Tauchers, um es zu verstehen. Doch trotz der Schwierigkeiten einer Deutung der Fragmente, die von dieser Schrift allein noch überliefert sind, übt Heraklit eine unabschätzbare Wirkung aus. Hegel behauptet, »der tiefsinnige Heraklit« führe »den vollendeten Anfang der Philosophie« herauf. Nietzsche stimmt dem zu: »Heraklit wird nie veralten.«
Wie Parmenides wendet sich auch Heraklit gegen die landläufige »Meinung«. Von den in ihr befangenen Menschen gilt: »Zu hören verstehen sie nicht noch zu sprechen«; »sie verstehen nicht, wenn man sie belehrt, aber sie bilden sich ein, sie verstünden«. Über diese Sicht des gängigen Weltbildes aber erhebt sich nun der Philosoph. Er weiß, wie es mit den Dingen in Wahrheit steht; er besitzt den Logos, die Einsicht.
Der Kampf gegen die Meinung setzt sich bei Heraklit in konkrete Zeitkritik um. Gegen Hesiod, gegen Pythagoras, gegen Xenophanes erhebt er den Vorwurf der unverständigen Vielwisserei. Aber »Vielwisserei lehrt nicht, das wahre Verstehen zu besitzen«; »Scheinhaftes erkennt und bewahrt selbst der Berühmteste«. Sogar gegen Homer wird – in der Form einer Anekdote – der Einwand der Unwissenheit ausgesprochen. »Es täuschen sich die Menschen in Bezug auf die Einsicht in das Offenbare, dem Homer vergleichbar, der weiser war als alle Griechen. Denn ihn täuschten Knaben, die Läuse jagten, indem sie sagten: Was wir sahen und griffen, das lassen wir; was wir aber nicht sahen und griffen, das bringen wir.« Was so für das Wissen gilt, das gilt auch für die religiöse Einsicht. »Zu den Götterbildern beten sie, wie wenn einer mit Häusern redete; sie kennen Götter und Heroen nicht nach ihrem eigentlichen Sein.« Kurz: Überall mangelt es an Einsicht, am Logos.
Freilich: Auch die große Menge könnte die wahre Einsicht besitzen. Denn in seltsamer Verschüttetheit lebt der Logos auch in den vielen. »Mit dem Logos, mit dem sie doch ständig umgehen, leben sie im Zwiespalt«. So sind die Menschen wie Schlafende, die zu erwecken die Aufgabe des Philosophen ist.
Mit dem Satz: »Der Seele ist ein Logos eigen«, richtet sich zum ersten Mal in der Philosophie der Blick auf die Innerlichkeit des Menschen. In diesem Sinne sagt Heraklit: »Ich durchforschte mich selbst.« Freilich: Wenn hier von Innerlichkeit die Rede ist, dann muss sie griechisch gedacht werden. Es handelt sich nicht um die moderne Neugier der psychologischen Selbstzergliederung, auch nicht, wie etwa bei Augustinus, um die bekümmerte Durchforschung des Inneren nach den geheimsten Seelenregungen. Es geht vielmehr darum, zu sehen, wie sich im Selbst des Menschen das wahre Verstehen der Wirklichkeit findet. Die Innerlichkeit ist gleichsam nach außen gerichtet. Doch gibt es auch eine tiefere Dimension. In seinem Blick nach innen stößt Heraklit bei der Frage nach sich selbst ins Unabsehbare. »Der Seele Grenzen dürftest du nicht ausfindig machen, auch wenn du gehst und jeglichen Weg dahinwanderst; einen so tiefen Logos hat sie.« So kommen bei ihm zum ersten Mal in der Geschichte der Philosophie die Verwunderung und das Erstaunen des Geistes über sich selbst zum Ausdruck.
Doch darüber verliert Heraklit die philosophische Hauptaufgabe seines Zeitalters nicht aus den Augen: das wahre Wesen dessen, was ist, zu erforschen. Physis, Natur, nennt er das in allem Seienden waltende Wesen. Und nun spricht er ein merkwürdig zurückschreckendes Wort aus: »Die Physis liebt es, sich zu verbergen.« Was in allem waltet, die Natur, liegt nicht offen zutage; sie hält sich verborgen und muss erst eigens in der Gewalt des Philosophierens der Verborgenheit entrissen werden. Wohinein aber hat sich die Natur verborgen? In das Wirkliche, das dementsprechend nur verhüllt sein wahres Wesen erkennen lässt. Denn das Wirkliche ist auch bei Heraklit zweideutig: Es macht das in ihm Waltende offenbar und verbirgt es doch zugleich. Wie steht es mit dieser Zwiespältigkeit der Wirklichkeit?
Heraklit erblickt, ebenso wie Parmenides, die Wirklichkeit als in sich widersprüchlich. Er wird nicht müde, die Gegensätze, die sich in der Welt zeigen, aufzuweisen: »Tag – Nacht, Winter – Sommer, Krieg – Friede, Überfluss – Hunger«, »Sterbliche – Unsterbliche«. Auch im einzelnen Seienden finden sich solche Gegensätzlichkeiten. »Meerwasser ist das reinste und das schmutzigste; für Fische trinkbar und Heil bringend, für Menschen untrinkbar und verderblich.« Vor allem der Fluss wird zum Symbol dieser durchgängigen Gegensätzlichkeit. »Denen, die in denselben Fluss steigen, strömt immer anderes Wasser zu«; »in dieselben Flüsse steigen wir und steigen wir nicht; wir sind und wir sind nicht«. So ist auch der Mensch zwiespältig und in sich widersprüchlich. Und nun spricht Heraklit diese innere Gegensätzlichkeit in allem Wirklichen im Leitwort des Krieges aus. »Der Krieg ist der Vater von allem, der König von allem; die einen zeigt er als Götter, die anderen als Menschen; die einen macht er zu Sklaven, die anderen zu Freien.« Kurz: Die Welt ist eine zerrissene Welt.
Parmenides – man erinnert sich – wird durch eine verwandte Sicht auf die Wirklichkeit dazu gebracht, die Welt als bloßen Schein überhaupt zu verwerfen. Im Unterschied dazu hält Heraklit daran fest: Die Welt in ihrer ganzen Gegensätzlichkeit und Widersprüchlichkeit darf nicht einfach übersprungen werden; sie ist die Wirklichkeit, in der der Mensch lebt. Dennoch kann der Philosophierende diesen Aspekt nur als vorläufig ansehen. Es gilt, die Gegensätzlichkeit tiefer zu deuten: auf das hin, was letztlich in ihr waltet.
Der Weg, den Heraklit in dieser Richtung einschlägt, führt dahin, dass offenkundig wird: Die Gegensätzlichkeit ist nicht das Letzte; vielmehr sind die Glieder der Gegensätze je aufeinander bezogen. So stehen Leben und Tod in inniger Berührung miteinander. Vom Menschen heißt es: »Lebend rührt er an den Toten, wachend rührt er an den Schlafenden.« In diesem Sinne berichtet ein antiker Gewährsmann, Heraklit habe gelehrt, alle Dinge seien »durch ihr gegensätzliches Verhalten miteinander zusammengefügt«. Dazu kommt die Beobachtung, dass die Gegensätze immer wieder ineinander umschlagen. »Das Kalte erwärmt sich, Warmes kühlt sich ab; Feuchtes trocknet sich, Dürres feuchtet sich.« Und nun, in tiefsinniger Formulierung: »Unsterbliche sind sterblich, Sterbliche unsterblich; sie leben einander ihren Tod und sterben einander ihr Leben.« So ist denn die ganze Welt ein einziger Kreislauf von Verwandlungen. »Für Seelen ist es Tod, Wasser zu werden, für Wasser aber Tod, Erde zu werden; aus Erde aber wird Wasser, aus Wasser Seele.« Schließlich findet Heraklit das zentrale Symbol für diese ständigen Verwandlungen: Die ganze Welt ist ein Feuer, das aufglimmt und verlöscht, wieder aufglimmt und wieder verlöscht, in ewigem Kreislauf.
Doch das ist noch nicht das letzte Wort Heraklits. Er entdeckt vielmehr, dass im Bezogensein der Gegensätze aufeinander eine tiefere, diese haltende Einheit sichtbar wird. Er ist also nicht, wie die Tradition will, einfachhin der Philosoph des Werdens gegenüber Parmenides als dem Philosophen des Seins. Auch er dringt hinter die Ebene des Werdens zurück in die des Seins. Darum sagt er im Blick auf die Zerrissenheit der Wirklichkeit: »Unsichtbare Harmonie ist stärker als sichtbare«, oder: »Das Auseinanderstrebende vereinigt sich, und aus dem Verschiedenen entsteht die schönste Harmonie.« Schließlich wird der Gedanke in der kurzen Formel zusammengefasst: »Alles ist eins.« Damit rückt Heraklit in eine erstaunliche Nähe zu Parmenides. Und doch bleibt der Unterschied bestehen. Denn auch wenn Heraklit auf die Einheit blickt, lässt er die Vielheit nicht, wie sein großer Zeitgenosse, im wesenlosen Scheine hinter sich. Das Werden wird vielmehr in das Sein mit aufgenommen: »Aus allem wird eins und aus einem alles.« So kann Heraklit schließlich von dem Einen, das in allen Verwandlungen sichtbar wird, sagen: »Sich wandelnd ruht es.« Es ist lebendig sich entfaltende und sich wieder in sich selber zurücknehmende Einheit. Als solche ist es die tiefere Wirklichkeit in der zerklüfteten Welt.
Blickt man von da aus noch einmal auf die Überschrift dieses Kapitels zurück, dann sieht man: Parmenides und Heraklit sind in der Tat geistige Zwillinge; denn es geht ihnen beiden zuletzt um das wahre Sein, das eine und ganze. Und doch bleibt ein Rest von Gegensätzlichkeit. Nicht als ob sie einander feindselig gegenüberstünden. Aber der eine, Parmenides, nimmt um des reinen Seins willen den völligen Weltverlust in Kauf, der andere, Heraklit, rettet die widerspruchsvolle Wirklichkeit in das lebendig verstandene Eine. Damit bilden diese beiden frühen Philosophen zwei Grundmöglichkeiten des metaphysischen Philosophierens aus, die dann in der ganzen späteren Geschichte der Philosophie in unendlichen Variationen wiederkehren: das versunkene und entsunkene Blicken auf das Absolute und den Versuch, von diesem her die rätselhafte Wirklichkeit zu deuten.
SokratesoderDas Ärgernis des Fragens
Wer es unternimmt, über die philosophische Hintertreppe zu Sokrates hinaufzusteigen, dem kann es geschehen, dass ihm nicht dieser, sondern dessen Weib Xanthippe die Tür öffnet. Das ist sogar sehr wahrscheinlich; denn Sokrates ist viel unterwegs. Es hat aber auch von der Sache her gesehen seinen Sinn. Denn wenn Sokrates unter den Philosophen berühmt ist, so nicht minder Xanthippe unter den Philosophenfrauen. Nun mag man sagen: Berühmt ist sie wegen ihres berühmten Gatten. Sicherlich. Aber vielleicht ist es doch auch ein wenig umgekehrt; vielleicht wäre auch Sokrates nicht Sokrates geworden, wenn er nicht Xanthippe gehabt hätte. So wenigstens sieht es Nietzsche, der Philosoph mit dem psychologischen Spürsinn: »Sokrates fand eine Frau, wie er sie brauchte … Tatsächlich trieb ihn Xanthippe in seinen eigentümlichen Beruf immer mehr hinein.«
Ist das aber richtig? Wenn man den antiken Berichten glauben darf, tut Xanthippe doch genau das Gegenteil: Sie bietet alles auf, um ihren Gatten gerade nicht zu seinem philosophischen Handwerk kommen zu lassen. Zu Hause macht sie ihm die Hölle heiß, und wenn er dann genug hat und sich mit seinen Freunden zu philosophischem Gespräch treffen will, ist sie es auch nicht zufrieden. Gelegentlich schüttet sie ihm aus dem Fenster einen Eimer mit schmutzigem Wasser über den Kopf, oder sie läuft ihm gar nach und reißt ihm auf öffentlichem Markt den Mantel vom Leibe.
Die Freunde empören sich darüber und nennen Xanthippe das unerträglichste Weib, das je gelebt habe und je leben werde. Sokrates aber nimmt dergleichen häusliche und außerhäusliche Gewitter mit philosophischem Gleichmut hin. Als ihn der Wasserguss von oben trifft, äußert er nur: »Sagte ich nicht, dass Xanthippe, wenn sie donnert, auch Regen spendet?« Und als der geniale Jüngling Alkibiades einmal meint: »Die keifende Xanthippe ist unausstehlich«, antwortet Sokrates: »Auch du lässt dir doch das Geschrei der Gänse gefallen.« Im Übrigen meint er, der Umgang mit einem widerspenstigen Weibe habe auch sein Gutes; denn wer mit Xanthippe fertig geworden sei, werde leichthin auch mit den andern Menschen zurechtkommen.
Spätere Biografen haben mit Sokrates mehr Mitleid, als er sich selbst gegenüber aufbringt. Um ihm doch auch ein wenig Liebesglück zukommen zu lassen, erfinden sie eine hübsche Geschichte. Die Athener hätten nämlich, als die Einwohnerzahl ihrer Stadt nach einem verlorenen Kriege allzu sehr reduziert war, beschlossen, jeder Bürger dürfe von zwei Frauen Kinder haben. So habe auch Sokrates, den Gesetzen gehorsam, sich ein zweites Mal vermählt, und zwar mit einem Mädchen, das den schönen Namen Myrto trug. Aber die Geschichte ist recht unwahrscheinlich, und Sokrates hätte vermutlich auch über diese seine zweite Ehe gesagt, was er einem, der ihn fragte, ob er heiraten solle oder nicht, zur Antwort gibt: »Was du auch tust, du wirst es bereuen.«
Um noch einmal auf Xanthippe zurückzukommen: Was erreicht sie schließlich mit all ihrem Schelten? Nichts anderes, als dass Sokrates umso williger das unfriedliche Heim verlässt und umso eiliger zu seinen philosophischen Gesprächen entweicht. Damit aber wird Sokrates erst zu Sokrates. Denn er ist ein Athener, und in dieser Stadt Athen mit ihrer Lust am öffentlichen Leben gilt nur, wer selber in die Öffentlichkeit tritt. Hätte sich Sokrates in seine Studierstube vergraben, er wäre nie der berühmte Sokrates geworden. So verkehrt sich die Absicht Xanthippes in ihr Gegenteil; in ihrem Tun ist, wenn man es im Geiste Hegels deuten darf, eine gewisse »List der Idee« wirksam. Was diesen Philosophen am Philosophieren hindern will, bringt ihn nur immer tiefer zum Philosophieren. Wenn Xanthippe meint, ihr Donnern und Wassergießen seien Abschreckungsmittel, so täuscht sie sich. Nietzsche hat auch darin recht: »Tatsächlich trieb ihn Xanthippe in seinen eigentümlichen Beruf immer mehr hinein, indem sie ihm Haus und Heim unhäuslich und unheimlich machte.«
Doch was tut Sokrates eigentlich, wenn er außer Hause geht? Dem äußeren Anscheine nach nichts, als dass er Märkte und Sportplätze besucht, um mit den Leuten zu schwatzen. Er ist also ein rechter Müßiggänger. Das eben ist es, was Xanthippe wurmt. Statt sich um das Haus, um die Frau und die Söhne zu kümmern, statt den Beruf des Steinmetzen auszuüben, den er doch vom Vater erlernt hat, kurz, statt einen ordentlichen bürgerlichen Lebenswandel zu führen, zieht Sokrates herum und fängt mit allen möglichen Leuten nichtsnutzige Gespräche an. Mag er auch gelegentlich, wie man berichtet, auf der Straße Geldstücke finden und damit in nicht eben landesüblicher Weise zur Finanzierung des Haushaltes beitragen – das ist schließlich doch nicht das Gleiche, wie wenn einer mit einem ehrlichen Handwerk seine Familie ernährt. Nicht einmal Schuhe kann er sich leisten, weshalb ihn der Komödiendichter Aristophanes barfuß auf der Bühne erscheinen lässt. Solche Genügsamkeit mag noch hingehen, soweit es seine eigene Person betrifft. Aber kann man es einem Weibe zumuten, im Anblick all der vielen in der Stadt verführerisch ausgelegten Waren, für die doch kein Denar da ist, dieselbe Gelassenheit zu bewahren, von der der Ausspruch des Sokrates zeugt: »Wie zahlreich sind doch die Dinge, deren ich nicht bedarf!« Und kann man verlangen, dass Xanthippe sich gar zu der philosophischen Höhe jenes anderen Wortes erhebe: »Wer am wenigsten bedarf, ist den Göttern am nächsten«?
Das eigentlich Aufreizende am Verhalten des Sokrates ist übrigens, dass er von Natur aus ganz und gar nicht der Typ des schlaffen Nichtstuers ist. Er treibt eifrig Gymnastik, und sogar im Tanzen stellt er seinen Mann; freilich übt er es, wie man berichtet, lediglich der Gesundheit wegen aus. Noch ein später Gewährsmann rühmt seine »vortreffliche körperliche Verfassung«. Kurz, Sokrates ist ein Mann, zu echtem männlichen Tun geschaffen. Das beweist er auch in den Feldzügen, die er als einfacher Soldat mitmacht. Man erzählt sich Wunderdinge von seiner Härte im Ertragen von Strapazen. Wenn andere sich wegen der Kälte dick vermummen, geht er mit bloßen Füßen über das Eis. Einmal auch, als alles um ihn her in wilder Flucht sich davonmacht, schreitet er als Einziger neben seinem General gelassen einher, »ruhig umherschauend nach Freund und Feind«.
Freilich, auch als Soldat fällt Sokrates durch Absonderlichkeiten auf. Alkibiades berichtet darüber aus gemeinsamer Kriegskameradschaft: »Über etwas nachdenkend stand er vom Morgen an auf derselben Stelle und bedachte es, und da es ihm nicht voranging, ließ er nicht ab, sondern blieb nachforschend stehen. Es wurde Mittag, und die Leute wurden aufmerksam, wunderten sich und sagten einer zu dem anderen, Sokrates stehe vom Morgen an da und sinne über etwas nach. Schließlich trugen einige Ionier, als es Abend war und nachdem sie gegessen hatten, ihre Schlafdecken hinaus – denn es war damals Sommer –, teils um im Kühlen zu schlafen, teils um ihn zu beobachten, ob er wohl auch die Nacht über stehen bleiben werde. Er aber blieb stehen, bis die Morgenröte kam und die Sonne aufging. Daraufhin entfernte er sich und betete im Weggehen zur Sonne.« So also verhält sich Sokrates im Kriege. Nun aber, in friedlichen Zeiten, ist von Tapferkeit und Männlichkeit offenbar nichts mehr zu merken. Nun ist Sokrates, wenigstens in den Augen Xanthippes, nicht mehr als ein Herumtreiber, ein Schwätzer und ewiger Diskutierer.
Er selber erblickt freilich eben darin die einzige Möglichkeit, sein philosophisches Handwerk auszuüben. Kaum erspäht er jemanden auf der Straße, so geht er auf ihn zu und beginnt, sich mit ihm zu unterhalten. Dabei ist es ihm gleichgültig, ob sein Partner ein Staatsmann ist oder ein Schuster, ein General oder ein Eseltreiber. Er meint offenbar, das, was er zu sagen habe, gehe jeden an. Was er aber zu sagen hat, ist der eindringliche Hinweis darauf, dass es auf das rechte Denken und auf nichts anderes ankomme. Rechtes Denken nun heißt für ihn zunächst und vor allem: dass man verstehe, was man sagt, dass man sich über sich selbst Rechenschaft ablege. Denn Sokrates ist der Überzeugung, es gehöre zum Menschen, über sich selber wirklich Bescheid zu wissen. Wie er die anderen darauf aufmerksam macht, schildert nach einem Bericht Platons höchst lebendig der angesehene Feldherr Nikias: »Du scheinst mir nicht zu wissen, was geschieht, wenn jemand dem Sokrates ganz nahe ist und sich mit ihm auf ein Gespräch einlässt; auch wenn er sich zunächst über irgendetwas anderes unterhält, wird er notgedrungen und unaufhörlich von jenem durch Reden umhergeführt, bis er dahin geraten ist, dass er sich selber Rechenschaft darüber gibt, wie er jetzt lebt und wie er sein bisheriges Leben gelebt hat.« So wie mit Nikias macht es Sokrates mit aller Welt. Er fragt jeden, ob er denn auch wisse, wovon er rede: den einen, der von der Frömmigkeit spricht, einen anderen, der immerzu das Wort »Tapferkeit« im Munde führt, einen Dritten, der meint, er kenne sich im Staatswesen oder in der Kunst der überzeugenden Rede aus. Wenn sich diese Leute einmal auf die Unterhaltung eingelassen haben, sind sie rasch verloren. Denn dann zeigt ihnen Sokrates mit Ironie und mit vielerlei dialektischen Künsten, dass sie im Grunde nichts von dem verstehen, wovon sie so selbstsicher daherreden, und dass sie am wenigsten sich selber begreifen.
Das ist – man kann es verstehen – den Befragten keineswegs immer angenehm. Goethe und Schiller haben mit ihrem Distichon aus den ›Xenien‹ recht, mit dem sie auf den Spruch des Delphischen Orakels über Sokrates anspielen: »Dich erklärte der Pythia Mund für den weisesten Griechen. / Wohl! Der Weiseste mag oft der Beschwerlichste sein.« So wird denn auch berichtet, die Athener hätten den Sokrates häufig verächtlich behandelt und verlacht, ja gelegentlich sogar unsanft angefasst und zerzaust. Wer lässt sich auch gern seine Unwissenheit vor Augen führen und dazu noch auf offenem Markt? Nur ein paar junge Adelige, rechte Müßiggänger auch sie, halten zu ihm und begleiten ihn unermüdlich auf seinen Streifzügen durch die Stadt. Die andern aber, die ehrbaren Bürger, wollen damit nichts zu tun haben. Und die Dichter machen sich zu ihren Wortführern. »Weltverbessernder Schwätzer«, nennen sie den Sokrates, »Erfinder spitzfindiger Rede«, »Nasenrümpfer« und »Flausenmacher«, und sie ergießen über seine »gespreizten, leeren Phrasen«, seine »Tüfteleien«, seine »Quengeleien« ihren Spott.
Was sie aber nicht begreifen und was auch die große Menge der Athener nicht sieht, das ist, dass es diesem »mächtigen Querkopf«, wie ihn Nietzsche nennt, zuletzt nicht um den Streit der Worte geht und nicht darum, im dialektischen Gefecht der Argumente und Gegenargumente recht zu behalten. Was Sokrates sucht, ist die Wahrheit. Von der Frage nach ihr ist er besessen. Zu seinem Freunde Kriton sagt er noch kurz vor seinem Tode: »Ganz und gar nicht haben wir das zu bedenken, was die vielen über uns sagen, sondern das, was der sagt, der sich auf das Gerechte und das Ungerechte versteht: der Eine und die Wahrheit selbst.« Er will um alles in der Welt herausbekommen, wie es in Wahrheit um den Menschen und sein künftiges Schicksal steht. Denn, so meint er, davon, dass man dies wisse, hänge alles ab. Das bekennt er selber in seiner Verteidigungsrede vor dem athenischen Gerichtshof: »Solange ich noch atme und dazu imstande bin, werde ich nicht aufhören zu philosophieren, euch ermahnend und entlarvend, wem immer unter euch ich begegne, und ich werde reden, wie ich es gewohnt bin: ›Bester Mann, der du ein Athener bist, aus der größten und an Weisheit und Macht angesehensten Stadt, du schämst dich nicht, dich um möglichst viel Geld, Ruhm und Ehre zu sorgen, aber um Einsicht, Wahrheit und darum, dass die Seele so gut wie möglich werde, sorgst und kümmerst du dich nicht?‹« Und weiter: »Es ist das größte Gut für den Menschen, jeden Tag von der Tugend zu sprechen und von all dem andern, worüber ihr mich reden hört, wenn ich im Gespräch mich und die andern prüfe; ein Leben ohne Prüfung aber ist für den Menschen nicht lebenswert.«
Das also ist die Leidenschaft des Philosophen Sokrates. Nur die Freunde begreifen etwas davon. So berichtet Xenophon, der schriftstellernde Feldherr: »Er unterhielt sich stets über die menschlichen Dinge und untersuchte, was fromm sei und was gottlos, was schön und was schimpflich, was gerecht und was ungerecht, was Besonnenheit und was Wahnsinn, was Tapferkeit und was Feigheit, was ein Staat und was ein Staatsmann, was Herrschaft über Menschen und was ein Herrscher über Menschen; er fragte auch nach allem anderen, wovon er glaubte, dass diejenigen, die es wissen, recht und gut seien.« Noch eindrucksvoller schildert es Alkibiades: »Wenn jemand den Reden des Sokrates zuhören will, dann dürften sie ihm wohl zuerst ganz lächerlich erscheinen; in solche Substantive und Verben sind sie äußerlich eingehüllt wie in das Fell eines übermütigen Satyrs. Von Lasteseln spricht er und von Schmieden, Schustern und Gerbern, und er scheint immerzu dasselbe durch dasselbe auszudrücken, sodass jeder unerfahrene und unverständige Mensch seine Reden verlachen muss. Wenn aber einer sieht, wie diese Reden sich auftun, und wenn er in sie eindringt, dann wird er zunächst finden, dass sie allein von allen Reden Sinn in sich tragen, sodann, dass sie ganz göttlich sind und mehr als anderes Standbilder der Tugend in sich enthalten und dass sie sich auf das meiste oder vielmehr auf alles erstrecken, was zu betrachten dem ziemt, der schön und gut werden will.«
Was also will Sokrates mit seiner lästigen Fragerei? Nichts anderes, als den Menschen dahin bringen, dass er verstehe, wie er sich verhalten müsse, um in Wahrheit Mensch zu sein. Rechtes Denken soll zum rechten Handeln führen. Das scheint dem Sokrates zu keiner Zeit so notwendig zu sein wie in seiner Gegenwart. Mit Schrecken sieht er die Anzeichen des Verfalls im Leben der Griechen, sieht die Ratlosigkeit, in die sich seine Zeit verstrickt, sieht die Heraufkunft einer tief greifenden Krisis des griechischen Geistes. Dafür öffnet er seinen Schülern und Freunden den Blick. So schreibt denn Platon, noch ganz unter dem Eindruck des Sokrates, in einem seiner Briefe: »Unser Staat wurde nicht mehr gemäß den Sitten und Einrichtungen der Väter verwaltet … Alle jetzigen Staaten insgesamt werden schlecht regiert; denn der Bereich der Gesetze befindet sich in ihnen in einem fast unheilbaren Zustand.«
Eben weil Sokrates das erkennt, liegt ihm so viel daran, dass man wieder ehrlich zu fragen beginne. Denn Fragen heißt: sich nicht von den Illusionen in Schlummer wiegen lassen. Fragen heißt: den Mut haben, auch die Bitternis der Wahrheit zu ertragen. Diese Radikalität des Fragens, diese Einsicht in die Not der Zeit, dieses Wissen um die wahren Erfordernisse des Menschseins, das ist es, was dem Sokrates die leidenschaftliche Zuneigung seiner Schüler verschafft. Es gibt dafür kein ergreifenderes Beispiel als die Rede des jungen Alkibiades, die Platon in seinem ›Symposion‹ wieder gibt. Alkibiades vergleicht den Sokrates mit dem Flöte spielenden Halbgott Marsyas. »Dieser bezauberte die Menschen durch seine Instrumente mit der Kraft seines Mundes … Du aber unterscheidest dich von ihm allein insoweit, als du ohne Instrumente eben dasselbe mit nackten Worten ausrichtest … Wenn einer, sei es ein Weib, ein Mann oder ein Knabe, dich selbst oder einen andern, der von deinen Worten berichtet, hört, auch wenn der Berichtende ganz unbedeutend wäre –, dann sind wir außer uns und hingerissen. Ich wenigstens, ihr Männer, wenn ich nicht völlig betrunken erschiene, würde schwören und euch sagen, was ich selber von seinen Reden erlitten habe und noch jetzt erleide. Denn wenn ich sie höre, klopft mir das Herz noch viel stärker als den korybantischen Tänzern, und Tränen entströmen mir unter seinen Worten. Auch sehr viele andere sehe ich das Gleiche erleiden … Von diesem Marsyas also bin ich oft in einen solchen Zustand versetzt worden, dass es mir schien, es lohne sich nicht zu leben, wenn ich so bliebe, wie ich bin … Denn er zwingt mich einzugestehen, dass mir noch vieles fehlt und dass ich überdies mich selber vernachlässige, indem ich die Sache der Athener betreibe. Mit Gewalt halte ich mir die Ohren zu wie vor den Sirenen und schicke mich an zu fliehen, damit ich nicht bei ihm sitzen bleibe, bis ich alt bin. Bei ihm allein von allen Menschen ist mir widerfahren, was wohl keiner in mir suchen würde: dass ich mich vor irgendjemandem schäme; ich schäme mich aber allein vor ihm. Denn ich bin mir bewusst, dass ich ihm nicht entgegnen kann, man müsse nicht tun, wozu er auffordert … Ich entlaufe ihm also und fliehe ihn, und wenn ich ihn sehe, schäme ich mich dessen, was ich eingestehen muss. Und oftmals würde ich es gerne sehen, wenn er nicht mehr unter den Menschen weilte; wenn das aber geschähe, wäre ich, wie ich wohl weiß, noch viel betrübter. Ich weiß also nicht, wie ich es mit diesem Menschen halten soll.«