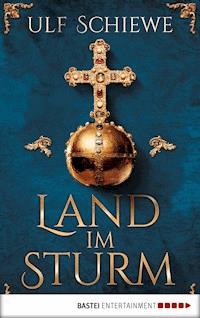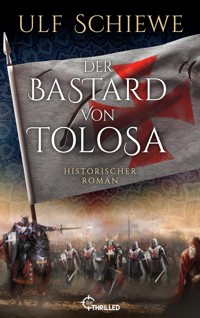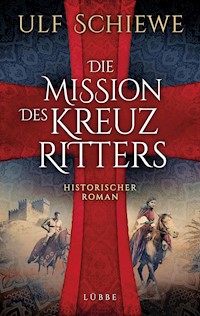9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Normannensaga
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Süditalien 1054: Die Contessa Gaitelgrima, Gemahlin des normannischen Grafen von Apulien, reist in ihr heimatliches Salerno, wo sie ihren neugeborenen Sohn an der Seite ihres Bruders, Prinz Guaimar, taufen lassen will. Der junge Normanne Gilbert erhält von Robert Guiscard den Auftrag, sich um ihre Sicherheit zu kümmern. Reichtum und Opulenz des lombardischen Salernos beeindrucken ihn. Doch hinter der glitzernden Fassade braut sich ein gewaltiger Machtkampf zusammen, der die illustre Prinzenfamilie zu vernichten droht. Im mörderischen Sturm des Aufstands kämpfen Gilbert und seine Gefährten um ihr Leben und riskieren alles, um Gaitelgrima und ihr Kind zu retten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 533
Ähnliche
Ulf Schiewe
Die Rache des Normannen
Roman
Knaur e-books
Über dieses Buch
Inhaltsübersicht
Robert und Alberada
Der Tod kommt in vielerlei Gestalt. Manchmal auch nur als winzige Unachtsamkeit. Und davor hatte ich Angst in dieser elenden Hitze, dem gleißenden Licht der Nachmittagssonne und dem Schweiß, der mir in die Augen lief.
Ich leckte mir die trockenen Lippen, packte mein Schwert fester. Von unseren Stiefeln aufgewirbelt, hing feiner Staub in der Luft.
Vor mir, geduckt und sprungbereit, die bullige Gestalt meines Gegners. Wie ich trug er Kettenpanzer und Helm mit eisernem Nasenschutz. Über den Schildrand hinweg verfolgten seine blassgrünen Augen jede meiner Bewegungen. Ich konnte den erregten Atem des anderen hören, seine Ausdünstungen riechen. Er war immer noch leichtfüßig auf den Beinen mit einer schweren Axt in der rechten Faust.
Ich aber spürte das Ende meiner Kräfte nahen. Unter der Rüstung war ich schweißgebadet, das Herz hämmerte mir in der Brust, jeder Schritt war zur Anstrengung geworden, der linke Arm brannte wie Feuer, und nur mit Mühe gelang es mir überhaupt noch, den Schild hochzuhalten.
Als er plötzlich axtschwingend wieder auf mich losging, duckte ich mich zu spät. Zum Glück verfehlte mich die Waffe, aber so knapp, dass ich den Luftzug auf dem schweißnassen Gesicht spürte. Erschrocken taumelte ich zurück und schnappte keuchend nach Luft. Da war sie gewesen, die Unachtsamkeit, die einen das Leben kosten kann.
Der andere ließ den Schild sinken und lachte gehässig. Dabei funkelten seine Augen triumphierend, und die Zähne blitzten in dem roten, struppigen Bart, der den größten Teil seines Gesichts bedeckte. Wir beide wussten, dass der Kampf nicht mehr lange dauern würde. Aber noch war ich nicht bereit, aufzugeben, stählte erneut meinen Widerstand, machte ein paar Schritte um ihn herum, damit die Sonne mich nicht länger blendete.
Ich wartete auf einen neuen Angriff mit der Axt. Stattdessen sprang er vor und rammte mich unter vollem Körpereinsatz mit dem Schild. Fast hätte es mich von den Füßen gestoßen. Nur mühsam Halt suchend, wankte ich zurück, da fuhr schon die Axt auf mich nieder. Noch einmal gelang es mir im letzten Augenblick, den Schild hochzureißen. Diesmal war die Wucht seiner Waffe so heftig, dass sie für einen Augenblick stecken blieb. Als er an ihr zerrte, riss ich den Schild zurück und brachte ihn dadurch ebenfalls zum Straucheln. Aber ich war zu erschöpft, um den Vorteil zu nutzen. Mein Schwerthieb ging ins Leere, und bevor ich den Kopf zurückziehen konnte, traf mich die Kante seines Schildes mit voller Wucht an der Schläfe.
Trotz Helm wurde mir schwarz vor Augen, und ich ging in die Knie. Ein Tritt seines eisenbewehrten Stiefels beförderte mich endgültig in den Staub. Benommen tastete ich nach dem Schwert, das mir entglitten war. Doch da spürte ich schon die scharfe Axtklinge an der Kehle und zog es vor, reglos liegen zu bleiben.
Rainulf beugte sich über mich und lachte wieder in seinem tiefen Bass. »Eine schwache Vorstellung, Gilbert. Du hast schon besser gekämpft.«
»Merde«, fluchte ich und mühte mich stöhnend hoch.
Er hielt mir grinsend die Hand hin und zog mich auf die Füße. Angewidert warf ich den Schild weg. Das verdammte Ding schien eine Tonne zu wiegen. Die gepanzerten Kampfhandschuhe folgten ihm nach, und ich wischte mir den Schweiß aus dem Gesicht.
»Lach nur, aber irgendwann bezwinge ich dich. Dann bist du es, der im Staub liegt.«
»Bestimmt«, nickte er, selbst außer Atem. »Aber erst wenn ich alt und klapprig bin.«
»Du hättest mich beinahe umgebracht. Ist dir das klar?«
»Wenn ich dich hätte umbringen wollen, lägst du schon längst in deinem Blut, anstatt dummes Zeug zu reden.«
Rainulf war einer von Robert Guiscards Unterführern und ein Kerl wie ein Felsen. In einer Schlacht hatte er ein Stück seines linken Ohrs verloren, und wo kein Bart war, bedeckten Sommersprossen das Gesicht. Über der Nasenwurzel stand eine tiefe Falte. Allein seine Gegenwart schüchterte viele ein. Dabei war er ruhig und besonnen. Ein guter Anführer, der aber keinen Müßiggang unter den Männern duldete. Und ein ausgezeichneter Kämpfer.
»Es ist die verdammte Axt«, sagte ich. »Bin nicht gewohnt, gegen einen Axtkämpfer anzutreten.«
»Dummes Zeug«, knurrte Ragnar barsch, der zu uns getreten war. »Du bist einfach weich geworden, Gilbert, das ist alles. Ich kann mich kaum erinnern, wann ich dich das letzte Mal auf einem Übungsplatz gesehen habe. Wenn du so weitermachst, kann dich bald jede Jungfrau aufs Kreuz legen.«
»Was nicht das Schlechteste wäre«, lachte der kleine Hamo, der Witzbold unserer Truppe.
»Es war die Axt, sag ich euch.«
Wütend hob ich Schild, Schwert und Handschuhe vom Boden auf. Dabei schmerzte die Schulter, wo er mich hart getroffen hatte. Dank des Panzers würde es jedoch nur einen blauen Fleck geben. Ich biss die Zähne zusammen und stapfte zum Rand des Kampfplatzes, wo ich mich neben Thore auf einer Bank niederließ. Rainulf, Thore, Hamo und Ragnar gehörten zu unserer alten Truppe, die vor einigen Jahren unter Robert Guiscards Führung vor den Schergen des Herzogs Williame aus der Heimat geflüchtet war. Ragnar war ein großartiger Reiter und Schwertkämpfer und Thore ein Meister mit dem Bogen.
»Mach dir nichts draus«, meinte Thore versöhnlich und reichte mir seine Feldflasche. »Aber es stimmt schon. Seit Civitate hast du dich gehenlassen.«
Die große Schlacht von Civitate lag nun schon fast ein Jahr zurück. Zuvor war es zu einem Bündnis zwischen Papst und Byzantinern gekommen, um uns Normannen endlich aus dem Land zu jagen. Fast alle lombardischen Fürsten hatten sich ihnen angeschlossen. Sogar der Kaiser hatte Truppen geschickt. Wir fürchteten schon das Ende für uns Normannen gekommen. Aber dann war es unter großen Verlusten gelungen, das übermächtige Heer zu schlagen, dem Heiligen Vater unsere Bedingungen aufzuzwingen und unser junges normannisches Fürstentum als eigenständige Macht im Mezzogiorno zu bestätigen. Nun würde uns niemand mehr vertreiben.
Alle in Roberts Gefolge, die die Schlacht überlebt hatten, waren bei der Verteilung der Beute gut bedacht worden, denn Robert war großzügig zu seinen Männern. Auch ich besaß nun mehr Silber, als ich bei meinem unsteten Lebenswandel benötigte.
Und doch war es mir in letzter Zeit nicht gut gegangen. Oft niedergeschlagen und ohne Antrieb hatte ich das Jahr verbracht, mich durch alle Huren der Stadt gevögelt und mehr Zeit in den Schenken von Melfi vertrödelt, als gut für mich war. Meine Freunde hatten recht. Ich hatte mich gehenlassen – auch wenn ich es ungern zugab. Dabei hatte der Schmerz in meiner Seele weder mit den Gräueln der Schlacht noch mit den Männern zu tun, die ich getötet hatte. Nein, es war Gerlaine, die ich nicht vergessen konnte. Ich konnte es nicht verwinden, dass sie mich verlassen und einen anderen vorgezogen hatte.
Ich seufzte. Thore warf mir einen forschenden Blick zu, als ahnte er, was in mir vorging. Doch er sagte nichts, um nicht weiter an die Wunde zu rühren.
Ich nahm Helm und Kettenhaube ab und stürzte mir das lauwarme Wasser der Feldflasche in die Kehle. Ragnar war für seine scharfe Zunge bekannt. Seine Bemerkung schmerzte. Noch mehr, dass Rainulf mich auf dem Kampfplatz wie einen verdammten Knaben vor sich hergetrieben hatte. Ich schwor mir, die Dinge würden sich ändern und dass ich es ihnen schon zeigen würde.
»Ab morgen siehst du mich hier jeden Tag«, sagte ich. »Gleich in der Früh können wir mit dem Bogenschießen anfangen. Das wird meine Brustmuskeln und den Schwertarm stärken.«
Thore machte ein zufriedenes Gesicht. »Ich hab da ein schönes Beutestück«, sagte er. »Ein Sarazenenbogen. Den schenk ich dir.«
Ich nickte stumm und goss mir den Rest des Wassers übers Gesicht. Es war heiß für Anfang Mai, die Sonne stach unangenehm auf uns herab. Der Übungsplatz befand sich auf freiem Feld außerhalb der Stadtbefestigung und war nur von einer mannshohen Mauer umsäumt. Weit und breit kein Baum, der uns hätte Schatten spenden können.
Melfi liegt auf einem sanft ansteigenden Hügel, dessen Nordseite in einer scharfen Klippe endet, auf der die normannische Trutzburg thront. Vor uns, nach Süden zu, hatten wir einen guten Ausblick auf die umliegenden Berge, aus denen, alles beherrschend, der dunkel bewaldete, massige Kegel des Monte Vulture ragt. Eine gute Gegend zum Jagen für den, der sich nicht scheut, die steilen Hänge dieses schlafenden Vulkans zu erklimmen.
Thore war nur ein paar Jahre älter als ich, ein gutaussehender, unbekümmerter Bursche, meist gut gelaunt und immer mit einem wachen Auge für die Weiblichkeit. Es war mir ein Rätsel, wie er sie rumkriegte, denn wo immer wir uns auf unseren Märschen aufhielten, dauerte es nicht lange, bis der Kerl eine neue Eroberung gemacht hatte, auch wenn es nicht immer die Allerschönsten waren. Zurzeit war es eine Gerberwitwe, der er die einsamen Nächte versüßte.
Thore hielt sehr er auf sein Äußeres, besonders auf das strohblonde Haar, das ihm bis auf den Rücken fiel, und seinen Bart, in dem winzige Silberringe eingeflochten waren. Auch an den Händen trug er Ringe. Beutestücke, von denen er sich nicht trennen wollte. Aber trotz aller Leichtigkeit war er eine treue Seele und in den letzten Jahren mein bester Freund geworden.
»Alberada ist gestern aus Kalabrien angekommen«, sagte er und meinte Roberts Eheweib, die als schönste Frau des ganzen Südens galt. »Mit ihrem kleinen Sohn. Er muss jetzt fast ein Jahr alt sein.«
Ich sah ihn erstaunt an. In der Tat hatte es am Nachmittag irgendeine Aufregung in der Stadt gegeben, aber was genau, hatte ich nicht mitbekommen. Natürlich wohnte ich in Roberts Haus, doch wie so oft war ich seit vorgestern in einer der übleren Kaschemmen der Stadt bei Wein und Würfelspiel versackt. Seine Worte ließen mein Herz heftiger schlagen, denn wo Alberada weilte, war für gewöhnlich auch Gerlaine nicht weit.
Thore hatte meinen hoffnungsvollen Blick bemerkt und schüttelte den Kopf. »Nein, Gerlaine ist nicht in ihrem Gefolge. Sie ist in Argentano geblieben, wie es heißt.« Er packte mich an der Schulter. »Hör endlich auf, dich zu quälen. Sie hat jetzt einen anderen. Schlag sie dir aus dem Kopf. Es gibt auch noch andere Weiber.«
Ich nickte und versuchte ein Lächeln. Es war kein Geheimnis, dass sie Tancred geehelicht hatte, Roberts Kastellan in Argentano.
»Guiscard erwartet uns heute Abend in der Halle«, sagte Thore. »Er will seinen erstgeborenen Sohn vorstellen. Sieh zu, dass du da bist.«
Meine Stute Alba ließ den Kopf hängen. Auch sie litt unter der Hitze. Ich löste die Zügel vom Eisenring in der Mauer und strich ihr sanft über die Blesse auf der Stirn, nach der sie benannt war. Sie hob den schön geformten Pferdeschädel und blies mir ins Gesicht.
Wenn man einen verdammten Gaul lieben kann, so kam Alba dem ziemlich nahe. Wir hatten schon so viel zusammen durchgemacht, dass mir das Viech ans Herz gewachsen war. Ich führte sie ein paar Schritte weiter an eine Pferdetränke und ließ sie ihren Durst stillen. Daneben steckte auch ich den Kopf ins Wasser, um mich abzukühlen. Dann machten wir uns auf den Weg. Aber zu Fuß, denn die übliche Mittagsruhe war längst vorbei, und in den Gassen würde es jetzt geschäftig zugehen.
Die Wachen am Tor grüßten mich mit Respekt, ja sogar einer gewissen Ehrerbietung. Ganz anders, als wir vor Jahren angekommen waren. Da hatten sie in mir nur den dummen, siebzehnjährigen Pferdeknecht gesehen, der keinen zweiten Blick verdiente. Und mit Recht, denn ich war nicht edlen Blutes, hatte nicht einmal Eltern, an die ich mich erinnern konnte, und war bei den Hautevilles als Schweinehirt aufgewachsen. Davon zeugte noch heute eine Narbe auf der Wange, wo eine wütende Sau mich gebissen hatte. Als Gilbert le porchon war ich im Dorf bekannt gewesen, obwohl ich eigentlich Brynjarr hieß. Aber das hatte keiner aussprechen können.
Und Schweinehirt wäre ich geblieben, wenn Robert mich nicht aus einer Laune heraus mitgenommen und zu seinem Knappen gemacht hätte. Zwar war ich zusammen mit seinen jüngeren Brüdern unter der Fürsorge ihrer Mutter aufgewachsen, musste ihm aber dankbar sein, wie ein Familienmitglied behandelt zu werden. In Melfi war ich inzwischen gut bekannt. Oder sollte ich sagen berüchtigt? Denn die meisten wussten, was ich während der Schlacht von Civitate in Roberts Auftrag getan hatte.
In den Gassen der Stadt bot sich mir das übliche Bild. Zwischen den Häusern und hoch über den Köpfen der Leute flatterte die Wäsche in der Brise wie die Wimpel und Banner eines Heeres. Darunter das rege Treiben der Melfitanos an einem geschäftigen Nachmittag.
Da waren Bauern, die Gemüse, Geflügel, Ferkel oder ein paar Zicklein zum Markt brachten. Wasserträger, Bettler, Esel und beladene Maultiere, die ihren Kot fallen ließen, wo sie gerade standen. Frauen, die sich mit großen Körben den Weg durch das Menschengewühl bahnten. Und jede Menge Kinder, die zwischen Buden und Verkaufsständen herumtobten, Fangen spielten oder sich Maulschellen abholten, wenn sie es zu bunt trieben.
Es roch nach Abfall, Hinterhoflatrinen und gegrilltem Fleisch. Und dies besonders aus den Weinstuben und Kochbuden, wo Soldaten herumlungerten und unzüchtige Blicke auf alles warfen, was einen Rock anhatte. Man musste achtgeben, dass man nicht über die Stände und Auslagen der Händler und Handwerker stolperte. Es gab Geldwechsler und Hehler für Beutegut, Sattler, Waffenschmiede oder Seifenkocher. Und überall ein unendliches Stimmengewirr. Fränkisch, Lombardisch, manchmal Griechisch oder sogar ein paar Brocken Arabisch. Seit unserem Sieg bei Civitate war Melfi trotz seiner Lage im Landesinneren zu einem Anziehungspunkt für Geschäftemacher aller Art geworden, die Gewinn aus dem Erfolg der Normannen zu schlagen suchten.
Welch ein Gegensatz zu dem verschlafenen Nest, das Melfi noch bis vor zehn Jahren gewesen war, als normannische Söldner unter Führung der Hauteville-Brüder Williame und Drogo es erobert hatten. Denn das dünn besiedelte Bergland zwischen dem von Byzanz beherrschten Apulien und dem lombardischen Salerno wurde von keiner Seite beansprucht. Hierhin konnte sich die immer größer gewordene Schar normannischer Abenteurer und Halsabschneider zurückziehen, die im Laufe der Zeit gekommen waren, um ihr Schwert den Meistbietenden der lombardischen Fürsten zu leihen. Bis hierhin verfolgte man sie selten, wenn sie von ihren Raubzügen heimkehrten. Die im Kampf Gefallenen wurden schnell durch andere blonde Recken ersetzt, die regelmäßig aus der Heimat eintrafen.
Roberts Brüdern war es gelungen, die Anführer dieser Kriegerbanden zu einen und so eine Grafschaft unter der Lehnsherrschaft des Prinzen Guaimar von Salerno zu errichten. Guaimar bezahlte sie gut, um seine ehrgeizigen Ziele durchzusetzen. Und im Gegenzug verlieh seine Schirmherrschaft ihrem Anspruch und Titel eine gewisse Rechtmäßigkeit, die sogar vom Kaiser der Alemannen anerkannt worden war.
Das byzantinische Apulien, das sie beraubten und eines Tages vollständig in ihre Gewalt zu bringen hofften, hatten sie vorauseilend in zwölf Baronien aufgeteilt, in denen jeder der Barone sich mühte, seinen Anspruch durch gewaltsame Landnahme zu erweitern und durch hastig errichtete Burgen zu festigen. Nach Williames frühzeitigem Tod war Drogo zum Grafen gewählt worden, und durch seine Vermählung mit Guaimars Schwester Gaitelgrima war auch der Pakt mit Salerno erneuert und bekräftigt worden.
In Melfi hatte eine wilde Bauwut eingesetzt, um den Bedürfnissen der neuen Herren gerecht zu werden. Die Burg war vergrößert, die Befestigungen der Stadt waren erweitert und in aller Hast neue Häuser und Unterkünfte hochgezogen worden. Melfi war zum Mittelpunkt normannischen Tatendrangs geworden, zur neuen Heimat von armen Schluckern, wie ich einer gewesen war, oder von Abenteurern, die sich mit dem Schwert in der Faust eine Zukunft zu erkämpfen hofften.
Die Melfitanos hatten sich wohl oder übel an ihre neuen Herren gewöhnen müssen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten herrschte inzwischen ein gutes Einvernehmen, denn auch die Einheimischen zogen aus dem Erfolg der Kriegsherren ihren Gewinn, ob Handwerker, Händler oder Schankwirte. Aus dem dörflichen Melfi war eine geschäftige und lebendige Stadt geworden.
Plötzlich unterbrach ein Tumult meine Gedanken. Vor der Bude eines Geldwechslers brüllte jemand und stieß wilde Flüche aus, andere bemühten sich, ihn zu beruhigen. Es folgte ein Schieben und Schubsen, dann flogen Fäuste, der aufgebockte Tisch brach zusammen, Münzen kullerten in alle Richtungen, und der Geldwechsler versuchte aufgeregt, sein Geld zwischen den Beinen der Umstehenden aufzusammeln. Neugierige traten näher und gafften. Es war kein Durchkommen mehr. Alba warf den Kopf hoch und tänzelte gereizt, bis ich ihr beruhigend über den Hals strich.
In dem Gewühl zog mich jemand am Kettenhemd, und als ich mich umdrehte, stand eine hübsche, junge Frau vor mir, die mir sehr wohl bekannt war.
»Geretrudis«, sagte ich ein wenig steif.
»Du hast uns lange nicht besucht, Gilberto«, rief sie, um den Lärm zu übertönen. Sie beobachtete mich mit einem spöttischen Lächeln. Dabei wusste sie doch genau, warum ich mich nicht mehr hatte sehen lassen.
»Stimmt«, erwiderte ich lahm. »Und wie geht es euch?«
»Dem Himmel sei Dank, es geht uns gut.« Der Lärm hatte sich etwas gelegt, so dass wir nicht mehr schreien mussten. »Wir haben in letzter Zeit so viel zu tun, dass wir gar nicht nachkommen. Du erinnerst dich an unseren Hinterhof? Den haben wir überdacht und drei Nachbarsfrauen als Näherinnen angestellt. Wir bekommen jetzt sogar Aufträge von der Burg.«
Sie trat an mich heran und legte mir vertraulich die Hand auf den Arm. »Du solltest uns mal wieder beehren, Gilberto. Hermelinda würde sich freuen.«
Hermelinda. Das war ihre Schwester. Und leider auch der Grund, warum Gerlaine mich verlassen hatte. Weshalb ich den Teufel tun würde, die beiden zu besuchen. Verbranntes Kind scheut das Feuer.
»Ja, vielleicht«, murmelte ich, um nicht unhöflich zu sein.
»Wir würden uns so freuen«, sagte sie und himmelte mich an. »Und wie geht es dir, Gilberto? Ich höre, du stehst hoch in der Gunst des Grafen und seiner Brüder.«
Ich zuckte mit den Schultern. »Ich bin mit ihnen aufgewachsen.« Das stimmte, obwohl sie wesentlich älter gewesen waren und auf einen Knirps wie mich kaum geachtet hatten. Ich überlegte, wie ich Geretrudis loswerden konnte. »Ich muss jetzt weiter. Man wartet auf mich.«
»Natürlich. Du bist ja jetzt ein wichtiger Mann.«
Ich musste lachen. »Wie kommst du darauf?«
»Na, du speist täglich mit den Baronen in der Burg, wie man so hört, warst Leibwächter der Contessa und bist Roberts rechte Hand.«
»Nur sein Schildträger, Geretrudis«, wehrte ich ab. »Ich muss jetzt aber wirklich gehen. Soll ich Thore von dir grüßen?«
Thore hatte eine Weile bei den beiden Näherinnen gewohnt, bis Geretrudis angeblich von ihm schwanger geworden war. Erstaunlicherweise hatte er seine werdende Vaterschaft durchaus ernst genommen. Bis sich herausgestellt hatte, dass an der Sache nichts dran gewesen war. Seitdem mied auch er die Schwestern, so lieb und nett sie waren.
»Nein. Ich glaube nicht.« Bei Thores Namen hatte sich ihr Gesicht verfinstert. Aber nur für einen Augenblick, dann lächelte sie wieder. »Du weißt, wo wir wohnen. Vielleicht kommst du am Sonntag nach der Messe. Wir kochen etwas Schönes für dich.«
Vom Kochen verstanden sie wirklich etwas. Und von anderen Dingen auch, wie ich mich erinnerte. Fast war ich geneigt, meinen guten Vorsatz wieder umzustoßen. Aber nur fast.
»Werd’s mir überlegen«, sagte ich unbestimmt und verabschiedete mich, denn der Tumult hatte sich verlaufen und der Weg war wieder frei. Sie winkte mir noch einmal fröhlich zu und verschwand dann in einer Nebengasse.
Geretrudis und Hermelinda, die beiden hübschen Schwestern. Besonders Hermelinda. Eine süße Versuchung. Aber besser nicht. Das Kapitel war abgeschlossen. Außerdem hatte ich keine Lust, mich an ein Weib zu gewöhnen. Bei dem unsteten Leben eines Soldaten brachte die Liebe nur Ärger und Herzeleid.
Der Weg zu Roberts Haus führte über den Marktplatz, wo die alte Christenkirche gestanden hatte. Sie war zu klein für Melfi geworden. Außerdem war an ihrem Altar Roberts Bruder Drogo im Beisein seiner Frau ermordet worden. Eine hinterhältige, verachtenswerte Tat im Auftrag unserer Feinde und von griechischem Gold bezahlt. Thore und ich waren durch Zufall in der Nähe gewesen und hatten die Mörder erledigt, als sie mit blutigen Schwertern aus der Kirche gekommen waren. Gaitelgrima, vom Blut ihres Gemahls besudelt und halb wahnsinnig vor Angst, hatte sich an meine Brust geworfen. Niemand außer mir durfte sich ihr fortan nähern. Sie hatte Tage gebraucht, um sich zu beruhigen.
Nun war die alte Kirche abgerissen worden und sollte durch eine größere ersetzt werden. Ein Teil der Außenmauern und der wuchtige Kampanile standen schon. Sogar eine neue, bronzene Glocke hatten sie hinaufgehievt. Aber es würde noch ein paar Jahre dauern, bis alles fertig war, weshalb die Christen der Stadt vorab mit dem großen Zelt vorliebnehmen mussten, das man für ihre Messen errichtet hatte.
Der Platz war voller Menschen. Rings um einen Bereich, der mit Seilen gesichert war, standen Wachen. In der Mitte, auf einem erhöhten Holzthron saß Robert, der zwei Männern zuhörte. Natürlich. Heute war Gerichtstag. Und in Onfrois Abwesenheit fiel es Robert zu, die leichteren Angelegenheiten zu richten. Bluttaten oder Vergehen, die mit schweren Geldbußen geahndet wurden, mussten auf Onfroi warten, der nach Drogo Graf von Apulien geworden war.
Die neuen Herren von Melfi hatten rasch gelernt, dass Gerechtigkeit und Ordnung den eigenen Zwecken dienlicher waren als Landraub, Mord und Vergewaltigung. Ein ähnliches Lehnsrecht wie das in der Normandie war eingeführt und erobertes Land an verdienstvolle Männer vergeben worden. Ansonsten achtete man die Rechte lombardischer Grundbesitzer, wenn sie bereit waren, den Baronen Treue zu schwören und Abgaben zu entrichten.
An Gerichtstagen durfte das Volk seine Klagen vorbringen. Streitigkeiten wurden geschlichtet und Übergriffe geahndet. Wenn es an Zeugen fehlte, halfen Gottesurteile. Betrüger wurden öffentlich ausgepeitscht und Viehdiebe gehängt. Es war auch schon vorgekommen, dass ein ehebrecherisches Weib nackt durch die Stadt getrieben wurde. Besonders Drogo hatte mit harter Hand geherrscht, was ihn nicht bei allen beliebt gemacht hatte. Onfroi dagegen ließ gern die Zügel schleifen und schien Wichtigeres zu tun zu haben, als sich um die Nöte von Bauern und Handwerkern zu kümmern. Robert aber nahm die Sache ernst, gab jeder Partei ausgiebig Gelegenheit, ihren Standpunkt vorzutragen, und fällte sorgfältig überlegte Urteile.
Immer mehr Volk drängte auf den Platz, und Alba begann unruhig zu werden. Wir zwängten uns gerade an einer Gruppe von Matronen vorbei, als ich einen alten Freund entdeckte.
»Fulko!«, rief ich erfreut. »Du bist zurück? Wie war Salerno?«
Wir umarmten uns stürmisch. Dann sah ich ihn mir genauer an. »Bei Odin, man erkennt dich kaum wieder. Und was zum Teufel hast du mit deinen Haaren gemacht?«
Das letzte Mal, vor einem Jahr war es gewesen, hatte er noch, wie ich selbst, in einem Kettenpanzer gesteckt, bärtig und mit langen Haaren, ein großes Schwert an der Seite. Ein tapferer Krieger und Anführer war er gewesen. Und mit Pferden umgehen konnte er besser als jeder andere. Nun steckte er in einem Habit, wie die Christenmönche sie trugen, hatte Sandalen an den Füßen, war glatt rasiert und trug das Haar kurz geschnitten. Und das Schlimmste, auf seinem Scheitel war ein Fleck, so blank geschoren wie ein Kinderpopo. Bei meinen Worten fuhr er sich etwas verlegen über die Tonsur.
»Das gehört zu meinem neuen Stand.«
»Du hast dich also tatsächlich zum Christenpriester machen lassen.« Ich schüttelte den Kopf. »So ein Jammer, Mann. Schämst du dich nicht?«
In seinen Augen blitzte es auf. »Warum sollte ich mich schämen? Dass ich beschlossen habe, das Schwert an den Nagel zu hängen und das Wort des Herrn zu verbreiten? Es gibt verdammt noch mal Besseres, als Leute umzubringen.«
»He, ich dachte, ihr Priester dürft nicht fluchen.« Ich lachte ihm ins Gesicht.
Da musste auch er grinsen. »Alte Gewohnheiten sind schwer abzulegen.« Er zeigte auf das Kirchenzelt. »Morgen früh halte ich zum ersten Mal die Messe ab. Ich erwarte dich, du alter Heide.«
»Du weißt doch, dass ich keinen Fuß in eure Kirche setze. Aber Glück wünsche ich dir trotzdem.«
Eigentlich hatte Fressenda mich taufen lassen, als ich zu den Hautevilles gekommen war. Aber nachdem der alte Tancred mir von Sven Langhaar erzählt hatte, jenem Seeräuber aus dem Norden, der angeblich mein Vater gewesen sein soll, war ich zum alten Glauben zurückgekehrt. Nein wirklich, mit diesem jämmerlichen Christengott hatte ich nichts im Sinn. Meine Götter waren die unserer Vorfahren. Thor und Odin, die in Walhall mit den Tapferen um die Wette zechten. Bis ans Ende der Welt.
Fulko hob die Brauen und setzte ein überlegenes Lächeln auf. »Eines Tages werde ich dich taufen, Gilbert. Verlass dich drauf.«
»Eher friert die Hölle zu«, grinste ich zurück. »Bist du wegen der Gerichtsverhandlung hier?«
»Ich soll für den guten Leumund eines Händlers aus Salerno aussagen, der beschuldigt wird, seinen Vertrag nicht erfüllt zu haben.«
Wir sahen eine Weile zu. Robert saß in entspannter Haltung da, das Kinn aufgestützt, und lauschte aufmerksam dem, was der Kläger zu sagen hatte. Sein helles Haar leuchtete im Licht der späten Nachmittagssonne. Er war wie die meisten seiner Brüder außergewöhnlich groß, breitschultrig und von kräftiger Statur, doch auch schlank und wohlgeformt. Sein kantiges Gesicht konnte furchterregend wirken und dann im nächsten Augenblick schalkhaft gute Laune verbreiten. Von seinen Männern verlangte er viel, jedoch selten mehr, als er selbst zu leisten bereit war. Er konnte grausam, hart und unerbittlich sein, wie ich aus eigener Erfahrung wusste. Und war dennoch großzügig gegenüber jenen, die ihm treu zur Seite standen. Robert musste man hassen oder lieben, dazwischen gab es nichts. Und was mich betraf, so hatten die Nornen meinen Lebensfaden fest mit dem seinen verknotet.
Nach einer Weile wurde es mir zu langweilig, die zähe Verhandlung zu verfolgen. »Sehen wir dich heute Abend in der Halle, Fulko? Ein paar Becher wirst du hoffentlich noch leeren dürfen.«
»Natürlich. Ich werde kommen.«
Damit trennten wir uns. Ich fasste Alba am Zügel und bahnte uns den Weg durch die Menge.
Jeder der normannischen Barone besaß ein Haus in Melfi. Manche waren nicht besonders schön, da sie hastig errichtet worden waren. Die meisten aber waren geräumige, mit Ställen und Vorratsschuppen versehene und von hohen Mauern gesicherte, kleine Festungen. Hier hielten sie sich auf, wenn sie nicht in Apulien waren, um ihre eroberten Landstriche durch Burgen zu sichern, byzantinische Städte zu belagern oder von deren Bewohnern Tribute einzufordern.
Roberts Haus hatte früher Drogo gehört. Eine seltsame Fügung des Schicksals, denn als damals unsere kleine Truppe arm und abgerissen in Melfi angekommen war, hatte Drogo seinem Bruder kaum eine Unterkunft, geschweige denn Land geben wollen. Sollte er doch selbst sehen, wie er zu Besitz und Reichtum käme. Nur eine kleine Holzburg weit im Süden, in einer einsamen, fieberverseuchten Gegend von Kalabrien, hatte er ihm zugestanden. Aber wir hatten uns selbständig gemacht, im Benevento und in Apulien in den Wäldern gehaust, Klöster ausgeraubt und Lösegelder erpresst. Keine ehrenvollen Taten, aber besser, als zum Gespött der Barone untätig auf einer halb verfallenen Burg herumzusitzen. Mit Thors Hilfe hatte sich unser Glück in den Jahren gewandelt. Girard di Buonalbergo, Roberts Vetter, war mit zweihundert Mann zu ihm übergetreten, wir hatten Ehre auf dem Schlachtfeld erworben, Gold und Silber erbeutet und sogar Teile von Kalabrien zu Tribut verpflichtet. Niemand wagte mehr, über Robert Guiscard und seine Männer zu spotten.
»Wo bist du gewesen?«, fragte der Wachmann am Tor. »Robert hat nach dir gefragt, und die Herrin ist gestern angekommen. Soll ich dich bei ihr melden?«
Ich schüttelte den Kopf. »Muss gleich wieder weg. Ich seh sie später.«
Damit führte ich Alba in den Stall. Ich versorgte sie lieber selbst, als es einem Knecht zu überlassen. Anschließend zog ich mir im Hof die Rüstung und das schweißgetränkte Hemd vom Leib und wusch mich ausgiebig am Pferdetrog. Eine Magd brachte mir ein Leinentuch zum Abtrocknen und eine saubere Tunika. Als Schildträger des Hausherrn genoss ich gewisse Vorrechte. Dann machte ich mich zur Küche auf, denn ich war hungrig. Kaum hatte mir die Magd etwas Brot, Salz und Olivenöl hingestellt, dazu ein Stück kalten Braten, da tauchte die Baronessa Alberada in der Tür auf.
»Gilbert«, rief sie fröhlich. »Ich hoffe, du willst dich nicht wieder davonstehlen, ohne mich zu begrüßen.«
Ich erhob mich verlegen, denn das hatte ich in der Tat vorgehabt. Die Baronessa erinnerte mich zu sehr an Gerlaine, die ihr seit langem diente. Doch Alberada trat rasch näher, hielt mich begeistert an beiden Armen fest und musterte mich strahlend aus leuchtend blauen Augen. Ich hatte vergessen, wie überirdisch schön sie war. Schlank und hochgewachsen, ein betörendes Gesicht mit hohen Wangenknochen und vollen Lippen, umrahmt von goldblonden Locken, die sie mit einem feinen Goldreif aus der Stirn hielt. Trotz ihres fortgeschrittenen Zustands bewegte sie sich leicht und anmutig. Sie beugte sich vor und küsste mich auf beide Wangen.
»Es freut mich, Euch zu sehen, Herrin«, sagte ich immer noch etwas steif. »Vor allem, dass Euer Leib erneut gesegnet ist.«
Im Umgang mit den Lombarden hatte ich gelernt, mich Hochgestellten gegenüber gewählter auszudrücken als unter den rauen Kerlen, mit denen ich sonst Umgang hatte. Aber bei Alberada verfing es nicht, denn sie fasste mich lächelnd an der Nase und schüttelte sie sanft.
»Keine Förmlichkeiten zwischen uns, Gilbert. Ich erlaube es nicht. Schließlich gehörst du zur Familie.«
Zur Familie? In Wirklichkeit war ich ein Bastard von unbekannten Eltern, den sie in einem normannischen Drecksdorf geraubt hatten, in der verfehlten Hoffnung auf Lösegeld. In letzter Zeit hatte ich des Öfteren solche Anwandlungen gehabt, als ob ich nirgendwo hingehörte. Dabei wusste ich, dass ich ihnen damit unrecht tat. Fressenda hatte mich neben ihren Söhnen aufgezogen. Und über Robert konnte ich mich schon gar nicht beklagen.
Alberada setzte sich, brach ein Stück von meinem Brot ab und schob es sich zwischen die Zähne. »Nun erzähl schon. Was hast du so getrieben?«
Seit mehr als zwei Jahren hatten wir uns nicht gesehen. Sie war Robert nach Kalabrien gefolgt und hatte ihn trotz Drogos Verbot geheiratet. Und nachdem es ihm gelungen war, die Festungsstadt San Marco Argentano zu erobern, hatte sie dort gelebt und ein Kind zur Welt gebracht. Nun war sie wieder hier, und ich freute mich, sie so gesund und strahlend zu sehen.
»Was soll ich schon getrieben haben?«, antwortete ich. »Nichts Besonderes.«
Sie schüttelte den Kopf und lachte. »Du bist mir einer. Nichts Besonderes? Eine Schlacht geschlagen und den Papst besiegt. Und dann hast du auch noch diesen abscheulichen Pandulf bestraft. Ist das etwa nichts? Ich bin Tausend Tode gestorben vor Angst und Sorge. Um dich und um Onfroi und natürlich um meinen Robert.« Ihre Augen waren plötzlich feucht geworden. »Du kannst dir nicht vorstellen, wie es ist, wenn man wochen- oder monatelang nichts hört.«
»Doch. Das kann ich mir durchaus vorstellen«, sagte ich und senkte den Blick.
Sie musste den traurigen Unterton in meiner Stimme bemerkt haben, denn sie fasste meine Hand und drückte sie mitfühlend.
»Ich hätte dir gern Gerlaines Grüße überbracht«, seufzte sie. »Ich weiß nicht, was zwischen euch vorgefallen ist, aber sie weigert sich, auch nur ein Wort über dich zu verlieren.« Es tat weh, das zu hören. Und Alberada sah es mir an, denn sie fügte hinzu: »Es tut mit so leid, Gilbert, schließlich seid ihr mir beide ans Herz gewachsen.«
Man sah ihr an, dass sie es meinte, und dafür war ich ihr dankbar. Es war schließlich nicht zu erwarten, dass eine Baronessa sich die Zeit nahm, mit einem einfachen Soldaten wie mir über seine verflossene Liebe zu reden. Man konnte sich für Robert nur freuen, dass er eine solche Frau gefunden hatte.
»Sie ist hellsichtig«, bekam ich schließlich heraus. »Aber das weißt du ja. Sie hat einmal behauptet, uns in ihren Traumbildern und Gesichten nie vereint gesehen zu haben. Das hat sie bedrückt.«
»Ach, an so was glaube ich nicht.«
Ich schon. Denn ich hatte oft genug erlebt, wie richtig Gerlaine mit ihren Eingebungen gelegen hatte. Jeder weiß doch, dass es Menschen gibt, die diese Fähigkeit besitzen. Und dass solche Menschen früher hoch verehrt wurden, bevor die Christen kamen und das alles für Teufelszeug erklären mussten. Aber ich wollte ihr nicht widersprechen.
»Geht es ihr gut?«, fragte ich stattdessen.
Sie zögerte einen Augenblick. Aber dann sah sie mir in die Augen und nickte. »Ich will nicht lügen. Ja, es geht ihr gut. Und Tancred freut sich über seinen neugeborenen Sohn. Er ist ganz vernarrt in den Kleinen. Ein hübsches Kind. Sie haben große Freude daran.«
Ein Kind hatte sie also auch schon. Das war mir neu. Als Alberada mein versteinertes Gesicht bemerkte, fügte sie rasch hinzu: »Tancred ist ein guter Kerl, Gilbert. Ich hoffe, du siehst es ihm nicht nach, dass er …«
Ich schüttelte den Kopf. »Natürlich nicht.«
Dann schwiegen wir. Ich brauchte eine Weile, um das Gesagte zu verdauen, und Alberada war feinfühlig genug, nicht einfach weiterzuplappern. So recht konnte ich mir meine wilde, abenteuerlustige Gerlaine gar nicht als brave Mutter und Ehefrau vorstellen. Aber für die Tochter eines Dorfschmieds hätte sie es kaum besser treffen können. Denn als Weib eines Kastellans von Argentano war sie eine Dame geworden. Ich erinnerte mich an Tancred. Ja, kein schlechter Kerl. Aber warum ausgerechnet er?
»Liebt er sie?«, fragte ich nach einer Weile.
»Bestimmt. Er behandelt beide gut. Du musst dir um Gerlaine keine Sorgen machen.«
Ich nickte. »Mehr kann man wohl nicht erwarten.«
Das castello von Melfi lag am Ende der Stadt, dort, wo der Hügel in einer steilen Klippe ins Tal abfiel. Die aus rau behauenen Felsbrocken gefügte Ringmauer überragte die angrenzende Stadtbefestigung und bildete ein Viereck mit mächtigen, kantigen Türmen, von denen einer besonders breit und hoch war, der Bergfried, die letzte Verteidigung, sollten Stadt und Burg bei einer Belagerung fallen.
Als ich mich näherte, wirkte das graue Gemäuer in der Abenddämmerung besonders unwirtlich und bedrohlich. Die Schlitze der Schießscharten blickten wie die leblosen Augen eines blinden Riesen ins weite Land. Nur die Schwärme von Schwalben, die im letzten Licht des Tages nach Beute jagten, belebten und milderten den Eindruck.
Die Burg diente nicht nur als Zitadelle, sondern auch als Wohnsitz des gegenwärtigen Grafen von Apulien, Onfroi de Hauteville. Doch in letzter Zeit hielt er sich eher selten in Melfi auf. Denn nach dem Sieg bei Civitate schien die Sicherung des Erreichten einen Kriegszug nach dem anderen zu erfordern. Ich selbst war im vergangenen Jahr unter Roberts Befehl an verschiedenen Streifzügen und Belagerungen beteiligt gewesen. Der Papst war erneut bemüht, ein Bündnis gegen uns Normannen zu schmieden, und auch die Byzantiner ruhten nicht. Selbst in den Gegenden, die wir unterworfen hatten, mussten gelegentlich Aufstände niedergeschlagen werden.
Der einzige verlässliche Freund, den wir im Mezzogiorno hatten, war Prinz Guaimar von Salerno, dessen Schwester Gaitelgrima als Gräfin und Gemahlin Onfrois über die Burg herrschte. Schon zuvor war sie mit einem Hauteville, Onfrois Bruder Drogo, in kinderloser Ehe verheiratet gewesen. Um weiterhin die Blutsbande zwischen Salerno und den Normannen zu festigen, hatte Onfroi die Witwe seines Bruders zum Weib genommen. Und zur allgemeinen Freude hatte sie ihm vor sechs Monaten einen Sohn und Erben geschenkt, dem man den Namen Abelard gegeben hatte. Die Verbindung zwischen Salerno und Melfi war für beide Seiten von großer Bedeutung. Außerdem brachten die Kriegsdienste, die wir dem Prinzen leisteten, Jahr für Jahr reichlich lombardisches Gold in die Truhen des Grafen und seiner Barone.
In der Stadt erwachte jetzt an diesem schönen Abend das nächtliche Treiben. Mit fortschreitender Dunkelheit wurden Lichter in Hütten und Häusern entzündet, in der Hauptgasse und auf dem Marktplatz brannten Fackeln und Laternen. Roberts Gerichtsversammlung war lange zu Ende. Der Händler war zu einer bescheidenen Geldbuße verurteilt worden. Einen armen Teufel dagegen hatte Robert für seine Missetaten in den Stock schließen lassen, wo er die nächsten Tage zur Volksbelustigung verbringen würde. Am Brunnen lungerte eine lärmende Gruppe junger Burschen herum, zweifellos, um ihren nächtlichen Unsinn zu planen. Die Schenken füllten sich mit Zechern, und in den dunkleren Ecken hoben die ersten Huren ihre Röcke.
Den kurzen Weg bis zur Burg ging ich zu Fuß. Mein Ziel war die große Halle, in der die Barone sich zum Mahl trafen, wo Besprechungen abgehalten und Feste gefeiert wurden. Unterwegs traf ich Thore, der sich für den Abend herausgeputzt hatte. Seine Haare waren geölt und gestriegelt, eine nachtblaue Tunika von edlem Tuch hatte er angelegt, die Stiefel waren neu, und auch den silberverzierten Schwertgürtel sah ich zum ersten Mal.
»Welches Weib willst du denn heute verführen?«, fragte ich spöttisch.
Er zuckte gleichmütig mit den Schultern. »Irgendwas muss man ja mit seinem Beuteanteil anfangen. Alles zu versaufen ist mir zu blöd.«
Das war auf unseren Kameraden Rollo gemünzt, ein muskelbepackter Riese, kampfstark und dennoch gutmütig, zumindest im nüchternen Zustand. Leider auch etwas einfältig. Man konnte fast zusehen, wie ihm jedes Mal das Geld aus den Fingern rann. Würfel, Wein und Weiber. In dieser Reihenfolge. Nun, ich war selbst kein Kind von Traurigkeit, aber etwas mehr als die Hälfte meiner Beute hatte ich vergraben. Und zwar an einem schwer zu erreichenden Ort, damit mich niemand bestehlen und ich selbst auch nicht so leicht in Versuchung geraten konnte, es auszugeben.
Die Wachen am Tor ließen uns wortlos passieren. Mich kannten sie als Mitglied der Familie Hauteville. Und Thore, weil er zu meinen Freunden gehörte.
Im Burghof vertrieben sich die Männer die Zeit mit Geplauder. Einige hatten sogar ihre Eheweiber mitgebracht. Nicht so Asclettin d’Aceranza, einer der Barone, ein langer, hagerer Kerl von etwa fünfzig mit einem kalten, hochmütigen Zug um den Mund. Trank sich gerne in einen Zustand, in dem er mit irgendjemandem Streit anfing. Das heißt, wenn er nicht zu beschäftigt war, den Mägden unter die Röcke zu greifen. Der Mann hatte eine scharfe Zunge, und ich mochte ihn nicht.
Bei ihm standen zwei andere Barone. Hugo Tubœuf und Girard di Buonalbergo. Sie waren schon eher nach meinem Geschmack. Hugo war ein Muskelberg und trug diesen Beinamen, weil er fähig war, einen ausgewachsenen Ochsen mit der bloßen Faust bewusstlos zu schlagen. Das wurde jedenfalls von ihm behauptet. Und Girard, obwohl wesentlich älter als Alberada, war dennoch ihr Neffe und Roberts Freund und Gefolgsmann. Mit seinen Männern hatte er ihm geholfen, Argentano zu erobern und weite Teile von Kalabrien zum Tribut zu zwingen. Als er mich sah, löste er sich von den anderen und kam auf uns zu.
»Gilbert, mein Junge. Gut, dich zu sehen.« Er nickte Thore zu und legte mir den Arm um die Schultern. »Hast du Alberada gesehen? Sie hat nach dir gefragt.«
»Habe gerade mit ihr gesprochen.«
Ich mochte Girard und freute mich über seine Freundlichkeit. Schließlich war er nicht irgendwer, sondern einer der zwölf Barone. Er hatte kluge Augen und ein offenes Gesicht, leider von Pockennarben gezeichnet, die er unter einem kurzen Bart zu verbergen suchte. Im Gegensatz zu seiner Tante war er dunkelhaarig.
»Hast du gemerkt? Mein Tantchen ist schon wieder schwanger. Ich glaube, Robert hat vor, so schnell wie möglich einen Klan zu gründen.«
Er lachte ausgelassen und steuerte uns dann auf den Eingang der Halle zu, damit wir uns einen guten Platz sichern konnten. Nicht jeder war hier willkommen, für gewöhnlich nur die Barone und ihre näheren Getreuen. Trotzdem war die Halle selten leer.
»Wenn du dich wunderst, warum ich so anhänglich bin …«, grinste Girard. »Ich bin einfach froh, dass du mich aus Asclettins Klauen gerettet hast. Keine Lust, mir den ganzen Abend sein dummes Geschwätz anzuhören.«
»Was hat er denn?«
»Er mault mal wieder über euch Hautevilles.«
»Was ist es diesmal?«
»Dass ihr zu viel Land besitzt, euch überhaupt alles unter den Nagel reißt. Womit er natürlich nicht unrecht hat.« Er grinste vielsagend. »Angeblich habe man Onfroi viel zu übereilt zum Grafen gewählt, nur weil alle beim Anrücken der Päpstlichen die Hosen voll hatten und einen fähigen Reiterführer brauchten.«
»Na und? Er hat seine Sache doch gut gemacht«, erwiderte ich. »Ohne Onfroi gäbe es uns hier nicht mehr. Dann säße in Melfi jetzt der Papst oder die verdammten Byzantiner.«
Girard nickte. »Natürlich. Aber seit jetzt noch mehr von euren Brüdern aufgetaucht sind, gibt es Gerede. Man stünde inzwischen knietief in Tancreds Brut, murrt Asclettin, und das sei kaum noch zu ertragen.«
Mit Tancred war natürlich Roberts alter Vater daheim in der Normandie gemeint, leider schon verstorben. Zwölf Söhne hatte er gezeugt. Einer kräftiger und draufgängerischer als der andere. Wie Girard gesagt hatte, waren vor kurzem Godefroi, Mauger und Guillerm im Mezzogiorno angekommen. Und Onfroi hatte sie gleich für seine Zwecke eingespannt. Kein Wunder, dass so mancher Baron fürchtete, von den Hautevilles übervorteilt zu werden.
Wir setzten uns zu Rainulf und Fulko. Auch ein gewisser Bertran Le-Chauve saß bei ihnen, noch einer von Roberts Anführern, ein bärbeißiger Veteran vieler Schlachten. Den Spitznamen hatte er dem spärlichen Haarkranz zu verdanken, der seinen breiten Schädel zierte.
Fackeln an den hölzernen Stützpfeilern verbreiteten ein warmes Licht. Dazu trug auch die riesige Feuerstelle in der Mitte des Raumes bei, an der Knechte einen jungen Ochsen rösteten. Der Duft von gebratenem Fleisch erinnerte mich daran, dass ich außer den paar Happen bei Alberada kaum etwas gegessen hatte.
Die Contessa Gaitelgrima hatte in letzter Zeit den Saal deutlich verschönert. Die alten Waffen und Jagdtrophäen an den Wänden waren trotz Onfrois heftigem Einspruch einer Reihe von kostbaren Teppichen gewichen, die sie aus Salerno hatte kommen lassen. Der Boden wurde häufiger als früher ausgefegt, mit frischem Stroh und duftenden Kräutern bestreut. Und an christlichen Feiertagen waren die aufgebockten Tafeln sogar mit weißem Leinen bedeckt, dazu wurden silberne Kerzenhalter aus den Truhen geholt, um dem Raum einen festlichen Glanz zu verleihen.
Wer sich vergaß und achtlos seine abgenagten Knochen auf den Boden warf, erntete von der Hausherrin vernichtende Blicke. Auch wenn es ihr nie gelingen würde, aus diesen ungehobelten Kerlen vornehme Herren zu machen, so ging es doch jetzt wesentlich gesitteter zu. Zumindest musste sie sich nicht mehr schämen, wenn lombardische Würdenträger einen Besuch abstatteten.
Heute war allerdings ein ganz gewöhnlicher Abend. Maria, die oberste Schankmagd der Burg, gab ihren Mädchen Anweisungen und eilte dann selbst mit einem großen Krug von einem zum anderen. Dabei zog sie wie immer hungrige Blicke auf sich, denn sie war mit beeindruckenden Rundungen gesegnet.
»Maria, komm her. Ich hab solche Sehnsucht nach dir«, ließ sich irgendein Witzbold im Hintergrund vernehmen.
»Dann spring in den Brunnen zum Abkühlen«, rief sie unter allgemeinem Gelächter und füllte unsere Becher mit Landwein.
Sie zwinkerte verschmitzt in die Runde und eilte weiter, nicht ohne mir noch verspielt in die Wange zu kneifen. Thore hob erstaunt die Brauen. Ich aber tat, als hätte ich seinen fragenden Blick nicht bemerkt.
Kaum hatte ich den ersten Schluck Wein getrunken, da spürte ich eine harte Hand im Nacken. »Wo hast du dich wieder herumgetrieben?«, hörte ich Roberts tiefe Stimme. »Ich hätte dich heute Nachmittag gebrauchen können.«
»Ich war auf dem Übungsplatz.«
Ein zweifelnder Blick aus stahlgrauen Augen heftete sich auf mich. Robert machte man so schnell nichts vor.
»Ich schwör’s. Rainulf und Thore können es bezeugen.«
»Und wie macht er sich so?«, wollte er von Rainulf wissen.
»Wir arbeiten noch dran«, erwiderte dieser und grinste vielsagend.
»Na gut«, meinte Robert und fuhr mir mit einer rauen Geste durch die Haare. »In zehn Tagen trittst du gegen mich an. Dann will ich sehen, was du kannst.«
Ich stöhnte innerlich auf. Von seinen Männern erwartete er äußerstes Geschick im Umgang mit Pferd und Waffen und die allerbeste körperliche Verfassung. Es war nicht leicht, ihn in diesem Punkt zufriedenzustellen. Ich würde mich in den kommenden Tagen besonders anstrengen müssen.
Inzwischen hatte die edle Gaitelgrima durch eine Hintertür die Halle betreten, gefolgt von zwei Damen ihres Gefolges. Sie waren noch sehr jung, Töchter von Edelleuten, die bei der Fürstin höfische Artigkeiten lernen sollten. Noch so eine lombardische Neuheit, die sie eingeführt hatte.
Die Contessa selbst war wie immer erlesen gekleidet. Diesmal in goldbestickter, dunkler Seide und einem weißen, durchsichtigen Schal lose um ihr Haupt gelegt. Das schöne, schwarze Haar trug sie heute offen bis auf die Schultern und nicht wie üblich unter einem Gebende versteckt. Das machte sie jünger als ihre fünfunddreißig Jahre und nahm ihrem schmalen Gesicht mit der leicht gebogenen Nase etwas von jener Schärfe, die ihr den gehässigen Spitznamen la capra magra eingetragen hatte. Sie eine dürre Ziege zu nennen tat ihr unrecht, wie ich fand, denn unter den hochgeschlossenen Gewändern waren durchaus weibliche Formen zu erkennen. Ihre dunklen Augen und vollen Lippen versprachen zudem mehr Leidenschaft, als die oft ernste Miene vermuten ließ. Ich musste es schließlich wissen, denn ich kannte ihr Geheimnis, die unselige Liebe, die sie für ihren Schwager Robert empfand und vor ihm und der Welt verbergen musste.
Man konnte es ihr nicht einmal verdenken, denn Robert besaß eine Ausstrahlung und ein verwegenes Lächeln, das Männer für ihn einnahm und Frauenherzen höher schlagen ließ. Auch an diesem Abend machte er eine gute Figur, trug ein Gewand aus edlem Stoff, Gürtel und Stiefel von feinstem Leder. Ganz anders als der abgerissene Wegelagerer von einst, der er gewesen war.
Er beeilte sich, der Contessa höflich den Stuhl vorzuziehen. Sie dankte ihm die Aufmerksamkeit mit einem strahlenden Lächeln und ließ sich würdevoll auf ihrem angestammten Sitz an der Stirnseite der u-förmigen Tafel nieder. Guiscard raunte ihr etwas mit einem unbekümmerten Grinsen ins Ohr, das sie zu erfreuen schien, dann nahm auch er seinen Platz am Kopfende ein, ließ jedoch mit Bedacht Onfrois Ehrenplatz zwischen ihnen unbesetzt.
Asclettin schien sich dennoch daran zu stoßen, dass er an der Seite der Contessa das Kopfende beansprucht hatte.
»Es ist noch nicht lange her, Guiscard«, rief er ihm mit unangenehm lauter Stimme zu, »dass Drogo dich aus dieser Halle verbannt hat. Neuerdings aber scheinst du dich als zweiten Mann der Grafschaft zu betrachten. Nicht genug, dass du dir das Richteramt angemaßt hast. Jetzt willst du wohl auch noch den Vorsitz führen, wie mir scheint.«
Bevor Robert sich äußern konnte, sprang Gaitelgrima ihm bei. »Onfroi hat bestimmt, dass Robert ihn in seiner Abwesenheit vertritt. Wenn dir das nicht passt, Asclettin, dann besprich es mit Onfroi, wenn er zurück ist. Bis dahin dulde ich keinen Streit.«
Sie bedachte Asclettin mit einem so kalten Blick, dass er verlegen die Augen senkte. Nicht wenige waren erstaunt, sie in diesem Ton mit einem wie ihm reden zu hören. Vor ein paar Jahren hätte sie es nicht gewagt. Da hatte sie sich noch vor den wilden Männern aus dem Norden gefürchtet. Seitdem aber hatte sie an Haltung gewonnen.
»Nun gut«, murrte Asclettin. »Wie du meinst. Aber es ist schon schlimm, wie Tancreds Brut hier alles an sich reißt.«
»Dann lass mich daran erinnern«, erwiderte Robert geduldig, »dass Onfroi zu dieser Stunde deinem Freund Pierron mit unseren Truppen hilft, seinen Herrschaftsbereich um Trani auszudehnen. Und dein eigener Sohn ist ebenfalls nur mit Onfrois Hilfe Graf von Aversa geworden.«
Gemeint war die andere normannische Grafschaft. Sie lag in der Nähe von Napoli und war ebenfalls mit Guaimar verbündet.
»Das war sein Geburtsrecht«, entrüstete sich Asclettin. »Verlangst du dafür Dankbarkeit von mir?«
Nun mischte sich Hugo Tubœuf ein. Dass er Asclettin nicht ausstehen konnte, war allgemein bekannt.
»Ach, halt’s Maul, Asclettin. Williame, Drogo und jetzt auch Onfroi, denen haben wir alle viel zu verdanken. Und wer etwas anderes sagt, ist ein verdammter Lügner und Dummkopf.«
Bei jedem anderen hätte Asclettin sein Schwert gezogen. Doch mit Hugo stritt man besser nicht.
»Ich will nur sagen …«, hob Asclettin noch einmal an.
»Du hast schon alles gesagt«, grollte Hugo. »Und jetzt ist Schluss damit.« Dann wandte er sich gut gelaunt an Robert. »Du hast uns deinen Sohn versprochen, Guiscard. Nun zeig ihn schon her. Wo hast du den Bengel versteckt?«
»Bei seiner hübschen Mutter. Wo sonst?«, lachte Robert. »Ich warte genauso ungeduldig wie du. Sosehr ich die Tugenden meines Eheweibs schätze, Pünktlichkeit ist nicht immer ihre Stärke.«
Die Männer im Raum grinsten und tranken ihm zu. Man kannte das, oder nicht? Je hübscher die Weiber, desto länger ließen sie einen warten.
Plötzlich erklang eine helle Stimme, mehr belustigt als empört. »So also redest du hinter meinem Rücken.«
Es war Alberada, die in die Halle gerauscht kam, gefolgt von einer Amme, die den Säugling hielt. Alle Hälse drehten sich. Die Männer starrten sie wie eine Erscheinung an, denn sie war eine Frau, die aller Augen auf sich zog, wo immer sie sich zeigte. Der Amme nahm sie das Kind ab und drückte es Robert ohne Umstände in die Arme.
»Du kannst dich gerne selbst um ihn kümmern«, sagte sie mit spöttischem Lächeln. »Dann werden wir sehen, wie pünktlich du bist.«
»Ich gebe mich geschlagen«, lachte Robert und hielt das Kind glücklich grinsend, wenn auch etwas unbeholfen in den Armen. Der blonde Knabe, erst knapp ein Jahr alt, aber ungewöhnlich groß und stämmig für sein Alter, starrte mit staunenden Kinderaugen in die Runde. Besonders die Fackeln hatten es ihm angetan. Dann blickte er zu seinem Vater auf, runzelte die kleine Stirn und zog ihn kräftig am Bart. Allgemeines Gelächter war die Folge und verzückte Ausrufe unter den Frauen.
»Tapferes Kerlchen«, rief Hugo. »In ein paar Jahren wird er zum Schrecken der Byzantiner.«
Es war nur ein dummer Spruch. Aber viele Jahre später sollte ich mich noch gut daran erinnern, denn es war, als hätte Hugo in die Zukunft geschaut. Byzanz würde noch den Tag verfluchen, an dem dieser Knabe das Licht der Welt erblickte. Aber das ist eine ganz andere Geschichte und gehört nicht hierher.
Während aller Augen nur auf Robert und seiner kleinen Familie lagen, merkte ich, wie Gaitelgrima einen Augenblick lang mit unverhohlener Abneigung die jüngere Frau musterte, deren Anmut die Halle erhellte. Es war nicht nur Alberadas Schönheit, auch ihre fröhliche Natur und ihre Herzlichkeit mit allen, die mit ihr in Berührung kamen. Nicht zuletzt musste auch der gut zehnjährige Altersunterschied die Eifersucht der Contessa schmerzlich befeuern. Doch sie beherrschte sich und zwang sich zu einem frostigen Lächeln.
Alberada beugte höflich das Haupt vor der Fürstin, bevor sie sich zu Robert setzte. Sie wusste, dass die Contessa vor ein paar Jahren nichts unversucht gelassen hatte, um ihr Eheglück mit Robert zu vereiteln. Der kurze eisige Blickwechsel zwischen den Frauen bezeugte daher, dass die Abneigung auf Gegenseitigkeit beruhte.
»Ist er nicht ein Prachtbursche?«, rief Robert und hielt den strammen Knaben in die Höhe. »Er hat es seiner Mutter wahrlich nicht leicht gemacht bei der Geburt.«
Bei diesen Worten legte Alberada die Hand auf den schwangeren Leib. »Ich hoffe, das bleibt mir diesmal erspart. Aber bei Kerlen wie euch Hautevilles …« Sie sprach nicht weiter, sondern verdrehte nur schmerzlich grinsend die Augen.
Den Männern gefiel das, aber die Frauen im Raum machten mitfühlende Gesichter, denn sie ahnten, wie schwer eine solche Entbindung gewesen sein musste. Nur Gaitelgrima zog die Mundwinkel herunter. Vermutlich fand sie Alberadas Bemerkung geschmacklos und fehl am Platz, denn eine lombardische Prinzessin redete nicht in aller Öffentlichkeit über ihr leibliches Befinden, schon gar nicht über Schwangerschaft und Entbindung.
Robert aber war in seinem Vaterstolz nicht zu bremsen. Das Kind im linken Arm, hob er mit der anderen Hand den Weinkelch in die Höhe. »Trinken wir auf meinen Bohemund«, rief er in die Runde.
»Aber Robert!«, widersprach Alberada entrüstet. »Sein Taufname ist Mark. Hast du das vergessen?«
Doch Guiscard ließ sich nicht beirren. »Ich weiß, mein Herz. Aber ein so kräftiges Kerlchen kann nur Bohemund heißen. Trinken wir darauf, dass er so stark wird wie sein Namensvetter, der Riese aus unseren alten Sagen.«
Alberada schüttelte den Kopf.
Gaitelgrima aber, die bisher ohne ein Wort dabeigesessen hatte, erhob sich aus ihrer eisigen Starre mit einem Weinkelch in der Hand und lächelte zuckersüß.
»Bohemund. Was für ein schöner Name, Roberto«, sagte sie, nicht ohne einen spöttischen Blick auf Alberada. »Trinken wir darauf, dass aus dem kleinen Bohemund ein fähiger Mann wird, der dem Grafen Onfroi und meinem Sohn tatkräftig zu Seite stehen wird.«
Darauf erhoben sich alle und tranken auf das Wohl des Kindes. Und weil Gaitelgrima sie daran erinnert hatte, wer in Melfi das Sagen hatte und wer der wahre Erbe der Grafschaft sein würde, ließ man die Contessa und ihren kleinen Sohn hochleben. Auch Robert ließ es sich nicht nehmen, lautstark auf ihr Wohl anzustoßen, während seine Gemahlin nur mit vorgetäuschter Begeisterung den Becher hob.
Die Fürstin schien nun für den Rest des Abends in besserer Stimmung zu sein, als habe der kleine Sieg über Alberada sie versöhnt. Und was den Namen Bohemund angeht, er sollte für immer kleben bleiben, ganz gleich, wie oft seine Mutter darauf bestand, den Jungen Mark zu rufen.
Ein grausiges Geschenk
Ich spürte ein Messer am Hals und riss die Augen weit auf. Um mich herum Dunkelheit. Mein Herz hämmerte, Panik schnürte mir die Kehle zu. Der Drang zu fliehen war übermächtig. Aber ich konnte mich nicht von der Stelle rühren, denn ich war gefesselt. Und vor mir das wutverzerrte Gesicht eines bärtigen Kerls, der drauf und dran war, mich umzubringen.
Ich bäumte mich auf, riss an den Fesseln, wollte schreien, brachte jedoch keinen Ton hervor. Die Augen vor mir verengten sich zu Schlitzen. Jetzt würde er mir den Dolch in den Hals rammen. Ich wartete darauf, biss die Zähne zusammen, stählte mich dagegen. Stattdessen wandte er sich ab. Sein pechschwarzer Umhang begann mit der Nacht zu verschmelzen. Er zerrte eine schemenhafte Gestalt hinter sich her, die sich wehrte und erbärmlich schrie. Es war eine Frau, die wild um sich schlug und doch unaufhaltsam mit in die schwarzen Nebel gezogen wurde, bis man sie kaum noch erkennen konnte. Auch ihr Wehklagen wurde schwächer.
Hatte sie nach mir gerufen? Es kam mir so vor, aber sicher war ich mir nicht. Zitternd vor Ohnmacht blieb ich zurück, bis ihre Stimme ganz verklungen war und nur noch tiefschwarze Nacht mich umhüllte.
Noch im Bann dieser Bilder stützte ich mich auf einen Arm, überrascht, dass ich mich frei bewegen konnte. Mit der anderen Hand tastete ich in der Dunkelheit herum und berührte plötzlich etwas verwirrend Weiches neben mir. Was zum Teufel? Doch schließlich dämmerte es mir, was es war und wo ich mich befand.
Ich fuhr mir übers Gesicht, wie um die schrecklichen Eindrücke zu verscheuchen, atmete tief durch und wartete, bis mein Herz etwas gleichmäßiger schlug. Dann ließ ich mich zurück auf den Rücken sinken und legte meine Hand auf Marias Hüfte. Wie gut sie sich anfühlte. Und wie beruhigend. Sie murmelte etwas im Schlaf und drehte sich auf die andere Seite. Kurz darauf ging ihr Atem wieder tief und ruhig.
Das war für lange Zeit das einzige Geräusch. Bis ein paar Katzen in der Nachbarschaft jaulten und weiter entfernt ein Hund bellte. Schließlich war es wieder still.
Ich versuchte, die Einzelheiten des Traums einzufangen und zu ergründen. Heißt es nicht, durch solche Träume wollen die Götter uns etwas mitteilen? Eine Ankündigung oder eine Warnung. Aber dieser Traum war so verrückt und unverständlich, dass ihn der hinterhältige Loki geschickt haben musste, um mich zu narren und zu ängstigen.
Die Bilder waren verzerrt gewesen, dunkel und von Nebelschwaden durchzogen, auch die Gestalt der Frau war kaum zu erkennen gewesen. Im Grunde hatte ich nur das Gesicht des Mannes deutlich gesehen. Ein dichter, schwarzer Bart, dazu drohende Brauen über Augen, die mich voller Mordlust angestarrt hatten. Und als ich sicher war, mein Ende war gekommen, hatte er sich abgewandt. Was hatte das zu bedeuten? Wer mochte der Kerl sein?
Nach einer Weile gab ich es auf und lauschte auf Marias Atem. Manchmal verbrachte ich die Nacht bei ihr. Eher zufällig war es dazu gekommen, wie genau, ist mir entfallen. Vielleicht, weil ich nach Gerlaines Verschwinden ziemlich oft betrunken war und Maria mich aus Mitleid mitgenommen hatte. Vielleicht auch, weil sie sich nach Reynards Tod selbst einsam fühlte und mit einem Kerl neben sich besser schlafen konnte. Und weil sie nicht allzu wählerisch war, mit wem sie ins Bett kroch.
Für manche war sie deshalb nicht mehr als eine Wirtshausschlampe mit einem frechen Mundwerk. Aber sie hatte auch ein gutes Herz. Ich mochte sie. Und sie mich. Doch wir posaunten unser loses Verhältnis nicht hinaus. Keiner wusste davon, da war ich mir sicher. Sie gab mir einfach von Zeit zu Zeit einen unauffälligen Wink, und dann schlich ich mich des Nachts in ihr winziges Häuschen, das sie in Melfi mit ein paar Katzen teilte.
Das Gute daran war, dass es nichts zu bedeuten hatte. Wirklich bedeutet hatte ihr nur Reynard Le-Vieux, mein Freund und angegrauter Kriegsveteran. Auf dem langen Marsch von der Normandie bis hierher ins Mezzogiorno hatte er mich unter seine Fittiche genommen, war wie ein Vater zu mir gewesen und hatte mir diese fremde Welt erklärt, in der er zuvor schon einige Jahre verbracht hatte. Ihm hatte Maria ihr Herz geschenkt. Doch er war im Kampf gefallen. Sein Tod hatte sie schwer getroffen, und manchmal verlor sie ein paar Tränen, wenn sie von ihm sprach. Es war also, dass wir uns gegenseitig trösteten, wenn man so will.
Ich weiß nicht, ob ich sie geweckt hatte, aber mit einem Mal drehte sie sich zu mir um, rückte näher und legte mir den Kopf auf die Schulter. Ich schlang den Arm um sie und genoss die Berührung ihrer Brüste an meiner Seite.
»Bist du wach?«, raunte sie verschlafen.
»Ich hatte einen Albtraum.«
»Wieder von verstümmelten Leibern?«
Nach der Schlacht von Civitate hatte ich eine Weile mit bösen Träumen zu kämpfen gehabt. Obwohl ich nicht im Getümmel selbst gewesen war, so hatte mir doch der entsetzliche Anblick des Schlachtfeldes und der übel zugerichteten Leichen vieler Freunde arg zugesetzt. Auch Reynard hatte ich die toten Augen schließen müssen.
»Nein. Diesmal war es anders.« Ich erzählte ihr von dem Unbekannten, der mich im Traum beinahe ermordet hatte. »Der Kerl war von Kopf bis Fuß in Schwarz, sogar Augen, Bart und Brauen. Seine Augen hättest du sehen sollen. Die glühten richtig.«
»Madonna mia«, rief Maria erschrocken und setzte sich auf. »Das kann nur der Leibhaftige selbst gewesen sein.« Ich spürte im Dunkeln, wie sie sich bekreuzigte.
»Kein Teufel. Es war ein Sarazene.«
»Ein Sarazene?«
»Er trug ein schwarzes Tuch um den Kopf geschlungen, eine Art Turban.«
»Bist du sicher? Vielleicht waren es Hörner. Du musst es verwechselt haben. Denk nach. Hatte er Hörner auf dem Kopf?«
»Es war dunkel, und ich konnte kaum etwas erkennen. Aber ich bin sicher, da waren keine Hörner. Nein, es war ein Maure. Einer, wie sie hier manchmal zum Handeln herkommen.«
Sie verirrten sich nicht oft bis Melfi, aber hin und wieder tauchten ein paar Berberhändler aus Sicilia mit ihren Maultieren auf und boten Rohrzucker an, Gewürze, Silberschmuck für die Damen und wohlriechende Salben. Sie trugen ebenfalls Turbane und lange Baumwollgewänder. Aber nicht schwarz. Und besonders gefährlich sahen sie auch nicht aus.
Ich erzählte Maria von dem Weib, das der Maure verschleppt hatte. »Da waren dunkle Nebel, die aus einem schwarzen Loch stiegen. Es sah aus, als würde er sie ins Reich der Toten entführen.«
»In die Hölle, meinst du.«
»Wie auch immer.«
»Und hast du die Frau erkannt?«
Ich zögerte. »Ich bin mir nicht sicher. Aber sie hat nach mir gerufen, glaube ich. Er nahm sie mit sich fort, und ich war unfähig, irgendetwas zu tun.«
Wir schwiegen einen Augenblick und dachten darüber nach.
»Glaubst, es könnte Gerlaine gewesen sein?«, fragte ich. »Irgendetwas erinnerte mich an sie.«
Maria sagte nichts.
Ich hatte die Frau nur ganz undeutlich sehen können, aber sie hatte dunkle Haare gehabt, da war ich mir sicher. Und ihre Bewegungen, die Stimme, sie waren mir vertraut vorgekommen. Die Erinnerung an meine Hilflosigkeit ließ mich erschauern.
»Irgendwas Wichtiges muss es doch bedeuten. Glaubst du, sie ist in Gefahr?«
Ich redete noch ein Weile über Gerlaine und merkte dabei nicht, dass Maria stumm geworden war, ja, dass sie sogar etwas von mir abrückte.
»Nun sag schon. Wie siehst du das?«
»Wie ich das sehe?«, fragte sie patzig. »Du weckst mich mitten in der Nacht, nur um schon wieder von deiner Gerlaine zu quatschen. In allem siehst du nur Gerlaine. Bleib mir doch gestohlen mit ihr und deinem schwarzen Sarazenen.«
Sie drehte sich abrupt auf die Seite und streckte mir ihr umfangreiches Hinterteil zu.
»Bist du etwa eifersüchtig?«, fragte ich erstaunt. Dass Maria auf Gerlaine eifersüchtig sein könnte, wäre mir im Leben nicht eingefallen. Schließlich waren wir doch kein Liebespaar.