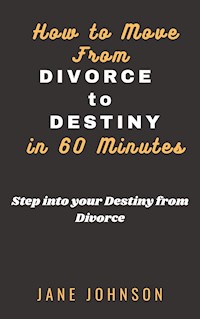10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Akka, Heiliges Land, Ende des 12. Jahrhunderts: Nathanael, der Sohn des jüdischen Medicus, und das arabische Mädchen Zohra verlieben sich ineinander. Doch ihre Liebe wird auf eine harte Probe gestellt. Denn nachdem Saladins Armee Jerusalem eingenommen hat, breitet sich der Krieg bald auch nach Akka aus. Zur selben Zeit flieht der junge John Savage aus einem englischen Kloster. Mit der Armee von Richard Löwenherz zieht er in den dritten Kreuzzug. In Akka trifft er auf das verzweifelte Liebespaar. Gemeinsam versuchen die drei jungen Menschen – ein Christ, eine Muslima, ein Jude – in einer Stadt zu überleben, in der die großen Weltreligionen sich aufs Bitterste bekämpfen ..
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 704
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Buch
Heiliges Land, 1187: Auf dem Basar der Stadt Akka – von den christlichen Besatzern Akkon genannt – begegnet das arabische Mädchen Zorah zum ersten Mal dem Mann, an den sie ihr Herz verlieren wird: Nathanael. Der Sohn des jüdischen Medikus erwidert ihre Gefühle. Doch schon bald wird ihre Liebe auf eine harte Probe gestellt. Denn nachdem Salah ad-Dins Armee Jerusalem eingenommen hat, breitet sich der Krieg bald auch nach Akka aus. Zur selben Zeit flieht in England der junge John Savage aus einem Kloster. Mit der Armee von Richard Löwenherz zieht er in den dritten Kreuzzug. In Akka trifft er auf das verzweifelte Liebespaar. Gemeinsam versuchen die drei jungen Menschen – ein Christ, eine Muslima, ein Jude – in einer Stadt zu überleben, in der die großen Weltreligionen sich aufs Bitterste bekämpfen …
Weitere Informationen zu Jane Johnson
sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin
finden Sie am Ende des Buches.
JANE JOHNSON
Die Säulen
des Lichts
Roman
Aus dem Englischen
von pociao und Roberto de Hollanda
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel
»Pillars of Light« bei Doubleday Canada.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
1. Auflage
Deutsche Erstveröffentlichung Juni 2016
Copyright © der Originalausgabe 2016 by Jane Johnson
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2016
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Published by agreement with the author c/o Baror International, Inc.,
Armonk, New York, USA
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München
Umschlagmotiv: FinePic®, München
Redaktion: Antje Steinhäuser
mb · Herstellung: Str.
Satz: omnisatz GmbH, Berlin
ISBN: 978-3-641-12433-5V001
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für Abdel
Liebende finden geheime Orte
in dieser gewalttätigen Welt,
wo sie sich der Schönheit widmen.
Rumi
Akka, bei den Christen bekannt als Akkon
Syrien
Sommer 1187
So viele Verführungen und nie genügend Geld. Trotz der Ausdünstungen der Tiere und des beißenden Gestanks nach zu vielen schwitzenden Menschen auf dem Markt kitzelten Zohra Najib bereits die ersten Düfte von Sayedi Efraims Parfümstand in der Nase. Während Sorgan ihnen einen Weg durch die Menschenmenge bahnte, schlug ihr Herz schneller. An geschäftigen Markttagen war ihr Bruder ein guter Rammbock, ansonsten eher eine Last.
Als sie in die Nähe des Stands kamen, drückte sie ihm eine Münze in die Hand. »Für Zuckermandeln.« Er wusste, wo die Leckereien verkauft wurden, und würde dort unschlüssig herumlungern und nicht wissen, wofür er sich entscheiden sollte, bis sie ihn abholte. Sie sah, wie er die Hand hob, um die Silbermünze in seiner Hand zu begutachten, und ein breites Grinsen auf seinem Gesicht erschien. Dann schloss er gierig die Hand um die Münze und konnte sie gar nicht schnell genug verlassen. Mehr als einer der Passanten schrie empört auf, als sie rücksichtslos beiseitegeschoben wurden, während Sorgan sich zu dem Stand mit den Süßigkeiten drängelte.
Sie zwängte sich zwischen zwei gebeugten Frauen hindurch. Sie ächzten unter der Last ihrer übervollen Körbe, deren Tragriemen in ihre Stirn schnitten. Zohra wäre um ein Haar gegen zwei große Tempelritter geprallt, die durch die Menschenmenge patrouillierten. Ihr älterer Bruder Malek, Offizier im syrischen Heer, hatte sie vor den christlichen Kriegsmönchen gewarnt. »Sie geloben Keuschheit, halten sich aber nicht immer daran«, hatte er gesagt, und sein hübsches Gesicht war plötzlich streng geworden. »Geh ihnen lieber aus dem Weg.«
Doch die Ritter interessierten sich gar nicht für sie. Ihre wölfischen Augen konzentrierten sich auf die Menschenmenge. Am Parfümstand ließ Zohra ihren Blick begehrlich über die ausgestellte Ware schweifen. Manches Räucherwerk – Weihrauch, weiße Benzoe, Myrrhe – lag jenseits ihrer Möglichkeiten, doch es gab auch andere, weniger kostspielige Optionen. Sie liebte es, ihre Zeit hier zu verbringen, Patchouli-Blätter zu zerreiben, bis sie ihren Duft verströmten, an den Kristallen und Harzen zu schnuppern, aromatische Hölzer und getrocknete Rosenblüten zwischen den Handflächen zu rollen und sich eine Zeit lang in einer Welt aus herrlichen Möglichkeiten zu verlieren, ehe ihr langweiliger Alltag sie erneut einholte.
Der Besitzer Sayedi Efraim war ein kleiner Mann mit einer zerknitterten braunen Robe und einem gehäkelten Käppchen. Er hatte nur ein Auge; die andere Augenhöhle war verkümmert und abgedeckt. Doch dieses eine Auge war wachsam und schlau. Es hieß, es könne das Geld sehen, egal, wie gut es versteckt war. Jetzt musterte es seine Kundin und strahlte vor Freude über das Funkeln der Silbermünze in ihrer Hand. »Lass dir Zeit, mein Vögelchen. Lass dir alle Zeit, die du brauchst.«
Zohra wusste, dass es gut für das Geschäft war, ein hübsches Mädchen am Stand zu haben. Es zog andere Kunden an. Sie erwiderte sein Lächeln. »Zeig mir etwas, das nicht so teuer ist, Sayedi.«
Er breitete die Hände aus. »Wie soll man einem Haus, das wie ein Palast riecht, einen Preis geben oder einem Mädchen, das wie eine Prinzessin duftet? Der Preis ist eine Sache des Verstands, mein Vögelchen.«
Sie warf ihm einen Blick zu, den ihre Mutter als »direkt« bezeichnet hätte. »Der Preis steckt in meiner Tasche, Sayedi. Ich habe nur einen Dinar und muss noch eine Menge mehr kaufen als Parfüm.« Sie öffnete die Hand. Ihre Münze funkelte verführerisch im Sonnenlicht.
In der Mitte des Silberlings war ein Kreuz eingeprägt. Es stammte aus dem Königreich Jerusalem; so nannten die franj ihr bedrängtes Gebiet. Nicht dass es eine Rolle spielte. Zohra wusste, dass der Händler über jede Münze froh war – byzantinische Goldmünzen aus Zypern und Tripolis, silberne Dirhams aus Aleppo, Sindschar und Bagdad, Deniers aus Antiochia und Jerusalem … Akka war schon immer stolz auf seine kosmopolitische Tradition gewesen. Am Ufer des Mittelmeeres gelegen, bildete es einen Knotenpunkt für den Handel. Vom Norden, Osten und Westen, aus Venedig, Marseille, Indien, China, Trapezunt und Sarai kamen Kaufleute hierher, um mit Gold und Gewürzen, Seide und Safran, Fischeiern und Harzen, Glas und Singvögeln zu handeln.
Die Bucht von Haifa bot eine Zuflucht während der berüchtigten Winterstürme, und der tiefe, sichere Ankerplatz gewährte einer ganzen Flotte von Handelsschiffen Schutz. Im Norden lag die befestigte Stadt Tyrus, im Osten die Straße nach Nazareth und Jerusalem und dazwischen fruchtbares Land. Akka war ein strategisches Juwel, daher wechselte die Stadt oft ihren Besitzer, doch egal, wer über sie herrschte, der Handel blühte. Waren wechselten ihre Besitzer, das Geld zirkulierte, und alle waren zufrieden. Nun ja, »zufrieden« ist vielleicht übertrieben, dachte sie, als sie sich vor Augen hielt, wie die Tempelritter mit Schwertern und von riesigen Kreuzen geschmückten Waffenröcken – ein unerträglicher Affront für jeden guten Muselmanen – durch die Straßen marschierten. Wenn man die Ohren spitzte, konnte man auf dem Viehmarkt Schweine quietschen hören, und jeden Tag läuteten die Glocken, die die Christen ins Minarett der Freitagsmoschee gehängt hatten, und huldigten mit ihrem abscheulichen Klang dem Shaitan. Jeden Tag betete sie, dass Salah ad-Din die Stadt zurückerobern und die verfluchten Glocken einschmelzen würde.
Der Händler nahm ein Stück Weihrauch – einen schimmernden Kristallklumpen – und hielt es Zohra unter die Nase. Dem anfänglich kräftigen Duft nach Moschus folgte eine hochgerühmte balsamische Note. Benommen roch sie daran.
»Das ist mein erlesenster Al-Hojari«, erklärte Sayedi Efraim. »Der erste Anschnitt vom Harz der fernen heiligen Bäume von Dhofar, der von den Karawanen durch das Leere Viertel und die Große Sandwüste hierhergebracht wurde. Stell dir bloß einmal vor, welche Gefahren die tapferen Kamelreiter auf sich nehmen mussten, damit ein alter Mann ein junges Mädchen glücklich machen kann. Ist ihr Mut nicht den niedrigen Preis wert, den ich verlange?«
»Lass das Theater, Efraim! Siehst du nicht, dass sie deine Wucherpreise nicht bezahlen will?«
Zohra drehte sich um und sah einen jungen Mann vor sich stehen. Er war hochgewachsen und schlaksig, hatte ein lebendiges Gesicht und dichtes schwarzes Haar, das ungebändigt unter der in die Stirn gezogenen Kappe hervorlugte. Außerdem ein energisches Kinn, geheimnisvolle dunkelbraune Augen und ein spöttisches, schräges Grinsen. »Warte lieber ab, bis eine Kaufmannsfrau mit der prall gefüllten Börse ihres Mannes vorbeikommt. Außerdem ist Weihrauch viel zu schwer für so viel Schönheit. Wie wäre es mit Veilchen oder Kassia?«
Zohra öffnete den Mund, um etwas zu sagen, doch der Mann beugte sich vor und legte ihr den Finger auf die Lippen. Beschämt trat sie einen Schritt zurück.
Der Mann griff nach ihrem Arm. »Du musst nicht gleich weglaufen, mein Täubchen. Hier, das brauchst du, Amber, passend zu deinen Augen.« Er nahm ein Stück Bernsteinharz und rieb es zwischen den Fingern. »Schließ die Augen«, sagte er und wärmte das Harz in den Händen, um seinen Duft freizusetzen. »Atme ganz aus, und wenn ich es dir sage, atme wieder ein.«
Zohra tat wie befohlen, obgleich sie sonst nicht so fügsam war. Als der Mann die Hände öffnete, atmete sie tief ein. Der süße, moschusartige Duft überflutete ihre Sinne. Sie streckte die Hand aus, um nicht das Gleichgewicht zu verlieren, und schlug die Augen wieder auf. Da erst wurde ihr bewusst, dass sie sich am Arm des Mannes festhielt. Wie konnte sie bloß in aller Öffentlichkeit einen fremden Mann berühren? Hastig zog sie die Hand zurück. Doch er lächelte, und es war, als strahlte sein ganzes Ich auf. In diesem Augenblick kam die Sonne hinter einer Wolke hervor und ließ seine blasse Haut wie Weihrauch schimmern. Der Duft des Bernsteinharzes hüllte sie in eine Wolke. Es kam ihr vor, als wären sie die einzigen Menschen auf der Welt.
»Ich nehme vier Stücke«, erklärte der Mann dem Händler und feilschte so lange, bis er für die vier weniger bezahlte, als Zohra für zwei bezahlt hätte. »Pack sie einzeln ein«, sagte er gebieterisch, und als der Verkäufer fertig war, nahm er Zohras Hand in die seine und schloss ihre Finger um zwei der Stücke. Sie blickte auf ihre ineinander verschränkten Hände und spürte unter ihrer Haut, wie das Blut in seinen Adern pochte. Plötzlich hatte sie das Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen.
Dann ließ er sie plötzlich los, und als sie blinzelnd aufblickte, merkte sie, dass er sie nicht länger ansah, sondern den Hals reckte und über die Menschenmenge hinwegstarrte. Sie empfand einen Anflug von Enttäuschung, bis sie das Geschrei hörte. Wütende Stimmen, laut und eindringlich.
O nein, war ihr erster Gedanke, was hat Sorgan jetzt wieder angestellt?
Doch es hatte nichts mit ihrem Bruder zu tun. Sie hörte deutlich: »Hattin«, »Niederlage« und dann »Saladin« – so verunstalteten die franj den Namen ihres Sultans. Ihr Herz krampfte sich zusammen. War das Heer der Muselmanen besiegt worden? Die Vorstellung, dass ihr Bruder Malek von den Schwertern des Feindes zerstückelt worden sein könnte, raubte ihr einen Moment lang den Atem.
»Was rufen sie?«, fragte sie schließlich.
Der Fremde hob ihren Korb auf und nahm ihren Arm. »Wir müssen hier weg. Sofort.«
»Mein Bruder ist noch im Basar.«
»Dein Bruder kann auf sich selbst aufpassen.«
»Nein, das verstehst du nicht!« Sie versuchte, sich von ihm loszureißen. »Ich muss ihn holen, ich muss …«
Doch er ließ sie nicht los. Seine Augen funkelten, aber sie konnte nicht sagen, ob aus Wut, Angst oder irgendeiner anderen Empfindung. Dann zerrte er sie davon.
Als sie um die Ecke bogen, schrie jemand auf. Im nächsten Moment erhob sich ein wütendes Brummen ringsum.
Der Fremde zog sie derart heftig mit, dass sie das Gefühl hatte, ihre Füße berührten kaum noch den Boden. Schließlich kamen sie zum Rand des Markts, wo das Gedränge der Menschen abnahm. Erst dort ließ er sie los. »Ich musste dich so schnell wie möglich da rausholen.«
Zohra fuhr ihn wütend an: »Ich kann selbst auf mich aufpassen!«
»Das ist keine Schlägerei zwischen Händlern. Es hat eine große Schlacht gegeben. Die Christen sind besiegt worden. Der Bischof von Akka ist tot, und Salah ad-Din hat das Heilige Kreuz erbeutet.«
Zohra starrte ihn an. »Unser Sultan hat die franj geschlagen?«
»Bei Hattin, ja, ein großer Sieg. Zwanzigtausend Männer sind gefallen, und ihr König wurde gefangen genommen. Es wird Vergeltungsmaßnahmen geben, es wird Blut fließen. Hier ist es nicht mehr sicher. Wo wohnst du? Ich bringe dich nach Hause.«
»Ohne Sorgan kann ich nicht nach Hause.« Zohra wünschte sich mit aller Macht, dass ihr Bruder endlich aus dem Basar stolperte. Doch es gab keine Spur von ihm.
»Dein Bruder findet auch allein nach Hause.«
»Sorgan ist zwar groß wie ein Riese, aber in Wirklichkeit ist er wie ein kleines Kind.«
Er wurde unsicher. »Tut mir leid. Das wusste ich nicht. Bleib hier, versteck dich, ich hole ihn.« Er schob sie in einen Hauseingang. Zohra beschrieb ihm ihren Bruder und erklärte ihm, dass er Zuckermandeln habe kaufen wollen, dann beobachtete sie, wie sich der dunkle Umhang des Fremden unter dem Dach des Basars in einen Schatten von vielen verwandelte.
Sorgan würde niemals mit einem Fremden mitgehen. Es würde eine Szene geben. Er konnte Stunden an dem Stand mit den Süßigkeiten verbringen und alles mit den Augen verschlingen, bevor er seine enorme Entscheidung traf. Er war stur wie ein Maultier und würde sich nicht von der Stelle rühren. Es wäre besser, wenn sie ihn selbst holen …
Doch jetzt strömte plötzlich eine große Menschenmenge aus dem Markt, Frauen mit Einkäufen und Kindern, junge Männer mit blutverschmierten Kleidern und wilden Augen. Aus der Straße hinter ihr tauchte eine Gruppe von Tempelrittern auf, ihre Schwerter funkelten in der nachmittäglichen Sonne. Zohra drehte sich wieder um und sah, wie Sorgan aus dem Basar kam, zusammen mit dem Fremden, der ihn am Arm festhielt. Ihr großer einfältiger Bruder grinste von einem Ohr zum anderen und hielt ein großes Bündel an die Brust gedrückt.
Ihre Erleichterung verwandelte sich sofort in Verwirrung. »Was hast du getan? Was hast du da?«
Sorgans Blick schoss hin und her. Er antwortete nicht.
»Er wollte nicht mitkommen«, sagte der Fremde, ohne die abziehenden Tempelritter aus den Augen zu lassen. »Also mussten wir den halben Laden leer kaufen, stimmt’s, Sorgan?«
Ihr Bruder lachte auf seine ansteckende, kehlige Art, woraufhin Zohra ihm einen vorwurfsvollen Blick zuwarf. Sorgan steckte die Hand in das Bündel. »Magst du?« Zwischen seinen großen Fingern schimmerte eine einzelne Zuckermandel, die er jetzt nicht etwa seiner Schwester, sondern dem Fremden anbot. Sie hatte noch nie gesehen, dass er etwas mit anderen teilte. Allein das war seltsam, aber noch merkwürdiger war, dass sie in seiner Hand die Silbermünze funkeln sah, die sie ihm gegeben hatte.
Der junge Mann nahm die Mandel feierlich entgegen und steckte sie in den Mund. »Danke, Sorgan. Du bist ein Ehrenmann. Aber jetzt müssen wir dich nach Hause bringen.«
»Du kommst doch mit uns, nicht wahr?«, fragte Sorgan besorgt.
»Natürlich.«
»Wirklich?« Zohra war besorgter darüber, dass er mitkommen könnte, als ihr Bruder, dass er es ablehnte. Was würden die Nachbarn sagen, wenn man sie in Begleitung eines Fremden sah, der obendrein Jude war? Wie würde ihr Vater reagieren? Doch sie gingen so schnell, dass sie nicht die Möglichkeit hatte, das Problem auf höfliche Art anzusprechen. Sie wartete, bis sie oben auf dem Hügel waren, zwei Straßen vom Familienhaus entfernt, dann blieb sie stehen. »Hier können wir allein weitergehen. Vielen Dank«, sagte sie und klang lächerlich formell. Noch schlimmer, sie steckte die Hand in ihre Börse, nahm zwei große Silbermünzen heraus und hielt sie ihm hin. »Für deine Mühe. Und für den Bernsteinharz und die Mandeln. Wir können wirklich keine Geschenke von einem Fremden annehmen.«
Der junge Mann warf ihr einen spöttischen Blick zu. Dann nahm er ihr die Münzen ab und steckte sie wieder in ihre Börse. Unter dem Vorwand einer tiefen Verbeugung, bei der er sein Käppchen verlor, nahm er ihre Hand und drückte seine Lippen auf die Handfläche.
Dann richtete er sich auf und drückte sich das Käppchen wieder auf den Kopf. »Ich heiße Nathanael bin Yakub, jeder kennt mich als Sohn des Arztes. Du findest mein Haus am Ende der Straße der Schneider. Klopf einfach an die Tür mit der Hand. Solltest du es vergessen, schicke ich meine djenoun nach dir.«
Er grinste sie schräg an, ermahnte Sorgan, gut auf seine Schwester aufzupassen, und ging davon, während Zohra ihm nachsah und spürte, wie sein ungezogener Kuss auf ihrer Haut brannte.
TEIL 1
DIE WUNDERMACHER
EINS
Kloster St Michael on the Mount,
Cornwall, England
Sommer 1187
Ich wurde als gottloses Wesen geboren.
Zwei Bettelmönche, die zum Kloster von St Michael on the Mount pilgerten, fanden mich zwischen den alten Steinkreisen im Moor über der Bucht, wo ich mich, von Kopf bis Fuß mit dunklem Fell bedeckt, von Würmern und Beeren ernährte.
Vielleicht hatte meine Mutter mich ausgesetzt, weil sie in mir mehr ein Tier als ein Kind sah. Oder ich hatte das Fell bekommen, als ich den Elementen trotzte. Wie auch immer, sie brachten mich in das Kloster, um mich im Haus Gottes aufzuziehen und einen zivilisierten Menschen aus mir zu machen. Ich wehrte mich mit Händen und Füßen. Später hörte ich, wie sie überlegten, ob sie mich von dem kleinen Boot, das sie vom Festland zur Insel brachte, ins Meer stoßen sollten. Es gab Tage, da wünschte ich mir, sie hätten es getan.
Sie gaben mir ein kratziges Gewand aus Sackleinen und einen Namen. Savage. John Savage. Ich wurde als Novize im Orden aufgenommen, obgleich meine Eltern (falls ich jemals welche hatte) mich nie offiziell aufgegeben hatten und der heilige Benedikt verboten hatte, Kinder vor dem zehnten Lebensjahr in den Orden aufzunehmen. Niemand wusste, wie alt ich war. Sie machten mich zum Diener und benutzten und misshandelten mich, wie es ihnen gerade passte.
Wenn die älteren Jungen mich schikanierten, wehrte ich mich laut fauchend wie das Tier, für das sie mich hielten. Doch sobald ich versuchte wegzulaufen, unternahmen sie alles, um mich wieder einzufangen, ehe ich über den Damm fliehen konnte, der während der Ebbe wie durch Zauberhand aus dem Meer emporstieg, und schleppten mich ins Kloster zurück. Da Novizen in der Hackordnung an unterster Stelle standen, war es ihnen nur recht, jemanden zu haben, an dem sie ihre Frustrationen auslassen konnten.
Wenn ich einen Anfall bekam und zu Boden fiel, glaubten sie, ich sei vom Teufel besessen. Doch bald merkten sie, dass ich am verletzlichsten war und mich nicht wehren konnte, wenn ich mich mit Schaum vor dem Mund auf dem Boden wälzte und Unsinn redete. Dann traten sie erst recht zu. Und wenn ich eine Stunde später wieder zu mir kam, hatte ich keine Erinnerung daran, was geschehen war, bloß überall am Körper blaue Flecken und seltsame Traumbilder im Kopf.
Turmhohe Säulen und aufsteigende Bogen. Der Duft von Rosen. Diese Visionen verfolgten mich schon damals. Und so ist es bis heute geblieben.
An dem Tag, an dem ich den Reliquienbehälter fallen ließ und die Gebeine des heiligen Felec über den Boden der Kapelle rollten, verprügelte mich Bruder Jeremiah so heftig, dass seine Weißdornrute zerbrach.
Soweit ich mich erinnere, war ich damals schon vierzehn Jahre im Kloster. Kein Wunder, dass die Rute aufgrund meiner andauernden Widerspenstigkeit abgenutzt war. Für einen kurzen Augenblick jubelte ich, doch dann hob er die zerbrochenen Teile auf, und mir wurde bewusst, dass er nun zwei Waffen statt einer besaß. Schützend hob ich die Hände vor den Kopf und fiel auf den harten Schieferplatten auf die Knie, wo ich zwischen den zerbrochenen Knochen und Holz kauerte.
Ich sammelte sie ein. »Ich flicke sie wieder zusammen, man wird nicht sehen, dass sie je kaputt waren! Und auf dem Friedhof, von dem sie stammen, gibt es noch viele andere Knochen!« Ich erinnerte mich nur allzu gut an jenen Morgen im Oktober, als der Prior den Sakristan angewiesen hatte, das Gerippe eines unbekannten Mönches auszugraben und dessen Fuß abzuhacken, um die Reliquie des heiligen Felec zu erschaffen – des alten Königs im untergegangenen Lyonesse.
Zu spät erkannte ich, dass es ein Fehler gewesen war, dieses schändliche Geheimnis zu erwähnen, denn jetzt steigerte sich Bruder Jeremiahs Wut ins Unermessliche.
»Du dummer kleiner Teufel!«, grollte er. »Für diese Lüge wirst du in die Hölle kommen!« Der erste Schlag. »Lügner, undankbarer Schuft!« Ein Schlag auf die Schulter. »Du bist ein Wilder, vom Teufel besessen.« Ein Schlag gegen das Schienbein. »Und wenn ich ihn dir nicht mit Gebeten austreiben kann …« Ein Schlag auf den Arm. » … dann muss ich ihn eben aus dir herausprügeln.« Der Speichel schimmerte auf seinem grauen Bart.
Ich kauerte mich zusammen wie eine sterbende Wespe. »Mea culpa, Bruder, mea culpa!«
Er grinste und hob beide Arme, als wollte er auf eine riesige Trommel einschlagen. Ich bereitete mich auf den Schmerz vor, doch er blieb aus. Stattdessen stand plötzlich ein hagerer, dunkelhäutiger Mann an der Tür der Kapelle und kam rasch auf uns zu. Die Röcke des schwarzen Habits flogen um seine Beine, so schnell ging er.
»Halt ein, halt ein! Er ist doch nur ein Kind! Lass von ihm ab!«
Bruder Jeremiah warf ihm ein grausiges Lächeln zu. »Ein Fremder wie du wird unser Tun nicht verstehen, Bruder. Er ist ein gefallenes Wesen. Wir müssen die Sünder in dieser Welt züchtigen, sonst werden sie sich nicht bessern, und dann sind ihre Seelen für immer verdammt.« Als er erneut die Arme hob, zog ich den Kopf ein und wartete auf das Unvermeidliche.
Doch als auch dieser Schlag ausblieb, blickte ich wieder auf und sah, dass der dunkelhäutige Mann Jeremiah am Arm gepackt hatte und ihn gegen die Wand drückte. Der Mönch wehrte sich heftig und zeterte: Gottloser, Schwarzer, Schurke, Dummkopf. Doch für einen so schmalen Mann war der Fremde außerordentlich kräftig. Er bändigte Bruder Jeremiah, bis er seine Stöcke fallen ließ. Dann rief er mir über die Schulter zu: »Steh auf, John, und geh hinaus.«
Doch ich kniete da, als wäre ich gelähmt. Ich hatte gesehen, wie Bruder Jeremiah einen Diener stranguliert und einem anderen den Schädel eingeschlagen hatte. Er mochte alt sein, aber er war unerbittlich wie der Tod. Sogar der Prior fürchtete ihn. Wer war dieser Fremde, der meinen Namen kannte und daher auch lange genug hier gewesen sein musste, um zu wissen, wie grausam Bruder Jeremiah war? Ich riskierte einen Blick auf sein Gesicht. Feine, scharf geschnittene Züge, wie in der Abbildung eines Heiligen. Nur war seine Haut dunkel wie Leder. Plötzlich fiel mir etwas ein. Vor einigen Wochen, während der Winterstürme, hatte es einen Schiffbruch an den Felsen von Tater Du gegeben, an der Westküste, Richtung Land’s End. In einer wilden Nacht hatten Matrosen drei Männer in die Krankenstation des Klosters gebracht, alle leblos wie nasser Seetang. Die beiden größeren Männer waren gestorben. War das der dritte? Der Einzige, der überlebt hatte?
Ich rappelte mich auf und trat hinaus. Es wurde Abend. Himmel und Meer hatten dieselbe dunkelgraue Färbung, der Horizont verschmolz mit den Wolken. Das ferne Festland war der dunkle Buckel eines Wals im Halbdunkel, die winzigen Lichter der Feuer und Kerzen im Dorf flackerten über das Wasser. Wie oft hatte ich sie beobachtet und mir gewünscht, in einem der kleinen Häuser zu sein, weit weg von den Mönchen und den Novizen? Unzählige Male. Doch von diesem Ort gab es kein Entkommen, außer im Tod.
Um mich herum wurde es immer dunkler. Kleine aufrechte Steine markierten den Weg zwischen den Welten früherer Bewohner. Der Friedhof des Klosters, ein Grab wie das andere, kein Unterschied im Rang oder Status, so wie der heilige Benedikt es im zweiten Absatz seiner Regeln verfügt hatte. Ich hatte mir immer vorgestellt, dass ich ihnen eines Tages folgen würde, eher früher als später.
Jetzt zitterte ich in der aufkommenden Brise, stahl mich zum Eingang der Kapelle zurück und lugte hinein.
Bruder Jeremiah kniete reglos vor dem Altar, die Augen geschlossen, die Hände zum Gebet gefaltet wie ein braver kleiner Junge. Und neben ihm stand der dunkelhäutige Mann, der im Halbdunkel lediglich am Funkeln der Augen zu erkennen war. Als hätte ein Windzug meine Anwesenheit verraten, sagte er, ohne sich umzudrehen: »Bruder Jeremiah ist von uns gegangen, und auch wir sollten nun gehen.«
In den frühen Stunden dieser Sommernacht verließ ich St Michael’s Mount zusammen mit dem Fremden, der mich anwies, ihn einfach »den Mauren« zu nennen.
Endlich würde ich diesen verhassten Ort verlassen, und die gehässigen Novizen könnten mich nicht mehr daran hindern. Wir ließen etwas von dem Gold des Priors mitgehen, doch der Maure meinte, das sei in Ordnung, da dieser es nicht vermissen würde, zudem hätten wir eine bessere Verwendung dafür, als dem korrupten alten Kirchenmann jemals eingefallen wäre. Als Erstes bestachen wir einen jungen Fischer, damit er uns über die Meerenge zwischen der Insel und der Küste von Cornwall ruderte. Danach marschierten wir nachts den Pilgerweg entlang und schliefen tagsüber zwischen stachligen Ginster- und Brombeerbüschen.
Anderen Reisenden gingen wir aus dem Weg, obwohl der Maure sich deswegen offenbar keine Sorgen machte. »Wie ist Bruder Jeremiah eigentlich gestorben?«, fragte ich ihn eines Tages.
Er brauchte eine ganze Weile, ehe er antwortete. »Frag lieber nicht, John.«
»Werden sie uns wie Mörder suchen?« Ich hatte Männer hängen sehen und spürte bereits den Strick um meinen Hals.
»Sie werden keine Spuren an ihm finden. Gott hat ihn zu sich gerufen. Er war nicht mehr der Jüngste.«
Würde Gott auch mich unerwartet zu sich rufen, wenn ich nachts unter einem Ginsterbusch einschlief? Ich beschloss, den Mauren lieber zum Freund zu haben, obgleich ich nicht wusste, wie ich es anstellen sollte. Ich hatte noch nie einen Freund gehabt. Also löcherte ich ihn mit Fragen, und am Ende erzählte er mir, er sei mit einem Steinmetzmeister unterwegs gewesen, als ihr Schiff in einen Sturm geriet und an einem Felsen zerschellte. Er sei aus Córdoba gekommen, einer Stadt im Süden, wo er jahrelang in der Bibliothek eines großen Mannes Manuskripte kopiert hätte.
»Bist du ein Schreiber?«, fragte ich neugierig.
»Ein wenig mehr als das«, antwortete er mit einem geheimnisvollen Lächeln.
»Ich zeichne gern«, erzählte ich ihm. Im Skriptorium des Klosters hatte ich die Mönche beobachtet. Ihre Kritzeleien faszinierten mich, und wenn sie ihr Tagwerk beendeten und ich sauber machte, hatte ich die Stücke von Pergament und die zerbrochenen Federn, die sie wegwarfen, eingesammelt. Ich füllte die Schalen der Purpurschnecken, die ich am Strand fand, mit Gallustinte und versuchte, heimlich zu kopieren, was sie geschrieben hatten. Ich zog Linien auf dem Papier – wie Schrift, und doch nicht wie Schrift. Meine Linien sahen aus wie wackelige Würmer. Ich zeichnete einen Wurm, gab ihm Augen und Mund und musste lachen. Dann flog eine Krähe vorbei, und ich zeichnete auch sie. Bald zeichnete ich alles Mögliche: Möwen mit schwarzem Rücken, bucklige Katzen und kahle Bäume. Wasserspeier mit den Gesichtern von Heiligen, Heilige mit den Köpfen von Wasserspeiern. Karikaturen der Mönche mit aufgesetzten Kapuzen und Sensen über der Schulter: Todesarmeen. Und die seltsamen Visionen, die ich hatte, wenn ich meine Anfälle bekam. Sie waren am schwierigsten. Es gelang mir einfach nicht, das Unermessliche, das ich im Geist vor mir sah, auf das Papier zu übertragen. Und das brachte mich zur Weißglut.
Der Maure betrachtete mich interessiert. »In dir steckt mehr, als man glaubt, John. Das gefällt mir.«
Niemand hatte mir jemals so etwas gesagt. Ich errötete vor Freude und beschloss, ihm überallhin zu folgen. »Wohin gehen wir?«
»Wir werden sehen, was wir sehen müssen, und tun, was wir tun müssen. Aber durch die Welt zu reisen ist nicht gerade billig.«
»Jetzt haben wir ja Gold«, entgegnete ich unbekümmert.
»Aber nicht lange. Nichts hält ewig.«
Wir standen in der frühen Morgensonne am Rand des Bodmin Moors. Ein Bussard flog mit trägen, gleichmäßigen Flügelschlägen über uns hinweg und verschwand. Ich blinzelte und blickte den Mauren an.
»Mönche scheinen immer sehr viel Gold zu haben«, entgegnete ich.
»Die Leute geben es ihnen für ihre Heiligen, deren Reliquien sie bewahren, damit sie ihre Gebete erhören, ihre Krankheiten heilen und ihnen die Sünden vergeben.«
Ich dachte eine Weile darüber nach. In der Ferne hörte man einen kurzen gequälten Schrei. Er klang fast menschlich, doch wahrscheinlich war es ein Hase, den der Bussard gerissen hatte. Dann erzählte ich dem Mauren, was ich über die »Reliquien« des heiligen Felec wusste.
Seine Augen funkelten. »Gebeine«, sagte er nachdenklich. »Nun, das ist interessant.«
Ein paar Nächte später standen wir unter einem gelblichen Mond vor einem Massengrab in Slaughter Moor. Ich blies in meine Hände und stampfte mit den Füßen. Wie konnte es bloß so kalt sein, mitten im Sommer?
»Kannst du dich nicht ein bisschen beeilen?«
Aus der Grube stieg ein polterndes Lachen auf. »Manche Dinge brauchen ihre Zeit, John. Vor allem die Toten. Wenn du schneller fertig sein willst, kommst du am besten auch hier herunter.«
Mehr als alles andere auf der Welt wollte ich es ihm recht machen, aber bei dem Gedanken an all die ruhelosen Geister … »Keine zehn Pferde bringen mich da hinunter.«
Sorgfältig durchwühlte er die Erde, zog einen sauber durchtrennten Schädel heraus und hielt ihn einen Augenblick in die Höhe, um ihn im goldenen Schein der Öllampe, die wir dem Fischer abgekauft hatten, unter die Lupe zu nehmen. Im flackernden Licht erkannte man die Augen- und die dreieckige Nasenhöhle. Anschließend legte er ihn beiseite, sanft, als würde er seinen Besitzer kennen, und vertiefte sich wieder in seine Aufgabe. Nicht viele hätten es gewagt, diesen Ort zu schänden, vor allem nicht nach Einbruch der Dunkelheit, doch der Maure meinte, die Toten seien tot und der Körper sei nichts anderes als ein Gefäß, das die Seele verlassen habe. Die Geister hätten längst das Weite gesucht, und Knochen seien nichts anderes als Knochen.
»Möglich, dass ihre Besitzer vor langer Zeit gelebt haben, aber bevor ihre Leichen wie Abfall hier hinabgeworfen wurden, war ihr Leben voller Leidenschaft, Leid und Freude.« Er seufzte. »Krieg ist Wahnsinn, John. Noch nie hat er etwas von Wert hervorgebracht.«
Aus der Senke, in der wir uns befanden, stieg Dampf auf, die Schwaden schlängelten sich im Mondschein wie Gespenster. Das Licht hier war seltsam, es war wie der Schimmer, der jemand in den Sumpf lockte und in das tiefe braune Wasser zog, wo die Wichtel lebten. Ich schauderte, setzte mich an den Rand der Grube und ließ die Beine baumeln. Der Maure sah auf, und seine Augen leuchteten wie Halbmonde.
Zu seiner Verblüffung sprang ich hinunter und wurde mit einem schrägen Lächeln belohnt. »Sonst werden wir noch die ganze Nacht hier verbringen«, sagte ich knapp. Von Ekel erfüllt packte ich einen Knochen und versuchte, ihn herauszuziehen, wobei ich einen kleinen Erdrutsch auslöste.
»Vorsichtig«, ermahnte mich der Maure.
Ich war entschlossen, ihm nicht zu zeigen, wie sehr ich mich fürchtete. Gemeinsam durchwühlten wir die Erde und inspizierten halb zerfallene Kleidungsstücke, Knochen und rostige Metallstücke. Nach einer Weile kam ein großer Knochen zum Vorschein, und ich zog ihn heraus. »Wie wäre es mit dem hier?«
Der Maure drehte die Lampe um. »Eine Scapula«, sagte er.
»Was ist eine Scapula?«
Er legte seine Hand auf meinen Rücken. Die Haut unter dem rauen Zwirn meines Hemdes prickelte. »Ein Schulterblatt. So wie das hier.«
»Wer hat je im Leben von einem heiligen Schulterblatt gehört?«
»Es gibt weit seltsamere Dinge in den goldenen Reliquienschreinen deiner Kirchen. Der Papst in Rom bewahrt die Sandalen von Jesus Christus und seine Vorhaut unter dem Altar der Lateranbasilika auf. In Venedig habe ich Goliaths Backenzahn besichtigt, und wie ich höre, haben sie in Konstantinopel die Axt, mit der Noah seine Arche baute, und eine Phiole mit der Muttermilch der Jungfrau Maria.«
»Die müsste doch längst zu Käse geronnen sein!«, erwiderte ich. »Welcher Narr würde schon so einen Unsinn glauben?«
»Spotte nicht über den Glauben der anderen, John. Trotzdem, ein Schulterblatt ist wirklich nicht ideal.«
Schließlich stieß er auf einen Arm. Die Knochen waren alt, aber intakt. Eines Tages wird mein Arm auch so aussehen, schoss es mir durch den Kopf. Ich schauderte. Der Maure streifte die Erde ab, die unheimlichen Finger umklammerten immer noch den Griff einer mit zwei ineinander verschlungenen Bestien geschmückten Parierstange.
Ich hatte noch nie ein Schwert angefasst. Er reichte es mir, und als ich es in der Hand hielt, war es so, als strömte seine Kraft über das Eisen in meinen Arm. Ich fühlte mich wie ein König. Ja, wie ein König …
»Vorsicht, John«, sagte der Maure und trat einen Schritt zurück, als ich ungeschickt das Schwert über meinem Kopf schwang.
»Sehet die Gebeine und das Schwert König Artus’, des Retters der Engländer! Des Helden, der die Heiden von unseren Küsten vertrieb, ehe er in der letzten Schlacht auf tragische Weise ums Leben kam.« Die Einheimischen hatten uns erzählt, hier habe die Schlacht von Camlann stattgefunden, in der das englische Heer sich ein letztes Mal den sächsischen Eroberern stellte.
Der Maure sah nachdenklich aus. »König Artus war kein Heiliger. Ob die Klöster für die Gebeine eines toten Königs etwas zahlen würden?«
»Jeder liebt den Helden aus Monmouths Sage, vom ärmsten Ackerknecht bis zum reichsten Ritter. Sie werden Schlange stehen, um seine Gebeine berühren zu dürfen. Die Mönche sind nicht dumm. Sie werden die Popularität stets über die Heiligkeit stellen, solange sie Geld einbringt.«
Der Maure seufzte. »Es ist überall auf der Welt dasselbe, John.«
ZWEI
Glastonbury
Allerheiligen
1. November 1187
Der Maure legte den Kopf in den Nacken, um die komplexen Schnitzereien über der Tür zu betrachten. »Sie haben nur drei Jahre dafür gebraucht. Bemerkenswert.«
Ich sah auf und sog den Geruch des Winters ein. Holzrauch und kalte Erde.
Die alte Kirche, die einst Josef von Arimathäa erbaut hatte, war niedergebrannt. Sie hatten in Windeseile eine neue Marienkapelle gebaut. Wir waren gerade recht zur Einweihung gekommen. Zu Allerheiligen waren die Heiligen am stärksten, und man konnte sie anrufen, um Satans Macht Einhalt zu gebieten.
Die Kunde von der wundersamen Reliquie, die nach Glastonbury gekommen war, hatte sich rasch herumgesprochen: König Artus’ Arm, der noch das Schwert in den Händen hielt, mit dem er England gerettet hatte. Von Neugier, Verzweiflung und Hoffnung getrieben, hatten manche Pilger Hunderte von Meilen zurückgelegt. Eine riesige Menschenmenge wartete darauf, dass die Prozession ihren Rundgang beendete.
»Was werden sie wohl mit uns anstellen, wenn sie herausfinden, dass es eine Fälschung ist?«, hatte ich den Mauren immer wieder gefragt, während wir durch Devon nach Somerset wanderten. Doch der hatte bloß gelacht. Es hatte mich nicht beruhigt. Ein kalter Windzug kam plötzlich auf, und ich fuhr mir mit der Hand über den ungewohnt kahlen Schädel. Ich hasste es, eine Tonsur zu haben, aber der Maure hatte darauf bestanden. Wir mussten unsere Rolle spielen. »Bestimmt hängen sie uns auf.« Ich trug eine weiße Robe, die die Mönche der Abtei uns gegeben hatten, die traditionelle Farbe für das Fest der Allerheiligen. Und da ich an das benediktinische Schwarz gewohnt war, kam ich mir beinahe nackt vor. Der Maure trug auffälliges Pfingstrot. »Ich sehe aus wie ein bunter Hund«, hatte er gesagt, als er die Robe anzog. »Ein Schwarzer wird nie übersehen, egal, was er trägt, aber als schwarzer Kardinal wird man eher respektiert.«
Es war still geworden, als die Ehrengäste eintrafen: Vizeregent Ranulf de Glanvill, bekannt als »des Königs Auge«, da er über das Königreich wachte, wenn Heinrich II. in Frankreich weilte. Ich hoffte, dass sein Auge nicht ausgerechnet auf mich fiel. Und neben ihm sein Bruder Geoffrey, mit dem roten Gesicht eines Metzgers und der fleischigen Faust eines geborenen Schlägers. Der Vizeregent hatte eiskalte blaue Augen, scharf und durchdringend. Sie streiften mich und blieben dann an dem Mauren hängen, der in seinem roten Gewand unübersehbar war. Mir stockte für eine Sekunde das Herz. Doch der Maure zuckte nicht mit der Wimper, sondern nickte, als wäre er ihnen ebenbürtig, und die beiden Männer gingen vorbei.
Es folgte der Bischof von Bath, Reginald de Bohun, der mit seinem grauen Wuschelkopf aussah wie ein Schaf in Violett. Wir waren uns schon einmal begegnet. Auch er blickte uns an und wandte sich dann hastig – allzu hastig – wieder ab.
Die von niederem Adel trugen übertrieben bunte Kleider, in denen sich ihr Reichtum und ihr Mangel an Geschmack widerspiegelten. Die Frauen der wohlhabenden Kaufleute waren mit funkelnden Edelsteinen geschmückt, um den Erfolg ihrer Ehemänner zur Schau zu stellen. Ned und Quickfinger würden sie im Auge behalten.
Quickfinger hatten wir in Launceston aufgegabelt. Ich hatte beobachtet, wie er unter einen auf Böcken stehenden Tisch gekrabbelt war, an dem die Leute zum Erntedankfest aßen. Als sie den Tisch verließen, bemerkten sie, dass sie unterschiedliche Schuhe trugen oder mit ihren Strumpfbändern an ihren Tischnachbarn gefesselt waren. Während ich noch über das Durcheinander lachte, sah ich, wie er zwischen ihnen herumschlich und gelegentlich eine Börse mitgehen ließ, und stieß den Mauren an. Der nickte grinsend, auch ihm war die Szene nicht entgangen. Kurz darauf wurde Quickfinger als Erster in unsere Gruppe aufgenommen. Er stammte aus dem Norden. »York?«, fragte ich. »Noch weiter.« Quickfinger zeigte mit dem Finger nach oben, als wäre er vom Himmel gefallen.
Er hatte einen so starken Akzent, dass ich ihn manchmal nicht verstand. Dasselbe hielt er umgekehrt mir vor. Er machte meine Westküstenvokale nach und verspottete mich derart, dass ich ihn manchmal am liebsten windelweich geprügelt hätte. Zweimal hätten wir uns fast in die Haare bekommen, doch er war mit den Beinen genauso flink wie mit den Händen. Dann grinste er so breit, als wäre er nicht richtig im Kopf. Das war seine Art, die Leute abzulenken. Man will keinen Blickkontakt mit jemandem, der grinst wie ein Irrer, und das tat er jedes Mal, wenn er jemanden ausraubte und dessen Börse, Messer oder etwas anderes, das er zu fassen bekam, mitgehen ließ. Für Quickfinger war das Leben ein einziger großer Spaß. Das machte ihn liebenswert und abstoßend zugleich.
Ned war klein und dunkel wie eine Ratte und ging mühelos als der Krüppel durch, als der er sich ausgab. Er hatte sich der schnell anwachsenden Gruppe angeschlossen, als wir durch Tavistock gekommen waren. Ich mochte ihn nicht wegen seines hinterhältigen, verschlagenen Blicks, doch er brachte uns Tricks bei, die wirklich atemberaubend waren. Er zauberte Goldmünzen aus den Ohren des Mauren oder kroch in ein kleines Baumloch, in das nicht einmal eine Katze gepasst hätte, ehe er ganz verschwand und auf einem Ast über uns wieder auftauchte.
Schwindler und Diebe: Man konnte ihnen nicht über den Weg trauen. Ich spürte, wie meine Haut prickelte.
Dienstboten, Schmiede, Bauern, Büßer und Krüppel standen überwältigt am Rand der Gemeinde. Die Leprakranken aus St Mary Magdalene, diese armen Seelen, die bereits auf der Erde durch ein Fegefeuer gingen und das Aussätzigenhaus hatten verlassen dürfen, um Heilung für ihr Leid zu suchen, das sie lediglich in einem Wunder finden konnten, wurden mit ihren entstellten Gesichtern, die sie unter einer Kapuze verbargen, ihren Klappern und Glocken von den Konstablern auf Abstand gehalten.
Jetzt tauchte die Prozession erneut auf, angeführt von einem Mönch. Er trug ein großes, mit Edelsteinen geschmücktes Kreuz, kostbar wie das Lösegeld für einen König. Dahinter kam der Prior mit dem Corpus Christi und anschließend eine Reihe von Domherren mit den Reliquien, die den Brand überlebt hatten. Und ganz am Ende folgte die große Kiste aus Eichenholz und Silber mit »König Artus’« Schwert und Arm. Die Türen der Kapelle öffneten sich, und sie traten ein, als zelebrierten sie den siegreichen Einzug des Herrn in die Heilige Stadt Jerusalem. Anschließend winkte uns der Sakristan hinein.
Im Innern der Marienkapelle war es stockdunkel, und ein animalischer Gestank stieg uns in die Nase. Dann begann eine Kakophonie aus unheimlichem Geheul und dröhnendem Metall. Die Mönche von Glastonbury trommelten, stampften und kreischten in ihrer Rolle als Lakaien der Hölle. Einmal im Jahr schoben sie die stille Disziplin des klösterlichen Lebens beiseite und durften sich so schlecht benehmen, wie sie nur wollten, um die Versammelten an die dämonischen Strafen zu erinnern, die nach dem Tod auf die Sünder warteten, wenn sie nicht taten, was man ihnen sagte. Oder der Kirche möglichst viel Geld spendeten. Anwesende, die die Zeremonie des Lichts noch nie erlebt hatten, schrien vor Schrecken auf.
Ich drehte mich um und sah den Mauren in der Dunkelheit grinsen. Er genoss es, ein Sarazene zu sein, ein Ketzer, ein Gottloser, ein feindlicher Eindringling, ein Wolf im Schafspelz. Sein Grinsen flößte mir keine Zuversicht ein. Wenn das hier schiefläuft, werden wir nicht einmal bis zum Galgen kommen, sie werden uns noch vorher in Stücke reißen, schoss es mir durch den Kopf. Dann stimmte ich in den dämonischen Chor ein und war erleichtert, mir die Angst von der Seele schreien zu können. Am Ende wurden die Fenster enthüllt und Kerzen entzündet. Licht durchflutete die Marienkapelle und vertrieb alle Finsternis. Für ein weiteres Jahr war die Hölle verbannt. An ihre Stelle traten hohe Säulen, mit geschnitztem Laubwerk verziert, Arkaden, die mit Purpur, Gold und Blau ausgemalt waren. Sonne und Mond forderten die natürliche Ordnung heraus und schwebten nebeneinander über einer lächelnden Jungfrau Maria, die das Gotteskind in den Armen hielt. Zwischen den Säulen gab es helle Friese von Heiligen, Märtyrern und Aposteln, die auf die Gemeinde hinabsahen. Ich spürte ihre Blicke auf mir.
Ich betrachtete die Kirchengemeinde. Irgendwo zwischen den Kaufleuten stand Red Will und weiter weg, in der Nähe des Bauernvolks, Hammer und Saw und Plaguey Mary, der Rest unserer Truppe.
Hammer und Saw waren Zwillinge, klein, dunkel und drahtig. Wenn sie betrunken waren, unterhielten sie sich in einer Geheimsprache, die keiner von uns verstand. Wir hatten sie in einem Dorf am Rand von Dartmoor aufgelesen, wo sie jonglierten. Sie waren arbeitslose Zimmerleute und sehr geschickt mit ihren Händen. Quickfinger hatte sie rasch zu Taschendieben ausgebildet.
Red Will und Plaguey Mary hatten wir am Stadtrand von Exeter gefunden. Will spielte mehr schlecht als recht auf einer Flöte, und Mary lachte ihn aus. Sie hatte uns einen abschätzenden Blick zugeworfen, als wären wir potenzielle Freier, was uns allerdings erst später klar wurde, denn trotz des Namens, den sie sich selbst zugelegt hatte, war sie kerngesund und munter, hatte viel Humor und lachte gern. Wir gingen an ihnen vorbei, doch Mary war uns nachgelaufen, da sie ein besseres Geschäft als das ihre witterte, und Will hatte sich ihr angeschlossen.
Fahrende Schausteller, ein grässlicher Minnesänger, Gaukler, Taschendiebe und eine Hure. Wie genoss ich ihre Gesellschaft nach den scheinheiligen Mönchen und den boshaften Novizen mit ihrem grausamen Geläster! Wir lachten und erzählten uns Geschichten aus unserem Leben, und bald hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, Teil einer Familie zu sein, statt Abschaum. Vielleicht würde ich mich mit unseren schlauen Tricks irgendwie an der Kirche rächen können für alles, was ich in ihrem Schoß erlitten hatte.
Von Dartmoor bis Somerset Levels zog unsere bunt gemischte Bande von Kirche zu Kapelle, von Kloster zu Abtei und Marktplatz. Mal täuschten wir hier eine Heilung vor, mal dort eine Auferstehung, und so gewannen wir an Ansehen und kamen zu Pfründen. Die Leute sind gewillt zu glauben. Sie wollen, dass es Wunder gibt. Geistliche, denen wir begegneten, waren nur allzu gern bereit mitzuspielen. Wunder brachten Geld in Form von kleinen und großen Gaben. Aber in den dreizehn Jahren seit Thomas Beckets Heiligsprechung hatte Canterbury Unmengen an Gold eingenommen, worunter die anderen Heiligen sehr zu leiden hatten. Deren Kirchengemeinden waren neidisch, und deshalb waren wir selten abgewiesen worden, wenn wir ihnen unsere Echtheitsprüfungen und Belege vorlegten. Wir lebten gut von unseren Schandtaten. Trotzdem sollte der große Schwindel hier in Glastonbury unser Schwanengesang sein. Sobald der Schatzmeister der Abtei die Beute mit uns geteilt hatte, würden wir uns trennen, und jeder würde seines Weges gehen.
Zumindest war das der Plan …
Während der Predigt schrie einer der angeketteten Wahnsinnigen plötzlich wie am Spieß los und wurde in einen Nebenraum geschafft, in die notdürftig wiederaufgerichteten Ruinen des Kirchenschiffs. Als der Prior bemerkte, dass die Aufmerksamkeit unter den Gläubigen nachließ, erklärte er: »Miraculum magna videbis!« Jetzt wird man Wunder sehen.
Dann wurden die Reliquien angekündigt. Der heilige Aidan von Lindisfarne, die heiligen Indracht und Beonna, der heilige Patrick von Irland … die Liste zog sich in die Länge. Beim Abendessen am Tag zuvor hatte man uns erzählt, dass vor der Heiligsprechung von Thomas Becket Glastonbury mit zweiundzwanzig vollständigen Heiligen die meisten Reliquien besessen hatte (nun ja, fast: die Hälfte des heiligen Aidan wurde von den Mönchen in Iona beansprucht, ein anderer Teil befand sich in Durham, doch fast die Hälfte eines derart mächtigen Heiligen war mehr wert als ein vollständiger unbedeutender Märtyrer), sodass die Schatztruhen gut gefüllt waren. Aber nach dem Aufstieg des Becket-Kults und dem Brand in Glastonbury war der Reichtum allmählich verebbt. Die Spendenbereitschaft der Gemeinde schwand; sie war unzufrieden mit dem Aufgebot an verschlissenen Heiligen und wartete nun darauf, dass die Reliquien unter den wachsamen Augen der Aufseher in der Kapelle ausgestellt wurden. Es war schon vorgekommen, dass Pilger ein Andenken gestohlen hatten. Ein Mann war mit dem Mund voller Knochen des heiligen Beonna erwischt worden, nachdem er sich hinabgebeugt hatte, um sie zu küssen.
Schließlich kam auch die verzierte Kiste, die unsere gewieften Zimmerleute Hammer und Saw gebaut hatten. Erstaunlich, welche Ähnlichkeit blank geputztes Blech mit Silber haben kann.
Die Domherren öffneten den Reliquienbehälter, damit die Gläubigen die Knochen von Artus’ kräftigem rechtem Arm bestaunen konnten. Die Leute in der Kapelle hielten den Atem an. Um das zu sehen, waren sie gekommen. Seit Wochen hatten Gerüchte von den Wundern die Runde gemacht, die der heldenhafte König von Cornwall bis zum Moor von Somerset vollbracht hatte. In Newton St Cyres war ein toter Junge, der in den Brunnen gefallen war, wieder zum Leben erweckt worden. In Ottery St Mary war eine an den Pocken erkrankte Frau plötzlich genesen. In Chard hatte ein tauber Mann singen können wie ein Engel. In Charlton Mackrell waren alle möglichen Krankheiten geheilt worden, nachdem die Menschen Wasser getrunken hatten, das mit den Knochen in Berührung gekommen war. Schüttelfrost, Pocken, Mandelentzündungen und Fallsucht: alle geheilt von dem Schwertarm dieses Königs.
Und so waren sie gekommen, die Hoffnungslosen und Hilflosen, jene, für die ihre Ärzte nichts anderes hatten tun können, als ihnen auf wundersame Weise das Geld abzunehmen, jene, die von gekochten Schnecken bis Hundespeichel und alles dazwischen probiert hatten, die zur Ader gelassen und in übel riechende Umschläge gepackt worden waren, die sämtliche Heiligen angebetet hatten, um Kinder oder gesunde Gliedmaßen zu bekommen oder von Haarausfall geheilt zu werden, alles vergebens. Jetzt konnte bloß noch König Artus helfen.
Als die Pilger nach vorn strömten, brach Gezänk aus. Mitten im Durcheinander gab der Maure ein Zeichen, und ein verkrüppelter kleiner Mann auf einem Gestell mit Rädern, dessen Hände in Holzpantinen steckten, bewegte plötzlich seine entstellten Glieder, erhob sich von seiner Karre auf Beine, die nun gesund erschienen, und schritt aufrecht durch die Menge. Die Menschen berührten ihn, damit sein Glück auf sie abfärbte. Das Zweitbeste nach den Knochen war zweifellos ein solcher Mensch, der Mana ausstrahlte, diese beinahe übersinnliche Lebenskraft.
Ein angeblich von Geburt an blinder Mann – so hatte man jedenfalls den Büßern versichert – starrte grinsend in die Menge. »Ah, die Farben brennen in meinen Augen! Gelobt sei Jesus! Purpur und Gold, Blau und Grün. Wachsen da Bäume aus den Säulen, oder sind die Steine vor meinen Augen lebendig geworden?«
Nur nicht zu dick auftragen, Will, dachte ich.
Ein besessener Mann kam wieder zur Besinnung und sang das Te Deum.
Ein Leprakranker kratzte sich den schorfigen Aussatz ab, und darunter kam eine gesunde Haut zum Vorschein.
Alles lief wunderbar, die Kaufleute und Adligen drückten den überwältigten Kirchenmännern immer größere Opfergaben in die Hand. Das Geld strömte nur so. Da veranlasste mich ein Tumult hinter mir, mich umzudrehen. Ein anderer Blinder rief: »Ich kann sehen! Ich kann sehen!« Im gleichen Moment prallte er gegen eine Säule und fiel wie vom Hammer eines Pferdeschlachters getroffen um.
Der Maure packte Plaguey Mary am Arm. »Der gehört doch nicht zu uns, oder?«
Sie schüttelte den Kopf. »Irgendein Dummkopf, der sich hat anstecken lassen.«
Der Mann fing an, sich zu krümmen, Blut sickerte aus seinem gespaltenen Schädel.
»Um Himmels willen, lenk die Leute ab, bevor er ihnen auffällt.«
Mary fing an, zu jammern und zu stöhnen wie eine Besessene, wirbelte davon und riss sich das Mieder auf. »Rette mich, König Artus! Ein Dämon ist in mich gefahren, hier zwischen meine Brüste. Kannst du ihn sehen? Er ist schwarz wie die Nacht und niederträchtig wie der Satan. Treibe ihn aus, ich flehe dich an!«
Ehemänner drängten sich vor, um ihre prallen Brüste zu begaffen, und wurden von ihren Frauen zurückgehalten. Jetzt achtete niemand mehr auf den blinden Mann, der stöhnend neben der Säule lag und mit beiden Händen seinen aufgeschlagenen Kopf umklammerte.
Mitten in diesem Chaos kam ein Mann durch die Tür gelaufen und schrie etwas, das im Tumult unterging. Der Maure flüsterte mir hastig etwas ins Ohr. Ich sah, dass sein rotes Gewand wie eine Pfingstflamme aufleuchtete, und dann war er verschwunden. Ich wollte ihm nach, doch die Menschenmenge war plötzlich so dicht geworden, dass ich mich nicht rühren konnte.
Der Bruder des Vizeregenten packte den Boten am Arm und befahl ihm, die Nachricht zu wiederholen. Sein großes rotes Metzgergesicht war jetzt kreidebleich. Der Bote holte Luft und schrie: »Bei Gott und auf Befehl Heinrichs, Rex Angliae, Dux Normaniae et Aquitainiae et Comes Andigaviae, hört meine Kunde: Jerusalem ist gefallen!«
Mir lief es eiskalt über den Rücken. Bei Gott, das fehlte noch!
Der Bote versuchte, sich Gehör zu verschaffen. »Jerusalem, die Goldene, Salomos Stadt und Nabel der Welt, ist in die Hände des großen Teufels Saladin und seiner heidnischen Horden gefallen! Seine Bewohner wurden niedergemetzelt oder davongejagt. Das Heiligtum ist geschändet, die Sarazenen haben das Heilige Kreuz erbeutet. Der kostbarste Schatz des Christentums wurde zerstört. Alles ist verloren!«
Totenstille breitete sich in der Kapelle aus. Die offenen Münder wirkten wie dunkle Höhlen der Verzweiflung. Menschen bekreuzigten sich und beteten. Eine Frau begann zu klagen. »Jerusalem, die Goldene! Jerusalem, die Goldene!«, als hätte sie ein Kind verloren. Damit war der Zauber gebrochen.
Das Herz des Christentums hatte aufgehört zu schlagen. Jetzt, in diesem Augenblick, wurde es von den Heiden geschändet. Und sie waren hier, Kontinente entfernt und machtlos.
Wer konnte in solch einer Welt noch an Wunder glauben?
Das goldene Licht der Hoffnung war erloschen. Was eben noch durch die Herrlichkeit der Heiligen gestrahlt hatte, entpuppte sich als schäbiges Trugbild. Als hätte man ihr plötzlich die Augen geöffnet, starrte eine Frau den Leprakranken an – einen dunklen kleinen Mann, den wir Saw nannten, Hammers Zwillingsbruder – und runzelte die Stirn. Ich wusste, dass das schreckliche Zeichen der Lepra in seinem Gesicht nichts anderes war als eine Paste aus gefärbtem Mehl und Wasser. Jetzt beugte sich die Frau plötzlich wagemutig vor und zupfte ein Stück von seiner wunden Haut ab. Darunter offenbarte sich eine Wange, die nie etwas Schlimmeres gekannt hatte als Pickel.
Im selben Augenblick entdeckte jemand den blinden Mann mit dem blutverschmierten Gesicht, ein anderer ging auf Red Will zu und bezichtigte ihn, niemals blind gewesen zu sein. Wer hätte je von einem Mann gehört, der von Geburt an blind gewesen sei und dennoch die Unterschiede und Namen der Farben kannte?
Angsterfüllt versuchte ich, im Hintergrund zu bleiben, als wäre ich bloß ein weiterer entsetzter Mönch unter vielen. In dem Karren von Little Ned fand man ein Fach für seine ganz und gar nicht verschrumpelten Beine und darin zudem eine Perlenkette, die er von irgendeinem fetten Hals gestohlen hatte. Die Ehefrau eines Kaufmanns schrie: »Meine Juwelen! Meine Juwelen!« Plötzlich war Jerusalem, die Goldene, vergessen, die Menschen fassten sich an den Hals, tasteten nach ihren Geldbörsen und bemerkten, dass ihnen allerlei fehlte, das sie dabeigehabt hatten – nicht Krankheiten, Schmerzen oder Sünden, sondern Börsen, Ringe und Halsketten …
Mist, jetzt sitzen wir in der Klemme.
»Lauft!«, schrie ich Quickfinger und Hammer zu, und sie flitzten auf die Tür zu. Ich bahnte mir einen Weg durch die Menge, schubste die Menschen aus dem Weg. Wütende Kirchgänger verfolgten die Mitglieder der Truppe. Quickfinger stürzte zu Boden, Hammer landete auf ihm, seine Beute flog über den Gang. »Schließt die Tür!«, befahl Ranulf de Glanvill. Kurz bevor ich sie erreichte, knallten die zwei großen hölzernen Portale zu, und plötzlich versperrte mir der Bruder des Vizeregenten den Weg. Ich konnte nicht mehr ausweichen und prallte gegen ihn. Es war, als wäre ich gegen eine Mauer gerannt.
»Eine Bande von Dieben, wie?« Er packte den Kragen meiner Robe und zerrte mich auf die Beine. »Wer zum Teufel bist du?«
Wer ich war? Nur ein Wilder, ein als Mönch verkleideter Junge. Mein Schweigen wurde als Zeichen der Missachtung gedeutet. De Glanvill schlug zu, und der große Ring an seinem Finger zerschmetterte mir die Nase. Ich spürte, wie etwas brach, Blut strömte auf mein makelloses, weißes Gewand.
»Wie heißt du, verdammter Mistkerl?«, wiederholte er und schüttelte mich wie eine Ratte.
Aus lauter Angst fing ich an zu lachen. »Ich … ich … ach!«
Ein Muskel zuckte in meiner Wange. Der Duft von Rosen breitete sich in meinem Kopf aus. Mächtig, durchdringend und heiß wie der Sommer versengte er meine Nase. Meine Knie gaben nach, nur seine Faust hielt mich fest. Dann fingen meine Beine an zu zappeln, ich sah noch den Ausdruck des Ekels in seinem Gesicht, und im selben Moment öffneten sich die Tore in meinem Kopf und offenbarten einen Himmel aus Gold, mit Säulen und Bogen, die weit höher waren als die in der Marienkirche. Ich verlor das Bewusstsein.
DREI
Akka
Herbst 1187
Mach sie gleich groß, Zohra!« Nima Najib blickte ihrer Tochter über die Schulter, die es wieder einmal nicht geschafft hatte, die ma’amul– köstliche Pastetchen mit einer Füllung aus gehackten Datteln, Pistazien und Walnüssen, Orangenblütenwasser und Gewürzen– so zu formen, dass sie ihren strengen Anforderungen gerecht wurden. »Sieh mal, das hier ist doppelt so groß wie die anderen. Sei nicht so schludrig!«
Zohras Cousinen liebten solche präzisen, immer gleichen Aufgaben, doch Zohra fehlte die Geduld. »Ich gebe mir Mühe, Ummi, wirklich.« Was machte es schon, wenn die Pasteten nicht alle gleich groß waren? Am Ende schmeckten sie trotzdem gleich.
Sie hatten den ganzen Morgen verschiedene Gerichte zubereitet, um die Wiedervereinigung der Familie Najib zu feiern. Die Besatzung war zu Ende. Akka war befreit und Jerusalem von den Gläubigen zurückerobert worden. Nach vielen Jahren der Trennung war die Familie nun wieder zusammen. Zohras Vater, Baltasar, war auf dem Weg in die Moschee beim Viehmarkt vorbeigegangen und hatte einen schönen schwarzen Schafbock und drei Hühner gekauft. Gutmütig hatte er den Schafbock seinem ältesten, etwas zurückgebliebenen Sohn Sorgan anvertraut, während er selbst und die Zwillinge – Aisa und Kamal – je ein flatterndes Huhn nahmen. Als sie wieder zu Hause waren, hatte er Sorgan angewiesen, die Tauben auf dem Dachboden zu füttern, um ihn zu beschäftigen, während sie im Hof den Schafbock schlachteten. Sorgan hatte ein schwaches Gemüt, und niemand wollte ihm die Verbindung zwischen dem Blut auf den Kacheln, den fehlenden Tieren und dem Fleisch auf seinem Teller erklären müssen. Während Sorgan das flaumige Gefieder seiner Lieblingstaube streichelte, zeigte Baltasar den Zwillingen, wie man das Fleisch des Schafbocks von den Knochen löst. Der zwölfjährige Kamal, der fünf Jahre jünger war als Zohra und sich benahm wie ein kleines Kind, bekam einen Klaps, weil er mit den Hörnern auf dem Kopf umhersprang und sein Gewand mit Blut befleckte, und als Aisa versuchte, Kamal zu bändigen, hatte er sich eine Ohrfeige eingehandelt, was weitere Blutspritzer bedeutete, die nun ausgewaschen werden mussten.
Da Zohra das einzige Mädchen war, gehörte es zu ihren Pflichten, für saubere Kleider ihrer Geschwister zu sorgen, eine Aufgabe, die sie mit zusammengebissenen Zähnen und der nötigen Entschiedenheit erledigte. Danach hatte sie ihrer Mutter weiter in der Küche geholfen. Fünf volle Stunden arbeiteten sie nun schon. Sie hatten das Fleisch des Schafbocks gewaschen, mit frisch gemahlenem Kardamom und Zimt eingerieben, es in den größten Topf gelegt und auf das Holzfeuer gestellt. Sie hatten ein Dutzend Zwiebeln geschält, die drei Hühner gerupft und zerlegt, Safran ins Fleisch gerieben und es mit Zitronensaft und Knoblauch mariniert. Während Nima die Auberginen über dem Feuer grillte, bis die Haut verbrannte und sich die Küche mit Rauch füllte, hatte Zohra den Brotteig geknetet und anschließend ruhen lassen, während sie im Garten Kräuter sammelte. Sie zerstampften das Auberginenfleisch mit Knoblauch, Zitronensaft und Sesampaste und zerkleinerten Kräuter, Tomaten, Gurken und Rettiche für den Salat. Danach hatten sie sich dem vertrackten, kniffligen Gebäck gewidmet.
»O je«, sagte Nima plötzlich. Ihre Wangen waren erhitzt, und auf ihrer Stirn standen Schweißperlen. Sie fuhr sich mit der Hand über das Haar. Waren diese grauen Strähnen gestern auch schon dagewesen? Zohra war nicht sicher. Aber natürlich, schließlich wurde niemand über Nacht grau.
»Ruh dich aus, Ummi. Setz dich in den Hof, weg von dem Rauch und der Hitze.«
»Keine Zeit, wir müssen hiermit fertigwerden und den qidreh aufsetzen.« Nima wischte sich über die Stirn, dann fuhr sie fort mit dem Schneiden und Füllen, als wäre sie geradezu davon besessen.
Zohra fühlte sich hilflos, sie hatte ihre Mutter nicht davon abbringen können, dieses Fest zu geben. Nima hatte darauf bestanden. Zum Teil, weil sie ihre Schwägerinnen beeindrucken wollte, deren Ehemänner wohlhabende Händler waren, während Zohras Vater ein invalider Kriegsveteran war. Sie mussten jede Münze zweimal umdrehen oder von dem leben, was Malek, der in Salah ad-Dins Heer diente, ihnen von seinem Sold schickte. Doch wer machte sich schon etwas daraus, was die Tanten und Cousinen von ihnen dachten? Zohra bestimmt nicht.
Sie ertappte sich dabei, wie sie an den Mann dachte, dem sie an Sayedi Efraims Parfümstand begegnet war. Nathanael, der Sohn des Arztes. Wie seltsam er ausgesehen hatte. Die dichten Locken, der dreiste Blick! Und wie er ihre Handfläche geküsst hatte! Noch nie hatte jemand sie so berührt. Ein muselmanisches Mädchen war unantastbar. Von einem Mann berührt zu werden, egal von wem, galt als haram, verboten. Trotzdem hatte der Sohn des Arztes so getan, als sei es völlig normal und keine Schande. Er war ein faszinierendes, verstörendes Rätsel …
»Zohra, wach auf! Den ganzen Morgen träumst du vor dich hin. Sieh nur, was du mit den ma’amul angestellt hast. Jetzt kann man nichts mehr machen. Los, bring sie hinunter zum Bäcker, aber vergiss nicht den Teig für das Brot.«
Zohra stellte alles auf ein Tablett, ritzte das Zeichen der Familie in den Teig und lief mit dem Tablett auf dem Kopf zum Bäcker des Viertels am Ende der Straße, um ihm das Gebäck und das Fladenbrot zu bringen, musste aber feststellen, dass der Laden überfüllt war. Alle feierten, nicht bloß ihre Familie. Vor der nächsten Bäckerei reichte die Schlange bis zur Straßenecke, also lief sie den Hügel hinunter zu einer dritten Bäckerei, die sie nur anhand des Rauches fand, der vom Ofen in den Himmel aufstieg.
»Lass es mir da«, sagte eine alte Frau und nahm ihr das Tablett ab. Verzweifelt erkannte Zohra in ihr die Witwe Eptisam, ein unverbesserliches Klatschmaul. Sie hatte ein Hasengesicht mit vorstehenden Zähnen und einen gierigen Blick, der ständig von einem Ding zum anderen schweifte. »Ich stecke sie in den Ofen, sobald meine eigenen fertig sind. Ich mache es gern, binti.«
»Nicht nötig, ich kann warten.« Zohra wollte nicht in der Schuld der alten Frau stehen. Doch die hielt das Tablett bereits fest und ließ nicht von ihm ab, und statt hierzubleiben und sich eine halbe Stunde beschwatzen zu lassen, überließ sie ihr das Gebäck und die Fladenbrote und kehrte nach Hause zurück.
Als sie an einer Kreuzung vorbeikam, nagte ein Gedanke an ihr. Wenn sie einer von diesen Gassen folgte, würde sie zur Straße der Schneider kommen, wo Nathanael, der Sohn des Arztes wohnte. Bei dem Gedanken daran, wie nahe er war, errötete sie.
Die ganze Zeit, knapp drei Monate schon, seit sie ihm im Basar begegnet war, hatte sie jeden Tag mit dem Gedanken gespielt, seine schamlose Einladung anzunehmen und ihn zu besuchen, und jeden Tag hatte sie den Gedanken daran, was passieren konnte, wenn sie es tat, verdrängen müssen.
Zohra war im Glauben erzogen worden, dass ein guter Engel auf einer ihrer Schultern saß und ein böser auf der anderen, und dass es bei jeder Entscheidung zu einem Kampf zwischen den beiden kam. Bislang hatte ihr guter Engel gewonnen – zumindest tagsüber –, doch jetzt spürte sie, wie der böse an ihr zupfte. Oder waren es die djenoun, mit denen Nathanael ihr gedroht hatte?
Als Salah ad-Din die Stadt wiedereroberte, hatte eine Zeit lang Chaos geherrscht, und sie hatte es kaum gewagt, einen Fuß vor die Tür zu setzen. Doch es hatte sie nicht daran gehindert, sich vor dem Schlafengehen und in ihren Träumen mit Nathanael bin Yakub zu beschäftigen. Es waren schändliche, lüsterne Träume, die sie am Morgen beschämten. Sie betete um die Kraft, nicht an Nathanael zu denken, doch anscheinend hatte Allah im Augenblick Wichtigeres zu tun, als sich um die lasterhafte Schwärmerei eines jungen Mädchens zu kümmern.