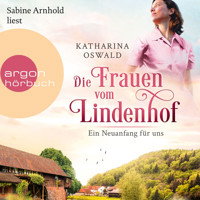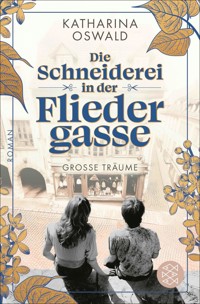
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei Geschwister und ein großer Traum vom Leben: die neue Familiensaga um Liebe und Selbstbestimmung Frühling, 1977: Susanne und Leonard stecken in der Zwickmühle. Leonard studiert Jura, und Susanne soll die familieneigene Schneiderei übernehmen. Dabei ist es Susanne, die ihrem Bruder heimlich mit den Studienarbeiten hilft, während Leonard fürs Theater schwärmt und gerne Kostüme näht. Doch ihre vorherbestimmten Wege waren der letzte Wunsch ihres sterbenden Vaters. Als die Schneiderei in finanzielle Schwierigkeiten gerät, müssen die Geschwister zusammenhalten. Das ist gar nicht so einfach, denn sie sind in denselben Mann verliebt ... Band 2 erscheint im Herbst 2025 Mehr von Katharina Oswald: Die Frauen vom Lindenhof - Ein Neuanfang für uns Die Frauen vom Lindenhof - Zusammen können wir träumen Die Frauen vom Lindenhof - Gemeinsam der Zukunft entgegen Die Schneiderei in der Fliedergasse - Große Träume
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 320
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Katharina Oswald
Die Schneiderei in der Fliedergasse
Große Träume
Roman
Über dieses Buch
Mehr von Katharina Oswald:
Die Frauen vom Lindenhof – Ein Neuanfang für uns
Die Frauen vom Lindenhof – Zusammen können wir träumen
Die Frauen vom Lindenhof – Gemeinsam der Zukunft entgegen
Die Schneiderei in der Fliedergasse – Große Träume
Die Schneiderei in der Fliedergasse – Neue Hoffnung (erscheint im Frühjahr 2026)
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Andrea Bottlinger und Claudia Hornung schreiben gemeinsam als Katharina Oswald. Beide sind in Baden-Württemberg geboren und lieben es, sich in Frauenschicksale verschiedener Jahrzehnte hineinzudenken. Sie kennen sich schon lange und ergänzen sich beim Schreiben perfekt: Andrea achtet immer auf die Struktur der Geschichte, und Claudia vertieft sich ganz in die Details und Emotionen. Zusammen schaffen sie mitreißende Familiensagas.
Impressum
Originalausgabe
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2025 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Redaktion: Silke Reutler
Covergestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich
Coverabbildung: Hauptmann & Kompanie mit Midjourney
ISBN 978-3-10-491947-8
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
[Leseprobe]
Prolog
Kapitel 1
Prolog
Tübingen, Juni 1970
Hubert Körber schloss die Augen. Wie gut es tat, die Wärme der Sonne noch einmal im Gesicht zu spüren!
Er war dankbar, dass die Ärzte ihm gestattet hatten, die Klinik für ein paar Stunden zu verlassen und diesen Tag mit seiner Familie zu verbringen. Dass er den dreizehnten Geburtstag der Zwillinge noch erleben durfte, war ein Geschenk. Susanne und Leonard – so ähnlich sie sich sahen, so grundverschieden waren sie auch, aber immer hielten sie zusammen wie Pech und Schwefel. Er hörte ihr Lachen, als sie ausgelassen durch den Garten in Derendingen tobten, der ihrer Tante gehörte. Die Geschenke lagen ausgepackt auf dem Tisch – das Knobelspiel, die neuen Federballschläger und zwei Briefmarkenalben, in die er jeweils einige Sonderbriefmarken gesteckt hatte, als Grundstock für ihre Sammlungen. Der Wind hatte ein Stück abgerissenes Kräuselband herabgeweht. Wie eine kleine gelbe Schlange lag es vor seinen Füßen im Gras.
»Möchtest du ein Stück Geburtstagskuchen?« Elisabeth legte ihm sanft die Hand auf den Arm.
»Nein danke.« Er öffnete die Augen, um sie anzusehen. In ihrem Gesicht standen Sorge und Anspannung, auch wenn sie versuchte, es zu überspielen. Sicher schmeckte die Torte, die sie gebacken hatte, wunderbar, aber sein Magen vertrug feste Nahrung nicht mehr sonderlich gut.
»Kann ich dir sonst etwas bringen?«, fragte sie. »Noch ein Glas Limonade vielleicht?«
Er schüttelte leicht den Kopf. Selbst die kleinste Bewegung strengte ihn an, aber er wollte nicht jammern. »Lass mich einfach nur hier sitzen. Das reicht mir.«
Im Transistorradio lief eine Hörerwunschsendung. Nach einem Hit von Abba spielten sie nun einen Evergreen, den er gern mochte. Dass die Melodie hin und wieder von leisem Knacksen und Rauschen unterbrochen wurde, störte ihn nicht.
Elisabeth setzte sich neben ihn auf einen Gartenstuhl und schloss die schlanken Finger so fest um ihre Kaffeetasse, dass die Knöchel weiß hervortraten.
»Es wird alles gut werden«, versuchte er, sie zu beruhigen.
»Wie kannst du so etwas sagen?«
»Ihr seid versorgt, auch wenn ich nicht mehr da bin.«
»Meinst du, darauf kommt es mir an?« Schmerz blitzte in ihren Augen auf. »Wie …?«
»Mir kommt es darauf an«, unterbrach er sie, ehe sie weiterreden konnte. »Mir ist es wichtig, dass ihr drei abgesichert seid. Deshalb habe ich das Haus auf dich überschrieben. Und dass du die Schneiderei führen kannst, hast du in den letzten Monaten doch schon bewiesen!«
Eine Träne stahl sich aus einem ihrer Augenwinkel. Elisabeth wischte sie mit einer hastigen Bewegung weg. Nie wollte sie schwächer wirken als er.
»Ohne dich wird alles anders sein«, sagte sie.
»Ja, das wird es. Aber ihr werdet es schaffen.« Dass er das wusste, machte ihm den Abschied leichter. Die vielen Jahre, die sie gemeinsam verbracht hatten, ebenso. Damals im Krieg, als er schwer verwundet worden war, hätte er nie gedacht, dass ihm noch so viel Liebe und Familienglück beschieden sein würden. Dass eine Frau wie sie jemanden wie ihn heiraten würde. »Das Schicksal ist manchmal eine Wundertüte, stimmt’s? So haben wir doch immer gesagt.«
Elisabeth seufzte schwer. »Ach, Hubert …«
Ein Fußball flog quer durch das Gras und prallte seitlich gegen den Rollstuhl, in dem er saß.
»Ups! Entschuldige, Papa!« Susanne stürmte heran. Das lange Haar klebte an ihrer verschwitzten Stirn, und auf ihrem T-Shirt prangte ein Erdbeerfleck.
»Könnt ihr nicht aufpassen?«, fuhr Elisabeth sie an.
Susanne hob den Ball auf. »Alles in Ordnung, Papa?« Unsicher blinzelte sie ihn an und nagte an ihrer Unterlippe. Leonard tauchte mit schuldbewusster Miene hinter ihr auf.
»Ich war’s, Papa«, gestand er.
»Schon gut, nichts passiert.« Er lächelte die beiden an. Sie waren im Fußballfieber, gerade erst war Gerd Müller bei der WM in Mexiko zum Torschützenkönig gekrönt worden. Wie hätte er ihnen da den Spaß am Spielen verübeln können?
Die Zwillinge legten den Ball dennoch beiseite. Sie hatten darauf verzichtet, ihre Freunde einzuladen, damit er den Tag mit ihnen verbringen konnte. Nicht mehr lange, dann würden sie erwachsen sein. Er hätte sich gewünscht, sie auf ihrem Weg noch länger begleiten zu dürfen. Aber da ihm sein kranker Körper diesen Wunsch nicht gestattete, hoffte er, sie würden sich später immer an diesen Tag erinnern. An die Sonne, den Duft der Blumen, die summenden Insekten.
Und an seine Abschiedsworte.
Es war ihm wichtig, jedem von ihnen etwas mitzugeben.
»Leonard?«, fragte er. »Hast du einen Moment?«
Elisabeth erhob sich, hängte ihre helle Häkeljacke über die Stuhllehne und winkte Susanne mit sich. »Komm, wir gehen noch ein paar Erdbeeren pflücken.« Die Beete hinten am Zaun waren übervoll mit reifen Früchten.
»Kochen wir Marmelade ein?« Susanne hopste davon.
Leonard nahm auf dem frei gewordenen Stuhl Platz. Er blickte ein wenig scheu. Hubert mochte die stille, verträumte Art des Jungen. Im Grunde war Leonard immer sein Lieblingskind gewesen, auch wenn er sich bemüht hatte, Susanne das nicht spüren zu lassen. Aber der Junge stand ihm näher. Vielleicht weil er sich ein Stück weit selbst in ihm erkannte.
»Hör zu, ich wollte, dass du etwas weißt«, sagte er. »Ich habe ein Sparbuch für dich eingerichtet. Darauf befindet sich eine größere Summe Geld. Genug für ein Studium.«
»Oh.« Leonard rutschte auf dem Stuhl herum. »Ich weiß nicht, ob ich studieren will …«
»Ich finde, das solltest du«, sagte Hubert. »Auf Männer wie dich kommt es an in dieser Welt.«
»Hm?« Leonard hörte auf zu zappeln. »Was meinst du damit?«
»Es gibt so viele Männer, die meinen, alles, was sie können müssen, ist kämpfen. Aber schau, was uns das eingebrockt hat. Wir haben zwei schreckliche Kriege geführt. So viele Leben wurden zerstört. So kann es nicht weitergehen. Wir brauchen sanftmütige Männer wie dich, um eine bessere Zukunft zu schaffen.«
Nun hing Leonard gebannt an seinen Lippen. Hubert lächelte.
»Ich habe früher davon geträumt, Jura zu studieren, weißt du?« Er blickte für einen Moment versonnen auf das sattgrüne Gras. »Leider konnte ich den Traum nicht wahr machen. Meine Familie hatte für ein Studium kein Geld, und nachdem mein Vater an der Front gefallen war, stand fest, dass ich die Schneiderei übernehmen muss.«
»Ich bin echt froh darüber«, platzte Leonard heraus. »Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwo anders zu wohnen als in unserem Haus mit der Schneiderei.«
»Du musst ja nicht woanders wohnen«, sagte er. »Jura kannst du auch hier in Tübingen studieren. Die Juristische Fakultät gibt es hier schon seit Gründung der Universität vor fast fünfhundert Jahren.«
»Was, so lange?«, staunte Leonard.
»Ja, so lange«, bestätigte er. »Wenn du dann den Abschluss hast, kannst du für Gerechtigkeit in der Welt sorgen. Denen eine Stimme geben, auf die sonst niemand hört, und dich dafür einsetzen, dass es in Zukunft keine Kriege mehr gibt. Dass all jene zur Rechenschaft gezogen werden, die Unrechtes tun. Denn das ist wichtig, verstehst du?«
Leonard nickte langsam. »Aber meine Noten sind nicht so gut«, wandte er ein. »Vor allem in Mathe und Physik.« Das stimmte zwar, aber der Junge war nicht auf den Kopf gefallen, nur eben manchmal ein bisschen verträumt. »Was, wenn ich das Abitur nicht schaffe?«
»Streng dich an, dann schaffst du das.« Hubert hätte ihm gern aufmunternd gegen die Schulter gestupst, aber schon allein den Arm zu heben, kostete zu viel Kraft. »Um Jura zu studieren, brauchst du kein Mathe und Physik.«
Bald darauf kamen Elisabeth und Susanne mit einer großen Schüssel Erdbeeren zurück. Mit einem feuchten Tuch rieb Elisabeth sorgsam eine besonders schöne Frucht ab und steckte sie ihm in den Mund. Der Geschmack war überwältigend – als läge ihm der Sommer selbst auf der Zunge. Wieder schloss er die Augen. Versuchte, den Moment auszukosten, das Leben festzuhalten.
»Papa?«, fragte Susanne.
Das Gespräch mit Leonard hatte ihn ermüdet, aber er wollte auch ihr noch ein paar Worte sagen.
»Du bist ein kluges Mädchen«, begann er.
Aufmerksam lauschte sie ihm, die Stirn leicht gerunzelt, wie immer, wenn sie sich konzentrierte. Hubert war sicher, dass sie sich später an jeden Satz erinnern würde, also wählte er seine Worte mit Bedacht. »Hilf deiner Mutter im Laden, dann kannst du ihn später übernehmen. Ein Kaufmann wird immer ein Auskommen haben, das hat mich die Vergangenheit gelehrt. Die Schneiderei ist mein Vermächtnis an euch, und ich bin sicher, du kannst das Geschäft so gut führen wie ich.«
Freude blitzte in Susannes Augen auf. Hatte er sie in der Vergangenheit zu selten gelobt?
»Ich bin stolz auf dich«, sagte er deshalb mit Nachdruck – und als sich Elisabeth mit einem frisch gefüllten Krug Limonade näherte, fügte er hinzu: »Auf euch alle.«
Über den Tod und das Sterben redete an diesem sonnigen Tag im Garten niemand, dennoch lag die Gewissheit wie ein dunkler Schatten über allem. Bei jeder Bemerkung, jedem Lachen war ihm bewusst, dass er ihre Stimmen vielleicht zum letzten Mal hören würde. Irgendwann übermannte ihn die Erschöpfung.
»Lass uns zusammenpacken.« Elisabeth rief die Kinder, die Ball, Geschenke und Geschirr im Bollerwagen verstauten und ihn fröhlich klappernd hinter sich herzogen.
An der Steinlach entlang kehrten sie in die Stadt zurück.
Elisabeth schob den Rollstuhl, und der Himmel über Hubert war so intensiv blau, dass es ihm vorkam, als könnte er direkt in die Unendlichkeit blicken.
Es tröstete ihn ein wenig, dass dieser Himmel auch dann noch da sein würde, wenn er es nicht mehr war.
Kapitel 1
April 1977
Susanne hielt das Stück Spitze mit den eingearbeiteten Perlen an das Mieder des Brautjungfernkleides, das sie gerade nähte. Skeptisch zog sie die Nase kraus. Die Kundin hatte ihr die Entscheidung überlassen, welche Art Spitze am besten zu dem altrosa Ensemble passte, das sie für ihre Tochter ausgewählt hatte – etwas, das Susanne gleichermaßen fürchtete und hasste. Sie arbeitete gerne mit den Händen, sie war gut im Nähen und überzeugt von dem, was sie tat. Aber Design-Entscheidungen für anspruchsvolle Käuferinnen zu fällen, war ganz eindeutig keine ihrer Stärken. Lieber machte sie die Buchhaltung der Schneiderei.
Die Ladenglocke war da eine willkommene Unterbrechung. Susanne legte das halb fertige Kleid beiseite in der Hoffnung, dass irgendeine Kundin sie lange genug ablenken würde, bis ihre Mutter die Spitze an ihrer Stelle auswählte. Wegen starker Kopfschmerzen hatte sie sich zurückgezogen, Susanne wollte sie ungern wecken, solange es nicht nötig war.
Doch die Person, die ihr entgegenkam, als sie in den Verkaufsraum eilte, war keine Kundin, sondern ihr Bruder. Leonard trottete zwischen den Tischen voller Stoffballen und den Kleiderständern mit den handgenähten Einzelstücken hindurch zum Kassentresen, neben dem sich die Anprobekabine befand. Als würde er alle Last der Welt auf seinen Schultern tragen, ließ er sich schwer in den Polstersessel fallen, der dort für die Kunden bereitstand.
»Was ist los?«, fragte Susanne. »Anstrengender Tag?«
Leonard seufzte. »Die Texte, die wir für die Uni lesen müssen, sind mir einfach zu hoch. Ich versteh nur die Hälfte und komm mir vor, als könnte ich kein Deutsch.«
Er hatte sein Studium im letzten Herbst begonnen, weil er aufgrund eines – zum Glück harmlosen – Herzklappenfehlers ausgemustert worden war. Ein Vorteil gegenüber den anderen Abiturienten, die zur Bundeswehr hatten gehen müssen. Susanne wusste, dass er sich die größte Mühe gab und fleißig war, aber die komplexen juristischen Texte mit all den Fremdwörtern, die er lesen musste, setzten ihm zu.
»Warum kann sich keiner von diesen gebildeten Leuten verständlich ausdrücken?«, jammerte er.
Susanne lachte. »Das ist Absicht! Sonst würde man ja viel zu schnell merken, dass sie auch nur mit Wasser kochen«, scherzte sie.
»Den Verdacht habe ich auch.« Leonard streckte sich und sah sich um. »Heute ist wieder wenig los, hm? Warum machen wir mittwochs überhaupt noch auf?«
»Vorhin war jemand da«, sagte Susanne. »Der Auftrag lohnt sich sogar. Komm mit, ich zeig’s dir!«
Ihr Bruder folgte ihr zur Treppe im hinteren Bereich des Ladens. Das alte Haus mit der Schneiderei war schmal – als ob es nachträglich in die Lücke zwischen den größeren Nachbarhäusern eingefügt worden wäre. Die Nähstube und das Materiallager befanden sich aus Platzgründen über dem Verkaufsraum in der ersten Etage, die Wohnräume der Familie lagen in den beiden Stockwerken darüber.
Neugierig betrachtete Leonard den von Susanne gezeichneten Entwurf des Kleides und die Stoffe. »Spitze mit Perlen?«, fragte er skeptisch. »Will die Kundin das so?«
»Nein, nicht unbedingt. Sie hat mir die Entscheidung überlassen.« Vielleicht konnte sie die ja auf ihren Bruder abwälzen. Susanne griff nach einem der anderen Spitzenmuster, die zur Auswahl standen. »Besser?«
Die Falte zwischen Leonards Brauen sagte ihr, dass ihn das auch noch nicht ganz überzeugte. »Zu welchem Anlass?«, fragte er.
»Eine Hochzeit.« Susanne hielt ihm das nächste Muster hin und blickte ihn fragend an.
»Ja, das«, sagte Leonard bestimmt.
Susanne konnte kaum einen Unterschied zu den beiden vorherigen Spitzenmustern ausmachen, aber sie würde sich hüten, mit Leonard zu diskutieren. Bisher hatte er mit seinen Empfehlungen immer genau richtiggelegen, und die Kundinnen waren begeistert gewesen.
»Du bist meine Rettung«, sagte sie.
»Ich wünschte, irgendjemand würde mich retten.« Leonard ließ die Schultern hängen und sackte in sich zusammen wie eine Marionette mit lockeren Fäden. Es fiel Susanne schwer, nicht zu lachen. Er tat gerne mal überdramatisch, wenn etwas nicht so lief, wie er sich das vorstellte.
Aber vielleicht konnte sie ihn ja tatsächlich irgendwie unterstützen. Schließlich hatte er ihr auch gerade geholfen. »Was ist denn das Problem?«, fragte sie, während sie gleichzeitig nach dem Kissen mit den Stecknadeln griff und begann, die Spitze festzustecken, damit sie sie annähen konnte.
»Wir haben hier einen Text, der erklärt, wie man Gesetzestexte analysiert.« Er wühlte in seiner Tasche, die er neben ihren Stuhl hatte fallen lassen, und zog eine Mappe hervor, um damit zu wedeln. Soweit Susanne durch den durchsichtigen Plastikumschlag sehen konnte, enthielt die Mappe Fotokopien aus einem Buch. Es waren richtige Fotokopien, nicht solche stinkenden bläulichen Matrizenabzüge, wie sie in der Schule ausgeteilt worden waren. »Das ist ganz bestimmt wichtiges Grundlagenwissen, aber es gibt keinen Satz, der kürzer als eine Seite ist, und außerdem hat der Autor ein Fremdwörterlexikon gefressen. Ich versteh jedenfalls nix.«
Susanne lachte. »Komm schon, so schlimm kann es doch nicht sein.«
Leonard hielt ihr die Mappe hin. »Lies selbst und dann sag das noch mal.«
»Wenn du in der Zeit das Kleid fertig nähst, mach ich das.«
Susanne hatte nicht erwartet, dass ihr Bruder auf den Vorschlag eingehen würde, aber er nahm ihr sofort den Stoff und die Spitze für das Mieder aus der Hand, offensichtlich begierig darauf, sich auf irgendetwas zu stürzen, das nichts mit Jura zu tun hatte. Also ließ Susanne ihn hinter der Nähmaschine Platz nehmen und griff nach der Mappe. Wenn er ihre Arbeit erledigen wollte, würde sie sich nicht beschweren. Er nähte mindestens ebenso geschickt wie sie, ihre Mutter hatte es ihnen beiden beigebracht, als sie Kinder gewesen waren.
Susanne vertiefte sich in die Lektüre. Leonard hatte nicht übertrieben. Direkt der erste Satz zog sich über zwanzig Zeilen und strotzte nur so von Wörtern, die sie dazu zwangen, in ihrem Hirn nach den verschütteten Lateinkenntnissen zu suchen, um ihnen einen Sinn abzugewinnen. Immerhin hatte sie im Gegensatz zu Leonard in der Schule bei der Latein-AG mitgemacht. Die zweite Fremdsprache am Uhland-Gymnasium war Französisch gewesen, und Leonard hatte lieber an der Theater-AG teilgenommen, statt sich freiwillig mit Latein herumzuschlagen – auch wenn ihr Vater Letzteres sicher lieber gesehen hätte. Aber er war zu früh gestorben, um Leo deshalb ins Gewissen reden zu können. Als sie ihr Abitur gemacht hatte, war Susanne der festen Überzeugung gewesen, dieses Lateinwissen nie wieder zu brauchen. Tja, da hatte sie sich offenbar getäuscht.
»Der systematische Aufbau eines Gesetzes beinhaltet Normen, die durch Verbote, Gebote und Kann-Bestimmungen kodifiziert werden«, las sie einen Satz laut vor. »Was heißt denn kodifiziert in dem Zusammenhang?«
»Soweit ich es verstehe, einfach, dass man Regeln als Gesetz aufschreibt.« Leonard steckte geschickt und schnell die restliche Spitze fest. Als er sprach, sah er nicht einmal auf.
»Das hätte man wirklich einfacher ausdrücken können.«
»Sag ich doch!« In Leonards Stimme schwang Triumph mit, weil sie ihm recht gab.
Doch je weiter Susanne las, desto mehr stellte sie fest, dass der Text zwar schwer zugänglich sein mochte, sie den Inhalt aber faszinierend fand. Es gab also Tricks, die Anwälte und Richter nutzten, um dem Gesetz einen Sinn abzugewinnen. Und in diesem Text wurden diese Tricks verraten. Sie blickte auf, um sich nach einem Stift umzusehen. »Darf ich am Rand Notizen machen?«
»Klar.« Leonard schaute ebenfalls von seiner Arbeit auf. »Verstehst du das Juristengefasel etwa?«
»Einiges davon schon, ja.« Susanne hätte lügen müssen, hätte sie behauptet, alles zu verstehen, aber je öfter sie bestimmte Absätze las, desto mehr von deren Sinn enthüllte sich ihr. Ein wenig kam es ihr vor, als würde sie eine Art Geheimschrift entschlüsseln. Sie fand einen Bleistift auf dem Tisch neben der Nähmaschine und beugte sich damit wieder über den Text.
Es hatte etwas Beruhigendes, sich beim Rattern der Nähmaschine durch diesen Wust an Fremdwörtern und Schachtelsätzen zu wühlen. Hin und wieder hielt sie inne, um Leonard etwas zu fragen.
»Schau mal in meine Vorlesungsnotizen«, sagte er schließlich, als er bei einer Frage nicht weiterwusste. »Die sind hinten in der blauen Mappe. Ich glaube, der Professor hat heute davon gesprochen.«
Susanne breitete seine Notizen auf den Stoffballen ringsum aus und vertiefte sich in die Lektüre. Das erneute Klingeln der Ladenglocke ließ sie hochschrecken.
»Moment, ich komme gleich«, rief sie.
Leonard grinste. »Soll ich runtergehen?«
Zu spät, schon waren Schritte auf der Treppe zu hören, und gleich darauf spähte Frau Brendle zu ihnen in die Nähstube.
»Huch!« Frau Brendle war eine treue Kundin der Schneiderei. Sie kam schon seit vielen Jahren, trank manchmal mit ihrer Mutter einen Kaffee, weshalb sie sich auch nicht scheute, durch den Laden nach oben zu kommen. Heute trug sie ein schickes Kostüm und einen farblich passenden Hut mit einem Blumengesteck darauf. »Was ist denn hier passiert?«, rief sie erstaunt.
Verlegen erhob sich Susanne und stellte sich vor das Durcheinander aus Papier. »Mein Bruder studiert doch jetzt Jura«, erklärte sie. »Wir versuchen gerade, einen Text zu verstehen.«
Frau Brendle warf Leonard hinter der Nähmaschine einen skeptischen Blick zu. »Es sieht fast so aus, als würdest du studieren, Sannele«, sagte sie lächelnd.
Erleichtert atmete Susanne auf. Wenn Frau Brendle keinen Anstoß an der Situation nahm, dann würde sie sich auch nicht bei ihrer Mutter beschweren. Dafür ließ sie sich den albernen Kosenamen gern gefallen, den sie ansonsten nicht ausstehen konnte. Vor allem auch, weil es Frau Brendle niemals eingefallen wäre, ihren Bruder »Leole« zu nennen! Der war schließlich ein Mann und kein niedliches Mädchen.
»Sie sind wegen der Bluse hier, gell?«, beeilte Susanne sich, das Thema zu wechseln. »Die ist fertig. Ich hole sie schnell.«
Während sie nach unten in den Verkaufsraum eilte, stand Leonard auf, um die Vorlesungsnotizen einzusammeln. Frau Brendle erkundigte sich neugierig nach seinem Studium.
»Hast du denn vor, Richter zu werden?«, hörte Susanne sie fragen. »Das ist ein hohes Ziel …«
Leonard antwortete mit leiser, aber fester Stimme. »Mein Vater hat mal zu mir gesagt, dass es mehr Männer braucht, die für Gerechtigkeit auf der Welt sorgen, und weniger, die kämpfen.«
»Dein Vater war ein kluger Mann.«
Als Susanne mit der maßgeschneiderten Bluse aus dem Laden zurück nach oben kam, sah die Nähstube nicht mehr wie ein wildes Studierzimmer aus, sondern wieder so, wie es sein sollte. Während Susanne Frau Brendle die Bluse reichte, lächelte die Leonard wohlwollend zu. »Ich bin sicher, dein Vater wäre sehr stolz auf dich.«
Die Worte versetzten Susanne einen Stich. Manchmal wünschte sie, die Leute würden so etwas auch zu ihr sagen. Allerdings hatte ihr Vater ihr genau das selbst gesagt, kurz bevor er gestorben war. Das war doch eigentlich viel mehr wert und tröstete sie meistens darüber hinweg, dass Leonard mit seinem Jurastudium natürlich mehr Anerkennung einheimste als sie mit ihrer kaufmännischen Ausbildung.
Genauso wie die Tatsache, dass Leonard mit dem ganzen Druck, der auf ihm lastete, oft nicht allzu glücklich aussah. Je klarer es für die Nachbarn und Bekannten war, dass er Richter werden wollte, umso selbstverständlicher würden sie fragen, wie er im Studium vorankam, und dann auch erfahren, wenn er eine Prüfung vermasselte oder am Ende womöglich das Staatsexamen nicht schaffte. Susanne dagegen wurde nichts gefragt, es war für alle klar, dass sie fleißig beim Nähen half und die Schneiderei so führte, dass sie nicht im finanziellen Ruin endete. Auch ihr selbst kam das vergleichsweise einfach vor, obwohl sie mehr Freude an der Organisation des Geschäfts als an der eigentlichen Näharbeit hatte.
Frau Brendle warf einen Blick auf ihre Armbanduhr. »Oje! Jetzt muss ich mich aber beeilen! Gleich hat mein Mann Feierabend, und er kann es gar nicht leiden, wenn er aufs Essen warten muss.«
Sobald Susanne kassiert hatte und die Ladentür hinter Frau Brendle zugefallen war, stöhnte Leonard auf. »O Mann, gerade erst sind die Semesterferien vorbei, und schon muss ich eine dämliche Hausarbeit über die Analyse von Gesetzestexten schreiben.«
Susanne tippte ihm lachend mit der Mappe auf den Hinterkopf. »Schau dir mal an, was ich an den Rand geschrieben habe. Ich denke, das könnte helfen.«
Leonard schlug die Mappe auf und blätterte die fotokopierten Seiten durch. Als er sah, wie viele Notizen Susanne gemacht hatte, wurden seine Augen groß. »Wie hast du das so schnell kapiert?«
»Man darf sich nicht von den Fremdwörtern einschüchtern lassen«, erklärte Susanne. »Dann geht es schon.«
»Ich hab nicht mal annähernd begriffen, worum es geht.«
»Guck’s dir einfach noch mal an! So schwierig ist es nicht.«
Zweifelnd starrte Leonard auf seine Unterlagen. »Falls ich bei der Hausarbeit Hilfe brauche …«, begann er dann zögernd.
Susanne grinste ihn an. Sie ahnte, worauf er hinauswollte. »Solange du dafür Näharbeiten übernimmst, helfe ich dir sehr gerne.« Sie musste zugeben, dass sie Blut geleckt hatte. Die Gelegenheit, tiefer in das Thema einzusteigen, ergriff sie nur zu gerne.
Jetzt grinste auch ihr Bruder. »Abgemacht«, sagte er.
Kapitel 2
Laut hallte der Gong durch die kaufmännische Berufsschule. Susanne atmete auf. Mitunter fand sie den Stoff wirklich langweilig. Trotzdem lag ihr etwas daran, die Ausbildung zu machen und am Ende ein Zeugnis in Händen zu halten, das sie offiziell befähigte, die Schneiderei zu übernehmen. Auch wenn ihre Praxiserfahrung dafür vermutlich längst ausgereicht hätte, sie half schließlich seit Jahren im Familienbetrieb mit. Manchmal hätte sie gern ihren Kopf für anspruchsvollere Herausforderungen eingesetzt – beispielsweise um juristische Formulierungen zu entschlüsseln, so wie ihr Zwillingsbruder es durfte. Zu studieren hätte sie weitaus mehr gereizt als ihn. Aber das Leben war nun mal, wie es war. Leider.
»Puh, geschafft!« Das Mädchen neben ihr stand auf und warf sich die Umhängetasche über die Schulter. Sie trug modische Plateauschuhe zu einer Schlaghose und dazu ein knallgelbes Oberteil. »Tschüss, Sanne, bis nächste Woche!«
»Tschüss, Anita!« Sie winkte kurz und folgte ihr dann zum Ausgang. Während viele Berufsschüler zur nahe gelegenen Bushaltestelle strömten, weil sie im Umland wohnten, lief Susanne zu ihrem Fahrrad. Sie selbst hatte es zum Glück nicht weit und musste sich nicht in den stickigen Bus drängen, um nach Hause zu kommen.
Die Aprilsonne war überraschend warm, das Wetter fast schon frühsommerlich. Susanne nutzte den Zwischenstopp beim Lebensmittelladen, um ihre Jacke in den Fahrradkorb zu stopfen. In den nächsten fünf Minuten würde hoffentlich kein Dieb vorbeikommen, um die Jacke zu stehlen. Ihre Mutter hatte sie gebeten, Milch und Eier mitzubringen. Spontan packte Susanne noch ein paar Bananen dazu, die gerade im Angebot waren. Dafür reichte ihr Geld noch. Auf dem Tübinger Wochenmarkt, wo sie sonst Gemüse und Obst kauften, gab es nämlich keine Bananen.
Die Groschen vom Wechselgeld schob sie in die Hosentasche – eine Angewohnheit aus ihrer Kindheit, als sie damit sämtliche Kaugummiautomaten im Umkreis geplündert hatte. Leonard neckte sie manchmal, weil sie die bunten Kugeln auch heute noch so unwiderstehlich fand.
Vergnügt vor sich hin summend überquerte sie wenig später die breite Neckarbrücke. Spaziergänger bevölkerten die Platanenallee, ein Grüppchen Touristen schoss Fotos vom Hölderlinturm. Am Ufer scheuchte ein Hund eine Ente auf, die sich empört schnatternd ins Wasser rettete. In der Ferne war der Umriss eines Stocherkahns zu sehen.
Susanne bog links in die Neckargasse ein, bremste, stieg ab, um beim Bäcker noch schnell ein frisches Mischbrot zu kaufen, und schob das Rad schließlich bis zur Fliedergasse. In dem winzigen Hof hinter der Schneiderei stellte sie es ab. Hier fiel kaum je ein Sonnenstrahl auf den Boden, die Häuser in der Altstadt standen dafür einfach zu dicht. Zwischen den hohen Mauern war es dämmrig und kühl, und im Holzverschlag neben der Mülltonne war gerade mal Platz für den alten Bollerwagen und die Fahrräder. Leonards Rad fehlte, sicher war er noch an der Uni oder mit Kommilitonen unterwegs.
Vor dem Haus war es heller. Die Blüten des mächtigen alten Fliederbuschs, dem die kleine Gasse ihren Namen verdankte, verströmten einen betörenden Duft. Durch den Torbogen, über den der Flieder seine Äste streckte, führten einige krumme Steinstufen hinunter zur Neckarmauer.
Bepackt mit ihren Einkäufen trat Susanne durch die Ladentür. Der schwere Vorhang der Anprobekabine war zugezogen. Ihre Mutter blickte heraus, den Mund voller Stecknadeln, und nickte ihr wortlos zu. Susanne fiel wieder ein, dass Frau Allgaier heute einen Termin hatte – eine Kundin, die ihre Kleidung meist über den Versandhandel kaufte, weil das angeblich billiger war, aber sie dann stets zum Abändern brachte, weil sie nicht richtig passte. Schmunzelnd stieg Susanne die Treppe ins Obergeschoss hinauf. Solange sie mit dem Auslassen von Hosen- und Mantelsäumen oder dem Kürzen von Blusenärmeln Geld verdienten, war Frau Allgaier jederzeit willkommen. Immerhin kam sie recht regelmäßig mit solchen Aufträgen vorbei.
Susanne räumte Milch und Eier in den Kühlschrank und schnappte sich eine der Bananen. Eine kleine Stärkung, bevor sie die restliche Zeit bis zum Ladenschluss um achtzehn Uhr im Geschäft verbrachte, hatte sie sich verdient. Auf dem Küchentisch lag ein Stapel Post und das Schwäbische Tagblatt. Nichts davon hatte ihre Mutter genauer angesehen – gut möglich, dass sie über Mittag gar keine Pause gemacht, sondern genäht hatte. So hielt sie es oft, wenn sie allein war.
Seufzend warf Susanne die Bananenschale in den Müll unter der Spüle. Während sie kaute, sah sie sich die Absender auf den Umschlägen an: Ein Schreiben von der Stadt, die Telefonrechnung, und dann war da noch eine Urlaubskarte aus Italien von ihrer Tante. Die ließ es sich gut gehen, seit sie verwitwet war und ihr Haus verkauft hatte. Susanne betrachtete das Motiv – ein Foto von der Insel Capri – und legte die Karte zurück auf den Stapel. Der Behördenbrief interessierte sie mehr. Was mochte die Stadtverwaltung wollen? Irgendwelche Gebühren erheben?
Sie setzte bereits an, den Umschlag aufzureißen, überlegte es sich dann aber doch anders. Der Brief war an ihre Mutter adressiert. Sie hatten zwar keine Geheimnisse voreinander, aber es war sicher trotzdem besser, wenn sie ihn selbst öffnete. Da musste Susanne ihre Neugier eben bis zum Abend bezähmen …
Leonard tauchte zum Abendessen auf, wirkte müde, gleichzeitig angespannt und verschwand direkt danach in seinem Zimmer unterm Dach. »Ich muss lernen«, behauptete er.
Susanne hatte den Verdacht, dass er sich nur vorm Spülen drücken wollte, aber irgendwie tat er ihr auch leid.
»Hast du die Post inzwischen angeschaut?«, fragte sie ihre Mutter, während sie einen Teller abtrocknete.
»Nein.«
Susanne wunderte sich über den Gesichtsausdruck ihrer Mutter. Warum presste sie die Lippen so fest zusammen, dass sie beinahe weiß wurden? »Auch nicht den Brief von der Stadt?«
»Ich kann mir schon denken, was drinsteht«, murmelte ihre Mutter.
Susanne ließ das Geschirrtuch sinken. »Was denn?«
»Es geht sicher um die Altstadtsanierung.«
»Und betrifft uns die?« Das Thema war für Susanne nicht neu. Schon seit Jahren wurde darüber öffentlich diskutiert, und in Teilen der Altstadt fanden bereits Restaurierungsarbeiten statt, es wurden Häuser eingerüstet, das Straßenpflaster ausgebessert und stillgelegte Brunnen wieder zugänglich gemacht und in Betrieb genommen. Eigentlich fand Susanne den Plan gut, das historische Stadtbild zu erhalten. Es gab etliche verwahrloste Ecken, die nicht sonderlich hübsch anzusehen waren. »Ich dachte, es wären vorerst nur drei Sanierungsbereiche ausgewählt worden. Da ist unser Haus doch nicht dabei, oder?«
»Es betrifft die gesamte Altstadt«, sagte ihre Mutter, die Augen dunkel vor Sorge. »Viele Nachbarhäuser gelten inzwischen als Kulturdenkmal, weil sie mit ihren Mauern Teil der ehemaligen Stadtbefestigung sind. Es wurden ja sämtliche Gebäude von Experten begutachtet. Kannst du dich nicht mehr an den Besuch dieser Leute erinnern?«
Susanne musste in ihrem Gedächtnis kramen. Im letzten Jahr, als sie fürs Abitur gelernt hatte, war die Schneiderei einmal geschlossen gewesen, um die Bausubstanz zu überprüfen. Sie hatte sich nichts weiter dabei gedacht. »Aber unser Haus ist nicht aus dem Mittelalter …«
»Doch, im Kern schon.« Ihre Mutter schlug verzweifelt die Hände vors Gesicht. »Die Fachwerkfassade und der Giebel sind zwar erst später entstanden, aber sie haben unser Haus trotzdem als erhaltenswertes Gebäude eingestuft. Nun sollen im Rahmen der Sanierung Maßnahmen stattfinden, um …« Sie stockte. »Ach, ganz egal wofür, wir können uns das eh nicht leisten.«
Allmählich ahnte Susanne, dass das womöglich nicht der erste Brief der Stadtverwaltung gewesen war. Ihre Mutter neigte dazu, den Kopf in den Sand zu stecken, wenn sie mit etwas überfordert war, und finanzielle Angelegenheiten waren ihr ein Graus.
»Mama?«, fragte sie alarmiert. »Hast du deswegen etwa schon vorher Post bekommen?«
Ihre Mutter nickte kläglich. »Die Briefe liegen da in der Schublade. Auf den ersten habe ich noch geantwortet und geschrieben, dass wir nicht genug Geld haben, um den Dachgiebel fachgerecht zu erneuern und alle Fassadenelemente, die sie aufgezählt haben. Die Fensterumrahmungen mit den Klappläden, das Dachgesims, die Markise vor dem Schaufenster … Ich weiß gar nicht mehr, was die da alles aufgelistet haben. Jedenfalls war das schlicht unmöglich. Und daran hat sich nichts geändert. Es ist nicht zu bezahlen.«
Das hörte sich nach einem größeren Problem an.
»Ich mache jetzt den Brief auf, dann wissen wir wenigstens, was drinsteht, okay?« Susanne warf das Geschirrtuch auf die Anrichte und öffnete die Schublade der Kommode. Fein säuberlich von einem Gummiband gehalten, lag dort ein Stapel Briefe. Sie zog den obersten heraus und riss den Umschlag auf.
Nachdem sie den Inhalt rasch überflogen hatte, blickte sie ihre Mutter an. »Du hattest recht. Es ist die Aufforderung, den Giebel und die Fassade zu sanieren. Sie schreiben, Hauseigentümer, die dieser Aufforderung nicht nachkommen, müssen mit einer Geldstrafe rechnen.«
»Hoffnungslos, wie ich schon gesagt habe. Sie können oder wollen unsere Lage nicht verstehen.« Ihre Mutter hob den Kopf, in ihren Augen schimmerten Tränen der Erschöpfung. »Ich beschwere mich nicht über zu viel Arbeit. Wenn es sein muss, nähe ich bis tief in die Nacht hinein! Aber heutzutage kaufen die Menschen ihre Kleidung in Modehäusern und Boutiquen, sie gehen nicht mehr oft zum Schneider. Das war früher, als deine Großeltern das Geschäft hatten, noch anders. Heute wirft es gerade genug zum Leben ab.«
»Ja, ich weiß. Das musst du mir nicht erzählen.« Susanne kümmerte sich nicht erst seit gestern um die Buchhaltung, sie wusste Bescheid.
»Dann muss ich dir ja auch nicht erzählen, dass wir keine Rücklagen haben, um diese Sanierung zu bezahlen.«
»Aber es muss einen Weg geben!« Susanne schob den Brief in den Umschlag zurück. »Wir sind doch ganz sicher nicht die einzigen Hauseigentümer, die keine Million auf dem Konto haben. Die kleinen Läden ringsherum werfen alle keinen so großen Gewinn ab, da bin ich mir sicher. Auch die Leute, die Zimmer an Studenten vermieten, werden damit ja nicht reich, oder? Dafür sind die alten Häuser doch viel zu mickrig.«
Ein bisschen ratlos war sie jetzt schon, wie sie dieses Problem bewältigen sollten, zumal die Zeit nun drängte – andererseits hatte sie sich ja auch noch gar nicht eingehend damit beschäftigt, eine Lösung zu finden.
»Warum hast du mir davon denn nicht schon früher erzählt?«, fragte sie, während sie zurück zur Spüle ging, um den Topf aus dem Spülwasser zu ziehen. »Ich bin kein kleines Kind mehr und Leo auch nicht. Du hättest uns das sagen müssen!«
»Tut mir leid.« Die Stimme ihrer Mutter zitterte. »Ich hab einfach gehofft, dass ich die Angelegenheit lange genug aufschieben kann.«
»Du meinst, bis Leo mit dem Studium fertig ist?« Der Gedanke ließ Susanne kurz innehalten. Vielleicht war das sogar eine Möglichkeit.
»Aus meinem eigenen Haus werfen lasse ich mich jedenfalls nicht«, sagte ihre Mutter. »Und sie können uns auch nicht zwingen, das Haus zu verkaufen. Das kommt gar nicht in Frage!«
Das sah Susanne genauso. Ihr Vater würde sich im Grab umdrehen, wenn es dazu käme. Das Haus mit der Schneiderei gehörte ihnen, niemand sonst hatte ein Recht darauf.
»Ich mache mich schlau«, versprach sie. »Irgendeine Lösung muss es ja geben, das wird schon! Wir sind doch nicht die einzigen Altstadtbewohner, denen es so geht. Vielleicht ist diese Geldstrafe überhaupt nicht rechtens. Eigentlich brauchen wir einen Anwalt, der sich das mal anschaut.«
»Wir haben kein Geld für einen Anwalt«, sagte ihre Mutter. »Und dein Bruder hat noch nicht lange genug studiert, um sich darum zu kümmern.«
Das stimmte, aber die Erwähnung von Leonard brachte Susanne auf eine Idee. »Wir machen uns schlau«, wiederholte sie und beeilte sich, mit dem Abwasch fertig zu werden.
Als endlich der letzte Teller abgetrocknet und wieder in den Schrank geräumt war, lief sie mit dem Brief in der Hand schnurstracks zu Leonards Zimmer. Rockmusik drang durch die Tür, und Susanne musste sich anstrengen, den Song von Smokie mit ihrem Klopfen zu übertönen.
»Leo, mach auf!«, rief sie.
Sie hörte es rumpeln, dann öffnete sich die Tür. »Was denn?«, murrte er.
»Ich komme morgen mit dir zur Uni. Wir müssen in die Bibliothek und da etwas rausfinden.«
Kapitel 3
Die Juristische Fakultät verfügte über eine eigene Fachbereichsbibliothek, und so hatten sich Susanne und Leonard um die Mittagszeit vor der sogenannten Neuen Aula verabredet. Aus dem eindrucksvollen Portal mit den mächtigen Säulen ergoss sich ein Strom von Studenten. Die Seminare und Vorlesungen waren gerade zu Ende gegangen, und die meisten wollten vermutlich in der nahe gelegenen Mensa etwas essen. Einen Moment lang blieb Susanne vor den Stufen des Eingangs stehen und blickte zum darüberliegenden Balkon hinauf. Wie viele Räume gab es wohl in diesem historischen Gebäude mit seinen gewaltigen Seitenflügeln? Der Anblick flößte ihr jedenfalls Respekt ein.
»Wartest du schon lange?« Leonard stupste sie von der Seite an. »Wenn man dich für eine Studentin halten soll, dann mach lieber den Mund zu.« Er klang amüsiert.
Ertappt senkte Susanne den Blick. Sie war hier, weil sie Informationen brauchten. Ihre Familie mochte sich zwar keinen Anwalt leisten können, aber immerhin studierte Leonard Jura. Wenn sie wissen wollten, ob es überhaupt rechtens war, dass die Stadt Tübingen sie zur Renovierung der Außenfassade ihres Hauses zwang, dann konnten sie das auch selbst herausfinden.
»Komm, gehen wir rein!« Susanne folgte ihrem Bruder die Stufen hinauf und ins Foyer.
Leonard lotste sie durch die scheinbar endlos langen Gänge im Inneren des Gebäudes und blieb, noch ehe sie die Bibliothek erreichten, unvermittelt stehen.
»Mist«, zischte er.
»Was ist los?« Susanne spähte über seine Schulter nach vorne in den Gang. Dort näherten sich drei junge Männer.
»Leonhart!«, tönte der Erste. Wie die beiden anderen trug er ein Hemd mit Krawatte und einen albernen Seitenscheitel. Bei Susannes Anblick pfiff er durch die Zähne. »Na, wen haben wir denn da? Du hast gar nicht erwähnt, dass es eine zweite Version von dir gibt, Leonhart. Und eine viel hübschere noch dazu! Ehrlich, wie konntest du uns das nur verschweigen?«
»Meine Schwester hat mich abgeholt«, sagte Leonard kühl und wandte sich zu Susanne um. »Wir wollten gerade gehen.«
»Wie schade.« Der Anführer schenkte Susanne ein Lächeln, aber es wirkte verschlagen.
Sie widersprach nicht, als Leonard sie wortlos an den Wandgemälden vorbei zur Treppe zog. Das Lachen des Trios schallte ihnen hinterher.
»Was waren das bitte für Idioten?«, fragte Susanne erst, als sie wieder auf dem Platz vor der Neuen Aula standen.
»Burschenschaftler«, sagte Leonard grimmig. »Bringt nichts, sich mit denen anzulegen.«
»Studierst du mit denen zusammen?«
»Leider ja.«
»Und dann weiß der Typ nicht mal, wie du richtig heißt?«
»Ulrich weiß genau, wie ich heiße«, sagte Leonard. »Aber ohne H ist ihm mein Name nicht deutsch genug. So ticken diese Typen eben.«
Susanne begriff. Bisher hatte sie nichts mit den Studenten zu tun gehabt, die in den Verbindungshäusern auf dem Österberg wohnten. Sie wusste nur, dass sie beim Maisingen alljährlich für Aufruhr in der Innenstadt sorgten, wenn sie mit ihren Uniformen und Fackeln aufzogen und dabei von der Polizei eskortiert werden mussten. Das Spektakel zog von Jahr zu Jahr mehr Gegendemonstranten an, die mit Musik und lauten Pfiffen den grölenden Gesang der Burschenschaftler übertönten.