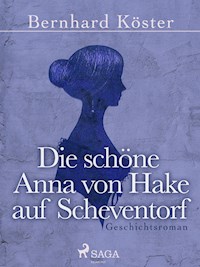
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Geschichtsroman befasst sich mit der Sage um die Schöne Anna von Hake, die während des Dreißigjährigen Krieges wegen einer nicht standesgemäßen Liaison lebendig in der Burg Scheventorf eingemauert worden sein soll. Anna von Hake soll im 17. Jahrhundert einen Förster oder einen Knecht geliebt haben.-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 324
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Bernhard Köster
Die schöne Anna von Hake auf Scheventorf
Saga
Zur Person:
Schwarz wie sein bodenlanger Talar war auch die Tinte, mit der er seine Predigten und Bücher schrieb, und drum fiel es nicht weiter auf, wenn er eine in die Schreibfeder geratene Fussel mit einem Ratsch über die breite Seite seines Gewandes entfernte. Die unbeirrbare Versenkung in sein Werk am Altar, auf der Kanzel und an seinem Stehpult bekam der zu spüren, der da nicht mittat; er kriegte eins über die Finger, hörte es laut und deutlich oder hatte es schwarz auf weiß.
Aufrecht war seine Haltung, sogar auf dem Fahrrad unterwegs in seiner Gemeinde, im Beichtstuhl und selbst am Eßtisch, wenn Maruschka, die humorvolle polnische Haushälterin, für das leibliche Wohl treu sorgte mit ihrer Kunst der Küche, die gerühmt ward und weite Kreise zog, hin und wieder sogar den Bischof aus dem fernen Osnabrück an die gastliche Tafel des Pastorats nach Glandorf. Aber auch Bettler und Zigeuner taten sich dort gütlich. So erfuhr Pastor Bernhard Köster, weil nur geistlicher Rat und deshalb der Zigeunersprache nicht kundig, an der Quelle eines Zigeunermundes, was das heißt: er ist gekocht, nicht Krebse oder der Hahn im Suppentopf, sondern einer in der Geschichte der Schönen Anna, doch lesen Sie es selbst!
Aber mit dem Duft von solchermaßen Gutgekochtem begnügte er sich nicht, nein, auch den Duft der großen weiten Welt lernte dieser abenteuerliche Mann im schwarzen Rock schon kennen um neunzehnhundertzehn, indem er betteln ging. Durch ganz Europa, von Hof zu Hof, von Banken zu Kardinalspalästen und so fort. Warum? Nun, um Spenden für das Krankenhaus in Lübeck, doch das führt jetzt weit, wie seine Reisen damals auch, zu weit hier. Drum lesen Sie es und vieles mehr in dem guten Buch von Dr. Riese über die „Glandorfer Gestalten“.
Vielleicht ahnen Sie dann, was meine Großmutter – Gott hab sie selig – schon vor vielen Jahren meinte mit den Worten: Wenn der Onkel nicht ein guter Pastor geworden wäre, hätten wir heute einen großen Gauner in der Familie.
Waren die Zigarern, die guten, einmal am Ende, so packte er in seine weiten und tiefen Gesäßtaschen einige Stücke Speck, fuhr nach Osnabrück der Zigarren wegen, schlug sich dort im Laden hinten drauf und sagte nur ein einziges Wort: Fettigkeiten. Und er bekam in der Kriegszeit Zigarren, sagte dann auch dem Bischof guten Tag, erhielt auch dort ab und an eine Zigarre, blätterte in alten Archiven seiner Heimatgeschichtsforschung wegen und kam zufrieden zurück nach Glandorf.
Ganz ernst soll er den Brautunterricht genommen haben, sagte mir erst kürzlich ein ehemaliger Kandidat, und da riet er trotz der damaligen Tabus und trotz gewisser zölibatär bedingter Gewissenskonflikte durchaus zur Freude und zur Einhaltung der Regel nach Luther.
Als der große Krieg begann, hub er ein sofortiges Beten um ein baldiges Ende an, daheim im stillen Kämmerlein und auch mit seiner Gemeinde, und lauschte gläubig und hoffnungsvoll, wie er ja war, den täglichen englischen Botschaften auf gute Kunde von Radio London. So laut zuweilen, daß es ins Dorf schallte. Saßen wir doch beim Abendmahl auf der Gartenterrasse und stand das Radio am anderen Ende des Hauses in Straßennähe beim offenen Fenster, eilte er erst hinüber beim Dröhnen des englischen Big Ben. Aber es ist ihm nichts passiert.
Das erflehte Ende hat er nicht erlebt; denn am 23. Juni 1944 raffte diesen Mann des starken Willens und des guten Geistes voller Liebe eine schwere Krankheit im Alter von 75 Jahren dahin.
Als der Bischof am Sterbelager zum Segen seine Hände erhob, raunzte der Sterbende die Dabeistehenden an: „Knien!“ Und sie gingen alle in die Knie. Entschlafen ist er gegen vier Uhr nachmittags, in Frieden. –
Es ist in seinem Sinn, wenn wir nach 33 Jahren heute Dr. Riese danken für den Anstoß und die Hilfe zur Neuauflage des Werks, Frau Isolde Köhler sagen, wie einfühlsam und gelungen ihre Zeichnungen sind, und den Verleger und die Buchdrucker loben für Wagemut und Kunst.
Stuttgart, den 6. Februar 1977
Dr. Hermann Schomaker
Zum Buch:
Bernhard Köster schrieb in seiner Glandorfer Zeit 14 Erzählungen und Romane. Das Buch von der schönen Anna von Hake auf Scheventorf führt uns in die finstere Zeit des 16. Jahrhunderts. Wiedertäufertum, Glaubenskämpfe, Religionskriege, Hexenwahn mit Folterungen und Verbrennungen, Feuersbrünste und Seuchen kennzeichnen diese Epoche. Auf den vielen kleinen Rittersitzen und Burgmannshöfen des Osnabrücker Landes herrschte gefährliches Leben und Treiben. Die einen hielten zum Fürstbischof, die anderen zur Stadt Osnabrück. Rauflustige schlossen sich bekannten Räuberbanden an, zum Beispiel Cord Grodhus und dem berüchtigten Seißenbernd. Nur wenige kämpften für sich allein um Geld und Rittergut. Der Verfall des Lehnswesens und des Rittertums kündigte sich an. Miguel de Cervantes karikierte mit seinem Roman „Don Quijote“, dem Ritter von der traurigen Gestalt, das nicht mehr edle Rittertum und ließ die böse Zukunft erahnen.
Es kann nicht verwundern, daß in jenen Kriegszeiten, in denen die Männer auszogen, um zu rauben, zu plündern, zu brandschatzen und zu morden, Sitte und Anstand in Städten und Dörfern, Gehöften und Burgen in Verfall gerieten. Wurden Fälle von Untreue oder Fehltritten ritterlicher Frauen oder Mädchen ruchbar, so waren Strafen oder Rache entsprechend mittelalterlich und grausam. Ein Verhältnis mit einem nicht ebenbürtigen Mann wurde nicht selten durch die Familie mit dem Tode bestraft. Auf manchen Burgen und Rittersitzen wurden „gefallene“ Frauen oder Mädchen vom Leben zum Tode gebracht. Daß hier noch Zusammenhänge mit germanischen Rechtsgepflogenheiten bestehen, glaube ich nicht. Eher dürften Tötungen von Frauen durch die eigene Familie ihre Ursache in überbewerteter Ritterehre und verletztem Männerstolz haben.
Anna von Hake ist eine geschichtliche Persönlichkeit und hat im 16. Jahrhundert auf Scheventorf gelebt. 1858 fand man in einem zugemauerten Kellergewölbe Reste von morschen Knochen und Holz. Seither heißt dieses Gewölbe „Annekenloch“. Bei meinem letzten Besuch auf Scheventorf diente es als Runkelkeller. Ob Anna von Hake von ihrem Vater, Bruder oder Schwager zum Tode gebracht wurde, darüber geben Urkunden keine Auskunft. Es stand darum Bernhard Köster durchaus frei, sich für seinen Roman seine eigene Version auszusuchen.
Die Wasserburg Scheventorf liegt an der B 51, etwa einen Kilometer südlich der Iburg, am Fuße des Teutoburger Waldes. Ihre Gräften reichten dereinst an die Allee, die von Iburg nach Glandorf führte. In dem großen Mühlenteich westlich der Burg lag auf einer nur über einen schmalen Pfad zu erreichenden Insel ein Hausgarten. Das noch stehende Herrenhaus stammt aus dem Jahre 1552 und ist zugleich das älteste Fachwerkgebäude des Osnabrücker Landes. Einen besonders malerischen, mittelalterlichen Eindruck erweckt der auf drei steinernen Säulen ruhende Fachwerkbau (Taubenhaus) in der Ecke am Gefangenenturm, dessen Füllbretter im Obergeschoß die Jahreszahl 1578 aufweisen. Aus jener Zeit dürften auch noch das eingemauerte Wappen des Bistums Osnabrück, der große, steinerne Löwe auf der Hofmauer am Eingang zur Burg sowie im Innern das reichverzierte Treppengeländer sowie Türen, Wandschränke und die dicken Eichenpfosten und die eichenen Unterzüge stammen. Die Burg Scheventorf war ein Burgmannssitz der Iburg. Urkundlich war sie seit 1252 im Besitz der Familie Scevincdorpe. Das Geschlecht derer von Hake ist urkundlich seit 1225 im Osnabrücker Lande nachweisbar, kommt im 14. Jahrhundert als alteingesessene Iburger Burgmannsfamilie in den Besitz der Burg Scheventorf und machte sich im Osnabrücker Land rümlich und unrühmlich bemerkbar, bis es 1633 im Mannesstamm erlosch. Agnes Josina von Hake heiratete den schwedischen Oberstleutnant Bernhard Jakob von Henderson. Für einige Jahre fiel die Burg Scheventorf sodann an den Osnabrücker Hofmarschall Christoph von Hammerstein, der sie dem Bischof von Osnabrück gegen das Tafelgut Gesmold überließ. Seit 1664 verblieb das Wasserschloß im Besitz der Osnabrücker Fürstbischöfe. 1803 wurde Scheventorf durch Säkularisation Staatsdomäne und ist seither verpachtet.
Bernhard Köster waren selbstverständlich auch die Verhältnisse auf den Nachbarburgen bekannt. Alle bis dahin erschienenen Bände der „Osnabrücker Mitteilungen“ hatte er studiert. Vom Volksmund und von Überlieferungen her wußte er von dem Räubergeschlecht der Untkemänner in Knetterhausen bei Versmold, welche dort hinter den Wäldern und Knetterhäuser Dünen Kaufleuten und Reisenden auflauerten, die über den Tatenhausener Weg ihre Waren transportierten oder die Reiseroute Osnabrück-Ravensberg benutzten. Auf ihren Raubzügen kamen die Untkemänner auch in die benachbarten Dörfer Füchtorf, Milte, Glandorf und Laer. Sie bestahlen besonders die größeren Bauern und die Geistlichkeit. Erst 1923 wurden sie von einer vereinigten Kohorte von Landgendarmen und Förstern endgültig ausgehoben.
Bernhard Kösters Sprache ist derb und deutlich, kurz und bündig. Man könnte sogar, wie es J. Boesch anläßlich der zweiten Auflage dieses Buches getan hat, von einem eigenen „Köster-Stil“ sprechen. Köster ist ein Meister der kurzen Ausdrucksweise. Wo andere einen Satz gebrauchen, nimmt er ein Wort oder eine Silbe. Kräftige Satzwendungen liegen ihm besonders. Dieser Stil ist zwar etwas rauh, aber er paßte zum Mittelalter und zu Räubergeschichten.
Dank gebührt Hermann Schomaker und dem Verlag Krimphoff, daß sie vielen Verehrern von Bernhard Köster und den Freunden heimischer Literatur mit der Neuauflage dieses einzigen historischen Romans des Südosnabrücker Landes eine echte Freude bereitet haben. Darüber hinaus wünsche ich diesem Buch viele neue Leser und Freunde; denn dadurch würden Herausgeber und Verlag in die Lage versetzt, weitere Köster-Bücher neu auszustatten und aufzulegen.
Füchtorf, den 22. Februar 1977
Dr. Riese
1.
Auf Scheventorf war heute mancherlei Besuch. Darum war auch den ganzen Tag die Zugbrücke heruntergelassen, und auf dem Burgfried flatterte die Fahne mit den Scheventorfer Farben. Im Schloßhof war buntes Leben. Das kam von den vielen Kindern, die sich allmählich über die Zugbrücke geschlichen hatten. Sonst durften sie niemals über das Wasser, aber nun heute – o wie fein! – Die Brücke war immer heruntergelassen, und man konnte ganz nach Belieben hin- und herlaufen. Schön war es, die Pferde zu besehen, im Hof und im Stall; einige hatten noch die bunten Schabracken aufliegen. Freilich, den Reitknechten mit ihrem Brustharnisch und den Beinschienen durfte man nicht zu nahe kommen, wenn sie aus dem Teiche Wasser holten. Denn die schrien und fluchten fürchterlich und hauten mit ihren eisernen Fäusten so schrecklich grob zu, daß man meinte, der Kopf flöge einem auseinander.
„Jetzt, du, guck mal dahin, aus der Burg da, der Ritter mit den wallenden Federn, ist das der Harkotten?“
„Ist doch nicht der Harkotten, ist doch unser eigener; hast unsern Ritter von Hake noch nie gesehen?“
„Oh, wie du lügst, hab’ ich nicht neulich erst Ritter Hake vor der Kirche in Glane gesehen? Und da – – –“
„Und da lügst du jetzt, das war er ja gar nicht, das war ja der Herr von der Krankenburg.“
„Still doch! Was ruft der Kerl da?“
Der Kerl war wirklich der Ritter Harbort von Hake und bestellte dem Nesselroder Reiter, daß er die Pferde wieder absatteln sollte, weil sein Herr lange noch nicht reiten könne, und die Zugbrücke sollte sofort herauf! – Damit ging er wieder in die Burg zurück.
Der Nesselroder hatte seine Pferde mit großer Sorgfalt gezäumt und gesattelt. Er schimpfte und brummte also, daß nun die ganze schöne Arbeit für nichts gewesen sein sollte. Was wußte auch dieser grobe, einfältige Tölpel von den wichtigen Dingen, die die großen Herren jetzt in den Kopf zu nehmen hatten. O weh, was glühten die Gesichter da oben im Saal der Scheventorfer Wasserburg. Das kam von den eifrigen Beratungen. – „Ach was“, sagten die Reitknechte, „das Glühen kommt bloß von all dem Burgunder und Tokaier, den sie da oben pokulieren.“
Aber die Reitknechte hätten bloß hören sollen, wie sie da oben durcheinander schrien und berieten. Es war gerade der Spanisch-Niederländische Krieg in vollem Gange, und hier im Osnabrükker Lande, so nahe der holländischen Grenze, verging doch kein Tag in den letzten Jahren, wo man sich nicht einen neuen Unfug, Raubzug oder Spuk erzählte. An einem Ort hatten die Spanier geplündert, am andern die Holländer, man nannte sie auch wohl die Statischen, auch wohl die Geusen, und wieder an andern Orten hatten einfach bewaffnete Räuberbanden ganz grausamlich gehaust. Vor Bewaffneten hatten die Bauern solchen Schrecken, daß ihrer zwanzig feldein stürmten, wenn sich ein Harnisch oder eine Kriegslanze sehen ließ.
„Es ist weit gekommen mit unserer lieben Heimat“, sagte Herr Korff-Schmising von Harkotten, „unsere Dörfer sehen entsetzlich aus. Glandorf zum Beispiel ist kürzlich wieder einmal gründlich geplündert, und zwar diesmal von sechzig Engländern, die aber freilich im Solde der Generalstaaten waren; und dabei ist es vor zwei Jahren noch von den Statischen bis auf den letzten Faden ausgeraubt worden. Ähnlich in Laer. Nach Füchtorf kommen sie auch, aber meist nachts und ganz rasch; werden doch wohl Respekt haben vor unseren Reisigen. Die Angst der Menschheit ist so entsetzlich, daß sie fliehen und sich verstecken, sobald sie irgendein fremdes Gesicht sehen. Ja, Ihr mögt es glauben oder nicht: Ich habe heute, als ich mit meinen Knechten über Glandorf hierher ritt, auf dem ganzen weiten Weg auch nicht ein einziges menschliches Wesen zu Gesicht bekommen; Krähen und Kaninchen wohl, auch einen Hasen, aber Menschengesichter? Nicht ein einziges!“
„Kommt alles nur von den aberwitzigen Religionsstreitereien. Die Spanier sind nun einmal so schrecklich katholisch“, sagte der dicke Kerstapel von der nahen Schleppenburg und dehnte sich dabei behaglich in einem breiten Polstersessel am Kamin; „wenn die Mynheers bloß von ihrem reformierten Glauben lassen wollten; aber das tun die Dickköpfe auch nicht. Wären sie nur alle so vernünftig wie ich und der Harbort.“
Dabei schlug er dem Ritter von Hake, der neben ihm saß, mit der fleischigen Rechten auf den Oberschenkel.
„Was haben wir gemacht? Wir haben unsere Federfuchser zum Fürstbischof geschickt, er solle uns in Glane neben dem katholischen Pater auch einen lutherischen Prädikanten verstatten!“
„Was ist das?“ fuhr der Nesselroder von Palsterkamp auf, „wollt Ihr zwei lutherisch werden?“
Auch Korff-Schmising sah starr auf den Schleppenburger: „Ich meinte, euer Klosterpater in Glane wäre ein so umgänglicher und feiner Mann? Ist doch der Herr von Kneheim?“
„Ach was, Kloster hin, Kloster her; wenn die Papen mir nicht einmal in der Ostenfelder Mark meine Gerechtigkeit zukommen lassen wollen, dann mag sie mitsamt dem Prior und dem Abt und dem Kellner der Teufel holen! Ich halte es damit, zwei Eisen im Feuer zu haben! Harbort, ich bring’ dir’s!“
Harbort von Hake sah ihn freundlich an und tat ihm Bescheid, sagte aber nichts von seiner Zwei-Eisen-Theorie.
„Wie habt Ihr’s denn, Freund Hake?“ fragte der Nesselroder, „tragt Ihr auch auf zwei Schultern?“
Ritter von Hake lenkte ab: „Ich meine, das ist jetzt nicht unsere dringendste Sorge; das können wir auf später vertagen. Heute sind wir hier zusammen, um zu beraten, wie wir uns und unsere Leute und unsere Burgen gegen das Raubgesindel schützen. Habt Ihr das Neueste schon gehört? Auf der Burg Wolbeck sind zwölf Landzwinger eingebracht, die hatten bei Ostbevern dreizehn Osnabrücker Pferde geraubt und beim Kloster Rengering zwei Iburger Bürger ausgeplündert und halbtot geschlagen. Jetzt hat sie der münstersche Fürst.“
„Herr Gott im Himmel“, schnaufte der Kerstapel dazwischen, „jeden Tag neue Raubstücke, und dann die ‚wilden Geusen‘.“
„Ja, ja, also der Münstersche hat die Frevelanten unserm Fürsten hinführen lassen, und der hat sie in Osnabrück mit goldenen Ketten aufgehängt.“
„Eiserne hätten’s auch getan“, sagte der Schleppenburger. – „Also was nun?“
Korff-Schmising riet: „Vor allem muß jeder von uns seine Knechte und alle seine Gewaffen Nacht und Tag parat halten und muß wissen, daß er zu jeder Stunde seine gesamten umwohnenden Leute rufen kann. Ich bringe vierzig Gewaffnete auf die Beine, sie kennen alle genau meinen Hornruf und auch die Burgglocke.“
Herr Nesselrode von Palsterkamp meinte, in jedem Anfall müßten doch die Ritter und Burgherren sich gegenseitig helfen und benachrichtigen, wenn eine von ihren Burgen überfallen würde. Denn auf den Fürsten und auf Iburg könne man sich nicht verlassen.
Ritter von Hake stimmte ihm lebhaft bei: „Nein, auf Iburg ist wirklich kein Verlaß, da sitzt der Abt mit seinen Benediktinern in dem großmächtigen Gebäu und kann sich selbst nicht mal verteidigen, und dann das Bischofshaus mit dem Bischofsturm dabei – ja, ja, es sind ja schon einige Landsknechte und einige Reuter da, besonders wenn der Fürst hier wohnt. Aber bis sein Drost endlich beredet ist, uns davon etwas zu schicken, sind die Räuberbanden entweder längst auf ihren schnellen Gäulen entflohen, oder wir sind allein mit ihnen fertig geworden, und sie baumeln an unseren Eichen; darum ist Nesselrodes Vorschlag sehr wichtig, Ihr Herren.“
Damit hob er den Pokal und trank dem Palsterkamper kräftig zu. Ritter Harbort von Hake konnte sehr freundlich sein, und heute war er es auch wirklich. – Er war ein stattlicher Mann in den besten Jahren, eigentlich kein geborener Hake, sondern einer von Langen aus der Grafschaft Lingen, ob von Spiek oder von der Kreienburg oder Venhaus oder – nun, man wußte es nicht genau, war ja auch nicht wichtig.
Jedenfalls war Ritter Harbort auf den Nachbarburgen wohlgelitten; und man bedauerte nur, daß seine meistens kränkliche, blasse Frau so gar nicht zu ihm paßte. – wenigstens schien es so nach ihrer stillen, fast ängstlichen Art.
Jetzt eben fragte der von Harkotten ihn: „Wie geht’s Frau Heilwigis?“
Ritter Harbort zog sein Gesicht in bedauernde Falten: „Ach Gott, liebwerter Nachbar, es ist ein Elend. Sie liegt in letzter Zeit oft zu Bette und ist immer am Klagen, wenn man sie besucht.“
„Gesunde Weiber sind eine nützliche Sache auf der Burg“, behauptete wichtig der Kerstapel; „aber solche Dinge kommen später. Erst laßt uns über die Räuberhülfe zu Ende sprechen. Ich meine, die Kerle sollten beharrlich verfolgt werden. Sie verjagen, genügt in keinem Fall. Und dann sie ohne Ausnahme und ohne Gnade sofort aufhängen, wie’s unser Fürst ja auch macht.“
Viel weiter kam man aber nicht in der Beratung. Nur daß man sich noch gegenseitige schnellste Benachrichtigung und nachdrücklichste Hülfe versprach. Und das war doch alles eigentlich ohne Beratung schon selbstverständlich.
Aber so ging das meist auf Scheventorf, besonders wenn der Kerstapel von Schleppenburg dabei war. Da wurde tapfer pokuliert und nicht minder tapfer getafelt. Harbort Hake machte es seinen Gästen sehr behaglich, und meist war es spät in der Nacht, wenn die Herren Gäste nach Palsterkamp oder Helfern, oder Iburg, Osnabrück, oder Bevern und Harkotten strebten. Es war auch heute nicht anders. Die Herren waren so lebhaft und laut in der Unterhaltung, daß noch niemand an das Nachtessen dachte. Nur Kerstapel hatte ein- oder zweimal erwartend nach, der Saaltür geschaut. Da zogen zwei Diener in schmucker Liverei herein, der eine mit Zinntellern und Bestecken, der andere mit einer mächtigen Schüssel Ochsenzunge.
Kerstapel räusperte sich, schrie „Attention!“ und setzte sich in Positur. Er bekam auch die riesige Platte zuerst und sorgte sich gründlich vor. Nur langsam folgte die eine Schüssel der andern. Man hatte Zeit dazwischen; die Pausen waren leicht auszufüllen, indem man die Becher kreisen ließ. Kerstapel stimmte auch schon einmal ein Soldaten- oder Schelmenlied an.
Ritter Korff fragte besorgt: „Euer Gemahl wird doch nicht durch unser lautes Sprechen gestört?“
„Behüte Gott, Herr Nachbar, Frau Heilwigis liegt eine Stiege höher, ist ja auch nicht krank auf den Tod und kann von uns hier nicht den mindesten Laut hören.“
„Lippold!“ – Das galt dem Mundschenk. – Der stürzte geradezu heran. Man sah, Ritter Harbort hielt auf rasches Folgen.
„Lippold, Malvasier holen, sämtliche Becher neu füllen!“
„Auf die Gesundheit der edlen Burgherrin!“ sagte Korff-Schmising.
„Und die der liebreizenden Frau Juttilde auf Harkotten“, erwiderte Harbort Hake mit großer Höflichkeit.
Indes half Nesselrode mit rauher Kehle seinem Schwiegervater singen. Endlich sang auch Ritter Hake. Bis dann der Harkottener aufstand und heimwärts begehrte. Aber, das war leichter gesagt als ausgeführt. Kerstapel ließ ihn einfach nicht an sich vorbei, und auf der anderen Seite hinderte der hohe Kamin. Also Korff setzte sich wohl oder übel wieder hin. Weiter ging das Zechen und Singen. Gelegentlich eine scharfe Bemerkung über die Domherren, besonders Klaus Bar und Beverförde schienen ihnen nicht zu behagen, gelegentlich auch sehr derbe Witze. Korff und Hake hielten sich aber zurück, nur lachte Ritter Hake aus Herzensgrund mit Kerstapel und Nesselrode.
Endlich kam doch der lange hinausgeschobene Aufbruch. Viel Unruhe und Lärm in der Halle, bis die Ritter mit Brustharnisch und Wehrgehänk versehen waren, Noch mehr Lärm draußen, wo die Landsknechte ihren Herren in die Sättel halfen. Korff sagte noch: „Ich hätte Frau Heilwigis noch aufsuchen wollen, wie mich auch mein Gemahl gebeten hat. Bestellet Ihr doch, Herr Nachbar, unsere guten Wünsche.“
„Das tue ich mit tausend Freuden. Ich hoffe, das nächste Mal begrüßt sie selber Euch im Saal.“
„Walte es Gott!“
Inzwischen war auch Herr Kerstapel reisefertig; nicht in Panzer oder Koller, sondern in ein dickes, warmes Wams gehüllt, auch nicht oben auf Rossesrücken, sondern in einer niedrigen, äußerst behaglichen Sänfte, deren Gebrauch er jedem, der es hören wollte, mit vollen Backen empfahl. Dann verschwand der ganze Menschentrupp über die große Zugbrücke auf die Heerstraße zu, die Osnabrück mit Münster verband. Nur Kerstapels Sänfte schaukelte langsam nach Schleppenburg fort; die Flüche und Scheltworte des ungeduldigen Herrn im Innern der Sänfte verklangen erst allmählich.
Ritter Harbort sah noch aufmerksam zu, wie die Zugbrücke aufgezogen und die Kette gehörig festgemacht wurde, fragte mit hartem Klang in der Stimme, wer die erste Wache hätte, und schlug die Saaltür ohne ein weiteres Wort hinter sich zu. Er warf sich in einen Sessel und brütete mit finsterm Gesicht vor sich hin. Dann holte er sich Wein, weißen und roten, trank mehrere große Pokale in langen Zügen aus, aß auch von dem kalten Wildfleisch auf dem Tisch und wanderte zwischendurch im Saal auf und ab. – Was bewegte den einsamen Mann? Freundliche Gedanken waren es, nach dem mürrischen, verdrossenen Blick zu urteilen, nicht. Mehrfach blieb er auch stehen, starrte mit großen, wilden Augen empor und lauschte. Aber da regte sich nichts.
„Will doch mal nachsehen, ob – nein, Torheit, morgen sehe ich schon alles. Was soll ich nur, damit diese Nacht –“
Wahrhaftig, jetzt ballt er die Faust aufwärts zur Zimmerdecke, knirscht mit den Zähnen, ingrimmig starren seine Augen nach oben. Sein eben noch rotes Gesicht wird aschgrau. – War das noch der ruhige, gesetzte und immer freundliche Ritter Harbort? Ein ganz fremdes, wahrhaft erschreckendes, verzerrtes Männerantlitz starrte da im Saal herum. – Allgemach verloren die Augen das gräßliche Starren, wurden matter. Er stand still auf einem Fleck und starrte vor sich hin. Da wurde der Blick schon wieder stier:
„Was sind das für Tropfen auf den Buchendielen? Ist das – allmächtiger Gott! – ist das – Blut? Satan!!“
Schon kniete er am Fußboden und wischte mit der Handfläche die Tropfen auf, besah sie, lachte laut auf und sah sich ängstlich um. Dann ging er rasch durch eine Seitentür des Saales. Ein paar Augenblicke war alles still, dann sprang er wieder in den Saal, auf die Kerzen zu und löschte sie aus, bis auf eine, die er mitsamt dem wuchtigen kupfernen Leuchter mitnahm, verrammelte die Saaltür mit einem starken Balken und lief wieder durch die Seitentür weg. Der Saal lag finster und totenstill.
2.
Totenstill – das qualvolle Schluchzen der zwei jungen Frauen da oben in der Burg hörte man im Saal nicht.
Was war doch nur auf diesem Scheventorf? – Eng hielten die beiden sich umschlungen, als wollten sie nie voneinander lassen. Aufrecht im Bett saß die eine, und zu ihr beugte sich die zweite, jüngere, und barg ihren Kopf in dem aufgelösten Haargelock der älteren.
„O Anna, nun laß mich! Anna, mir ist so elend, so furchtbar elend, ich kann nicht mehr sitzen!“
Anna gab sie frei, und sie sank wie ohnmächtig in die Kissen. – So leichenblaß lag sie da, die Augen geschlossen, daß man sie für tot halten mochte. Aber plötzlich fuhr sie wieder auf, zuckend vor Pein und innerer Qual:
„O Anna! Anna, hilf mir, gib mir zu trinken! Hat der Pater denn gar kein Mittel?“
Anna hatte so lange vor dem Bett gekniet; mit unendlicher Zärtlichkeit faßte sie die eiskalten Hände der Schwerleidenden und preßte sie an ihre Lippen.
„Heilwig, liebe Heilwig, warte nur, ich gebe dir etwas!“
Sie reichte ihr von der Medizin, die der Pater von der Krankenburg geschickt, etwas Rotwein hatte sie dazu gemischt.
„O wie schrecklich!“ seufzte Heilwig. „Riech doch nur, so etwas kann mir doch nicht gut sein. Wie kann der Pater nur so etwas schicken? Ach, möchtest du nicht morgen zu ihm gehen, um eine andere Latwerge, und zeige ihm doch diese, die unmöglich richtig sein kann! O Anna, o Anna!“ – die junge Frau warf ihre Arme um Annas Hals – „gib mir zu trinken, ich verbrenne vor innerlichen Schmerzen!“
Anna wendete das Gesicht weg, um der Schwester ihren Gram und ihre Tränen zu verbergen, und hantierte am Tisch mit den Gläsern herum.
Nun lag die Kranke wieder wie tot in den Kissen. Anna war allein mit ihren verzweifelten Gedanken. – Ach, wenn doch wenigstens die Wendelburg noch hier wäre! Die war doch treu. „Du hast sie uns weggenommen!“ – drohend ballte sie ihre schmale Hand nach der Zimmerdecke – „du, du!“ – Heiße Tränen ohnmächtiger, hilfloser Wut strömten über ihr Gesicht. „Du – du Scheusal ohne Mitleid, ohne Herz, du Menschenquäler! Du hast uns auch die Goda weggejagt! Du allein! Warum? Weil sie zu uns hielt und nicht zu dir! Du – du!“
Hinreißend schön war die Anna in ihrem Schmerz und Zorn! Die „schöne“ Anna Hake, sagten die Bekannten, sagten auch die Leute von Scheventorf und Glane bewundernd, und sie hatten wahrhaftig recht. Diese entzückende, ja berückende Schönheit hatte sie als Kind schon vor ihren Altersgenossinnen ausgezeichnet, manchen rohen Jungen zu stummer Begeisterung gezwungen, war ihr unvermindert geblieben ins Jungfrauenalter hinein. Wer sie sah, war entzückt! Unschuldig und kindlich gutmütig war Anna Hake immer durchs Leben gegangen mit ihrem lieben, süßen Madonnengesicht! Aber die schreckliche Krankheit ihrer ach so heiß geliebten Heilwig hatte sie verändert. Sie zwei waren ja immer ohne Vater, ohne Mutter gewesen, immer allein, mit fremden Leuten auf der großen, weiten Burg. Keine Freude, keinen Schmerz, den sie nicht gemeinsam empfunden, gemeinsam getragen. Und jetzt lag Heilwig da in ihren Qualen, und sie konnte ihr nicht helfen. Wenn doch wenigstens dieser Harbort – still, kam er da die Stiege herauf? – Sie lauschte mit wild pochendem Herzen. Nein, Gott Lob, es war nichts! Du, du da unten! Wieder ballte sie die Hand.
„Mußt nicht schelten, Anna, bitte, nicht!“ sagte Heilwig ganz leise, matt wie ein Hauch. „Ist doch der Vater unserer Kinder. Anna, schlafen die Kinder alle gut?“
„Will gleich eben schauen!“
Anna ging leise hinaus. – Ja, da lagen die zwei Schwesterchen und schliefen mit zart geröteten Wangen. Anna beugte sich still und leise über sie und berührte mit ihren Lippen die Kinderstirnen, und da der kleine Kerl in seiner Wiege, der Lukas, wie ein Englein so schön, ganz wie Heilwig, gar nicht wie Harbort. – Zu den zwei größeren Jungen ging sie nicht, sie mußte erst zurück und nach der kranken Schwester schauen.
„Schlafen alle schön!“ beruhigte sie die Kranke. „Wie ist dir jetzt?“
„Schlecht, ach, so schlecht, Anna!“ – Heilwig faßte tastend nach ihrer Hand – „Anna, wenn ich – sterben muß, verlaß – meine Kinder nicht! Oh, es wird dunkel – die Kerze –“
Anna starrte entsetzt auf sie, die Kerze brannte hell wie immer. Da lag Heilwig, weiß wie eine Leiche – atmete nicht.
„Sie stirbt, sie stirbt!“ schrie sie auf, „und niemand – niemand –“ Heilwig schlug matt die Augen auf: „Anna, verlaß meine Kinder nicht – ich sterbe noch nicht!“ Angsterfüllt hingen die Augen der todkranken jungen Mutter an dem Blick der Schwester. „Anna, verlaß . . .“
„Heilwig, glaub doch nicht, daß ich deine Kinder je verlasse. Eher lasse ich mich in Stücke zerreißen! Sei ganz, ganz ruhig!“
Es war, als wenn ein Lächeln wie ein Leuchten über das Gesicht der armen Dulderin ging. Anna flüsterte: „Nein, Liebe, nie in meinem Leben, und wenn der Harbort –“ Da winkte die Kranke müde mit der Hand ab.
Anna verstummte. Es war, als ob Heilwig ein wenig schlummern könne. Sie strich sich aufatmend durch das zarte Gesicht, kniete lange da und schaute in das liebe Antlitz der Schwester. Endlich stand sie auf und setzte sich in den Ledersessel, bedeckte das Gesicht mit den Händen und weinte und weinte und hörte gar nicht wieder auf zu weinen.
Es waren wirklich zwei arme, arme Menschen da in der einsamen, totstillen Nacht. Keine Magd, kein Diener, keine Pflegerin, ganz allein! Wäre die gute Wendelburg noch da, dann ginge ich morgen früh gleich zur Krankenburg, ob dann nicht ein heilkundiger Pater mit mir kommen möchte. Aber ich muß hier bleiben. Oh, lieber Vater im Himmel, erbarme dich über uns zwei verlassene Waisen, habe Mitleid – Barmherzigkeit! – Ihre Lippen bewegten sich im Gebet. – Für kurze Minuten überwältigte sie der Schlaf. Aber dann sah sie wieder verstört um sich. Heilwig schien noch immer sanft zu schlummern. Anna betete leise weiter. Jetzt sieht sie starr herüber zur schlafenden Schwester. Wie war das Gesicht da vor ihr in den Kissen so wächsern und die Nase so spitz! – Wie betäubt stand Anna vor dem Bett – faßte die Hand – – eiskalt, das Gesicht – eiskalt.
„Heilwig, liebe Heilwig!“ schrie sie überlaut. Keine Antwort. – Da schlägt Anna mit einem dumpfen Stöhnen zur Erde nieder, hart streifte ihr Gesicht im Fallen den Bettpfosten. Dann lag sie regungslos, das feine, edle Antlitz leichenblaß, vor dem Totenbett der Schwester. –
3.
Pater von Kneheim schüttelte den Kopf: „Nein, was für Dinge geschehen doch auf Erden! Wie traurig für die armen Kinder! Das muß ich ihnen doch einmal auf der Krankenburg erzählen!“ Der gute Pater mußte sich immer aussprechen, wenn’s nicht anders war mit dem Klosterbruder, denn mehr waren sie nicht im Hause. Aber er hatte ja die Krankenburg ganz nahe, keine dreihundert Schritte entfernt. Und da waren immer einige vom Kloster, besonders kränkliche Patres, manchmal auch Gäste. Was der eine nicht wußte, wußte der andere. Also gleich am Vormittag noch stapfte der alte Pater zur Krankenburg. Die lag da auch wie eine Wasserburg, rings herum Gräben, doch nicht so breit wie um Scheventorf, und die Zugbrücke wurde gar nicht aufgezogen. – Er traf es gut; da war Pater Heribert von Langen und auch Pater Jodokus, der Beichtvater von den Oeseder Nonnen. Gerade war auch der Mühlmeier aus der Krankenburger Mühle gekommen, und weil er ein ganz manierlicher Mensch war, auch bisweilen einen herzhaften Witz aufzubringen wußte, so hatte ihn der Pater Heribert mit ins Refektorium genommmen.
„Hoh, Diedrich“, schallte es dem guten Glaner Pfarrvikar laut entgegen, als sein Gesicht sich in der Tür zeigte, „geschwind heran, du fehltest uns hier gerade noch. Was erzählte der Mühlmeier da von deinen Pfarrkindern? Eins liegt tot im Bett, das andere davor? Und deine allervornehmsten sind es obendrein? Ritterliches Geschlecht?“
„Kinder, so laßt mich doch mal zu Atem kommen!“ sagte Pater Diedrich von Kneheim und tat einen tiefen Zug aus dem zinnernen Bierkrug, den der Bruder ihm ohne viel Fragen hingestellt hatte. Nahm auch ein Stück Weißbrot aus dem Korb. Denn Brot stand immer beim Bier auf dem Tisch. „Ja, ist es nicht schrecklich? Die armen Waislein; die können einen wirklich dauern! Und alles so rasch!“
„Also, beide sind tot? Heilwig und die Schwester, die schöne Anna?“
„Gott behüte! Das Freifräulein lebt und ist auch soweit gesund; aber die edle Frau Heilwig, ja, die ist allerdings im Herrn entschlafen. Gott habe sie selig! War eine gute Seele, habe ihre Mutter noch gut gekannt, Orkradis von der Hoya!“
„Vorbeigeschossen, Diedrich!“ sagte Pater Heribert, „es war Orkradis von Dalewigk!“
„So? Irre ich mich da? War das –“
„Sicher irrst du; ich bin ja mit Dalewigks verwandt, also weitläufig auch mit Haken. Aber nun, was ist das? Nec poenituit, nec confituit nec communitatus et etiam non oleastus, schrieb der Pastor an seinen Bischof, ergo sepultatus sine lux, sine crux, sine aqua benedictus? So geht’s meiner adeligen Base? Mühlmeier“, erklärte er nebenher dem Bauern, „das ist Latein, das versteht Ihr nicht.“
„Doch“, sagte der Mühlmeier, „ich kann soviel Latein, dies heißt, er ist nicht ‚versehen‘ und wird also ohne Kreuz, ohne Kerzen, ohne Weihwasser unter die Erde getan.“
„Nun schau diesen klugen Mehlwurm an“, staunte der Pater Jodokus.
Aber Pater Diedrich sagte: „Nicht doch, Frau Heilwig war mit allem berichtet, nur ohne die heilige Ölung gestorben, ja, das konnte man auch so rasch unmöglich vermuten.“
„Was ist denn nun mit der schönen Anna?“
„Ganz einfach, die ist ohnmächtig geworden und hat sich im Fallen ihr Gesicht etwas gestreift. Liegt zwar noch zu Bett, aber ihr fehlt weiter gar nichts.“
„Ach so, das ist alles. Da wird dann gleich solch groß Geschrei gemacht in Glane!“
„Das ist in Glane wohl nicht schlimmer als anderwärts auch“, verteidigt Pater Diedrich seine Pfarrkinder; „es lautete auch gefährlich genug. Da ist gestern morgen die neue Kindesmagd, die der Ritter Harbort angeschafft hat, ins Vorzimmer gegangen, hört drinnen nichts, klopft und klopft, macht endlich leise auf und sieht da durch den Türspalt die beiden liegen, die Frau im Bett, das Fräulein davor, beide natürlich marmorblaß, die Kerze schwelt noch; wird ja auch grauslich ausgeschaut haben. Und nun dies dumme Ding, statt vernünftig den Ritter Harbort zu rufen, damit der ganz ruhig, wie immer, das Nötige anordnet, was tut dies einfältige Geschöpf? Läuft im Schloß herum, in der einen Hand einen Kandelaber, in der andern eine Handeule, und schreit wie eine Irrsinnige, bis sie richtig die ganze Burg, vom Turmwart bis Gänsejungen, und vor allem die sämtlichen fünf kleinen Würmer da im Schlafzimmer, vor den beiden Leichen stehen hat. Natürlich, das Kindervolk schreit greulich – ach Gott ja, es war ja doch auch ihre eigene liebe Mutter, und dann dazu die beinahe noch liebere Tante Anna, die die Kinder so gern hatte. Aber die gerade macht nun von all dem Getue endlich die Augen auf, ist erst, versteht sich, völlig kopflos, schon mehr ganz außer sich, und als sie die Leiche sieht, fällt sie wieder vor dem Bett hin und weint herzzerbrechend. Aber dann faßt sie doch noch am ersten Verstand, schickt die Völker weg, führt die Kinder in ein anderes Zimmer und schafft Ordnung, so gut es geht. Inzwischen weiß der eine, den es doch am allernächsten angeht, ganz allein auf der Burg noch nichts. Der Ritter schläft nämlich noch, und niemand weckt ihn oder ruft ihn.“
„Verstehe ich nicht“, sagte Pater von Langen, „so viel hätte die Anna doch wissen können!“
„Das ist doch nichts Auffälliges“, wirft Pater Jodokus ein, „in solchen schrecklichen Augenblicken kann ein junges Mädchen schon etwas übersehen!“
Der Mühlmeier sagt: „Immerhin, dies ist morgens sechs Uhr gewesen, und um zehn Uhr soll der Ritter noch immer geschlafen haben. So was passiert in einem Bauernhaus nicht! Und am Abend vorher soll viel Besuch und Gasterei in der Burg gewesen sein. Und den dicken Herrn von der Schleppenburg hat man beinahe in Visbeck singen und schimpfen hören.“
„Mühlmeier“, sagte etwas schärfer als sonst Pater Heribert, „man muß nicht alles herumposaunen, was der große Haufen sich zusammenschwätzt. Wenn die Herren zusammengewesen sind, dann war das wegen unserer jetzigen bösen Zeit. Habt Ihr schon von der blauen und roten Fahne gehört? Und von dem spanischen Feldobristen Verdugo? Oder von Alfonsus Mendo? Oder von Major Kurtzbach? Nein, Mühlmeier, das habt Ihr nicht! So was werdet Ihr Bauern nicht eher gewahr, als bis es zu spät ist. Das aber ist eben die Sorge und die Beratung der Herren Ritter. Denn die tragen für euch die Last und die Verantwortung! Daran denket gefälligst! Und das mit dem Singen und Schimpfen? Was kann das anders gewesen sein als ein paar betrunkene Bauern? Herr Kerstapel von der Schleppenburg ist über solche Roheiten hoch erhaben, Mühlmeier, dafür kenne ich ihn besser.“
Der Mühlmeier schwieg und tat einen Schluck aus seinem Bierkrug. Vielleicht hatte die Belehrung ihn überzeugt, vielleicht auch nicht. Jedenfalls fragte Pater Jodokus: „Ja, aber als der Ritter um zehn Uhr ausgeschlafen hatte, da ist man gekommen, hat ihm alles gesagt, und er ist sehr traurig an der Leiche gekniet, nicht wahr, oder wie ist es gewesen?“
„Sicher, natürlich“, antwortete Pater Diedrich, „wie soll es sonst wohl gewesen sein? Der Ritter hat lange an der Leiche gebetet, und bitter geweint hat er, man hat ihn schluchzen hören, die Burgleute alle haben sich sehr gewundert.“
„Worüber gewundert?“
„Nun, gewundert, daß der Ritter weinte. Werden ihn wohl sonst noch nie im Leben haben weinen sehen, schätze ich. Ist eben ein ganzer Mann, unser tapferer Herr Harbort, und hatte sein Gemahl, die edle Heilwig, rechtschaffen lieb. Wenn er auch als Burgherr streng ist, so muß er es doch sein in diesen entsetzlichen Zeiten, wo jeden Augenblick wilde Geusen oder noch wildere Spanier oder richtige Räuberbanden einem alles nehmen, das Haus in Brand stecken, die Leute elend massakrieren können. Ich sage, streng ist der Ritter Hake, aber das muß so sein, und ein gutes, edles Herz hat er doch, das wissen wir alle.“
Der Mühlmeier schmunzelte ob dieser langen Lobrede von Pater Diedrich.
„Was lacht Ihr, Mühlmeier?“ fragte Pater Heribert, der auch auf Ritter Harbort nichts kommen ließ.
„Ich?“ fragte der Mühlmeier unschuldig, „habe ich gelacht? Weiß ich doch gar nicht. Könnte höchstens sein, fielen meine Gedanken eben auf die schöne Predigt – habe ich neulich gelesen die der Fuchs den Gänsen hält.“
„Sprecht uns nicht solch ungereimtes Zeug dazwischen, das nicht zur vorhandenen Sache gehört, Mühlmeier; bedenket, mit wem Ihr hier redet.“
„Nun, Heribert“, sagte der Jodokus, „nicht gar zu ernst! Der Mühlmeier ist ein guter Kerl. Freuen uns immer, wenn er kommt; hat immer treffende Vergleiche und Anmerkungen in petto und meint’s ehrlich. Was wollten wir auf der Krankenburg auch machen, wenn der Mühlmeier uns nicht die Forellen und Hechte lieferte! Der Nagelteich, der Ruwenteich und die vielen anderen schönen Teiche, ja, die sind nicht für uns Krankenburger. Da halten wir uns eben an unsere treue Mühle.“
„Das tue ich nicht mehr als gerne“, versetzte der biedere Mühlmeier.
„Aber nun, Diedrich, erzähle weiter von Scheventorf“, bat Pater Heribert.
„Da ist nicht viel mehr zu erzählen. Wann die Leiche sein wird, weiß ich noch nicht. Wird wohl noch acht Tage dauern. Die verlassenen armen fünf Waislein können einen dauern. Gut nur, daß Muhme Anna da ist. Das Gescheiteste wäre, die nähme der Ritter als Frau.“
„Das wird Fräulein Anna nicht tun; ist auch ja ein strenges Ehehindernis“, meinte der Mühlmeier.
Heribert sagte: „Von der Schwägerschaft dispensiert der Fürst in diesem dringenden Falle sofort. Aber die Anna wird’s nicht tun, meint Ihr? Warum denn wohl nicht? Ist an dem Ritter auch nur etwas zu monieren? Ein stattlicher, hübscher Mann ist er, mit altem Adelsblut, nobel und rechtlich gesinnt, ein liebevoller Gatte seiner verewigten Frau Heilwigis, ein Feind der Bösen, ein Freund der Guten, ein Wohltäter unseres Klosters! Wird Anna nicht tun, sagt Ihr? Was soll sie denn besseres tun? Wo bekommt ein Jüngferlein heute kräftigeren Schutz als von einem solchen Mann?“
„Oh“, sagte der Mühlmeier, „daß Herr Harbort so brav ist, habe ich noch gar nicht gewußt. Wenn Fräulein Anna Hake das alles hört, nimmt sie ihn gleich morgen.“
Pater Heribert sah den Müller etwas zweifelnd an. War das nun ehrlich gemeint, oder war es blanker Hohn? Was hatte der Mühlmeier denn gegen den edlen Ritter? Aber nun, es war ja eigentlich auch noch etwas früh, vom Wiederheiraten zu beratschlagen, wo Frau Heilwigis kaum erkaltet, geschweige denn zur Erde bestattet war in der Erbgruft der Scheventorfer Burg, dem Turm der Glaner Pfarrkirche.





























