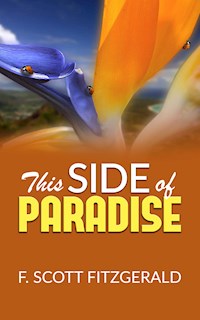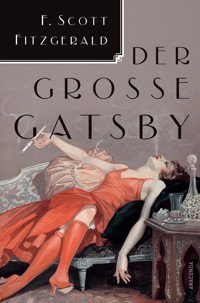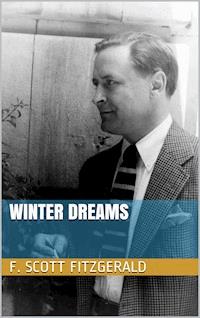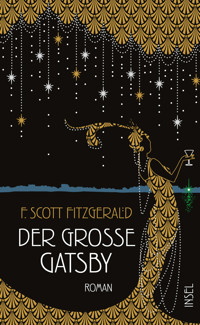7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Penguin Edition
- Sprache: Deutsch
In Champagnerlaune auf der Suche nach dem Sinn des Lebens
Da haben sich zwei gefunden: Anthony, der smarte Millionenerbe, und Gloria, die betörende Schönheit. Gemeinsam verbringen sie ein Leben im Rausch, und die ganze Welt liegt ihnen zu Füßen. Dennoch fühlt sich ihr snobistisches Upperclass-Dasein immer öfter reizlos und eintönig an. So beginnen sie sich in ihrem goldenen Käfig zu langweilen und ihrer Glamourwelt überdrüssig zu werden.
Von zwei Glückskindern im Überfluss, die ihr wertvollstes Gut vergeuden: ihr Leben. Fitzgeralds Romanklassiker aus dem New York des »Jazz-Age« ist ein großes Lesevergnügen und zugleich eine scharfsinnige Gesellschaftssatire.
PENGUIN EDITION. Zeitlos, kultig, bunt. – Ausgezeichnet mit dem German Brand Award 2022
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 647
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Große Emotionen, große Dramen, große Abenteuer – von Austen bis Fitzgerald, von Flaubert bis Zweig. Ein Bücherregal ohne Klassiker ist wie eine Welt ohne Farbe.
F. Scott Fitzgerald (1896–1940) kam in den Roaring Twenties nach New York, um hier seinen Traum zu leben, und gehörte mit seiner Frau Zelda bald zu den begehrtesten Celebrities der Stadt. Seine in der luxuriösen Welt des amerikanischen Geldadels spielenden Romane Die Schönen und Verdammten (1922) und Der große Gatsby (1925) wurden auf Anhieb zu Bestsellern. 1937 ging der Autor nach Los Angeles und arbeitete als Drehbuchschreiber in Hollywood.
«Ein atemberaubendes Buch, witzig, voller Erotik, aber auch voll tiefer Trauer über die Unbarmherzigkeit einer angeblich neuen Gesellschaft.» Brigitte
«Wohl der sinnlichste amerikanische Schriftsteller der ersten Jahrhunderthälfte.» Paul Ingendaay, Deutschlandradio
«Fitzgerald gibt dem aufgeregten Jahrzehnt nicht nur den Namen – er ist der Erfinder des Jazz-Age. Er beschreibt es nicht nur – er inszeniert und lebt es.» Kyra Stromberg, Süddeutsche Zeitung
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook.
F. Scott Fitzgerald
DIE SCHÖNEN UND VERDAMMTEN
Roman
Aus dem Englischen von Renate Orth-Guttmann
Mit einem Nachwort von Tilman Höss
Die Originalausgabe erschien 1922
unter dem Titel The Beautiful and Damned.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 1998 der deutschsprachigen Ausgabe by Manesse Verlag
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Regg Media in Adaption der traditionellen Penguin Classics Triband-Optik aus England
Umsetzung eBook: Greiner & Reichel, Köln
ISBN 978-3-641-26839-8V001
www.penguin-verlag.de
ERSTES BUCH
1 ANTHONY PATCH
1913 war Anthony Patch fünfundzwanzig, und bereits zwei Jahre zuvor hatte ihn – zumindest theoretisch – die Ironie, der Heilige Geist unserer Tage, berührt. Ironie, das war die letzte Politur auf dem Schuh, der allerletzte Strich mit der Kleiderbürste, eine Art intellektuelles «Na bitte!» – doch zu Beginn dieser Geschichte ist er über die Bewusstseinsphase noch nicht hinausgekommen. In dem Moment, da wir ihn kennenlernen, fragt er sich häufig, ob er nicht ehrlos und ein bisschen verrückt ist, eine schmachvolle und abscheuliche Schicht, die auf der Oberfläche der Welt schillert wie Öl auf einem sauberen Teich, wobei solche Überlegungen natürlich mit anderen abwechseln, in denen er sich für einen ziemlich außergewöhnlichen jungen Mann hält, ausnehmend weltgewandt, seiner Umgebung gut angepasst und eine Spur bedeutender als alle anderen ihm bekannten Leute.
Es war dies ein Zustand, der ihm überaus zuträglich war, ihn munter und liebenswürdig machte und äußerst anziehend auf intelligente Männer und auf alle Frauen wirken ließ, ein Zustand, in dem er sich sagte, dass er eines Tages irgendeine diskrete, subtile Tat vollbringen würde, die den Auserwählten wohlgefällig war, und dass er sich nach seinem Hinscheiden den matter leuchtenden Sternen an einem nebulösen, ungewissen Himmel zwischen Tod und Unsterblichkeit zugesellen würde. Bis die Zeit kam, diese Tat zu vollbringen, würde er sich damit begnügen, Anthony Patch zu sein, kein Bild von einem Mann, aber eine fest umrissene, dynamische Persönlichkeit, eigenwillig, anmaßend, von innen nach außen wirkend – ein Mann, der sich bewusst war, dass es keine Ehre geben konnte, und der dennoch Ehre im Leib hatte, der um die Sophisterei des Mutes wusste und dennoch tapfer war.
Ein ehrenwerter Mann und sein begabter Sohn
Dass er der Enkel von Adam J. Patch war, schenkte Anthony ebenso viel gesellschaftliche Sicherheit, als hätte er sein Geschlecht übers Meer bis zu den Kreuzfahrern zurückverfolgen können. Das war unvermeidlich: Ungeachtet der Virginier und Bostoner, die das Gegenteil beweisen, verlangt eine ausschließlich auf Geld gegründete Aristokratie vom Einzelnen vor allem Wohlstand.
Adam J. Patch, auch – und zwar nicht ohne Grund, da er ein rechter Murrkopf war – unter dem Beinamen «Cross Patch» bekannt, hatte die Farm seines Vaters in Tarrytown Anfang 1861 verlassen, um in ein New Yorker Kavallerieregiment einzutreten. Er kehrte als Major aus dem Krieg zurück, stürmte die Wall Street und raffte unter viel Getöse und Tamtam, Bekundungen des Beifalls wie des Unmuts ungefähr fünfundsiebzig Millionen Dollar zusammen.
Diese Aufgabe beanspruchte bis zu seinem siebenundfünfzigsten Lebensjahr seine ganze Kraft. Nach einer schweren sklerotischen Attacke beschloss er, sein restliches Leben in den Dienst der moralischen Erneuerung der Welt zu stellen. Er wurde ein leuchtendes Vorbild für alle Reformer. Den bewundernswerten Leistungen Anthony Comstocks nacheifernd, nach dem sein Enkel benannt wurde, kämpfte er mit einem Hagel von Uppercuts und Bodyblows gegen Alkohol, Literatur, das Laster, die Kunst, Patentmedizin und sonntägliche Theatervorstellungen. Unter dem Einfluss jenes heimtückischen Mehltaus, der bis auf wenige Ausnahmen die meisten Menschen befällt, warf er sich voller Hingabe auf alles, was seine Zeit empörte. Von seinem Sessel im Arbeitszimmer auf dem Anwesen in Tarrytown aus führte er gegen den machtvollen hypothetischen Feind, die Verworfenheit, einen Feldzug, der fünfzehn Jahre währte und in dem er sich als fanatischer Monomane, uneingeschränkter Quälgeist und lästigster Langweiler erwies.
In dem Jahr, in dem unsere Geschichte beginnt, hatten seine Kräfte bereits nachgelassen, aus den großen Schlachten waren Scharmützel geworden. 1861 und 1895 wurden allmählich eins. Seine Gedanken kreisten sehr häufig um den Bürgerkrieg, gelegentlich um seine tote Frau und seinen toten Sohn und verschwindend selten um seinen Enkel Anthony.
Zu Beginn seiner Laufbahn hatte Adam Patch eine anämische Frau von dreißig Jahren, eine gewisse Alicia Withers, geheiratet, die hunderttausend Dollar mitbrachte und ihm ein untadeliges Entree zu New Yorks Bankenkreisen verschaffte. Unverzüglich und recht beherzt hatte sie ihm einen Sohn geboren und sich, als habe diese Großtat sie völlig entkräftet, danach in die Schattenwelt des Kinderzimmers zurückgezogen. Der Knabe, Adam Ulysses Patch, entwickelte sich zum beispielhaften Mitglied zahlreicher Clubs, Kenner guter Umgangsformen und Tandemfahrer. Im zarten Alter von sechsundzwanzig Jahren begann er mit der Abfassung seiner Memoiren unter dem Titel «Die New Yorker Gesellschaft, wie ich sie gesehen habe». Sobald gerüchteweise die Entstehung dieses Werkes bekannt wurde, traten eilfertige Verleger mit Angeboten an ihn heran, aber da sich nach seinem Tod herausstellte, dass es unmäßig wortreich und überwältigend langweilig war, kam es später nicht einmal als Privatdruck heraus.
Dieser Chesterfield der Fifth Avenue heiratete mit zweiundzwanzig. Seine Frau war Henrietta Lebrune, «Salon-Altistin» aus Boston, und der einzige Spross dieser Verbindung wurde, dem Wunsch seines Großvaters entsprechend, auf den Namen Anthony Comstock Patch getauft. Als er nach Harvard ging, fiel das Comstock aus seinem Namen heraus und in einen tiefen Orkus des Vergessens und tauchte nie wieder auf.
Der junge Anthony besaß ein einziges Bild, auf dem seine Eltern zusammen zu sehen waren. So oft hatte es ihm in seiner Kindheit vor Augen gestanden, dass es für ihn mittlerweile die Unpersönlichkeit eines Möbelstücks besaß, aber jeder, der sein Schlafzimmer betrat, betrachtete es voller Anteilnahme. Es zeigte einen schlanken, gut aussehenden Dandy aus den neunziger Jahren neben einer hochgewachsenen brünetten Dame mit Muff und angedeuteter Tournüre. Zwischen ihnen stand ein kleiner Junge mit langen braunen Locken in einem Samtanzug à la Lord Fauntleroy. Das war Anthony im Alter von fünf Jahren, im Todesjahr seiner Mutter.
Seine Erinnerungen an die Bostoner Salon-Altistin waren nebelhaft und mit Musik verbunden. Sie war eine Dame, die im Musikzimmer ihres Hauses am Washington Square unentwegt sang – manchmal umgeben von Gästen, Männern mit verschränkten Armen, die mit angehaltenem Atem sich auf dem Rand von Sofas wiegten, und Frauen, die die Hände in den Schoß gelegt hatten, hin und wieder den Männern etwas zuflüsterten, stets begeistert klatschten und nach jedem Lied leise, girrende Rufe ausstießen –, häufig aber auch ganz allein für Anthony, in Italienisch oder Französisch oder in einem fremden und grauenhaften Dialekt, den sie für die Sprechweise der Neger aus den Südstaaten hielt.
An den stattlichen Ulysses, den ersten Mann, der in Amerika die Revers seines Rocks rollte, erinnerte er sich sehr viel deutlicher. Nachdem Henrietta Lebrune Patch «in einen anderen Chor» eingetreten war, wie ihr Witwer gelegentlich mit belegter Stimme bemerkte, lebten Vater und Sohn bei Großpapa in Tarrytown, und Ulysses kam täglich in Anthonys Kinderstube und sonderte – manchmal eine ganze Stunde lang – vergnügliche, stark duftende Worte ab. Er versprach Anthony ständig Jagdausflüge und Angelpartien und Abstecher nach Atlantic City – «wirklich ganz bald» –, aus denen aber nie etwas wurde.
Eine Exkursion machten sie dann doch zusammen. Als Anthony elf war, reisten sie nach England und in die Schweiz, und dort, im besten Hotel von Luzern, starb sein Vater schwitzend und schnaufend und lautstark um Luft ringend. Ein zutiefst verzweifelter und verstörter Anthony wurde nach Amerika zurückgebracht, einer unbestimmten Schwermut verhaftet, die ihn sein ganzes Leben lang begleiten sollte.
Vergangenheit und Person des Helden
Mit elf hatte er einen Horror vor dem Tod. Innerhalb von sechs empfänglichen Jahren waren ihm beide Eltern gestorben, und seine Großmutter war fast unmerklich dahingewelkt bis zu dem Tag, an dem sie zum ersten Mal seit ihrer Hochzeit unbestritten die Hauptperson in ihrem Salon war. So war denn für Anthony das Leben ein Kampf gegen den Tod, der an jeder Ecke wartete. Als Zugeständnis an seine hypochondrische Fantasie gewöhnte er sich an, im Bett zu lesen, was ihn beruhigte. Er las, bis er müde wurde, und schlief häufig ein, wenn das Licht noch brannte.
Bis zu seinem vierzehnten Lebensjahr beschäftigte er sich am liebsten mit seiner für einen Jungen seines Alters ungewöhnlich umfangreichen Briefmarkensammlung, von der sein Großvater törichterweise glaubte, sie sei dazu geeignet, die Geografiekenntnisse des Enkels zu fördern. Anthony korrespondierte mit fünf, sechs Briefmarken- und Münzhändlern, und kaum ein Tag verging, an dem ihm die Post nicht neue Briefmarkenalben oder Päckchen mit glänzenden Probebogen brachte. Für ihn lag ein geheimnisvoller Zauber darin, seine Neuerwerbungen endlos von einem Album ins andere zu transferieren. Die Briefmarken waren sein größtes Glück, und jeder, der ihn störte, wenn er mit ihnen beschäftigt war, handelte sich ungehaltene Blicke ein. Sie verschlangen sein monatliches Taschengeld, und nachts lag er wach und sann unermüdlich ihrer Vielfalt und Farbenpracht nach.
Mit sechzehn hatte er kaum Kontakte nach außen; er war ein wenig redegewandter, völlig unamerikanischer Knabe, der seine Mitmenschen mit höflicher Ratlosigkeit betrachtete. In den zwei vorangegangenen Jahren hatte er mit einem Privatlehrer Europa bereist, der ihm dringend zu einem Studium an der Harvard-Universität riet. Dort würden sich ihm «Türen öffnen» und ungeahnte neue Kräfte zuwachsen. Diese Hochschule würde ihm unzählige aufopferungsvolle und ergebene Freunde schenken. Also besuchte er Harvard; es war die nächstliegende Lösung.
Da er mit den dortigen Gepflogenheiten nicht vertraut war, hauste er eine Weile allein und unbeachtet in einem hohen Zimmer in Beck Hall – ein schlanker, mittelgroßer, brünetter Junge mit einem schüchternen, sensiblen Mund und einem mehr als großzügigen Taschengeld. Er schuf die Grundlage für eine Bibliothek, indem er von einem herumziehenden Bibliophilen Erstausgaben von Swinburne, Meredith und Hardy und einen vergilbten, verblassten, eigenhändig von Keats geschriebenen Brief erwarb, wobei er, wie er hinterher feststellte, kräftig übers Ohr gehauen worden war. Er wurde ein ausgesuchter Dandy, brachte eine fast rührende Sammlung von Seidenpyjamas, Brokathausmänteln und Krawatten zusammen, die zum Tragen in der Öffentlichkeit zu auffallend waren. In diesem geheimen Staat stolzierte er in seinem Zimmer vor einem Spiegel auf und ab, lag in Satin gehüllt auf seinem Fenstersitz, sah auf den Campus hinaus und nahm unbestimmt das lebhafte Treiben dort unten zur Kenntnis, an dem er wohl nie teilhaben würde.
In seinem letzten Studienjahr aber stellte er zu seiner Überraschung fest, dass er sich in seiner Klasse eine gewisse Position erworben hatte. Er bemerkte, dass er als eine einigermaßen romantische Erscheinung galt, als ein Gelehrter, Einsiedler, eine Leuchte der Gelehrsamkeit. Das amüsierte ihn, insgeheim freute er sich aber auch darüber. Er begann auszugehen, erst ein wenig, dann sehr häufig. Er wurde sogar im Pudding aufgenommen. Er trank – diskret und wie es die Tradition vorschrieb. Wäre er nicht so jung ins College gekommen, sagte man, hätte er es «weit bringen können». Als er 1909 seinen Abschluss machte, war er erst zwanzig Jahre alt.
Danach ging er wieder nach Europa, diesmal nach Rom, wo er abwechselnd auf dem Gebiet der Architektur und der Malerei dilettierte, das Geigenspiel erlernte und etliche schauerliche italienische Sonette schrieb – vorgebliche Betrachtungen eines Mönchs aus dem 13. Jahrhundert über die Freuden des kontemplativen Lebens. Unter seinen engeren Studienfreunden sprach sich herum, dass er in Rom war, und wer in jenem Jahr nach Europa kam, besuchte ihn und entdeckte mit ihm auf so mancher Exkursion bei Mondlicht vieles in der Stadt, was älter als die Renaissance oder auch die Republik war. Maury Noble aus Philadelphia beispielsweise blieb zwei Monate; gemeinsam erfreuten sie sich an dem eigenartigen Reiz südländischer Frauen und genossen das Gefühl, sehr jung und frei in einer sehr alten und freien Kultur zu sein. Auch etliche Bekannte seines Großvaters suchten ihn auf, und hätte ihm der Sinn danach gestanden, hätte er in Diplomatenkreisen zur persona grata werden können; ja, er stellte fest, dass er immer mehr Gefallen an der Geselligkeit fand, auch wenn die aus dem langen Abstandhalten der Adoleszenz resultierende Schüchternheit noch immer sein Verhalten bestimmte.
1912 kehrte er wegen einer der plötzlichen Erkrankungen seines Großvaters nach Amerika zurück, und nach einem ausnehmend unerfreulichen Gespräch mit dem ständig rekonvaleszenten alten Herrn beschloss er, sich erst dann auf Dauer in Europa niederzulassen, wenn sein Großvater gestorben war. Nach langem Suchen fand und mietete er eine Wohnung in der Fifty-second Street und schien allmählich häuslich werden zu wollen.
Im Jahre 1913 war Anthony Patchs Anpassung an die Welt nahezu vollzogen. Körperlich hatte er sich seit seiner Studienzeit gut entwickelt. Er war noch immer zu dünn, aber seine Schultern waren breiter geworden, und der furchtsame Erstsemesterblick hatte sich verloren. Er war, auch wenn er das nicht nach außen dringen ließ, ein sehr ordentlicher Mensch und stets geschniegelt und gebügelt. Seine Freunde schworen, sie hätten ihn noch nie mit zerzaustem Haar gesehen. Seine Nase war zu spitz, sein Mund, unglückseligerweise ein getreuer Spiegel seiner Stimmungen, neigte dazu, sich in Phasen der Unzufriedenheit nach unten zu verziehen, aber die blauen Augen hatten – ob sie einen nun mit wacher Intelligenz anblickten oder in einem komisch-schwermütigen Ausdruck halb geschlossen waren – einen ganz eigenen Charme.
Obschon ihm die Symmetrie der Züge fehlte, die als unerlässlich für das arische Ideal gelten, sprach man hier und da von ihm als einem gut aussehenden Mann. Überdies war er sowohl äußerlich als auch in Wirklichkeit sehr reinlich; es war dies jene spezielle Sauberkeit, die eine Anleihe bei der Schönheit genommen hat.
Die Wohnung ohne Fehl und Tadel
Die Fifth und Sixth Avenue waren für Anthony die Holme einer endlos langen Leiter, die vom Washington Square bis zum Central Park reichte. Wenn er in einem Omnibus auf dem Oberdeck in Richtung Fifty-second Street fuhr, hatte er unweigerlich das Gefühl, sich Hand über Hand an einer Reihe tückischer Sprossen hochzuhangeln, und wenn der Omnibus ruckelnd an seiner eigenen Sprosse anhielt, empfand er, während er die widerspenstigen Metallstufen zur Straße hinunterstieg, fast so etwas wie Erleichterung.
Danach führte sein Weg nur noch einen halben Block die Fifty-second Street hinunter und an einer massigen Reihe von Brownstone-Häusern vorbei, dann stand er schon hochzufrieden unter der hohen Decke seines großen Vorderzimmers – denn hier begann das Leben. Hier schlief er, frühstückte er, las er und empfing seine Gäste.
Das Haus war Ende der neunziger Jahre aus einem dunklen Naturstein erbaut worden. Wegen der ständig wachsenden Nachfrage nach kleinen Wohnungen hatte man alle Etagen von Grund auf umgebaut und einzeln vermietet. Von den vier Wohnungen war die von Anthony gemietete im zweiten Stock die reizvollste.
Das Vorderzimmer hatte schöne hohe Decken und drei große Fenster, die sich zur Fifty-second Street öffneten. Bei der Einrichtung hatte man geschickt vermieden, sich auf einen bestimmten Stil festzulegen; sie zeigte sich weder steif noch muffig, weder karg noch dekadent. Das Zimmer roch weder nach Zigaretten- noch nach Weihrauch – es war hoch und bläulich. Schläfrigkeit umwaberte wie leichter Dunst eine Chaiselongue aus weichstem braunem Leder. Ein hoher Wandschirm – eine chinesische Lackarbeit, auf der man dekorative Fischer und Jäger in Schwarz und Gold bewundern konnte – bildete eine Nische für einen voluminösen Sessel, dem eine orangefarbene Stehlampe als Wachposten beigegeben war. In der Tiefe des Kamins stand ein schwarz verrußter gevierter Wappenschild.
Durch das Esszimmer, das, da Anthony zu Hause nur das Frühstück einnahm, allenfalls vielversprechende Möglichkeiten bot, und über einen ziemlich langen Gang kam man zu dem Herz- und Kernstück der Wohnung – Anthonys Schlafzimmer und Bad.
Beide Räume waren riesig. Unter der Decke des ersteren wirkte sogar das breite Himmelbett nur durchschnittlich groß. Auf dem Boden lag eine exotische Brücke aus scharlachrotem Samt, der weich wie Vlies seine nackten Sohlen streichelte. Das Badezimmer war im Gegensatz zu der ein wenig einschüchternden Atmosphäre des Schlafraums fröhlich, hell, sehr wohnlich und sogar ein wenig verspielt. An den Wänden hingen gerahmte Fotografien von vier berühmten thespischen Schönheiten des Tages: Julia Sanderson als «The Sunshine Girl», Ina Claire als «The Quaker Girl», Billie Burke als «The Mind-the-Paint Girl» und Hazel Dawn als «The Pink Lady». Zwischen Billie Burke und Hazel Dawn hing ein Druck, auf dem über einer weiten Schneefläche eine bedrohlich frostige Sonne stand, die, wie Anthony zu sagen pflegte, Sinnbild für die kalte Dusche war.
Die mit einer sinnreichen Buchhaltevorrichtung versehene Badewanne war groß und niedrig. Daneben türmte sich in einem Wandschrank genug Wäsche für drei Männer sowie eine ganze Generation von Krawatten. Statt eines dürftigen Vorlegers, eines besseren Handtuchs, lag dort eine üppige Brücke von der gleichen wunderbaren Weichheit wie jene im Schlafzimmer, die den nassen Fuß, der aus der Wanne kam, gleichsam massierte.
Alles in allem ein Raum, mit dem sich zaubern ließ. Es war leicht einzusehen, dass Anthony sich dort ankleidete, dort sein makelloses Haar kämmte und überhaupt Sämtliches dort erledigte außer Essen und Schlafen. Das Badezimmer war sein ganzer Stolz. Hätte er eine Liebste gehabt, hätte er wohl ihr Bild direkt gegenüber der Badewanne aufgehängt, um sich, von den beruhigenden Dampfwolken des heißen Wassers umschmeichelt, zurückzulehnen, zu ihr aufzusehen und sinnlich-genüsslich über ihre Schönheit nachzusinnen.
Und er bewegt sich nicht
Für die Sauberkeit der Wohnung war ein englischer Diener mit dem ausnehmend, fast dramatisch treffenden Namen Bounds verantwortlich, dessen Erscheinung nur durch die Tatsache beeinträchtigt wurde, dass er einen Umlegekragen trug. Wäre er zur Gänze Anthonys Bounds gewesen, wäre dieser Mangel sehr schnell behoben worden, aber Bounds war noch zwei weiteren Herren in der Nachbarschaft verpflichtet. Vormittags von acht bis elf Uhr aber gehörte er ganz und gar Anthony. Er brachte die Post mit und bereitete das Frühstück zu. Um halb zehn zupfte er an Anthonys Bettdecke und äußerte einige wenige, knappe Worte; Anthony merkte sie sich nie im Einzelnen, hatte aber den Verdacht, dass es etwas Abfälliges war. Dann stellte ihm Bounds das Frühstück auf einen Beistelltisch im Vorderzimmer, machte das Bett und ging, nicht ohne sich mit einem feindseligen Unterton zu erkundigen, ob Anthony noch weitere Wünsche habe.
Mindestens einmal in der Woche suchte Anthony vormittags seinen Börsenmakler auf. Sein Einkommen – die Zinsen aus dem von seiner Mutter ererbten Vermögen – belief sich auf etwas unter siebentausend im Jahr. Sein Großvater, der seinem Sohn nie gestattet hatte, sich über ein ausnehmend großzügiges Taschengeld hinaus weiterzuentwickeln, war der Meinung, dass diese Summe für die Bedürfnisse des jungen Anthony ausreichte. Zu Weihnachten schickte er ihm stets einen Pfandbrief über fünfhundert Dollar, den Anthony nach Möglichkeit gleich verkaufte, da er stets ein wenig – wenn auch nicht ernsthaft – knapp bei Kasse war.
Mit seinem Börsenmakler führte er einmal halb private, dann wieder ernsthafte Gespräche über die Sicherheit achtprozentiger Anlagen und genoss beides gleichermaßen. Ihm schien, dass das große Konzerngebäude ihn eindeutig mit den großen Vermögen verband, deren Solidarität er respektierte und die ihm die Gewissheit gaben, dass er von der Finanzhierarchie angemessen beschützt wurde. Jene stets eiligen Herren vermittelten ihm das gleiche Gefühl der Sicherheit, das ihn erfüllte, wenn er sich mit dem Geld seines Großvaters befasste – oder sogar in noch stärkerem Maß, denn Letzteres schien ihm wie ein täglich kündbares Darlehen, das die Welt Adam Patchs moralischer Redlichkeit gewährte, während das Geld an der Wall Street von nackter, unbezähmbarer Stärke und ungeheurer Willenskraft zusammengerafft und festgehalten wurde; überdies schien es endgültiger und ausdrücklicher – Geld zu sein.
So dicht Anthony auch stets seinem Einkommen auf den Fersen blieb, glaubte er doch, damit auskommen zu können. In einer goldenen Zukunft würde er selbstverständlich über viele Millionen verfügen; inzwischen besaß er einen raison d’être in der theoretischen Abfassung von Aufsätzen über die Päpste der Renaissance. Und damit blenden wir zurück zu dem Gespräch, das er unmittelbar nach seiner Rückkehr aus Rom mit seinem Großvater geführt hatte.
Er hatte insgeheim gehofft, seinen Großvater nicht mehr lebend anzutreffen, aber als er vom Pier aus anrief, erfuhr er, dass es Adam Patch wieder vergleichsweise gut ging, und so war er denn am nächsten Tag, seine Enttäuschung tapfer verbergend, nach Tarrytown gefahren. Fünf Meilen vom Bahnhof entfernt bog die Motordroschke in eine gepflegte Auffahrt ein, die sich durch ein wahres Labyrinth von schützenden Mauern und Maschendrahtzäunen schlängelte, weil, wie die Leute sagten, bekanntlich einer der ersten, den die Sozialisten umbringen würden, der alte Murrkopf Patch wäre.
Anthony hatte sich verspätet, und der würdige Philanthrop erwartete ihn in einer Glasveranda, wo er die Morgenzeitungen zum zweiten Mal überflog. Edward Shuttleworth, sein Sekretär, der vor seiner moralischen Erneuerung Spieler, Kneipenwirt und Tagedieb gewesen war, geleitete Anthony hin und führte seinen Retter und Wohltäter vor wie einen Schatz von ungeheurem Wert.
Sie schüttelten sich feierlich die Hand.
«Freut mich sehr, dass es dir besser geht», sagte Anthony.
Patch senior, der so tat, als habe er seinen Enkel erst letzte Woche gesehen, zog seine Uhr hervor: «Zugverspätung?», fragte er sanft.
Dass er auf Anthony hatte warten müssen, verdross ihn. Er gab sich der irrigen Meinung hin, dass er in seiner Jugend nicht nur all seine Vorhaben mit der größten Sorgfalt abgewickelt und zu jedem Termin auf den Schlag pünktlich gekommen war, sondern dass dies auch der unmittelbare und wichtigste Grund für seinen Erfolg war.
«Er hatte im letzten Monat ziemlich oft Verspätung», bemerkte er mit einem Hauch sanften Vorwurfs in der Stimme. Und nach einem tiefen Seufzer: «Setz dich.»
Anthony betrachtete seinen Großvater wie stets mit wortlosem Staunen. Dass dieser gebrechliche, beschränkte alte Mann mit so viel Macht ausgestattet war, dass sich – was immer die Boulevardpresse schreiben mochte – mit den Menschen, deren Seelen er nicht direkt oder indirekt hätte kaufen können, kaum White Plains bevölkern ließ, schien so undenkbar wie die Vorstellung, er könne in ferner Vorzeit ein rosafarbenes Baby gewesen sein.
Die Spanne seiner fünfundsiebzig Lebensjahre hatte wie ein magischer Blasebalg gewirkt. Dieser hatte ihm im ersten Vierteljahrhundert pralles Leben eingeblasen und ihm im letzten alles wieder genommen. Er hatte Wangen und Brust, Arme und Beine leergesogen. Er hatte gebieterisch seine Zähne gefordert, einen nach dem anderen, seine kleinen Augen in dunkel-bläuliche Säcke gebettet, ihm die Haare geraubt, an manchen Stellen Grau zu Weiß, an anderen Rosa zu Gelb verfärbt, rücksichtslos Farben tauschend wie ein Kind, das einen Malkasten ausprobiert. Er hatte ihm Nachtschweiß und Tränen und grundlose Ängste geschickt. Dann hatte er sich über Körper und Seele an sein Hirn herangemacht, hatte die geballte Normalität von Adam Patch in Leichtgläubigkeit und Argwohn gespalten. Aus dem groben Klotz seiner Begeisterungsfähigkeit hatte er Dutzende kleiner, aber verdrießlicher Obsessionen geschnitzt. Seine Tatkraft war zu dem Unmut eines verwöhnten Kindes geschrumpft, und an die Stelle seines Machtstrebens war ein törichtes kindisches Verlangen nach einem Land der Harfen und Lobgesänge auf Erden getreten.
Nach einem angemessenen Austausch von Artigkeiten dachte sich Anthony, dass nun wohl von ihm erwartet wurde, seine Zukunftspläne zu umreißen, zugleich aber warnte ihn ein Glitzern in den Augen des Alten davor, von der beabsichtigten Verlegung seines Wohnsitzes ins Ausland zu sprechen. Er hatte gehofft, Shuttleworth – den Anthony verabscheute – würde taktvoll genug sein, das Zimmer zu verlassen; der aber hatte es sich in einem Schaukelstuhl bequem gemacht und ließ seinen welken Blick zwischen Patch junior und Patch senior hin- und hergehen.
«Jetzt, wo du zurück bist, solltest du etwas tun», sagte sein Großvater sanft. «Etwas leisten.»
Anthony wartete vergeblich auf die Floskel «etwas hinterlassen, wenn du aus der Welt gehst …», dann sagte er vorsichtig: «Ich denke … ich habe den Eindruck, dass ich mein schriftstellerisches Talent nutzen könnte …»
Adam Patch zuckte zusammen, offensichtlich sah er einen Familiendichter mit langem Haar und drei Mätressen vor sich.
«… um über Geschichte zu schreiben.»
«Geschichte? Welche Geschichte? Die Sezession? Den Unabhängigkeitskrieg?»
«Also eigentlich … nicht direkt, Sir. Eine Geschichte des Mittelalters.» Gleichzeitig wurde eine Idee für eine aus einem völlig neuen Blickwinkel dargestellte Geschichte der Renaissance-Päpste geboren. Trotzdem war er froh, dass er «Mittelalter» gesagt hatte.
«Mittelalter? Warum nicht eine Geschichte deines eigenen Landes? Etwas, worin du dich auskennst.»
«Ich habe so viel Zeit im Ausland verbracht …»
«Warum du übers Mittelalter schreiben willst – ‹das finstere Mittelalter› haben wir es nur genannt –, ist mir ein Rätsel. Keiner weiß, was damals wirklich los war, und keinen kümmert es, Hauptsache, das ist jetzt alles vorbei.» Er verbreitete sich noch ein paar Minuten über die Nutzlosigkeit einer solchen Dokumentation, wobei natürlich auch die spanische Inquisition und die «Verderbtheit der Klöster» nicht unerwähnt blieben.
Dann: «Glaubst du, dass du in New York wirst arbeiten können – oder willst du überhaupt arbeiten?» Letzteres kam mit leisem, fast unmerklichem Zynismus.
«Aber ja, selbstverständlich, Sir.»
«Und wann soll die Sache fertig sein?»
«Zunächst ist ein Exposé zu erstellen, und ich werde viel lesen müssen.»
«Na, das hast du ja bis jetzt schon recht ausgiebig besorgt.»
Das Gespräch schleppte sich mühsam noch eine Weile hin, bis Anthony ziemlich abrupt aufstand, auf die Uhr sah und bemerkte, er habe heute Nachmittag einen Termin bei seinem Börsenmakler. Er hatte eigentlich ein paar Tage bei seinem Großvater bleiben wollen, aber nach einer ziemlich stürmischen Überfahrt war er müde und schlecht gelaunt und hatte keine Lust, sich in raffiniert scheinheiligem Ton unter Druck setzen zu lassen. Er werde in ein paar Tagen wiederkommen, sagte er.
Dennoch hatte sich infolge dieser Begegnung der Gedanke an Arbeit in ihm festgesetzt. Im Laufe des Jahres, das seither vergangen war, hatte er mehrere Quellenverzeichnisse erstellt, hatte sogar mit Kapitelüberschriften und der Einteilung seines Werks in Zeitabschnitte experimentiert, doch gab es derzeit noch keine einzige Zeile Text, und es schien nicht wahrscheinlich, dass es jemals eine geben würde. Und entgegen jeder anerkannten Lehrbuchlogik gelang es ihm aufs Trefflichste, sich abzulenken.
Nachmittag
Es war der Oktober des Jahres 1913 und Wochenmitte in einer Woche schöner Tage. Der Sonnenschein bummelte durch die Nebenstraßen, und die Luft war so träge, als hinge sie voll von geisterhaft fallendem Laub. Es war vergnüglich, müßig am offenen Fenster zu sitzen und ein Kapitel aus «Erewhon» zu Ende zu lesen. Es war vergnüglich, gegen fünf genüsslich zu gähnen, das Buch auf einen Tisch zu werfen und summend über den Gang zum Bad zu schlendern.
«To … you … beaut-if-ul lady»,
sang er, während er den Hahn aufdrehte.
«I raise … my … eyes;
To … you … beaut-if-ul la-a-dy
My … heart … cries …»
Er hob die Stimme, um sich gegen das in die Wanne flutende Wasser durchzusetzen, und während er das Bild von Hazel Dawn an der Wand betrachtete, legte er eine eingebildete Geige an die Schulter und strich sanft mit einem geisterhaften Bogen darüber. Mit geschlossenen Lippen brachte er ein Summen zustande, das unbestimmt an einen Geigenton erinnerte, dann aber stellten die Hände ihre Kreisbewegungen ein und fingen an, das Hemd aufzuknöpfen. Entkleidet und in der athletischen Pose des Tigerfellmanns aus der Reklame besah er sich mit einiger Zufriedenheit im Spiegel, um dann probehalber mit einem Fuß im Wasser zu planschen. Nachdem er einen Hahn nachgestellt und ein paar vorbereitende Grunzlaute ausgestoßen hatte, ließ er sich in die Wanne gleiten.
Als er sich an die Wassertemperatur gewöhnt hatte, verharrte er in einem Zustand wohliger Entspannung. Nach seinem Bad würde er sich in Muße ankleiden und über die Fifth Avenue zum «Ritz» gehen, wo er sich zum Abendessen mit den beiden Freunden verabredet hatte, mit denen er am häufigsten zusammen war, Dick Caramel und Maury Noble. Danach wollte er mit Maury ins Theater, Caramel würde vermutlich nach Hause traben und an seinem Buch arbeiten, das seiner Vollendung entgegenging.
Anthony war heilfroh, dass er nicht an seinem Buch zu arbeiten brauchte. Die Vorstellung, sich hinsetzen und nicht nur Worte hervorbringen zu müssen, in die man seine Gedanken kleiden konnte, sondern vor allem auch Gedanken, die einer solchen Mühe überhaupt wert waren! Nein, die ganze Sache erschien ihm nicht im mindesten erstrebenswert.
Er stieg aus der Wanne und rubbelte sich mit der gewissenhaften Sorgfalt eines Schuhputzers ab. Dann ging er ins Schlafzimmer und lief, eine unbestimmte Melodie pfeifend, hin und her, schloss hier einen Knopf, rückte da etwas zurecht und genoss die Wärme des dicken Teppichs unter seinen Füßen.
Er zündete sich eine Zigarette an und warf das Streichholz aus dem geöffneten oberen Teil des Fensters. Dann blieb er, die Zigarette bis auf fünf Zentimeter vor den halb geöffneten Mund geführt, wie angewurzelt stehen. Sein Blick fixierte einen leuchtenden Farbfleck auf dem Dach eines weiter hinten im Durchgang stehenden Hauses.
Es war eine junge Frau in rotem, vermutlich seidenem Négligé, die sich in der heißen, von keinem Hauch bewegten Luft des sonnigen Spätnachmittags die Haare trocknete. Sein Pfeifen erstarb in der stickigen Zimmerluft. Vorsichtig, unter dem plötzlichen Eindruck, dass sie schön war, trat er noch einen Schritt näher ans Fenster heran. Auf der steinernen Brüstung neben ihr lag ein Kissen von der gleichen Farbe wie das Kleidungsstück, das sie trug, und jetzt stützte sie beide Arme darauf, während sie auf den besonnten Durchgang hinuntersah, in dem Anthony Kinder spielen hörte.
Er beobachtete sie mehrere Minuten lang. Etwas hatte ihn berührt, was sich nicht durch den warmen Duft des Nachmittags oder das sieghaft leuchtende Rot erklären ließ. Er wurde von dem Gefühl bedrängt, dass sie schön war – und dann begriff er, was es war: ihre Distanz – nicht eine edle, kostbare Distanz der Seele, aber immerhin eine wenn auch nur in irdischen Ellen gemessene Entfernung. Die Herbstluft, die Dächer und undeutlichen Stimmen – all das stand zwischen ihnen. Und doch war er eine nicht ganz erklärbare Sekunde lang einem Gefühl der Anbetung näher gewesen als in dem innigsten Kuss, den er je erlebt hatte.
Er vervollständigte seine Garderobe, holte eine schwarze Schleife heraus und band sie sorgfältig vor dem dreiteiligen Spiegel im Badezimmer. Dann ging er, einer spontanen Regung folgend, rasch noch einmal ins Schlafzimmer und sah aus dem Fenster. Die junge Frau war aufgestanden; sie hatte das Haar zurückgeworfen, und er konnte sie jetzt deutlich erkennen. Sie war korpulent, mindestens fünfunddreißig und völlig unbeachtlich. Er schnalzte kurz mit der Zunge, ging zurück ins Badezimmer und scheitelte sein Haar neu.
«To … you … beaut-if-ul lady»,
trällerte er vergnügt.
«I raise … my … eyes …»
Mit einem letzten bändigenden Bürstenstrich, der eine schimmernde Fläche aus schierem Glanz schuf, verließ er das Badezimmer und seine Wohnung und ging die Fifth Avenue hinunter zum «Ritz-Carlton».
Drei Männer
Um sieben sitzen Anthony und sein Freund Maury Noble an einem Ecktisch auf dem kühlen Dach. Wenn man Maury Noble ansieht, drängt sich der Vergleich mit einem großen, schlanken, imposanten Kater auf. Die Augen sind schmal und blinzeln unablässig. Das Haar liegt wie von einer herkulischen Katzenmutter beleckt glatt an. Während Anthonys Studienzeit in Harvard galt Maury als die auffallendste Erscheinung seiner Klasse, eine brillante, originelle Figur, gescheit, zurückhaltend – und als einer der Erwählten.
Diesen Mann betrachtet Anthony als seinen besten Freund, es ist der Einzige unter seinen Bekannten, den er bewundert und – mehr als er selbst zugeben würde – auch beneidet.
Sie freuen sich beide über das Wiedersehen, in ihren Blicken steht eine große Zuneigung, als sie sich nach kurzer Trennung wie neu betrachten. Ihre Spannung löst sich; wenn sie zusammen sind, umfängt sie gelassene Heiterkeit. Maury Noble mit seinem eindrucksvollen, lächerlich katergleichen Gesicht scheint fast zu schnurren, und der nervöse, ruhelose Irrwisch Anthony hat zur Ruhe gefunden.
Sie führen eins dieser lakonischen, knapp formulierten Gespräche, wie sie sich nur Männer leisten, die jünger als dreißig oder stark beansprucht sind.
ANTHONY: Sieben Uhr. Wo steckt bloß dieser Caramel? (ungeduldig:) Wird Zeit, dass er seinen endlosen Roman abschließt. Ich bin schon halb verhungert …
MAURY: Er hat einen neuen Titel. «The Demon Lover» – nicht übel, was?
ANTHONY(interessiert): «The Demon Lover»? Nein, gar nicht schlecht.
MAURY: Recht gut. Wann hattest du gesagt?
ANTHONY: Um sieben.
MAURY(nicht feindselig, aber mit leichter Missbilligung im Blick der verengten Augen): Neulich hat er mich zur Verzweiflung gebracht.
ANTHONY: Wie denn?
MAURY: Diese Angewohnheit, sich Notizen zu machen.
ANTHONY: Geht mir auch so. Offenbar hatte ich am Abend zuvor etwas gesagt, was er verwenden wollte, aber vergessen hatte, und nun ging es ständig: «Überleg doch mal … Kannst du nicht versuchen, dich zu konzentrieren?» Und ich: «Du ödest mich an. Ich weiß es einfach nicht mehr.»
(Maury lacht lautlos, indem er seine Züge verständnisvoll in die Breite gehen lässt.)
MAURY: Dick sieht nicht unbedingt mehr als andere Leute. Er kann nur einen größeren Anteil von dem, was er sieht, zu Papier bringen.
ANTHONY: Dieses durchaus beeindruckende Talent …
MAURY: Oja. Beeindruckend!
ANTHONY: Und diese Energie – ehrgeizige, zielgerichtete Energie. Er ist so unterhaltend, so unheimlich an- und aufregend. Es verschlägt einem oft geradezu den Atem.
MAURY: Oja.
(Schweigen, und dann …)
ANTHONY(dessen schmaler, ein wenig unsicherer Gesichtsausdruck sehr überzeugt wirkt): Aber keine unerschöpfliche Energie. Irgendwann wird sie sich immer mehr verflüchtigen und sein durchaus beeindruckendes Talent ebenfalls, und Zurückbleiben wird ein schmächtiges und kleines Männchen – reizbar, selbstsüchtig und geschwätzig.
MAURY(lacht): Da sitzen wir nun und versichern einander, dass unser kleiner Dick nicht so tiefsinnig zu denken vermag wie wir, dabei möchte ich wetten, dass er seinerseits das Gefühl hat, uns überlegen zu sein. Der kreative gegenüber dem rein kritischen Geist und so weiter.
ANTHONY: Ja, aber das sieht er falsch. Er wird auf tausend lächerliche Schwärmereien hereinfallen. Müsste er nicht als überzeugter Anhänger des Realismus im Gewand des Zynikers daherkommen, wäre er so … so leichtgläubig wie ein religiöser Anführer im College. Er ist Idealist, o ja, auch wenn er vom Gegenteil überzeugt ist, weil er dem Christentum abgeschworen hat. Erinnerst du dich noch, wie er es im College gemacht hat? Einen Schriftsteller nach dem anderen hat er sich einverleibt samt seinen Ideen, seiner Technik, seinen Figuren – Chesterton, Shaw, Wells –, ohne je Schluckbeschwerden zu kriegen.
MAURY(noch mit seiner letzten Bemerkung beschäftigt): Ja, ich weiß.
ANTHONY: Wirklich. Der geborene Fetischist. Nimm nur die Kunst …
MAURY: Komm, wir bestellen. Er wird …
ANTHONY: Ja, gut, bestellen wir. Ich hab’ ihm gesagt …
MAURY: Da kommt er. Schau, er wird mit dem Kellner zusammenstoßen. (Er hebt grüßend einen Finger wie eine freundlich weiche Pfote:) Da bist du ja, Caramel.
EINENEUESTIMME(grimmig): Hallo, Maury. Hallo, Anthony Comstock Patch. Was macht der Enkel des alten Adam? Sind die Debütantinnen immer noch hinter dir her?
(Richard Caramel ist klein und blond – mit fünfunddreißig wird er mit einer Glatze herumlaufen. Er hat gelbliche Augen – das eine ist auffallend klar, das andere trüb wie ein schlammiger Tümpel – und eine vorgewölbte Stirn wie ein Baby in einem Comic-Heft. Auch sonst ist er mit zahlreichen Wölbungen ausgestattet. Sein Bauch wölbt sich prophetisch, die Worte quellen ihm in dicken Wölbungen aus dem Mund, sogar die Taschen seines Smokings wölben sich – als seien sie von der allgemeinen Tendenz infiziert – unter dem Druck von Fahrplänen, Programmen und vielerlei Zetteln, auf denen er sich, die ungleichen Augen zusammenkneifend und mit der freien linken Hand um Ruhe bittend, seine Notizen zu machen pflegt.
An ihrem Tisch angekommen, schüttelt er Anthony und Maury die Hand. Er ist einer von denen, die das Händeschütteln nicht lassen können, auch wenn sie den Betreffenden erst vor einer Stunde gesehen haben.)
ANTHONY: Hallo, Caramel. Schön, dass du da bist, wir brauchen dringend eine heitere Einlage.
MAURY: Du bist spät dran. Bist du einen Block mit dem Briefträger um die Wette gelaufen? Wir haben dich inzwischen genüsslich durchgehechelt.
DICK(richtet das klare Auge erwartungsvoll auf Anthony): Was habt ihr gesagt? Legt los, ich schreib’s auf. Heute Nachmittag hab’ ich in Teil eins dreitausend Worte gestrichen.
MAURY: Edler Ästhet. Und ich habe mir Alkohol in den Bauch geschüttet.
DICK: Das glaube ich dir aufs Wort. Ich wette, ihr zwei sitzt schon seit einer Stunde hier und redet übers Trinken.
ANTHONY: Aber wir kippen nie um, du Milchbart.
MAURY: Wir gehen nie mit Damen nach Hause, die wir in beschwipstem Zustand kennenlernen.
ANTHONY: Alles in allem zeichnen sich unsere Feste durch eine gewisse Vornehmheit aus.
DICK: Eine Ansammlung dieser besonders blödsinnigen Typen, die sich damit brüsten, «Schluckspechte» zu sein. Der Haken ist, dass ihr euch beide nach englischer Gutsherrenart volllaufen lasst, still und diskret, ohne richtigen Spaß daran zu haben. Das ist bei euch nicht drin. O nein, so was tut man nicht.
ANTHONY: Das ist wohl aus Kapitel sechs?
DICK: Wollt ihr ins Theater?
MAURY: Ja. Wir werden uns heute Abend einige hintergründige Gedanken über die Probleme des Lebens machen. Das Stück heißt kurz und bündig «Die Frau». Vermutlich wird sie «büßen» müssen.
ANTHONY: Ach, so was ist es? Dann doch lieber noch mal in die Follies.
MAURY: Die hängen mir zum Hals heraus, ich war dreimal da. (Zu Dick:) Das erste Mal sind wir nach dem ersten Akt gegangen und haben eine umwerfende Bar entdeckt. Als wir wieder rein wollten, sind wir im falschen Theater gelandet.
ANTHONY: Und haben des Längeren mit einem verstörten jungen Pärchen diskutiert, das wir im Verdacht hatten, unsere Plätze in Beschlag genommen zu haben.
DICK(mehr oder weniger zu sich selbst): Ich denke, wenn ich noch einen Roman und ein Bühnenstück geschrieben habe und vielleicht einen Band mit Erzählungen, mache ich mal eine musikalische Komödie.
MAURY: Ja, mit intellektuellen Liedertexten, die keiner hören will. Und alle Kritiker werden dem «guten alten HMS Pinafore» nachtrauern. Und ich werde weiterhin als brillant bedeutungslose Gestalt in einer bedeutungslosen Welt glänzen.
DICK(gespreizt): Kunst ist nicht bedeutungslos.
MAURY: Isoliert gesehen schon. Nur insofern nicht, als sie versucht, das Leben weniger bedeutungslos zu machen.
ANTHONY: Mit anderen Worten, Dick: Du spielst vor einer mit Gespenstern besetzten Tribüne.
MAURY: Was ihn nicht daran hindern sollte, eine gute Vorstellung zu geben.
ANTHONY(zu Maury): Im Gegenteil. Lebten wir in einer Welt ohne Bedeutung, würde ich mich fragen, warum ich überhaupt schreiben soll. Schon der Versuch, ihr Zweck und Ziel zu geben, ist doch dann zwecklos.
DICK: Aber du solltest trotzdem pragmatisch genug sein, um einem armen Schlucker den Sinn seines Lebens zu lassen. Möchtest du denn, dass alle diesen sophistischen Blödsinn akzeptieren?
ANTHONY: Warum nicht …
MAURY: Nein, mein Lieber! Ich glaube, dass in Amerika bis auf eine ausgewählte Tausendschaft jedermann gezwungen werden sollte, sich einem rigiden moralischen System – dem Katholizismus beispielsweise – zu verschreiben. Ich habe nichts gegen konventionelle Moralbegriffe, aber ich habe sehr viel gegen mittelmäßige Häretiker, die sich auf gewisse Erkenntnisse ihrer weltgewandten Mitmenschen stürzen und für sich daraus eine moralische Freiheit ableiten, zu der ihre Intelligenz sie keinesfalls berechtigt.
(Die Suppe kommt, und was Maury vielleicht noch weiter hätte ausführen wollen, ist auf immer dahin.)
Nacht
An einer Theaterkasse erwarben sie zu einem stolzen Preis Karten für eine neue musikalische Komödie mit dem Titel «High Jinks». Im Foyer blieben sie einen Augenblick stehen, um den Einzug des Premierenpublikums zu beobachten. Da gab es Abendmäntel aus vielerlei bunten Seiden und Pelzen; Juwelen, die von Armen und Hälsen und weißrosa Ohrläppchen troffen; ungezählte Glanzlichter an ungezählten Zylinderhüten; gold- und bronzefarbene, rote und tiefschwarz spiegelnde Schuhe; die hochgetürmten festgepackten Coiffuren vieler Frauen, das glatte, mit Wasser gebändigte Haar gepflegter Männer; und vor allem das Wogen gleiche Steigen und Fallen, das Murmeln und Glucksen und Schäumen der fröhlichen Menschenflut, die sich an diesem Abend als glitzernder Strom in die künstliche See des Gelächters ergoss.
Nach dem Stück trennten sie sich. Maury wollte zu «Sherry’s» zum Tanzen, Anthony wollte heim ins Bett.
Langsam bahnte er sich seinen Weg durch das Gedränge am Times Square, dem das Wagenrennen und dessen tausend Satelliten eine seltene Schönheit, Helle und festliche Intimität verlieh. Gesichter jagten an ihm vorbei, ein Kaleidoskop hässlicher Mädchen, ja, Mädchen, die hässlich wie die Sünde, zu dick oder zu mager waren und doch von der Herbstluft getragen wurden wie auf ihrem eigenen warmen, leidenschaftlichen Atem, den sie in die Nacht entließen. Trotz ihrer Vulgarität fand er sie auf eine seltsame Weise geheimnisvoll. Achtsam atmend sog er Parfümduft und den nicht unangenehmen Geruch vieler Zigaretten ein. Er fing den Blick einer dunklen jungen Schönheit auf, die allein in einer geschlossenen Droschke saß. Im matten Licht suggerierte ihr Blick Nacht und Veilchen, und einen Augenblick regte sich in ihm wieder das halb vergessene Gefühl des Fernen, das ihn an diesem Nachmittag erfasst hatte.
Zwei junge Juden kamen an ihm vorbei, die sich mit lauter Stimme unterhielten und mit töricht arrogantem Blick den Kopf hierhin und dorthin wandten. Sie trugen die zu jener Zeit halb in Mode gekommenen übertrieben engen Anzüge, Umlegekragen mit einer Kerbe am Adamsapfel, graue Gamaschen und graue Handschuhe am Spazierstockgriff.
Eine verschüchterte alte Dame schwankte wie ein Korb voller Eier zwischen zwei Herren dahin, die ihr die Wunder des Times Square vorführten und die Erklärungen so rasch auf sie niederprasseln ließen, dass der Kopf des um unbefangene Anteilnahme bemühten Muttchens sich hin und her bewegte wie eine vom Wind verwehte dürre Orangenschale.
Anthony hörte einen Gesprächsfetzen: «Da ist das ‹Astor›, Mama!»
«Schau, die Leuchtreklame mit dem Wagenrennen …»
«Da waren wir heute. Nein, da!»
«Grundgütiger!»
«Ist mir doch schnuppe, ob ich dünn wie ein Dime werde!» Das Witzwort des Jahres kam mit durchdringender Stimme von einem der Paare neben ihm.
«Und da hab’ ich zu ihm gesagt, also, sag’ ich …»
Das leise Rauschen, mit dem Droschken an ihm vorbeirollten, schlug an sein Ohr, und Gelächter, Gelächter, krähenhaft heiser, laut und unablässig, darunter das Gerumpel der Untergrundbahn, darüber die kreisenden, bald größer, bald kleiner werdenden Lichter, die zu perlgroßen Punkten versprühten und sich zu glitzernden Stäben, Ringen, monströs-grotesken Figuren neu zusammenfanden, die verblüffend am dunklen Himmel standen.
Aufatmend flüchtete er sich in die Stille, die wie ein dunkler Wind aus einer Seitenstraße wehte, kam an einer Bäckerei mit Speiselokal vorbei, in der sich ein Dutzend Brathähnchen unermüdlich an einem elektrischen Spieß drehten und der ein teigiger heißer rosa Geruch entströmte, und an einem Drugstore, in dem es nach Medizin, vergossener Limonade und angenehm nach Kosmetikabteilung duftete. Die dampfige stickige chinesische Wäscherei war noch geöffnet, sie roch nach Zusammengelegtem und leicht Vergilbtem. All das deprimierte ihn. An der Ecke Sixth Avenue machte er einen Abstecher in einen Zigarrenladen. Danach fühlte er sich wesentlich besser. Der Zigarrenladen war ein heiterer Ort: in marineblauen Nebel gehüllte Menschheit, die sich ein Stückchen Luxus kaufte …
In seiner Wohnung angekommen, rauchte er, im Dunkeln am offenen Fenster des Vorderzimmers sitzend, eine letzte Zigarette. Zum ersten Mal nach mehr als einem Jahr genoss er New York ohne jeden Vorbehalt. Von der Stadt ging ein erstaunliches Prickeln, etwas fast Südstaatliches aus. Aber sie barg auch sehr viel Einsamkeit. Er, der allein aufgewachsen war, vermied es neuerdings, für sich zu sein. In den letzten Monaten hatte er, wenn er abends nicht verabredet war, nichts Eiligeres zu tun, als einen seiner Clubs aufzusuchen, um Bekannte zu treffen. Oh, diese Einsamkeit hier …
Seine Zigarette, deren Rauch wie leichte weiße Gischt an den dünnen Vorhangfalten hing, glühte, bis die Uhr von St. Anne’s an der Ecke mit klagend-modischem Wohllaut eins schlug. Von der einen stillen halben Block entfernten Stadtbahn her tönte es wie leiser Trommelton; würde er sich aus dem Fenster lehnen, könnte er sehen, wie der Zug, einem zornigen Adler gleich, die dunkle Kurve an der Ecke nahm. Er musste an einen fantastischen Zukunftsroman denken, den er vor Kurzem gelesen hatte und in dem Städte aus fliegenden Zügen heraus bombardiert worden waren, und einen Moment stellte er sich vor, Washington Square habe Central Park den Krieg erklärt und dies sei eine gegen Norden donnernde, Verderben und plötzlichen Tod bringende Gefahr. Dann war der Zug vorbei, das bedrohliche Bild verblasste, übrig blieb ein immer leiser werdender Trommelwirbel und schließlich nur noch das ferne Grummeln des Adlers.
Der Klang der Glocken drang zu ihm und das ständige leise Hupen von Automobilen auf der Fifth Avenue, aber in seiner Straße herrschte Stille, hier war er in Sicherheit vor den Bedrohungen des Lebens, denn da waren seine Tür und der lange Korridor und das schützende Schlafzimmer – selige, selige Sicherheit. Die Bogenlampe, die ihr Licht in sein Fenster schickte, schien zu dieser Stunde wie der Mond, nur heller und schöner.
Rückblende ins Paradies
Die Schönheit, die alle hundert Jahre neu geboren wird, saß in einer Art Freiluftwartezimmer, durch das weiße Winde wirbelten und hin und wieder ein atemlos eiliger Stern. Die Sterne blinzelten ihr im Vorbeihasten vertraulich zu, die Winde zausten sanft ihr Haar. Sie war unbegreiflich, denn in ihr waren Seele und Geist eins – die Schönheit ihres Körpers war das Wesen ihrer Seele. Sie war jene Einheit, nach der Philosophen seit vielen Jahrhunderten streben. In diesem Freiluftwartezimmer der Winde und Sterne hatte sie sich nun hundert Jahre friedlich in die Betrachtung ihrer selbst versenkt. Schließlich wurde ihr kundgetan, dass sie wiedergeboren werden sollte. Seufzend begann sie ein langes Gespräch mit einer Stimme, die in dem weißen Wind war, ein Gespräch, das viele Stunden währte und von dem ich hier nur ein Teilstück wiedergeben kann.
SCHÖNHEIT (mit fast unbewegten Lippen, den Blick wie stets auf ihr Inneres gerichtet): Wohin soll ich diesmal reisen?
DIESTIMME: In ein neues Land – ein Land, das du noch nie gesehen hast.
SCHÖNHEIT(nörgelnd): Ich hasse es, in diese neuen Kulturen einzudringen. Wie lange soll ich diesmal bleiben?
DIESTIMME: Fünfzehn Jahre.
SCHÖNHEIT: Und wie heißt das Land?
DIESTIMME: Es ist das prächtigste, reichste Land auf Erden – ein Land, dessen weise Männer nur wenig weiser als die Dümmsten unter seinen Bewohnern sind; ein Land, dessen Herrscher denken wie die kleinen Kinder und dessen Gesetzgeber an den Weihnachtsmann glauben. Ein Land, in dem starke Männer von hässlichen Frauen herumkommandiert werden …
SCHÖNHEIT (erstaunt): Was?
DIESTIMME(sehr bedrückt): Ja, es ist ein wahrhaft trauriges Spektakel. Frauen mit fliehendem Kinn und formlosen Nasen laufen am helllichten Tag herum und sagen: «Tu das! Tu jenes!», und alle Männer, sogar die reichsten, gehorchen diesen Frauen, die sie vollmundig entweder als «Mrs. Sowieso» oder «Meine Gattin» bezeichnen.
SCHÖNHEIT: Aber das darf doch nicht wahr sein. Dass sie auf reizvolle Frauen hören, kann ich ja verstehen. Aber auf dicke Frauen? Auf knochige Frauen? Auf Frauen mit hageren, faltigen Wangen?
DIESTIMME: So ist es.
SCHÖNHEIT: Und wie steht es mit mir? Welche Chancen habe dann ich?
DIESTIMME: Du wirst dich recht schwertun, wie man so sagt.
SCHÖNHEIT(nach einer unzufriedenen Pause): Warum nicht die alten Länder, das Land der Trauben und charmanten Männer oder das Land der Schiffe und Meere?
DIESTIMME: Die dürften in Kürze sehr viel zu tun bekommen.
SCHÖNHEIT: Oh!
DIESTIMME: Dein Leben auf Erden stellt wie stets den Zeitabstand zwischen zwei bedeutungsvollen Blicken in einen irdischen Spiegel dar.
SCHÖNHEIT: Aber jetzt sag: Was werde ich sein?
DIESTIMME: Zunächst war daran gedacht, dich als Filmschauspielerin auf die Erde zu schicken, aber davon ist man abgekommen. Du wirst diese fünfzehn Jahre als sogenanntes «Soseiäti Görl» getarnt verbringen.
SCHÖNHEIT: Was ist das?
(Im Wind ist ein neuer Laut zu hören, den wir uns wohl als nachdenkliches Kopfkratzen der Stimme deuten müssen.)
DIESTIMME(nach geraumer Zeit): Eine Art Talmi-Aristokratie.
SCHÖNHEIT: Und was ist Talmi?
DIESTIMME: Auch das wirst du in diesem Land erfahren. Du wirst auf viel Talmi treffen. Und auch du wirst vieles tun, was Talmi ist.
SCHÖNHEIT(resigniert): Das klingt alles sehr ordinär.
DIESTIMME: Nicht halb so ordinär, wie es ist.
Man wird dich in diesen fünfzehn Jahren «Ragtime Kid», «Flapper», «Jazzbaby» und «Babyvamp» nennen. Du wirst neue Tänze tanzen – mit ebenso viel Anmut wie die alten.
SCHÖNHEIT(flüsternd): Wird man mich bezahlen?
DIESTIMME: Ja, wie üblich. Mit Liebe.
SCHÖNHEIT(mit einem leichten Lachen, bei dem ihre sonst so unbeweglichen Lippen ganz kurz zucken): Und wird es mir gefallen, wenn man mich «Jazzbaby» nennt?
DIESTIMME(trocken): Ja. Sehr sogar …
(Hier endet der Dialog. Die Schönheit sitzt noch immer still da, die Sterne bleiben in verzückter Bewunderung stehen, der weiße, böige Wind fährt ihr durchs Haar.
All das geschah sieben Jahre, ehe Anthony am offenen Fenster seiner Wohnung saß und den Glockenschlägen von St. Anne’s nachhorchte.)
2 PORTRÄT EINER SIRENE
Einen Monat später legte sich frostige Frische auf New York; sie brachte den November mit, die drei großen Footballspiele und ein gewaltiges Gewoge von Pelzen auf der Fifth Avenue. Und sie brachte auch eine fühlbare Spannung und unterdrückte Erregung in die Stadt. Jeden Morgen waren jetzt Einladungen in Anthonys Post. Drei Dutzend tugendhafte Damen aus der obersten Schublade der Gesellschaft taten ihre Befähigung, ja, ihre ausdrückliche Bereitschaft kund, drei Dutzend Millionären Kinder zu gebären. Fünf Dutzend tugendhafte Damen der zweiten Schublade begnügten sich nicht damit, diese Befähigung kundzutun, sondern ließen sich von ihren hochfliegenden Plänen im Hinblick auf besagte drei Dutzend junge Männer nicht abbringen, die natürlich zu sämtlichen sechsundneunzig Partys geladen wurden – ebenso wie die Freunde, Bekannten, Collegestudenten und begehrlichen jungen Außenseiter der jeweiligen jungen Dame. Dann gab es noch eine dritte Schublade junger Damen aus den Randbezirken, aus den Vororten von Newark und Jersey bis hinauf ins kalte Connecticut und zu den nicht gesellschaftsfähigen Vierteln von Long Island – und danach zweifellos weitere Schubladen bis hinunter zur untersten Krabbelkiste: Jüdinnen debütierten in einer Gesellschaft jüdischer Männer und Frauen von der Riverside bis zur Bronx und warteten hoffnungsvoll auf einen strebsamen jungen Börsenmakler oder Juwelier und eine koschere Hochzeit. Irische Mädchen richteten ihren Blick endlich einmal erlaubterweise auf eine Gesellschaft junger Politiker aus Tammany Hall, fromme Bestattungsunternehmer und erwachsene Chorknaben.
Und natürlich steckte diese Debütantinnen-Atmosphäre an; die Arbeiterinnen, arme hässliche Seelchen, die in den Fabriken Seife einwickelten und in den großen Kaufhäusern den Kundinnen Putz vorlegten, träumten davon, in der unglaublichen Erregung dieses Winters womöglich doch den ersehnten Mann zu ergattern – so wie ein unbegabter Taschendieb sich in einer leichtsinnigen Volksfestmenge erhöhte Chancen ausrechnen mag. Und die Schornsteine begannen zu rauchen, und in der stickigen Untergrundbahn spürte man einen Hauch von Frische. Und die Schauspielerinnen debütierten in neuen Stücken und die Verleger mit neuen Büchern und die Castles mit neuen Tänzen. Und die Eisenbahnen debütierten mit neuen Fahrplänen, die neue Fehler enthielten statt der alten, an die man sich als Pendler inzwischen gewöhnt hatte.
Die Stadt debütierte!
Als Anthony eines Nachmittags unter einem stahlgrauen Himmel über die Forty-second Street ging, lief er unvermutet Richard Caramel in die Arme, der aus dem Friseurladen des «Manhattan Hotel» kam. Es war ein kalter Tag, der erste wirklich kalte Tag, und Caramel hatte einen dieser knielangen, schaffellgefütterten Mäntel an, wie sie Arbeiter im Mittleren Westen tragen und die gerade von der modischen Welt entdeckt worden waren. Sein weicher Filzhut war von diskret dunkelbrauner Farbe, und darunter leuchtete sein klares Auge wie ein Topas. Begeistert hielt er Anthony an, schlug ihm – weniger spielerisch als aus dem Wunsch heraus, sich warm zu halten – auf beide Arme und legte nach dem unvermeidlichen Händedruck los.
«Verteufelt kalt heute! Ich habe den ganzen Tag gearbeitet wie besessen, bis es in meinem Zimmer so kalt wurde, dass ich Angst hatte, mir eine Lungenentzündung zu holen. Meine Wirtin ist verflixt knauserig mit den Kohlen, sie kam erst zum Vorschein, nachdem ich eine halbe Stunde auf der Treppe nach ihr gerufen hatte, und sie rechtfertigte sich des Langen und Breiten. Erst hat sie mich damit verrückt gemacht, dann aber interessierte sie mich als Figur, und ich habe mir, während sie redete, Notizen gemacht, natürlich ganz unauffällig, als ob ich nebenbei etwas aufschreibe.»
Er hatte Anthony am Arm gepackt und marschierte in flottem Tempo mit ihm die Madison Avenue hoch.
«Wohin?»
«Eigentlich nirgendwohin.»
«Was soll dann das Ganze?», fragte Anthony.
Sie blieben stehen und sahen sich an, und Anthony überlegte, ob sein Gesicht in der Kälte ebenso abstoßend wirkte wie das von Dick Caramel, dessen Nase scharlachrot, dessen vorgewölbte Stirn blau, dessen helle ungleiche Augen rot gerändert waren und tränten. Nach einer kurzen Pause gingen sie weiter.
«Bin mit meinem Roman schon ganz schön weit gekommen», sagte Dick emphatisch, den Blick auf den Gehsteig gerichtet. «Aber ab und zu muss ich auch mal raus, ein Wort reden.» Er warf Anthony einen entschuldigenden, gleichsam um Ermutigung flehenden Blick zu. «Ich glaube, dass die wenigsten Menschen jemals richtig denken – so, dass sie sich hinsetzen und überlegen und Gedanken aneinanderreihen, meine ich. Ich besorge das Denken beim Schreiben oder im Gespräch. Man braucht einen Ansatz … etwas, was man rechtfertigen oder niedermachen kann … Findest du nicht?»
Anthony brummte und entzog Dick vorsichtig seinen Arm. «Ich habe an sich nichts dagegen, dich zu schleppen, aber mit diesem Mantel …»
«Ich meine», fuhr Richard Caramel eindringlich fort, «dass auf dem Papier dein erster Absatz die Idee enthält, die du verdammen oder über die du dich ausführlicher auslassen willst. Im Gespräch kannst du dich an die letzte Bemerkung deines Gegenübers halten, doch wenn du einfach dasitzt und grübelst, jagen sich deine Gedanken wie Bilder in einer Laterna magica, bei der eins das andere ablöst und verdrängt.»
Sie ließen die Forty-fifth Street hinter sich und verlangsamten den Schritt. Beide zündeten sich eine Zigarette an und entließen gewaltige Rauch- und Wasserdampfwolken in die Luft.
«Lass uns auf einen Eggnogg bis zum ‹Plaza› gehen», schlug Anthony vor. «Die Luft wird dir guttun und bläst dir das widerliche Nikotin aus den Lungen. Komm! Du darfst auch auf der ganzen Strecke über dein Buch sprechen.»
«Nicht, wenn es dich langweilt. Mir zu Gefallen muss es nicht sein», sprudelte Dick hastig hervor und verzog, so gleichmütig er sich auch gab, besorgt das Gesicht, sodass Anthony sich bemüßigt fühlte zu protestieren: «Natürlich langweilt es mich nicht! Wo denkst du hin?»
«Ich habe eine Cousine …», setzte Dick an, aber Anthony unterbrach ihn, indem er mit einem leisen Schrei des Wohlbehagens die Arme ausstreckte.
«Schönes Wetter, nicht? Ich fühle mich wie ein Zehnjähriger. Oder so, wie ich mich von Rechts wegen als Zehnjähriger hätte fühlen müssen. Mörderisch! Himmel noch mal, eben noch ist das meine Welt, und gleich darauf hält sie mich wieder zum Narren! Heute ist es meine Welt, und alles ist ganz leicht. Selbst das Nichts ist leicht.»
«Ich habe eine Cousine im ‹Plaza›. Famoses Mädchen. Der könnten wir guten Tag sagen. Im Winter wohnt sie neuerdings mit ihren Eltern dort.»
«Ich wusste gar nicht, dass du Verwandtschaft in New York hast.»
«Sie heißt Gloria und ist aus meiner Heimatstadt – Kansas City. Ihre Mutter ist praktizierende Bilphistin, und ihr Vater ist furchtbar öde, aber ein echter Gentleman.»
«Sind sie literarisches Material?»
«Sie bemühen sich nach Kräften darum. Der Alte erzählt mir ständig, ihm sei gerade eine ganz wunderbare Romanfigur über den Weg gelaufen. Und dann erzählt er mir von irgendeiner blödsinnigen Bekannten und meint: ‹Na, wenn das keine Type ist! Über den solltest du schreiben. Für solche Burschen interessiert sich jeder.› Oder er kommt auf Japan oder Paris oder sonst einen nahe liegenden Ort zu reden und fragt: ‹Warum schreibst du nicht über diese Stadt, wär’ doch ein großartiger Schauplatz für eine Geschichte.›»
«Und wie ist diese … diese Gloria?»
«Gilbert. Gloria Gilbert, du musst schon von ihr gehört haben. Sie geht zu College-Tanzereien … und so Sachen.»
«Der Name kommt mir bekannt vor.»
«Sieht gut aus. Verflixt attraktives Mädchen.»
Sie waren an der Fiftieth Street angekommen und bogen in die Fifth Avenue ein.
«Normalerweise interessiere ich mich nicht für junge Mädchen», sagte Anthony stirnrunzelnd.
Diese Aussage entsprach nicht ganz den Tatsachen. Zwar hatte er bei den landläufigen Debütantinnen immer den Eindruck, dass sie ihre Tage ausschließlich damit verbrachten, darüber nachzudenken und zu reden, was die große Welt in der nächsten Stunde für sie in petto hatte, ein Mädchen aber, das unmittelbar von ihrem guten Aussehen lebte, interessierte ihn sogar sehr.
«Gloria ist verteufelt nett. Keine Spur von Hirn im Kopf.»
Anthony ließ sein kurzes, schnaubendes Lachen hören. «Womit du wohl sagen willst, dass sie nicht hochgestochen über Literatur reden kann.»
«Durchaus nicht!»
«Dick, du weißt genau, was du unter Frauen verstehst, die Hirn im Kopf haben, wie du sagst. Das sind junge Damen, die mit dir in einer Ecke sitzen und fade Gespräche über das Leben führen. Frauen von der Sorte, die mit sechzehn allen Ernstes erörterten, ob Küssen recht oder unrecht und das Biertrinken für Erstsemester unmoralisch ist.»
Richard Caramel war sichtlich gekränkt. Seine Stirn war voller Knitterfalten wie ein zusammengeknülltes Blatt Papier.
«Nein …», setzte er an, aber Anthony fiel ihm rücksichtslos ins Wort: «O doch. Von der Sorte, die jetzt in Ecken sitzt und über den neuesten skandinavischen Dante in englischer Übersetzung debattiert.»
Dick sah ihn an. Sein Gesicht hatte sich bekümmert in die Länge gezogen, und er fragte Anthony fast flehentlich: «Was ist bloß los mit Maury und dir? Manchmal redet ihr, als wäre ich irgendwie zweitklassig.»
Anthony stutzte, aber weil er fror und auch ein bisschen verlegen war, entschied er sich für den Angriff als beste Verteidigung. «Ich glaube nicht, dass dein Hirn so wichtig ist, Dick.»
«Natürlich ist es wichtig», stieß Dick zornig hervor. «Was soll denn das? Wieso soll es nicht wichtig sein?»
«Vielleicht weißt du ja mehr, als deiner Feder guttut.»
«Ausgeschlossen.»
«Ich könnte mir vorstellen», beharrte Anthony, «dass jemand über so viel Wissen verfügt, dass sein Talent nicht ausreicht, um es angemessen zu formulieren. Wie bei mir. Angenommen, ich wäre klüger und weniger begabt als du. Das würde mir womöglich die Sprache verschlagen. Du hingegen hast genug Wasser, um den Eimer zu füllen, und einen Eimer, der groß genug ist, das Wasser aufzunehmen.»
«Ich kann dir nicht folgen», klagte Dick entmutigt. Er war so bestürzt, dass sich alles an ihm protestierend zu wölben schien, und weil er Anthony nicht aus den Augen ließ, stieß er immer wieder mit Passanten zusammen, was ihm böse Blicke einbrachte.
«Ich meine damit, dass ein Talent wie Wellsdie Intelligenz eines Spencer transportieren konnte. Aber ein zweitklassiges Talent wirkt nur dann ansprechend, wenn es zweitklassige Gedanken transportiert. Und je enger du etwas siehst, desto unterhaltender kannst du dich dazu äußern.»
Dick wusste offenbar nicht recht, wie ernst Anthonys Kritik zu nehmen war. Der aber sprach schon mit einer Geläufigkeit weiter, die ihn häufig überkam – mit leuchtenden Augen, hochgerecktem Kinn, erhobener Stimme, auch körperlich scheinbar über sich selbst hinauswachsend: «Angenommen, ich wäre stolz, vernünftig und weise – ein Athener unter Griechen. Dann könnte ich womöglich Schiffbruch erleiden, wo ein Geringerer reüssieren würde. Er könnte nachahmen, ausschmücken, sich begeistern, hoffnungsvoll konstruktiv ans Werk gehen. Mein hypothetisches Ich aber wäre zu stolz zur Nachahmung, zu vernünftig, um sich zu begeistern, zu weltgewandt für eine Utopie, zu griechisch für Ausschmückungen.»
«Dann glaubst du nicht, dass die Arbeit des Künstlers aus seiner Intelligenz erwächst?»
«Nein. Er verbessert, soweit er kann, das, was er stilistisch imitiert, und wählt aus der eigenen Interpretation seiner Umwelt das aus, was sich als Material anbietet. Aber jeder Schriftsteller schreibt schließlich, weil das seine Art zu leben ist. Erzähl mir nicht, dass du mit diesem Gewäsch von der ‹göttlichen Funktion des Künstlers› einverstanden bist …»
«Ich nenne mich ja nicht einmal selbst einen Künstler.»
«Dick, ich möchte dich um Verzeihung bitten», sagte Anthony in verändertem Ton.
«Wofür?»
«Für diesen Ausbruch. Es tut mir ehrlich leid. Er war reine Effekthascherei.»
Ein wenig besänftigt gab Dick zurück: «Ich sage ja immer, dass du im Grunde deines Herzens ein Philister bist.»
In der frostklirrenden Dämmerung verschwanden sie hinter der weißen Fassade des «Plaza Hotel» und schlürften genüsslich den Schaum und das sämige Gelb ihres Eggnogg. Anthony musterte seinen Begleiter. Auf Richard Caramels Nase und seiner Stirn zeigte sich allmählich wieder dieselbe Farbe: Aus Ersterer zog sich das Rot, aus Letzterer das Blau zurück. Bei einem Blick in den Spiegel sah Anthony zu seiner Genugtuung kein missfarbenes, sondern ein frisches, gut durchblutetes Gesicht. Noch nie, fand er, hatte er vorteilhafter ausgesehen.
«Mir reicht das», erklärte Dick im Ton eines Sportlers, der im Training ist. «Ich will mal eben hoch zu den Gilberts. Kommst du mit?»
«Warum nicht? Vorausgesetzt, du hängst mir nicht die Eltern an und verziehst dich mit Dora in eine Ecke.»
«Nicht Dora. Gloria.»
Sie ließen sich telefonisch anmelden, fuhren mit dem Aufzug in den zehnten Stock und folgten einem verwinkelten Gang bis zur Tür von Nr. 1088. Eine Dame mittleren Alters öffnete ihnen: Mrs. Gilbert höchstpersönlich.
«Einen schönen guten Tag, die Herren!» Sie sprach in dem gekünstelten Ton der konventionellen Amerikanerin. «Das ist ja wirklich ganz schrecklich nett …»