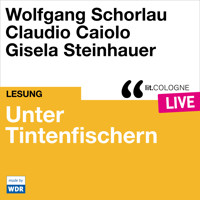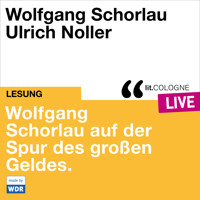9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Dengler ermittelt
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
Eine literarische Ermittlung im größten Kriminalfall der Nachkriegsgeschichte: den Morden des NSU Die Sicherheitsbehörden ermitteln nicht gegen die Täter, sondern gegen das Umfeld der Opfer der NSU-Mordserie, Akten werden geschreddert, der Verfassungsschutz hat überall seine Finger im Spiel … Was, wenn das kein bloßes Behördenversagen ist? Wer hält seine schützende Hand über die Mörder? Ein unbekannter Auftraggeber setzt den Privatermittler Georg Dengler auf die Spur. »Wer erschoss Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt?«, will er wissen. Dengler, notorisch pleite, nimmt den Auftrag an. Als er erfährt, dass Harry Nopper, sein Gegenspieler aus der Zeit beim Bundeskriminalamt, nun Vizepräsident des Thüringer Verfassungsschutzes ist, taucht Dengler tief in das Netz von Neonazis und Verfassungsschutz ein. Er beschafft sich die Ermittlungsakten zum angeblichen Selbstmord von Mundlos und Böhnhardt und deckt Schicht für Schicht die Anatomie eines Staatsverbrechens auf. Bis sich ihm eine Frage auf Leben und Tod stellt. Ein zusätzliches Kapitel fasst Georg Denglers neueste, beunruhigende Recherchen zusammen: Der Tatort des angeblichen Selbstmords von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt stellt sich als komplette Inszenierung heraus. Beide verstarben schon mindestens zwölf Stunden vor dem offiziell angegebenen Todeszeitpunkt. Alle Fälle von Georg Dengler: - Die blaue Liste - Das dunkle Schweigen - Fremde Wasser - Brennende Kälte - Das München-Komplott - Die letzte Flucht - Am zwölften Tag - Die schützende Hand - Der große Plan - Kreuzberg BluesDie Bücher erzählen eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 489
Ähnliche
Wolfgang Schorlau
Die schützende Hand
Denglers achter Fall
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Inhaltsverzeichnis
Über Wolfgang Schorlau
Über dieses Buch
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
Inhaltsverzeichnis
Hinweis
Widmung
Motto
Figuren
Erster Teil - Köln
1. Köln, 9. Juni 2004, Buchhandlung von Tufan Basher, Keupstraße
2. Stuttgart, Büro Georg Dengler
3. Berlin, 3. Januar 2011, Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika
4. Mietschulden
5. Berlin, 8. November 2011, Büro des Fraktionsvorsitzenden der SPD
6. Abends im Basta
7. Erfurt, Landeskriminalamt Thüringen
8. Der Auftrag
9. Köln, 10. Juni 2004, Wohnung von Tufan Basher, Keupstraße
10. Sieben goldene W
11. Der Zauber des Anfangs
12. Köln, 10. Juni 2004, Polizeipräsidium
13. Dengler und Olga
14. Erste Ermittlung
15. Dengler in Köln, 2004
16. Iris
17. Köln, 11. November 2011, Aktenvernichtung
18. Zweite Ermittlung
19. Dengler in Köln (2), 2004
20. Dritte Ermittlung
21. Leopold Harder, Redaktion Stuttgarter Blatt
22. Denglers Traum
23. Denglers Trauma
24. Notarzt
Zweiter Teil - Kassel
25. Der Mord in Kassel
26. Pontius Pilatus
27. Füße voraus
28. Think Tank
29. Die weiteren Fakten
30. Der Jäger
31. Jura
32. Spencers Vortrag
33. Ermittlerrunde
34. Dr. Schweikert
35. Die schweigende Frau
Dritter Teil - Erfurt
36. Erinnerungen
37. Stenzel
38. Theaterbombe
39. Weiteres Material
40. Berlin-Hellersdorf: eine Art Café
41. Stregda
42. 3. Januar 2011, Kanzleramt
43. Thüringen
44. Professor Stern
45. Jena, Rechtsmedizin
46. Der Schlüssel
47. Das Kabinett
48. Der Beweis
49. Beratung
50. Observation
51. Feuerwehr
52. Telefonat Sicherheitsmann
53. Feuerwehr (2)
54. 3. Januar 2011, Ku-Klux-Klan
55. Observation (2)
56. Gespräch mit Frau Professor Kullmann
57. Rückfahrt
58. Arthur
Vierter Teil - Heilbronn
59. Der Mord in Heilbronn
60. Brauer fasst einen Entschluss
61. Neue Akten
62. Brauer vernimmt Nachbarn
63. Die widersprüchliche Lage
64. Kleines Geschäft
65. Telefonat Samsung
66. Falschaussagen
67. Unter Strom
68. Auspuff
69. Der Händler
70. Der Auftrag
71. Brandgutachten
72. Die Lüge und der Polizeiberuf
73. Gas
74. Boxster
75. Das Gewicht
76. Harry Nopper
77. Brauers Fahrt
78. Wut
79. Waffe Kiesewetter
Finden und Erfinden – ein Nachwort
Neues zur Schützenden Hand Nachwort zur Taschenbuchausgabe
Wann und wo kamen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt ums Leben?
Denglers neue Ermittlungen
Auswahl der benutzten Fachliteratur
Inhaltsverzeichnis
Trotz der Verwendung von Ermittlungsunterlagen und obwohl »Die schützende Hand« sich mit realen Verbrechen beschäftigt: Dieses Buch ist ein Roman, ein Werk der Fiktion. Alle Figuren sind ausschließlich meiner Fantasie entsprungen.
Informationen zu diesem Buch:
www.schorlau.com
Inhaltsverzeichnis
Dieses Buch ist gewidmet den Familien von Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoǧru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Mehmet Turgut, İsmail Yaşar, Theodoros Boulgarides, Mehmet Kubaşık, Halit Yozgat und Michèle Kiesewetter.
In Erinnerung an die über 200 Todesopfer rechtsradikaler Gewalt seit 1990.
Inhaltsverzeichnis
»Ich empfehle ein gewisses Vertrauen in den Staat und seine Sicherheitsbehörden. … Außerdem weise ich darauf hin, dass sowohl BND als auch das Bundesamt für Verfassungsschutz von zwei hochkompetenten und absolut integren Beamten geleitet werden.«
Der frühere Bundesinnenminister Otto Schily, Der Spiegel vom 29. Juli 2013
»Als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland verspreche ich Ihnen: Wir tun alles, um die Morde aufzuklären und die Helfershelfer und Hintermänner aufzudecken und alle Täter ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Daran arbeiten alle zuständigen Behörden in Bund und Ländern mit Hochdruck. Das ist wichtig genug, es würde aber noch nicht reichen. Denn es geht auch darum, alles in den Möglichkeiten unseres Rechtsstaates Stehende zu tun, damit sich so etwas nie wiederholen kann.«
Bundeskanzlerin Angela Merkel, am 23. Februar 2012 auf der Gedenkfeier für die Opfer des NSU
Inhaltsverzeichnis
Figuren
Privatermittler
OlgaDenglers Freundin
Martin KleinSchreiber von Horoskopen und angehender Kriminalschriftsteller, Denglers Freund
MarioKünstler, Denglers Freund
Leopold HarderJournalist vom Stuttgarter Blatt, Denglers Freund
Marius BrauerKriminaloberkommissar, LKA Thüringen
Arthur SchützKriminalhauptkommissar, LKA Thüringen
James D. SpencerBotschafter der USA in Deutschland
Klaus-Dieter Welkerstellvertretender Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz in Köln
Iris Welkerseine Frau
Gerhard StenzelPolizeidirektor
Harry Nopperstellvertretender Präsident des Landesamtes für Verfassungsschutz in Thüringen
Tufan BasherBuchhändler, Keupstraße in Köln
Dr. SchweikertDenglers früherer Vorgesetzter beim BKA
MarliesChefsekretärin im BKA
Hans BaderKriminalist und OibE der Staatssicherheit
Professor Ludwig Sternfrüherer Leiter der Rechtsmedizin in Jena
Professorin Edith KullmannLeiterin der Rechtsmedizin in Jena
Inhaltsverzeichnis
Erster TeilKöln
1.Köln, 9. Juni 2004, Buchhandlung von Tufan Basher, Keupstraße
Es ist 15.42 Uhr.
Ein warmer Sommernachmittag. Tufan hat das Jackett zur Seite gelegt und steht im kurzärmligen Hemd vor dem neuen Kopierer.
Hier in seinem Buchladen ist es nicht so heiß wie draußen auf der Straße. Schon mittags, nachdem Frau Uzun als letzte Angestellte den Laden verlassen hatte, hat Tufan die Rollläden an der Vorderfront des Schaufensters und an der Eingangstür fast ganz herabgelassen. Mittwochnachmittags ist die Buchhandlung immer geschlossen. Er mag diese ruhigen Stunden, in denen er allein im Laden ist.
Ratsch, ratsch, ratsch – der Kopierer spuckt die Einladungen für die nächste Sitzung des »Vereins Keupstraße« aus, eines Zusammenschlusses der Einzelhändler in der Straße. Große Entscheidungen stehen an. Ratsch, ratsch, ratsch – Tufan legt die Hand auf die Abdeckung des Geräts. Die Investition hat sich gelohnt. Doch als hätte die Maschine auf dieses Zeichen gewartet, stößt sie genau in diesem Moment ein würgendes Geräusch aus und bleibt stehen; die rote Signalleuchte leuchtet auf. »Papierstau«, meldet die Anzeige. Tufan schaut instinktiv auf die Uhr.
Es ist 15.46 Uhr.
Wo ist der Hebel, um die Abdeckung zu öffnen? Tufans Hände tasten suchend die Seitenwände und die Rückwand ab – ohne Erfolg. Frau Uzun wird wissen, wie der Kopierer zu öffnen ist. Ob er sie anrufen soll? Er verwirft den Gedanken sofort. Sie wird ihn auslachen. Ohne mich sind Sie verloren, wird sie triumphierend sagen. Und das will er heute nicht hören. Verdammt noch mal, ich bin doch der Chef, also muss ich auch wissen, wie dieser neue Kopierer funktioniert, denkt er. Seine Hände fahren weiter die Seitenwände entlang. Er tastet, als wäre er blind. Nichts.
Wenige Minuten später findet er ihn, den länglichen Hebel, direkt oben auf der Abdeckung in einer Mulde, nicht mehr an der Rückseite wie bei dem alten Gerät. Tufan betätigt ihn, die Verriegelung löst sich. Tufan klappt das Kopfteil des Kopierers nach oben. Es geht ganz leicht. Er sieht das verknautschte Blatt sofort, das sich zwischen den Walzen verheddert hat. Er greift mit zwei Fingern ins Innere, zieht vorsichtig an dem Papier, die Walzen bewegen sich träge und geben das Blatt frei. Er drückt die Abdeckung zurück und atmet auf. Das hat er doch ganz fein ohne Frau Uzun hingekriegt.
Es ist jetzt 15.51 Uhr.
Der Toner hat seine Finger schwarz gefärbt. Zeigefinger und Daumen sind verdreckt. Auch die Abdeckung hat er mit Toner beschmiert. Er fährt mit dem Handballen über den grauen Kunststoff, doch der Schmutz bleibt. Er reibt fester, aber er verteilt den Toner nur über eine größere Fläche. Frau Uzun wird morgen den Fleck wegwischen, so, dass es jeder sehen kann. Der Chef hat kopiert und einen Saustall hinterlassen, wird ihr Blick ohne Worte sagen, und sie braucht dazu nicht einmal mit den Augen zu rollen. Tufan seufzt und geht in den hinteren Teil des Ladens, öffnet die Tür zu der kleinen Teeküche und wäscht sich die Hände. Dann nimmt er ein Papierhandtuch aus dem Spender, hält es unter den laufenden Wasserhahn, reibt zweimal mit der Seife über das nasse Papier, dreht den Wasserhahn zu und geht zurück ins Dämmerlicht, das in der Buchhandlung herrscht.
Als er mit dem Papiertuch über den Kopierer wischt, ist es 15.56 Uhr.
Dann bleibt mit einem Mal die Zeit stehen.
Ein Donnerschlag. Das Oberlicht über der Eingangstür platzt, Scherben schießen wie Geschosse durch den Raum. Instinktiv wirft Tufan sich auf den Boden, bäuchlings, die Hände schützend über dem Hinterkopf gekreuzt. Rechts und links, er hört es genau, knallen die Scherben auf den Kopierer, die Computer, die Tische und gegen die Wände.
Plötzlich ist es still.
Eine Explosion, denkt Tufan. So musste es ja kommen. Ali, der Kneipenwirt gegenüber – ständig lädt er die schweren Butangasflaschen aus dem Kofferraum seines Autos direkt vor dem Restaurant aus, hortet sie irgendwo im Keller seines Lokals. Eine, zwei, drei. Tufan hält den Kopf unter seinen Oberarmen geschützt, bewegt sich nicht. Eine weitere Flasche könnte explodieren. Wer weiß.
Wie oft hat er Ali gesagt, dass er mit dem Butangas vorsichtig sein soll? Warum reicht ihm nicht ein Behälter? Warum schleppt er immer mehrere davon an?
Was, wenn jemand verletzt worden ist?
Er bleibt noch einen Moment liegen, ein paar Sekunden nur, dann steht er auf, klopft sich den Staub von den Knien und läuft über die Scherben des Oberlichts zum Schaufenster. Auf dem Boden liegt etwas, was da nicht hingehört: ein Stift, grau, groß wie ein Kugelschreiber. Ein zweiter Stift ragt aus einem Buchrücken. Goethes »Wahlverwandtschaften«, ohnehin unverkäuflich, aber eines seiner Lieblingsbücher. Er bückt sich, greift nach dem Stift, hebt ihn auf – und lässt ihn sofort wieder fallen. Das Ding ist glühend heiß. Er reibt den schmerzenden Finger an der Wange. Doch auch die ist heiß. Verwirrt wendet er sich wieder zum Schaufenster, zieht den Rollladen ein Stück hoch, sodass er durch die schmalen Schlitze zwischen den Lamellen nach draußen sehen kann.
Verwüstung.
Glasscherben, Splitter – überall auf der Straße. Gegenüber ist eine Markise heruntergerissen, weiter hinten liegt eine Tür mitten auf der Fahrbahn, eine Rauchwolke wölbt sich über die Straße. Er hört Schreie, sieht Körper auf dem Boden liegen. Eine Frau brüllt, laut und schrill. Das Schreien kommt von der linken Seite des Buchladens.
Er ahnt mehr, als dass er versteht: Was immer hier passiert ist, es muss am Eingang der Keupstraße geschehen sein. Gedankenfetzen jagen ihm durch den Kopf: die Gasflaschen. Er hat Ali – verflucht sei er – oft genug gesagt: Sei vorsichtig mit den Gasflaschen! Die Keupstraße ist belebt, hat er zu ihm gesagt. Hier laufen, leben, arbeiten Menschen. Aber Ali hat nicht auf ihn hören wollen.
Da sieht Tufan einen Mann, der vor seinem Schaufenster steht. Ein Deutscher wahrscheinlich, helle Haut, mittelgroß, braune kurz geschnittene Haare. Unter seinem offen stehenden Jackett schaut der Griff einer Pistole hervor.
Allah sei Dank! Die Polizei ist schon da!
Tufan geht zwei Schritte auf die Eingangstür seines Geschäftes zu, bemerkt dann die herabgelassenen schweren Rollläden davor, greift in die Hosentasche, um die Schlüssel zu suchen, findet sie nicht, hastet hinüber zur Seitentür, die in den Flur führt und nicht abgeschlossen ist, er öffnet sie, steht im Treppenhaus, reißt die Tür zur Keupstraße auf – und steht direkt vor dem Polizisten, der gerade einem Mann auf der anderen Straßenseite etwas zuruft, einem Mann, der auch eine Waffe sichtbar im Schulterhalfter trägt. Noch ein Polizist, denkt Tufan. So schnell sind sie da in Deutschland. Wie beruhigend. Der zweite Mann steht direkt neben dem Torbogen, einer Art Durchfahrt, durch die man die Keupstraße verlassen kann. Tufan kann nicht verstehen, was der Mann seinem Kollegen zuruft.
Aber warum helfen sie nicht, diese Männer? Vor dem Friseurladen weiter rechts liegen Menschen auf der Straße, Blut überall, ein Mann torkelt mit aufgerissenen Augen von einer Straßenseite zur anderen, stolpert über ein Fahrrad, das aussieht, als sei es von einer Riesenhand zusammengedrückt worden, die Frau schreit immer noch, ein Kind brüllt, schwarze Rauchschwaden vor dem Friseurladen, es stinkt nach … nach Schwarzpulver, denkt Tufan. Fenster ohne Scheiben, Häuser ohne Türen, überall.
»Was ist passiert?«, fragt er den Polizisten. Der Mann ist etwa 1,75 Meter groß, größer als er, doch Tufan steht auf dem Treppenabsatz und blickt ihm daher direkt in die Augen. Der Mann weicht dem Blick aus, antwortet nicht, dreht sich um.
»Was ist passiert?«, wiederholt Tufan.
Der Polizist deutet auf den Boden: »Na, wonach sieht das wohl aus?«
Tufan blickt nach unten, und erst jetzt sieht er die großen Nägel, die überall auf dem Boden liegen. Zimmermannsnägel, lange Stifte, genau wie die in seinem Laden. Woher kommen diese Nägel, wenn eine Gasflasche explodiert ist? Irgendwo in seinem Kopf macht sich Angst breit. Es geht um etwas ganz anderes. Er kann jetzt nicht nachdenken. Tufan Basher springt vom Treppenabsatz und läuft in Richtung des Friseursalons, um den schreienden Menschen zu helfen.[1]
Es ist 17.04 Uhr.
Zu diesem Zeitpunkt setzt das Lagezentrum der Kölner Kriminalpolizei die erste Meldung ab:
betr.: terroristische gewaltkriminalitaet hier: anschlag auf zwei geschaefte in koeln – muelheim – bezug: fernmuendliche vorausmeldung am 09.06.2004, 16:35h durch br koeln vorbehaltlich der fernschriftlichen bestaetigung durch die tatortbehoerde teile ich folgenden sachverhalt mit: bei der explosion von zwei geschaeften auf der kolbstr. in koeln-muelheim wurden 10 bis 15 personen verletzt, davon einige schwer. da im umkreis zimmermannsnaegel gefunden wurden geht man von einem anschlag aus.
Kurz danach geht im Lagezentrum ein Anruf ein. Das Landeskriminalamt erteilt eine Weisung. Es wird eine neue Meldung verbreitet:
die im bezug genannte lageerstmeldung wird korrigiert. bisher liegen keine hinweise auf terroristische gewaltkriminalitaet vor. nach bisherigen erkenntnissen handelt es sich um einen anschlag unter verwendung von unkonventionellen spreng- und brandvorrichtungen bei dem personen- und sachschaden entstand. es wird nachberichtet.
Es ist jetzt exakt 17.45 Uhr in Köln.
Man wird nie herausfinden, wer diese Weisung veranlasst hat.
2.Stuttgart, Büro Georg Dengler
Vorsichtig legte er das Päckchen vor sich auf den Tisch. Postgelb, ein DHL-Karton, wie er auf jedem Postamt verkauft wurde, nicht groß, zwanzig Zentimeter mal fünfzehn Zentimeter, schätzte er. Leicht, zweihundert, vielleicht dreihundert Gramm. Die Anschrift auf dem Etikett in Times New Roman, Computerschrift, die jeder Rechner lieferte: Georg Dengler, Privatermittler, Wagnerstraße 39, 70182 Stuttgart.
Kein Absender.
Er hielt das Paket hoch und schüttelte es vorsichtig neben seinem Ohr. Ein leichter Gegenstand schlug gegen die Innenwände. Dengler neigte das Paket zur Seite. Der Gegenstand im Inneren folgte der Richtung und berührte die Kartonwand. Er wurde durch nichts gebremst, kein Füllmaterial. Vorsichtig legte er das Paket zurück auf den Tisch und roch daran. Kein verdächtiger Geruch. Er zog die Schublade des Schreibtischs auf, nahm ein Paar extradünner Latexhandschuhe heraus und streifte sie sich über.
Sicher ist sicher.
Wo ist die Schere? Er kramte in der Schublade, aber die verdammte Schere war nicht da, wo sie sein sollte, selbst in der hintersten Ecke lag sie nicht, dort, wohin die Rolle mit dem Klebeband gerutscht war. Er ließ die Schublade halb offen, stand auf und ging aus dem Büro durchs Schlafzimmer in die Küche. Kein schöner Anblick, seine Küche. Er zog die Luft tief durch die Nase ein. Ein Fehler, wie er sofort feststellen musste. Dengler öffnete das Fenster, dann zog er ein Messer aus dem wackligen Stapel schmutziger Teller und Bestecke, verschmiert mit getrockneter Tomatensoße, hielt es unter den Wasserhahn, rieb es mit zwei Fingern sauber, hielt die Schneide gegen das Licht des Fensters und prüfte die Schärfe mit dem Daumen. Das Küchenhandtuch lag zwischen den Tellern und sah aus, als feierte es bald das zehnjährige Dienstjubiläum, also zog er einen Hemdzipfel aus dem Gürtel und trocknete damit die Schneide des Messers, während er zurück ins Büro ging.
Er ließ sich auf den Stuhl fallen und griff nach dem Paket. Sein Blick fiel auf die Vase auf dem Tisch, in die Frau Muscic, die wunderbare Frau Muscic, die alle zwei Wochen bei ihm sauber machte, Kugelschreiber, Bleistifte und auch seine Schere angeordnet hatte. Dengler seufzte, legte das Messer zur Seite und zog die Schere aus der Vase. Er zerschnitt die durchsichtigen Klebestreifen, die das Paket zusammenhielten. Er hielt den Atem an und öffnete vorsichtig den Deckel.
In dem Paket lag eine quadratische Kartonhalterung, so ausgestanzt und gefaltet, dass sie einem Handy und einem Ladegerät Platz bot, das ganze Ensemble mit einem Gummiband umspannt. Dengler entfernte das Gummiband, nahm das Handy aus der Halterung, hob es hoch, genau vor seine Augen, betrachtete es von vorne, von der Seite, von unten. Schwarz, klein, billig. Nicht mal halb so groß wie seine Handfläche. Kein Smartphone, sondern ein einfaches Samsung-Handy. Er drückte auf die »Gespräch beenden«-Taste, das Telefon schaltete sich ein, und auf dem kleinen Display leuchteten Lettern und Zahlen auf hellem Grund auf: Lebara – die Telefongesellschaft, deren SIM-Karte in dem Gerät steckte. Voll aufgeladener Akku. Ein Prepaidhandy.
Ein Handy, das man nach dem ersten Telefonat wegwirft. Schwer zurückzuverfolgen.
Er prüfte das Adressbuch. Keine Einträge. Er drückte die Wahlwiederholtaste. Nichts. Das Gerät war sauber.
Dengler legte das Handy vorsichtig auf den Tisch.
Er nahm das Ladegerät heraus. Es passte zu dem Telefon. Das Telefon schob er in die Hosentasche. Den Karton und das Ladegerät deponierte er im Regal an der Wand.
Jemand wollte mit ihm telefonieren. Und diese Person legte Wert darauf, dass niemand von diesem Gespräch erfuhr. Dengler hielt einen Moment inne, dachte nach, zuckte mit den Schultern. Abwarten.
Vorsichtig zog er sich die Latexhandschuhe von den Fingern. Dann ging er zurück in die Küche. Zeit für einen Kaffee.
Rückblende
3.Berlin, 3. Januar 2011, Botschaft der Vereinigten Staaten von Amerika
James D. Spencers Karriere war steil und außergewöhnlich verlaufen, und dass er sich dessen bewusst war, sah man unter anderem an dem aufrechten, federnden Gang, auf den er stolz war und den er vor dem großen Spiegel im Fitnessraum im Keller der Botschaft immer wieder übte und perfektionierte. Er beherrschte noch einen weiteren Trick: Bei offiziellen Anlässen bog er die Ellbogen leicht nach hinten, bis die Brustmuskeln rechts und links auf Höhe der Schultergelenke angespannt waren, seine Brust nach vorne drückten und gleichzeitig die Nackenmuskulatur spannten, sodass er den Kopf automatisch hoch trug. Das brachte seine 6 feet – 1,85 Meter nach dieser eigenwilligen europäischen Messweise – erst richtig zur Geltung.
Der Botschafter saß im Kaminzimmer. Das Feuer wärmte ihn, zumindest von vorne. Auf dem kleinen Tisch vor ihm lag eine Mappe mit Hintergrundinformationen für das Gespräch mit der deutschen Kanzlerin und ihrem Finanzminister. Er nahm sie in die Hand, blätterte immer schneller die Seiten um und legte das Dokument dann zurück. Zahlensalat. Fuck ’em. Er las lieber noch ein Kapitel in dieser aufregenden Biografie über Louis Mountbatten, den letzten englischen Vizekönig in Indien. Er mochte diesen Kerl. Toller Bursche. Der kannte den Trick mit den Brustmuskeln sicher auch. Wahrscheinlich noch ein paar andere. Aufrecht stand er da auf diesem Foto, langes schmales Gesicht (das Spencer leider nicht hatte), ganz ohne Doppelkinn (das Spencer leider hatte), die Marineuniform stand ihm gut, edel irgendwie, die ganze Erscheinung – klasse!
Der Bursche hatte einiges erlebt: von hohem englischem Adel, Ausbildung bei der Marine, wurde dann Admiral, später sogar Generalstabschef. Er sollte das Weltreich der Briten retten. Die Biografie schilderte, wie er seit Ende der Sechzigerjahre Putschversuche gegen den damaligen Premierminister Harold Wilson plante. Wichtige Leute des Geheimdienstes MI5 waren dabei, aufrechte Angehörige des britischen Generalstabs, Mitglieder des Königshauses waren informiert – der Plan stand. Eine Horde englischer Faschisten und anderer mob waren bereits bezahlt, um als Stimme des Volkes für Unterstützung des Projekts auf der Straße zu sorgen. Mountbatten sollte dann als neuer Premierminister eingesetzt werden. Hätte sich gut gemacht mit dieser aristokratischen cakehole.
War eine unruhige Zeit damals in Europa, speziell in Großbritannien. Die Freiheit des Westens war in Gefahr. Hohe Inflation, steigende Arbeitslosigkeit und ständige Streiks in den großen Industriezweigen bedrohten diese Freiheit von innen – und die Sowjetunion bedrohte sie von außen. Die Männer um Mountbatten glaubten, dass die sozialdemokratische Labourpartei, die zu einem beachtlichen Teil von den streikwütigen Gewerkschaften finanziert wurde, zu einer Bedrohung von innen werden könnte. Sie nahmen an, dass Wilson ein sowjetischer Agent oder zumindest ein Sympathisant der Kommunisten war. Doch Mountbatten zögerte zu lange – der Putsch fand nie statt. Wilson blieb, und die Streiks blieben auch. Auch das Ende Mountbattens hing mit dem Kampf Großbritanniens um den Erhalt des Empires zusammen: Die IRA sprengte ihn 1979 samt seinem Boot mithilfe einer Fernzündung in die Luft. Seither galt er als englischer Held. Drei Seiten lang zählte der Biograf im Anhang des Buches Titel und Orden auf. Wirklich erstaunlich, dieser Mountbatten.
Spencer schlug das Buch zu, legte es auf seinen Schoß, ließ aber den linken Zeigefinger zwischen den Seiten, die er gerade gelesen hatte. Er sah zur Wanduhr und fuhr sich mit der rechten Hand über die verbliebenen Haare. Noch eine Stunde Zeit. Zahlensalat oder Mountbatten? Ganz klar: Mountbatten. Die Akten lieferten ihm nur Details, Kleinkram, Mäuseschiss. Mountbatten lieferte ihm die großen Denklinien, die gleichen Überlegungen, denen auch er sein ganzes Leben lang gefolgt war. Hier ging es um Überzeugungen und Haltung. Diese Biografie war die beste Vorbereitung für das Gespräch mit der deutschen Kanzlerin und ihrem Minister.
Der Botschafter öffnete mit einem kleinen Druck seines Zeigefingers erneut das Buch, aber er senkte den Blick nicht wieder auf die Buchstaben. Er starrte ins Kaminfeuer.
Mountbatten hatte die richtigen Ideale und war gut aussehend; trotzdem, er war in Wirklichkeit ein gut aussehender loser, egal, ob in Uniform oder in edlem Tuch. Vornehm, völlig verweichlicht. Er verlor nicht nur Indien. Seine Frau, so schrieb der Biograf, soll über einige Monate ein Verhältnis mit Nehru gehabt haben, während ihr Mann Vizekönig in Indien war. Nehru war ein insurgent aus Sicht der Briten. Wie muss sich so ein Aufständischer fühlen, wenn der die Frau des Vizekönigs vögelt, die Frau des höchsten Repräsentanten des britischen Feindes? Unbesiegbar muss er sich gefühlt haben. Das wäre ungefähr so, als triebe es die Frau des amerikanischen Vizepräsidenten mit einem kubanischen Minister.
Spencer schloss die Augen. Widerlich. Er schüttelte sich leicht. Nehru. Später wurde der immerhin ein Staatsmann. Das werden die Aufständischen nun mal, wenn man sie vorher nicht umlegt. Außerdem soll Mountbatten es mit Männern getrieben haben, Indern und Engländern. Kreuz und quer.
Adelige Unzucht. Die Engländer verloren ihre Weltmacht zu Recht.
Diese Engländer konnten sich nie entscheiden, ob sie ein Land ausbeuten oder es lieben wollten. Sie schleppten die Naturschätze ab und schrieben zugleich Gedichte über das geheimnisvolle Indien. Ihre Afrikapolitik war genauso: Sie beuteten Afrika aus und liebten es zugleich.
Spencer war einige Jahre lang Konsularbeamter in London gewesen. Bei jeder Gelegenheit schenkten ihm die britischen Ehefrauen selbst gemachtes Chutney, manchmal mit der Bemerkung: nach einem Rezept aus Südindien oder aus Rajasthan oder weiß der Henker woher. Alle englischen Frauen kochten unentwegt indisches Chutney und verschenkten es an Kollegen, an die Nachbarn und besonders gerne an die amerikanischen Freunde. Millionen von Gläsern mit selbst gemachtem Chutney zirkulierten im Vereinigten Königreich, mehr als die englische Bevölkerung je würde essen können. Diese Liebe zu den Kolonien – das war die Achillesferse der Engländer.
Kein Wunder, dass sie alles verloren hatten, wenn sie sich solchen adligen Versagern anvertrauten, typisch englische Oberschicht-Inzucht. The Right Honourable The Viscount Mountbatten of Burma – einer der unzähligen Titel, die die Biografie dokumentierte. Mountbatten verlor immer. Letztlich ein schwacher Charakter. Er verlor Indien, er verspielte die Chance, den Sozialdemokraten einen Schlag zu versetzen, von dem sie sich nie wieder erholt hätten. Zum Schluss ließ er sich von Terroristen in die Luft sprengen, weil die britische Security Mountbattens Boot nicht richtig durchsucht hatte. Was für eine Schande! Was für ein erbärmliches Lebensende.
Von Mountbatten konnte man lernen, wie man es auf keinen Fall machen durfte. Das faszinierte Spencer an der Biografie. Nicht nachgiebig sein mit dem Feind (Indien), auf Zucht achten, auch bei der Familie und der Frau, eine Geheimdienstoperation entschlossen zu Ende führen, wenn man sie schon einmal begonnen hat, die Terrorristen in die Luft sprengen, bevor sie es mit dir tun. Nur so hätten die Briten ihr Reich retten können. Vielleicht.
Wir machen das anders. Spencers Denken drehte sich seit seinem Studium um das gleiche Thema, das Mountbatten auch umgetrieben hatte: Wie schützt sich ein Weltreich vor dem Niedergang? Er hatte sie alle studiert, die gefallenen Mächte: Aufstieg und Fall der Griechen, der Römer, Venedigs, Spaniens, Portugals, der Briten, das kurze Intermezzo der Russen im Gewand der Sowjetunion, jetzt der Aufbruch der Chinesen. Doch die Macht der USA stand seit einem Jahrhundert unerschütterlich. Und alles strategische Denken drehte sich in Washington darum, dass dies im 21. Jahrhundert auch so bleiben sollte.
Deshalb war er in Berlin.
Deshalb auch das Gespräch mit der Kanzlerin.
Spencer sah auf die Uhr.
4.Mietschulden
Helga Lehnhard war attraktiv. Sie trug ihre schwarz-braunen Haare hochgesteckt. Falls sie gefärbt waren, dann sehr gut, denn Dengler sah weder einen grauen Ansatz noch unregelmäßig verteilte Tönung. Sie trug schwarze Jeans, ein schwarzes T-Shirt und darüber eine Jacke aus Wolle mit schwarz-weißen Mustern, Rauten und Linien, Sonnen und Monden, die Dengler an indianische Ornamente erinnerten. Sie saß aufrecht vor Dengler, ihre Hände ruhten auf dem Schreibtisch. Eine gute Figur. Eindeutig. Dengler sah ihr in die Augen und unterdrückte das dringende Bedürfnis, auf ihren Busen zu starren. Aber auch die Augen waren bemerkenswert. Sie strahlten in einem hellen Blau, manchmal, das wusste Dengler, wenn Helga wütend war, konnten sie in ein stahlhartes Grau wechseln. Jetzt zeigten ihre Augen ein helles Grau, eingebettet in ein freundliches Netz von Lachfalten. Sie kannten sich nun seit zehn Jahren, und in dieser Zeit waren sie so etwas wie Freunde geworden. Helga war nicht nur die Hauseigentümerin, sie war die Managerin des Basta, des Lokals unten im Erdgeschoss. Sie war eine Freundin – aber auch Georgs Vermieterin. Leider saß sie nun in dieser Eigenschaft vor ihm.
»Wer braucht in Stuttgart schon einen Detektiv?«
»Viel zu wenige, ich weiß. Aber ich hab nichts anderes gelernt. Ich war Polizist. Zielfahnder. Helga, das ist das Einzige, was ich kann. Menschen jagen. Ich meine, das kann ich gut. Wirklich. Beim BKA …«
Sie seufzte. Er sah zur Urkunde an der Wand, die dort akkurat auf gleicher Höhe neben der blauen Marienstatue hing, sorgfältig gerahmt und hinter Glas. Eine Belobigung, unterschrieben vom BKA-Präsidenten persönlich.
Lange her.
Helga folgte seinem Blick und seufzte zum zweiten Mal.
»Es gibt hier ein großes Landeskriminalamt. Ein paar höhere Bullen essen ab und zu im Basta. Vielleicht könnten die dich dort brauchen. Wer braucht denn in Stuttgart einen Privatdetektiv?«
Und nach einer Weile: »Soll ich nicht mal mit denen reden?«
Dengler senkte den Blick. Nicht auf ihren Busen, sondern auf den Schreibtisch. Er ballte die Hand zu einer Faust.
»Ich meine, wie stellst du dir das vor? Du musst doch irgendwann einmal auf die Beine kommen. Finanziell, meine ich.«
Sie brauchten es nicht auszusprechen. Sie wussten, worüber sie eigentlich sprachen, auch wenn sie das Thema umschifften wie ein Segelschiff eine Klippe: Dengler schuldete ihr vier Monatsmieten; insgesamt 2960 Euro. Und das Schlimmste: Er hatte keine Ahnung, wie er sie bezahlen sollte. Zwar schuldete ihm ein Kunde 1800 Euro für die Überwachung seiner Ehefrau, die Rechnung hatte Dengler schon vor vier Wochen verschickt, aber seit Dengler herausgefunden hatte, dass die Frau dienstags nicht zu einem Liebhaber, sondern zu den regelmäßigen Treffen der Anonymen Alkoholiker ging, hatte der Mann keinerlei Eile gezeigt, das fällige Honorar zu überweisen. Aber selbst wenn der Kunde endlich zahlte, würde es nicht ausreichen, Helga die ausstehenden Mietschulden komplett zu bezahlen. Und der nächste Monatsanfang drohte.
Dengler hob die Hände. »Ich warte auf die Zahlung eines Kunden. Sobald sie eintrifft …«
»Ich will dir nicht auf die Nerven fallen.« Sie stand auf. »Aber ich mache mir Sorgen um dich. Wie soll das denn weitergehen? Außerdem muss ich das Dach reparieren lassen. Und spätestens dann …«
Dengler nickte.
Er fühlte den Schweißtropfen auf seiner Stirn, der langsam abwärtsglitt und einen Zwischenstopp an der Nasenwurzel einlegte. »Ich werde meinen Kunden anrufen. Ich bin kein guter Kaufmann, Rechnungen schreiben, Mahnungen hinterherschicken, all das bürokratische Zeug, weißt du …«
»So viele untreue Ehefrauen gibt’s in Stuttgart gar nicht, dass du von ihnen leben kannst«, sagte Helga.
»Doch, die gibt es, aber leider nicht genügend eifersüchtige Ehemänner.«
In diesem Augenblick schrillte die Klingel.
Dengler, dankbar für die Unterbrechung, sprang auf, eilte zum Fenster und sah hinunter auf die Straße. »Der Briefträger«, sagte er. »Bin gleich wieder da.«
Er drückte den Türöffner und lief die Treppe hinunter zur Eingangstür. Der Postbote warf gerade einen weißen Umschlag in seinen Briefkasten, steckte die taz in den Briefkasten von Martin Klein, seinem Nachbarn, und verschwand sofort wieder. Dengler griff in den Schlitz und zog den Umschlag mit zwei Fingern heraus, stieg wieder die Treppe hinauf in sein Büro und legte ihn vor sich auf den Schreibtisch. Es war ein DIN-A4-Umschlag, die Adresse auf dem gleichen computergeschriebenen Etikett wie bei dem kleinen Paket gestern. Kein Absender. Keine besonderen Merkmale. Verschlossen mit einem durchsichtigen Klebeband. Niemand hatte den Verschluss also mit der Zunge abgeleckt. Der Absender war jemand, der DNS-Spuren vermeiden wollte. Er öffnete die Schublade und zog zum zweiten Mal die Latexhandschuhe an, nahm die Schere aus der Vase und ritzte vorsichtig den Umschlag auf.
»Machst du deine Post immer so auf?«, fragte Helga.
Dengler antwortete nicht. Er hob den Umschlag mit beiden Händen hoch und schüttelte ihn. Nichts. Er griff hinein – und zog ein Bündel Geldscheine heraus. 50-Euro-Noten mit Banderole.
»Oha! Die untreuen Ehemänner zahlen bar«, sagte Helga mit einer Spur Bewunderung in ihrer Stimme. »Wahrscheinlich sind deine Rechnungen beim Finanzamt nicht absetzbar.«
Dengler griff wieder in den Umschlag und zog zwei weitere Geldbündel heraus. Er legte sie vor sich auf den Schreibtisch. Dann steckte er die Hand tief in den Umschlag, aber er war nun leer. Er hob den Umschlag hoch, sah hinein und schüttelte ihn; vergebens, keine Nachricht, keine Notiz, kein Brief, kein Computerstick, nichts. Helga sah ihm interessiert zu.
»Da will jemand sein Schwarzgeld loswerden«, sagte sie.
Dengler nahm aus der Schublade seines Schreibtisches ein Lineal und maß die Höhe der Stapel.
»Anderthalb Zentimeter«, sagte er.
»Ich würde die Scheine zählen. Halte ich für die exaktere Methode«, sagte Helga spöttisch.
Drei Stapel. Jeder mit einer Banderole. Neue Scheine. Er untersuchte den Umschlag noch einmal. Nichts. Nur die drei Bündel Geldscheine.
Offensichtlich jemand, der selbst keine Geldsorgen kannte. Jemand, der allerdings seine Geldsorgen kannte.
»Soll ich dir zählen helfen?«
Dengler sah Helga an. »Ich hab keine Ahnung, woher die Kohle kommt.«
»Zählen würde ich’s trotzdem.«
Dengler befeuchtete den Handschuh vorne an der Kuppe des Zeigerfingers. »Eins, zwei, drei …«
»100«, sagte er nach einer Weile.
Helga: »5000 Euro.«
Dengler zog den zweiten Stapel zu sich.
»Muss eine tolle Frau sein. Dein eifersüchtiger Ehemann lässt sich das etwas kosten.«
Dengler wollte den Zählrhythmus nicht verlieren. »64, 65, 66, 67 …«, sagte er laut, und Helga schwieg.
Ausgeschlossen, dass der kleine Anwalt, dessen Frau er in den letzten Wochen jeden Dienstagabend überwacht hatte, ihm mehr Geld schickte, als die Rechnung betrug. Dr. Burger, so hieß der Mann, sprach aristokratisch klingendes Honoratiorenschwäbisch, und er feilschte mit ihm doppelt so lange um das Honorar, wie er mit ihm über den Verdacht gegen seine Frau gesprochen hatte. Der Mann klammerte sich an jeden Cent wie ein Schiffbrüchiger an die letzte Planke.
Von wem stammte das Geld also?
»… 98, 99, 100.«
Helga: »Nochmals 5000 Euro. Ein Hoch aufs Fremdgehen.«
Dengler nahm sich den dritten Stapel vor: »Eins, zwei, drei, vier …«
Achte auf die kleinen Dinge, die kleinen Ungereimtheiten – das hatte ihn Dr. Schweikert gelehrt. Wie es ihm wohl ging? Er hatte seinen früheren Chef beim Bundeskriminalamt schon lange nicht mehr besucht. Schweikert hatte ihn gefördert. »Dengler, Sie sind mein Lieblingsschüler«, sagte er einmal. Auf diese Bemerkung war er stolz gewesen, sie bedeutete ihm mehr als die Urkunde an der Wand, auch wenn diese die Unterschrift des Präsidenten trug.
»Es sind die kleinen Dinge, die uns den großen Einblick geben.« Auch so ein Satz von Dr. Schweikert. »Aber die kleinen Dinge fallen am wenigsten auf.«
»37, 38, 39 …«
Wenn jemand mit der Post einen großen Geldbetrag nur in einem einfachen Umschlag verschickt, nicht als Wertbrief, nicht einmal als Einschreiben – was bedeutet das? Ein unerschütterliches Vertrauen in die Deutsche Post? Eher wohl, dass er im Notfall den Verlust einer solchen Summe verschmerzen kann. Dengler könnte ebenso gut den Betrag einstecken und, falls der Besitzer sich meldet, behaupten, er habe den Umschlag nie bekommen.
Ich hab noch viel mehr davon. Ich kann dir auch noch mehr davon schicken – das war die erste Botschaft dieser Sendung.
Neue Scheine, kein gebrauchtes, abgegriffenes Geld. Sauberes Geld. Auch das war eine Botschaft. Kein Drogengeld, nichts offensichtlich Kriminelles. Auch das eine Botschaft.
Der Absender schien aber zu wissen, dass diese drei Bündel Denglers drängende Probleme lösen würden. Für den Absender nicht viel Geld, für ihn ein Lottogewinn.
Ich kenne dich, ich kenne dich gut – die dritte Botschaft.
Ich werde dir ein Geschäft vorschlagen, dir einen Auftrag erteilen, und dies ist die erste Anzahlung – die vierte Botschaft.
»98, 99, 100. Noch einmal hundert Scheine.«
Helga: »15000 Euro. Gratulation.«
Dengler griff in die Hosentasche, zog das kleine Samsung-Handy heraus und betrachtete es.
Dann nahm er den ersten Stapel in die Hand und schob ihn über den Tisch. »Und zweieinhalb Monatsmieten im Voraus«, sagte er.
Rückblende
5.Berlin, 8. November 2011, Büro des Fraktionsvorsitzenden der SPD
Deutscher Bundestag. Klaus-Dieter Welker wartete.
Eine der beiden Sekretärinnen hatte ihn in das Büro des mächtigen Fraktionsvorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei geführt. Da saß er nun auf einem mit schwarzen Stoff bezogenen Stuhl und wartete. Die Sekretärin hatte ein Tablett mit einer silbernen Kaffeekanne und eine Flasche Mineralwasser auf den runden Besprechungstisch neben dem Stuhl gestellt, auf dem er saß.
Hell war es hier. Aus hellem Holz der Schreibtisch und die Tischplatte, helles Licht fiel durch die beiden großen Fenster, helles Rot war die Farbe des Teppichs. Welker stand auf und sah hinaus. Unten floss die Spree. Schöne Aussicht. Schön hatte er es, der Herr Fraktionsvorsitzende. Wirklich. Hier war es freundlicher als in Welkers Kölner Dienstsitz mit den langen Fluren, den dunklen langen Fluren.
Abgeordnete sind beschäftigte Menschen. Und manchmal, nun ja, manchmal lassen sie die Beamten spüren, dass sie vom Volk gewählt sind und die Beamten bestenfalls ihre Laufbahn vervollkommnen. Welker wusste, dass der Fraktionsvorsitzende ihn absichtlich warten ließ. Wahrscheinlich saß er in der Lobby und palaverte mit einem Journalisten oder hielt ein Schwätzchen mit einem Kollegen. Welker stellte sich vor, wie er hin und wieder auf die Uhr sah und überlegte, ob er ihn nun lange genug hatte hier schmoren lassen. Vermutlich wird er zu dem Journalisten sagen: In meinem Büro wartet der stellvertretende Präsident des Bundesverfassungsschutzes, vermutlich will er mehr Geld oder sich rechtfertigen für die Erfurter Scheiße.
Welker seufzte. In der letzten Woche hatten sich in Eisenach nach einem Banküberfall zwei Rechtsterroristen erschossen. In ihrem Campingwagen war die Dienstwaffe der ermordeten Heilbronner Polizistin Michèle Kiesewetter gefunden worden und in Zwickau, in der Wohnung der toten Terroristen, die Waffe, mit der neun Ausländer in den letzten Jahren in der Bundesrepublik erschossen worden waren. Die sogenannte Döner-Mord-Serie war damit aufgeklärt und der Heilbronner Polizistenmord auch. Die Zeitungen, das Fernsehen, Radio, alle, kurz: jedes Arschloch dieser Republik fragte, warum Polizei und Verfassungsschutz vorher nichts gewusst hatten.
Löst den Verfassungsschutz auf – titelte eine Zeitung.
Deutschland war in Aufruhr.
Mal wieder.
Welker dachte nicht daran, sich zu rechtfertigen.
Klaus-Dieter Welker machte seinen Job.
Deshalb saß er hier und wartete.
Abgeordnete gab es nun mal. Knetmasse. Hielten sich für etwas Besseres, weil vom Volk gewählt. Tatsächlich verzehrten sie nur deshalb ihre Diäten, weil ihre Parteivorstände sie für hinlänglich berechenbar hielten. Deshalb setzten sie sie auf die vorderen Plätze der Landeslisten. Und manch einer kassierte das Sitzungsgeld nur wegen einer Laune irgendeines Parteitags. Knetmasse.
Die Medien rührten jetzt kräftig in der Suppe. Wie kann das sein, fragten sie mit ihren Schlagzeilen, ihren Kommentaren und Brennpunkt-Sendungen: Zwei Mörder ziehen jahrzehntelang marodierend und unerkannt durch Deutschland, erschießen zehn Menschen, verüben mehrere Sprengstoffattentate, rauben Banken aus – und niemand verhaftet sie. Schlimmer: Niemand bemerkt sie. Wo war die Polizei? Wo der Verfassungsschutz? Vollständiges Versagen der Sicherheitsbehörden.
Affen!
Welker reckte das Kinn. Wir werden gestärkt aus dieser Krise hervorgehen. Am Ende dieser sogenannten Krise wird das Amt besser dastehen als zuvor, es wird mehr Kompetenzen, mehr Personal haben und mehr Geld, viel mehr Geld. Das war Welkers Plan. Hier war seine Chance.
Er würde sie nutzen.
Deshalb war er hier. Deshalb wartete er auf den SPD-Fraktionschef. Während ganz Deutschland auf den Sicherheitsorganen herumhackte, bereitete er den nächsten Coup vor.
Klaus-Dieter Welker war ein wuchtiger Mann. 1,93 Meter groß. Er wirkte kahl, obwohl auf seinem Kopf noch einige verstreute Haare sich millimeterhoch dem Himmel entgegenstreckten. Kurz geschnittene graue Haare an der Seite, die den kahlen Eindruck seines Schädels nicht minderten. Klare graue Augen, moderne Funktionsbrille mit schmalen, elastischen Bügeln, randlosen Gläsern, dünne, kaum wahrnehmbare Lippen, immer dunkelgraue, manchmal schwarze Anzüge. Immer Krawatte. Elegant wirkte er nicht, weiß Gott nicht, und das wusste er.
Welker stammte aus Niederbayern, aus Scharnling, einem kleinen Dorf mit zweihundert Einwohnern. Fast wäre er Bauer geworden, hätte den Hof der Eltern übernommen, schließlich war er der älteste Sohn, das älteste von fünf Kindern. Nach ihm kamen drei Schwestern, dann Florian, der Jüngste, der vor zwölf Jahren den Hof vom Vater übernommen hatte. Florian stellte viel um, betrieb jetzt nachhaltige Landwirtschaft, artgerechte Tierhaltung und diese Dinge, aber einfach war es nicht. Der Milchpreis fiel nach Aufhebung der Milchquoten ins Uferlose, das Mästen der Bullen, mit dem der Vater noch einigermaßen Geld verdient hatte, lohnte sich schon lange nicht mehr.
Damals, in seiner Kindheit, beherbergte das Dorf noch zwei Krämerläden, eine Sparkasse, einen Metzger, eine Freibank, ein Feuerwehrhaus, ein Wirtshaus, einen Schuster, der zugleich die Post austrug, einen Schmied, einen Schreiner, und es gab noch eine Schule; zumindest die ersten beiden Klassen, die alle Kinder vom Welker-Hof besucht hatten.
Auf dem Gehöft, einem klassisch bayerischen Vierseithof, arbeiteten alle von früh morgens, bis es dunkel wurde: die Eltern und auch die fünf Kinder. Dreißig Kühe, zehn Jungkühe und zwölf Kälber mussten versorgt werden, zehn Bullen, die später an den Schlachthof verkauft wurden, mussten gefüttert werden. Es gab zwei Schweine, eines wurde im Frühjahr und eines im Herbst geschlachtet, über ein Dutzend Hühner, es gab den Kaninchenstall, einen Hund und unzählige Katzen. Zum Hof gehörte ein drei Hektar großes Waldstück, in dem die Kinder im Winter Äste und Zweige und Bruchholz sammelten, zum Anzünden des Feuers. Auf der Wiese mähte der Vater im Sommer das Gras, und wenn es trocken war, half die ganze Familie beim Rechen und dem Verladen des Heus auf den großen Wagen, beim Abladen und Hinaufschleppen in den Heuboden der Scheune. Ansonsten bestand zwischen Vater und Mutter eine strenge Arbeitsteilung. Die Mutter molk die Kühe, der Vater mistete die Ställe aus, die Mutter arbeitete im Garten, der Vater fuhr die Gülle aus, die Mutter kümmerte sich um die Kälber, während der Vater auf den Feldern ackerte und säte.
Die Welkers waren nahezu Selbstversorger gewesen. In ihrem Garten zog Mutter Salatgurken, Bohnen, Radieschen, Zwiebeln, Kartoffeln und Karotten. Es gab drei große Walnussbäume, deren Nüsse die Kinder im Herbst aufklaubten. Im Sommer lieferte der Garten Kirschen, im Spätsommer Zwetschgen und Birnen, es gab Himbeeren, Stachelbeeren und Johannisbeeren, die die Mutter einweckte und aus denen sie Marmelade kochte.
Die Schwestern kochten jeden Tag das Essen für die ganze Familie, sie stellten Gebäck her, kochten die Blutwurst, wenn geschlachtet wurde, halfen der Mutter im Garten und flickten die Kleider von allen. Klaus-Dieter half seinem Vater morgens im Stall, er half ihm, wenn die Scheune ausgebessert werden musste und wenn neue Wege angelegt wurden. Klaus-Dieter Welker konnte hart arbeiten. Er hatte noch nie aufgegeben.
Und das würde er jetzt auch nicht tun.
Böhnhardt und Mundlos – mögen sie in der Hölle schmoren – verhalfen dem Amt zu einem großen Sprung nach vorne.
Welker sah auf die Uhr.
Der Fraktionsvorsitzende mag ihn warten lassen. Er gab nicht auf.
Dass Welker das Abitur machen konnte, verdankte er dem Pfarrer Wildgruber. Bei ihm war Welker Messdiener gewesen. Wie die Buben von den benachbarten Höfen auch. Damals mussten die Messdiener während der Messe lateinische Gebete aufsagen. Klaus-Dieter schaffte es nicht. Schon der Anfang der unverständlichen Litanei wollte ihm nicht in den Kopf: Confiteor Deo omnipotenti, beatae Mariae, semper Virgini, beato Michaeli Archangelo … Bereits hier stieg er aus. Die ersten Wörter konnte er sich merken (und er kannte sie heute noch): Confiteor Deo omnipotenti, aber dann verwechselte er die lateinischen Begriffe, trug sie in der falschen Reihenfolge vor, vergaß einige oder erfand in seiner Verzweiflung neue Wörter, die zumindest in seinen Ohren irgendwie nach Latein klangen.
Für den Messdienerunterricht hatte Pfarrer Wildgruber große Tafeln aufgestellt, auf denen das Confiteor in Großbuchstaben stand, und sie lasen den Text gemeinsam. Im Sprechchor, den Text vor Augen, klappte das auch meistens, aber sobald einer der Buben allein und auswendig das Gebet aufsagen sollte, scheiterte er nach wenigen Worten.
Nur Alexander, der Sohn des Apothekers, und Maximilian, dessen Vater Tierarzt war und die Kühe des Vaters besamte – diese beiden Jungs schafften es. Sie sagten das komplette Confiteor auswendig auf und schauten verächtlich auf die Bauernbuben, die sich quia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere und die vielen anderen Sätze nicht merken konnten. Der Pfarrer, das Scheitern seiner Messdiener gewohnt, schlug ihnen daher den Trick vor, mit dem er seufzend seit Generationen das Problem löste. »Das kriegt ihr in eure Bauernschädel sowieso nicht rein. Ihr murmelt nicht Confiteor Deo omnipotenti, beatae Mariae, semper Virgini, beato Michaeli Archangelo, beato Ioanni Baptistae, sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi, pater, quia peccavi nimis cogitatione, verbo et opere – das macht ihr nicht. Sondern ihr zählt, aber so, dass die Leute in den ersten Bankreihen es nicht verstehen. Ihr zählt bis 32. Also los.«
Und so murmelten sie vor sich hin, dass niemand es verstand.
»Und bei 32 sagt ihr laut: ›Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa‹ und schlagt euch an die Brust.«
Das klappte bei allen.
»Dann zählt ihr murmelnd weiter: 33, 34 – bis 42. Und die 42 sagt ihr ein bisschen lauter.«
So machten sie es. Sobald Pfarrer Wildgruber die gebrummelte Zahl 42 von den Messdienern hörte, hob er die Arme zum Herrn empor und die Messe nahm ihren vorgesehenen Verlauf.
Zunächst war Klaus-Dieter so erleichtert wie die anderen Messdiener auch, dass er nicht mehr die unverständlichen lateinischen Wörter auswendig lernen musste. Doch als er die hochmütigen Gesichter von Alexander und Maximilian sah, ihre Verachtung für sie, die dummen Bauernburschen, da wollte er nicht länger zu den Dummen gehören. Er schrieb den lateinischen Text ab, einmal, zweimal, unzählige Male – er las ihn sich selbst immer wieder laut vor, und schon frühmorgens, wenn er dem Vater beim Stallausmisten half, deklamierte er laut zum Schwung der Mistgabel: »Ideo precor beatam Mariam, semper Virginem, beatum Michaelem Archangelum« – und schließlich: »… omnes sanctos et te, pater, orare pro me ad Dominum, Deum nostrum.«
Es war schwer. Doch er gab nicht auf. Irgendwann legte sich ein Schalter in seinem Hirn um, und Klaus-Dieter Welker, der Junge vom Welker-Hof, sprach das komplette Confiteor ruhig und fehlerfrei – wie ein perfekter Messdiener. Er tat es in der Frühmesse, und Franz, der zweite Messdiener, hörte auf zu zählen und starrte ihn an, und der Pfarrer, wie immer mit dem Rücken zur Gemeinde stehend, hob die Hände mit Verzögerung dem Herrn entgegen und wandte den Kopf und sah mit einem verzückten Lächeln zu dem knienden Messdiener, der nicht aufsah und stattdessen mit klarer, heller Bubenstimme das Confiteor fehlerfrei betete.
»Da Bua is gscheid, der muass studiern«, sagte Pfarrer Wildgruber eine Woche später zum Vater. Und der Pfarrer war nun einmal eine unangefochtene Autorität im Dorf. »Da Bua übernimmt den Hof, und dafür is gscheid sei koa Schoadn«, antwortete der Vater.
Damals gab es im weiten Umkreis keine höhere Schule. Der Bub musste also fast zwanzig Kilometer nach Deggendorf gebracht werden. Aber wie? Die Eltern konnten ihn nicht zur Schule fahren. Sie arbeiteten von fünf Uhr in der Früh bis um halb acht im Stall, sie misteten aus, sie fütterten die Kühe und versorgten die Kälber, sie säuberten die Melkkammer und die Milchkannen. Dann wurde die Milch in die Kannen gefüllt, die Kannen auf den Hänger gehoben, und der Vater fuhr mit Schlepper und Hänger zur nächsten Kreuzung, wo er die Kannen für das Molkereiauto abstellte. Niemand konnte den Bub ins Gymnasium fahren.
Wie soll der Bub dort hinkommen, fragte der Vater. Aber der Pfarrer hat’s gesagt, antwortete die Mutter. Seine Eltern waren tiefgläubig. Gläubigere Menschen hatte er nie wieder kennengelernt. Selbstverständlich ging die Familie jeden Sonntag in die Kirche und lauschte der Predigt von Pfarrer Wildgruber. Einmal im Jahr fuhr die Familie mit auf eine Wallfahrt der Kirchengemeinde nach Altötting. Sie beteten in der Gnadenkapelle der Schwarzen Madonna. Nie sah Klaus-Dieter seine Eltern so versunken, so weit entfernt von ihrem von Arbeit und Verzicht geprägten Leben, wie dann, wenn sie in dieser Wallfahrtskirche knieten, die Hände gefaltet und versunken im Gebet, vermutlich flehend um das Gelingen der nächsten Ernte oder darum, dass die Maul- und Klauenseuche sie nicht heimsuchte. Irgendwann [41]berührte Wildgruber den Vater am Arm, und der Vater wachte aus dem Gebet auf, verwirrt wie nach einem langen Schlaf, berührte die Mutter mit einer sanften Geste. Sie standen auf, die Beine noch steif vom langen Knien, und folgten ihrem Pfarrer nach draußen in die spätsommerliche Wärme.
In jungen Jahren war Wildgruber Soldat gewesen, und irgendwo im Osten, als Hitlers Armee bereits auf dem Rückzug war, verfolgt von der Roten Armee, hatte er wohl etwas Schlimmes erlebt – etwas, worüber er nie sprach, nie direkt jedenfalls, doch jeden Sonntag predigte Wildgruber inbrünstig und lange wider den Kommunismus und die Russen, sodass es Klaus-Dieter und den anderen Buben, die auf der Jungenseite in ihren Bänken saßen, angst und bange wurde vor den Russen. Manchmal träumte Klaus-Dieter in der Nacht davon, wie die Russen den Hof überfielen, die Ställe anzündeten, die Mutter erstachen und die Schwestern an den Haaren davonzogen.
Schreiend wachte er dann auf, und der kleine Florian, der im selben Zimmer schlief, musste ihn beruhigen. Das Predigen wider die Russen ließ bei Wildgruber nie nach. Selbst als es die Sowjetunion schon lange nicht mehr gab und die Demenz das Gedächtnis des alten Priesters weitgehend perforiert hatte, geschah es regelmäßig, dass Wildgruber bei einer Beerdigung den Namen des Verstorbenen vergaß und das Totengedenken erneut in eine wilde Predigt wider den Kommunismus verwandelte. Die Angehörigen und die Trauernden erstarrten, doch niemand sah sich an, niemand nahm den alten Pfarrer zur Seite, niemand lachte, seine Autorität im Dorf blieb unangetastet bis zu seinem letzten Atemzug.
In der knappen arbeitsfreien Zeit betete die Mutter mit den Kindern oft den Rosenkranz. Besonders wenn ein Gewitter aufzog: Auf Geheiß der Mutter huschten die Kinder durch die Stube und zogen die Stecker aller elektrischen Geräte, die Mutter entzündete eine Wetterkerze, stellte sie auf den Tisch – und dann knieten die Kinder mit der Mutter nieder und beteten den Rosenkranz, damit das Unwetter dem Vieh und der Ernte nichts zuleide tat.
Hat ja auch immer geklappt, dachte Welker und sah auf die Uhr. Vierzig Minuten saß er nun schon auf diesem Stuhl und wartete. Er stand auf und ging ins Nebenzimmer zu den beiden Sekretärinnen. Die eine, die den Kaffee gebracht hatte, sah ihn schuldbewusst an und hob die Schultern. Welker nickte ihr zu, drehte sich um und setzte sich wieder auf den Stuhl, dessen Sitzfläche noch warm war.
Selbstverständlich wählten seine Eltern CSU. Sie waren nie Mitglied in der Partei gewesen. Aber die CSU war der Familie und der Kirche zugetan, sie war der Landwirtschaft verbunden. Den Kandidaten der SPD hätten seine Eltern alleine schon deshalb niemals gewählt, weil er geschieden war. Aber das war nicht der Grund, warum Klaus-Dieter Welker in die CSU eingetreten war. Und erst recht nicht der Grund, warum er dort Karriere gemacht hatte.
Als er in die vierte Klasse ging, kam Pfarrer Wildgruber auf den Hof und erklärte dem Vater, dass im übernächsten Ort nun jeden Morgen ein Bus nach Deggendorf fuhr. Der Bub müsse nur pünktlich an der Bushaltestelle sein, eine Haltstelle sei direkt an der Schule, da könne er aussteigen. So half Klaus-Dieter nun am Morgen dem Vater beim Stallausmisten, ging dann zwei Kilometer zur Haltestelle, und am Nachmittag trottete er dieselbe Strecke zurück. Es war ihm früh klar, dass dies eine besondere Auszeichnung war. Keines seiner Geschwister würde auf die höhere Schule geschickt werden. Die Schwestern würden eine Lehre machen und dann heiraten, am besten einen Bauern aus der Umgebung. Schönheit vergeht, Hektar besteht. Aber er wollte Pfarrer werden.
War er in der Familie nun etwas Besonderes, so war er in der Schule ein Aussätziger. Natürlich, wenn er morgens seinen Schulranzen unter der Bank verstaute, roch er nach Stall, nach den Kühen und den Bullen, die er gefüttert hatte. Schließlich hatte er mit dem Vater den Mist von dreißig Kühen und zwei Schweinen auf den großen Haufen vor der Scheune geworfen. Seine Mitschüler rümpften die Nase, wenn er die Klasse betrat. Der Deutschlehrer öffnete demonstrativ das große Fenster und sah dabei nur ihn an. Welker war unglücklich. Er wollte nicht auf diese Schule. Er wollte nach Hause.
Wildgruber half ihm bei den Lateinaufgaben. Er paukte mit ihm sonntags nach dem Hochamt Vokabeln, erklärte ihm die Grammatik, half ihm bei den Übersetzungen, und bereits gegen Ende des ersten Jahres war er der Beste in Latein. Er war besser als Alexander, der Sohn des Apothekers, und das erfüllte ihn mit einem solchen Stolz, dass er dachte, es würde seine Brust sprengen. Seine Eltern verstanden seinen Stolz nicht, seine Schwestern auch nicht. Heimlich brachte er seiner jüngsten Schwester Agnes lateinische Wörter bei. Sie lernte rasch, es gefiel ihnen beiden. Sie hatten ein Geheimnis. Die Mutter mochte ihre Heimlichkeiten nicht.
Entscheidend aber war, dass er plötzlich begriff, dass er genauso klug war wie Alexander und Ferdinand und Franz und wie die Mitschüler alle hießen, die die Nase rümpften, wenn er in ihre Nähe kam oder einfach nur das Klassenzimmer betrat. Er wollte es ihnen zeigen. Er wollte dazugehören. Und mehr noch: besser sein als alle anderen. Und: die anderen seine Überlegenheit spüren lassen.
Es half ihm, dass Pfarrer Wildgruber zweimal in der Schule erschien und jeweils ein langes Gespräch mit dem Rektor führte. Der Hohn der Lehrer hörte auf, und damit erstarb nach einer Weile auch der Spott der Mitschüler. Er blieb Außenseiter, das schon, aber seine Leistungen wurden anerkannt und respektiert. Der Mathelehrer, der in den ersten beiden Jahren noch Witze auf seine Kosten gemacht hatte (»Klaus-Dieter bringt mal wieder gesunde Landluft mit in den Unterricht«), legte ihm einen Aufnahmeantrag für die Junge Union vor. Er unterschrieb, doch eigentlich dachte er dabei an seine Zukunft als Pfarrer. Darüber redete er mit Wildgruber, und vor allem redete Wildgruber darüber jeden Sonntag mit ihm. An diese Zukunft glaubte er damals ganz fest.
Bis er Iris kennenlernte.
Endlich – die Tür wurde aufgestoßen: Der Fraktionsvorsitzende stürmte ins Büro. Wie immer trug er einen dunkelgrauen Anzug, ein weißes Hemd und eine karierte rote Krawatte: sein Markenzeichen bei Auftritten im Parlament oder bei Parteiveranstaltungen. Der Mann war in den frühen Fünfzigern, in den letzten Jahren hatte die Parlamentsarbeit seine Falten tiefer gegraben, aber das Haar war noch braun und nicht gefärbt, wie Welker feststellte, nur an den Schläfen kurz geschnitten und grau. Er hatte noch Reste des offenen Blicks, der ihn aus der Masse seiner Kollegen hervorhob. Doch jetzt wirkte er fahrig und müde.
»Entschuldigen Sie, dass ich Sie warten ließ: der Innenausschuss … eine Sondersitzung … Was jetzt alles rauskommt … das Trio … der Polizistenmord … Vertrauenseinbruch … in unvorstellbarem Umfang … Heilbronn … Polizistenmord … Versagen der Sicherheitsorgane … eine katastrophale Presselage … Neuaufstellung … Sicherheitsbehörden …«
Klaus-Dieter Welker hatte der einladenden Geste des Mannes folgend sich auf den Stuhl vor dem Schreibtisch des Fraktionsvorsitzenden gesetzt und diese Unhöflichkeit hingenommen, ohne auch nur einen Gesichtsmuskel zu verziehen. Er wurde nicht an den Besprechungstisch gebeten.
»Also«, sagte der Fraktionsvorsitzende schließlich, hob die Hände und ließ sie gleich wieder in den Schoß fallen, »was kann ich für Sie tun?«
Welker schwieg. Er ließ das Schweigen und seinen Blick einige Sekunden wirken.
»Der Untersuchungsausschuss«, sagte er schließlich. »Es wird einen Untersuchungsausschuss geben. Ihre Partei ist an der Reihe und wird den Ausschussvorsitzenden stellen.«
»Da sind Sie ja schneller als wir«, sagte der Fraktionsvorsitzende. »Noch ist nichts beschlossen, die ganze Lage ist …«
Welker, dessen Hände auf dem Schreibtisch lagen, hob den Zeigefinger und senkte ihn sofort wieder. Der Fraktionsvorsitzende verhaspelte sich und schwieg dann.
»Es wird einen Untersuchungsausschuss geben. Wir möchten, dass Ihr Abgeordneter Omani den Vorsitz übernimmt. Deshalb bin ich bei Ihnen.«
»Also, noch ist nichts entschieden. Wir haben auch noch nicht mit der CDU gesprochen, also …«
»Die Union wird einverstanden sein.«
Die beiden Männer sahen sich an.
Welker stand auf.
»Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Glauben Sie mir: Omani ist der richtige Mann.«
Er ging zur Tür.
»Welker, warten Sie.«
Der Fraktionsvorsitzende stand hinter seinem Schreibtisch und wischte sich mit einer schnellen Bewegung den Schweiß von der Stirn.
»Welker, wie lange soll das noch so gehen. Sie haben mir versprochen, dass Sie nicht wieder und wieder …«
Welker sah den Mann kalt an. »Machen Sie sich keine Sorgen. Sein kleines Geheimnis ist bei uns in guten Händen. Entscheidend ist, dass Omani den Ausschuss leitet.«
Dann ging er.
6.Abends im Basta
Wie armselig das doch ist: ein Dauerauftrag, der jeden Monat die Miete automatisch abbucht. Lächerlich geradezu. Barzahlung der Miete – zehnmal besser. Hundertmal. Barzahlung löst den Knoten im Bauch, Barzahlung befreit die Seele, macht stolz, dass man zahlen kann, Barzahlung erinnert daran, dass es keineswegs selbstverständlich ist, seine Miete zahlen zu können. Dengler war in Hochstimmung.
Sie hatten sich im Basta verabredet. Mario war da, sein Freund seit Kindertagen, Leopold Harder kam gerade zur Tür herein, zerknautscht wie immer, und Martin Klein, sein Nachbar, der auf demselben Stock wohnte, gab dem kahlköpfigen Kellner ein Handzeichen: eine Flasche Rotwein. Vom Besten. Georg hatte ausnahmsweise Geld. Ein seltener Grund zum Feiern.
Nur Olga fehlte.
Der kahlköpfige Kellner stellte eine Flasche Nebbiolo auf den Tisch, verteilte vier Gläser. Leopold Harder ließ sich auf den Stuhl fallen und nahm sich sofort ein Glas. »Scheißleben«, stöhnte er und goss sich den Rotwein ein. Er war Journalist, arbeitete in der Wirtschaftsredaktion des Stuttgarter Blattes, einer der beiden großen Zeitungen der Stadt, aber sinkende Auflagen und die irrwitzige Politik der Verleger schliffen ihm tiefe und immer neue Falten ins Gesicht, sodass er von Tag zu Tag zerknitterter aussah.
Die Blicke der Freunde richteten sich auf Dengler.
»Welch Wunder ist geschehen? Wieso hast du Geld, uns einzuladen?«, fragte Harder.
»Es ist wirklich ein Wunder«, sagte Dengler und erzählte von dem anonymen Absender, dem Handy und den drei Bündeln Geldscheinen. Als wolle er seine Geschichte beglaubigen, zog er das Samsung-Handy aus der Tasche und legte es auf den Tisch. Da lag es nun wie ein erstarrtes schwarzes Insekt, und Denglers Freunde betrachteten es schweigend.
»Mmh, ich wäre vorsichtig«, sagte Harder. »Wenn du das Geld von dem Unbekannten jetzt ausgibst, musst du den Auftrag später annehmen. Egal, ob er dir passt. Egal, ob es möglicherweise illegal ist. Vielleicht ist der Absender ja irgendein Krimineller.«
»Muss er nicht, Leo. Das Geld kam ohne Absender, ohne Empfangsbestätigung. Ohne alles. Georg kann jederzeit sagen, er habe es nie erhalten. Es gibt kein Risiko«, sagte Mario und hob die Hand. »Noch eine Flasche, bitte!«, rief er dem kahlköpfigen Kellner zu.
»Wer weiß! Vielleicht wird das ein ganz spannender Fall«, sagte Martin Klein und hob das Glas. »Ein Fall, der mit einem guten Rotwein beginnt, kann so schlecht nicht werden.«
Alle lachten. Klein interessierte sich immer für Denglers Fälle, und alle am Tisch wussten, dass Martin einen großen Traum träumte: einen Kriminalroman zu schreiben. Alles, was ihm dazu fehlte, war ein geeigneter Stoff, und jetzt, dieses anonyme Handy und der große Geldbetrag: Vielleicht war das ja der Anfang einer Geschichte, die er zu seinem ersten Kriminalroman verarbeiten konnte.
»Erzähl uns auf jeden Fall, wie es weitergeht«, sagte er.
Martin Klein verdiente sein Geld mit dem Schreiben von Horoskopen. Woche für Woche veröffentlichte er in der Zeitung Der aktuelle Sonntag Kurzhoroskope. Er gab es nicht zu, aber seine Freunde waren sich sicher, dass er außerdem die Jahreshoroskope für einige der angesehensten Frauenzeitschriften schrieb. Leopold Harder vermutete, dass im November, wenn Brigitte und Cosmopolitan, Vogue und Freundin die Jahreshoroskope für ihre Leserinnen veröffentlichten, Martin Klein eine große Überweisung von diesen Zeitschriften erhielt. Im Dezember und Januar trug Martin Klein Spendierhosen und gab den Freunden im Basta großzügig Runden mit gutem Rotwein aus, im Frühjahr und im Sommer wurde er sparsamer und im Herbst geizig, bis ihn im November erneut ein Geldsegen heimsuchte.
Einen Kriminalroman schreiben. Statt dieser ewigen Horoskope. Dengler kannte die unzähligen Bücher über das Schreiben, die in Kleins Bücherregal standen. Martin Klein wusste wahrscheinlich alles über das Schreiben, doch was ihm fehlte – und darüber sprach er oft mit Dengler –, war ein Stoff, ein Fall, eine spannende Story. Deshalb hatte er sich damals sehr gefreut, als Dengler in dasselbe Haus, sogar in denselben Stock des Hauses einzog, in dem er lebte. Ein ehemaliger Zielfahnder des Bundeskriminalamtes – ein Wink des Schicksals! Er brauchte diesem Privatermittler nur über die Schulter zu schauen, und dann würde er den aufsehenerregenden Stoff finden, den ihm die Verleger, Buchhändler und Leser aus der Hand reißen würden. Dengler ahnte, was in seinem Freund vorging: das anonyme Handy, die große Geldsumme – nicht schlecht, gar nicht schlecht, das konnte tatsächlich der Anfang einer Story sein! Martin Klein hob das Glas und prostete seinen Freunden zu.
Der kahlköpfige Kellner brachte eine neue Flasche, Mario schenkte ihnen ein, Dengler sagte: »Geht auf meine Rechnung!«, und Leopolds zerknittertes Gesicht glättete sich.
In diesem Augenblick summte das Handy, die Resonanz der hölzernen Tischplatte verstärkte den Ton zu einem bedrohlichen Schnarren, das Telefon ruckte mit jedem Ton und begann, sich um die eigene Achse zu drehen, als wäre es lebendig geworden.
7.Erfurt, Landeskriminalamt Thüringen
Manchmal träumte Marius Brauer. Er legte dann die Füße auf den Schreibtisch und sah durch das Fenster seines Büros im Landeskriminalamt hinunter auf die vorbeifahrenden Autos. Immer noch sagte die kleine böswillige Stimme irgendwo in seinem Hinterkopf: alles Westautos. Nach so vielen Jahren! Immer noch diese Stimme. Alles Westautos. Alles Westverwandtschaft.
Mein Schmuck ist mein Halstuch,
das blaue, schaut her,
ich halt es sauber,
es kleidet mich sehr.
Sein Vater hasste es, wenn er das blaue Tuch der Jungpioniere umband.
Lange her.
Später hasste er das rote Tuch, das sein Sohn als Thälmann-Pionier trug. Steck die Rotzfahne in die Hosentasche, sagte er. Marius tat es und band es dann erst kurz vor dem Fahnenappell über den grauen Pullover. Appell zum Tag der Befreiung. Unterricht bis mittags um ein Uhr. Mittwochs Pioniernachmittag. Tannenzapfen sammeln, damit die Rentner heizen können. Bucheckern sammeln für die Wildschweine, Hagebutten sammeln für – ja, für wen sammelte er damals eigentlich die Hagebutten? Er hatte es vergessen. Unvergessen jedoch: Trupps bilden, die von Haus zu Haus gehen, Altstoffsammlung. Das Soll betrug zwei Kilogramm. Beim Klassenkameraden Arthur halfen der Vater, die Mutter, und sogar seine ältere Schwester, die ihn sonst nicht mochte, half mit. Zwölf Kilo Papier, Pappe und leere Flaschen schleppte Arthur am nächsten Tag in die Schule. Das gab eine Belobigung im Klassenbuch, eine Wandzeitung nur für den jungen Helden. Brauer stellte sich die Tonnen, die Züge, die Lastkähne voller Altstoffe vor, die die Kinder der DDR