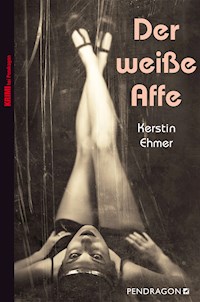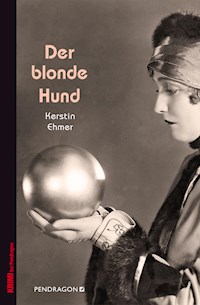Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Pendragon
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Ein Fall für Spiro / Berlin in den Goldenen Zwanzigern
- Sprache: Deutsch
Berlin Babylon: Die einen feiern, die anderen verrecken. Die Weimarer Republik neigt sich ihrem Ende zu, Nazis und Kommunisten kämpfen um die Macht und Kommissar Ariel Spiro sucht den Mörder zweier Männer, die niemand zu vermissen scheint. Berlin tanzt auf dem Vulkan. Glitzernde Tanzpaläste, wilde Partys, Drogen, sexuelle Freizügigkeit - die deutsche Hauptstadt gilt zur Zeit der Weimarer Republik als eine der aufregendsten Städte Europas. Russische Emigranten, darunter Schriftsteller, Gelehrte, Politiker und Anarchisten, haben nach der Revolution in Berlin Zuflucht gefunden vor dem Zugriff der sowjetischen Geheimpolizei. Mittendrin Kommissar Ariel Spiro, den zwei Giftmorde ins russische Milieu führen. Und dann ist da noch Nike, seine große Liebe, die ihn um Hilfe bei der Suche nach ihrem neuen Freund Anton bittet. Unversehens geraten beide in einen Strudel aus Politik und Gewalt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 439
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Kerstin Ehmer • Die schwarze Fee
Kerstin Ehmer
Die schwarze Fee
Für Stefan
In Erinnerung an meine Großeltern
Erna und Wilhelm Lentner
Inhalt
1. Samstag
2. Sonntag
3. Montag
4. Dienstag
5. Mittwoch
6. Donnerstag
7. Freitag
8. Samstag
»Wir kennen unsere Mienen; doch unsre Herzen, Da kennt er meins nicht mehr als ich das Eure, Noch ich seins mehr, Mylord, als Ihr das meine.«
William Shakespeare, Richard III.
Sie zielt. Mit zusammengekniffenen Augen fixiert sie den mageren hellgrauen Rücken des Mannes, der drei Reihen vor ihr regungslos wie ein Ölgötze gegen den Fahnenmast lehnt. Der hat jetzt genug geschlafen, beschließt sie. Ein kurzer Blick auf den Großvater, der mit geschlossenen Augen Sonne und Fahrtwind genießt. Das ist gut. Mit leisem Zischen katapultiert die Zwille ihre hart gekaute Papierkugel direkt ins Ziel. Aber nichts passiert. Der Mann zuckt nicht mal.
Dann kommt schon wieder ein Anleger und mit ihm das übliche Gewühl. Passagiere schieben sich in ihre Schusslinie, müssen runter vom Dampfer oder rauf und auf Deck erst mal ihre Plätze finden. Endlich sind alle da, wo sie hinwollen, und sie schickt ein zweites Geschoss in den teilnahmslosen Rücken. Diesmal fester. Wieder keine Reaktion. Enttäuschend. Sie kaut an einer neuen Kugel.
»Dafür hab ich dir die Zwille nicht gemacht.« Der Großvater nimmt sie aus ihren wiederstrebenden Händen und legt sie auf die Sitzbank.
Sie beißt sich auf die Unterlippe und linst hoch in sein ärgerliches Gesicht.
»Und jetzt gehste und entschuldigst dich.«
Seine Stimme duldet keinen Widerspruch. Beschämt trabt sie los und sieht den Mann jetzt zum ersten Mal von vorn. Die Luft bleibt ihr weg. Das kann doch nicht sein. Es waren doch bloß Papierkugeln, und Blut ist auch keins da. Aber tot ist er trotzdem. Augen aufgerissen und ganz starr, so guckt kein Lebendiger.
Ihre Knie werden weich, sie japst nach Luft. Sie sieht, wie der Großvater kommt, wie sich die Köpfe drehen, hört, wie eszuerst ganz still wird an Deck und sich gleich darauf große Aufregung erhebt. Eine Dame quiekt wie ein Ferkel.
1
Samstag
Anton
Sanftes, gleichgültiges Licht, das die engen Straßen des Weddings mit einer gnädigen Unschärfe überzieht, die buckelige Länge ihrer kopfsteingepflasterten Muskelstränge, von denen am Morgen noch immer die gesammelte Hitze der letzten Tage abstrahlt. Auch den stinkenden Dunst über der Panke lässt es leuchten wie einen von Zauberhand nachlässig gestreiften Nebel. Die Panke, eine der Schlagadern des Weddings, Transportband für seine Laugen und Säuren, für Kloake und Müll.
An ihrem Ufer entlang schlendert Anton, einen Korb über dem Arm, und pfeift. Auf der Straße dreht sich ein Seil. Kinder springen unter krähenden Gesängen hinein in den schweren, rotierenden Strick. Am Seilende erkennt er Fred aus dem vierten Stock, einen spargelig aufgeschossenen 13-Jährigen, der angestrengt versucht, die eckigen Bewegungen seiner langen Arme in einen schwingenden Kreis zu verwandeln. »Verliebt, verlobt, verheiratet, Kind gekriegt, geschieden. Wie viel Kinder wirst du kriegen? Eins, zwei, drei, vier …« Weiter kommen sie nicht, denn Anton tippt grüßend zwei Finger an die Mütze, und Fred vergisst das Seil, das prompt den Springern auf die Köpfe fällt. Sofort erhebt sich Protest: »Ej, du Pfeife, mach hinne.«
Anton lacht und geht weiter. Auf der Schulzendorfer Brücke wartet ein dünner Mann auf ihn, dreht aber ab, bevor er ihn erreicht, und fordert ihn mit einem Kopfnicken auf, ihm zu folgen. Anton kraust die Stirn. Aber der Tag ist jung, der Morgen noch nicht heiß, also folgt er ihm bereitwillig die Sellerstraße entlang bis zum Becken des Nordhafens. Er geht ein paar Schritte hinter ihm, als hätten zwei Fremde zufällig denselben Weg, aber er wundert sich über das grußlose Schweigen und die Strecke. Man wird sehen, denkt er, und sonst denkt er sich nichts, denn er weiß, dass das Deutsch des Dünnen schlecht ist, und irgendwer wird ihm schon erklären, was das soll.
In Höhe der Kieler Brücke schlüpfen sie nacheinander durch ein Loch im Zaun auf das Gelände der städtischen Gasanstalt. Anton sieht sich um. Über das Pflaster hetzt eine Kolonne aus Pferdewagen, Motordroschken und Fahrrädern, schieben Händler ihre Karren mit Äpfeln, Kartoffeln, Wirsingköpfen und Zwiebeln, scheppert ein Kesselflicker sein Wägelchen an ihm vorbei. Selbst früh am Morgen ist die Eile groß. Niemand beachtet Anton. Er eilt dem Dünnen nach, der zwischen den rußschwarzen Bauten der Gasanstalt verschwindet.
In drei Schichten wird hier rund um die Uhr Steinkohle in den großen Eisenbehältern zu Gas und Koks verarbeitet. Unablässig werden die Retorten von Heizern befeuert, unablässig stoßen die Öfen Qualm und Ruß über die eng gebauten Arbeiterquartiere des Weddings. Aber die Stadt wird elektrifiziert, der Verbrauch sinkt, und auf dem Gelände der Gasanstalt gibt es jetzt zunehmend Ecken, in die niemand mehr schaut, Ecken, die vergessen werden, in denen ausrangierte Maschinen rosten und sich Staub auf Kisten, Latten und Bohlen legt. In einer dieser Ecken steht ein windschiefer Schuppen, Lager für alles, was die Gasanstalt nicht mehr braucht, gleich neben dem Wehr, über das sich rauschend ein Arm der Panke ins Becken des Nordhafens ergießt.
Dahin, in diesen Schuppen, bringt ihn der Dünne. Anton gleitet durch den Türspalt und steht im Dunkeln. Er braucht etwas, bis sich seine Augen an den Dämmer gewöhnen. Er sieht die Umrisse rostiger Kessel bucklig in der Dämmerung kauern, Drahtrollen in mäandernder Auflösung, schwarze Quader, Kisten. Auf einem auseinandergerissenen Holzstapel kann er ein schmuddeliges Lager aus Säcken und Fetzen erkennen, aber es ist leer.
»Wo sind die anderen?«, fragt er, aber der Dünne bleibt stumm. Anton zieht eine Kiste in den hellen Lichtstrahl, der zwischen zwei Holzlatten ins Innere des Schuppens dringt. An seinen Handflächen klebt schwarzer Schmier. »Igitt.« Er wischt sie umständlich, aber erfolglos an seinem Taschentuch ab, zuckt schließlich resigniert die Schultern und packt aus: ein Brot, Käse, eine Speckseite und zuletzt vier Flaschen Bier. Erwartungsvoll grinsend sieht er seinen Begleiter an: »Na, was sagst du? Fast wie bei Rotkäppchen. Schön habt ihrs hier.« Er mustert spöttisch die Holz- und Alteisensammlung, die sie umgibt. »Warum seid ihr nicht mehr auf dem Dachboden?«
Der Dünne starrt ihn beinahe wütend an und knurrt: »Was ist Rotkäppchen?« Seine Märchen werden beherrscht von der Baba Jaga, einer Hexe, die in einem Holzhaus auf zwei Hühnerbeinen wohnt. Kleine Mädchen, die Wölfe überlisten, sind ihm unbekannt. Aber bevor sie sich über den unterschiedlichen Märchenschatz ihrer Länder austauschen können, hört Anton hinter sich ein Geräusch. Noch bevor er sich umdrehen kann, saust etwas auf seinen Hinterkopf. Ein schwarzer Vorhang senkt sich vor seinen Augen, und Anton kippt nach vorn wie eine frisch gefällte Tanne.
Fred
Fred, der Spargel, hat das Springseil fahren lassen und streunt mit seiner Clique durch die Straßen des Weddings. Ihre Väter arbeiten, ihre Mütter auch. Sind sie zu Hause, scheuern sie Wäsche auf dem Waschbrett, schieben Stopfpilze in fadenscheinige Socken, schälen Berge von Kartoffeln, zu ihren Füßen die Jüngsten in Körben und neben ihnen das Schnarchen der Schlafburschen. Sie befreien die Scheiben vom Ruß, der sich wie ein fettiges Tuch über den Wedding legt, und feuern selbst ihre Herde, damit einmal am Tag was Warmes auf dem Tisch steht. In den engen Wohnungen ist kein Platz für die stetig wachsende Masse der Kinder. Nach der Schule brodelt ihre wilde, aufgedrehte Flut durch die buckligen Straßen und das Gewirr der Hinterhöfe. Manche von ihnen arbeiten bereits, sind Laufburschen oder Zeitungsjungen. Manche müssen das nicht und sind frei.
Der harte Kern seiner Clique besteht aus Max, dessen Augen in unterschiedliche Richtungen blicken, was selbst Fred manchmal irritiert, aus August mit der rachitischen Hühnerbrust, der nicht so schnell ist wie der Rest, aus Erna mit den dicken Zöpfen, die nicht kratzt und beißt wie andere Mädchen, sondern rempelt und zuhaut wie ein Junge. Automatisch mit dabei ist deshalb auch ihr kleiner Bruder Kalle, liebevoll Keule genannt, der schon fünf ist, aber immer noch nicht spricht. »Er kann’s«, sagt Erna »er will bloß nich.« Wenn sie das sagt, schaut Kalle unbeteiligt aus der Wäsche, als könnte er zudem auch nicht hören, und Fred runzelt die Stirn.
Jetzt laufen sie nach Hause, ungewöhnlich um diese Zeit, aber aus ihrem Hof dringt die Musik eines Leierkastens und zieht sie an wie Zuckerwasser die Wespen. »Der sagenhafte Gallioni« ist da. So nennt sich ein alter Artist mit schlohweißem Haar, der Holzreifen um seine mageren Arme und ein ausgestrecktes Bein rotieren lässt. Die Fenster zum Hof stehen offen, um ihn hat sich ein Kreis aus Schaulustigen gebildet. Die Clique drängelt sich nach vorn, aber sie sind spät. Die Vorstellung ist bereits auf ihrem Höhepunkt angelangt. »… wir wollen unsern alten Kaiser Wilhelm wieder ham, aber den mit dem Bart, mit dem langen Bart …«, pfeift es aus der Drehorgel. Alle kennen das Lied, manche singen mit.
Der Alte läuft zu Höchstform auf. Immer mehr Reifen fliegen, zusätzlich schwankt jetzt eine Keule auf seiner Stirn. Das Publikum ist begeistert, erste Hände applaudieren, da ergießt sich aus dem dritten Stock ein Schwall Waschwasser auf die Darbietung. Der Alte zuckt zusammen, die Keule fällt, und Reifen klappern auf den rissigen Boden des Hinterhofs. Oben reckt sich der Kopf einer Frau aus dem Fenster: »Spiel was andres. Wir ham jetzt Republik«, zetert sie. Gelächter und Applaus, der beiden gilt.
»Das darfste in Helene ihrem Hof nicht spielen. Da versteht se keenen Spaß«, raunt Fred dem Alten zu. Der trocknet sich leise fluchend das nasse Gesicht, klaubt seine Utensilien auf und sammelt Pfennige und Sechser von den Umstehenden in seine umgedrehte Mütze. Kleine Münzen fliegen auch aus den Fenstern. Flink wie Silberfische zischen die Cliquenmitglieder über den Hof, klauben sie auf und machen, dass sie wegkommen. »Drecksgören«, schimpft ihnen der Alte hinterher. Auf der Straße schaut Fred sich um. Sie sind vollzählig.
Gleich um die Ecke, in der Markthalle Schönwalder Straße, gibt es einen Stand mit Naschwerk. Bonbons locken in hohen Schraubgläsern, Himbeeren, Zitronen, Stachelbeeren, Lutscher, Bruchschokolade, Karamell, dahin zieht es die Clique. Misstrauisch von einem Schutzpolizisten beäugt, zeigt ihm Fred die ergatterten Pfennige in der dreckigen Hand, und sie dürfen hinein. Nach komplizierten Verhandlungen untereinander und mit der Verkäuferin folgen sie Fred, der ihnen die dreieckige Papiertüte wie eine Standarte voranträgt. Sie laufen zum Nordhafen. Wo die Gasanstalt aufhört und das Wehr rauscht, lassen sie sich mit ihrer Beute auf der Uferböschung von der Sonne bescheinen und sehen zu, wie die Kräne am gegenüberliegenden Ufer die Ladung der flachen Frachtschiffe löschen. Eine Sirene verkündet das Ende der Frühschicht in der Gasanstalt. Fred dreht sich um, einen Himbeerkracher im Mund. Sein Blick streift einen dünnen Mann, der hinter dem Zaun der Gasanstalt, gegen einen Schuppen gelehnt, eine Zigarette raucht. Fred wendet sich wieder dem Hafenbecken zu. Der Blick ist hier weit, und die Luft riecht nach Rauch und Abenteuer.
Schon ist die Clique wieder unterwegs. Lange hält es sie nirgends. Am Weddingplatz bestaunen sie einen fahrender Schuster, der durchgelaufene Schuhe im Handumdrehen mit neuen Sohlen beklebt. »Endlich rasche Hilfe in Sohlennot« und »Unlöslicher Klebstoff«, liest Fred stockend auf dem Reklameplakat. Schnelligkeit ist das wichtigste Verkaufsargument, denn kaum jemand hier besitzt ein zweites Paar Schuhe zum Wechseln. In einem Glaskasten röstet ein Händler Maiskörner. Sie platzen zu immer neuen weißschaumigen Gebilden auf und werden als Schneeflocken mit Himbeersirup verkauft. »Kiieken kostet extra«, scheucht sie der Händler weiter. Sie lassen die schmierigen Abdrücke ihrer Nasen an der Scheibe des Kastens zurück.
Vor Hertie in der Müllerstraße bleiben sie wie angenagelt stehen und reißen die Augen auf. Ein Bettler sitzt neben seinem umgedrehten Hut auf dem Gehsteig. Vorbeieilende Frauen wenden sich schaudernd ab, Männer grinsen sich zu. »So kann’s kommen, wennste nich oofpasst.« Auf Gesicht und Händen des Mannes blühen kreisrunde, dunkelrote Ekzeme aller Größen, als hätte ihn ein vorbeirollender Wagen mit der schmutzigen Brühe aus einer Pfütze bespritzt. Zwei Frauen tuscheln. »Syphilis«, schnappt Fred auf, und das ist ihr Stichwort. Sie brüllen los:
»Hätter, hätter, hätter nicht,
geküsst die alte Dirne,
wärer, wärer, wärer nicht
weich in seiner Birne.«
Der Bettler hört sie singen und lacht das freundliche Lachen des Idioten. Ein brauner Zahn bewohnt als letzter die dunkle Höhle seines Mundes. Fred schaudert, und die Clique nimmt die Beine in die Hand.
Morgenthal
Die Stimme des greisen Mediziners ist brüchig. Seine Hand mit dem Objektträger zittert. Er stützt sie auf den Schreibtisch, um ihn sicher unter das Objektiv des Mikroskops zu bringen. Sie ist zum Fenster gegangen. Sonne verfängt im leichten Nessel ihres Kleids. Er tattert ein fahriges Zeichen, und sie zieht die Vorhänge zu.
Er schaut zuerst ins Mikroskop. Er ist es, der das Präparat platziert und die Vergrößerung wählt. Sie muss sich gedulden. Er ist streng. Er hat sie erwählt. Durch sie will er vernichtet werden, aber dafür muss sie lernen.
Er ist in Pension, schon lang. Seine Frau vor Jahren gestorben. Ihr Körper hat völlig anders reagiert als sein eigener. Das hat ihn überrascht. Es ging dann sehr schnell. Die Söhne sind schon vorher nach Paris gegangen, Forscher wie er. Jetzt streift er übers knarzende Parkett der weitläufigen Wohnung wie ein alter Wolf und streitet mit der Zugehfrau. Die Besuche der Institutskollegen werden seltener. Für Freunde hat er keine Zeit erübrigen können in seinem wissenschaftsgeweihten Leben. An guten Tagen schafft er es in den Tiergarten und füttert an der Luiseninsel die Schwäne. Unter ihren immer strengen, wütenden Blicken fühlt er sich am rechten Platz.
Professor Schade hat ihm Nike vorgestellt auf einer Habilitationsfeier, zu der man ihn pflichtschuldig eingeladen hatte. »Eine meiner Studentinnen möchte Sie kennenlernen. Es gibt ja mittlerweile etliche Damen, die bei uns studieren. Es sind ein paar schlaue Köpfe dabei. Prozentual gesehen sogar mehr als bei den Herren. Fräulein Fromm bringt gute Voraussetzungen mit: Intelligenz, Interesse, Leidenschaft. Dem entgegen steht ihr Dickkopf, und fleißiger sein könnte sie auch. Ihr Vater wurde im Frühjahr ermordet aufgefunden. Erinnern Sie sich, der Bankier im Hinterhof in Kreuzberg? Der Pfahl mit dem Kopf der Frau auf dem Dach? Außerordentlich bizarr, eine schlimme Geschichte. Nike Fromm, die Tochter des Toten, jedenfalls interessiert sich sehr für Ihr Fachgebiet. Da drüben ist sie ja. Ich werde sie holen.«
Er hatte mit einer dünnen Brillenschlange gerechnet. Auf ihn zu kam federnd eine leicht gebräunte Schönheit mit herzförmigem Gesicht, das unter einer tief hinuntergezogenen Cloche zu verschwinden drohte. Sie trug einen weiten, aber kurzen Rock, darüber im selben Unschuldsweiß einen voluminösen Pullover, der wahrscheinlich ihrem großen Bruder gehörte. Ihre Hand war schmal, der Druck überraschend kräftig. »Professor Morgenthal, der strahlende Meister des Dunkelfelds, wie schön, Sie kennenzulernen.« Hellgrünes Blinzeln, lächelndes Lippengekräusel.
In ihm formierte sich quietschend und knarzend eine eingerostete genetische Replik: Balz, der Tanz ums Weibchen, senil torkelnde Pirouette um die allerletzte Möglichkeit, das eigene Erbgut in die Zukunft zu retten. Armer alter Narr, dachte er und sagte: »Ich hoffe inständig, dass Sie mich nicht mit dem werten Kollegen, dem Zoologen Günther Enderlein, verwechseln und ich die Komplimente ganz allein für mich behalten darf.«
»Dürfen Sie, wertester Professor. Obwohl ich noch nicht durch bin mit Enderleins Bakterien-Cyclogenie. Die ist ja gerade erst herausgekommen.«
»Und ich habe sie noch gar nicht in den Händen gehabt. Aber sie wird mir nicht davonlaufen. Ich bin alt. Wissen Sie, da kann man den Dingen ihre Zeit und ihren Lauf lassen.«
In ihren Augen grüner Schalk und Unglaube: »Können Sie das wirklich? Können Sie das Nagen der Endlichkeit am trockenen Brot des Alters ignorieren? Ist es in Wahrheit nicht so, dass Ihnen die Bakterien, dieses alberne Gewürm, und ihre Freunde, die verfluchten Viren, langsam den Buckel runterrutschen können, und das, obwohl Sie so viele Tage und Nächte Ihres Lebens mit ihnen verbracht haben? Ist ihr Zauber, ihr Rufen nicht mehr stark genug? Was tun Sie stattdessen? Füttern Sie schon die Enten im Park?«
In diesem Moment hat er gewusst, dass sie seine Nemesis sein würde. Nemesis, Tochter der Nacht und des Herrschers über die Finsternis, Göttin der ausgleichenden Gerechtigkeit. Das war keine Studentin der Medizin, nein, sie war eine Fechterin in weißem Ornat. Nach zweiminütiger Bekanntschaft blutete er bereits, einen Augenblick später stürzte er sich in ihren Degen. Er winkte sie nah zu sich heran. »Schwäne, ich füttere ausschließlich die Schwäne. Ich mag ihre Strenge. Enten interessieren mich nicht.«
So hat es angefangen. Mit rumpelndem Herzen ließ er einen Tag später das schöne Fräulein Fromm in seine Wohnung, deren hohe Fenster in die Baumwipfel des Tiergartens sehen. Er folgte ihr in die Dämmerung des Flures, folgte ihr mit hinkenden Schritten über das ächzende Parkett. So konnte er sie betrachten, während sie ihm, gewagte Hypothesen hervorsprudelnd, vorauseilte. Längst lebt er für diese Stunden, an denen sie sein Arbeitszimmer mit einem Schwall an Fragen stürmt und die gläsernen Objektträger mit den bakteriellen Spuren aller erdenklichen Krankheiten auf seinen Schreibtisch klirren lässt. Er rasiert sich gründlich und wählt seine Garderobe mit Bedacht. Er wienert die Linsen seiner Mikroskope und wischt den Arbeitstisch. Dann sitzt er mit hohem Blutdruck, den hat er gemessen, in der Bibliothek bei der Tür und wartet. In seinem Studierzimmer legt er ihr die Geheimnisse des Dunkelfelds zu Füßen. Sein Fachgebiet, ihr Steckenpferd.
Nike
Für Nike ist jeder Blick ins Dunkelfeld wie ein Ausflug ins Weltall. Stunden kann sie über den wandernden, zuckenden Lebendblutpräparaten verbringen, um ihnen ihre Geheimnisse zu entreißen. Nichts steht im Voraus fest, sie kann auf alles stoßen. Das Dunkelfeld ist ihr eine Wundertüte, aus der sie triumphierend Auffälligkeiten, Anomalien und Erreger hervorzieht.
Im Hellfeld, in der Lichtmikroskopie, müssen viele Erreger durch Kontrastmittel erst sichtbar gemacht werden. So präpariert und fixiert, liegen sie als klare Beweise auf einem Hintergrund aus weißem Licht. Der Mikroskopierende muss allerdings schon vorher wissen, wie seine Diagnose lauten könnte und sein Präparat entsprechend vorbereiten. Im Gegensatz dazu begibt er sich im Dunkelfeld auf eine Jagd mit offenem Ausgang. Nur Lichtreste streifen hier das Präparat. Vor fast schwarzem Hintergrund zeichnen sich die Blutbestandteile als weißzarte, geisterhaft durchscheinende Körper ab. Aus ihrem Aussehen, ihrer Konstitution, ihrem Vorhandensein oder Fehlen kann ein erfahrener Mikroskopierer akute und zukünftige Krankheiten lesen. Noch mehrere Stunden nach dem Aderlass ist Blut lebendig. Das Dunkelfeld zeigt den Geistertanz seiner Bestandteile.
Vieles kann hier Aufschluss über den Patienten geben: Gleichen die roten Blutkörperchen, die Erythrozyten, nicht perfekt gerundeten Seifenblasen, sondern ähneln stattdessen Tiertatzen oder Tropfen, kann das auf eine Leberschwäche hinweisen; fädeln sie sich zu geldrollenartigen Ketten, gerinnt das Blut und der Sauerstoff wird knapp. Die Leukozyten, die weißen Blutkörper, sollten sich schimmernd und pulsierend an ihnen entlangsaugen und sie putzen. Liegen sie aber unbeweglich und starr, schlafen die Soldaten, und eine Infektion hat gute Chancen, den Organismus zu entern. Krankheiten legen große schwarze Brocken ins Plasma, auf denen bunte Geschwüre wachsen. Gelb für Leber, Grün für die Nieren, Blau für die Schilddrüse und Braun für Galle. Und überhaupt, das Plasma, die Flüssigkeit, in der alles schwimmt. Ist es von Nebelbänken durchzogen oder von einem Sturm wimmelnder Einzeller durchsetzt? Viren und Bakterien, gute und böse, sowie Erreger aller Arten bevölkern Plasma und Blutbestandteile.
Nike lernt sie zu erkennen und zu werten, lernt aus dem Blut auf den Zustand eines Organismus zu schließen. Niemand kennt sich in diesen dunklen Weiten so gut aus wie Morgenthal. Niemand versteht ihre Begeisterung, ihr Jagdfieber so wie er. Morgenthal ist ihr Komplize, ihr Mentor und Lehrer. Sie ignoriert alles, was darüber hinausgehen könnte. Soll er doch seufzen und schmachten. Immerhin rasiert er sich jetzt anständig und brennt die Haare in Nase und Ohren aus.
An diesem lichtdurchfluteten Samstagnachmittag rennt sie seinen knarzend protestierenden Flur entlang und reicht ihm frohlockend einen gläsernen Objektträger mit einem hellrot zerlaufenen Blutstropfen: »Hier habe ich eine frische Zirrhose für uns, was ganz Feines. Keine Stunde alt. Der Patient hat sich bereit erklärt, der nachwachsenden Wissenschaft«, sie deutet einen Knicks an und lächelt in die Runde, »mit einem Tropfen Lebenssaft auf die Sprünge zu helfen.« Sie hat die Vorhänge geschlossen, ihre Wangen glühen im Jagdfieber.
Morgenthals Stimme ist rau: »Das sollte noch hervorragend zu sehen sein. Selbst bei diesen Temperaturen.«
Er rückt zur Seite, sie lugt durchs Objektiv, schiebt, schraubt, dann blickt sie enttäuscht auf: »Ich kann nichts Besonderes sehen.«
»Suchen Sie weiter, lassen Sie sich nicht so schnell entmutigen.«
Den Kopf schon wieder über dem Mikroskop, murmelt sie vor sich hin: »Die Erythrozyten sind rund, das Plasma halbwegs klar. Aber wo sind die Leukozyten? Wo sind die Soldaten, wo ist die Polizei?« Plötzlich fährt sie zusammen. »Große Güte. Jetzt hab ich’s. So was habe ich noch nie gesehen. Das ist wirklich unheimlich.« Im ansonsten unauffälligen Blut sind die wenigen verbliebenen weißen Blutkörper von einer großen, exakt geometrischen weißen Struktur umgeben, einem Oktaeder. Sie haben aufgehört zu schimmern und pulsieren nicht mehr. Wie in einem Eiskristall eingefroren, sind sie leblos, erstarrt. Eine Gänsehaut stellt den blonden Flaum auf ihren Armen auf. Ihre Kehle wird eng, sie schluckt: »Er wird sterben, nicht wahr?«
»Ja«, antwortet Professor Morgenthal, »und es wird wehtun.«
Helene
Es ist zu still in den zwei Zimmern im Hof der Kunkelstraße. Helene liegt wach, starrt ins Dunkel und hört ihrem Herzklopfen hinterher. Viel zu still. Neben ihr die schlafwarmen Körper der Kleinen, Samtgeräusche ihrer Atemzüge, schwer und weich und selbstvergessen schmiegen sie sich in die Wärme ihres Körpers wie kleine Tiere. Sie muss eingeschlafen sein. Aus der Küche sollten Antons Schlafgeräusche dringen, leises Schmatzen, das Knistern des Lakens, das hohle Klopfen, mit dem er gegen die Bank stößt, wenn er sich umdreht. Ausnahmsweise hält die Stadt den Atem an, oder es ist nur der Wind, der den Lärm zur falschen Seite hin wegträgt, aber es ist still, und diese Stille klingelt in ihren Ohren wie eine Schulglocke.
Vorsichtig windet sie sich zwischen ihren Jüngsten heraus, schließt leise die Tür hinter sich und entzündet in der Küche eine Kerze. Sie braucht sie nicht. Sie weiß, dass er nicht da ist, die Bank neben dem Ofen leer, dabei hat er Frühschicht und ist deshalb auch nicht in die Versammlung. Oder doch? Oder ein Mädchen? Sein Schweiß riecht in letzter Zeit anders, wenn er sich an der Schüssel wäscht. Etwas Scharfes ist darin, ein Geruch, wie er in heißen Sommern über den Eingängen von Fuchsbauen steht. Sie hat ihn bemerkt, aber nicht weiter darüber nachgedacht. Erst jetzt, wo ihr Ältester nicht daliegt, wo er liegen sollte, fragt sie sich, ob diese Veränderung vielleicht etwas bedeutet.
Ihre Gedanken wandern zurück zu dem Moment als Antons Vater unter dem hellen Bimmeln des Glöckchens über der Tür in ihr Leben trat. Er kam in die Fleischerei, in der sie gearbeitet und gewohnt hat, seit sie mit dreizehn von zu Hause weg ist. Damals hat sie noch gesungen, damals war sie noch blond, mit klaren Augen, hell wie ein Dunsthimmel im Sommer. Sie blieb nicht sitzen beim Tanzen. Es gab mehr als einen, dem sie gefiel, aber der Hartnäckigste war der Verladearbeiter Kurt Grabowski. Einen Sack Kohlen trug er wie einen Einkaufsbeutel hoch in den vierten Stock und war nicht außer Atem. Er tanzte schlecht und lachte selten, aber er hatte eine eigene Wohnung, unglaublich, eine Wohnung mit zwei Zimmern ganz für sich allein. Sie wollte weg vom gellenden Quieken der Schweine, die sehr wohl ahnten, dass der Blutgeruch im gekachelten Schlachtraum nichts Gutes verhieß. Sie heirateten schnell. Bald lachte auch sie nicht mehr oft und suchte sich Arbeit. Kurt ging ihr nach, machte Szenen bei den Frauen, für die sie putzte und nähte, witterte Liebhaber, witterte Verrat. Sie brauchte dann nicht mehr wiederzukommen. Geld war knapp und wurde knapper, als er anfing zu trinken und im Suff zuschlug und dann weinte und am nächsten Morgen aufstand, als wäre nichts gewesen. Sie wurde trotzdem schwanger. Anton kam. Aber Kurt hörte nicht auf, nicht mit dem Trinken und nicht mit dem Schlagen. Da dachte die blonde Helene, dass es so nicht weitergehen konnte. Sie strich das Fleisch vom Speiseplan und hörte auf, das Haushaltsgeld zu verstecken. Eine Flasche Schnaps konnte er täglich trinken, sie ließ ihn und ging wieder putzen. Als er schon morgens zitterte und abends mit Leuten sprach, die gar nicht da waren, ließ sie nachts die Tür zum dunklen Treppenhaus offen, in das er endlich armrudernd hinabstürzte und sich den Hals brach.
Ein halbes Jahr später heiratete sie den Bahnarbeiter Kraftschick. Er hatte etwas gelernt, und er war Sozialist. Wenn er abends mit schmerzenden Muskeln nach Hause kam, hatte er etwas geschafft, worauf er stolz war. Kraftschick arbeitete gern. Er hatte auch nach der Schicht immer etwas in der Hand. Er zimmerte ihr Borde für die Küche, drechselte eine Garderobe, richtete der Grüttner aus dem Ersten das Türschloss und den Wondrascheks im Vorderhaus die Wasserleitung. Hatten seine Hände nichts zu tun, hingen sie wie Fremdkörper an seinen Armen. Aber das kam selten vor.
Anton liebte er gleich wie seinen Eigenen. Er hat ihn adoptiert. Nichts an dem Jungen erinnerte an seinen leiblichen Vater. Ein hübsches Kind, aufgeweckt, freundlich. Auf der Straße beugten sich Wildfremde lächelnd zu ihm hinunter und kniffen ihm zärtlich in die runden Backen, fuhren mit rissigen Händen durch die feine Seide seines Haars. Später wurde er Anführer der Clique aus der Kunkelstraße, seine Lehrerin wollte ihn aufs Gymnasium schicken. Sie redeten lange darüber. Dann beschloss Helene, dass er sich dort, zwischen den Söhnen von Ärzten, Apothekern und Anwälten, nicht wohlfühlen würde. Nach der neunten Klasse ging er ab von der Schule und in die Lehre. Werkzeugmacher bei Richard Kotsch, Maschinen- und Apparatebau.
Als Anton zehn wurde, brachte ihn Kraftschick zu den Ringern im Arbeitersport. An Wettkampftagen sah sie ihren Mann sonntagmorgens um sechs in der Küche hantieren. Er briet Spiegeleier für Anton und brachte ihn noch vor acht in eine muffige Turnhalle in Reinickendorf, Neukölln oder Kreuzberg. Sie wusste von Anton, dass Kraftschick ihn umarmte, kurz und kräftig, bevor er auf die Matte ging, ihm ins Ohr flüsterte: »Den schaffste. Det weeß ick.« Oft behielt er recht. Zwei Kinder gebar sie Kraftschick, die an dessen Zuneigung zu ihrem Ältesten nichts verändert haben.
Anton ist ein Glücksfall, und jetzt ist er weg. Die Angst hat sie an der Kehle. Schlafen kann sie nicht mehr. Auf Zehenspitzen tappt sie zurück ins Schlafzimmer, lauscht auf die regelmäßigen Atemzüge der beiden Kleinen. Tief und fest, sagt sie sich, tief und fest. Die schlafen durch. Da macht es nichts, wenn ich weggehe, ganz kurz.
Sie nimmt ihr Schultertuch und steigt die dunkle Stiege hinunter auf den Hof. Das Tor ist verschlossen. Sie fummelt einen Schlüssel aus ihrer Rocktasche. An beiden Enden hat er einen Bart. Sie steckt ihn ins Schloss, sperrt auf, dann schiebt sie ihn durch auf die Straßenseite. Sie geht durch die Tür, sperrt von außen mit dem zweiten Bart ab. Erst jetzt kann sie den Schlüssel wieder abziehen.
Sie hat es nicht weit. Gleich an der Ecke Schönwalder Straße ist die Kneipe, in der sich die Genossen treffen. Im dunstigen Hinterzimmer sitzen sie an langen Tischen. Kraftschick vor Kopf. Sie haben sich heiß geredet. Die große Revolution in Russland. Sollen sie die Bolschewiki unterstützen, die die Revolution schneller an sich gerissen haben, als mancher »Demokratie« sagen konnte, und ihr grausam straffe Zügel anlegten? Oder sind sie aufseiten der Flüchtlinge, die sie mit immer neuen Berichten über Verfolgung und Verhaftungen verstören? Aber sie sind durch für heute und singen. »Brüder, in eins nun die Hände. Brüder, das Sterben verlacht. Ewig, der Sklav’rei ein Ende, heilig die letzte Schlacht.«
Helene mustert die krummen Rücken, die breitgearbeiteten Hände mit ihren dunklen Nagelbetten, die müden Gesichter und hofft, dass es noch eine Weile hin ist, bis zur letzten Schlacht. Anton ist nicht dabei. Kraftschick lächelt ihr zu. Die Genossen grüßen. Sie kennen Helene. Sie wissen, dass sie mit der Sammelbüchse für die Arbeiterwohlfahrt die Aufgänge hoch- und runterklettert, ihre Kleinen im Schlepp oder auf dem Arm, dass sie vor Weihnachten Tüten packt mit Äpfeln, Nüssen und Schokolade für die Allerärmsten, die sonst gar nichts hätten zum Fest. Und sie wissen auch, dass Helene denkt, dass man weniger reden und mehr tun sollte.
Kraftschick hat gesehen, dass etwas nicht stimmt. Er geht mit ihr vor die Tür, und am Ufer der Stinkepanke hakt sie sich bei ihm ein und erzählt, dass Anton nicht da ist. Kraftschick lacht. »Der Junge wird groß. Er wird ein Mädchen haben. Dem geht’s gut.« Er will noch ein Bier trinken mit den Genossen.
Helene läuft zurück, entlang der Mauern, die die gespeicherte Hitze des Tages abstrahlen wie Heizplatten. Kein Wind, und die warme Nacht liegt schwül im stillen Hof. Im Dunkel des Treppenaufgangs fliegen ihr ihre Jüngsten winselnd in leuchtend weißen Nachthemden wie kleine Geister entgegen.
2
Sonntag
Spiro
Das Mädchen und sein Großvater stehen neben dem Toten und halten sich an den Händen. Von der Holzbank blättert weißer Lack. Der Tote sitzt noch immer aufrecht, nicht kerzengerade, sondern zurückgesackt, aber sein Kopf wird zwischen Kurbel und Fahnenmast gehalten. Die übrigen Passagiere sind mit ihren Picknickkörben, Federballschlägern und Decken von Bord gegangen und campieren nun inmitten ihrer zunehmend in Unordnung geratenden Habseligkeiten wie Treibgut auf dem Anleger. Sie dürfen nicht weg, nicht raus an den Strand des Müggelsees, nicht hoch zum Turm, nicht in die Pfifferlinge. Es ist Sonntag. Schnellstmöglich will man sich erholen, und die Zeit läuft.
Auf der anderen Seite die dunkle, von Ruder- und Faltbooten durchkreuzte Fläche des Sees. Hinterm Anleger das Friedrichshagener Wilhelmsbad, Badeanstalt für Damen und Herren, heute so hervorragend besucht, dass Kriminalkommissar Ariel Spiro kaum das Grün des Rasens unter all den hell gekleideten Badegästen ausmachen kann. Es gibt ein Restaurant, eine Rundbogenhalle, Umkleiden und eine Kapelle, die noch mit Mühe pietätvoll schweigt. Ein Kontrabass lehnt gegen den Pfeiler des Musikpavillons. Untätige Stöcke auf dem Trommelfell, ein goldglänzendes Saxofon, gebettet in grünen Samt. Ein Akkordeon schnauft tonlos. Unstete Musikerfinger zucken bereits über Saiten, Tasten und Knöpfe. Die bleiben nicht mehr lange still. Das ahnt Spiro und seufzt. Was für eine Kulisse für einen Mord. Seltsam irreal erscheint ihm alles, wäre da nicht der Tote auf der Bank.
Ein vielleicht sechsjähriger Junge im Matrosenanzug hat die Speckbeine in den Sand und dralle Arme in die Seiten gestemmt. Dreist mustert er die sehnige Gestalt des jungen Kommissars aus neugierigen Schweinsäuglein. Spiro erwidert seinen Blick amüsiert. Mit der Hand schlägt der Junge nach einer Wespe, die benommen wegtaumelt. Dann kehrt sie zurück, lässt sich in einem unvorsichtigen Moment unter der feuchten Achsel des Dicken einklemmen und sticht in einem letzten heroischen Akt der Verteidigung zu. In einem langen Atemzug saugt der Kleine Luft für einen markerschütternden Schrei in seine Lunge.
Spiro runzelt die Stirn und wendet sich ab. Sein Blick wandert von der Gruppe der Ausflügler zurück zum sacht schwankenden Gruppenbild aus Mädchen, Mann und Leiche auf dem Oberdeck des Dampfers. Hier oben klingt die Aufregung unten auf dem Steg wie das Summen eines Bienenvolkes. Nur der Schrei des dicken Jungen ragt aus dem Brummen empor wie das Lied einer übergewichtigen Lerche. Hier oben spiegelt sich der freundliche Himmel in den offenen Augen des Toten, und der Großvater hustet einen Schleimbatzen über Bord. »Heizer, der Staub«, murmelt er entschuldigend. Das Mädchen fixiert weiter Spiro, als wäre er verantwortlich dafür, dass bei bestem Sonntagsausflugswetter der Tod mit seinem Schweigen um die Ecke kommt und alle Pläne über den Haufen wirft. Eine kleine, feuchte Hand um eine Zwille aus frisch geschältem Holz.
»Zeig mal, wo du ihn erwischt hast.«
Sie tritt nah an den Sitzenden heran und tippt sanft gegen seinen Rücken. »Da. Mit Karacho, aber er hat nich mal gezuckt. Dann sollt ick mir entschuldigen und bin hin und habs gesehn.«
Spiro nickt. »Wo ist er denn an Bord gekommen?«
Der Großvater räuspert sich. »Hab ich nicht drauf geachtet. Als wir zugestiegen sind, sind wir gleich auf unsere Plätze. Ich glaube, da war er schon da. Aber drauf schwören würd ich nicht. Dürfen wir jetzt gehen?«
Spiro überlegt und nickt wieder. »Wir brauchen noch Ihren Namen und die Adresse.«
Er weist auf seinen Kollegen Ewald Bohlke, der sich einen provisorischen Schreibtisch eingerichtet hat und in eine Kladde kritzelt. Kein schöner Anblick. Das Gesicht des altgedienten Kollegen ist seit einer nicht besonders akkurat ausgeführten Operation in einem Feldlazarett unter Beschuss selbst zum Schlachtfeld geworden. Schief ist ihm ein ewiges Grinsen festgenäht. Das Mädchen weicht einen halben Schritt zurück. »Kommse ruhig ran, junges Frollein. Ick beiße nicht. Jetzt mal bitte Namen, Alter und woste wohnst.«
Spiro ist guter Hoffnung. Ein voller Dampfer, an die 70 Zeugen. Der Mörder ist sicher längst von Bord gegangen, aber irgendjemand wird ihn gesehen haben. Drei Stunden später ist sein Optimismus verflogen. »Ick habe geträumt.« »Wir haben uns die ganze Zeit geküsst, vom Zoo bis Stralau.« »Wir ham schon mal gegessen.« »Hier, die Vossische, von vorn bis hinten.« Man streckt ihm eine zerfledderte Zeitung entgegen. »Ick hab die Augen zugemacht. Die Sonne war so schön.«
»Er war schon da«, sagt ein kleiner Junge mit kurz geschorenem Haar, sein Kopf rund wie ein Ball. Spiro muss sich zu ihm hinabbeugen. »Ick hab seine Augen gesehn. Wie schwarze Löcher. Puterrot war er im Gesicht.«
Tatsächlich sind die Pupillen des Toten weit geöffnet, das helle Blau der Iris an den Rand gerutscht. Aber die Haut ist jetzt blass wie Lauge. »Wo bist du denn eingestiegen?«
»Köpenick.«
Das ist gerade mal zwei Haltestellen entfernt, der Dampfer davor schon fast drei Stunden unterwegs. »War er ganz allein?«, will Spiro wissen.
»Glaub schon.«
Spiro seufzt.
Über 70 Leute, zwischen denen einer stirbt. Der Tote ist weder alt noch jung, vielleicht 30 Jahre. In dem Alter neigt man nicht zum Herzinfarkt. Aber trotzdem wirkt er auf Spiro erschöpft. Ein kleines Gesicht, in dem sich deutlich die Wangenknochen abzeichnen. Spitz stechen Knie gegen die abgewetzte Sommerhose, magere Arme in einem kurzärmligen hellgrauen Hemd, weiße Haut mit blondem Flaum. Keine Krawatte, aber ein welkes Blümchen im Knopfloch. Eine graue Mütze mit kurzem Schirm über einem herausgewachsenen Haarschnitt, der sich zu aschblonden Strähnen ringelt.
Spiro kann seine Neugier nicht bezwingen. Vorsichtig nimmt er eine Hand des Toten in die eigenen Hände und öffnet sie. Eine Hand, so warm wie der Sommertag. Er hat in der Sonne gesessen. Da werden auch Tote nicht kalt. Spiro findet Schwielen und in den Rissen der Schwielen schwarzen, klebrigen Dreck. Schwarz auch die Halbmonde unter den Nägeln. Scheinbar ohne äußere Verletzungen ist er auf seinem Platz zusammengesackt und war weg. Sie haben hinter ihm ihre Brote aus dem Pergament gepackt, gesungen, geschwiegen und Zeitung gelesen, haben sich blenden lassen von den Lichtreflexen auf dem Wasser, sich einschläfern lassen von dem Motorengeräusch und dem Schäumen der Gischt. Keiner hat ihn kommen, keiner hat ihn sterben sehen.
»Da ham wa aber richtichjehend Glück heute.« Bohlke schlägt die Kladde zu.
»Mazel-tov«, sagt Spiro und grinst.
Bohlke fährt auf. »Versuchense bloß nich, mich zu vereimern. Ick weiß, dass Sie kein Jude sind. Auch wenn kein normaler Mensch sonst Ariel heißt. Egal, Sie sind keiner. Ick habe es begriffen.« Er klopft sich an den Kopf. »Ist hier drin. Von mir aus. Jeder nach seiner Fassong. Aber fangense nicht immer wieder davon an.«
Spiro lacht. »War nicht böse gemeint. Frieden?«
»Frieden. Fahrn wa heeme?«
Spiro resümiert: »Der Tote geht in die Hannoversche Straße zur Gerichtsmedizin. Hoffentlich finden die was, was uns hilft. Bis jetzt sind wir nicht wirklich weit. Keine Papiere, keine Todesursache, Tatort irgendwo zwischen hier und Spandau, und alles vor 70 Zeugen, die nichts gesehen haben.«
Bohlke gibt den Schupos ein Zeichen, dass sie die Passagiere ziehen lassen können, und sieht Spiro auffordernd an. Aber der reagiert nicht. Er guckt aufs Wasser.
»Heiß heute.«
»Ist mir auch schon aufgefallen.«
Schweigen breitet sich aus.
»Also, ich kann jetzt noch nicht zurück.«
»Aha«, sagt Bohlke, »und wer macht die Schreibarbeit?«
»Eine Molle? Morgen Mittag?«
Bohlke wiegt missmutig den dicken Kopf.
»Zwei?«
Bohlke beißt nicht an.
»Letztes Angebot: drei.«
»Ich denke drüber nach.« Der alte Kommissar dreht sich um und läuft mit leichtem Hinken Richtung S-Bahn. Sein Souvenir aus dem Weltkrieg, ein wandernder Schrapnellsplitter, piesackt seine Hüfte.
»Danke«, ruft ihm Spiro nach. Er läuft den Damm entlang, bis der Ort, das Bad, bis Musik und Stimmen hinter ihm zurückbleiben und nur noch Wind in den sommertrockenen Blättern der Eichen raschelt. Dann schlägt er sich über knackende Zweige nach rechts durch den Wald bis zum Seeufer. Seinen Anzug und das schweißnasse Hemd legt er auf den Sand und ist mit wenigen großen Schritten im dunkelgrünen Wasser, das in Ufernähe nach Wald und Moder riecht. Er schwimmt weit hinaus, wo es klarer und kühler wird. Er kommt aus Wittenberge, Stadt an der Elbe, deren Bewohner gar nicht oder sehr gut schwimmen können, denn die Strömung ist stark. Stehendes Wasser ist ihm fremd. Bis jetzt ist er entweder gegen die Strömung geschwommen oder mit ihr. Der See hat keine. Er dreht sich auf den Rücken. Über ihm schliert ein dunstiger Sommerhimmel. Er denkt an den Toten, der ungefähr so alt sein muss wie er selbst, an die seltsame Erschöpfung, die er zu spüren glaubte, aber an nichts festmachen kann. Er geht die Passagiere noch einmal durch. Keiner erscheint ihm auffällig. Er hat den Dampfer durchsucht und außer Bonbonpapieren und Apfelgriebschen nichts gefunden, was ihn weitergebracht hätte. Es fällt ihm nichts ein, was er jetzt noch tun kann. Er muss warten, und darin ist er schlecht.
Aus der schrägen Sonne nähert sich der plumpe Umriss eines Ruderboots. Einer fährt sein Mädchen spazieren, und das versetzt ihm einen feinen Stich. Er krault weiter hinaus, bis er merkt, dass seine Muskeln müde werden. Dann schwimmt er langsam zurück ans Ufer.
Anton
Im Schuppen bei der Gasanstalt kommt Anton mit dröhnendem Schädel wieder zu sich. Seit gestern verhören sie ihn. Etwas ist mit seinem Kopf. Er sieht alles doppelt, vier Peiniger statt zwei, die ihn doppelhändig ohrfeigen und achtbeinig, aber unentschlossen treten. Schläge – Fragen. Tritte – Fragen. »Wo ist Sergej?« » Was hast du gemacht?« »An wen hast du uns verraten?« Iwan auf dem Lager aus Säcken, Iwan im Fieber, hin und wieder rappelt er sich auf und versetzt ihm einen kraftlosen Tritt, dann schläft er wieder, und der Dünne macht weiter. Ihre Gesichter verschwimmen vor seinen Augen, und er übergibt sich. »Wo ist Sergej? Was hast du gemacht?« Sie geben keine Ruhe.
Anton stöhnt. Schmerz flutet in Wellen seinen Schädel. »Wasser. Ich brauche Wasser.«
»Du sagst uns, wo Sergej ist, dann kriegst du Wasser.«
Anton versucht den Kopf zu schütteln. Spitz fährt es ihm wie eine glühende Eisenstange in die Schläfen. Dann wird er ohnmächtig.
Wieder holen sie ihn zurück. »Wo ist Sergej? Er wollte zu dir, er wollte Medizin für Iwan.«
Langsam beginnt sein Hirn wieder zu arbeiten. »Er war bei mir, gestern. Ich habe ihm Tabletten gegeben. Dann ist er weg. Er soll nicht zu mir kommen. Das ist zu gefährlich. Er hatte sich frisch gemacht, sauber, bis auf die Hände. Er hatte eine Blume am Hemd. Er hatte was vor. Aber er hat mir nicht gesagt, wo er hinwollte.«
»Du lügst. Sergej hat keine Freundin. Keiner hat eine Freundin.«
Doch, ich, denkt Anton, aber er sagt es nicht laut. Und was für eine Freundin ich habe.
Sie binden ihn mit groben Stricken an einen der Balken, die das Dach des Schuppens stützen. Seine Schultern werden zurückgerissen, die Fesseln schneiden in seine Handgelenke. Er schreit: »Was seid ihr für Anarchisten? Die Freiheit seines Nächsten achten ist die Pflicht, sagt Bakunin. Was ist mit meiner Freiheit, ihr Arschkrampen?«
»Wer hat dich beauftragt? Wohin habt ihr Sergej verschleppt?«
Sonne brennt aus ihrem Zenit auf den Schuppen herab. Zwischen den Balken bricht Licht in Streifen durch das Dunkel, die sich zu einem verschwimmenden Raster duplizieren. Wieder muss er sich übergeben.
Langsam wischt der Dünne das Erbrochene auf. Dann essen sie sein Brot und trinken sein Bier. An den Rändern seines Schlafs hört er die beiden mit gedämpften Stimmen streiten. Als er aufwacht, ist er mit Iwan allein.
Was Anton weiß, hat er ihnen gesagt. Aber es war nicht, was sie hören wollten. Er weiß nicht, wo Sergej abgeblieben ist. Er ist verschwunden. Offenkundig hat die Medizin, die er ihm gegeben hat, Iwan nicht erreicht.
Der sieht ihn kauend und schwankend aus fiebrig glänzenden Augen an und sagt verächtlich: »Du willst über Bakunin sprechen? Du willst Anarchist sein? Du bist ein verdammter Sozialdemokrat, ein Speichellecker der Reformisten.«
»So einfach ist das nicht.« Anton sucht nach Worten, doch es fällt ihm schwer. Satzfetzen, einzelne Begriffe tauchen in seinem Bewusstsein auf und gehen wieder unter, bevor er sie aussprechen kann. Das alles ist so verkehrt, dass er es fast nicht glauben kann. Er hilft ihnen doch. Dafür sollten sie dankbar sein. Stattdessen schlagen sie ihn nieder und halten ihn gefangen. Er kann es nicht fassen, dass sie ihn für einen Verräter oder Schlimmeres halten. Er muss sich erklären.
»Meine Eltern sind Sozialisten. Ich war mit zehn schon im Arbeitersportverein. In ihren Zeltlagern habe ich mein erstes Mädchen geküsst. Jeden 1. Mai haben wir zuerst die roten Fahnen durch den Wedding getragen, dann gab es Reden und Turnen und Ringen im Stadion und zum Schluss die Internationale. Damals waren wir noch USPD. Mein Ziehvater hat mich mit zu Rosa Luxemburg genommen. Alles war in Aufruhr. Wir glaubten, dass die Revolution vor der Tür steht. Das Paradies zum Greifen nah. Es war wie ein Rausch, und dann war es vorbei.«
Er kann nicht mehr. Vor seinen Augen Geflimmer, in seinen Eingeweiden Würgen. Iwan sieht ihn nicht an. Aber er muss ihm zuhören. Also spricht Anton weiter: »Die Arbeiterbewegung zerfiel in Sozialdemokraten und KPD. Meine Eltern wurden SPD und hoffen jetzt mit jeder Wahl auf die Einführung des Sozialismus in kleinen Schritten. Aber sie kommt nicht. Die SPD macht gemeinsame Sache mit den alten preußischen Militärs, denen sie schon 1914 die Kriegskredite bewilligt hat. Da fing es an. Ohne die Kredite hätte es den Krieg nicht gegeben und ohne den Krieg keine Reparationszahlungen, für die wir jetzt geradestehen müssen.«
Iwan hat sich wieder auf das Lager fallen lassen. Anton muss ihn überzeugen, muss ihm klarmachen, dass er einer von ihnen ist, dass sie auf derselben Seite stehen. Er fährt fort: »Sie haben Liebknecht und Luxemburg und Leo Jogiches ermordet. Eigentlich kann ich nicht mehr Sozialdemokrat sein. Aber da, wo ich bin, im Ortsverein, in der Gewerkschaft, in der Arbeiterwohlfahrt, geht es gar nicht um große Politik, da geht es um einen Meister, der seine Lehrlinge bescheißt, es geht um Familien mit zwölf Kindern, die nicht satt werden. Es geht um Kranke, denen sonst keiner hilft. Soll ich die alle zurücklassen und sagen, ich bin jetzt nur noch Anarchist? Kropotkin sagt, Anarchismus sind Abmachungen von Mann zu Mann. Das gefällt mir. Und dass es um weniger Staat geht statt um mehr. In der Sowjetunion haben sie die Bosse nur durch die Partei ersetzt, und was die Partei will, ist Gesetz. Wer anderer Meinung ist, na, das wisst ihr selbst am besten.«
Er hat mit geschlossenen Augen gesprochen. Er hat sämtliche Kraft in diesen Monolog gelegt. Alles, was er hatte, in eine Waagschale. Mehr kann er ihnen nicht sagen. Iwan ist eingeschlafen. Leises Schnarchen mischt sich unter das Rauschen des Wehrs.
Bludau
Hartmuth Bludau, Kommissar der Sittenpolizei, hat frei. Er hat bis nachmittags geschlafen, denn seine Arbeitszeit liegt in der Nacht. Er lebt in einer kleinen Wohnung im Hinterhaus eines hochherrschaftlichen Gebäudes am Kurfürstendamm. Von vorn ziehen sich lediglich zwei Wohnungen pro Stockwerk mit acht und mehr Zimmern bis weit in die Seitenflügel hinein nach hinten und umrahmen einen Hof, in dem sich eine junge Kastanie zum Licht streckt. Man erreicht Hartmuth Bludaus Wohnung über den Dienstbotenaufgang. Treppauf, treppab werden über die enge Stiege Weine, Milchflaschen und Lebensmittel, werden Mangelwäsche, Kleider, Kohlen, Holzscheite, neu besohlte Schuhe und frisch gedruckte Zeitungen getragen. Das Vorderhaus legt sein marmorgetäfeltes Foyer den wenigen Bewohnern und ihren vereinzelten Besuchern zu Füßen wie eine stille weiße Wüste. Als er einzog, ist er probehalber hineingegangen, hat dem Hall seiner Absätze auf den Marmorfliesen gelauscht und gedacht: Aha, so ist das also hier. Und dann ist er wieder hinausgegangen, hat das schwere Tor zum Hof aufgezogen und ist den Dienstbotenwendel in den vierten Stock hinaufgeklettert, in seine Wohnung.
Hartmuth Bludau hat einen Stuhl vor dem Café Schiller ergattert und tankt das lachsrosa Spätnachmittagslicht wie eine satte Schlange. Die halbe Stadt ist auf den Beinen, schick gemacht, in Schale. Am Nebentisch bestellen zwei junge Frauen beim konsternierten Ober eine Tasse Kaffee. »Auf der Terrasse nur Kännchen, meine Damen, eins pro Nase.« Betretenes Schweigen. Dann stehen sie auf und trollen sich mit hochroten Gesichtern. Bludau grinst.
Keine Minute später wirft sich eine Dame nebst Begleiter auf die weiß lackierten Eisenstühle. Sie streckt die Beine weit von sich und fächert sich mit der Speisekarte Luft zu. »Pause, mein Lieber, ich muss verschnaufen. Die Suppe rinnt mir bei dieser Hitze in Strömen den Leib runter. Aber wir gehen wieder zurück, das hast du versprochen.«
»Ich kann den Tanztee schließlich nicht seiner Königin berauben, so gern ich es auch würde.« Er fährt ihr mit zwei Fingern über den feuchten Hals hinab ins Dekolleté.
Sie fängt sie ein und haucht einen Kuss auf seine Fingerspitzen. »Untersteh dich.«
»Falsch. Die Frage ist, wie ich den nächsten Charleston-Marathon überstehe.« Er tupft sich die Stirn mit einem karierten Taschentuch.
»An meiner Seite, Liebster, an meiner Seite.«
Der Ober schwänzelt herbei. Sie bestellen Eiswasser und Sekt und eine Ananas, die von den vorbeischlendernden Passanten neugierig betrachtet wird.
Der Kurfürstendamm ist das Aushängeschild des neuen Westens. Breite Bürgersteige säumen ihn auf beiden Seiten, zwei Fahrdämme, dazwischen eine Promenade mit Reitweg, Preußens Champs-Élysées. Zunächst als vornehme Wohnstraße geplant, sind die ursprünglichen Vorgärten schnell Café- und Restaurantterrassen gewichen. Die Komödie hat eröffnet, Hotels, Weinstuben, Lichtspielhäuser, Tanzlokale und Kabaretts. Vor den Schaufenstern der Modesalons, Pelzhäuser und Juweliere entzünden sich Sehnsüchte zu Feuersbrünsten.
Kommissar Bludau liebt den Ku’damm. Stundenlang kann er die Passanten betrachten, die Parade der Kleinen, der Großen und der Gernegroßen, der Betuchten und Schnorrer, der Profis und Amateure, die gut hundert Meter weiter im Romanischen Café am Auguste-Viktoria-Platz in Schwimmer und Nichtschwimmer geschieden werden. Bludau zählt sich zu den Profis. Seinen ersten Kaffee bestellt er stets bei Alfons, dem Ober des Café Möhring, den zweiten und Eier im Glas dann bei Lotte, Serviererin des Café Schiller, denn bei ihr muss er nicht zahlen, drückt er doch im Dienst großzügig beide Augen zu, wenn sie am Ende ihrer Schicht den ein oder anderen einsamen Gast gegen ein geringes Entgelt durch den Rest der Nacht begleitet. Hat er mal abends frei, geht er ins Nichtschwimmer-Bassin des Romanischen und erkauft sich mit ein paar Runden die Gunst der notorisch abgebrannten Literaten, die sich dort versammeln. Aus seiner Zeit vor dem Polizeidienst hat er sich die Liebe zu Poesie und Literatur bewahrt. Insgeheim schwärmt er für die Lasker-Schüler, die stundenlange, leidenschaftliche Debatten vor einer längst gelehrten Tasse Kaffee austrägt. Sie übersieht ihn seit Jahren, und er hat Angst vor ihr.
Aber jetzt sitzt er noch am Ku’damm und lässt sich die Sonne aufs kleine Bäuchlein scheinen. Das Hemd frisch und blütenweiß, der Anzug nicht billig. Ein paar mehr Haare hätte er gebrauchen können, doch die haben früh begonnen, sich von ihm zu verabschieden. Deshalb hat er sich für den Sommer einen leichten, eleganten Strohhut gegönnt. Omnibusse schieben sich zwischen Automobilen und Pferdekutschen hindurch Richtung Halensee und Villenkolonie Grunewald. Direkt vor ihm, an der Haltestelle Joachimsthaler Straße, quillt eine neue Ladung Flaneure aufs Trottoir.
Eine Frau erregt seine Aufmerksamkeit. Ihr Kleid ist hoffnungslos aus der Mode, aber es steht ihr gut. Unter der üppigen Büste betont es fischgratverstärkt ihre Taille, um sich darunter zu einem bodenlangen Rock aufzubauschen. Aus dem weiten Dekolleté erwächst ein langer, eleganter Hals, darauf ein kleiner Kopf mit ovalem Gesicht. Eine Flut dunklen Haars ist lose aufgesteckt. Sie wendet sich halb zurück und winkt mit weiß behandschuhter Hand einen Abschiedsgruß zu den spiegelnden Scheiben des Doppeldeckers hinauf. Und noch bevor sie den Kopf wieder nach vorn drehen kann, ist sie schon schwungvoll in den schönen Erich hineingelaufen. Sie strauchelt über sein Bein, und er strauchelt gleich mit, fast wär man gestürzt, und beim Hochkommen will es der Zufall, dass ihre Kette mit dem blitzenden Anhänger sich löst und in Erichs Tasche gleitet. Er entschuldigt sich wortreich, sie hebt abwehrend die Hände und will weiter. Erich auch. Er zieht zum Abschied noch den Hut. Fast hätte man sich getrennt, da baut sich Bludau vor den beiden auf, und Erich verzieht das Gesicht wie in plötzlichem Zahnschmerz.
»Machen wir es kurz, Erich. Ich hab frei heute. Es ist sicher nur deiner Zerstreutheit geschuldet, dass sich die Kette der Dame jetzt immer noch in deiner Hosentasche befindet, wo du sie doch eigentlich sofort zurückgeben wolltest, nicht wahr?«
Erich fingert und fördert zutage. Er reicht sie der Verdutzten. »Hab sie blitzen sehn und sofort in Sicherheit gebracht. Habe die Ehre.« Wieder lüpft er den Hut und ist diesmal wirklich verschwunden.
Bludau und die Besitzerin der Kette stehen voreinander und sehen sich an. Sie ringt um Fassung. »Das ist das Kettchen meiner Großmutter. Ich wäre nicht zu trösten. Fast ein Unglück.«
Sie rollt das r und kämpft mit dem ch. Eine Russin, denkt Bludau. »Sie sprechen ein ganz hervorragendes Deutsch.«
»Das sollte ich auch. Es ist mein Beruf. Ich bin Lehrerin am russischen Gymnasium.«
»Ich wusste gar nicht, dass es ein russisches Gymnasium in Berlin gibt.«
»Es gibt sogar zwei. Die Kinder müssen lernen. Sie müssen Deutsch lernen und Russisch auch. Vor allem Russisch. Und unsere Geschichte. Wenn wir zurückgekehrt sind, müssen sie wiederaufbauen, was die Bolschewiki zerstört haben.«
Bludau nickt vorsichtig. Mindestens 350 000 russische Flüchtlinge hat die Oktoberrevolution nach Berlin gespült. Geschätzte 150 000 sind immer noch da. Hier, in größter Nähe zur ehemaligen Heimat, warten weißrussische Militärs, Adelige und Großgrundbesitzer darauf, dass sich die Zeiten ändern und der Bolschewismus zusammenbricht. Auch gemäßigte Sozialisten und Demokraten, die in Lenins Sowjetunion ebenfalls um Freiheit oder Leben fürchten müssen, verschlägt es entweder nach Berlin oder ins liberalere Paris, den intellektuellen Mittelpunkt Europas. Und die zahlreichen Anarchisten, ehemalige Waffenbrüder der Roten Armee und mittlerweile von ihr gejagt, sind auch auf der Flucht und überall. Doch die Sowjetunion ist stabiler denn je, und nichts deutet auf den Zusammenbruch der ersten sozialistischen Republik hin, vor der die restlichen Mächte Europas zittern. Bludau wundert sich, dass die Emigranten offenbar noch immer ihre Rückkehr in ein imaginäres Russisches Reich vorbereiten. Interessant. Er lässt sich seinen Unglauben allerdings nicht anmerken. Es ist ihm letztendlich auch egal. Er ist kein politischer Mensch.
»Aber das ist kein schönes Gespräch so über Politik.« Sie scheint seinen Unwillen bei diesem Thema zu teilen. »Ich muss mich bedanken, sehr bedanken.«
»Machen Sie mir die Freude und trinken Sie mit mir einen Sekt.« Ihre Miene gefriert und er beeilt sich hinzuzufügen: »Oder einen Tee.« Sie sieht ihn noch immer an, als hätte er ihr ein unsittliches Angebot gemacht. So viel altmodischen Anstand ist er nicht gewöhnt. »Sie brauchen keine Angst zu haben: Mein Name ist Hartmuth Bludau, ich bin Preußischer Polizist, Kriminalkommissar bei der Sittenpolizei.«
Es scheint sie zu freuen, und das wiederum passiert Bludau nicht oft. Meist changiert die Reaktion auf dieses Bekenntnis irgendwo zwischen mitleidigem Lächeln und dem sofortigen Abbruch der Konversation.
»Apollinaria Zwetkowa.« Sie reicht ihm mit der Majestät einer Großfürstin die Hand, und Bludau beeilt sich, dem Luftraum über ihrem Handrücken einen Kuss aufzuhauchen. »Aber es muss sein ein schneller Tee, denn ich muss nach Hause zurück, dringend. Es wartet jemand. Und ich muss etwas für den Unterricht vorbereiten.«
»Aber es sind doch Ferien.«
»Wir bieten auch in den Ferien Unterricht an. Viele Kinder leben in Lagern oder auf sehr engem Raum. Es gibt zu Hause keinen Platz für sie, es gibt auch keine Ernte einzubringen, bei der man sie gebrauchen könnte. Wir beschäftigen sie, damit sie keine Dummheiten machen.«
Eine halbe Tasse lang hockt sie auf der Stuhlkante. Gerade lang genug, um in Bludaus vertrockneter Seele gänzlich verloren geglaubte Regungen zu entfachen. Wo andere in einem Gespräch aufrichtig staunen, sich interessiert fesseln lassen oder mitfühlend Tränen vergießen, steht ihm nur noch ein zynisches Grinsen zur Verfügung. Keine menschliche Regung ist ihm fremd, mag sie auch noch so bizarr ausfallen, aber die Anteilnahme ist dabei auf der Strecke geblieben. Doch diese junge, irgendwie aus der Zeit gefallene Frau lässt seinen in vielen langen Dienstnächten gewachsenen Panzer schmelzen wie einen Klacks Butter in der Pfanne. Er lächelt über allerliebst verquere Redewendungen in direkter Übersetzung. Sie sagt: »Das Leben zu meistern ist nicht wie Gehen über ein Feld.« Und: »Der Teufel ist nicht so furchterregend, wie man ihn malt.« Bludau stimmt ihr eifrig zu: »So isses. Ganz genau«, und hofft, dass sie dabei nicht über ihn selbst gesprochen hat. Unter seinem flehenden Blick hat sie für morgen einem gemeinsamen Essen zugestimmt. Er sieht ihr nach, als sie mit wogendem Rock in die Joachimsthaler Straße einbiegt.
Polina
Sie springt auf die Plattform eines Busses, fährt bis in die Kaiserallee und biegt in die Nachodstraße ein. Hier ist ihre Schule, und gleich daneben wohnt sie. Die Stufen im Seitenflügel sind steil wie eine Leiter. Langsam steigt sie mit hämmerndem Herzen hinauf. Schon im ersten Stock meint sie den Geruch zu erkennen und erschrickt. Das ist unmöglich. Das darf nicht sein. Im dritten Stock klopft sie ein Zeichen und dreht den Schlüssel im Schloss.