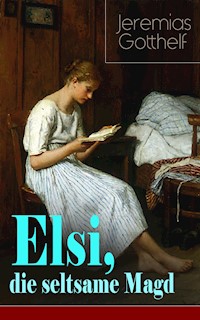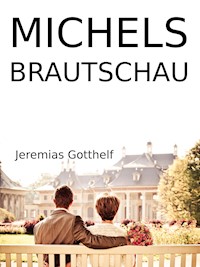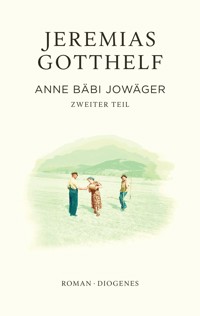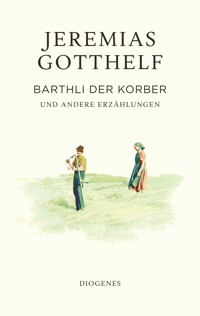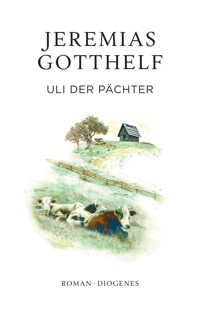26,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Gotthelf Zürcher Leseausgabe
- Sprache: Deutsch
Ein ländliches, fröhliches Tauffest wird zum Rahmen einer schaurigen Geschichte. Sie erzählt von einem jahrhundertealten Pakt der Bauern mit dem Teufel. Seit damals lauert das Böse überall. Jederzeit können die schwarzen Spinnen wieder hervorbrechen. Auch im Haus des kleinen Täuflings. ›Die schwarze Spinne‹ ist eine der berühmtesten Novellen der Weltliteratur – und doch nur eine von vielen Geschichten, die von Gotthelfs vielfältiger, großartiger Erzählkunst zeugen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 688
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Jeremias Gotthelf
Die schwarze Spinne
und andere Erzählungen
zürcher ausgabe
Herausgegeben von Philipp Theisohn Mit einem Nachwort von Monika Helfer
Diogenes
Die Wassernot im Emmental am 13. August 1837
Vorwort
Es gab eine Zeit, wo man ob den Werken Gottes Gott vergaß, wo die dem menschlichen Verstande sich erschließende Herrlichkeit der Natur die Majestät des Schöpfers verdunkelte. Diese Zeit geht vorbei. Aber noch weilt bei vielen der Glaube: Das Anschauen der Natur führe von Gott ab, Gott rede nur in seinem geschriebenen Worte zu uns; für seine Stimme, die tagtäglich durch die Welten zu uns redet, haben diese keine Ohren, dass Gott zu seinen Kindern rede in Sonnenschein und Sturm, dass er im Sichtbaren darstelle das Unsichtbare, dass die ganze Natur uns eine Gleichnisrede sei, die der Christ zu deuten habe, täte jedem not zu erkennen. Zu Förderung dieser Kenntnis ein Scherflein beizutragen versuchte die nachstehende Darstellung der Unterschriebene. Wer zu deuten weiß, was der Herr ihm schickt, verliert nimmer das Vertrauen, und alle Dinge müssen zur Seligkeit ihm dienen. Fände in dieser Wahrheit Trost ein Unglücklicher; würde sie den rechten Weg einem Irrenden erleuchten, offenbar machen einem Murrenden die Liebe des Vaters, zur Anschauung des Unsichtbaren einen Menschen führen, dessen fünf Sinne seine einzigen Wahrnehmungsquellen waren, dann hätte der Verfasser seinen Zweck erreicht; andere Ansprüche macht er nicht. Zu treuer Darstellung des Ereignisses waren andere berufener als er; aber da alle schwiegen, versuchte er die Darstellung auf seine Weise. Wenn er dazu höhere Beamtete nicht um Erlaubnis frug, so mögen gnädige Herren es ihm verzeihen. Was er sah und hörte, stellte er dar in möglichster Treue. Wer solche Ereignisse erlebte, weiß, wie mit verschiedenen Augen die Menschen sehen, wie verschieden sie die Farben auftragen auf das Gesehene; es wird später der Entscheid unmöglich, wer recht gesehen und recht erzählt, und nur das lässt sich ausscheiden, was offenbare Merkmale der Täuschung oder der Lüge an sich trägt. Dies die Ursache, wenn jemand einen Irrtum zu erkennen glaubt; wissentlich hat der Verfasser keinen hineingebracht. Das Ereignis an sich war so groß, dass der Mensch umsonst seine Kraft anstrengt, es würdig darzustellen, dass er ein Tor sein müsste, wenn er in seiner Beschränktheit ausschmücken wollte, was der Herr mit flammenden Blitzen ins Gedächtnis geschrieben den Bewohnern des Emmentals.
Jeremias Gotthelf
Das Jahr 1837 wird vielen Menschen unvergesslich bleiben, die nicht ihren Träumen oder ihren Sünden allein leben, die einen offenen Sinn haben für die Stimme Gottes, welche zu uns redet in Schnee und Sonne, bei heiterem Himmel und im Dunkel der Gewitternacht.
Es war ein merkwürdiges Jahr, aber ein banges, angstvolles für Tausende; wohl ihnen, wenn diese Angst jetzt ihre Frucht trägt – ein gläubiges Vertrauen.
Der Winter, welcher bereits im Oktober 1836 angefangen, den 1. November 11 Grad Kälte gebracht hatte, wollte nie aufhören, der Frühling nie kommen. Am Ostersonntag den 26. März fuhren viele Herren lustig Schlitten, lustig gings auch von Biel nach Solothurn, wo sonst mancher Winter keine Bahn bringt. Während es lustig ging auf den breiten Straßen, konnte auch manch arm Mütterchen nicht an den auferstandenen Herrn denken. Es hatte kein Holz mehr, die zitternden Glieder zu wärmen, die Kälte drang ihm durch die gebrechlichen Kleider bis ans Herz hinan. Es musste hinaus in den schneeichten kalten Wald, einige Reiser zu suchen, oder musste den schlotternden Körper zusammendrücken in eine Ecke, in den eigenen Gliedern noch irgendwo nach einem Restchen Wärme spürend. Wenn diese frierenden Mütterchen den Zehnten gehabt hätten von dem an selbem Tage zum Überfluss getrunk’nen Wein, wie glücklich hätten sie am Abend ihre erwärmten Herzen ins Bett gelegt.
Aber auch mancher Bauer drückte sich in die engste Ecke seiner Stube, um das Brüllen der hungrigen Kühe an der leeren Krippe nicht zu hören, um nicht hinaus zu sehen in die Hofstatt, wo der Schnee so dicht in den Bäumen hing, so hoch am Boden lag, kein Gräschen sich regte. Er hätte gerne geschlafen, um nicht an seine Bühne denken zu müssen, auf der kein Heu mehr war, durch die der Wind so schaurig pfiff; doch Sorgen sind Wächter, die nicht schlafen lassen.
Am ersten Apriltage wehten Frühlingslüfte durchs Land, und frohe Hoffnungen schwellten alle Herzen; aber alle Hoffnungen wurden in den April geschickt. Schnee wehte wieder durch alle Lande, legte in Deutschland mannshoch sich, er lagerte sich ordentlich, als ob er übersömmern wollte im erstaunten Lande.
Zum eigentlichen Schneemonat ward der April, selten leuchtete die Sonne, und: ob sie warm sei? erfuhr man nicht; Gras sah man nicht, kein Lebenszeichen gaben die Bäume.
Die Not ward groß im Lande. Heizen sollte man die Stuben und hatte kein Holz; füttern sollte man das Vieh und hatte kein Futter. Es war Jammer zu Berg und Tal; in den Stuben seufzte, in den Ställen brüllte es tief und nötlich.
Mancher Bauer machte sich, so oft und so weit er konnte, in Weid und Wald hinaus, und wenn er wieder heimmusste, so wollten seine zögernden Füße nicht vorwärts, wollten gar nicht auf den Platz, wo ihm, wie er genau wusste, das hungrige Muhen seiner Kühe wieder ins Ohr dringen, im Herzen wiedertönen würde. Des Nachts wusste er nicht, auf welche Seite sich legen, damit er nicht höre, wie es seufze und stöhne draußen in den Ställen. Endlich übermannte das Elend sein Herz, er stieß seine schnarchende Frau an und sagte: Frau, du musst morgen zeitlich auf, musst mir zMorge machen, ich muss in die Dörfer hinab, muss um Heu aus, ich kanns my armi türi nümme usgstah. Dann stund er auf, machte nicht einmal Licht, zählte seine Fünfunddreißiger im Gänterli und rechnete mühselig nach: Ob es wohl ein oder zwei Klafter erleiden möge? Hatte er das ausgerechnet und sich wieder ins Bett gelegt, so kam es ihm erst vor, wie das wieder einen Strich durch seine Rechnung mache, dass er keinen neuen Wagen könne machen lassen, dass ein dritter oder vierter Zins ihm auflaufe, und statt des Schlafes kam eine neue Trübseligkeit über ihn. Am Morgen zog er seufzend die Überstrümpfe an, die Frau band ihm das Halstuch um, ermahnend: Er solle doch zeitlich heimkommen, sie hätte nicht Zeit zu füttern, und die Magd gebe gar unerchant yche.
Er wanderte, er zog von Dorf zu Dorf, er fragte von Haus zu Haus, nicht nach dem Preise des Heus, sondern bloß nach Heu, und glücklich pries er sich, wenn er welches fand. Freilich tat es ihm weh, 20 bis 25 Kronen zahlen zu müssen für ein Klafter, und vielleicht am Ende für was – für Esparsettenstorzen; aber es war doch etwas Fressbares, es war besser als Tannennadeln, die auch an Orten zu 3 Fr. per Zentner verkauft worden sein sollen.
Wenn er endlich seinen matten Pferden das Füderchen lud, wie sprang er jedem Heuhalm nach, den der neckische Wind ihm entführen wollte; und wenn mit dem Füderchen die Pferde matt das Land auf sich schleppten, wie schwermütig und beladen zottelte er hinter dem Gespann her!
Hat niemand wohl hinter einem der Hunderten von Fudern, die für so viele, viele tausend Franken Heu ins Emmental führten, einem Fuhrmann ins Gesicht geschaut? In demselben hat er in großer Schrift lesen können ohne Brille, was in dem armen Manne vorging, wie er rechnete und rechnete: Wie lange er an diesem Heu füttern könne? War er mit der trostlosen Rechnung fertig, so sah er auf zum Himmel: ob nicht bald die Sonne kommen wolle warm über den Schnee. Und wann dann der alte eisige Wind ihm das Wasser aus den Augen peitschte, sah niemand, wie schmerzlich seine Gedanken sich hinwandten zu seinem leeren Gänterli, in welchem keine Fünfunddreißiger mehr waren. Aber wie der arme Mann später, nachdem dieses Heu zu Ende war, das Stroh aus den Strohsäcken, das Stroh vom Dach, wo man Strohdächer hatte, fütterte, das sah selten jemand, denn das tat er im Verborgenen. Wenn aber der Mann mit nassen Augen in finsterm Stalle den letzten Strohsack leerte, so rieb manche Kuh den ungeschlachten Kopf dem armen Manne am schmutzigen Zwilchkleid ab und leckte erst seine rauen Hände, ehe sie hungrig ins zerknitterte Stroh biss; es war fast, als ob die gute Kuh den Schmerz ihres Ernährers mehr fühlte als den eigenen Hunger.
Freilich gab es auch Leute, die nicht Heu kauften, nicht Mitleid hatten mit ihrem Vieh, und zwar nicht aus Geiz, sondern aus – Stolz und Hochmut. Der Ätti habe auch nie Heu gekauft, sagten sie, und sie wollten lieber ihr Vieh verhungern lassen, als dass man ihnen nachrede, dass sie einmal auf ihrem Hofe nicht Futter genug für ihr Vieh gemacht hätten. Ja, sie wollten nicht einmal Vieh verkaufen, damit man ihnen nicht entweder Geld- oder Futternot vorwerfe, damit es nicht heiße: Sie hätten nur so und so viel Stück zu überwintern vermögen. Sie fürchteten, das täte ihren Ehren Abbruch; aber wie zwanzig Kühe, die Tag und Nacht von einem Knubel herab brüllen, was sie in die Haut zu bringen vermögen, einen Bauer verbrüllen können fast bis ins Länderbiet hinein, fast bis ins Aargau hinab, daran dachten sie nicht. Es gab welche, deren Pferde des Morgens nicht mehr aufstehen konnten, die mit Fuß und Gabel das Älteste aufjagten, es zum Stall austrieben, um es dem Hungertode preiszugeben.
Da wehten am ersten Maitage wieder Frühlingslüfte; es grünte in den Matten, laut jauchzten die Menschen, und gierig graste das ausgetriebene Vieh das Wenige, was es fand.
Karst und Pflug wurden eiligst gerüstet, die Kuttlein an die Ofenstange gehängt, die Winterstrümpfe in den Spycher, aus den Dörfern schwärmte es aus wie aus dem Stock die Bienen, und am heißen dritten Maitag glaubte man alles gewonnen. Aber ein Gewitter verzehrte die vorrätige Wärme und – der Winter war wieder da.
Man jammerte in allen Hütten, auf allen Höfen, ganz besonders aber die Küher. Viele wussten kein Futter mehr zu kaufen, mussten fort aus den Ställen, und Schnee verfinsterte noch die Luft, lag weiß über die Ebenen und klaftertief auf den Bergen. Manchen Küher trieb die Angst auf seine Alp, er hoffte es droben besser anzutreffen, als es von unten das Ansehen hätte, hoffte aufzuziehen, und anfangs mit dem Heu nachhelfen zu können, das er auf dem Berge gemacht und im Staffel gelassen hatte. Aber was fand er? Schnee fast mannstief, und wenn er mit Lebensgefahr zum Staffel sich durchgearbeitet hatte – kein Heu mehr! So konnte er nicht auf den Berg, konnte aber auch nicht bleiben unten im Lande. Da wuchs manchem Küher der Gram über den Kopf, und das Sterben wäre ihm lieber gewesen als das Leben.
Und wenn sie wegfahren mussten aus ihren Winterquartieren im Schneegestöber, die hungrigen Kühe, wenn sie am Wege ein mager Gräschen abraufen wollten, das Maul voll Schnee kriegten, auf den Bergen der Schnee höher und höher sich zu türmen schien, und sie auf diese Berge zu mussten in Gottesnamen: Da sah man manchen harten Kühersmann die Augen wischen, ja, manchen hörte man schluchzen, und zwar weit.
Wie es anfangs auf den Bergen gegangen, wie Tannkris das Köstlichste war, was man den Kühen, die dazu noch fast erfroren, bieten konnte, will ich nicht erzählen. Und wenn ich’s erzählte, so würde sich niemand darüber verwundern, schneite es doch auch unten im Lande noch den 19. Mai.
Da grub sich tiefer und tiefer grimmig Zagen bei den Menschen ein. Man hörte wieder rollen durchs Volk Weissagungen über den nahenden Untergang der Welt. Alle drei, vier Jahre wird der Untergang der Welt ganz bestimmt vorausgesagt, und eine Menge Leute glauben daran, nehmen es aber ziemlich kaltblütig und bereiten sich nach ihrer Weise darauf vor.
Vor sechs, sieben Jahren sollte der Merkur die Erde zerstören; da wurde man in einem gewissen Schachen rätig: mit dem Erdäpfelsetzen zu warten, bis der gefährliche Tag vorüber sei. Es wäre doch gar zu ärgerlich, meinten sie, wenn sie die Mühe umsonst haben sollten. Der Seiler-Daniel aber sagte zu seiner Frau: Lisi, wir haben noch zwei Hammli in der Heli, koche die doch, heute eins und morgen wieder eins, es wäre gar zu schade, wenn die übrig bleiben sollten und wir nichts davon hätten. Aber die früheren Untergänge der Welt stellte man sich plötzlich schnell vor und auch fürchterlich, aber wie viel grässlicher der jetzt drohende langsame, peinvolle Untergang in Kälte und Hunger?
Wenn andere auch an den Untergang der Welt nicht dachten, so begannen sie doch zu zagen: Der liebe Gott möchte sie vergessen haben. Sie erkannten, dass alle Großhansen im Lande und alle Großmäuler alles machen könnten, nur die Hauptsache nicht.
Sie konnten mit all ihrem Witz keine Wärme machen, kein gschlacht Wetter zum Erdäpfelsetzen; auf alle ihre Machtsprüche kam kein Frühlingszeichen, zeigten sich keine sommerlichen Spuren. Sie begannen zu glauben, der liebe Gott wolle seine Sonne erkalten, wolle sie erlöschen lassen.
Mensch! wie wäre dir, wenn einst an einem Morgen keine Sonne aufstiege am Himmelsbogen, wenn es finster bliebe über der Erde? Wie wäre es dir ums Herz? Schauer um Schauer, immer todeskälter, würden es fassen; wenn deine Uhr schlüge Stunde um Stunde, Morgenstunden, Tagesstunden, Abendstunden, und die Finsternis wollte nicht weichen, schwarze Nacht bliebe unter dem Himmel. Was hülfen da alle Lichter und Laternen? Der Mensch könnte sie nicht einmal anzünden vor Grauen und Beben. Den Jammer, das Entsetzen auf Erden, wenn einmal an einem Morgen die Sonne ausbleibt, kann keiner sich denken. Am fürchterlichsten wird das Entsetzen dann die armen Sünder schütteln, in deren Herzen auch keine Sonne scheint. O wie wird dann klein werden, was groß war, und groß, was so klein und armütig schien! In so manches Herz scheint Gottes Sonne nicht, scheint das Licht der Welt nicht hinein, das kam, die Menschen zu erleuchten. Lichter und Laternen von allen Sorten zünden die armen Schächer an in ihren Herzen, lassen Irrlichter flunkern darin herum; aber der trübe Dämmerschein erleuchtet den Graus, den Moder, die Totengebeine nicht, und der Geblendete, der nur in sein Laternchen sieht, brüstet sich noch mit demselben und den flunkernden Irrlichtern, rühmt sich, dass er sein trüb und verblendend Laternchen nicht gegen die Sonne tausche und ihr strahlend Licht. Der Arme wird mit Entsetzen innewerden, was für ein Unterschied es sei zwischen einer Laterne und der Sonne, wenn die Sonne seinen Augen erlöscht am Himmelsbogen. Es begann der arme Menschenwurm mit Gott zu hadern; die Ungeduld des vergebenen Wartens verwandelte sich in Bitterkeit, fast in Verzweiflung.
Die Menschen dachten nicht daran, dass Gott ihnen auch einmal werde zeigen wollen, was Warten, was vergebens Warten sei, wie bitter es sei, jeden Hoffnungsschimmer in eine Täuschung sich verflüchtigen zu sehen. Und wie lange lassen die Menschen Gott warten auf das Bezahlen ihrer Gelübde, bis sie reimen ihre Tat mit dem Wort, bis sie erwidern seine Liebe? Ist nicht eben darin auch groß seine Liebe, dass er euch einmal so recht zeigte, wie angsthaft schon das Warten sei auf seine Sonnenblicke, damit ihr fühlen möchtet zur rechten Zeit, wie grässlich einst ein vergeblich Warten auf seine Liebesblicke sein würde. In diesem Wartenlassen war also nicht der Zorn Gottes, sondern die Liebe des Vaters; er wusste wohl, dass, wenn es Zeit sei, seine Kraft in Tagen vermöge, wozu der Mensch Wochen nötig glaubt. Und als die Zeit da war, den 24. Mai, winkte er, und die Sonne brannte auf die Erde nieder, die düstere Wolkendecke fiel, der Schnee schmolz, und in den Feldern und auf den Wiesen ward ein Leben mächtig, das der Mensch nie gesehen hatte. Die Nächte schienen mit Himmelsgewalt ausgerüstet, und ans Wunderbare grenzt, um wie viel einzelne Pflanzen ausschossen in einer Nacht. Mit dem Beginn des Brachmonats kränzten sich die Bäume mit ihrem Blütenschmuck, üppig und prächtig; aber wie die große Welt die Jugend gerne um die Früchte des Alters bringt, so blühen die Bäume wohl schön in der Sommerhitze und den majestätischen Gewittern, aber die Blüten verwelken bald, und die Frucht bildet sich nicht oder fällt im Werden ab, weil ihr die Nahrung fehlt.
Wie die Kühe sich freuten über das duftige Gras, wie die Menschen jubelten über die Wärme, über den Schweiß, der ihnen von der Stirne rann, konnte jeder sehen und hören, der Luft schöpfte im freien Lande. Die trübe Zeit war vorüber, eine herrliche war eingekehrt, und Gottes Pracht und Macht wurden alle Morgen neu. Aber die trübe Zeit, der grässliche Futtermangel, entstanden durch fünf trockne Sommer, wird hundertfältig Früchte tragen, und besonders den Emmentalern. Am Ende ist denn doch Gott der beste Prediger, der gewaltigste Lehrer in allen Dingen; er macht in wenig Zeit den Menschen begreiflich, wozu Menschen lange lange Zeit umsonst gebraucht. Er lehrt und predigt über alle Dinge, auch über weltliche, er ist’s, der den Bauern im Emmental gepredigt hat, wie gut der Klee sei, und wie vorteilhaft die Esparsette auf ihren Grienbüggeln in allen Jahren, besonders in den trock’nen. Was sie niemandem geglaubt, das glaubten sie endlich ihrem Gott, da er es ihnen handgreiflich zeigte an den hämpfeligen Rippen ihrer armen Kühe. Und wie das Sechszehnerjahr Erdäpfelpflanzen lehrte (dieses Jahr besonders, und nicht das Branntenweinbrennen, wie ein unweiser Mann behaupten will, hat den vermehrten, so vorteilhaften Erdäpfelbau hervorgerufen), so werden diese Jahre Futter pflanzen lehren im Emmental, bis die Milch bachweis fließt. Es war Wetter, wie nur Gott es machen konnte; das schnell gewachsene Heu wurde prächtig eingebracht, und auch das Korn kam gut in die Scheuern.
Die große Hitze bei der feuchten Erde musste starke Gewitter erzeugen; besonders gewitterhaft ging der erste Hundstag vorüber, der ein Vorbild sein soll für alle übrigen Hundstage. In der Tat witterte es auch die folgenden Tage gewaltig. Den 20. Juli entlud sich ein Gewitter über die Ecke zwischen Heimiswyl und Ruegsau, wie sie in dieser Gegend seit Jahren selten waren. Nicht von mächtigen Donnerschlägen will ich reden, in denen die Erde erbebte mit allem, was sie trug, sondern von den Wasserströmen, die sich über die Mannenberg-, Rachisberg-, Allmisberghöhen ergossen, und zu beiden Seiten in die Täler stürzten. Was die Wasser auf den Bergen fanden, brachten sie zu Tale nieder, rissen Erdlawinen los, versandeten den Fuß der Berge und schwellten den Ruegsaubach, der sonst so bescheiden um die Füße der Ruegsauer sich windet, zu einer selten gesehenen Höhe. Er trug Holz, wälzte Felsenstücke, grub sich neue Läufe, ergoss sich über Matten, ließ zappelnde Fische zurück auf denselben, machte Straßen unfahrbar, und wollte mit aller Gewalt dem Wirte zu Ruegsau in den Keller, um ihm Fuhren ins Welschland zu ersparen oder vielleicht dessen Wein dem durstigen Schachen zuzuführen. Der Wirt stund alle Leibesnot aus, den ungebetenen Gast, der weder Geld noch Silber, sondern nur Sand und Kieselsteine mit sich führte, vom Keller abzuhalten. Während das halbe Dorf teilnahm an diesem Kampfe für den Wein und gegen das Wasser, denn das ganze Dorf war dabei beteiligt, versuchte das Wasser heimtückisch einen andern Streich. Vor einem Spycher stund ein Fässchen mit ungelösch’tem Kalch, bis dorthin spülte das Wasser sich unbemerkt, schlich dem Fässchen an die Füße. Da fing es an zu zischen und zu brausen in demselben, und noch eine Viertelstunde, so hätten die Leute mit Feuer zu tun und das Wasser im Keller freier Hand gehabt, aber ein kluger Mann, der seine Augen gerne in allen Ecken hat, sah den Rauch und rief zur nötigen Hülfe.
Auf der andern Seite der Ecke, Heimiswyl zu, strömten die Wasser, was sehr merkwürdig ist, wieder feindselig besonders auf einen Keller los, und zwar auf den oder vielmehr die Keller des Lochbachbades. Die Wasser in ihrer Bosheit und ihrer fanatischen Wut gegen die Keller dachten nicht daran, dass den Fundamenten des dortigen Hinterhauses so unsanfte Berührungen unangenehm sein möchten. Sie stürzten sich mit fürchterlicher Gewalt dem Hause, den Kellern zu, nicht nur, als ob kein Wein im Keller, sondern kein Stein auf dem andern bleiben sollte. Da war kein Wirt, der dem Wasser unschädliche Bahnen anwies, keine Dorfschaft, die um den Wein besorgt, ihm mannlich zur Seite stund; aber beide ersetzte eine kuraschierte Hausfrau, die den Mut nicht verlor, dem Wasser sich entgegenstemmte, so gut es sich tun ließ, und schuld ist, dass der Schaden nicht größer wurde, als er ward.
Dieses Gewitter schädigte Einzelne bedeutend, ängstigte viele Leute, gab Stoff zu mancher Rede, aber daran dachte man nicht, dass es nur ein ganz kleiner Vorbote eines Riesengewitters sei, mit dem der Schoß der Wolken schwanger ging.
Es blieb heiß, und den vierten August war ein stark Gewitter. Da schien auf einmal der Sommer zu schwinden, der Herbst einzukehren; und auf wunderbare Weise teilten sie den Tag unter sich. Der Morgen war herbstlich, man glaubte der Kühe Läuten, der Hunde Jagdgebell hören zu müssen, dann ward der Abend wieder sömmerlich und von des Donners Stimme hallten alle Berge wider. Ganze Nebelheere hatten der Schweiz sich zugezogen, waren über die Berge gestiegen, hatten in die Täler sich gestürzt und lagerten sich grau und wüst über den Talgründen und an den Talwänden. Von allen Seiten waren sie hergekommen, als ob alle Mächte der ehemaligen sogenannten heiligen Allianz, die rings uns umgürten, vereint in ihren Ländern alle Dünste und alles die Luft Trübende zusammengeblasen und fortgeblasen hätten über ihre Grenzen weg über unsere Berge herein, dass es sich da ablagere und niederschlage zu Graus und Schrecken der armen arglosen Schweizer. Wirklich berichten Astronomen, dass in Deutschland und besonders im Norden desselben, wo die pfiffigen Preußen wohnen, die witzigen Berliner, die unsern Herrgott morgens und abends mitleidig bedauern, weil er nicht Witze zu machen verstehe wie sie, die Atmosphäre nie so lauter und durchsichtig gewesen sei als in jenen Tagen des Augusts, wo am Morgen Nebelmassen, am Abend Wolkenmassen schwarz und schwer den Schweizern, mit denen jeder unverschämte Bälli sein Bubenwerk treiben zu können meint, über die Köpfe hingen, den Gesichtskreis trübend, das Atmen erschwerend.
Diese Massen waren nicht arglose Wölkchen, die auf sanfter Winde leichten Fittigen reisen von Land zu Land und rosenrot in der Abendröte Schein lächeln übers Land herein; diese Massen bargen Verderben in ihrem Schoße und entluden sich unter Blitz und Donner gewaltig und zerstörend.
Zuerst schienen sie nur Spaß treiben zu wollen, etwas groben freilich, so wie man ihn um den Schwarzwald herum gewohnt ist und an der Donau rauem Strande und an der Oder superfeinem Sande. Sie jagten die Kühe auf dem Leberberge in die Sennhütten und erschreckten die L…nauer, ihnen ihre Herzkäfer, mächtige Schweine, durchs Dorf schwemmend.
Dann zogen sie, wie anno 1798 die Franzosen, vom blauen Berge weg das Land hinauf der Hauptstadt zu, trüb und feucht. Sie wetterten zwei Tage über der Hauptstadt, dass ein Teil der Hauptstädter zu zagen begann, der andere sich erboste, dass es so laut hergehe im Lande ohne obrigkeitliche Bewilligung. Und ratlos zwischen beiden Teilen stund verblüfft ein Direktor – oder Präsident, mit seinen zwei müßigen Sekretärs, und wusste nicht recht, sollte er erschrecken oder sich erbosen; er drehte mühselig und vorsichtig in steifer Krawatte den Kopf nach beiden Seiten, um zu erforschen, was am rätlichsten sei. Aber die Blitze zuckten feurigen Schlangen gleich, der Donner schmetterte seinen Schlachtenruf, die Winde brausten ihr Loblied, sie frugen nichts nach Landjägerkommandanten, nichts nach Polizeidirektoren, sie zuckten, schmetterten und brausten als die Herren des Landes, deren Ruf und Schelten alles untertan.
Bäume brachen, Häuser krachten, Türme wankten, bleich verstummte das Menschenkind und barg seinen Schrecken in des Hauses sichersten Winkel. Und als die zornigen Wolken den Herrleins und den Fräuleins gezeigt hatten, wer Meister sei im Lande, wälzten sie sich, jeden Tag von neuen Dünsten schwerer, durch neue Nebelmassen gewaltiger, noch weiter das Land hinauf. Aber zu reich gesättigt, vermochten sie sich nicht zu schwingen über der hohen Berge hohe Firnen, dem trocknen Italien und dem weiten Meere zu. Schon an den Voralpen blieben sie hängen, tobend und wild, und sprühten mit gewaltigen Wassergüssen um sich. Die Truber, die Schangnauer, Marbacher, die Escholzmatter wurden tüchtig eingeweicht, die Röthenbacher glaubten argen Schreck erlebt zu haben. Menschenleben gingen verloren, Land wurde verwüstet. Die zwei wilden Schwestern, von ungleichen Müttern geboren, die zornmütige Emme und die freche Ilfis, stürzten in rasender Umarmung brüllend und aufbegehrend das Land hinab, entsetzten die Zollhausbrücke, und überall ward ihnen zu enge im weiten Bette. Bebend stand der Mensch am allgewaltigen Strome. Er fühlte die Grenzen seiner Macht, fühlte, dass nicht er es sei, der die Wasserströme brausen lasse über die Erde und sie wieder zügle mit kühner mächtiger Hand. So wild und aufgebracht hatte man die Emme lange nie gesehen. Unzählbare Tannen und viel ander Holz schwamm auf ihrem grauen Rücken und erschütterte die Brücken; aber diesmal ward ihrer Gewalt ein baldig Ziel gesetzt, und der grauende Morgen fand sie bereits ohnmächtig geworden.
Am Morgen des 13. Augusts erhob sich die Sonne bleich über ihrem lieben Ländchen. Der Mensch glaubte, der Schreck von gestern, als sie so schnell von dem wilden Heere überzogen ward, weile noch auf ihren blassen Wangen. Der arme Mensch dachte nicht, dass das Grauen vor dem auf der lieben Sonne Antlitz war, dessen Zeugin sie sein sollte an selbigem Tage. Es war der Tag des Herrn, und von Tal zu Tal klangen feierlich die Glocken, sie klangen über alle Ecken in alle Gräben hinein und stiegen dann in immer weicheren Klängen zum Himmel auf. Und von allen Ecken und aus allen Gräben strömte die andächtige Menge dem Hause des Herrn zu. Dort stimmte in feierlichen Klängen die Orgel feierlich der Menschen Seelen, es redete tief aus dem Herzen herauf der Pfarrer tief in die Herzen hinein; und aus manchem Herzen stiegen gen Himmel Wölkchen christlichen Weihrauchs – das Sehnen, dass der Herr einziehen möge in sein himmlisches Jerusalem – in des frommen Beters geheiligtes Herz. Vom hohen Himmel herab hörte das wüste Wolkenheer das feierliche Klingen, das sehnsüchtige Beten. Es ward ihm weh im frommen Lande. Es wollte dem Lande wieder zu, wo wohl die Glocken feierlich läuten, wo wohl viel die Menschen beten, wo aber in den Herzen wenig Sehnen nach dem Himmel ist, sondern das Sehnen nach Liebesgenuss und des Leibes Behagen. Und auf des Windes Flügeln durch Windessausen wurde allen Nebelscharen und allen Wolkenheeren entboten, sich zu erheben aus den Tälern, sich loszureißen von allen Höhen der Hohnegg zu, um dort zu grauenvoller Masse geballt durchzubrechen in das Thuner Tal und von diesem lüsternen Städtchen weg einen leichtern Weg zu finden aus dem frömmern Land ins sinnlichere Land. Sie gehorchten dem Ruf. Schar um Schar, Heer um Heer wälzte dem Sammelplatz sich zu. Von Minute zu Minute wurde dichter und grauenvoller der ungeheure dunkle Wolkenknäuel, der an die Wände der Hohnegg sich legte und deren Gipfel zu beugen suchte zu leichterem Durchgang für die schwer beladene Wolkenmasse. Aber der alte Bernerberg wankte nicht, beugte sich nicht, wie ungeheuer der Andrang auch war, wie klug ein kleines Beugen auch scheinen mochte. Als die Wolkenheere, in tausend Stimmen heulend, tausendmal fürchterlicher als tausend Hunnenheere heranstürmten, lag schweigend der Berg da in trotziger Majestät und sperrte kühn den Weg nach alter Schweizerweise, die den Feind hineinließ ins Land, aber nicht wieder hinaus. Da hob höher und höher der Knäuel sich, aber durch die eigene Schwere immer wieder niedergedrückt, ergrimmte er zu fürchterlicher Wut und schleuderte aus seinem feurigen Schoße zwanzig züngelnde Blitzesstrahlen auf des Berges Gipfel nieder und mit des gewaltigsten Donners Getose versuchte er zu erschüttern des Berges Grund und Seiten.
Aber der alte Bernerberg wankte nicht, umtoset von den grimmigsten Wettern, beugte sein kühnes Haupt nicht vor den zornerglühten Blitzesstrahlen. Unten im Tale stund lautlos die bleiche Menge rings um die Häuser, im Hause hatte niemand Ruhe mehr; vor dem Hause stund neben dem blassen Mann das bebende Weib und schauten hinauf in den grässlichen Wolkenkampf an des Berges Firne. Schwarz und immer schwärzer wie ein ungeheures Leichentuch mit feurigen Blitzen durchwirkt, senkte sich das Wolkenheer über die dunkel werdende Erde, und auch durch das Tal hinab fing es an zu blitzen und zu donnern. Ein langer Wolkenschweif, die Nachhut des großen Heeres, dehnte sich das lange Tal hinab, und am trotzigen Berge zurückgeprallte Wolkenmassen eilten blitzend und donnernd, geschlagenen Heeressäulen gleich, über die Häupter der Zitternden. Schwer seufzte der Mann aus tiefer Brust; ein »das walt Gott« nach dem andern betete in dem bebenden Herzen das bebende Weib. Da zerriss im wütenden Kampfe der ungeheure Wolkenschoß; losgelassen wurden die Wassermassen in ihren luftigen Kammern, Wassermeere stürzten über die trotzigen Berge her; was dem Feuer nicht gelang, sollte nun im grimmen Verein mit den Wassern versucht werden. Es brüllte in hundertfachem Widerhall der Donner, tausend Lawinen donnerten aus den zerrissenen Seiten der Berge nieder ins Tal; aber wie kleiner Kinder Gewimmer verhallt in der mächtigen Stimme des Mannes, so kam plötzlich aus den Klüften der Hohenegg und der Schyneggschwand über der Donner und der Lawinen Schall eine andere Stimme, wie Trompetengeschmetter über Flötengelispel. Waren es Seufzer versinkender Berge? War es das Ächzen zusammengedrückter Täler? Oder war es des Herrn selbsteigene Stimme, die dem Donner und den Lawinen gebot? Lautlos, bleich, versteinert stund die Menge, sie kannte den Mund nicht, der so donnernd wie tausend Donner sprach durchs Tal hinab.
Aber in einsamer Bergeshütte sank auf die Knie ein uralter weißbärtiger Greis und hob die sonst so kräftigen Hände zitternd und betend zum Himmel auf: »Herrgott, erbarme dich unser!«, betete er. »Die Emmenschlange ist losgebrochen, gebrochen durch die steinernen Wände, wohin du sie gebannt tief in der Berge Schoß seit anno 64. Sie stürzt riesenhaft durch den Röthenbach ihrer alten Emme zu, vom grünen Zwerglein geleitet. Ach Herrgott, erbarme dich unser!« Er allein da oben hatte die Sage von der Emmenschlange noch nicht vergessen, wie nämlich der zu besonderer Größe anschwellenden Emme eine ungeheure Schlange voran sich winde, auf ihrer Stirne ein grün Zwerglein tragend, welches mit mächtigem Tannenbaum ihren Lauf regiere; wie Schlange und Zwerglein nur von Unschuldigen gesehen würden, von dem sündigen erwachsenen Geschlecht aber nichts als Fluss und Tannenbaum. Diese Schlange soll von Gott gefangen gehalten werden in mächtiger Berge tiefem Bauche, bis in ungeheuren Ungewittern gespaltene Bergwände ihren Kerker öffnen; dann bricht sie los, jauchzend wie eine ganze Hölle, und bahnt den Wassern den Weg durch die Täler nieder. Es war die Emmenschlange, deren Stimme den Donner überwand und der Lawinen Tosen. Grau und grausig aufgeschwollen durch hundert abgeleckte Bergwände stürzte sie aus den Bergesklüften unter dem schwarzen Leichentuche hervor, und in grimmem Spiele tanzten auf ihrer Stirne hundertjährige Tannenbäume und hundertzentnerige Felsenstücke, moosicht und ergraut. In den freundlichen Boden, wo die Oberei liegt, stürzte sie sich grausenvoll, Wälder mit sich tragend, Matten verschlingend, und suchte sich da ihre ersten Opfer. Bei der dortigen Sägemühle spielte auf hohem Trämelhaufen ein liebliches Mädchen, als die Wasser einbrachen hinter dem Schallenberg hervor. Um Hülfe rief es den Vater, auf der Säge sich zu sichern rief ihm derselbe zu vom gegenüberstehenden Hause. Es gehorchte dem Vater, da wurde rasch die Säge entwurzelt und fortgespült wie ein klein Drucklein. Das arme Mädchen hob zum Vater die Hände auf, aber der arme Vater konnte nicht helfen, konnte es nur versinken sehen ins wilde Flutengrab. Aber als ob die Sägeträmel dem Kinde hätten treu bleiben wollen, fassten sie es in ihre Mitte, wölbten ihm ein Totenkämmerlein und türmten sich unterhalb Röthenbach zu einem gewaltigen Grabmale über ihm auf. Sie wollten nicht, dass die Schlange es entführe dem heimischen Boden, sie hüteten es in ihren treuen Armen, bis nach Wochen die Eltern es fanden und es bringen konnten an den Ort der Ruhe, wo sein arm, zerschellt Leibchen ein kühles Plätzlein fand, gesichert vor den bösen Fliegen, die es im Tode nicht ruhig ließen, aber auch sein Kämmerlein den Suchenden verrieten.
Einen armen Köhler jagten die Wasser in seine Hütte, zertrümmerten ihm diese Hütte und wollten ihn weiß waschen, den schwarzen armen Mann, bis er weiß zum Tode geworden wäre; aber auf einen Trämel, der ihm durch die Hütte fuhr, setzte er sich, und ritt nun ein halsbrechend Rennen mit tausend Tannen, bis er Boden unter seinen Füßen fühlte und an dem Berge hinauf sich retten konnte. Der arme Mann weiß nichts mehr zu sagen von seiner Todesangst und Todesnot, aber dass der Bach ihm seine Effekten weggenommen, aufs Wenigste 81 Btz. wert und darunter zwei Paar Schuhe, von denen die einen ganz neue Absätze gehabt, das vergisst er nicht zu erzählen und wird es auch im Tode nicht vergessen. Die Kühe in der Riedmatt hatten am Morgen ihre Meisterleute ungern gehen sehen an die Kindstaufe in der Grabenmatt, hatten ihre Häupter bedenklich ihnen nachgeschüttelt; als nun der Donner brüllte und die Wasser brausten, da retteten sie sich in eine Hütte und schauten von da wehmütig übers Wasser nach der Grabenmatt: ob der Meister nicht kommen wolle ihnen zu Rat und Hülfe. Als die Wasser die Hütte zerstießen, da riefen sie gar wehlich nach dem Meister und, vom Wasser fortgerissen, wandten sie ihre stattlichen Häupter immer noch dem erwarteten Meister entgegen, doch umsonst. Es wussten’s die Kühe, wie tief ihr Elend dem Meister ins Herz schnitt, der eine der geretteten, aber schwer verletzten Kühe nicht zu schlachten vermochte, weil sie ihm zu lieb war. Während in der Weid die Kühe verloren gingen, stunden im Hause die zurückgebliebene Magd und ein Knabe Todesnot aus. Auf den Brückstock hatten sie sich gerettet und der Knabe das Fragenbuch, in dem er in der Stube gelernt hatte, mitgenommen. Auf dem Brückstock lernte derselbe nun fort und fort in Todesangst und Todesschweiß, bis die Not vorüber war, im Fragenbuch. Das war ein heißes Lernen! Der Knabe nennt es Beten – und wird dasselbe ebenso wenig vergessen als der Köhler seine alten Schuhe mit den neuen Absätzen.
Die tiefe Flut wurde dem Bach zu enge immer mehr, er riss die Ufer immer weiter auseinander zur Rechten und zur Linken, stieg hoch hinauf zu beiden Seiten, warf schwere Steine in hohe Matten, bespülte den Fuß des höher gelegenen Dorfes Röthenbach, und gewaltige Tannen bäumten hoch sich auf, den Menschen, die sie nicht erreichen konnten, wenigstens zu drohen. Unterhalb dem Dorfe zerriss er die dortige Sägemühle und stürzte sich nun das liebliche Tälchen hinab.
Um ihre Hütten stunden dort schon lange die armen Bewohner schauernd in dem Feuer des Himmels, welches das Tal erfüllte, die Menschen blendete, Menschen und Hütten zu verzehren drohte. Da drang das furchtbare Tosen zu ihnen heran; ihm nach alsobald stürzte schwarz die ungeheure Flut, hochauf ganze Bäume werfend, radweis schwere Trämel überschlagend vor sich her. Ein Stück des Bodens, der sie vom Bache trennte, nach dem andern verschwand. Die Flut wühlte sich um ihre Füße, untergrub des Hauses Seiten, warf Tannen durch die Fenster, erschütterte mit Trämeln den ganzen Bau, alles in wenig Augenblicken. Da ward’s den armen Leuten, als ob die Tage der Sündflut wiederkehrten; es floh, wer fliehen konnte, nach allen Seiten der hohen Bergwand oder hohen Bäumen zu.
Mütter ergriffen ihre Kinder, Söhne trugen ihre Väter, arme Witwen führten ihre Ziegen, andere flohen in Angst mit dem, was ihren Händen am nächsten lag, mit einem Hausgerät oder gar mit einem Stück Holz oder Laden.
Aber wer steht dort unter der Tür der Hütte, die im Wasser wankt, wankend und blass, winkend mit den Händen, da ihr Jammergeschrei im Rollen des Donners, im Toben der Flut, im Krachen der fortgerissenen Holzmasse ungehört verhallt? Eine arme Kindbetterin ist’s, die vor einer Stunde ein Kind geboren, aufgeschreckt worden ist aus ihrer ohnmächtigen Schwäche durch das Brüllen der Wogen und, das Kind im Fürtuch tragend, bis an des Hauses Schwelle sich schleppte, aber die Kraft nicht hatte, durch die sie umringenden Wasser sich zu wagen mit dem wimmernden Kindlein. Schon glaubte sie zu fühlen, wie der Tod kalt ans Herz ihr trete, vor den Augen flimmerte es ihr, auf den Wellen getragen wähnte sie sich; da zeigte Gott einem wackern Manne das arme winkende Weib. Der zauderte nicht, folgte dem Winke, setzte das eigene Leben ein und rettete kühn die Mutter und ihr Kind. Wohl, es gibt noch getreue Schweizerherzen!
Mitten zwischen Röthenbach und Eggiwyl stunden zwei Häuser mitten im Tale nicht weit von des Baches flacher gewordenen Ufern, »im Tennli« nannte man die beiden Häuschen, von denen das eine ein Schulhaus war, das andere ein Krämer bewohnte mit Weib und Kindern, von denen zwei die Gabe der Sprache entbehren. Die Wasser hatten des Krämers Haus umringt, ehe er fliehen konnte mit seinen Kindern, seiner Kuh. Durch die Fenster der untern Stube schlugen gewaltige Tannenbäume, er flüchtete sich mit den Seinen in die Kammern hinauf. Aber nun erst sahen sie recht die Größe ihrer Not, die Wut der Flut, die unaussprechliche Gewalt, mit welcher die größten Bäume wie Wurfgeschütze hoch aufgeschleudert wurden und ihrem Häuschen zu, wie sie an den Fenstern vorbeifuhren und sogar das Dach über den obern Fenstern beschädigten. Sie sahen das oberhalb leerstehende Schulhaus aufrecht gegen sie schwimmen und an der westlichen Ecke des Daches sich feststellen; es schien ein Schirm von Gott gesandt, Holz stauchte davor sich auf, ein immer sicherer werdendes Bollwerk. Da betäubte die Hoffenden ein fürchterliches Krachen, eine Woge hatte das Schulhaus fortgerissen, mit ihm das schützende Holz. Aufs Neue donnerten die Tannen, Sturmböcken gleich, an das schutzlose Häuschen; aufs Neue gruben die Wellen dem Häuschen das Grab; es senkte sich mehr und mehr, und mit lebendigen Augen mussten die Armen immer näher schauen ins grause Grab hinab, das ihnen die wütenden Fluten tiefer und immer tiefer gruben. Sie ertrugen den Anblick nicht, er war fürchterlicher, als ein sterbliches Herz ertragen mochte. In der obern Ecke der Kammer knieten sie nieder, die Eltern die Kinder umschlingend, die Eltern von den Kindern umschlungen; dort weinten sie und beteten und bebten, und kalter Schweiß bedeckte die Betenden. Und die Kinder jammerten den Eltern um Hülfe, und die Stummen liebkosten und drängten sich an die elterlichen Herzen, als ob sie in denselben sich bergen möchten, und die Eltern hatten keinen Trost den armen Kindern als Beten und Weinen und dass sie alle miteinander untergehen, in der gleichen Welle begraben werden möchten. Über drei fürchterliche Stunden harrten sie aus betend und weinend, litten jede Minute die Todespein, litten 180 Male die Schrecken des Todes, und die Herzen schmolzen nicht, ihre Augen brachen nicht in dieser grässlichen Not! Der Herr hörte das Beten. Das entsetzte, untergrabene und halbeingefallene Häuschen blieb stehen, und die armen Kinder mussten nicht trinken aus den trüben Wassern. Der Mann mit seinen Kindern wird sein Lebtag an seinen Herrn im Himmel denken, den mächtigen Retter in so großer Not, sonst verdiente er, dass der Herr auch seiner nicht mehr gedächte in einer andern Not.
Von da bis zur Mündung in die Emme liegt noch manches schöne fruchtbare Heimwesen, liegen Mühle und Säge und gerade oberhalb der Mündung Eggiwyl. Dieses Tälchen herunter brauste die wütende Flut, durch Ströme aus jeder Bergesrinne immer höher anschwellend, in ganzer Talbreite, zerstörte die Säge, nahm im wohlbesorgten Leimegut ein Scheuerchen mit zwei Kühen weg, und stürzte nun auf Eggiwyl zu. Auch hier hatten die wilden Wetter getobt auf unerhörte Weise, und als nun von oben her das Schnauben und Brüllen der Wasser den Donner überstimmte und die Blitze immer feuriger zuckten, da ergriff alle der heilige Schrecken des jüngsten Tages. Sie glaubten der Posaune Ruf zu hören, sie gedachten ihrer Sündenschuld, ihre Knie wankten, trugen sie kaum auf den nächsten Hügel, kaum vermochten sie zu beten, nicht um ein gnädiges Gericht, sondern um des Vaters Erbarmen. Unten im Dorfe hatte des Sagers Familie vor dem strömenden Regen sich in die Stube geflüchtet, nur der alte Vater war noch draußen geblieben, zu sehen, was da kommen werde. Seiner alten Frau war nicht wohl in der Stube ohne Ätti, der nicht mehr flink auf den Beinen war, sie wollte ihn holen unten im Baumgarten, wo der Alte, auf seinen Krückenstock gelehnt, in die Wetter schaute. Da brachen plötzlich die Wasser ein, erfassten die beiden alten Leute und trugen sie der brüllenden Emme zu. Der alte Mann wurde an einen Baum geschwemmt und kaum hielt er sich an demselben fest, so sah er sein altes Fraueli bei sich vorbeitreiben, bittend die Hände aufheben, glaubte zu hören, wie sie »ach Gott« sagte – und er konnte nicht helfen, konnte seinem alten Fraueli nicht helfen, das seinetwegen in den Wassern schwamm, musste es in den Fluten begraben sehen, während er selbst gerettet wurde. Hat der Mann wohl die Lösung der Fügung gefunden, warum der liebe Gott sein Fraueli zu sich genommen, ihn selbst noch auf Erden gelassen hat?
Das Dorf Eggiwyl war bis hinauf zum Pfarrhaus überflutet, die Mühle beschädigt, aber besonders die Säge dem Flutendrange ausgesetzt, wo des alten Sagers Sohn mit Weib und Kind in der Stube war. Sie retteten sich mit schwerer Not hinauf auf das Futter, aber als sie die Häupter ihrer Lieben zählten, fehlte ihnen ein teures Haupt, ein rosenrotes dreijähriges Mädchen. Sie suchten es, so gut sie konnten, glaubten es endlich in den Fluten vergraben und jammerten laut um den Liebling. Den Jammer hörte endlich ein tüchtiger Mann, der, von dem Wasser überfallen, auf einem Baume geborgen saß. Der Drang zu retten stieg ihm zu Herzen und er vom Baume, über wankende Trämel weg durch die schäumende Flut und sprang durch ein Fenster in die Stube, in welcher Stühle schwammen und Tische. Er suchte da das Kind und fand es nicht. Er rief, aber kein Stimmchen antwortete ihm. Er suchte endlich im Nebenstübchen. Da fand er das Kindlein erstarrt, bis an den Hals in Schlamm und Sand eingemauert, das Köpfchen in den Unrat gesenkt, zwischen zwei Betten, wohin es die Eltern so oft getragen hatten, wenn ihm die Schlafnot angekommen war, und wo es jetzt Rettung gesucht haben mochte in seiner Wassernot. Der unerschrockene Mann machte sachte das Kindlein los, trug es den gleichen Todesweg zurück, ohne dass der Fuß ihm bebte oder stärker das Herz ihm klopfte. Erst als er das Kindlein legte in der Mutter Schoß und dem Vater die stille Freude aus den Augen glühte (»als der Vater ihm um den Hals fiel«, pflegt man sonst in solchen Fällen zu schreiben, aber ein Eggiwyler nimmt wohl den andern bei dem Hals, aber dass ein Eggiwyler dem andern um den Hals gefallen sei aus Zärtlichkeit, weiß man sich seit Mannsdenken nicht zu erinnern), da klopfte dem mächtigen Manne doch stärker das Herz und trieb ihm die Röte ins Gesicht. Ein inneres Etwas sagte ihm: Der himmlische Vater hätte gesehen, was er getan, und das werde ihm wohlkommen an jenem Tage, dessen Einbrechen sie heute erwartet, der jeden erreichen wird zu der Stunde, die der Vater festgesetzt hat.
Das Mädchen kam wieder zu sich, blühte noch in selber Nacht einem Röschen gleich und verlangte dringend zu Großmütti ins Bett – ach, das arme Kindlein wusste nicht, wie nass und kalt dem Großmütti gebettet worden war.
Der Zusammenfluss der Emme und des diesmal mächtigeren Röthenbachs war fürchterlich, der ganze Talgrund ward angefüllt mit wütenden Wassern, bedeckt mit Holz und Häusern, zwischen denen eine Kuh oder ein Pferd seinen betäubten Kopf nach Rettung emporhob. Wie die tausend und tausend Stücke Holz, ganze Tannen mit ihren Wurzeln, ästige Bäume, 100 Fuß lange Bautannen, Trämel von 3 Fuß im Durchmesser, die Schwellen- und Brückenhölzer, die Hausdächer, die Spälten alle den Weg fanden im engen Bette der Emme durch das dichte Schachengestrüpp, das meist an beiden Seiten des Flusses sich hinzieht, könnte niemand begreifen, wenn man nicht bedächte, welche ungeheure Gewalt die Holzmasse riss durch dick und dünn, eine Gewalt, entstanden eben durch die unnennbare nachdringende Holzmenge und die furchtbare Wassermasse, geschwängert mit fetter Erde und darum doppelt so schwer und doppelt so gewaltig.
Keine Tentsche schützten das Land, hie und da brach auch kein Schachen mit seinem Unterholz den Zug des Stromes, darum wankte in der Holzmatt das dortige Krämerhaus im Wasserstrome; darum überschüttete er das schöne Dippoldswyl, riss dem reichen Zimmezeier ein Scheuerchen um und zahlte ihn dafür mit Sand und Steinen aus. Untenher wendet sich die Emme von der rechten Talseite auf die linke in kurzer Beugung. Wenige Schritte untenher der Beugung ohne Schutz fast in gerader Richtung mit der Emme obern Lauf, stunden zwei Häuser, von denen eins wieder ein Schulhaus war. Hier nun stürzte die Emme, krumme Wege hassend, gerade fort, zertrümmerte das eine Haus, jagte durch das Schulhaus Trämel, als ob es Kanonenkugeln seien, und ergoss sich über das fruchtbare Horbengut, mehr als 1200 Korngarben mit sich schwemmend.
Der andere Teil der Emme stürzte sich unter der schönen Horbenbrücke durch, wo kein Joch den Wasserstrom hemmte, das Anhäufen des Holzes erleichterte. Und doch war es der halben Emme zu eng unter dem weiten Bogen, sie wühlte sich um die Brücke herum, würde in kurzer Zeit den Brückenkopf weggerissen, die Brücke in die Wellen gestürzt haben, wenn nicht jede irdische Gewalt ihr Ende fände und also auch der Emme Macht und Gewalt. Sie rührte bei der Eschau-Säge das Holz untereinander und strömte durch Stall und Stuben, sie erbarmte sich des schönen Ramseigutes nicht, wurde erst recht wild, als der noch nicht abgebrochene mittlere Satz der unglücklich angefangenen Bubeneibrücke ihren Lauf hemmte, und überströmte dort fürchterlich.
Wie es den armen Leuten allen durch alle die Schächen nieder in all den schlechten ärmlichen Häuschen ward, als der gestrige Schreck in dreifachem Maße wieder kam, als der Strom so plötzlich sie überflutete, Leben und Habe gefährdend, und niemand wusste, wohin sich sicher retten, welches Ende der Vater da oben der Not gesetzt, das kann ich nicht beschreiben. Ginge einer aber von Häuschen zu Häuschen, er würde vieles vernehmen und in jedem Häuschen Neues, Rührendes und Schönes, Heldenmut von Mann und Weib, Gottesfurcht bei Jung und Alt; er würde hören von manchem Gewissen, das aufsprang im Donner der Fluten, von manchem Glauben, dem die gewaltigen Wogen nicht nur des Hauses Türe, sondern auch des Herzens Pforten sprengten zu offenem weitem Eingang. Aber das alles so recht schön und treu zu erzählen wäre schwer.
Ich aber bin nicht gegangen von Häuschen zu Häuschen, sondern nur der Emme nach, sah, wie furchtbar sie wider Schüpbach anrannte und wieder in der dortigen Beugung die Säge teilweise zerstörte, die Brücke zerriss, in immer wütenderem Laufe den Emmenmattschachen überschwemmte, die dortige Straße durchbrach und die heute mattere schwesterliche Ilfis verächtlich bei Seite schiebend, der Zollbrücke zustürzte, um dort das gestern angefangene Werk zu vollenden.
Sie kam gerade noch zu rechter Zeit, um den dortigen Arbeitern die Mühe des Abbrechens zu ersparen und einer Schar Neutäufer tückisch den Übergang zu wehren, boshaft ihnen Wasser um die Füße wirbelnd zu abermaliger Taufe, trübes freilich, aber wie es zu ihrer Lehre passt, nach welcher der O…bach-S… bald ihr heiligster Heilige werden wird.
Mit gewaltigen Armen riss sie diese Brücke weg, trug sie spielend fort, als ob sie dieselbe bei der berühmt gewordenen Wannenfluh aufführen wolle; doch zertrümmerte sie dieselbe obenher. Bei der Wannenfluh erbarmte sie sich Menschen und Vieh, spülte die damals zu schmale Straße, auf der Menschen den Hals, Pferde die Beine gebrochen hätten, teilweis fort und nahm den Rest von zirka 20000–30000 Fr. Lehrgeld, welches der gute Stand Bern ihr zahlte, damit sie seine mit 2000–3000 Fr. besoldeten oder betaggeldeten Ingenieurs schwellen und straßen lehre, in Empfang.
Der teure Kot, den sie da verschluckt hatte, würgte sie, sie spie ihn zu beiden Seiten wieder aus, rechts, wo der sich alles einbildende X keine Schutzmauer nötig gefunden hatte, über das Ramseigut, links über den Schnetzischachen, wo ihn die liebe Republik noch einmal bezahlen musste, und wahrscheinlich wieder teuer. Dem aber frug die wütende Emme nichts nach, wahrscheinlich ebenso wenig als die, für welche der Staat das Lehrgeld bezahlt.
Wo keine Felsen ihr im Wege stunden, ging sie in nie gesehener Fülle über beide Ufer weg, trug die größten Tannen über die höchsten Tentsche und jagte sie mit rasender Gewalt durch die Schächen. Ebendiese Wasserfülle hauptsächlich bewahrte die untere Gegend vor unendlichem Unglück, vor einem Durchbruch der Emme, einem Ergießen des Hauptstromes durch eingerissene Schwellen und Dämme ins freie Land hinaus. Wäre der erfolgt, dann wären Dörfer zugrunde gegangen und viel mehr Menschenleben, indem man in Ebenen dem Wasser nicht entfliehen kann wie in Tälern, wo die zwei Seitenwände wenig hundert Schritte auseinander liegen. So ergoss die Emme nicht an einem Orte, sondern fast allenthalben und zu beiden Seiten ihren Überfluss, so entlud sie sich auch einer Masse Holz, die, im Strome geblieben, noch manche Brücke zerrissen hätte. Auf die armen obrigkeitlichen Schwellen und Arbeiten hatte es die Emme mit besonderer Bosheit abgesehen, wahrscheinlich weil die für den Staat Schwellenden sie frecherweise ein klein Mühlebächlein genannt hatten. Am Fuße von Lützelflüh lag auch eine, die trotz allem Warnen auf neue Mode, d.h. auf Sand gebaut worden war; schon lange lag sie im traurigsten Zustande, aber man sagte es nicht gerne, und zu klagen hielt der Respekt die untern Besitzer ab. Aber der verhöhnte Eggiwylfuhrmann kannte keinen Respekt, er zerstörte die letzten Reste dieser traurigen Schwelle und nahm eine Ecke Land mit sich. Zum rechten Einreißen hatte er keine Zeit, sonst hätte diese teure aber traurige Schwelle auch noch ein teures Ende genommen.
Auf der Brücke zu Lützelflüh stund eine bange Menge. Hier und obenher hatte man ein Anschwellen der bereits verlaufenen Emme nicht geahnet. Wohl sah man seit drei Uhr einen schwarzen Wolkensaum an den obern Bergen, sah Regen dort und Blitze und hörte hie und da einen dumpfen Donner; kleine Tropfen waren gefallen, ein schöner Regen strich gegen Abend übers Land, und gelassen rüsteten die Männer ihre Tubakpfeifen, um einem Schoppen nachzugehen. O wenn der Mensch wüsste in jeder Stunde, wie es andern Menschen wäre zur selben Stunde, dann wäre ihm selten mehr eine glückliche Stunde vergönnt!
Auf einmal erscholl der Emme Gebrüll in dem friedlichen, sonntäglichen Gelände. Man hörte sie, ehe sie kam, lief an die Ufer, auf die Brücke. Da kam sie, aber man sah sie nicht, sah anfangs kein Wasser, sah nur Holz, das sie vor sich her zu schieben schien, mit dem sie ihre freche Stirne gewappnet hatte zu desto wilderem Anlauf. Mit Entsetzen sah man sie wiederkommen, so schwarz und hölzern und brüllend, und immer höher stieg das Entsetzen, als man Hausgeräte aller Art daherjagen sah: Bütten, Spinnräder, Tische, Züber, Stücke von Häusern, und diese Trümmer kein Ende nahmen und der Strom immer wilder und wilder brauste, immer höher und höher schwoll. Wo ein fühlend Herz war, das brach in Jammer aus über das entsetzliche Unglück, dessen Zeugen der Täter selbst an ihren Augen vorbeiführte.
Dem wilden Strome war auch diese Brücke im Wege. Er stürmte mit Hunderten von Tannen an deren Jöcher, schmetterte Trämel um Trämel nach, stemmte mit großen Haufen Holz sich an, schleuderte in wütendem Grimme ganze Tannen über diese Haufen weg an die Brücke empor wie Schwefelhölzchen, brachte endlich das Dach einer Brücke und verschlug damit die Bahn zwischen beiden Jöchern. Da krachte die Brücke, und hochauf stürzten die Wasser mit jauchzendem Gebrülle. Ein jäher Klupf ergriff die auf der Brücke Weilenden, kaum trugen die zitternden Glieder sie auf sichern Grund; ein angstvoll Bangen klemmte die Herzen der Umstehenden zusammen, die Stimme stockte in des Menschen Brust. Der Nachbar fasste am Arme den Nachbar und nur ein einzelnes Jetzt, jetzt! wurde hörbar unter der lautlosen Menge. Die Brücke wankte, bog sich, schien klaffen zu wollen fast mitten voneinander; da zerschlug der Strom in seiner Wut sein eigen Werk, schmetterte einen ungeheuren Baum mitten an das schwellende Dach. Nun borst statt der Brücke das Dach und verschwand unter der Brücke in den sich bäumenden Wellen. Es war der Durchgang wieder geöffnet, es ward wieder frei die Stimme in der Menschen Brust, und jede frei gewordene Brust brachte ein Gottlob zum Opfer dar. Es wussten diese Menschen, dass man das Ärgste erwarten muss, wenn blinde Wut sich selbst den Weg verlegt. Aber wo das Ärgste droht, da hilft oft Gott; er gebeut, und die machtlose Wut, die sinnlose Leidenschaft zerstört durch eigenes Beginnen die eigenen Zwecke.
Tobend wütete die Emme das Tal hinunter, viele hundert Fuß breit, fast von einem Emmenrain zum andern, Hasle und dem Rüegsauschachen zu. Dort hatten die Winkel sich längst geleert, männiglich auch ängstlich die dreifach gejochte Brücke verlassen, die mit ihren engen Zwischenräumen den Holzmassen den freien Durchgang wehrte. Hier wie an allen obern Orten dachte kein Mensch an Maßnahmen zu Schirmung der Brücken, wie es doch in früheren Zeiten üblich war und namentlich bei der Haslebrücke. Die gehemmte Emme bäumte Tanne auf Tanne, Trämel auf Trämel, bis weit oberhalb der Brücke türmten sich die krachenden Holzhaufen. Zu beiden Seiten strömten nun die Wasser aus mit immer steigender Gewalt und suchten dem Strom eine ungehemmte Bahn. Noch einige Minuten, und ihr Beginnen wäre auf der Hasle-Seite gelungen. Es harrten in den Schrecken des Todes die Kalchofenbewohner der einbrechenden Wasserflut, welche die ganze Oberburg-Ebene verwüstet, ein neues Bett sich gegraben hätte. Es flohen die Rüegsauer durch das steigende Wasser, und überall war ein Beten, dass die Brücke doch voneinandergehen möchte. Und die Betenden erhielten den Beweis, dass Gott oft Gnade vor Recht ergehen lässt. Die Brücke brach in zwei Teile, diese kreuzten sich majestätisch mitten auf der Emme, schwammen aufrecht einige hundert Schritte weit hinunter, pflanzten dort nicht weit von beiden Ufern sich auf, stellten das Bild zweier zerstörten Sägemühlen dar, und unglaubliche Holzmassen fingen sich an denselben. Mitten auf dem Grunde, gegenüber Hasle oder etwas unterhalb, lagerten sich ebenfalls furchtbare Holzstöße ab, schwellten die Emme wieder, die weiter oben einen Einbruch versuchte, aber zu rechter Zeit von versuchten Männern daran verhindert wurde.
Nachdem oberhalb Burgdorf holzsüchtige Jungens, angeführt von kühn im Wasser plätschernden gespregelten Schenkeln, den Mut gehabt hatten, von der wilden Jungfrau eigenmächtig den Holzzehnten zu erheben, schnob diese umso empörter die Bürger Burgdorfs an. Diese vergaßen diesmal das Tändeln mit der Jungfrau, ja vergaßen fast, einen Witz zu reißen, und schirmten mannlich und glücklich Brücken und Häuser. Nur hielten sie es nicht der Mühe wert, für die lockere Schinderbrücke, die seit Menschengedenken eine lockere war und wahrscheinlich in Ewigkeit eine lockere bleiben wird, damit man in der soliden Zeit nie vergesse, was locker für ein Wort gewesen, ihr Leben zu wagen.
Verächtlich eilte sie über die niedere Kirchbergerbrücke weg, die mit dem Bauche fast auf dem Grunde ruht; was nicht unter ihr durchmochte, sprang lustig über sie hin. Sie wusste, es wäre in Utzenstorf viel zu löschen und abzukühlen gewesen; auch kannte sie ihren alten Weg, auf dem sie in den Sechzigerjahren mitten durchs Dorf gegangen und beim Spritzenhaus einen Mann ertränkt hatte, noch gar wohl; allein eigener Wogendrang trieb sie geradeaus, und nur ein klein Brücklein nahm sie weg. Den Bätterkindern goss sie eine gute Portion Wasser über ihr Büchsenpulver. Den Wylerern vertrieb sie für einige Zeit die Lust zum Wässern, aber nicht zum Prozedieren; den Herren von Roll zu Gerlafingen schonte sie, die waren ihr zu gute Kunden, um ihre Schwellen und Dämme verderben, dem Kanton das Holz verwässern zu helfen. (Es nimmt einem doch wunder, was die Solothurner für ein Gewissen haben. In ihrem Kanton erlauben sie keinem Berner, an ihren Fyrtigen zu arbeiten, die den Berner doch nichts angehen; ungeniert ziehen sie aber an unserem und ihrem Sonntag mit ihren wüsten Banden Emme auf und ab durch unsern Kanton und ärgern alle Leute. Kömmt euch dann euer Glaube nicht nach in unsern Kanton, oder glaubt ihr, es gebe keinen Sonntag in unserem Kanton? Das könnte aber, nach der herrschenden Erbitterung zu schließen, ein baldiges trauriges Ende nehmen. Leute, lasst doch die Emme am Sonntag ruhig, stört sie nicht mutwillig, sonst zeigt sie euch wieder, was sie am Sonntag kann, und lässt auch euch am Sonntag nicht ruhig.)
In Biberist hatte sie Lust, die Abweissteine am dortigen Stutz, die seit Jahren da liegen, ohne dass sie jemand aufgerichtet hätte, zurechtzusetzen. Wahrscheinlich fiel ihr ein, das Solothurner Blatt werde vielleicht einmal seine Nase nicht nur in andere Kantone stecken, sondern auch in den eigenen Kanton, und dort dahin, wo es nottäte; an den Biberiststutz z.B., darum eilte sie vorbei und brünstig in die Arme ihrer älteren Schwester. Auch diese hatte durch die Zull und Rothachen einen Teil der Wasser empfangen, die über die Gipfel der Berge eingebrochen, aber auf der West- und Südwestseite niedergestürzt waren. Vereint trugen beide Trümmer weit ins Aargau, bis in den Rhein hinunter. In Aarau wurde ein Brett der Schüpbachbrücke mit folgender Inschrift aufgefangen: Ich bendicht Dälenbach brugvogd zu der Zit Schüpach han im namen der zweien Uirteln dise brüg lasen bon 1652.
Nach einem unendlich langen Abend lagerte endlich die Nacht über der Erde sich. Wolken bedeckten den Himmel. Was dem Auge verhüllt ward, das kam mit dreifachem Grausen durch das Ohr zum Bewusstsein des Menschen. Da rissen die Wolken auseinander, und durch die Spalte sah der Mond nieder auf die Wasserwüste; seine blassen Strahlen erleuchteten Streifen des schauerlichen Bildes.
Man sah Wogen spritzen, Tannen im Wasser sich bäumen riesigen Schlangen gleich, sah ganze Bäume ihre Äste hervorrecken aus dem flimmernden Wellenschaum, man glaubte, Kraken ihre ungeheuren Arme ausbreiten zu sehen in dem ungewohnten Wasser. Bald verhüllte der Mond sich wieder, ergraut darüber, was seine Strahlen enthüllten, und das ganze Bild versank in schwarze Nacht.
Da gingen die Menschen; die einen ihren Häusern zu, andere zur Labung, und weil die angefüllte Brust noch der Rede bedürftig war, einem Schoppen nach, wenige blieben zu wehren und zu wachen in der Nähe des Flusses, der in dem Maße, als seine Wut schwand, an Heimtücke zunahm.
Wo Menschen sich fanden, da war bange Nachfrage nach den Übeltaten, die der Fluss unten und oben im Lande ausgeübt. Wie auf Windesflügeln flog die Kunde den Fluss hinauf, den Fluss hinab; man wusste nicht, woher sie kam, wusste nicht, wer sie brachte; augenblicklich war sie in aller Ohren, und jeder Mund sprach sie gläubig nach. Röthenbach, Eggiwyl, Schüpbach sollten zerstört, Eschau, Bubeneisägen weggenommen, ungezählte Menschenleben verloren gegangen sein; man nannte viele und die Weise ihres Todes. Mit der Rüegsaubrücke seien nicht weniger als fünfzig Menschen dem Tode verfallen, mit dem Lochbachsteg ebenfalls Menschen dem Fluss zur Beute geworden, so lauteten die Nachrichten; und wie die Brücken zu Burgdorf, Kirchberg, Bätterkinden gebrochen worden, wusste man ganz genau. Zu Bestätigung des Unglaublichen, was anderwärts vorgegangen sein sollte, erzählte man sich das Unglaubliche, was man mit eigenen oder befreundeten Augen gesehen haben wollte. Auf der Brücke zu Lützelflüh erzählte man sich von Kühen und ihrem Gebrüll, von einem Kinde in der Wiege, von Männern auf einer Tanne, welche alle sichtbarlich unter der Brücke durchgefahren sein sollten. Man erzählte: Auf dem Klapperplatz hätte die Emme eine Bäurin samt Ross und Bernerwägeli fortgerissen, und diese Bäurin sei mit Ross und Wagen unter der Brücke durchgefahren, das Ross noch eingespannt und lebendig vorauf, die Bäurin bolzgrad, munter und fett hinten auf dem Sitz, das Leitseil in der einen Hand, aber mit der andern hätte sie mit einem roten Nastuch sich die Augen ausgewischt. Ja, man erzählte: Auf einem aufrechtstehenden Kirschbaum sei einer dahergeschwommen gekommen, in seiner Angst hätte er immerfort gekirset, so stark er konnte; den eben voll gewordenen Kratten hätte er über die Brücke hereinreichen wollen. Solches erzählte man auf Ort und Stelle. Niemand hatte es selbst gesehen, und doch wurde das meiste geglaubt; nur das letzte Müsterlein wollte vielen doch gar zu ung’hürig vorkommen.
Es ist eine merkwürdige Sache, wie bei allen großen Unglücksfällen an Ort und Stelle noch während denselben oder doch unmittelbar darauf Dinge erzählt werden, ob denen einem die Haare zu Berge stehen, lauter Lug sind, erzählt, geglaubt werden von Mann zu Mann, und woher sie kommen, wird nie ergründet. Es verzehrte einmal das Feuer ein ganz Städtlein. Um die Mitternachtstunde hatte der Blitz eingeschlagen, um fünf Uhr morgens erzählte man sich an Ort und Stelle folgende Dinge: Ein einzig Kind sei verbrannt, man wisse nicht, wo und wie; ein Weib sei erschlagen worden von einer zum Fenster herausgeworfenen Kommode; ein durch viele Brandwunden scheußlich zugerichtetes Weib hätte einen Mann dringend um den Tod gebeten, der habe unb’sinnt sein Sackmesser genommen und es dem Weibe in die Brust gestoßen; der Pfarrer sei ganz feurig seinem Hause entronnen; und in einem Wirtshause sei eine große Kammer ganz voll Handwerksbursche gewesen, die seien alle mit Haut und Haar verbrannt. Und von allem diesem war keine einzige Silbe wahr.