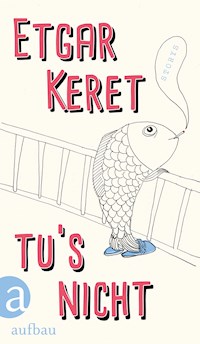8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In seinem bisher persönlichsten Buch erzählt der israelische Autor Etgar Keret von seinem Leben als Vater und als Sohn. Es sind glückliche und einzigartige sieben Jahre: Angry Birds und Raketenangriffe, alles muss man dem kleinen Sohn erklären, den man beschützen will, wie man selbst behütet wurde; und langsam wird man zum Hüter des eigenen Vaters, der immer älter wird …
Vor dem düsteren Hintergrund Israels leuchten der Witz, der Humor und die erzählerische Großherzigkeit Etgar Kerets nur noch heller. Niemand kann so schnell von tiefsinnig und bewegend zu grotesk und komisch wechseln wie Keret – es sind Geschichten, deren Wahrheit wie Songs wirken und für immer bleiben - kongenial übersetzt von Daniel Kehlmann.
»In seinem Buch ›Die sieben guten Jahre‹ gelingt dem israelischen Autor Etgar Keret etwas Seltenes: schwereloses Erzählen.« Süddeutsche Zeitung »Und Gott schuf Etgar Keret, den besten Kurzgeschichten-Autor seit Kafka und Hemingway.« Maxim Biller.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 186
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Über das Buch
In seinem bisher persönlichsten Buch erzählt der israelische Autor Etgar Keret von seinem Leben als Vater und als Sohn. Es sind glückliche und einzigartige sieben Jahre: Angry Birds und Raketenangriffe, alles muss man dem kleinen Sohn erklären, den man beschützen will, wie man selbst behütet wurde; und langsam wird man zum Hüter des eigenen Vaters, der immer älter wird… Vor dem düsteren Hintergrund Israels leuchten der Witz, der Humor und die erzählerische Großherzigkeit Etgar Kerets nur noch heller. Niemand kann so schnell von tiefsinnig und bewegend zu grotesk und komisch wechseln wie Keret – es sind Geschichten, deren Wahrheit wie Songs wirken und für immer bleiben – kongenial übersetzt von Daniel Kehlmann.
»In seinem Buch ›Die sieben guten Jahre‹ gelingt dem israelischen Autor Etgar Keret etwas Seltenes: schwereloses Erzählen.« Süddeutsche Zeitung
»Und Gott schuf Etgar Keret, den besten Kurzgeschichten-Autor seit Kafka und Hemingway.« Maxim Biller
Über Etgar Keret
Etgar Keret, geboren 1967 in Ramat Gan, Israel, ist einer der bedeutendsten zeitgenössischen Schriftsteller Israels. Er gilt als Meister der Kurzgeschichte, seine Short-Story-Bände sind in Israel Bestseller und werden in 40 Sprachen übersetzt. Sein neuester Band »Tu's nicht« wurde mit dem National Jewish Book Award ausgezeichnet. Etgar Keret schreibt auch Drehbücher und Graphic Novels. Er lebt mit seiner Familie in Tel Aviv. Mehr zum Autor unter www.etgarkeret.com.
Daniel Kehlmann, 1975 in München geboren, wurde für sein Werk vielfach ausgezeichnet. Sein Roman »Die Vermessung der Welt« wurde zu einem der erfolgreichsten deutschen Romane der Nachkriegszeit, und auch sein Roman »Tyll« stand monatelang auf der Bestsellerliste und fand begeisterte Leser im In- und Ausland.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Etgar Keret
Die sieben guten Jahre
Mein Leben als Vater und Sohn
Aus dem Englischen von Daniel Kehlmann
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Jahr 1
Plötzlich wieder das Gleiche
Großes Baby
Anruf und Antwort
Unsere guten alten Kriege
Jahr 2
Mit unaufrichtigen Grüßen
Meditation im Flug
Seltsame Bettgefährten
Verteidiger des Volkes
Requiem für einen Traum
Auf lange Sicht
Jahr 3
Entscheidung am Spielplatz
Schwedenträume
Streichholzkrieg
Heldenverehrung
Jahr 4
Gott behüte, dass es besser wird
Was sagt der Mann?
Klage um meine Schwester
Vogelperspektive
Jahr 5
Imaginäre Heimat
Fette Katzen
Poseur
Bloß ein Sünder mehr
Shit Happens
Last Man Standing
Verwirrungspark
Jahr 6
Ganz unten
Pyjamaparty
Jungen weinen nicht
Unfall
Ein Schnurrbart für meinen Sohn
Liebe auf den ersten Whiskey
Jahr 7
Shiva
In meines Vaters Fußspuren
Marmelade
Taximeter
Pastrami
Anmerkung des Autors
Impressum
Für meine Mutter
Jahr 1
Plötzlich wieder das Gleiche
»Ich kann Terroranschläge nicht leiden«, sagt die dünne Krankenschwester zu der älteren, »Kaugummi gefällig?«
Die ältere nimmt einen und nickt. »Was soll man tun? Ich kann auch Notfälle nicht leiden.«
»Es sind gar nicht die Notfälle«, sagt die dünne. »Ich hab kein Problem mit Unfällen und so. Aber Terroranschläge, ich sag’s dir, die hüllen alles in graue Watte.«
Wie ich da auf einer Bank vor der Geburtsstation sitze, sage ich mir: Sie hat schon recht. Vor einer Stunde bin ich hergekommen, ganz aufgeregt, mit meiner Frau und einem Sauberkeitsfanatiker von Taxifahrer, der, als die Fruchtblase platzte, vor allem Sorge hatte, dass seine Polsterung schmutzig werden könnte. Und jetzt sitze ich in einem Korridor, und mir ist unwohl, und ich warte darauf, dass das medizinische Personal endlich aus der Intensivstation zurückkommt. Alle außer den beiden Schwestern sind damit beschäftigt, den Menschen zu helfen, die bei dem Anschlag verletzt wurden. Sogar die Wehen meiner Frau haben sich verlangsamt. Womöglich fühlt auch das Baby, dass die Sache mit dem Geborenwerden gerade nicht so dringend ist. Auf dem Weg zur Cafeteria werden einige der Verletzten auf quietschenden Tragen an mir vorbeigefahren. Eben noch, im Taxi hat meine Frau wie eine Verrückte geschrien. Aber diese Leute sind alle still.
»Bist du Etgar Keret?«, fragt ein junger Mann in einem karierten Hemd. »Der Schriftsteller?« Ich nicke zögernd. »Was hast du gerade gemacht?«, fragt er und zieht ein Aufnahmegerät aus der Tasche. »Wo warst du, als es passiert ist?« Als ich zögere, sagt er voll Mitleid: »Lass dir Zeit. Kein Druck. Du musst ja traumatisiert sein!«
»Ich war nicht bei dem Anschlag«, erkläre ich. »Ich bin nur zufällig da. Meine Frau bringt ein Kind zur Welt.«
»Oh«, sagt er, versucht gar nicht, seine Enttäuschung zu verbergen, und drückt den Stopp-Knopf. »Mazel tov.« Er setzt sich neben mich und zündet sich eine Zigarette an.
»Vielleicht solltest du lieber mit jemand anderem reden«, schlage ich vor, um den Lucky-Strike-Rauch aus meinem Gesicht zu kriegen. »Vor einer Minute habe ich gesehen, wie sie zwei Leute in die Neurologie gebracht haben.«
»Russen«, sagt er seufzend. »Können kein Wort Hebräisch. Außerdem lassen sie ohnehin keinen in die Neurologie. Das ist mein siebter Anschlag in diesem Krankenhaus, und ich kenne inzwischen ihren ganzen Schtick.« Eine Minute sitzen wir da, ohne zu reden. Er ist etwa zehn Jahre jünger als ich, aber er bekommt bereits eine Glatze. Als er bemerkt, dass ich ihn ansehe, lächelt er und sagt: »Zu schade, dass du nicht dort warst. Eine Reaktion von einem Schriftsteller wäre gut für meinen Artikel gewesen. Jemand Originelles, jemand mit ein bisschen Vision. Nach jedem Anschlag bekomme ich immer das Gleiche: ›Plötzlich hörte ich einen Knall.‹ ›Ich weiß nicht, was passiert ist.‹ ›Alles war voll Blut.‹ Wie viel davon kann man schon gebrauchen?«
»Es ist nicht deren Fehler«, sage ich. »Das ist, weil die Anschläge immer gleich sind. Was soll man schon über eine Explosion und sinnloses Sterben Originelles sagen?«
»Keine Ahnung«, sagt er achselzuckend. »Du bist der Schriftsteller.«
Die ersten Leute in weißen Jacken kommen von der Intensivstation zurück zur Geburtsstation. »Du bist aus Tel Aviv«, sagt der Reporter zu mir. »Also warum kommt ihr für die Geburt den ganzen Weg raus zu dieser Müllkippe?«
»Wir wollten eine natürliche Geburt. Die Abteilung hier – «
»Natürlich?«, unterbricht er kichernd. »Was ist natürlich daran, wenn ein Zwerg, dem ein Kabel aus dem Bauchnabel hängt, aus der Vagina deiner Frau fällt?«
Ich versuche gar nicht, ihm zu antworten.
»Ich habe meiner Frau gesagt, wenn du jemals ein Kind bekommst, dann nur mit Kaiserschnitt, wie in Amerika. Ich will nicht, dass dir irgendein Baby für mich die Figur ruiniert. Heutzutage bringen Frauen nur noch in primitiven Ländern Kinder wie Tiere zur Welt. Yallah, ich muss jetzt arbeiten.« Er steht auf, aber bevor er geht, versucht er es ein letztes Mal. »Vielleicht hast du trotzdem was über den Anschlag zu sagen? Hat es irgendwas für dich verändert? Zum Beispiel den Namen, den du dem Baby gibst oder so was, ich weiß nicht …«
Ich lächle entschuldigend.
»Ist egal«, sagt er zwinkernd. »Ich hoffe, es läuft gut, Mann.«
Sechs Stunden später fällt ein Zwerg, dem ein Kabel aus dem Bauchnabel hängt, aus der Vagina meiner Frau und fängt sofort an zu weinen. Ich versuche, ihn zu überzeugen, dass man sich gar keine Sorgen machen muss. Dass alles im Nahen Osten geklärt sein wird, wenn er erwachsen ist. Frieden wird kommen, es wird keine weiteren Terroranschläge mehr geben, und sogar wenn es ganz selten einmal einen geben sollte, wird immer jemand Originelles, jemand mit ein wenig Vision in der Nähe sein, um ihn perfekt zu beschreiben. Er beruhigt sich für eine Minute und überlegt, was er als Nächstes tun soll. Man kann wohl davon ausgehen, dass er naiv ist – er ist ja nicht umsonst ein Neugeborener – , aber nicht mal er glaubt mir, und nach einer Sekunde des Zögerns und einem kurzen Schluckauf fängt er wieder an zu weinen.
Großes Baby
Als ich ein Kind war, nahmen mich meine Eltern mit nach Europa. Der Höhepunkt der Reise war nicht Big Ben oder der Eiffelturm, sondern der Flug von Israel nach London – vor allem das Essen. Auf dem Tischchen vor mir stand eine kleine Dose Coca-Cola, und daneben lag eine Packung Cornflakes, die nicht größer war als eine Schachtel Zigaretten.
Meine Überraschung beim Anblick dieser Miniaturverpackungen wurde zu wahrer Begeisterung, als ich sie öffnete und herausfand, dass die Cola genauso schmeckte wie jenes in Dosen normaler Größe und dass auch die Cornflakes ganz echt waren. Es ist schwer zu erklären, woher diese Begeisterung wirklich kam. Immerhin ging es ja nur um ein Softgetränk und um Frühstücksflocken in sehr kleinen Packungen, aber als ich sieben war, war ich sicher, dass vor meinen Augen ein Wunder geschah.
Und heute, dreißig Jahre später, da ich in meinem Wohnzimmer in Tel Aviv meinen zwei Wochen alten Sohn ansehe, habe ich wieder genau das gleiche Gefühl: Da ist ein Mensch, der nicht mehr wiegt als zehn Pfund – aber innen drin ist er wütend, gelangweilt, geängstigt und ernst wie jeder andere Mensch auf diesem Planeten. Zieh ihm einen Dreiteiler und eine Rolex an, gib ihm einen kleinen Aktenkoffer und schick ihn hinaus in die Welt, dann wird er verhandeln, kämpfen und Verträge abschließen, ohne zu zögern. Ja natürlich, er spricht nicht. Außerdem bekackt er sich selbst, als gäbe es kein Morgen. Ich bin der Erste, der zugibt, dass er noch die eine oder andere Sache lernen muss, bevor man ihn ins All schießen oder ihm erlauben kann, eine F-16 zu fliegen. Aber im Prinzip ist er eine vollständige Person in einer Miniaturpackung, und zwar nicht irgendeine, sondern eine ziemlich extreme Person, ein Exzentriker, ein Charakter. Einer von der Art Leuten, die man respektiert, aber nicht ganz versteht. Denn wie alle komplexen Menschen, unabhängig von Größe oder Gewicht, hat er viele Seiten.
Mein Sohn, der Erleuchtete: Als jemand, der viel über Buddhismus gelesen, zwei oder drei Vorträge von Gurus angehört und einmal sogar Diarrhö in Indien gehabt hat, muss ich sagen, dass mein Babysohn die erste erleuchtete Person ist, die ich je getroffen habe. Er lebt ganz und gar in der Gegenwart: Er nimmt keinem etwas übel und fürchtet die Zukunft nie. Er ist vollkommen frei von Ego. Nie versucht er, seine Ehre zu verteidigen oder sich irgendwas als Verdienst anrechnen zu lassen. Übrigens haben seine Großeltern längst ein Bankkonto für ihn eröffnet, und jedes Mal, wenn er seine Wiege schaukelt, erzählt ihm Großpapa von dem großartigen Zinssatz, den er für ihn ausgehandelt hat, und davon, wie viel Geld er unter Voraussetzung einer durchschnittlichen einstelligen Inflationsrate bekommen wird, wenn das Konto in einundzwanzig Jahren fällig wird. Der Kleine antwortet nicht. Aber wenn Großpapa die Prozente gegen den Zinssatz berechnet, bemerke ich, wie einige Falten auf der Stirn meines Sohnes auftauchen – die ersten Risse in der Wand seines Nirvana.
Mein Sohn, der Junkie. Ich möchte mich bei allen gegenwärtigen und ehemaligen Süchtigen entschuldigen, aber bei allem Respekt für ihr Leiden: Niemand hat Entzugserscheinungen wie mein Sohn. Wie jeder wahre Abhängige hat er hinsichtlich seiner Freizeitgestaltung nicht die gleiche Zahl von Optionen wie andere – zum Beispiel ein gutes Buch oder einen abendlichen Spaziergang oder die NBA-Playoffs. Für ihn gibt es nur zwei Möglichkeiten: eine Brust oder die Hölle. »Bald wirst du die Welt entdecken – Mädchen, Alkohol, illegales Online-Glücksspiel«, sage ich, um ihn zu beruhigen. Aber wir beide wissen, dass bis dahin nur die Brust existieren wird. Zum Glück für ihn und für uns hat er eine Mutter, die mit zweien davon ausgestattet ist. Worst-Case-Scenario: Wenn eine versagt, gibt es noch eine zum Ersatz.
Mein Sohn, der Psychopath. Manchmal, wenn ich nachts aufwache und sehe, wie sich sein kleiner Körper neben mir im Bett unter kehligen Lauten schüttelt, als wäre er ein Spielzeug, dessen Batterien durchbrennen, kann ich nicht anders, als ihn in meiner Phantasie mit Chucky der Mörderpuppe zu vergleichen. Sie sind gleich groß, sie haben das gleiche Temperament, und keinem der beiden ist etwas heilig. Das ist das wirklich Enervierende an meinem zwei Wochen alten Sohn: Er hat keinerlei Moralität, nicht eine Unze. Rassismus, Ungleichheit, Rücksichtslosigkeit, Globalisierung – das ist ihm alles völlig egal. Er hat keinerlei Interessen, die über seine unmittelbaren Antriebe und Begehren hinausgehen. Was ihn betrifft, können die anderen Menschen zur Hölle gehen oder Greenpeace beitreten. Alles, was er jetzt gerade will, ist etwas gute Milch oder Linderung für seinen Windelausschlag; und wenn die Welt zerstört werden müsste, damit er das kriegt, dann zeigt ihm einfach den Schalter. Er wird ihn umlegen, ohne eine Sekunde zu zögern.
Mein Sohn, der sich selbst hassende Jude …
»Meinst du nicht, dass jetzt mal genug ist?«, unterbricht meine Frau. »Statt dir hysterische Vorwürfe gegen deinen entzückenden Sohn auszudenken, könntest du vielleicht etwas Nützliches tun und ihm die Windeln wechseln.«
»Okay«, sage ich. »Okay. Bin ja schon fertig.«
Anruf und Antwort
Ich empfinde große Bewunderung für aufmerksame Telefonverkäufer, die zuhören, die versuchen herauszufinden, in welcher Stimmung man ist, und die einem nicht sofort ein Gespräch aufzwingen wollen. Daran liegt es, dass ich, als Devora von der Satelliten-TV-Firma YES anruft und fragt, ob gerade ein guter Moment zum Reden ist, ihr zunächst für ihre Rücksicht danke. Dann sage ich höflich, dass es leider kein guter Moment ist.
»Es ist nämlich so, dass ich vor einer Minute in ein Loch gefallen bin und meine Stirn und meinen Fuß verletzt habe, deshalb ist es wirklich nicht der beste Zeitpunkt.«
»Ich verstehe«, sagt Devora. »Also wann, glauben Sie, wäre ein guter Moment zum Reden? In einer Stunde?«
»Bin nicht sicher. Mein Knöchel ist wohl gebrochen, als ich gefallen bin, und das Loch ist ziemlich tief, und ich glaube nicht, dass ich ohne Hilfe rausklettern kann. Es hängt davon ab, wie schnell das Rettungsteam hier ist und ob sie meinen Fuß eingipsen müssen oder nicht.«
»Dann soll ich besser morgen anrufen?«, fragt sie unbeirrt.
»Ja«, stöhne ich. »Morgen ist gut.«
»Was soll das Zeug mit dem Loch?«, fragt meine Frau, die neben mir im Taxi sitzt und all meine Ausweichtaktiken mitangehört hat. Es ist das erste Mal, dass wir ausgehen und unseren Sohn Lev bei meiner Mutter gelassen haben, deshalb ist sie ein wenig nervös. »Warum kannst du nicht einfach sagen: ›Danke, aber ich bin nicht daran interessiert, etwas zu kaufen oder zu mieten oder auszuleihen, was auch immer es ist, das Sie verkaufen, also bitte rufen Sie nicht mehr an, nicht in diesem Leben und, wenn es irgend möglich ist, auch nicht im nächsten.‹ Dann mach eine kurze Pause, sag ›Schönen Tag noch‹ und häng auf wie jeder andere auch.«
Ich glaube nicht, dass jeder andere so hart und gemein zu Devora und ihresgleichen ist, wie meine Frau es wäre; aber ich muss doch zugeben, dass sie nicht unrecht hat. Im Nahen Osten sind die Menschen sich ihrer Sterblichkeit stärker bewusst als an anderen Orten des Planeten, was wiederum dazu führt, dass ein großer Teil der Bevölkerung aggressive Tendenzen gegenüber Fremden entwickelt, deretwegen sie die kurze Zeit verschwenden, die ihnen auf Erden bleibt. Und obwohl ich meine Zeit ebenso eifersüchtig verteidige wie wir alle, fällt es mir doch sehr schwer, zu Fremden am Telefon nein zu sagen. Ich habe keine Probleme dabei, Verkäufer auf Straßenmärkten abzuschütteln oder nein zu jemandem zu sagen, den ich kenne, wenn er mir etwas am Telefon anbietet. Aber die unheilige Verbindung eines telefonischen Angebotes und eines Fremden paralysiert mich, und in weniger als einer Sekunde stelle ich mir das narbige Gesicht der Person am anderen Ende der Leitung vor, die ein Leben voll Leiden und Erniedrigung geführt hat. Ich stelle sie mir auf dem Fensterbrett ihres Büros im zweiundvierzigsten Stock vor, während sie mit ruhiger Stimme am drahtlosen Telefon mit mir spricht und ihre Entscheidung längst getroffen hat: »Wenn noch ein einziges Arschloch nein zu mir sagt, dann springe ich!« Und wenn man eine Entscheidung treffen muss zwischen dem Leben eines Menschen und dem Abonnement des Ballonskulpturen: endloser Spaß für die ganze Familie-Kanals für nur 9,99 Shekel im Monat, dann wähle ich das Leben, oder wenigstens habe ich das getan, bis meine Frau und mein Finanzberater mich höflich gebeten haben, damit aufzuhören.
Und deshalb habe ich die »arme Großmutter-Strategie« entwickelt, welche sich auf eine Frau beruft, für die ich bereits Dutzende virtuelle Begräbnisse arrangiert habe, um aus sinnlosen Gesprächen herauszukommen. Aber da ich nun schon ein Loch für mich gegraben habe und für Devora vom Satelliten-TV-Konzern hineingefallen bin, kann ich diesmal Großmutter Shoshana in Frieden ruhen lassen.
»Guten Morgen, Herr Keret«, sagt Devora am nächsten Tag. »Ich hoffe, jetzt ist ein besserer Moment für Sie.«
»Die Wahrheit ist, dass es einige Komplikationen mit meinem Fuß gegeben hat«, murmele ich. »Ich weiß nicht wie, aber es ist Wundbrand entstanden, und jetzt haben Sie mich gerade knapp vor der Amputation erwischt.«
»Es dauert wirklich nur eine Minute«, versucht sie es tapfer.
Aber ich bleibe hartnäckig. »Es tut mir leid, sie haben mir schon ein Beruhigungsmittel gegeben, und der Doktor zeigt mir gerade, dass ich mein Handy ausmachen muss. Er sagt, es ist nicht steril.«
»Dann versuche ich es morgen. Viel Glück bei der Amputation.«
Die meisten Telefonverkäufer geben nach einem Anruf auf. Meinungsforscher und Verkäufer von Internet-Paketangeboten versuchen es höchstens noch ein zweites Mal. Aber Devora von der Satelliten-TV-Firma ist anders.
»Hallo, Herr Keret«, sagt sie, als ich das nächste Mal unvorbereitet abnehme. »Wie geht es Ihnen?« Und bevor ich antworten kann: »Da Ihre neue gesundheitliche Lage Sie wahrscheinlich zu Hause festhalten wird, wollte ich Ihnen unser Extremsportpaket anbieten. Vier Kanäle, die alle unterschiedlichen Extremsportarten aus der ganzen Welt bieten, von den Zwergenweitwurfweltmeisterschaften bis hin zum Australischen Gläserwettessen.«
»Sie wollen Etgar?«, flüstere ich.
»Ja«, sagt Devora.
»Er ist gestorben«, sage ich und mache eine Pause, bevor ich weiterflüstere. »Eine Tragödie. Ein Assistenzarzt hat ihn auf dem Operationstisch erledigt. Wir erwägen eine Klage.«
»Mit wem spreche ich denn?«, fragt Devora.
»Michael, sein jüngerer Bruder«, improvisiere ich. »Aber ich kann jetzt nicht reden. Ich bin auf dem Begräbnis.«
»Mein herzliches Beileid«, sagt Devora mit zitternder Stimme. »Ich habe nur wenig mit ihm geredet, aber er klang wie ein wunderbarer Mensch.«
»Danke«, flüstere ich. »Ich muss auflegen. Ich muss den Kaddish beten.«
»Natürlich«, sagt Devora. »Ich rufe später an. Ich habe ein absolut perfektes Trostangebot.«
Unsere guten alten Kriege
Gestern rief ich die Mobiltelefongesellschaft an, um dort Leute anzuschreien. Am Vortag hatte mir mein Freund Uzi erzählt, dass er dort angerufen, ein wenig geschrien und gedroht hätte, den Anbieter zu wechseln. Und sofort hätten sie ihm den Preis um 50 Shekel pro Monat herabgesetzt. »Ist das nicht unglaublich?«, hatte er aufgeregt gesagt. »Ein wütender Anruf, fünf Minuten nur, und du sparst 600 Shekel im Jahr.«
Die Kundendienstmitarbeiterin hieß Tali. Sie hörte ruhig meine Beschwerden und Drohungen an, und als ich fertig war, sagte sie mit einer leisen, tiefen Stimme: »Sagen Sie, mein Herr, schämen Sie sich nicht? Wir sind im Krieg. Leute werden getötet. Raketen fallen auf Haifa und Tiberias, und alles, woran Sie denken, sind Ihre 50 Shekel?«
Da hatte sie nicht unrecht, und sofort fühlte ich mich etwas unwohl. Ich entschuldigte mich, und die noble Tali vergab mir. Schließlich ist ein Krieg nicht die richtige Zeit, um einem der eigenen Leute etwas übelzunehmen.
Am selben Nachmittag probierte ich die Wirksamkeit von Talis Argument an einem störrischen Taxifahrer aus, der sich weigerte, mich und meinen kleinen Sohn mitzunehmen, weil ich keinen Kindersitz dabeihatte.
»Sagen Sie, schämen Sie sich nicht?«, fragte ich und versuchte, Tali so exakt wie möglich zu imitieren. »Wir sind im Krieg. Menschen werden getötet. Bomben fallen auf Tiberias, und alles, woran Sie denken, ist Ihr Kindersitz?«
Das Argument funktionierte auch hier, und der verlegene Taxifahrer entschuldigte sich und bat mich, schnell einzusteigen. Als wir auf die Autobahn fuhren, sagte er, teils zu mir und teils zu sich selbst: »Es ist ein echter Krieg, nicht?« Und nach einem langen Atemzug fügte er nostalgisch hinzu: »Wie in alten Zeiten.«
Nun, da das Echo von »wie in alten Zeiten« in meinem Geist widerhallt, sehe ich diesen Konflikt mit dem Libanon in völlig neuem Licht. Wenn ich zurückdenke und versuche, meine Gespräche mit besorgten Freunden über diesen Krieg zu rekonstruieren, über die iranischen Bomben, über die syrischen Intrigen und die Vermutung, dass der Anführer der Hisbollah, Scheich Hassan Nasrallah, die Fähigkeit hat, einen Schlag gegen jeden Ort im Land, sogar Tel Aviv, zu führen, wird mir klar, dass alle ein schwaches Leuchten in den Augen hatten, eine Art unbewusste Erleichterung.
Und nein, das liegt nicht etwa daran, dass wir Israelis uns nach Krieg oder Tod oder Trauer sehnen. Aber wir sehnen uns nach den »alten Zeiten«, von denen der Taxifahrer sprach. Wir sehnen uns danach, dass ein echter Krieg an die Stelle dieser ermüdenden Jahre der Intifada treten möge, in denen es kein Schwarz und Weiß gab, sondern nur Grau, in denen wir nicht einer bewaffneten Armee gegenüberstanden, sondern nur resoluten jungen Leuten mit Sprengstoffgürteln. Jahre, in denen die Aura der Tapferkeit verschwand und ersetzt wurde von langen Menschenschlangen vor unseren Checkpoints, schwangeren Frauen kurz vor der Niederkunft und älteren Leuten, die kaum die mörderische Hitze ertragen.
Plötzlich hat uns die erste Raketensalve das vertraute Gefühl zurückgebracht, dass wir Krieg führen gegen einen skrupellosen Feind, der unsere Grenzen angreift, einen wahrhaft bösartigen Feind, nicht etwa einen, der für Freiheit und Selbstbestimmung kämpft, nicht einen, der uns Stottern macht und uns in Verwirrung stürzt. Wir sind wieder überzeugt von der Richtigkeit unserer Sache, und wir kehren mit Lichtgeschwindigkeit zurück zu jenem Patriotismus, den wir fast schon aufgegeben hatten. Wir sind wieder ein kleines Land, umgeben von Feinden, das um sein Leben kämpft, nicht eine starke Besatzungsmacht, die jeden Tag gegen die Zivilbevölkerung kämpfen muss.
Ist es also erstaunlich, dass wir alle im Geheimen ein klein wenig erleichtert sind? Her mit dem Iran, her mit einer Prise Syrien, her mit einer Handvoll Scheich Nasrallah, wir schlucken sie ganz herunter. Wenn es darum geht, moralische Unklarheiten zu lösen, sind wir nicht besser als irgendwer sonst. Aber wie man einen Krieg gewinnt, wussten wir immer.