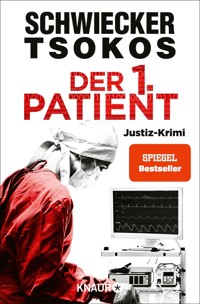9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Eberhardt & Jarmer ermitteln
- Sprache: Deutsch
»Die siebte Zeugin« ist der 1. Band der Justiz-Krimi-Reihe aus Berlin mit Insider-Einblicken des ehemaligen Strafverteidigers Florian Schwiecker und des Rechtsmediziners und Bestseller-Autors Michael Tsokos. Ein rätselhafter Amoklauf erschüttert Berlin - doch nichts ist, wie es scheint... An einem Sonntagmorgen wie jeder andere auch verlässt der Verwaltungsbeamte Nikolas Nölting sein Haus in Berlin-Charlottenburg. Er winkt seiner kleinen Tochter zu, schwingt sich aufs Fahrrad und fährt zu einer Bäckerei. Dort schießt er plötzlich aus heiterem Himmel und ohne Vorwarnung um sich. Ein Mensch ist tot, zwei weitere verletzt – und Nikolas Nölting schweigt. Nöltings Anwalt Rocco Eberhardt steht vor einem Rätsel: Welches Motiv könnte der unauffällige Familienvater für eine solche Tat gehabt haben? Das Ganze erscheint völlig sinnlos – bis der Rechtsmediziner Dr. Justus Jarmer eine überraschende Entdeckung macht, die Rocco Eberhardt mitten in einen Sumpf aus Korruption, Geldwäsche und Clan-Kriminalität führt. Doch wer sich mit der Unterwelt von Berlin anlegt, bringt nicht nur sich selbst in größte Gefahr … Hochspannend und 100% authentisch In ihrer Justiz-Krimi-Reihe um den Berliner Anwalt Rocco Eberhardt und den Rechtsmediziner Dr. Justus Jarmer gewähren die Autoren tiefe Einblicke in ihren eigenen Berufsalltag: Florian Schwiecker arbeitete lange Jahre als Strafverteidiger, Bestseller-Autor Michael Tsokos leitet das Institut für Rechtsmedizin der Berliner Charité. Gemeinsam begeben sich Eberhardt und Jarmer so auf auf eine spannende und authentische Ermittlung, die sie tief in die Abgründe der menschlichen Seele führt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Florian Schwiecker / Michael Tsokos
Die siebte Zeugin
Justiz-Krimi
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Hochspannend und 100% authenthisch:
»Die siebte Zeugin« ist der 1. Teil einer neuen Justiz-Krimi-Reihe aus Berlin mit Insider-Einblicken des ehemaligen Strafverteidigers Florian Schwiecker und des Rechtsmediziners und Bestseller-Autors Michael Tsokos.
An einem Sonntagmorgen wie jeder andere auch verlässt der Verwaltungsbeamte Nikolas Nölting sein Haus in Berlin-Charlottenburg. Er winkt seiner kleinen Tochter zu, schwingt sich aufs Fahrrad und fährt zu einer Bäckerei. Dort schießt er plötzlich aus heiterem Himmel und ohne Vorwarnung um sich. Ein Mensch ist tot, zwei weitere verletzt – und Nikolas Nölting schweigt.
Nöltings Anwalt Rocco Eberhardt steht vor einem Rätsel: Welches Motiv könnte der unauffällige Familienvater für eine solche Tat gehabt haben? Das Ganze erscheint völlig sinnlos – bis der Rechtsmediziner Dr. Justus Jarmer eine überraschende Entdeckung macht, die Rocco Eberhardt mitten in einen Sumpf aus Korruption, Geldwäsche und Clan-Kriminalität führt. Doch wer sich mit der Unterwelt von Berlin anlegt, bringt nicht nur sich selbst in größte Gefahr …
In ihrer Justiz-Krimi-Reihe um den Berliner Anwalt Rocco Eberhardt und den Rechtsmediziner Dr. Justus Jarmer gewähren die Autoren tiefe Einblicke in ihren eigenen Berufsalltag: Florian Schwiecker arbeitete lange Jahre als Strafverteidiger, Bestseller-Autor Michael Tsokos leitet das Institut für Rechtsmedizin der Berliner Charité.
Inhaltsübersicht
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
43. Kapitel
44. Kapitel
45. Kapitel
46. Kapitel
47. Kapitel
48. Kapitel
49. Kapitel
50. Kapitel
51. Kapitel
52. Kapitel
53. Kapitel
54. Kapitel
55. Kapitel
56. Kapitel
57. Kapitel
58. Kapitel
59. Kapitel
60. Kapitel
61. Kapitel
62. Kapitel
63. Kapitel
64. Kapitel
65. Kapitel
66. Kapitel
67. Kapitel
68. Kapitel
69. Kapitel
70. Kapitel
71. Kapitel
72. Kapitel
73. Kapitel
74. Kapitel
75. Kapitel
76. Kapitel
77. Kapitel
78. Kapitel
79. Kapitel
80. Kapitel
81. Kapitel
82. Kapitel
83. Kapitel
84. Kapitel
85. Kapitel
86. Kapitel
87. Kapitel
88. Kapitel
89. Kapitel
90. Kapitel
91. Kapitel
92. Kapitel
93. Kapitel
94. Kapitel
95. Kapitel
96. Kapitel
97. Kapitel
98. Kapitel
99. Kapitel
100. Kapitel
101. Kapitel
102. Kapitel
103. Kapitel
104. Kapitel
Danksagung
1. Kapitel
Nikolas Nölting drehte sich noch einmal um und sah zu seiner Tochter Lily, die ihm vom Fenster ihrer Wohnung im Hochparterre des Berliner Altbaus aus zuwinkte. Voller Liebe und Zuneigung winkte er zurück und lächelte sie kurz an. Dann wandte er sich um, zog die Schlaufe seines grauen Fahrradhelmes etwas enger und stieß sich kräftig mit seinem rechten Fuß vom Bürgersteig ab.
Kalt wehte ihm der Fahrtwind ins Gesicht, und Nölting fröstelte. Während er krampfhaft mit der linken Hand den Lenker festhielt, um nicht umzukippen, zog er mit der rechten Hand den Reißverschluss seiner blauen Funktionsjacke bis unters Kinn und geriet dabei kurz ins Straucheln. Nölting fluchte leise, fing dann das Fahrrad aber im letzten Moment ab. Erleichtert atmete er tief aus, ehe er rechts in die Königin-Elisabeth-Straße einbog. Um diese Zeit herrschte sonntags kaum Verkehr. Kurz entschlossen überfuhr er die rote Fahrradampel Ecke Kaiserdamm und radelte dann quer über die Kreuzung in östlicher Richtung.
Nölting war wegen der vielen Arbeit in letzter Zeit wenig zum Fahrradfahren gekommen. Er legte ein für seine Verhältnisse flottes Tempo vor, weshalb er leicht außer Atem war, als er etwa sieben Minuten später sein Ziel in der Neuen Kantstraße erreichte: die Bäckerei »Aux Délices Français«. Er stieg von seinem Fahrrad ab, um es an dem Straßenschild anzuketten, und sah zu dem uniformierten Polizisten hinüber, der vor der Bäckerei stand.
»Guten Morgen«, grüßte er den nicht mehr ganz jungen Beamten freundlich und lächelte ihm zu.
»Morgen«, erwiderte der knapp und musterte Nölting eingehend. Erst als dieser weiterlief, schaute der Polizist wieder konzentriert auf sein Smartphone.
Nölting atmete tief durch. Mit schnellen Schritten ging er auf die Bäckerei zu, blieb dann aber abrupt vor der Eingangstür stehen und drehte sich um. Der Polizeibeamte, der das aus dem Augenwinkel mitbekommen hatte, sah kurz zu ihm herüber.
Nölting zuckte mit den Schultern. »Mein Beutel«, sagte er und zeigte zu dem Fahrrad, wo seine alte Stofftasche über dem Lenker hing. Der Beamte nickte und widmete sich wieder seinem Handy.
Jetzt, dachte Nölting. Jetzt oder nie. Sein Puls stieg an, und sein Herz raste. Nervös atmete er noch einmal tief ein und ging wieder zurück in Richtung seines Fahrrades. Auf Höhe des Polizisten blieb er unvermittelt stehen und schlug mit aller Kraft, die er aufbringen konnte, mit seiner rechten Faust gegen die Schläfe des Mannes. Ein stechender Schmerz schoss durch seine Fingerknöchel, während der Beamte, ohne einen Laut von sich zu geben, in sich zusammensackte. Nölting schüttelte seine Hand. Panik stieg in ihm auf. Wenn er jetzt seine Finger nicht mehr benutzen konnte, weil etwas gebrochen war, war alles umsonst. Vorsichtig ballte er seine Hand zur Faust, öffnete sie dann wieder. Es tat höllisch weh, aber die Motorik funktionierte noch. Das war alles, was zählte. Reiß dich zusammen, dachte er und kämpfte gegen den Instinkt an, einfach davonzurennen. Tief atmete er durch die Nase ein und durch den Mund wieder aus. Bloß nicht durchdrehen! Einen Schritt nach dem anderen. Er gab sich einen Ruck und beugte sich dann eilig zu dem Polizisten hinunter. Ich muss an die Waffe kommen. Schnell! Nölting drehte den Beamten auf die Seite, öffnete die Sicherung des Holsters und nahm die Pistole vom Typ SIG Sauer 225 an sich. Er hatte sich zuvor im Internet informiert, welche Waffen die Berliner Polizei verwendete, und in einem Geschäft für Jagdbedarf in Brandenburg genau erklären lassen, wie diese zu handhaben waren. Unter dem Vorwand, er wolle einen Jagdschein machen, hatte er sich dann auch zu einem Schießtraining angemeldet und recht schnell eine gewisse Routine mit Handfeuerwaffen erlangt.
Erleichtert stellte Nölting fest, dass alles genauso war, wie er es geübt hatte. Alles lief genau nach Plan. Mit einem kurzen Blick vergewisserte er sich, dass die Waffe schussbereit war. Dann drückte er sich hastig vom Boden ab und eilte in Richtung Bäckerei. Sein Puls raste, auf seiner Stirn fühlte er kalten Schweiß. Dennoch versuchte Nölting, so ruhig wie möglich zu bleiben.
Entschlossen öffnete er die Tür und betrat den gut gefüllten Verkaufsraum. Es roch nach frischen Brötchen und Kaffee, und es schien, als hätten die drei Verkäuferinnen allerhand zu tun, die Wünsche der zahlreichen Kunden zu erfüllen. Hektisch sah Nölting sich um. Ihm blieb kaum Zeit. Er musste jetzt handeln. Ein letzter Blick. Dann hob er die Pistole und gab in kurzer Folge vier Schüsse ab. Der Knall jedes einzelnen Schusses war ohrenbetäubend, und die Menschen im Verkaufsraum zuckten erschrocken zusammen.
Die blonde Verkäuferin, die ganz links am Tresen stand, wurde von der Wucht des ersten Geschosses nach hinten geschleudert. Es hatte ihren rechten Oberarm getroffen. Sie hing jetzt in dem Regal zwischen Brötchen und Baguettes. Instinktiv presste sie ihre linke Hand auf die Wunde. Zwischen ihren Fingern bildete sich auf dem weißen Stoff ihrer Bluse ein roter Fleck, der immer größer wurde. Der Schock stand ihr ins Gesicht geschrieben. Entsetzt starrte sie Nölting mit offenem Mund an, dann sackte sie ohnmächtig zusammen.
Der zweite und dritte Schuss trafen einen dunkelhaarigen Mann in einem blauen Anzug, der an einem der Bistrotische saß und entspannt seinen morgendlichen Espresso getrunken hatte. Als hätte man ihm den Stecker herausgezogen, war er schlaff nach vorn gekippt und lag zusammengesunken mit dem Oberkörper auf dem Tisch. Er bewegte sich nicht mehr – sein Gesichtsausdruck war starr und leer.
Die vierte Pistolenkugel hatte das Bein eines älteren Herrn in einem braunen Mantel getroffen, der weiter vorne in der Schlange gestanden hatte. Der Mann war sofort mit einem spitzen Schrei in sich zusammengesunken. Wimmernd saß er jetzt auf dem Boden und blickte mit einer Mischung aus Schmerz und Angst zwischen seinem blutigen Bein und Nölting hin und her.
Das alles geschah sehr schnell – von Nöltings Betreten der Bäckerei bis zur Abgabe des letzten Schusses waren nicht einmal zwanzig Sekunden vergangen. Erst jetzt begriffen die übrigen Anwesenden, was hier gerade passierte. Schlagartig brach Panik aus. Eine alte Frau in einem blauen Regenmantel floh an Nölting vorbei aus dem Laden, während sich die anderen Kunden hinter dem Verkaufstresen und den kleinen Bistrotischen in Sicherheit zu bringen versuchten.
Nölting bekam das alles nur noch wie durch einen Filter mit. Vor seinen Augen verschwammen die Bilder zu einem Farbbrei, die Schreie der Menschen hörte er wie durch Watte. Für einen Moment dachte er, er würde ohnmächtig werden, doch er wusste, dass das jetzt nicht passieren durfte. Er biss sich auf die Unterlippe, bis sie blutete, um bei Bewusstsein zu bleiben. Es dauerte eine Weile, bis er seine Umgebung wieder wahrnahm und sein Gehör zurückkehrte. Benommen blickte er sich um und starrte in angsterfüllte Gesichter. Dann ließ er, von einer Sekunde auf die nächste, die Waffe neben sich fallen, kniete sich auf den Boden und verschränkte die Hände hinter dem Kopf. Er hatte es getan. Nölting schloss die Augen und dachte an seine Tochter Lily.
2. Kapitel
Waren das Explosionen? Träumte er? Langsam wurden die Geräusche klarer, und Polizeioberkommissar Andreas Schäfer erlangte sein Bewusstsein zurück. Im ersten Moment dachte er, er würde zu Hause in seinem Bett liegen und aus einem tiefen Schlaf erwachen, doch dann holte ihn die Realität brutal ein. Hinter seiner linken Schläfe spürte er einen Schmerz, der sich anfühlte, als würde eine ganze Kompanie von Bauarbeitern mit Presslufthämmern seinen Kopf bearbeiten. Er schlug die Augen auf. Die Bäckerei. Warum um alles in der Welt lag er hier vor dem »Aux Délices Français«? Vorsichtig stützte er sich ab, um aufzustehen, als er Schreie hörte. Die Tür der Bäckerei wurde aufgestoßen, und eine ältere Dame in einem blauen Regenmantel stürmte panisch heraus. Sie achtete auf nichts und niemanden und rannte, so schnell sie ihre Beine trugen, den Bürgersteig entlang.
In diesem Moment begriff Polizeioberkommissar Schäfer, dass hier gerade etwas Schreckliches passierte. Das waren keine Explosionen in einem seiner Träume. Das waren echte Schüsse gewesen.
Ihm war klar, dass er mit seinen einundsechzig Jahren nicht mehr der Jüngste war, und er gestand sich ein, dass er in letzter Zeit körperlich ein wenig abgebaut hatte. Ohne auf die Schmerzen zu achten, zwang er sich auf die Beine. Verstärkung rufen war keine Option, es kam auf jede Sekunde an. Jede Verzögerung konnte Menschenleben kosten. Schäfer griff nach seiner Pistole und erschrak. Sein Sicherungsholster war leer. Und dann wusste er auch, warum: Der Mann mit der Tasche und dem Fahrrad hatte ihn brutal niedergeschlagen, offensichtlich um an seine Dienstwaffe zu kommen. Egal, das änderte jetzt auch nichts. So schnell es ging, stürmte er die drei Meter auf die Eingangstür zu. Durch die Scheiben konnte er sehen, dass zahlreiche Kunden geduckt hinter kleinen Tischen und den dazugehörigen Stühlen oder an der Seite der Regale hockten. Schäfer blickte hastig von links nach rechts, als er die Eingangstür aufriss. Wo war der Kerl? Es gab hier niemanden, der wild um sich schoss. Dann sah er, wie zwei der Kunden, die rechts von ihm an die Wand gelehnt kauerten, auf einen Mann zeigten, der vor dem Verkaufstresen auf dem Boden kniete. Schäfer erkannte ihn sofort wieder. Das war der Mann mit der Tasche und dem Fahrrad. »Keine Bewegung! Rühr’n Se sich nich!«, schrie er ihn an und eilte mit zwei schnellen Schritten auf ihn zu. Er stieß ihn nach vorne und drückte ihm sein rechtes Knie so in den Rücken, dass der Täter flach auf dem Boden zu liegen kam, das Gesicht nach unten gepresst, die Arme ausgestreckt neben sich. Der Mann machte zu Schäfers großer Verwunderung keine Anstalten, sich zu wehren. Dann entdeckte der Polizeioberkommissar seine Dienstwaffe, die direkt neben ihm auf dem Boden des Verkaufsraums lag. Er griff sich die SIG Sauer und befahl in einem Ton, der keinen Widerspruch duldete: »Hände uff den Rücken!«
Der Mann gehorchte. Schäfer legte ihm die Handfesseln an.
3. Kapitel
Sechs Monate später, erster Verhandlungstag
»Herr Nikolas Nölting wird angeklagt, in Berlin am 12. Januar um 8.26 Uhr einen Menschen heimtückisch getötet und zwei weitere Menschen lebensgefährlich verletzt zu haben. Der Angeklagte hat sich dadurch des Mordes in Tatmehrheit mit zweifachem versuchtem Mord und gefährlicher Körperverletzung strafbar gemacht.«
Oberstaatsanwalt Doktor Bäumler genoss es ganz offensichtlich, die Anklageschrift zu verlesen. Und das war kein Wunder, denn der Fall Nölting hatte in den vergangenen Monaten die Schlagzeilen der Berliner Boulevardpresse wie kaum ein anderes Ereignis beherrscht. Niemand konnte sich erklären, wie der unscheinbare Verwaltungsbeamte aus heiterem Himmel zum gefährlichen Killer werden konnte.
Langsam blickte Bäumler über die dicht besetzten Reihen im Schwurgerichtssaal 700 des Kriminalgerichts in Berlin-Moabit. Obwohl er gerade einen Meter fünfundsiebzig maß und leicht untersetzt war, stellte er mit seinen kurzen, hellgrauen Haaren und dem markanten Kinn eine imposante Erscheinung dar. Dieser Eindruck wurde noch dadurch verstärkt, dass er anstelle der üblichen Krawatte eine weiße Fliege zu seinem makellosen Hemd trug. Es war allgemein bekannt, dass Bäumler stets auf sein Äußeres achtete und das Rampenlicht liebte. Und mit diesem spektakulären Fall schien er der Berliner Öffentlichkeit wieder einmal beweisen zu wollen, dass er der Hüter des Gesetzes war und mit unerbittlicher Härte durchgriff, wenn es darum ging, einen Verbrecher hinter Gitter zu bringen.
Mit abschätzigem Ausdruck schaute der Oberstaatsanwalt, sodass es auch ja niemandem entgehen konnte, zu Nölting, ehe er mit der Verlesung der Anklageschrift fortfuhr.
Auf Bäumlers Blick hin drehte sich Rocco Eberhardt, Nöltings Verteidiger, zu seinem Mandanten um. Nölting saß zusammengesunken unmittelbar hinter dem Tisch der Verteidigung, in dem Bereich, der im Schwurgerichtssaal die Angeklagten durch eine Glasscheibe von den übrigen Beteiligten trennte. Nölting starrte ausdruckslos auf den vor ihm liegenden Leitz-Ordner. Er war ein unscheinbarer Mann, das komplette Gegenteil von Bäumler, mit einem Allerweltsgesicht, das einem auf der Straße nicht auffallen würde.
Eberhardt fuhr sich mit der Hand durch seine dunklen Haare und lockerte die Krawatte über seinem blauen Hemd. In der Presse wurde darüber spekuliert, warum er, einer der renommiertesten Strafverteidiger der Stadt, das Mandat angenommen hatte, denn die Sache Nölting konnte er nach allgemeiner Auffassung nur verlieren.
Eberhardt selbst sah das vollkommen anders. Ein Fall war erst verloren, wenn das Gericht in letzter Instanz das Urteil gesprochen hatte – und davon waren sie hier noch meilenweit entfernt. Beiläufig notierte er sich etwas in der Akte und blickte dann zu Oberstaatsanwalt Bäumler. Der war sichtlich um die Aufmerksamkeit der zahlreichen Gerichtsreporter bemüht, die sich in der ersten Reihe des Zuschauerblocks eifrig Notizen machten. Was für ein Lackaffe! Eberhardt schüttelte kaum merklich den Kopf. Er konnte Menschen wie Bäumler nicht ausstehen, denen es weniger um ihre Arbeit als vielmehr um die Inszenierung ihrer eigenen Person ging. Aber damit würde er dieses Mal nicht durchkommen, auch wenn momentan noch alle Fakten gegen Nölting sprachen. Denn irgendetwas war hier faul.
Warum hatte sein Mandant einfach in der Bäckerei um sich geschossen? Dass er plötzlich durchgedreht war, konnte Rocco Eberhardt sich nicht vorstellen. Aber welchen Zweck hatte er dann verfolgt? Was auch immer hinter dieser scheinbar absurden Tat steckte, Nölting musste einen Grund gehabt haben. Und auch wenn Rocco Eberhardt noch im Dunkeln tappte, hatte er sich fest vorgenommen, herauszufinden, was das war.
4. Kapitel
Sechs Monate zuvor, am Tag der Tat
Mit einem großen Cappuccino stand Rocco Eberhardt auf der Terrasse seiner Dachgeschosswohnung unweit des Bundesplatzes in Berlin-Wilmersdorf und begrüßte den Tag. Ein Ritual aus seiner Kindheit, das er von seiner italienischen Oma, seiner Nonna, gelernt hatte. Il corpo e l’anima ridono a chi si alza di buon mattino: Der Körper und der Geist lächeln dem zu, der früh aufsteht, hatte sie immer gesagt. Rocco musste an die Zeit denken, als er noch zur Grundschule ging und fast die gesamten Sommerferien in Italien bei seinen Großeltern verbringen durfte. Sie hatten eine kleine Pension in der Nähe von Neapel geführt und waren an den heißen Tagen immer mit ihm zum Strand gegangen. Er schloss die Augen und konnte förmlich den weichen, warmen Sand unter seinen Füßen spüren. Anfangs hatte er großen Respekt vor den Wellen und dem weiten Meer gehabt. Das änderte sich, als sein Großvater ihm das Schwimmen beigebracht hatte. Von da an hatten seine Großeltern Schwierigkeiten, ihn wieder aus dem Wasser zu bekommen. Er hatte es geliebt, bei seinen italienischen Nonni zu sein. Seit ihrem Tod vor fünfzehn Jahren war er nie wieder nach Italien gefahren.
Unten im Hof wurde eine Tür zugeworfen, und Rocco schreckte aus seinen Gedanken. Er schlug die Augen auf und schaute in den bedeckten Himmel. Es war heute sehr kalt, nur knapp über null Grad. Er fröstelte ein bisschen, denn er hatte wie meistens, wenn er nicht im Büro war, nur eine beige Chinohose und ein dunkelblaues T-Shirt an. Ganz gleich, ob Sommer oder Winter. Rocco warf noch einen letzten Blick über die Dächer von Berlin und ging dann zurück in seine Wohnung. Das große Zimmer mit der offenen Küche war lichtdurchflutet und trotz der vielen Fenster so geschnitten, dass man es von außen kaum einsehen konnte. Eberhardts Blick fiel auf den langen, massiven Esstisch aus Nussbaumholz, den er auch zum Arbeiten nutzte und auf dem ein großer Stapel Akten lag. Was soll’s, dachte er, stellte seinen Becher ab und wollte gerade mit der Arbeit beginnen, als sein Telefon vibrierte. Eine Whatsapp-Sprachnachricht seiner »kleinen« Schwester Alessia. Mit ihren achtundzwanzig Jahren war sie ganze dreizehn Jahre jünger als er. Und obwohl sie sich mit ihrem dunklen Teint und den fast schwarzen Haaren vom Aussehen her ähnelten und beide eher nach ihrer italienischen Mutter als nach ihrem deutschen Vater kamen, hätten sie vom Charakter her nicht unterschiedlicher sein können. Alessia entsprach dem Stereotyp einer Südländerin. Sie redete mit Händen und Füßen, war laut und begeisternd und sagte immer geradeheraus, was sie dachte und fühlte. Auch Rocco mochte auf den ersten Blick wie ein offener Mensch wirken, unterhaltsam und souverän in Gesellschaft. Wie es aber in seinem Inneren aussah und was er wirklich fühlte, teilte er mit niemandem.
Trotz dieses Unterschiedes hatten die Geschwister sehr viele Gemeinsamkeiten. Sie liebten gutes, natürlich vorzugsweise italienisches Essen, Musik, die Natur und waren stets füreinander da. Es gab nur einen einzigen Punkt, der immer wieder für Streit sorgte: Das war das Verhältnis zu ihrem Vater. Rocco hatte vor vielen Jahren mit ihm gebrochen und mied, so gut es ging, jeden Kontakt. Für Alessia hingegen war ihr Papa das große Vorbild und ihr Held. Eine Vaterfigur durch und durch. Sie hatte nicht mitbekommen, was damals zwischen Vater und Sohn vorgefallen war – sie war noch zu klein, als die Situation eskalierte, gerade mal drei Jahre alt. Und Rocco hatte es ihr bisher nie erzählt. Es hätte sowieso nichts geändert.
Wahrscheinlich ahnte Alessia trotzdem, dass es einen dunklen Punkt in der Vergangenheit gab, der Roccos Verhalten erklärte. Auch wenn sie nicht zu wissen schien, was es war, tat es ihr offenbar sehr weh. Sie war ein Familienmensch durch und durch. Alessia lebte nicht in der Vergangenheit, sondern blickte stets nach vorne. Das war wohl auch der Grund, warum sie immer wieder versuchte, das Verhältnis zwischen ihrem Bruder und ihrem Vater zu kitten.
Rocco öffnete die Nachricht und freute sich, die Stimme seiner Schwester zu hören. Die Qualität war ausgezeichnet, als würde sie direkt vor ihm stehen.
»Hallo, großer Bruder, ich hoffe es geht dir gut und du sitzt nicht schon wieder über deinen Fällen! Heute ist Sonntag, und du solltest den Tag mal freinehmen.«
Rocco musste lachen. Seine Schwester kannte ihn doch verdammt gut. Als er den nächsten Teil der Nachricht hörte, verfinsterte sich allerdings sein Gesicht.
»Hör mal, ich habe mit Papa telefoniert. Und auch wenn es nicht einfach war, hab ich ihn überreden können, dass ihr euch am nächsten Freitag zum Essen treffen könnt. Um 12.30 Uhr im Numi am Zoo. Du weißt doch, das ist oben auf dem Hotel, gegenüber von der Elephant Bar. Tu mir den Gefallen und sei nicht zu spät, ja? Tausend Küsse. Und denk dran: Nicht mehr so viel arbeiten heute.«
Rocco Eberhardt fluchte leise. Das war das Allerletzte, worauf er jetzt Lust hatte. Ein Treffen mit seinem Vater. Alessia schien das geahnt zu haben, denn im nächsten Moment kam eine zweite Sprachnachricht.
»Hey. Nicht so ärgern. Ich weiß, du hast keine Lust. Also tu es einfach für Mama und mich! Daaaanke!«
Rocco schüttelte den Kopf. Sosehr er seine Schwester liebte, so wenig konnte er es leiden, wenn sie sich in etwas einmischte, das sie nicht verstand. Vielleicht war es ja doch an der Zeit, ihr zu erzählen, was ihn und seinen Vater vor so vielen Jahren auseinandergebracht hatte.
5. Kapitel
Doktor Justus Jarmer, Facharzt am Berliner Institut für Rechtsmedizin, wies sich mit seinem Dienstausweis dem Beamten gegenüber aus, der den Tatort absicherte. Jarmer war knapp einen Meter achtzig groß und hatte dunkle, fast schwarze, lockige Haare. Zu einer blauen Jeans trug er ein weißes Poloshirt. Seine auffallend grünen Augen strahlten Ruhe und gleichzeitig die Erfahrung eines Mannes aus, der in seinem Leben schon vieles gesehen hatte.
Seit der Tat war eine gute Stunde vergangen. Rund um die Bäckerei lief die Polizeiarbeit auf Hochtouren. Zahlreiche Einsatzwagen der Schutzpolizei sowie ein Bus der Spurensicherung und auch ein Übertragungswagen eines lokalen Fernsehsenders säumten die Szenerie. Die Verletzten waren längst mit zwei Notarztwagen abtransportiert worden.
Jarmer blickte auf seine Uhr. Eigentlich hatte er in der nächsten Stunde mit seiner Frau und den Kindern noch einen Ausflug geplant, doch das konnte er sich jetzt wohl abschminken. Es gehörte zu seinen Aufgaben, eine erste Inaugenscheinnahme der Leichen unmittelbar am Tatort vorzunehmen. Anhand von Spuren zu rekonstruieren, was genau geschehen war. Der Polizei Hinweise zu möglichen Tatwaffen und der ungefähren Todeszeit zu geben. Dinge, die in diesem Fall aber eher von untergeordneter Bedeutung waren, denn es gab zahlreiche Augenzeugen des Geschehens.
»Mein Name ist Jarmer, ich bin der Rechtsmediziner«, wandte er sich an einen Beamten, der neben dem Eingang der Bäckerei stand und etwas in seinen Block notierte. »Können Sie mir sagen, wer hier den Einsatz leitet?«
»Das ist vorläufig die Kollegin Pox vom Kriminaldauerdienst«, erwiderte der und zeigte in Richtung eines Streifenwagens, bei dem eine Frau von etwa vierzig Jahren mit dunklen Haaren, einer abgewetzten Lederjacke und einem auffallend blassen Teint stand.
Jarmer bedankte sich und ging zu der Kommissarin. Nachdem er sich erneut vorgestellt und sie die üblichen Höflichkeiten ausgetauscht hatten, fragte er sie: »Wissen Sie schon, was hier genau passiert ist?« Er wollte sich erst einmal einen Überblick verschaffen, bevor er mit seiner eigentlichen Arbeit begann.
Kerstin Pox nickte und erwiderte knapp: »Mehrfache Schussabgabe. Zwei Schwerverletzte und ein Toter. Und eine ganze Menge Zeugen, allen voran der Kollege Schäfer, der zufällig am Tatort war und den Schützen überwältigt hat.« Sie zeigte auf einen älteren Beamten in Uniform, der in einem Krankenwagen gerade von einer Ärztin behandelt wurde. »Ich bin auch gerade erst gekommen, lassen Sie uns doch zusammen zu ihm rübergehen, die scheinen gerade fertig zu werden«, sagte sie.
Gemeinsam mit der Beamtin machte Jarmer sich auf den Weg zu Schäfer. Mit fachmännischem Blick musterte er den Polizisten. Dessen linke Schläfe war geschwollen, die Haut über und unter seinem linken Auge schimmerte rötlich. Das Hämatom sackt der Schwerkraft folgend nach unten, ging es Jarmer durch den Kopf. Trotzdem machte er einen gefassten Eindruck. Kerstin Pox stellte Jarmer kurz vor, und Schäfer nickte den beiden freundlich zu. Mit leichtem Berliner Akzent sagte er: »Ick bin hier sicherlich gleich fertig, ein Sekündchen noch.«
Die behandelnde Ärztin händigte Schäfer zwei Zettel aus, auf denen neben der Diagnose vermerkt war, welche Untersuchungen sie durchgeführt und welche Medikamente sie verabreicht hatte, ehe sie ihm auf die Schulter klopfte und sagte: »So, und vergessen Sie nicht, dass Sie heute noch ins Krankenhaus müssen, damit Sie noch mal ordentlich untersucht und vor allen Dingen auch geröntgt werden.«
Schäfer musste grinsen. »Wird schon werden«, sagte er und kletterte dann aus dem Krankenwagen.
»Können wir kurz mit Ihnen reden?«, fragte Pox, und Schäfer nickte.
»Ja, is nich so schlimm. Hab ’nen harten Schädel und is wohl nüscht passiert außer ’ner dicken Beule und ’nem blauen Auge.«
Jarmer musste lächeln. Von dem könnten sich einige Beamte ruhig mal eine Scheibe abschneiden, dachte er. Aus langjähriger Erfahrung wusste er, dass der Krankenstand in den Reihen der Polizei viel zu hoch war, und er hatte den Eindruck, dass gerade die jungen Beamten außerordentlich anfälligwaren.
»Ick globe, wir setzen uns lieber in einen der großen Wagen, da können wa in Ruhe reden«, sagte Schäfer. »Die Kollegen von der Spurensicherung sind gerade jekommen, um mit der Tatortarbeit zu beginnen, sonst stehen wir denen nur im Weg rum, wa?«
Gute Idee, dachte Jarmer. Je mehr Informationen er jetzt erhalten würde, desto leichter würden ihm die anstehende Untersuchung des Toten und die Rekonstruktion der Ereignisse fallen. Gemeinsam mit den beiden Kommissaren setzte er sich in den Polizeibus, und Schäfer begann gerade zu erzählen, was in der letzten Stunde passiert war, als plötzlich ein Handy klingelte. Das Klingeln kam vom Beifahrersitz. Neben einem Schlüsselbund, einer Packung Taschentücher und einer Rolle Pfefferminzbonbons lag da ein Handy.
»Auweia«, sagte Schäfer. »Det sind ja die Sachen, die ick dem Täter abjenommen habe. Ick hab die hierhinjelegt und ganz vergessen. Soll ick da ranjehen?«, fragte er.
Kerstin Pox schüttelte den Kopf und griff sich das Telefon. Auf dem Display konnte Jarmer den Namen des Anrufers erkennen. In weißen Buchstaben auf schwarzem Hintergrund las er: Anja Home.
6. Kapitel
Anja Nölting starrte aus dem großen Fenster ihrer Küche auf die Straße und war außer sich vor Sorge. Nikolas war jetzt schon zwei Stunden weg. Normalerweise drehte er nach dem Bäcker immer noch mal eine Runde über den Ku’damm, um den Kopf frei zu kriegen, wie er sagte, aber er war noch nie länger als eine Stunde weg gewesen. Sie wollten ja spätestens um halb zehn frühstücken.
Zum vierten Mal rief sie auf dem Handy ihres Mannes an und hoffte inständig, dass er sich endlich meldete. Die Angst, dass ihm etwas passiert war, wuchs mit jedem Klingeln.
»Verdammt noch mal, geh doch bitte endlich ran!«, fluchte sie, mehr aus Verzweiflung als vor Ärger. Im selben Moment hörte das Klingeln auf. Nikolas hatte tatsächlich abgenommen. »Nikolas, oh, mein Gott, ich habe mir solche Sorgen gemacht. Warum hast du denn nicht angerufen?«
Aber es war nicht Nikolas, der antwortete. Stattdessen meldete sich eine Frauenstimme.
»Hallo, guten Tag. Mit wem spreche ich bitte?«
Anja Nöltings Zuversicht war von einem Moment auf den anderen wie weggeblasen. Panik stieg in ihr auf.
»Wer sind Sie?«, rief sie verzweifelt in den Hörer. »Was ist mit meinem Mann? Wo ist Nikolas?«
»Hören Sie jetzt bitte genau zu und bleiben Sie ganz ruhig«, erwiderte die Stimme am anderen Ende der Leitung. »Mein Name ist Pox, ich bin von der Kriminalpolizei. Sind Sie Anja Nölting, die Frau von Nikolas Nölting?«
Anja war starr vor Angst. Was war mit Nikolas geschehen, und warum ging die Polizei an sein Telefon?
»Hallo, sind Sie noch dran?«, fragte die Stimme wieder. »Sind Sie Anja Nölting?«
»Ja«, erwiderte sie mit schwacher Stimme. »Ja, das bin ich.«
»Entschuldigen Sie bitte, Frau Nölting. Ich musste erst sichergehen, dass Sie auch sind, wer Sie vorgeben zu sein. Und bitte beruhigen Sie sich. Ihrem Mann geht es gut, er kann nur gerade nicht ans Telefon kommen.«
»Es geht ihm gut, sagen Sie? Oh, Gott, da bin ich aber erleichtert. Danke, vielen Dank! Wo ist er denn, und warum kann er nicht mit mir sprechen?«
»Frau Nölting, auch wenn es Ihrem Mann gut geht, muss ich Ihnen sagen, dass etwas Schlimmes passiert ist. Es hat hier eine Schießerei gegeben. Ihr Mann ist nicht verletzt, aber wir müssen ihn noch weiter festhalten. Sie können natürlich später zu ihm. Deshalb würde ich jetzt gerne mit einem Kollegen zu Ihnen nach Hause kommen, damit ich Ihnen alles erzählen und Ihnen auch ein paar Fragen stellen kann. Wäre das okay für Sie?«
»Eine Schießerei?«
»Ja, aber Ihrem Mann ist nichts passiert.«
Anja Nölting verstand die Welt nicht mehr. Eine Schießerei? Als ihr die Polizistin dann noch einmal ausdrücklich versicherte, dass ihr Mann nicht verletzt war, stimmte Anja Nölting schließlich zu.
»Gut, in einer Dreiviertelstunde sind wir da«, sagte die Kommissarin abschließend. »Bleiben Sie ruhig, es wird sich alles klären!«
Anja Nölting war vollkommen durcheinander, als sie auflegte. Was um alles in der Welt war mit Nikolas passiert?
7. Kapitel
Einen Tag nach der Tat
Rocco Eberhardt verzog sein Gesicht und stellte den braunen Plastikbecher mit der dunklen Flüssigkeit angewidert vor sich ab. Was der Automat im Anwaltszimmer ausspuckte, war alles, nur kein Kaffee. Mit der rechten Hand lockerte er seine dunkle Krawatte und öffnete die beiden obersten Knöpfe seines hellblauen Hemdes. Seit einer knappen Stunde wartete er jetzt schon vergeblich darauf, dass sein nächster Termin, die Verhandlung um eine schwere Körperverletzung, aufgerufen wurde. Und gerade eben hatte er vom Wachtmeister erfahren, dass er wenigstens noch eine weitere Stunde warten müsste, was seine Laune nicht gerade verbessert hatte. Wie so oft verzögerten sich die Verhandlungen im Kriminalgericht auch heute, weil zu viele Termine in zu kurzen Abständen anberaumt waren. Rocco griff zu seinem Telefon, um sein Büro zu informieren, dass er später kommen würde, als etwas anderes seine Aufmerksamkeit erregte.
Am Eingang zum Anwaltszimmer redete eine blonde Frau Mitte dreißig in Designerjeans und heller Bluse schon seit ein paar Minuten auf die Empfangssekretärin ein. Ihr Tonfall wurde zunehmend ungeduldiger, und jetzt sah es so aus, als würde gleich ein Streit zwischen den beiden ausbrechen. Frau Schröder, die Empfangssekretärin, kam langsam an die Grenzen ihrer Geduld – und das wollte etwas heißen. Seit über zwanzig Jahren war sie die gute Seele, die den Eingang des Anwaltszimmers von Europas größtem Strafgericht bewachte, und noch nie war jemand unberechtigt an ihr vorbeigekommen. Mit Ruhe und Souveränität erfüllte sie ihre Aufgabe so zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk. Aber jetzt schien selbst sie kurz davor zu sein, ihre Fassung zu verlieren. Ihre dunklen Augen funkelten hinter ihrer schlichten schwarzen Brille, die im Kontrast zu ihren streng nach hinten frisierten grauen Haaren standen. Doch die blonde Frau ließ sich einfach nicht abwimmeln.
Eigenartig, die passt so gar nicht hier rein, dachte Eberhardt. Zu gut angezogen, zu beharrlich, das machte irgendwie keinen Sinn. Genau das weckte aber seine Neugier. Er liebte das Ungewöhnliche. Kurzerhand schob er den Plastikbecher mit der Automatenbrühe beiseite und ging zum Empfang.
»Noch mal, ich brauche einen Anwalt. Verstehen Sie doch, das ist eine Notsituation. Hier ist ein Irrtum passiert, und mein Mann sitzt jetzt im Gefängnis«, versuchte es die blonde Frau ein weiteres Mal. Sie klang verzweifelt und schien kurz vor einem Zusammenbruch zu stehen.
»Ich kann mich nur wiederholen«, erwiderte Frau Schröder gebetsmühlenartig. »Das hier ist keine Kanzlei, Sie sind im Gericht. Die Anwälte warten hier nur auf ihre nächsten Verhandlungen und ganz sicher nicht auf Sie. Rufen Sie bitte bei der Nummer an, die ich Ihnen gegeben habe. Das ist der Notdienst der Berliner Strafverteidiger. Die werden Ihnen ganz bestimmt helfen.«
Die blonde Frau schüttelte den Kopf und ließ sich immer noch nicht abwimmeln. Gerade als sie zu einem weiteren Anlauf ansetzen wollte, ging Rocco Eberhardt dazwischen. Vertrauensvoll blickte er sie an, ehe er ruhig sagte: »Mein Name ist Eberhardt, Rocco Eberhardt. Ich bin Strafverteidiger. Lassen Sie uns doch ein paar Schritte gehen.« Er wies mit seiner rechten Hand in Richtung des Flures vor dem Anwaltszimmer und zwinkerte dabei der Empfangssekretärin unauffällig zu. Zunächst irritiert und dann sichtlich erleichtert erwiderte sie seinen Blick. Sie schien froh zu sein, dass sie die anstrengende Person los war, verstand aber ganz offensichtlich nicht, warum sich Eberhardt der Sache angenommen hatte. Dann zuckte sie mit den Schultern und wandte sich wieder den Papieren vor sich zu.
Eberhardt schob die Frau sanft, aber bestimmt aus dem Eingang und musterte sie dabei von oben bis unten. Klassisch gekleidet, schlicht, aber teuer. Über dreißig, aber noch nicht vierzig. Selbstbewusst, aber verzweifelt. Und ganz offensichtlich ohne jeglichen Plan.
»Na, dann erzählen Sie mal, was hat Sie denn hierhergeführt?«
Sie musste erst einmal tief durchatmen. Dann sagte sie: »Mein Name ist Nölting. Und mein Mann Nikolas sitzt unschuldig im Gefängnis.«
8. Kapitel
Einen Tag nach der Tat
Hier werde ich also die nächsten Monate verbringen, dachte Nölting, als die schwere Zellentür mit einem lauten Krachen hinter ihm ins Schloss fiel. Kein Holiday Inn, aber wenigstens bin ich allein. Ihm war klar gewesen, dass er im Gefängnis landen würde. Wie es aber hinter Gittern wirklich aussah, hatte er sich nicht vorstellen können. Seine Befürchtung, dass sie ihn mit einem anderen Insassen in eine Zelle stecken würden, womöglich mit einem Schwerverbrecher oder Vergewaltiger, hatte sich zum Glück nicht bewahrheitet. Er hatte auch gar keine Ahnung, ob es in Deutschland überhaupt Gemeinschaftszellen gab. Seine gesammelten Kenntnisse, was Gefängnisse betraf, stammten aus US-amerikanischen Fernsehserien. Und die hatten ganz offensichtlich nichts mit der Realität in Moabit zu tun.
Sein Blick fiel auf das einfache Stahlrahmenbett. Die moosgrüne Farbe war an den meisten Stellen abgeplatzt, und die Matratze hatte schon bessere Zeiten gesehen. Vorsichtig ließ er sich nieder und streckte sich aus. Muffig. Alt. Durchgelegen. Ein Blick auf sein linkes Handgelenk erinnerte ihn daran, dass sie ihm auch die Uhr abgenommen hatten. Genau wie alles andere, bis auf sein blaues Poloshirt, seine Jeans, die Schuhe und natürlich seine Brille. Auch seinen Gürtel und die Schnürsenkel hatte man ihm gelassen, anders als er es aus dem Fernsehen kannte.
Wie spät war es eigentlich? Das Mittagessen war jetzt schon eine Weile her. Es musste nach zwei sein, schätzte er. Egal. Er war müde, überaus müde. In seiner ersten Nacht, die er noch in einer Zugangszelle in Europas größtem und vollkommen überbelegten Gefängnis verbracht hatte, hatte er kein Auge zugetan – er befand sich in einem Zustand zwischen totaler Erschöpfung und ständiger Angespanntheit. Zu viele Gedanken liefen in seinem Kopf um die Wette, und er konnte keinen zu Ende bringen.
Wie es wohl Lily ging? Er liebte sie so sehr. Noch bevor sie geboren wurde, hatte er ihr Zimmer gestaltet und eingerichtet. Die Wände rosa, ein Mobile über der Wickelkommode und sogar schon ein Schaukelpferd, das auf die Ankunft des Babys wartete. Voller Freude hatte er sich vorgenommen, ein Vater zu sein, auf den die Kleine stolz sein konnte. Ein cooler Vater. Aber auch ein Fels in der Brandung. Fußball spielen wollte er mit ihr. Und reiten. Und klettern. Vielleicht auch etwas Technisches? Vielleicht was aus Holz bauen? Mit Säge und Nägeln. All das wollte er mit ihr unternehmen. Und dann war sie da. So hübsch. Und so unschuldig.
Doch alles kam ganz anders. Das Schicksal hatte unbarmherzig zugeschlagen. Er war am Boden zerstört. Lily konnte natürlich nichts dafür. Sie war doch nur ein winzig kleines Wesen. Sein kleiner Liebling! Vor gerade mal einem Monat hatte sie ihren sechsten Geburtstag gefeiert.
Für sie, und nur für sie, hatte er all das getan. Am Anfang war alles ganz einfach. Es kam ja auch niemand zu Schaden. Ganz im Gegenteil. Voller Überzeugung hatte er sich damals eingeredet, er hätte sogar ein Anrecht darauf. Schließlich ließ der Staat sie im Stich. Und keiner bekam etwas mit. Auch Anja nicht. Dass sie auf einmal mehr Geld hatten, erklärte er mit einer Beförderung. Und lukrativen Beraterverträgen. Erst später wurde es doch kompliziert. Verzweifelt hatte er versucht, das seinem Ansprechpartner zu erklären. Sie würden sonst auffliegen. Aber der wollte nicht hören. Aus diesem Grund hatte er für sich den Weg gewählt, der ihn schließlich an diesen Ort, in die Justizvollzugsanstalt Moabit, ins Gefängnis, geführt hatte. Das alles war Teil seines Plans.
9. Kapitel
Einen Tag nach der Tat
»Wein oder Kaffee?«, fragte Klara Schubert den Chef von ihrem Schreibtisch aus.
»Wein.«
Klara Schubert nickte, stand auf und ging an den großen antiken Eichenschrank, der auf der linken Seite ihres Sekretariats stand. Die Bar, die sich hinter den massiven Türen verbarg, erinnerte an die Ausstattung eines Cary-Grant-Films aus den Sechzigerjahren. Whisky, Gin, Rum und Wodka standen nebeneinander aufgereiht. Nur vom Feinsten. Ein Sodaspender aus Kristallglas und vier Flaschen Rotwein. Zwei aus Frankreich und zwei aus Italien.
»Primitivo. Und bringen Sie sich auch was mit«, hörte sie Rocco Eberhardt dann aus seinem Büro rufen.
Klara Schubert nickte erneut, griff sich zwei Gläser, den Wein und brachte alles in das große Büro ihres Chefs. Sie setzte sich an den langen gläsernen Besprechungstisch, der so typisch für den Einrichtungsstil der Kanzlei war. Eine perfekte Mischung aus modernen Elementen in einem klassischen Altbau. Die hohen, stuckverzierten Decken waren in mattem Weiß getüncht und wurden durch elegante Lampen und zwei Edelstahlfluter perfekt in Szene gesetzt. An den Wänden hingen Aquarelle in leuchtenden Farben von Gertrude Köhler, die Rocco vor einigen Wochen auf Empfehlung von Klara Schubert gekauft hatte.
»Wir haben einen neuen Fall«, sagte er, zog das Sakko aus und warf es lässig über seinen ausladenden, ledernen Stuhl. Dann griff er sich ein Glas und trank einen großen Schluck. Seine Gesichtszüge entspannten sich merklich, er atmete tief durch.
Eberhardt setzte sich an den Besprechungstisch zu seiner Assistentin. Klara Schubert arbeitete nun schon seit dreizehn Jahren für ihn und war mehr als nur seine Sekretärin. Ihre dreiundsechzig Jahre sah man ihr nicht im Geringsten an. Die dunkelbrünetten Haare waren perfekt frisiert, und ihr Boss-Hosenanzug saß wie immer tadellos. Sie wäre ohne Weiteres als Ende vierzig bis Anfang fünfzig durchgegangen. Lediglich die kleinen Fältchen um ihre Augen gaben dem aufmerksamen Beobachter einen Hinweis auf ihr wahres Alter.
Rocco Eberhardt hatte sie vor knapp sechzehn Jahren während seines Referendariats in einer Kanzlei kennengelernt, in der er drei Monate gearbeitet hatte. Sie war dort Bürochefin gewesen und hatte den jungen, vielversprechenden Juristen vom ersten Tag an unter ihre Fittiche genommen. Klara Schubert fand es enorm wichtig, dass ein angehender Anwalt auch eine Ahnung davon hatte, wie eine Kanzlei organisiert ist. Er hatte von ihr in kürzester Zeit mehr über die juristische Arbeit gelernt als in all den Jahren zuvor an der Uni.
Nach Abschluss seines Studiums, er hatte schon zwei Jahre als Einzelkämpfer in seinen eigenen Räumen gearbeitet, hatte Rocco Eberhardt von einem befreundeten Kollegen gehört, dass die Kanzlei, in der Klara Schubert tätig war, geschlossen wurde. Der Inhaber wollte sich zur Ruhe setzen. Kurz entschlossen hatte er den Hörer in die Hand genommen und ihr ein Angebot gemacht. Ohne lange nachzudenken, hatte sie angenommen. Seit dieser Zeit bildeten sie ein perfektes Team. Während er an vorderster Front im Gerichtssaal kämpfte, kümmerte sie sich um den ganzen Rest. Und das nicht nur mit unermüdlichem Arbeitseinsatz. Klara Schubert hatte auch für die Einrichtung der Kanzleiräume gesorgt und mit sicherer Hand eine perfekte Mischung aus klassischen Altbauelementen, modernen Möbeln und dazu passenden Kunstwerken kombiniert. Innenarchitektur und die deutschen Künstler des zwanzigsten Jahrhunderts waren ihre heimliche Passion. Rocco war darüber sehr dankbar, denn Klara hatte in den Räumen eine Atmosphäre geschaffen, die nicht nur immer wieder von Mandanten bewundert wurde, sondern mit der er sich selbst auch ausgesprochen wohlfühlte.
»Die Schießerei in der Bäckerei an der Neuen Kantstraße«, sagte Eberhardt und trank einen weiteren Schluck Wein. Er sah sie erwartungsvoll an und wartete auf ihre Meinung dazu.
»Und?«, fragte sie. »Wie kommen Sie zu diesem Fall? Stimmt damit etwas nicht?« Die beiden siezten sich seit jeher, und obwohl sie sich sehr nahestanden, hatten sie das nie geändert. Eine Form des gegenseitigen Respekts.
Rocco Eberhardt musste lächeln. Klara kannte ihn besser als die meisten Menschen. Sie merkte sofort, wenn ihn etwas nachdenklich stimmte.
»Weiß ich auch nicht so genau. Seine Frau, Anja Nölting, hat mich engagiert. Auf der Suche nach einem Anwalt ist sie heute direkt ins Anwaltszimmer im Gericht gestürmt.« Er hielt inne und leerte mit dem nächsten Schluck sein Glas. Klara Schubert füllte ihm nach.
»Sie war vollkommen verzweifelt. Hält das alles für einen Irrtum und kann sich nicht vorstellen, dass ihr Mann das getan hat.«
»Hat er es getan?«
»Daran besteht wohl kein Zweifel. Nach allem, was sie mir erzählt hat, stellt sich allerdings die Frage: warum? Nikolas, ihr Mann, ist wie an jedem Sonntag mit dem Fahrrad zum Bäcker gefahren. Und dann ist er da reinmarschiert und hat scheinbar aus heiterem Himmel und ohne jede Veranlassung um sich geschossen. Drei Menschen hat er getroffen, einer ist gestorben. Wie schwer die anderen beiden verletzt sind, weiß ich nicht. Und zu guter Letzt hat er sich wohl widerstandslos festnehmen lassen. Zumindest haben sie das gestern in der Abendschau und heute in den Boulevardzeitungen berichtet.«
»Der Killer-Beamte«, erwiderte Klara Schubert.
»Ja, so hat ihn die Journaille getauft. Der ›Killer-Beamte‹. Reißerisch, aber nicht ganz falsch. Nölting arbeitet als Sachgebietsleiter Stadtentwicklung im Fachbereich Bau der Stadt Nauen in Brandenburg, westlich von Berlin.«
»Warum hat er das getan?«
»Das ist die Eine-Million-Euro-Frage. Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe auch noch nicht in die Akte schauen können und mit niemandem bisher darüber gesprochen. Nach dem, was seine Frau erzählt hat, ist er der Prototyp eines langweiligen Beamten. Er hat sogar eine elektrische Eisenbahn im Hobbyraum.«
»Wer vertritt die Anklage?«
»Bäumler.«
Klara Schubert blickte auf und sagte mit einem nicht zu überhörenden sarkastischen Unterton: »Na, dann werden wir auf jeden Fall eine Menge Öffentlichkeit haben.«
»Das werden wir.«
»Haben Sie schon mit Nölting gesprochen?«
»Nein, ich werde ihn morgen in Moabit besuchen. Dort ist er nach der Verkündung des Haftbefehls gestern Abend am Tempelhofer Damm direkt hingebracht worden. Da hat ihn Anja Nölting auch das letzte Mal gesehen.«
»Wurde kein Anwalt beigeordnet?«