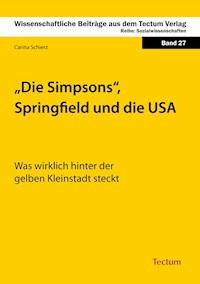
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tectum
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum Verlag
- Sprache: Deutsch
"Die Simpsons" - gelb, witzig und so viel mehr als Zeichentrick. Seit über 20 Jahren erleben nicht nur die Familienmitglieder der Simpsons-Sippe ihre Abenteuer in der Serienstadt Springfield. Homer bemerkt plötzlich, dass sich Bildung im Leben auszahlt. Bart lernt den viel besseren Lebensstandard der Reichen zu schätzen. Der alte Gil ist die personifizierte Unterschicht, Kernkraftwerkbesitzer Montgomery Burns genau das Gegenteil. Lisa ist Buddhistin, der Fernsehclown Krusty jüdischen Glaubens. Was steckt also hinter der bunten Fassade Springfields? Spiegelt das komplexe gesellschaftliche Treiben in Springfield das Leben der amerikanischen Bevölkerung wider? Carina Schierz deckt demografische, ethnische und religiöse Prozesse in fast jeder Szene der Zeichentrickserie auf und gewinnt so auf anschauliche Art und Weise Erkenntnisse über das heutige Amerika.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 206
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Carina Schierz
Die Simpsons, Springfield und die USA. Was wirklich hinter der gelben Kleinstadt steckt
Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum Verlag. Sozialwissenschaften, Bd. 27
© Tectum Verlag Marburg, 2010
ISSN 1861-8049
ISBN 978-3-8288-5605-9
Bildnachweis Cover: Michael Ohnesorge
(Dieser Titel ist zugleich als gedrucktes Buch unter der ISBN 978-3-8288-2179-8 im Tectum Verlag erschienen.)
Besuchen Sie uns im Internet unter www.tectum-verlag.de
www.facebook.com/Tectum.Verlag
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Danksagung
Mein herzlichster Dank gilt Herrn Prof. Dr. Brock für die hervorragende Betreuung und Unterstützung während des Entstehens meiner Arbeit.
Ebenso danke ich Micha für die Gestaltung des Covers, Julia, Enno sowie meiner Familie „und vor allem meinem Lieblingsbruder Markus“.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung
1.1 Anmerkungen
1.2 Gliederung
2 Die Simpsons
2.1 Matt Groening
2.2 Die TV-Serie
2.3 Charaktere und Eingangssequenz der Comicserie
2.3.1 Die Kernfamilie Simpson
2.3.2 Weitere Charaktere Springfields
3 Die Vereinigten Staaten von Amerika heute - Eine Sozialstrukturanalyse
3.1 Bevölkerung und Demographie
3.1.1 Alter, Fertilität, Mortalität und Lebenserwartung
3.1.2 Ethnische Zusammensetzung und Migration
3.2 Soziale Ungleichheit
3.2.1 Einkommen und Armut
3.2.2 Bildung und Zugangschancen
3.2.3 Beruf und Erwerbstätigkeit
3.3 Religion
4 Springfield und die USA – ein Sozialstrukturvergleich
4.1 Die amerikanische Kleinstadt und Springfield: Community und Modernisierung
4.2 Von Einwohnerzahlen zu Scammer & Z-Dog: Demographische Prozesse in Springfield
4.3 Der Bienenmann, Apu und Co. - Die ethnische Zusammensetzung Springfields
4.4 Soziale Ungleichheit in Springfield
4.4.1 Einkommen und Armut
4.4.2 Bildung und Zugangschancen
4.4.3 Beruf und Erwerbsbeteiligung
4.4.4 Ein Klassenmodell für Springfield
4.5 Religionen, Sekten und „Christ ist Christ”
5 Ergebnisse, Fazit und Ausblick
6 Literaturverzeichnis und Quellenverzeichnis
Anhang
Springfield – Stadtplan
Episodenguide
Abkürzungsverzeichnis
$ Dollar, Währung der Vereinigten Staaten von Amerika
Abb. Abbildung
Dr. Doktor
IQ Intelligenzquotient
Mr. Mister, Herr
Mrs. Misses/Mistress (Bezeichnung einer zumeist verheirateten oder geschiedenen Frau)
Ms. Miss (Bezeichnung einer zumeist unverheirateten Frau)
Tab. Tabelle
US United States, Sachverhalte die Vereinigten Staaten betreffend
USA United States of America
1 Einleitung
Der Besitz eines Handys oder Computers ist in der heutigen Zeit für die meisten Menschen in industrialisierten Ländern längst keine Seltenheit mehr. Der technische Fortschritt hat vielen Individuen neue Wege bereitet, die Forschung voran getrieben und ganz neue Methoden und Produkte auf den Markt gebracht. Er hat Einfluss auf Wirtschaft, Politik und andere wichtige gesellschaftliche Prozesse und Phänomene. Selbst einige Religionen stehen im Bann der Technik. Die Technisierung kann als Merkmal sozialstruktureller Prozesse gedeutet werden. Hinzu kommen noch viele andere Aspekte. Klassen, soziale Schichten oder Milieus sind die Dinge, die in modernisierten Gesellschaften wohl weitläufig als bekannt gelten. Verschiedene Bildungsniveaus, verschiedene Jobs, verschiedene Lebensstile. Prozesse wie Alterung, Fertilität und Mortalität bestimmen die sich verändernde Demografie einer Gesellschaft. All das sind Merkmale der Sozialstruktur ganz unterschiedlicher Gruppen von Menschen, Nationen, Gesellschaften. Aber können jene beschriebenen Prozesse auch außerhalb unserer realen Welt – in den fiktiven Weiten des Fernsehens – Anwendung finden? Ist Sozialprestige wirklich bereits an Schulen von so enormer Bedeutung für das gesellschaftliche Leben innerhalb wie außerhalb des Klassenzimmers wie es dem Zuschauer im Film „Eiskalte Engel”1 verdeutlicht wird? Wurde der offensichtlich nach wie vor existierende Rassenhass und die tiefe amerikanische Religionsverbundenheit in der TV-Serie „Eine himmlische Familie”2 überspitzt dargestellt? Und sind die Klassenunterschiede und die damit verbundenen vollkommen differenten Lebensstile wirklich so groß wie sie im Film „Das Streben nach Glück“ gezeigt werden? Auch wenn letzt genannter US-Film auf einer wahren Geschichte beruht, ist dies kein Garant dafür, dass Protagonist Chris Gardner3 es im realen Leben wirklich so schwer hatte wie der Film es dem Zuschauer weismachen will.
Die TV-Sensation, der sich diese Arbeit widmet, ist die amerikanische Zeichentrickserie „Die Simpsons”. Auch in dieser sind Sätze der Figuren zu hören, sind Dinge zu sehen, die sozialstrukturelle Merkmale freilegen. In den folgenden Kapiteln soll versucht werden, diese Charakteristika mit denen der Vereinigten Staaten von Amerika zu vergleichen.
Stellt die Sozialstruktur von Springfield ein „reales“ Abbild der US-Sozialstruktur dar?
Dies ist die Kernfrage dieses Buches. „Real“ ist hier nicht wörtlich zu nehmen. Es wird untersucht, ob das fiktive Springfield Merkmale aufweist, die in ähnlichem oder gleichem Ausmaß in den Vereinigten Staaten aufzuspüren sind. Natürlich kann kein reelles Bild dessen geliefert werden und der Zuschauer wird vielleicht denken, es ist ja nur eine Zeichentrickserie. Aber ich behaupte, es steckt sozialstrukturell viel mehr dahinter als nur der reine Unterhaltungswert und -wahnsinn, den diese Comicserie nun einmal hat. Viele Autoren und angehende Akademiker haben diese Serie bereits in den verschiedensten wissenschaftlichen Feldern erforscht und wissen, dass „hinter den Kulissen“ mehr zu entdecken ist als nur Trick. Ich möchte mich mit meiner Arbeit in diese Riege der Simpsons-Kenner einreihen. Warum? Ich verehre die Simpsons seit Mitte der 1990er Jahre. Seitdem sind sie nicht nur Bestandteil des Programms von ProSieben, sondern auch fester Bestandteil in meinem Leben. Über ein Thema dieser Art zu schreiben, war daher nicht nur eine willkommene Herausforderung, sondern auch pure Freude; denn schließlich hatte ich auch die nötigen Mittel dazu vorrätig: 19 Staffeln geballte Simpsons-Power auf DVD und Video.
Der in Portland geborene Simpsons-Macher Matt Groening hat mit der Entwicklung der gelben Fernsehfamilie etwas Großartiges geschaffen: Amerikas bisher am längsten laufende Sitcom (vgl. Helmes 2009, Titel). Was sind „Die Simpsons”, wer sind sie und wo wohnen sie? Die Simpsons sind eine gelbfarbige, kleinstädtische, US-amerikanische Familie, bestehend aus Vater, Mutter und (knapp4) drei Kindern. Die Farbe Gelb lässt hier nicht auf eine asiatische Herkunft schließen – doch dazu später mehr.
Wie so vielen Leuten vor mir ist es natürlich auch mir nicht gelungen, einen genauen Ort festzusetzen, an dem Springfield liegt, geschweige denn den Staat nennen zu können. Aber Springfield kann beschrieben werden als Kleinstadt in den Vereinigten Staaten von Amerika und ist laut dem in der Serie auftauchendem Time Magazine „Amerikas schrecklichste Stadt“ (Laura, die neue Nachbarin, IV/8) oder wie Marge zitierend zu sagen pflegt: „Springfield ist Amerikas größter Schrottei- mer… zumindest laut News Week“ (Ein Sommer für Lisa, VII/25). Und auch wenn Episode 18 in Staffel VI (Springfield Film Festival) meint, Springfield ist die am wenigsten populäre Stadt in den USA, so kann dies wohl kaum außerhalb der Serie unterschrieben werden, wenn man den Kultstatus betrachtet, den „Die Simpsons“ in so vielen Ländern der Welt besitzen. Doch außer diesen – unter Umständen immens übertriebenen – Darstellungen durch die Charaktere steckt möglicherweise noch mehr hinter der Fassade einer normalen Zeichentrickserie, mehr hinter der kleinstädtischen Fassade Springfields:
„Springfield ist ein Hohlspiegel gesellschaftlicher Realitäten, ein gelber Mikrokosmos, in dem politische Mythen auf die Probe gestellt und gesellschaftliche Phänomene diskutiert werden. [… ] So repräsentieren die Akteure Springfields eher Institutionen und Ideen als individuelle Charaktere. Das Springfielder Universum funktioniert dabei wie ein Versuchslabor: Auf begrenztem Raum werden Fragestellungen durchgespielt und Konflikte ausgetragen. [… ] Der Mikrokosmos Springfield ist kein Gegenentwurf zur gesellschaftlichen Realität,
sondern deren Destillat.
(Tuncel/Rauscher in: Gruteser et alter 2002, Seite 154)
Inwiefern diese Aussage der Simpsons-Wirklichkeit entspricht, wird sich in den Folgekapiteln noch herausstellen.
1.1 Anmerkungen
Beim Lesen dieses Buches gilt es Einiges zu beachten, was für diverse Sinnzusammenhänge wie auch das Fernsehen betreffende Sachverhalte von Bedeutung ist:
Zu berücksichtigen wäre zunächst, dass im Folgenden wie auch bereits in Kapitel 1 beim Schreiben des Markennamens „Die Simpsons“ kein Trademark- oder Copyright-Zeichen gesetzt werden wird - aus Gründen des flüssigen Lesens. Die Simpsons sind eine Handelsmarke und stehen unter dem Urheberrecht des Senders FOX: The Simpsons™ and ©FOX5.
Wenn von Springfield die Rede ist, bezieht sich dies auf den Handlungsschauplatz der TV-Serie „Die Simpsons“ und nicht auf eine der real existierenden Städte der USA, es sei denn, dies wird ausdrücklich erwähnt.
Matt Groening ist nach wie vor der ausführende Produzent der Serie6. Da „Die Simpsons“ seine Idee waren, gehe ich auf die anderen Co-Produzenten, sowie auf Zeichner und Dialog-Schreiber nicht gesondert ein.
Es ist zu vermuten, dass durch deutsche Übersetzungen der Witz mancher Szenen, aber auch einige Zusammenhänge innerhalb der Serie falsch dargestellt werden könnten, dennoch beziehe ich mich ausschließlich auf diese Synchronisationen und lasse das Englische außen vor.
Des Weiteren ist vermutlich nicht jede Idee zu den einzelnen Episoden zugleich eine Idee Matt Groenings, wodurch davon auszugehen ist, dass eventuelle sozialstrukturelle Phänomene, die sich in den USA widerspiegeln, die Meinung Mehrerer oder eines Einzelnen darlegen, die nicht der Groenings selbst entspricht. Zur Produktion einer Zeichentrickserie dieses Ausmaßes ist ein großes Team nötig, die gezeigten sozialstrukturellen Charakteristika also das Produkt vieler (Einzelner) und möglicherweise von Folge zu Folge unterschiedlich und vielleicht auch widersprüchlich. In diesem Buch wird es also nur um das gehen, was dem Fernsehzuschauer vermittelt wird.
Einiges wird innerhalb der TV-Serie überspitzt dargestellt, aber auch das wird in den folgenden Kapiteln aufgearbeitet und untersucht. Eine lückenlose Darstellung der Sozialstruktur der Vereinigten Staaten ist sicher nicht möglich, aber es wird versucht, auf alle gesellschaftlich relevanten Prozesse und Strukturen einzugehen, über die die Serie etwas preisgibt.
Zu beachten ist außerdem, dass sich die Querverweise zu den einzelnen Folgen nach dem Episodenguide im Anhang richten. Dieser widerspiegelt die Episodenreihenfolge des US-Fernsehens, wie an den Daten der Erstausstrahlung zu erkennen ist. Im Folgenden wird die jeweilige Staffel mit römischen Zahlen bezeichnet, die entsprechende Episode mit einer arabischen Zahl. Die erste Folge der ersten Staffel trägt also die Bezeichnung „I/1”, die darauf folgende Episode „I/2“ und so weiter. Es wäre zu unüberschaubar geworden, hätte ich die Erstausstrahlung in Deutschland hierfür gewählt, da das deutsche Fernsehen die Folgen oftmals extra an Ereignisse wie Halloween oder Weihnachten angepasst hat oder beispielsweise die Fortsetzungsfolgen zu „Wer erschoss Mr. Burns?“ (VI/25 und VII/1) nicht wie das US-Fernsehen staffelübergreifend aneinander gereiht gesendet hat, sondern innerhalb der sechsten Staffel die erste Folge der US-siebten einschob. An den Daten der Deutschland-Premiere der betreffenden Episoden wird dies deutlich.
Ich habe mich entschieden, eine eigene Ordnung für jede Folge zu wählen und nicht die US-amerikanischen – offiziellen – Bezeichnungen wie beispielsweise „7G08“ für die allererste Folge (I/1). Für den Leser werden somit mögliche Weiterentwicklungen innerhalb der Serie zwischen verschiedenen Episoden leichter erfassbar, da kognitiv schneller eine zeitliche und logische Abfolge der Geschichten rund um die Simpson-Familie und Springfield gebildet werden kann. So lassen sich Entwicklungen der Beziehung zwischen Grundschul-Rektor Seymour Skinner und Lehrerin Edna Krabappel effizienter verfolgen, ebenso wie optimaler erfassbar wird, ab wann Springfields Einwohner in Besitz ihres erstes Mobiltelefons oder Computers sind.
Der Stadtplan im Anhang ist zu finden auf: http://adn.blam.be/springfield/. Er kommt dem sehr nah, der ab und an in den Eingangssequenzen des Couch Gags zu sehen ist: Die Familie rennt zur Couch, die „Kamera“ entfernt sich immer weiter. Das Haus der Simpsons ist nun von außen zu sehen, schließlich ein Großteil der Evergreen Terrace, halb Springfield, ganz Springfield und schließlich die ganze Welt. Wird das Bild angehalten als ganz Springfield zu sehen ist, zeigt sich jenes Bild, welches ähnlich dem des Stadtplans im Anhang dieses Buches ist.
1.2 Gliederung
Um die von mir aufgestellte Frage zu beantworten, wird zunächst der Erfinder der Simpsons, Matt Groening, und dessen Geschichte vorgestellt (Kapitel 2.1), anschließend die TV-Serie samt des Serienschauplatzes Springfield (2.2). Kapitel 2.3 beinhaltet einen Charakterguide rund um die wichtigsten Personen in Springfield, aber auch der Kernfamilie Simpson, deren Namen die Serie ihren Titel verdankt. Für den aufmerksamen Zuschauer wird es nicht verwunderlich sein, warum es Barkeeper Moe in den Charakterguide geschafft hat oder auch Krusty, der Klown, jedoch nicht Edna Krabappel oder Nelson Muntz. Im Fortlauf der Kapitel dieses Buches werden noch andere Charaktere auftauchen, auch die beiden eben genannten, die direkt oder indirekt Auskunft geben können über die Sozialstrukturprozesse ihrer Stadt oder der Vereinigten Staaten. Kapitel 2.3.2 beschränkt sich hierbei jedoch eher auf Persönlichkeiten, die in nahezu jeder Episode auftauchen oder so großen Einfluss haben, dass sie nicht außen vor gelassen werden können. Und wie kann ein weniger exakter Blick auf die Serie geworfen werden ohne eine genaue Darstellung der Hauptpersonen Homer, der oft gar nicht so dumm ist wie er sich gibt; Marge, die die perfekte Hausfrau verkörpert und das Sprachrohr für Vernunft, Moral und Religion darstellt; Tunichtgut Bart, der oft – und sei es nur in Traumsequenzen – zeigt, was einmal aus ihm werden wird; Lisa, die große politische Ziele und Ideale verfolgt; und schließlich Maggie, deren Kostenpunkt pro Monat ja schon in der Eingangssequenz der Serie festgelegt ist (vgl. Kapitel 2.3 dieser Schrift).
Mit der Sozialstruktur der Vereinigten Staaten von Amerika in ihren vielen Facetten beschäftigt sich Kapitel 3. Nach einer kurzen Definition des Begriffs der Sozialstruktur wird eingegangen auf die Merkmale der US-Bevölkerung sowie kurz auf deren historische Entwicklung von der Gründung bis zur Weltmacht mit ihren inzwischen rund 300 Millionen Einwohnern (3.1). Diese hohe Einwohnerzahl ist nicht nur das Resultat eines natürlichen, geburtenbedingten Wachstums, sondern auch der Einwanderungspolitik der Vereinigten Staaten. Die wirklichen Ureinwohner der USA machen lediglich noch ein Prozent der Gesamtbevölkerung aus. Die restlichen Millionen kommen von überall her. Trotz des hohen ethnischen Pluralismus’ gibt es nach wie vor Formen der Diskriminierung, die zu einem Großteil durch die jeweilige Rasse realisiert wird, aber auch durch andere Gründe existiert. Dieses wichtige sozialstrukturelle Merkmal ist das der sozialen Ungleichheit. Auch und vor allem in den Vereinigten Staaten spielt sie eine große Rolle und Kapitel 3.2 behandelt dieses Thema in Bezug auf Indikatoren wie Einkommen (3.2.1), Bildung (3.2.2) sowie Beruf und Erwerbstätigkeit (3.2.3). Dieses Kapitel wird zeigen, dass das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, das Land, das so viel Wert auf die Verwirklichung des American Dream legt, nicht all seinen Bürgern auch die Chancen dazu gewehrt. Eine afroamerikanische, junge Frau mit zwei Kindern wird nicht behandelt wie ein weißer Mann im besten Alter. Sie wird anders bezahlt, sie hat differente Zugangschancen zu Bildungseinrichtungen, sie übt vermutlich auch andere Jobs aus. Die Analyse, dass dem so ist oder sein könnte, liefert Kapitel 3.2. Bereits in der Verfassung ist das unantastbare Recht auf das Streben nach Glückseligkeit verankert, doch wieso erreicht dieses Glück nicht auch jeder US-Bürger?
Ein weiterer Punkt im sozialstrukturellen Gefüge der Vereinigten Staaten von Amerika ist die Religion. Sie nimmt in den Staaten einen ganz anderen Stellenwert ein als in Deutschland oder anderen Nationen der Welt – einen sehr großen. Ebenso wie verschiedene ethnische Gruppierungen ins Land kamen, so brachten diese natürlich auch ihre jeweiligen Kulturen und dadurch auch Glaubensrichtungen mit. In Kapitel 3.3 wird geschildert, wer in den USA an was glaubt, welches die größte Religionsgemeinschaft ist, welche Abspaltungen es gibt.
Das Hauptkapitel 4 vereint schließlich die sozialstrukturellen Muster der USA mit denen in Springfield. Springfield: der allgegenwärtige Schau- und Handlungsplatz bei „Die Simpsons”, Wohnort von Monty Burns, Moe, Flanders, Marge Simpson und ihrer Familie. Eine Stadt inmitten von Bergen, einem See, einem Fluss, vieler kleinerer und größerer Unternehmen, dem Flughafen und einer Vielzahl von Apartment- und Wohnhäusern.
Kapitel 4.1 wird etwas fernab sozialstruktureller Prozesse behandelt und dient der Untersuchung, ob Springfield wirklich als die oft benannte Kleinstadt identifiziert werden kann. Es wird eine Studie herangezogen, die helfen soll, dies zu ergründen. Kapitel 4.2 widmet sich schließlich der Sozialstruktur im Bereich der demografischen Prozesse. Einwohnerzahlen finden Erwähnung und etwas unorthodoxere Demografie-Themenbereiche wie Gewicht der Bevölkerung, Essgewohnheiten und Fernsehkonsum. Die in Kapitel 3.1.2 erläuterten Fragen ethnischer Zugehörigkeiten der US-Bevölkerung werden in 4.3 erneut aufgegriffen und anhand von Springfield verdeutlicht. Hier gilt es die Frage zu beantworten, ob Springfield sich ebenso multiethnisch darstellt wie dies auf die USA zutrifft. Kapitel 4.4 bearbeitet den großen Komplex sozialer Ungleichheit mit den Feldern Einkommen und Armut (4.4.1), Bildungsungleichheiten (4.4.2) sowie Beruf und Erwerbstätigkeit (4.4.3) noch einmal für Springfield. Zum Schluss dieses Teilkapitels wird aus diesen bisherigen Informationen zu sozialer Ungleichheit in Springfield ein Klassenmodell nach dem in Kapitel 3.2 vorgestellten „six-class model of the United States using income, occupational, and educationael criteria” von Gilbert und Kahl (1987) erstellt (Hurst 1995, Seite 14). Kapitel 4.5 widmet sich dem in den Vereinigten Staaten so wichtigem Bereich der Religionen und Sekten. Auch in Springfield finden diese häufig Erwähnung, ob es sich hierbei um Abspaltungen der christlichen Kirchen oder die Amish-Sekte handelt.
Zum Schluss folgt ein Fazit über die gewonnenen Resultate und ein Ausblick auf vielleicht zukünftige Forschungen.
—————————
1 Originaltitel: Cruel Intentions, 1999
2 US-amerikanische TV-Dramaserie, Originaltitel: 7th Heaven, 1996-2007
3 gespielt von Will Smith; 2006
4 2,2 Kinder sind es wohl laut Jörg C. Kachel und den Daten der US-Regierung. Die Simpsons als typisch durchschnittliche, amerikanische Familie (vgl. Ka chel, in: Gruteser et alter 2002, Seite 168).
5 “THE SIMPSONS is a Gracie Films Production in association with 20th Century Fox Television“ (Quelle: http://thesimpsons.com/about/)
6 zusammen mit James L. Brooks und Al Jean
2 Die Simpsons
In diesem Kapitel wird die Fernsehserie „Die Simpsons“ genauer betrachtet. Der „Macher“ des Primetime-Krachers, Matt Groening, wird kurz biografisch vorgestellt, die Idee der Simpsons erläutert und die Hauptcharaktere dargestellt. Es wird auch auf andere Persönlichkeiten eingegangen, die für die Serie, aber vor allem auch für diese Arbeit von Bedeutung sind und Hinweise auf die Sozialstruktur geben, die in Kapitel 4 genauer vorgestellt wird.
2.1 Matt Groening
Matthew Abram Groening wurde am 15. Februar 1954 in Portland im Staate Oregon/USA geboren. Seine Mutter – eine Lehrerin – ist Norwegerin, die Familie seines Vaters, der ebenfalls Produzent, allerdings für Filme, ist, stammt aus Deutschland. Laut dem Simpsons-Macher sind diese beiden Länder die humorlosesten von allen (vgl. Der Spiegel, 27/2007).
In Oregon gibt es ein Springfield, von dem Groening auch zugibt, dass er es als Inspiration für „Die Simpsons“ genutzt habe:
„Das war für mich als Kind die einzige Stadt in meiner Nähe. Es gab damals die Fernsehserie „Father Knows Best”, die in Springfield spielt. Das fand ich sehr aufregend. Als ich dann meine eigene Fernsehserie machen durfte, ließ ich sie auch in Springfield spielen.”
(Focus Online)
Nicht nur für den Handlungsschauplatz holte sich Groening Hilfe aus unmittelbarer Nähe, auch die Namen der Hauptcharaktere entstammen denen seiner eigenen Angehörigen: Der Trickfilmmacher hat Schwestern namens Lisa und Maggie, seine Mutter heißt Margaret7, sein Vater Homer und sein Großvater Abraham Groening. Der Name Bart fehlt in der Auflistung, aber Groening brauchte auch einen Namen für den kleinen Raufbold und Spaßmacher, der der Persönlichkeit seines Neffen entsprechen sollte, und wollte nicht seinen eigenen verwenden. Er entschied sich für Bart, da dies ein Anagramm für „Brat“ ist, was im Deutschen so viel wie Gör oder Balg bedeutet. Auch Groenings Kinder haben Namen, bei denen es nahe liegt, auf diesen Einfluss zu schließen. Sie heißen Homer und Abe.
Der amerikanische Cartoonist und Produzent gewann mit seiner Serie zehn Primetime Emmy Awards, unter anderem für die beste Zeichentrickserie (vgl. Microsoft Encarta Online-Enzyklopädie: Matt Groening), ebenso einen British Comedy Award in 2004.
Des Weiteren ist Groening bekannt durch seine Zeichentrickserie „Futurama“ und durch den Comic-Strip „Life in Hell”8, durch den schließlich James L. Brooks auf den Cartoonist aufmerksam wurde und ihm anbot, Kurzfilme mit vollkommen neuer, dynamischer Idee für die Tracey-Ullman-Show zu zeichnen: Die Simpsons entstanden. Die dort gezeigten „Shorts“ wurden ausgebaut und von Groening selbst, James L. Brooks und Sam Simon weiterentwickelt.
Der gewitzte Matt hat sich selbst natürlich auch als Charakter bei den Simpsons gezeichnet, ebenso wie viele andere Stars, darunter Bill Clinton, George Bush, Arnold Schwarzenegger, die Popgruppe *N Sync oder Britney Spears.
2.2 Die TV-Serie
Dem Einfluss des Fernsehens kann sich in der heutigen Zeit und beim derzeitigen Stand der Technisierung wohl kaum ein Mensch entziehen. Spielfilme, Quiz-Shows, Soaps und Serien, Reportagen, Nachrichten. Für jeden ist etwas dabei. Wurde bisher partiell angenommen, Zeichentrickserien seien nur für Kinder, so ist dies ein Irrtum. Natürlich dienen sie mehr als andere TV-Formate der seichten Unterhaltung der jüngsten Fernsehzuschauer, aber es gibt zumindest eine Serie, deren Ansprüche wahrscheinlich höher liegen als vielleicht vermutet wird: „Die Simpsons”. Wer kennt sie nicht – die gelbste aller Fernsehfamilien – und ihre Geschichten und Abenteuer, die in über 70 Ländern der Welt ausgestrahlt werden (vgl. simpsonsmania.de). Seit nunmehr 22 Jahren flimmern sie über die Bildschirme und sind in Deutschland fester Bestandteil der Fernsehlandschaft ProSieben.
Ihren Start hatten die Simpsons in der US-Comedy-Show von Tracey Ullman, in der erstmalig die Simpsons-Kurzepisoden zu sehen waren. Bei Ullman gingen diese „Shorts“ am 19. April 1987 auf Sendung. Im Jahr 1989 hat der Sender Fox Network diese kurzen Folgen zu einer Serie ausgebaut, die seit dem 17. Dezember schließlich im Wochenrhythmus zu sehen waren. Start der Serie in Deutschland war am 28. Februar 1991 auf Premiere, ZDF strahlte die Sendung ab dem 13. September desselben Jahres aus, bis sie ProSieben letztlich 1994 übernahm (vgl. Wikipedia.org: Die Simpsons). Dort ist der „gelbe Wahnsinn“ noch heute zu sehen, nicht mehr wöchentlich, sondern täglich mit je zwei (18:10 Uhr bis 19:10 Uhr), teilweise sogar sechs Episoden (18:10 Uhr bis 19:10 Uhr und 20:15 Uhr bis 22:15 Uhr). Zur Primetime 20:15 Uhr läuft die Serie meist dann, wenn eine neue Staffel beginnt und neue Folgen gezeigt werden.
Familie Simpson wohnt in der Stadt Springfield in einem Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika. Matt Groening, der Schöpfer der Simpsons, hat den Namen „Springfield“ nicht nur gewählt, weil dieser der am häufigsten vorkommende Städtename in den USA ist9, sicher aber aus den Gründen, die bereits im ersten Kapitel benannt wurden. Springfield hat alles, was der Mensch zum Leben braucht, und was man von einer Stadt erwartet: Straßen, Parks, einen Fluss, das Meer mit einem Strand, hohe Berge, Wohnhäuser im Stil der typisch amerikanischen Vorstadt, aber auch ein Rathaus, Bildungs- und Sporteinrichtungen, ein Krankenhaus, Einkaufscenter, ein Kino, viele kleine und große Unternehmen.
Gegründet wurde Springfield von Jebediah Obadiah Zachariah Jebediah Springfield (Bart köpft Ober-Haupt, I/8), der mit ursprünglichem Namen Hans Sprungfeld heißt und zuvor als Pirat sein Dasein fristete. Er versuchte sogar George Washington zu ermorden, um seinen Reichtum mit dessen Geld zu mehren (Das geheime Bekenntnis, III/13). Er zog los mit Shelbyville Manhattan, um mit ihm zusammen eine Stadt zu gründen. Als die Situation eskalierte, da Shelbyville das Heiraten von Cousinen in seiner Stadt erlauben wollte, entschlossen sie sich, dass jeder seine eigene Stadt gründe. Zeitlich lässt sich dies auf das Jahr 1796 verorten als einige Pilger Maryland verließen, um in den USA ein neues Leben zu beginnen (Auf zum Zitronenbaum, VI/24). Im Jahr 1838 kam Jebediah in den Westen10, dort tötete er einen Bären mit bloßen Händen. Diese Legende erzählen die Springfielder gern und oft. Jebediah Springfield hat die Stadt ihr erstes Krankenhaus zu verdanken, das der Stadtgründer aus Holz und Lehm baute. Im Zentrum der Stadt steht eine große Statue dieses Mannes, die den Bürgern sehr viel bedeutet. So sagt Lisa über diese:
„Es ist ein Symbol dafür, dass wir alles erreichen können, was wir nur wollen.“
(Bart köpft Ober-Haupt, I/8)
Die Einwohnerzahl der Stadt beträgt 30.720 (Sicherheitsdienst „Springshield”, XIII/22).
In vielen Episoden gibt es Anspielungen auf die oft gestellte Frage, in welchem Staat das Springfield der Simpsons wohl liegen mag. Doch es wird wohl immer ein Mysterium bleiben, denn die Angaben widersprechen sich von Folge zu Folge. Mal steht jemand vor der Landkarte, mal wird jemand unterbrochen oder es taucht plötzlich ein undurchdringbarer Lärm auf. Matt Groening macht das mit stetiger Absicht, vermutlich um zu zeigen, dass „sein“ Springfield eben eine fiktive Stadt ist. Fiktiv vielleicht vom Namen her und der Lage, aber sicher nicht fiktiv in Struktur und Geschehnissen – so die These dieses Buches.
Die Simpsons bestehen aus Hausherr Homer, seiner Frau Marge sowie den Kindern Bart, Lisa und Maggie. Diese fünf bilden die Hauptcharaktere, die im nächsten Abschnitt noch genauer vorgestellt werden (Kapitel 2.3.1). Diese Familie ist alles andere als perfekt. Vor allem Homer Simpson ist nicht der Klügste und tappt daher oft in Fettnäpfchen. Die Serie versucht beispielsweise zu zeigen, wie Homer in diese Probleme gerät und wie er meist mit Hilfe seiner Frau Marge oder auch der Kinder, vor allem Lisa, wieder heraus kommt. Aber die anderen Familienmitglieder sowie auch deren Freunde kommen nicht zu kurz in Bezug auf Geschichten rund um die Grundschule von Springfield, Maggies Nichtsprechen-wollen, Marges Vorstellungen für ihre Zukunft, Barts zahlreichen Streichen oder Lisas vielfältigen Interessen. Es wird ein Springfield gezeigt voll von verschiedensten Charakteren und Individuen, voller Spaß und Spannung – die Gründe, warum das Zusehen dabei nie langweilig wird.
2.3 Charaktere und Eingangssequenz der Comicserie
Bei „Die Simpsons“ gibt es eine Vielzahl unterschiedlichster Charaktere und Persönlichkeiten. Die wichtigsten werden im Folgenden kurz vorgestellt. Außerdem wird auf einige Nebenrollen eingegangen, die für die Begründung der von mir gestellten Frage von Bedeutung sein werden.
Ein Merkmal der Serie ist, dass es zwar ab und an Geburtstagsfeiern gibt, aber keiner der Charaktere wirklich altert11. Das Alter variiert allerdings von Folge zu Folge.
Bevor auf die Charaktere der Hauptprotagonisten (Kapitel 2.3.1) sowie deren Freunde und Bekannte (Kapitel 2.3.2) eingegangen wird, folgt erst einmal eine Erläuterung und Interpretation der Eingangssequenz der Serie.
Die Eingangssequenz
Fast jede Serie hat sie: eine Titelmelodie, die zu Beginn jeder Folge zu hören ist, teils auch mittendrin sowie am Ende jeder Episode. Im Fall von „Die Simpsons“ ist dies das inzwischen weltweit bekannte Theme von Danny Elfman, der auch die Titelmelodien von Sendungen wie „Desperate Housewives“ oder der „Batman”-Zeichentrickserie komponierte.





























