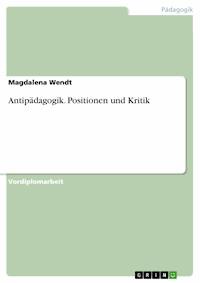39,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2007
Diplomarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich Pädagogik - Heilpädagogik, Sonderpädagogik, Note: 2,00, Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (Fachbereich Erziehungswissenschaften), Sprache: Deutsch, Abstract: In dieser Diplomarbeit soll es um eine Methode gehen, die in Schweden für die praktische Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung entwickelt wurde. Diese Methode heißt SIVUS-Methode und ist in verschiedenen Länder bereits sehr populär geworden. In Schweden, Österreich und der Schweiz, um nur einige zu nennen, wird diese Methode in vielen Einrichtungen der Behindertenhilfe verwendet. In Deutschland dagegen ist SIVUS bislang erst sehr selten anzutreffen. Mögliche Gründe dafür versuche ich später in dieser Arbeit herauszuarbeiten. Zu Beginn der Arbeit werde ich kurz die Entwicklung der Behindertenarbeit darstellen. Dabei soll besonders der Paradigmenwechsel in den letzten Jahren von der Verwahrung, über Förderung hin zur Selbstbestimmung näher erläutert werden. Danach werde ich das von THEUNISSEN und PLAUTE vertretene Empowerment-Konzept behandeln, das wichtige theoretische Impulse für die Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung setzt. Im Hauptteil soll es dann ausführlich um die SIVUS-Methode gehen. Dabei werde ich auf die grundlegenden Gedanken wie Menschenbild und Zielsetzung und auf die Arbeitsmethode eingehen. Im Anschluss an diese theoretischen Aussagen werde ich dann die SIVUS-Methode in Verbindung mit relevanten Themen erörtern. Im letzten Teil der Arbeit geht es schließlich um eine von mir durchgeführte Befragung von Personen, die in Deutschland mit SIVUS arbeiten oder gearbeitet haben. Ziel dieser Befragung soll sein, mögliche Schwierigkeiten, Probleme und Grenzen in der Arbeit mit SIVUS zu thematisieren, da bereits erschienene Erfahrungsberichte oftmals besonders die positiven Seiten und die Erfolge darstellen. Damit soll ein realistisches Bild von SIVUS erstellt werden. Weiter beschäftige ich mich in der Befragung mit der Frage, warum SIVUS in Deutschland so unbekannt ist und ob es hier eventuell Bedingungen gibt, die diese Arbeit behindern. In meiner Diplomarbeit habe ich mich auf die Betrachtung von erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung beschränkt. Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen soll dabei jedoch nicht geringgeschätzt werden. Aber die zusätzliche Bearbeitung unter diesem Gesichtspunkt hätte vermutlich den Rahmen der Arbeit gesprengt. Die Ausführungen in den Fachbüchern haben sich ebenfalls oft auf erwachsene Menschen beschränkt. Auch meine bisherigen praktischen Erfahrungen habe ich hauptsächlich mit erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung gesammelt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Inhalt
1. Einleitung
2. Von der Verwahrung zur Selbstbestimmung
2.1. Psychiatrische Anstalten – Orte der Verwahrung
2.2. Enthospitalisierung
2.2.1. Formale und inhaltliche Aspekte
2.2.2. Erfolge und Probleme
2.2.3. Kritik an gemeindeintegriertem Wohnen
2.3. Das Normalisierungsprinzip
2.3.1. Entwicklung in Skandinavien und in den USA
2.3.2. Umsetzung in Deutschland
2.4. Integration
2.5. Selbstbestimmung
3. Das Empowerment-Konzept
3.1. Begriffliche Auseinandersetzung
3.2. Geschichtliche Entwicklung
3.3. Menschenbild – Leitlinien – Wertebasis
3.3.1. Selbstbestimmung
3.3.2. Kollaborative und demokratische Partizipation
3.3.3. Verteilungsgerechtigkeit
3.4. Die Rolle der professionellen Helfer
3.5. Self Advocacy
4. Die SIVUS-Methode als Instrument von Empowerment
4.1. Die Entstehungsgeschichte der SIVUS-Methode
4.2. Grundlagen der SIVUS-Methode
4.2.1. Das Menschenbild nach SIVUS
4.2.2. Die Rolle der Begleiter
4.2.3. Die Zielsetzungen
4.2.4. Der individuelle und soziale Reifungsprozess
4.2.4.1. Die vier grundlegenden Fähigkeiten
4.2.4.2. Die zwei Dimensionen des sozialen Reifens
4.2.5. Arbeitsorganisation
4.3. SIVUS und Kommunikation
4.4. SIVUS im Bereich der Arbeit
4.5. SIVUS im Wohnbereich
4.6. SIVUS im Bereich Freizeit und Erwachsenenbildung
4.7. SIVUS bei Menschen mit intensiver geistiger Behinderung
4.8. SIVUS als Mittel zur Qualitätssicherung
5. Empirischer Teil
5.1. Gegenstand der Studie und zentrale Fragestellungen
5.2. Die Forschungsmethode
5.3. Auswahl der Interviewpartner
5.4. Vorbereitung und Durchführung der Interviews
5.5. Auswertung der Interviews
6. Abschließende Gedanken
7. Literatur
Anhang 1: SIVUS Schaubild
Anhang 2: Übersicht über die Individualebene
Anhang 3: Übersicht über die Paarebene
Anhang 4: Übersicht über die Gruppenebene
Anhang 5: Übersicht über die Intergruppenebene
Anhang 6: Übersicht über die Gesellschaftsebene
Anhang 7: SIVUS-Einschätzungsbogen
Anhang 8: Stützmodell für Verhaltensbesonderheiten
Anhang 10: Transkripte der Interviews
1. Einleitung
Man hilft den Menschen nicht,
wenn man für sie tut,
was sie selbst tun können.
Abraham Lincoln
In den letzten Jahrzehnten hat sich die Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung immer wieder stark verändert. Während diese früher von Verwahrung, Wegschließen, Fremdbestimmung und Inhumanität geprägt war, wurden in den letzten Jahren zunehmend Stimmen laut, die Normalisierung und Selbstbestimmung forderten. Seit Kurzem sind diese Stimmen auch direkt von Betroffenen zu hören, die nicht länger unter diesen fremdbestimmten Bedingungen leben wollen. Sie wollen nicht länger in Abhängigkeit von anderen Menschen leben. Einige haben diese neuen Möglichkeiten bereits für sich erkannt, sehr viele sind jedoch noch nicht in diese Prozesse eingetreten. Dieses neue Paradigma der Selbstbestimmung wurde mittlerweile auch von Theoretikern, Wissenschaftlern und auch von den professionellen Begleitern der Betroffenen anerkannt. So sind in den letzten Jahren Konzepte entstanden, die auf die Selbstbestimmung von Betroffenen aufbauen, diese fördern und Menschen bei dem Eintreten in solche Prozesse helfen und begleiten wollen. Solch ein Konzept stellt beispielsweise das Empowerment-Konzept dar.
Da die Entwicklung der Behindertenarbeit in anderen westlichen Industrienationen teilweise sehr viel fortgeschrittener ist als in Deutschland, stammen solche Konzepte meist aus dem Ausland. So hat das Normalisierungsprinzip seinen Ursprung in Skandinavien, das Empowerment-Konzept stammt aus den USA.
In dieser Diplomarbeit soll es um eine Methode gehen, die in Schweden für die praktische Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung entwickelt wurde. Diese Methode heißt SIVUS-Methode und ist in verschiedenen Länder bereits sehr populär geworden. In Schweden, Österreich und der Schweiz, um nur einige zu nennen, wird diese Methode in vielen Einrichtungen der Behindertenhilfe verwendet. In Deutschland dagegen ist SIVUS bislang erst sehr selten anzutreffen. Mögliche Gründe dafür versuche ich später in dieser Arbeit herauszuarbeiten.
Zu Beginn der Arbeit werde ich kurz die Entwicklung der Behindertenarbeit darstellen. Dabei soll besonders der Paradigmenwechsel in den letzten Jahren von der Verwahrung, über Förderung hin zur Selbstbestimmung näher erläutert werden. Danach werde ich das von THEUNISSEN und PLAUTE vertretene Empowerment-Konzept behandeln, das wichtige theoretische Impulse für die Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung setzt. Im Hauptteil soll es dann ausführlich um die SIVUS-Methode gehen. Dabei werde ich auf die grundlegenden Gedanken wie Menschenbild und Zielsetzung und auf die Arbeitsmethode eingehen. Im Anschluss an diese theoretischen Aussagen werde ich dann die SIVUS-Methode in Verbindung mit relevanten Themen erörtern. Im letzten Teil der Arbeit geht es schließlich um eine von mir durchgeführte Befragung von Personen, die in Deutschland mit SIVUS arbeiten oder gearbeitet haben. Ziel dieser Befragung soll sein, mögliche Schwierigkeiten, Probleme und Grenzen in der Arbeit mit SIVUS zu thematisieren, da bereits erschienene Erfahrungsberichte oftmals besonders die positiven Seiten und die Erfolge darstellen. Damit soll ein realistisches Bild von SIVUS erstellt werden. Weiter beschäftige ich mich in der Befragung mit der Frage, warum SIVUS in Deutschland so unbekannt ist und ob es hier eventuell Bedingungen gibt, die diese Arbeit behindern.
Für die Bearbeitung dieses Themas habe ich auf Bücher und Hefte des SIVUS Fördervereins in Österreich zurückgegriffen, da mir die Literatur über SIVUS in Deutschland nicht ausreichend für die Bearbeitung erschien. Die Materialien des SIVUS Vereines enthalten teilweise keine Jahres- oder Seitenangaben. Ich habe trotzdem daraus zitiert, die Kennzeichnung ist aufgrund dieses Fehlens aber zum Teil unvollständig. Ich habe dann mitunter statt der Seitenzahlen nur die Kapitel angeben können.
In meiner Diplomarbeit habe ich mich auf die Betrachtung von erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung beschränkt. Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen soll dabei jedoch nicht geringgeschätzt werden. Aber die zusätzliche Bearbeitung unter diesem Gesichtspunkt hätte vermutlich den Rahmen der Arbeit gesprengt. Die Ausführungen in den Fachbüchern haben sich ebenfalls oft auf erwachsene Menschen beschränkt. Auch meine bisherigen praktischen Erfahrungen habe ich hauptsächlich mit erwachsenen Menschen mit geistiger Behinderung gesammelt.
2. Von der Verwahrung zur Selbstbestimmung
Im Folgenden soll es in einem geschichtlichen Rückblick um die Situation von Menschen mit geistiger Behinderung nach dem zweiten Weltkrieg gehen. Natürlich gibt es Behinderungen nicht erst seit 1945. Mein Hauptaugenmerk liegt jedoch in der Beschreibung der Paradigmenwechsel von der Verwahrung über die Förderung bis hin zur Selbstbestimmung von Menschen mit geistiger Behinderung. Daher werde ich die Entwicklungen bis zum zweiten Weltkrieg sehr kurz darlegen. Ausführlicher werden diese z.B. bei MÖCKEL (1988) und bei SOLAROVA (1983) dargestellt.
Menschen mit Behinderung gab es zu allen Zeiten und in allen Kulturen. Die Bezeichnungen für diese Menschen waren über die Jahre jedoch sehr unterschiedlich (Idioten, Wechselbälger, Blödsinnige, Seelenlose, Schwachsinnige u.a.) und auch die Auffassung, wer zu diesem Personenkreis gehörte, war nicht immer einheitlich. So wurden u.a. auch kranke, faule, kriminelle und körperlich eingeschränkte Menschen zu diesen Personen gerechnet. Die Behandlung dieser Menschen war über Jahrhunderte hinweg jedoch sehr ähnlich. Sie galten als nutzlos, wertlos und nichtmenschlich und so wurden sie entweder gleich getötet oder sie lebten in Verfolgung und Missachtung (vgl. THEUNISSEN 1999, S.18ff).
Erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts änderte sich diese Einstellung. Mit dem Beginn der Entwicklung der Psychiatrie in dieser Zeit entstanden erste Ansätze und Konzepte, die die Erziehung dieser Menschen in Betracht zogen. So erschienen die ersten Erziehungsanstalten, in denen diese Menschen erstmals Unterrichtsangebote erhielten. Dennoch waren körperliche Züchtigungen, Gewalt und Zwangsmaßnahmen in den Anstalten Normalität (vgl. SPECK 1993, S.13ff.; THEUNISSEN 1999, S.21ff.).
Bis zum Beginn des 20. Jahrhundert wurden die Anstalten zunehmend mediziniert und psychiatrisiert. Geistige Behinderung wurde nun als Krankheit angesehen. Ärzte waren daher die „Machthaber“ in den Anstalten und verdrängten so die pädagogischen Prinzipien. Der Gebrauch von Medikamenten stand auf der Tagesordnung (vgl. THEUNISSEN 1999, S.26ff).
Zu Anfang des 20. Jahrhunderts wurden weiterhin zunehmend Stimmen laut, die den vollkommenen, gesunden, schönen und brauchbaren Menschen propagierten. Im gleichen Zuge wurde Menschen mit Behinderungen (aber auch andere z.B. Juden), die dieses Idealbild des Menschen nicht erfüllten, das Recht auf Leben und auf Fortpflanzung abgesprochen und der Ruf nach Euthanasie wurde laut. Diese Bewegung erlebte in der T4-Aktion unter Adolf Hitler ihren Höhepunkt. Traurige Bilanz der Euthanasiemaßnahmen sind Zwangssterilisationen von bis zu 400.000 Menschen und die Tötung von bis zu 100.000 Menschen bis 1945 (vgl. NOWAK 1994, S.21; THEUNISSEN 1999, S.35).
2.1. Psychiatrische Anstalten – Orte der Verwahrung
Der Neubeginn in der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung nach dem Krieg war einerseits geprägt von Armut, Hunger und Spuren der Verwüstung des Kriegs, andererseits schlossen die Pflegeanstalten unreflektiert an die alten Strukturen an. Die Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung wurde weiterhin durch Medizinierung und Medikalisierung bestimmt. Der Mensch mit Behinderung wurde als Patient (und somit als Objekt) betrachtet und wurde bestenfalls gepflegt, nicht aber gefördert (vgl. HÄHNER 1997b, S.26; THEUNISSEN 1999, S. 36ff, 62).
Diese Sichtweise basierte auf einem „biologisch-nihilistischen Menschenbild“ (THEUNISSEN 1999, S.41), welches zumindest Menschen mit schwerer geistiger Behinderung jegliche Lern- und Bildungsfähigkeit absprach und somit den rein pflegerischen Umgang rechtfertigte. Verhaltensauffälligkeiten und psychische Störungen wurden als personelle Merkmale gesehen und nicht als Folge der Behinderung und der Lebensumstände (vgl. auch THEUNISSEN 2001, S.12).
Während Menschen mit schwerer geistiger Behinderung nur auf ihre Pflegebedürftigkeit reduziert wurden, sollten Menschen mit leichter geistiger Behinderung nützliche Arbeit, in Form von Arbeitstherapien, verrichten. Das Ziel war jedoch nicht dem Menschen eine erfüllende Tätigkeit zu bieten. Es ging darum, die vorhandenen Fähigkeiten des Menschen so effektiv wie möglich zu nutzen. Da ein Großteil der schwerbehinderten Menschen solche Fähigkeiten unter den damaligen Lebensumständen nicht entwickeln konnte, waren die meisten nicht in der Lage zu arbeiten (vgl. ebd. S.41ff.). Diesen Menschen wurden jegliche Rechte und Ansprüche aberkannt, da sie für die Gesellschaft keinen Nutzen brachten.
Da es an spezifischen Behinderteneinrichtungen fehlte, war die Unterbringung in psychiatrischen Krankenhäusern die Realität. Die Psychiatrien wurden so ein „Auffangbecken“ (THEUNISSEN 1999, S.62) für die Menschen mit geistiger Behinderung, die nicht mehr zu Hause bei den Eltern leben konnten oder die nicht anderweitig untergebracht werden konnten. In diesen, meist sehr großen Anstalten lebten sie unter oft unmenschlichen Bedingungen, für die GOFFMAN (1972) den Begriff der “totalen Institution“ prägte.
Menschen mit geistiger Behinderung wurden in diesen, meist geschlossenen Anstalten nur verwahrt. Sie waren abgeschieden und isoliert von der Gesellschaft. Auf individuelle Bedürfnisse konnte und wollte man nicht hinreichend Rücksicht nehmen. Starre Hierarchien von oben nach unten (GOFFMAN 1972, S.45) bewirkten sowohl bei Betroffenen, als auch bei Mitarbeitern Entmündigung und Unterdrückung (vgl. THEUNISSEN 1999, S.43f. ; WEINWURM-KRAUSE 1999, S.37). Oft lebten sehr viele Menschen auf kleinem Raum zusammen. Aufgrund dieser äußeren Bedingungen, sowie des depersonalisierten Umgangs mit den Betroffenen, kam es zu zahlreichen Verhaltensauffälligkeiten, die man auch als Hospitalisierungsschäden bezeichnet (vgl. HOFFMANN 1999, S.17f.). Diese verschiedenen Verhaltensauffälligkeiten stellten oftmals einen verzweifelten Versuch dar, sich diesen unwürdigen Lebensbedingungen anzupassen und wenigstens kleine Bereiche von Individualität aufrechtzuerhalten. (vgl. JANTZEN/ SCHNITTKA 2000, S.35f.; auch THEUNISSEN 2000b; THEUNISSEN 2000d).
Dieses Verwahren in „totalen Institutionen“ (GOFFMAN), das Entmündigen von Betroffenen, der Krankenhauscharakter der Anstalten mit den entsprechenden Folgen für die Behandlung der Betroffenen, sowie die gesamte Medizinierung der Betroffenen (da Behinderung als Krankheit galt) bezeichnet man auch als „Psychiatrisches Modell“ (THEUNISSEN 1999, S.45).
Eine Wende in diesem Denken setzte in den 60er Jahren ein. Sie werden auch als „Dekade des Aufbruchs“ (HÄHNER 1997b, S.28) bezeichnet. Das öffentliche und politische Interesse an den Lebensbedingungen von Menschen mit geistiger Behinderung nahm zu.
Bereits 1958 entstand der Elternverband „Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind“ (SPECK 1993, S.30), andere (Eltern)Verbände folgten. Diesen ging es zunächst um die Versorgung von Kindern mit geistiger Behinderung in Kindergärten, Horten und später auch Schulen. So ist es vor allem den Elternverbänden anzurechnen, dass Mitte der 60er Jahre das Schulrecht für Kinder mit geistiger Behinderung gesetzlich verankert wurde (vgl. ebd., S.30f.; HÄHNER 1997b, S.29).
Auch das wissenschaftliche Interesse an geistiger Behinderung nahm zu. Die Medizin verlor ihre Vormachtstellung und die Pädagogik gewann zunehmend an Einfluss. Mitte der 60er Jahre entstand der erste Lehrstuhl der Sonderpädagogik mit dem Schwerpunkt Geistigbehindertenpädagogik in Mainz. Das „biologisch-nihilistische Menschenbild“ (THEUNISSEN) wurde durch ein Bild vom Menschen mit geistiger Behinderung als einem entwicklungsfähigen Individuum ersetzt. Der Mensch mit Behinderung galt nun als förderfähig (vgl. HÄHNER 1997b, S.30).
2.2. Enthospitalisierung[1]
Unter diesem öffentlichen Umdenken und dem Bekanntwerden der Lebensbedingungen in den Psychiatrien, wurde die Kritik an der Verwahrung von Menschen mit geistiger Behinderung in Großeinrichtungen lauter. Entscheidende Impulse gingen 1975 von der Psychiatrie-Enquête aus. Die unwürdigen Lebensbedingungen wurden hier erstmals öffentlich beschrieben. In der Enquête stand weiterhin, dass die Psychiatrie als Lebensort für Menschen mit geistiger Behinderung nicht geeignet ist, da diese keine medizinische, sondern pädagogische Betreuung benötigen. Man sprach hier von Fehlplatzierung. Danach lebten 1975 ca. 18.000 Erwachsene mit geistiger Behinderung in psychiatrischen Krankenhäusern und waren somit fehlplatziert. Daher wurde eine Umsiedlung von Menschen mit geistiger Behinderung aus den Anstalten und Großeinrichtungen in kleinere, gemeindenahe und integrierte Wohnformen vorgeschlagen (vgl. PSYCHIATRIE-ENQUÊTE 1975).
Dieser Prozess der Ausgliederung von Menschen mit geistiger Behinderung aus Großeinrichtungen und Psychiatrien bezeichnet man auch als Enthospitalisierung. Aber auch Stichworte wie Deinstitutionalisierung, Dezentralisierung, Normalisierung, Integration, Regionalisierung, Selbstbestimmung und Empowerment bezeichnen die Entwicklungen der folgenden Jahre. Die Bestrebungen, Menschen mit geistiger Behinderung aus den Anstalten zu holen, gemeindenah unterzubringen und zu fördern, wurden von allen westlichen Industrienationen aufgegriffen (oft weitaus früher als in der BRD) und mehr oder weniger erfolgreich durchgeführt (vgl. HOFFMANN 1999, S.20f.; THEUNISSEN/ LINGG 1999a, S.7f.).
In Deutschland/ BRD wurden die Empfehlungen der Psychiatrie-Enquête zuerst in Nordrhein-Westfalen aufgegriffen. Hier wurden zunächst Heilpädagogische Heime, die humanere Lebensbedingungen boten, geschaffen, um den sehr hohen Anteil der Menschen mit geistiger Behinderung, die in Psychiatrien lebten, auszugliedern. Außerdem wurde sehr viel Wert gelegt auf die Schaffung von Außenwohnungen und Außenwohngruppen, die auch für Menschen mit schwerer geistiger Behinderung Lebensraum boten (dazu BRADL 1996a).
Weiter Reformen fanden in Hessen und Bremen statt, wo durch politische Beschlüsse die Auflösung von Großeinrichtungen (z.B. die Klinik Kloster Blankenburg in Bremen) beschlossen wurde. Auch hier waren Regionalisierung und Dezentralisierung entscheidende Leitlinien (dazu SCHILLER 1996).
In anderen Bundesländern dagegen ging man erst sehr viel später und zögerlicher auf die Empfehlungen ein. Der Prozess der Enthospitalisierung ist in Deutschland auch heute noch lange nicht abgeschlossen (vgl. THEUNISSEN 1996, S.69; THEUNISSEN 1999, S.63).
2.2.1. Formale und inhaltliche Aspekte
Man kann Enthospitalisierungsbestrebungen in formaler und inhaltlicher Hinsicht betrachten. Diese Aufteilung lässt sich jedoch nur theoretisch vornehmen. In der Praxis sind sie nicht zu trennen (vgl. HOFFMANN 1999, S.20).
Bislang wurde nur die formale Seite von Enthospitalisierung betrachtet. Dazu gehören bauliche Veränderungen bestehender Einrichtungen, Auszug in kleinere Wohneinheiten, Dezentralisierung und Regionalisierung, räumliche Integration, gemeindenahe, häusliche Wohnformen, Selbstversorgung; sprich alle Maßnahmen die getroffen, werden um die objektiven und äußeren Lebensbedingungen zu humanisieren (vgl.ebd.,S.20f.).
Doch Enthospitalisierung wäre unvollständig, wenn nicht auch die inhaltlichen Aspekte berücksichtig und umgesetzt würden. Zu diesen zählen u.a. Anerkennung des Menschen mit geistiger Behinderung und Respektierung seiner Wünsche und Bedürfnisse, soziale und gesellschaftliche Integration, Selbstbestimmung, Normalisierung, Begleitung des Menschen in dem Umfang, wie es nötig ist, umfassende Hilfen bei Bedarf, Entscheidungsfreiheit und psychosoziale Angebote[2] (vgl. ebd., S.21). Dies sind Aspekte, die eine angemessene Begleitung der Menschen mit geistiger Behinderung vor, während und nach dem Aus-/ Umzug beinhalten sollte.
2.2.2. Erfolge und Probleme
Die weltweit zahlreichen Enthospitalisierungsprozesse haben eindeutig positive Ergebnisse gezeigt, teilweise traten jedoch auch erhebliche Probleme auf. Dabei ist allerdings festzustellen, dass die Ergebnisse in den verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich ausfielen. Das lag zum Großteil daran, wie man formale und inhaltliche Aspekte der Enthospitalisierung umgesetzt und miteinander verbunden hat. Zahlreichen Schriften belegen und diskutieren die verschiedenen Ergebnisse (z.B. BRADL/ STEINHART 1996, THEUNISSEN 1998a, THEUNISSEN 1999, THEUNISSEN/ LINGG 1999b). Im Folgenden sollen nur einige wichtige Ergebnisse dargestellt werden.
Positiv ist zunächst zu nennen, dass viele fehlplatzierte Menschen aus der Psychiatrie ausgegliedert wurden. Dabei entstanden neue (z.T. wieder sehr große) Wohnheime, aber auch zahlreiche Außenwohngruppen und Außenwohnungen. Diese boten den betroffenen Menschen zumeist eindeutig bessere äußere Lebensbedingungen, als es in den Psychiatrien der Fall war. Die Anzahl der Menschen, die zusammenlebten war sehr viel geringer. Auch die Strukturen der vollkommenen Fremdbestimmung in den Psychiatrien konnten hier endlich aufgebrochen werden. Dieser Prozess wurde aber nicht in allen Einrichtungen und in allen Ländern erfolgreich vollzogen. Hier entstanden z.T. große Probleme mit oft schwerwiegenden Folgen für die Betroffenen.
In vielen Ländern konnten eher die Menschen mit leichter geistiger Behinderung von einem Umzug in kleine, gemeindeintegrierte Wohnformen profitierten. Da der Betreuungsschlüssel in diesen Wohnformen meist geringer war, verblieben viele Menschen mit schwerer geistiger Behinderung und starken Verhaltensauffälligkeiten in großen Einrichtungen. Die Begründung war hier, dass diese Menschen einen so großen Hilfebedarf haben, der in den kleinen Wohnformen nicht abgesichert werden könne. So wurden die Großeinrichtungen mit der Zeit zu einem Sammelbecken für schwerbehinderte und stark verhaltensauffällige Menschen. Durch die Massierung dieser Menschen wurde es natürlich immer schwieriger, individuelle Bedürfnisse zu befriedigen und entwicklungsfördernde Bedingungen zu schaffen. Man spricht hier vom Prozess der Umhospitalisierung. Die Menschen werden zwar aus der Psychiatrie ausgegliedert, leben in den neuen Einrichtungen, aber unter ähnlich hospitalisierenden Bedingungen. Hier waren meist weder formale, noch inhaltliche Aspekte der Enthospitalisierung umgesetzt (vgl. HOFFMANN 1999, S.21ff.).
Doch diese Umhospitalisierung fand nicht nur in neuen Großeinrichtungen statt. Auch in den kleinen Wohnformen gab es zahlreiche Faktoren, die eine Umhospitalisierung ermöglichten. Zu nennen sind hier u.a. Mitarbeiter, Nachbarn, sowie die gesamten Umgebung in der die Menschen lebten. Das Problem war hier eher die fehlende Umsetzung der inhaltlichen Aspekte von Enthospitalisierung.
Viele (z.T. langjährige) Mitarbeiter sind zusammen mit den Betroffenen aus den Psychiatrien ausgezogen und in kleine Wohnformen gewechselt. Damit verbesserten sich zwar die äußeren Lebensbedingungen, der Umgang der Mitarbeiter mit Bewohnern blieb jedoch oft derselbe. Das bedeutete, dass der Alltag auch weiterhin von den Launen der Mitarbeiter und von Fremdbestimmung geprägt war. Es fiel den Mitarbeitern oft sehr schwer, sich von den alten Umgangsformen zu lösen. Viele wollten das auch gar nicht, denn schließlich hatten sich die alten Konzepte über viele Jahre hinweg bewährt. So musste erst ein Umdenken bei den Mitarbeitern stattfinden. Sie waren es nicht gewöhnt, Menschen mit geistiger Behinderung nach ihrer Meinung und nach ihren Bedürfnissen zu fragen und diese dann auch noch zu berücksichtigen. Den meisten Bewohnern wurde diese Selbstbestimmung auch gar nicht zugetraut. Fehlende Fort- und Weiterbildungen, sowie ungenügende Supervisionen waren oft der Grund für Ratlosigkeit der Mitarbeiter und das Verbleiben in den alten Strukturen (vgl. FRAENKEL 1996; THEUNISSEN 1999, S.65).
Ein großes Problem bei der sozialen Integration der Bewohner stellten Nachbarn und das weitere Umfeld dar. Da viele Menschen mit geistiger Behinderung sowohl in ihrem Aussehen als auch in ihrem Verhalten von der Norm abweichen, wollen viele „Nichtbehinderte“ nichts mit ihnen zu tun haben. Sie empfinden es als eine Zumutung, dass diese Menschen in Zukunft in „normalen“ Wohnvierteln leben sollen/ wollen. Menschen mit geistiger Behinderung werden darum häufig diskriminiert und von der Öffentlichkeit ausgeschlossen (vgl. SEIFERT 2000). Viele Bewohner wurden so sozial isoliert und verunsichert. Hilfen von der Bevölkerung bei alltäglichen Problemen konnten diese in der Regel nicht erwarten.
Darum ist der Aufbau eines regionalen Verbundsystems, welches gemeindenahe Hilfe und Unterstützung absichert, ein wesentlicher Punkt, wenn Enthospitalisierung gelingen soll. Dazu gehören u.a. das Angebot von verschiedenen Wohnformen, familienentlastende Hilfe, mobile Pflegedienste, schulische Angebote und Bildungs- und Freizeitangebote (vgl. THEUNISSEN 1997, S. 114ff.; THEUNISSEN 1999, S.66ff.).
2.2.3. Kritik an gemeindeintegriertem Wohnen
Anfang der 90er Jahre häuften sich Kritiken an gemeindeintegriertem Wohnen in den USA, Großbritannien und in Norwegen. In verschiedenen Untersuchungen stellte sich heraus, dass sich bei vielen Bewohnern dieser Wohnformen die Lebensqualität verschlechtert hatte. Sie lebten sozial isoliert und hatten kaum Kontakte zur Außenwelt. Teilweise war es wegen der mangelnden Unterstützung und Begleitung durch Betreuer sogar zu Sterbefällen gekommen. Das führte dazu, dass das gemeindeintegrierte Wohnen für Menschen mit geistiger Behinderung in Frage gestellt wurde (vgl. DALFERTH 1999, S.92ff.).
Als positives Beispiel lässt sich dagegen Schweden anführen. Hier wurden den Bewohnern verschiedene Hilfen und Assistenzen, die ihren Bedürfnissen entsprachen gesetzlich zugesichert. Enthospitalisierung fand hier sehr erfolgreich statt und belegt so, dass gemeindenahe Wohnformen sehr wohl für diese Menschen geeignet sind, wenn sie entsprechende Unterstützung erfahren. (vgl. ebd., S.100ff.)
Ausschlaggebend für eine verbesserte Lebensqualität sind also nicht allein die verbesserten äußeren Lebensumstände. Entscheidend ist die entsprechende individuelle Begleitung der Menschen nach dem Umzug.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass Enthospitalisierung z.T. sehr erfolgreich, oft jedoch nur auf formaler Ebene vollzogen wurde. In vielen Fällen fand lediglich Umhospitalisierung statt. Menschen mit geistiger Behinderung wurden zwar aus den Psychiatrien ausgegliedert, jedoch wurde vielen entscheidende bedürfnisgerechte Hilfe nicht zuteil.
Auf Grund dieser Entwicklungen wurden in den folgenden Jahren neben Regionalisierung, Dezentralisierung und Deinstitutionalisierung (die alle eher auf äußere Lebensbedingungen abzielen), stärker Leitprinzipien wie Normalisierung, Integration, Selbstbestimmung und Empowerment in der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung betont. Diese sollen nun im Folgenden näher erläutert werden.
2.3. Das Normalisierungsprinzip
2.3.1. Entwicklung in Skandinavien und in den USA
Der Ursprung des Normalisierungsprinzips geht zurück bis ins Jahr 1943 (in dieser Zeit wurden Menschen mit Behinderung in Deutschland im Zuge der Euthanasie noch legal getötet). In diesem Jahr wurde in Schweden ein Regierungsausschuss beauftragt, geeignete Hilfen für die Eingliederung von Menschen mit geistiger Behinderung oder „Teil-Leistungsfähigen“ (ERICSSON 1986, S.33) ins Arbeitsleben zu diskutieren. Die richtungsweisende Leitlinie, die dort entwickelt wurde, nannte man „das Normalisierungsprinzip“ (vgl. ebd.).
Bereits 1959 fand diese Diskussion ihre erste Verankerung im dänischen Gesetz. Ziel war es, „dem geistig Behinderten ein so normales Leben wie möglich zu gestatten“ (dänisches Gesetz Nr.192, zitiert nach LABRÉGÈRE 1986, S.64.).
In den 60er und 70er Jahren formulierten BANK-MIKKELSEN und NIRJE, die Väter des Prinzips, dieses weiter aus. So verdeutlichte der dänische Jurist BANK MIKKELSEN: „Es ist das Ziel, geistig Behinderten zu einem normalen Dasein zu verhelfen, das heißt, sie mit Hilfen jeglicher Art zu unterstützen und möglichst vielen von ihnen Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten unter gesellschaftsüblichen Bedingungnen zu sichern“ (zitiert nach ERICSSON 1986, S.35). Weiterhin legt er ausdrücklichen Wert auf die Stellung von Menschen mit geistiger Behinderung. Diese seien zuerst Mitmenschen und erst dann Mitmenschen mit Behinderungen. Daraus folgt, dass Menschen mit geistiger Behinderung als vollwertige Bürger zu sehen sind und ihnen somit ein normales Leben und die gleichen Rechte wie anderen auch zustehen (vgl. ebd.).
In Schweden verdeutlichte NIRJE als engagierter Vertreter der schwedischen Elternvereinigung, was ein normales Leben für Menschen mit geistiger Behinderung beinhalten soll:
1. „einen normalen Tagesablauf
2. einen normalen Wochenrhythmus
3. einen normalen Jahresrhythmus
4. normale Erfahrungen im Ablauf des Lebenszyklus
5. normalen Respekt vor dem Individuum und dessen Recht auf Selbstbestimmung
6. normale sexuelle Lebensmuster ihrer Kultur
7. normale ökonomische Lebensmuster und Rechte im Rahmen gesellschaftlicher Gegebenheiten
8. normale Umweltmuster und –standards innerhalb der Gemeinschaft“ (zitiert nach SPIEGEL 1999, S.79)
Im Gegensatz zu den ersten Formulierungen 1943 beziehen sich BANK-MIKKELSEN und NIRJE nicht nur auf die „Teil-Leistungsfähigen“. In der Weiterentwicklung werden alle Menschen mit geistiger Behinderung mitgedacht, unabhängig vom Schweregrad der Behinderung und den Fähigkeiten des Einzelnen (vgl. ERICSSON 1986, S.36).
Als Ergebnis der Diskussionen in Skandinavien über das Normalisierungsprinzip kann man folgende Erfahrungen festhalten. Es ist wichtig, Hilfen zu gestalten, die normale Formen des Lebens ermöglichen. Diese Hilfen müssen so entwickelt werden, dass sie den Bedürfnissen der Betroffenen entsprechen. Dabei sind Hilfen, welche die soziale Integration fördern, von besonderer Bedeutung. Ein normales Leben wird erst dann möglich, wenn Hilfen in der oben genannten Art vorhanden sind. Menschen mit geistiger Behinderung müssen als vollwertige Bürger anerkannt werden, denn erst dann wird Normalisierung nicht länger ein Konzept bleiben, sondern selbstverständlich (vgl. ebd., S.39ff).
In den 70er Jahren gewann das Normalisierungsprinzip auch in den USA an Bedeutung. Als engagiertester Vertreter gilt hier WOLFENSBERGER. 1969 formulierte er das Konzept neu und versuchte es theoretisch aufzubauen. Dabei stellte er fest, dass sich das Konzept nicht nur auf Menschen mit geistiger Behinderung beziehen lässt, sondern dass es auch für andere Menschen in gesellschaftlich marginalen Positionen gilt. Darum legte er sein Hauptaugemerk im Folgenden auf die Aufwertung der sozialen Rolle. Seine Überlegung war, dass Menschen verschiedener sozialer Rollen auch verschieden behandelt werden. Besitzt eine soziale Rolle wenig Prestige, so wird der Rolleninhaber auch entsprechend schlecht behandelt. Ziel war also für ihn, die sozialen Rollen der Benachteiligten aufzuwerten (vgl. WOLFENSBERGER 1986). Aus diesem Grunde nannte er sein Konzept „Aufwertung der sozialen Rolle“ (ebd., S.45).
2.3.2. Umsetzung in Deutschland
In Deutschland wurde das Normalisierungsprinzip in den 70er Jahren bekannt, aber erst in den 80er Jahren handlungsleitend in der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung. Außerdem kam es zu sehr unterschiedlichen Auffassungen über die praktische Umsetzung. Während das Normalisierungsprinzip eindeutig die Abschaffung von Anstalten zu Gunsten von kleinen, gemeindeintegrierten Wohnformen postuliert, gab es in Deutschland hierzu geteilte Meinungen. Die einen befürworteten eine Integration im Sinn des Prinzips, die anderen wollten Menschen mit geistiger Behinderung dieses Leben nicht zutrauen und forderten darum, normalisierte Lebensbedingungen in Anstalten (vgl. SEIFERT 1998, S.153f.).
In der Folge kam es zu zahlreichen Fehlinterpretationen und Missdeutungen. Normalisierung wurde missverstanden als „Normalmachen der Behinderten“, also als Anpassung des Menschen mit geistiger Behinderung an die bestehende Gesellschaft. Dies hatte mehrere Konsequenzen zur Folge. Zum einen wurden Betroffenen dadurch spezielle Hilfe, Dienste und Wohnformen verwehrt, da man der Meinung war, dass zu einem normalen Leben keine zusätzlichen Hilfen zur Verfügung gestellt werden müssten. Die Betroffenen müssten unter den gleichen Bedingungen leben, wie andere Menschen auch, um normal zu leben. Viele waren jedoch mit diesen „normalen“ Lebensbedingungen überfordert und konnten so nicht über längere Zeit leben. Die wiederum schien eine Abhängigkeit von anderen und somit die lebenslange (fremdbestimmte) Betreuung zu rechtfertigen (vgl. ebd., S.154f.).
Neben der Vorstellung des „Normalmachens“ entwickelte sich zunehmend das Bild vom entwicklungsfähigen Menschen mit geistiger Behinderung (vgl. THEUNISSEN 1999, S.114). Dies beförderte einen Aufschwung von Förderung und Therapie. Der Mensch mit Behinderung sollte durch gezielte Förderung und Therapie zu einem normalen Leben befähigt werden. Förderung und Therapien wurden handlungsleitend für die gesamte Arbeit mit Betroffenen und beherrschten bald sämtliche Lebensbereiche (Esstherapie, Spieltherapie, Beschäftigungstherapie, u.a.). Ziel der Arbeit war es, Defizite, Schwächen und Fehler zu erkennen und diese gezielt zu therapieren. Dabei wurde der Mensch als Ganzheit zunehmend vernachlässigt. Er wurde über sein Nicht-Können und über entsprechende Förderpläne definiert. Die individuellen Bedürfnisse der Betroffenen hingegen spielten bei der Förderung keine Rolle. Es wurde durch Experten von außen bestimmt, welche Defizite zu beseitigen seien. Den Betroffenen wurde eine lebenslange Förderbedürftigkeit unterstellt, um eine Integration in die Gesellschaft (Normalisierung) zu erreichen (vgl. THEUNISSEN 1999, S.114ff., auch THEUNISSEN 2001, S.13).
2.4. Integration
Normalisierung und Integration sind unmittelbar miteinander verbunden. „Integration durch Normalisierung der Hilfen“ so versteht THIMM (zitiert nach BECK 1998, S.351) das Normalisierungsprinzip. Integration lässt sich in drei verschiedenen Ebenen gliedern.
Die erste Stufe der Integration bezeichnet man als physische Integration. Diese meint das Wohnen oder Arbeiten außerhalb von speziellen Einrichtungen (Wohnheim, WfB) in normalen Wohn- und Arbeitsformen (vgl. SPIEGEL 1999, S.85).
Die zweite Stufe heißt funktionelle Integration und meint, die Nutzung öffentlicher Dienste und Hilfen wie öffentliche Verkehrsmittel, Friseur, Ärzte, Restaurants, Supermärkte, aber auch Sport- und Freizeitangebote. Man spricht von funktioneller Integration, wenn der Betroffene sich in der Öffentlichkeit und speziell in seiner Umgebung zurechtfindet und dort vorhandene Angebote selbständig in Anspruch nimmt. Selbständig meint in diesem Sinne, das Angebot entsprechend den Bedürfnissen und freiwillig anzunehmen. Dies schließt nicht aus, dass der Betroffene bei der Durchführung Hilfen von anderen Personen erhält (vgl. ebd., S.86).
Die soziale Integration schließlich stellt die wirkliche Integration dar. Der Mensch mit geistiger Behinderung lebt in einer normalen Umgebung und wird von dieser als vollwertiger Mitbürger angesehen (vgl. ebd.).
Oft scheitert soziale Integration daran, dass von den Menschen mit geistiger Behinderung erwartet wird, dass sie sich an die bestehende Gesellschaft anpassen. Dabei wird völlig übersehen, dass gelingende Integration von beiden Seiten ausgehen muss. Sowohl der Mensch mit Behinderung muss sich an bestimmte Normen und Werte anpassen; die Gesellschaft muss aber den Menschen auch mit seinen Eigenarten, mit seiner speziellen Lebensweise akzeptieren. Ansonsten kann man nicht von einem sozialen Prozess sprechen, sondern von Egoismus und Arroganz (vgl. SPECK 1993, S.171f.).
Integration beginnt demnach mit der Normalisierung von äußeren Lebensumständen, darf hier aber nicht enden.
2.5. Selbstbestimmung
In den vergangenen Jahren hat der Begriff der Selbstbestimmung zunehmend an Bedeutung gewonnen. Dieser Gedanke schließt direkt an Leitideen wie Entinstitutionalisierung, Normalisierung und Integration an, setzt jedoch gleichzeitig einen Perspektivenwechsel in Gang. Mit der Postulierung dieser Leitidee sollte ein Umdenken in der Arbeit mit Menschen mit geistiger Behinderung erfolgen. Während Normalisierung vorwiegend auf die Veränderung äußerer Lebensumstände abzielte, steuerte der Selbstbestimmungsgedanke eine neue Sicht von Menschen mit geistiger Behinderung und somit eine Veränderung der Beziehungen von Helfern und Hilfeempfängern an. Menschen mit geistiger Behinderung sollten nun als kompetent gelten, ihr Leben selbst bestimmen zu können. Normalisierung und Integration wurden dadurch nicht ersetzt. Sie behalten ihre Aktualität, werden jedoch um den Selbstbestimmungsgedanken ergänzt (vgl. FRÜHAUF, 1995, S.1f.).
Tatsächlich erfolgten vielerorts zahlreiche Diskussionen um diesen Begriff. Es stellten sich Fragen, wo Selbstbestimmung beginnt und wo sie endet. Wer kann selbstbestimmt leben und wer ist dazu gar nicht in der Lage? Kann man geistige Behinderung und Selbstbestimmung vereinbaren oder schließen sich beide nicht generell aus (vgl. SPECK 2000)? Selbstbestimmung wurde oftmals mit Selbständigkeit gleichgesetzt und somit wurden z.B. Menschen mit schwerer geistiger Behinderung gar nicht in der Diskussion beachtet.
Der Gedanke der Selbstbestimmung ist auch ein sehr wichtiges Element des Empowerment-Konzeptes und wird darum im nächsten Kapitel noch ausführlich erörtert. Darum sollen diese Ausführungen an dieser Stelle genügen.
Es ging mir in diesem Kapitel darum aufzuzeigen, dass viele Leitlinien, die das Leben von Menschen mit geistiger Behinderung verbessern sollten (Enthospitalisierung, Dezentralisierung, Normalisierung, Integration, Selbstbestimmung), in Deutschland fehlschlugen bzw. nicht konsequent umgesetzt wurden. Sicherlich haben diese Leitgedanken entscheidende Prozesse in Gang gesetzt und die Erfolge sollen auf keinen Fall negiert werden. Wichtige Reformen fanden ihren Ausgangspunkt in diesen Leitbildern. Die Entwicklung der Sicht des Menschen mit geistiger Behinderung von einem kranken, nutzlosen Wesen über einen entwicklungs- und förderfähigen Menschen hin zu einem zur Selbstbestimmung fähigen Individuum und die zunehmende Lebensweltorientierung stellen nur einige entscheidende Reformen dar (BECK 1998, S.351f.).
Dennoch gerieten diese Leitbilder in die Gefahr, zu Leerformeln zu gerinnen und unreflektiert gebraucht zu werden. Jeder hatte eine gewisse Vorstellung über die Bedeutung und den Inhalt der Begriffe, die auf konkreter Ebene z.T. jedoch sehr unterschiedlich definiert wurden.
Diese Begriffe waren eben „nur“ Leitlinien und stellten keine richtigen Theorien bzw. Konzepte dar. Demzufolge waren grundlegende Ziele, Werte und Menschenbilder, sowie konkrete Handlungslinien oft nicht genau definiert, was dazu führte, dass diese Begriffe nicht genau erläutert und hinterfragt wurden, weil der Sinn offensichtlich klar war.
Abhilfe versucht hier das Konzept des Empowerments zu schaffen. Dieses Konzept hat die Gedanken der Normalisierung und Selbstbestimmung von benachteiligten Personen aufgegriffen und zu einer umfassenden Theorie weiterentwickelt. Im nächsten Kapitel soll es darum um das Empowerment-Konzept, sein Menschenbild, seine Ziele und handlungsleitenden Werte und deren Umsetzung in die Praxis gehen.