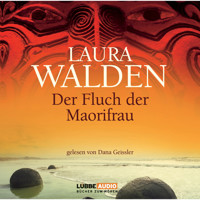9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Nelson, 1931: Kaum ist Lisa mit ihrem frisch angetrauten Ehemann Richard in Neuseeland angekommen, verfällt dieser dem Alkohol und wird gewalttätig. Trost findet die junge Deutsche in den starken Armen des Maori Rongo. Doch sie kann ihren Mann nicht verlassen, ohne ihren kleinen Sohn zu verlieren. Achtzig Jahre später finden Lisas Großnichten ihr Tagebuch, das von verbotenen Gefühlen, ungesühnten Verbrechen und einer tödlichen Familienfehde erzählt - und dann einfach abbricht...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 701
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über die Autorin
Titel
Impressum
Hamburg, November 2012
Upper Moutere, Februar 1931
Hamburg, November 2012
Upper Moutere, März 1931
Hamburg, November 2012
Upper Moutere, März 1931
Queen Charlotte Sounds, November 2012
Motueka, November 2012
Nelson, Dezember 1931
Nelson, November 2012
Nelson, Dezember 1931
Nelson, November 2012
Nelson, Dezember 1931
Motueka, November 2012
Nelson, November 2012
Nelson, Dezember 1931
Motueka, November 2012
Nelson, November 2012
Nelson, Mai 1932
Nelson, November 2012
Nelson, Mai 1932
Nelson, November 2012
Routeburn Track, November 2012
Nelson, September 1932
Nelson, November 2012
Dunedin, Dezember 2012
Nelson, November 1932
Dunedin, Dezember 2012
Nelson, Dezember 1932
Nelson, Dezember 2012
Nelson, Januar 1933
Nelson, Dezember 2012
Nelson, Januar 1933
Motueka, Dezember 2012
Nelson, Januar 1933
Motueka/Nelson, Dezember 2012
Collingwood, November 1933
Nelson, Dezember 2012
Sydney, Dezember 1934
Nachtrag, Sydney, September 1950
Nelson, Dezember 2012
Collingwood, Dezember 2012
Über die Autorin
Laura Walden studierte Jura und verbrachte als Referendarin viele Monate in Neuseeland. Das Land fesselte sie so sehr, dass sie nach ihrer Rückkehr darüber Reportagen schrieb und den Wunsch verspürte, es zum Schauplatz eines Romans zu machen. In der Folge gab sie ihren Berufswunsch Rechtsanwältin auf und wurde Journalistin und Drehbuchautorin. Wenn sie nicht zu Recherchen in Neuseeland weilt, lebt Laura Walden mit ihrer Familie in Hamburg. www.laurawalden.de
Laura Walden
DIE SPUR DESMAORI-HEILERS
Roman
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Originalausgabe
Copyright © 2013 by Bastei Lübbe AG, Köln
Textredaktion: Antje Steinhäuser
Titelillustration: © mauritius images/age; © Masterfile/Robert Harding Images
Umschlaggestaltung: Christina Krutz Design
Datenkonvertierung E-Book: Urban SatzKonzept, Düsseldorf
ISBN 978-3-8387-5386-7
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
HAMBURG, NOVEMBER 2012
Das Gästezimmer im Haus ihrer Großmutter sah aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Marie hatte ihre Mitbringsel aus Indien samt der schmutzigen Wäsche über den gesamten Fußboden verteilt. Ihre eigene Wohnung hatte sie vor der Reise für ein Jahr untervermietet, und das bedauerte sie jetzt, denn sie war bereits nach sechs Monaten zurückgekehrt. Aber nicht, um in Hamburg zu bleiben, sondern nur, um ihre Sachen für die Weiterreise zu packen und einmal kurz nach der Großmutter zu sehen.
Sie hatte nach ihrer Rückkehr aus Indien eigentlich nach Südamerika aufbrechen wollen, aber ihre Großmutter hatte ihr derart in den Ohren gelegen, lieber nach Neuseeland zu gehen, dass sie dem Drängen der alten Dame schließlich nachgegeben hatte. Ihrer Großmutter Anna konnte Marie kaum eine Bitte abschlagen. Sie war ihre wichtigste Bezugsperson seit dem grausamen Unfall, bei dem ihre Mutter gestorben war. Maries Miene verdüsterte sich. Sie konnte kaum an diese Geschichte denken, ohne dass kalte Wut in ihr aufstieg. Wut auf ihre Schwester, die den Unglückswagen gefahren und bei Blitzeis gegen einen Baum geprallt war. Mit der Beifahrerseite … Ihre Mutter war sofort tot gewesen. Genickbruch, während Amelie das Unglück fast unversehrt überstanden hatte.
Ich hätte Amelie längst anrufen und ihr mitteilen sollen, dass ich aus Indien zurückgekehrt bin und eine Woche in Hamburg bleibe, dachte Marie, aber sie spürte einen tiefen Widerwillen bei dem Gedanken, sich bei ihrer Schwester zu melden. Obwohl die Polizei kein Verschulden Amelies hatte feststellen können, machte Marie ihre Schwester insgeheim für den Tod der Mutter verantwortlich. Sicher, sie war nicht zu schnell gefahren, hatte keinen Alkohol getrunken und war vom Eis überrascht worden, aber hatte sie unbedingt in einer kalten Winternacht die heikle Strecke von Stade nach Hamburg fahren müssen? Nur, um an einem angeblich wichtigen gesellschaftlichen Event teilzunehmen wie diesem Ball? Und das, obwohl Amelie wegen ihrer enormen Arbeitsbelastung mal wieder mit den Nerven am Ende gewesen war?
Marie erinnerte sich noch genau, wie gestresst sie ihre Mutter abgeholt hatte. Sie war gar nicht richtig bei sich gewesen. Nein, ich werde mich nicht bei ihr melden, beschloss Marie und suchte aus einem Stapel bunter Tücher eines heraus, das sie mit nach Neuseeland nehmen würde. Wenn sie allein an ihre hektische Stimme und die Worte, die schneller aus Amelies Mund sprudelten, als Marie denken konnte, dachte … nein, das würde sich Marie nicht antun.
»Wenn du dich sehen könntest, Kind«, bemerkte Anna, die schon eine Weile im Türrahmen gestanden hatte. »Du bekommst Falten, wenn du die Stirn so kräuselst.«
»Das bleibt nicht aus, wenn man auf die vierzig zugeht«, lachte Marie.
»Ach, du Küken, das sind doch noch drei Jahre hin …« Anna hielt etwas in der Hand, das sie ihrer Enkelin nun reichte. »Das sind ein paar alte Fotos von Lisa und Richard.«
Marie nahm die Bilder entgegen und musterte das erste kritisch, ein Hochzeitsfoto. »Glücklich sehen die beiden nicht gerade aus.«
»Ich hätte auch nicht gelächelt, wenn ich Richard Bruhns hätte heiraten müssen«, erwiderte Anna.
»Musste deine Schwester denn?«
Anna schüttelte energisch den Kopf. »Natürlich nicht. Sie wäre niemals ausgewandert, wenn sie schwanger gewesen wäre.«
Marie betrachtete den Bräutigam intensiv. »Ich meine, mal abgesehen von seiner grimmigen Miene, sieht er nicht schlecht aus.«
»Ich befürchte, das hat meine Schwester damals letztlich dazu gebracht, seinen Antrag anzunehmen. Ich mochte ihn nicht, aber das war auch kein Wunder. Ich war noch ein Kind, und er wollte mir die geliebte Schwester rauben.«
»Und du meinst, ich könnte wirklich Spuren der beiden in Neuseeland finden?«
»Ja, irgendwo müssen sie abgeblieben sein. Angekommen sind sie jedenfalls. Das schreibt Lisa in einem Brief an unsere Eltern und mich.«
Anna zog einen vergilbten Brief hervor.
»Das war der erste und letzte Brief, den wir von meiner Schwester erhalten haben. Danach brach der Kontakt ab. Und ich verstehe das nicht. Wir waren einander so vertraut wie Schwestern nur sein können und sollten. Obwohl ich mit meinen zwölf Jahren noch ein halbes Kind und sie mit ihren neunzehn schon eine junge Dame war, hat sie mir nie das Gefühl gegeben, ein Dummerchen zu sein. Am letzten Abend vor ihrer Abreise hat sie mir hoch und heilig versprochen, dass sie mir eine Schiffspassage schenkt, wenn ich alt genug bin. Meine Eltern waren nämlich sehr streng. Lisa hat mich stets vor Vaters Schlägen beschützt. Ich habe sie angefleht, mich mitzunehmen. Ich glaube, sie hat es wirklich ernst damit gemeint, mich nachzuholen. Ach, was würde ich darum geben, wenn ich wüsste, welches Schicksal sie erlitten hat.« Anna musterte Marie durchdringend. »Geschwister sollten zusammenhalten«, fügte sie seufzend hinzu.
Maries Miene versteinerte. »Ist das der Wink mit dem Zaunpfahl, dass ich meiner vielbeschäftigten Workaholic-Schwester einen Besuch abstatten soll?«
Anna runzelte die Stirn. »Ach, es tut mir einfach weh, mitzuerleben, dass ihr beiden euch so gar nicht versteht. Wenn ich daran denke, wie glücklich Karla, eure Mutter, damals war, als sie mit Amelie schwanger geworden ist und dann drei Jahre später mit dir. Deine Eltern hatten doch gar nicht mehr mit Kindersegen gerechnet. Wenn sie mit ansehen müssten, wie ihr beiden euch aus dem Weg geht. Ein Trauerspiel.«
»Du weißt ganz genau, warum mein Verhältnis zu ihr getrübt ist!«, schnaubte Marie. »Musste sie Mutter unbedingt in ein Abendkleid zwängen und mit zu diesem dämlichen Innungsball schleppen? Und das bei klirrender Kälte? Wo Mutter gar keinen Spaß an solchen Repräsentationspflichten hatte. Denk an ihr Rheuma. Amelie hat sie sicherlich in ihrer unnachahmlichen Art so lange überredet, bis sie nicht mehr Nein sagen konnte.«
»Kannst du nicht endlich aufhören damit! Amelie trifft keine Schuld.«
»Ach ja? Die ewig überarbeitete Amelie hätte gar nicht Auto fahren dürfen.«
»Nun mach aber mal einen Punkt! Wer hat denn aus der kleinen Eckbäckerei deines Vaters ein florierendes Unternehmen gemacht? Amelie hat Tag und Nacht geschuftet, um das zu erreichen.«
Marie zuckte die Achseln. »Na und? Mir hätte die kleine Klitsche unserer Eltern völlig gereicht.«
»Kind, du bist sehr ungerecht. Wenn Amelie dich nicht ausgezahlt hätte, könntest du niemals einfach so durch die Welt reisen. Ich gönne es dir, aber mir wäre es langfristig lieber, wenn du deine Schwester im Geschäft unterstützen würdest, sobald du aus Neuseeland zurück bist. Dann hast du dich wirklich genügend selbst verwirklicht. Ihr müsst zusammenhalten!«
Marie rollte mit den Augen. »Ich werde niemals für die Jaspers-Bäckerei arbeiten. Lieber gehe ich zur Konkurrenz.«
»Woher hast du nur diesen Dickschädel? Warum könnt ihr kein Team sein? Ihr habt das Handwerk beide gelernt und Amelie noch zusätzlich als Betriebswirtin … Das ist ideal.«
»Weil ich niemals so werden will wie meine Schwester, der Statussymbole lieber sind als alle inneren Werte. Und vergiss nicht, dass ich auch studiert habe, nicht Betriebswirtschaft, sondern Ethnologie. Was soll ich wohl in einer solchen Firma? Um mich von ihr herumkommandieren zu lassen und mir ›Kohle‹ als Ziel auf die Fahnen zu schreiben? Nee, niemals, Amelie ist doch gar kein Mensch mehr, sondern ein Geldautomat! Kein Wunder, dass sie keinen Freund hat.«
Anna drohte ihrer Enkelin spielerisch mit dem Finger. »Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen. Du hast zwar immer mal wieder einen Lover, wie ihr das heute so schön nennt, aber da war auch noch kein halbwegs vernünftiger Kerl dabei. Also wenigstens in dem Punkt steht ihr euch in nichts nach. Urenkel werde ich wohl nicht mehr erleben.«
»Ach, Großmutter, nicht die Hoffnung aufgeben. Ich tue wirklich mein Bestes«. Grinsend holte Marie das Foto eines braun gebrannten, muskulösen Mannes hervor. »Heiß, oder?«
Anna stöhnte laut auf. »Und? Wann wirst du ihn wiedersehen?«
»Gar nicht, denn er wird demnächst in Kapstadt heiraten. Das war sozusagen seine Junggesellenreise.«
»Marie, Marie, wo soll das enden? Du weißt, ich bin recht fortschrittlich für meine Generation, aber ich finde, es steht dir nicht zu, über Amelie zu richten.«
Marie musterte ihre Großmutter zärtlich. »Du bist ein Phänomen. Kein Mensch, der dich nicht kennt, würde auch nur im Traum darauf kommen, dass du schon dreiundneunzig bist. Höchstens achtundsiebzig! So möchte ich im Alter mal aussehen!«
Anna Tanner war eine hochgewachsene, schlanke Frau mit blond getöntem Haar und für ihr hohes Alter erstaunlich wenig Falten. Sie litt zwar unter diversen Zipperlein, die Sehkraft ließ nach, sie brauchte ein Hörgerät, und die Knie schmerzten immer öfter, aber das sah man ihr nicht an. Als ehemalige Gymnasiallehrerin war sie geistig immer noch auf der Höhe und an allem interessiert, was dort draußen in der Welt geschah.
Marie drückte Anna einen Kuss auf die Wange.
»Du lenkst ab, Marie«, erklärte Anna mit gespielter Strenge.
»Ich verspreche dir, ich komme mit einem neuseeländischen Ehemann zurück. Bist du dann zufrieden?«
Anna lachte. »Das wäre allerdings etwas übertrieben. Ich wünschte mir nur, du könntest über deinen Schatten springen und zusammen mit deiner Schwester die Firma führen.«
»Ich würde dir gern jeden Wunsch erfüllen, aber den nicht. Amelie hat mich ausgezahlt. Schon vergessen? Jaspers gehört ihr samt dem Haupthaus, den Filialen, dem Cateringservice, dem Partydienst … und ich möchte nicht mehr als unbedingt nötig mit ihr zu tun haben. Ganz ehrlich, Großmutter, du müsstest mich eigentlich besser verstehen können, deine Schwester war auch nicht die Zuverlässigste. Ich meine, sie hat dich offenbar einfach vergessen.«
»Das kann und will ich nicht glauben!«, widersprach Anna heftig. »Deshalb musst du etwas herausbekommen! Versprich mir, dass du deine Reise in Nelson beginnst!«, beschwor sie ihre Enkelin.
»Ja, Großmutter, ich habe ein Ticket nach Wellington, muss nur noch die Cook Strait zwischen den beiden Hauptinseln überqueren, um nach Nelson zu gelangen, und dann werde ich herausfinden, was mit deiner Schwester geschehen ist. Die Farm, auf der ich mitarbeite, liegt ganz in der Nähe der Stadt.«
»Und du willst dir das Geld für die Rundreise wirklich auf einer Schaffarm verdienen? Du verfügst doch über ausreichende finanzielle Mittel.«
»Was weiß ich, wohin es mich danach führt. Es wäre unvernünftig, das ganze Geld auszugeben.«
Anna huschte ein Lächeln über das Gesicht. »Das könnte aus Amelies Mund stammen …«
Marie stöhnte genervt. »Nur weil ich nicht eines Tages ohne Kohle dastehen will. Nein, Amelie und ich haben wirklich nichts gemeinsam. Für sie zählt nur eins: Erfolg und Geld! Sie weiß gar nicht mehr, was Leben ist … Und jede Wette, sie ist seinerzeit nur von der Straße abgekommen, weil sie in Gedanken mal wieder bei ihren Zahlen war …«
»Schluss!«, schimpfte Anna. »Ich möchte nichts mehr davon hören. Ich liebe euch beide gleichermaßen, und ich finde deine Unterstellungen unerträglich! Das macht eure Mutter auch nicht wieder lebendig.«
Maries Augen wurden feucht. Anna hatte einen wunden Punkt getroffen. Sie würde es Amelie nie verzeihen, dass sie ihr die Mutter genommen hatte. Marie und ihre Mutter Karla hatten sich blind verstanden. Wohingegen Amelies Aktionismus und Getriebenheit, ihr bohrender Ehrgeiz und ihr Händchen für das Geschäft ihrer Mutter stets fremd geblieben waren. Dafür hatte ihr Vater Niko seine Älteste bis zu seinem plötzlichen Herztod umso mehr bewundert. »Papakind« und »Mamakind« hatten die Schwestern einander stets geneckt. Denn so unterschiedlich sie auch waren, sie hatten sich eigentlich immer gut verstanden. Bis vor acht Jahren Amelies Auto gegen den Baum gerast war. Von da an war Marie ihrer Schwester aus dem Weg gegangen. Allerdings hatte sie sich so weit im Griff, dass sie Amelie niemals offen vorgeworfen hatte, was sie insgeheim über den Unfall dachte. Und wie sie ihre Schwester kannte, war es ihr bei dem Dauerstress, unter dem sie litt, nicht einmal aufgefallen, dass sich Marie von ihr zurückgezogen hatte.
Anna umarmte ihre Enkelin zärtlich. »Ich weiß, Mamakind, der Gedanke, niemals mehr Karlas Lachen zu hören, ist schlimm. Sieh mal, sie war meine Tochter. Ich habe sie über alles geliebt. Das ist das Schrecklichste für eine Mutter, das es überhaupt geben kann …« Anna konnte nicht weitersprechen. Tränen erstickten ihre Stimme.
Ich will Amelie ja verzeihen, dachte Marie, aber ich kann nicht!
Das Telefon klingelte. Anna löste sich sanft aus der Umarmung mit ihrer Enkelin und meldete sich, tapfer bemüht, ihre Trauer zu verbergen.
Marie hing weiter ihren Gedanken nach, bis sie ihre Großmutter keuchen hörte: »Krankenwagen? Klinik? Ich komme sofort!«
Nachdem sie aufgelegt hatte, lehnte sie sich gegen die Wand. Sie war leichenblass geworden.
»Großmutter? Was ist los?« Mit einem Satz war Marie auf Anna zugestürzt und schob ihren Arm unter den der Großmutter.
»Amelie ist im Krankenhaus, sie hat … sie ist, … nein, sie wollte …«, stammelte Anna.
Marie fragte nicht nach. Sie wollte die Großmutter nicht noch mehr aufregen, aber ihr Herz klopfte bis zum Hals. Sie schob ihrer Großmutter einen Stuhl hin, auf den sich Anna fallen ließ. Maries Herzschlag beschleunigte sich. Verdammt, ich wollte Amelie noch so viel sagen, ging es ihr durch den Kopf.
Anna blickte ins Leere. »Es war ihre Sekretärin Svenja. Sie hat Amelie an einem offenen Fenster vorgefunden. Sie zitterte am ganzen Körper und schnappte nach Luft. Die junge Frau hatte den Eindruck, sie wollte sich hinunterstürzen. Sie konnte sie schließlich ins Büro zurückziehen. Amelie hat dann um sich geschlagen. Svenja konnte sie beruhigen und hat den Notarzt geholt, als Amelie einen Asthmaanfall bekam. Sie ist in die Uniklinik eingeliefert worden. Ich muss sofort zu ihr.«
»Und ich dachte schon …«, stieß Marie erleichtert hervor. »Ich fahr dich.«
Anna erhob sich von ihrem Stuhl. Marie erschrak. In diesem Augenblick sah ihre Großmutter wie ein Gespenst aus. Marie führte sie zur Garderobe und half ihr in den Mantel. Die alte Dame war schrecklich blass. Marie hatte Angst um sie.
»Soll ich nicht lieber allein fahren?«, fragte sie.
»Nein, nein, ich muss ihr doch helfen«, widersprach Anna, aber dann stöhnte sie auf und stützte sich schwer auf Maries Arm. Marie nahm ihrer Großmutter den Mantel rasch wieder ab und brachte sie ins Schlafzimmer. Annas Atem ging stoßweise, als sie sich auf das Bett legte.
»Ich hole den Doktor!«, sagte Marie entschlossen.
»Nein, keinen Arzt. Ich bin nicht krank«, protestierte Anna.
»Keine Widerrede!«
Marie rief erst den Arzt an, und dann sagte sie Annas Haushaltshilfe Bescheid.
»Das ist wirklich nicht nötig«, protestierte Anna. »Das war nur der Schreck. Ich habe immer Angst, dass ihr mich auch verlasst wie einst meine Schwester und eure Mutter.«
»Keine Sorge, wir sind zäh!« Marie nahm Annas Hand und strich ihr sanft über die knochigen Finger.
»Erzähl ein bisschen von deiner Schwester«, versuchte Marie, die Großmutter von ihrer Sorge um Amelie abzulenken. »Wie war das damals? Von wo aus sind sie gestartet?«
»Sie reisten von Hamburg nach London, um dort ein Schiff nach Neuseeland zu besteigen«, entgegnete Anna heiser.
»War es denn einfach, in diesen Jahren nach Neuseeland auszuwandern?«
»Gar nicht! Infolge der Weltwirtschaftskrise hatten alle typischen Auswandererländer ihre Bedingungen verschärft, aber Richard hatte gerade eine größere Erbschaft gemacht, und ein alter Freund hat ihm schriftlich bestätigt, dass er mit diesem Geld seinen Pub kaufen werde. Außerdem war Richard Zimmermann, und Handwerker wurden immer gern genommen.« Annas Atem wurde ruhiger und ihre Wangen bekamen wieder etwas Farbe.
Trotzdem gab der Arzt, der seine Praxis unten im Haus hatte und sofort zur Stelle war, Anna eine Vitalisierungsspritze und verordnete ihr strenge Bettruhe.
Die Haushälterin Elsa, die eigentlich ihren freien Tag hatte, versprach Marie, sich so lange um Anna zu kümmern, bis sie aus dem Krankenhaus zurückgekehrt war.
Marie verspürte auf dem Weg nach draußen ihr schlechtes Gewissen. Was, wenn ihrer Schwester wirklich etwas Ernsthaftes zugestoßen war? Würde sie sich nicht ewig Vorwürfe machen, dass sie sich all die Jahre seit dem Unfall derart von ihr abgegrenzt hatte? Wohl war ihr nicht, als sie in ihren alten Mini stieg. Sie besaß noch einen »echten«, wie sie es nannte. Wie oft hatte sich Amelie über ihren Wagen mokiert!
Beim Ausparken wäre sie beinahe mit einem fahrenden Auto zusammengestoßen. Ich muss mich auf den Straßenverkehr konzentrieren, ermahnte sie sich erschrocken. Doch es gelang ihr kaum. Immer wieder flogen ihre Gedanken davon. Sie war froh, als sie endlich den Haupteingang des Krankenhauses vor sich auftauchen sah.
UPPER MOUTERE, FEBRUAR 1931
Wir sind jetzt schon fast drei Monate in Neuseeland, und die Zeit seit unserer Ankunft ist wie im Flug vergangen. Heute komme ich endlich einmal dazu, meine ersten Worte in das entzückende Büchlein zu schreiben. Anna hat sich so viel Mühe gegeben und den Einband mit Glanzbildchen beklebt. Meine kleine Schwester ist außer meinen Freundinnen der einzige Mensch, den ich von Herzen vermisse. Ich habe ein schlechtes Gewissen, sie in Hamburg zurückgelassen zu haben. Vater ist schrecklich jähzornig und unberechenbar. Dann ist er noch Mitglied dieser üblen Partei geworden, die bei der Reichstagswahl Riesenerfolge feiern konnte. Genau wie mein ältester Bruder Kurt. Ich befürchte, dass auch Richard früher oder später zu diesem Verein gehört hätte, wenn wir geblieben wären, denn er ist sich mit Vater und Kurt einig, dass Deutschland nur mit einem starken Mann an der Spitze wieder auf die Beine kommt. Sie meinen damit diesen kleinen brüllenden Mann, der jetzt immer öfter in der Wochenschau im Kino zu sehen ist. Ich bin froh, dass Richard jetzt gar nicht in Versuchung kommt, denn das fände ich schrecklich. Sogar mit meiner besten Freundin Lotte habe ich mich zu guter Letzt vor meiner Abreise wegen des primitiven Schreihalses gestritten. Sie meinte, dieser Hitler habe eine magische Ausstrahlung. Kein Wunder, sie ist in Kurt verliebt. Wie gut, dass die Geschmäcker verschieden sind. Na ja, vielleicht schicken diese Nazis dann nachts keine Schlägertrupps mehr aus, wenn sie nun legal im Reichstag sitzen. Kurt ist ein paar Mal nachts von solchen Schlägereien nach Hause gekommen und hat damit angegeben, dass sie ein paar »Rote« zusammengeschlagen haben. Ich kann mir nicht helfen. Der Bursche ist wirklich verroht. Ich konnte nie etwas mit ihm anfangen. Er hat schon als Kind Mäuse gefangen, um sie zu quälen und mich gleich mit. Hoffentlich steckt er meinen kleinen Bruder Rolf nicht an. Den hätte ich am liebsten mitgenommen ans andere Ende der Welt. Genau wie meine kleine Schwester. Arme Anna! Mutter wird ihr gegen Vaters Jähzorn keine große Hilfe sein. Sie ist so unterwürfig, dass sie alles gutheißt, was unser Vater tut und lässt. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass ich meine Eltern nicht mehr sehen muss. Ich weiß, es ist entsetzlich, so etwas zu behaupten, aber es ist die Wahrheit. Vater ist ein Haustyrann und Mutter ein stummes Opfer. Ich befürchte, da werden noch Welten aufeinanderprallen, denn Anna ist eine mutige kleine Person. Sie widerspricht Vater sogar, wenn er androht, sie mit dem Riemen zu verprügeln. Ich darf gar nicht daran denken, dass ich sie in dieser Hölle zurückgelassen habe. Und ich lege hiermit den heiligen Schwur, meine Schwester nach Neuseeland zu holen, sobald sie die Schule beendet hat, schriftlich nieder. Ich muss heute unbedingt einen Brief an die Eltern und Anna schreiben. An die Eltern nur pro forma. Er ist als Lebenszeichen an meine Schwester gedacht. Meinen Eltern würde ich nicht freiwillig schreiben. Aber Vater würde es an Anna auslassen, würde ich nur ihr eine Nachricht zukommen lassen. Ich darf auf keinen Fall durchblicken lassen, wie Richard sich inzwischen aufführt. Vater würde natürlich für seinen lieben Schwiegersohn Partei ergreifen und mir einen Brief voller Ermahnungen schicken, dass es an den Frauen liegt, wenn die Männer zur Flasche greifen. Dabei ermutige ich ihn bestimmt nicht zum Trinken. Und ich bin auch keine Furie, vor der ein Mann in den Alkohol flüchten muss. Noch hat er den Pub nicht gekauft. Denn das wäre fatal. Er würde wohl selbst sein bester Kunde. Er hat immer schon gern getrunken, aber zu Hause war es meist Bier. Die Männer, mit denen sich Richard hier umgibt, trinken Whisky.
Es vergeht kaum ein Tag, an dem er nicht betrunken ins Bett fällt. Mit voller Kleidung. Ich ziehe ihm dann jedes Mal wenigstens die Schuhe aus. Am schlimmsten ist es aber am nächsten Tag. Er ist dermaßen unleidlich, dass ihn die Fliege an der Wand in Rage bringt. Es kann aber auch das Salz im Essen oder ein Fleck auf der Tischdecke sein, was ihn zum Schimpfen bringt. Ich weiß nicht, wie lange ich das klaglos ertrage. Noch schaffe ich es, meinen Mund zu halten. Ich nehme sein Verhalten einfach nicht ernst.
Manchmal denke ich an die Worte meiner kleinen Schwester, als ich erzählt habe, dass ich Richard heiraten werde. »Bist du verrückt geworden? Ich mag ihn nicht leiden!«, hat sie empört ausgerufen. Ja, vielleicht war ich wirklich verrückt, aber nun ist es zu spät. Ich bin seine Frau geworden und möchte eine eigene Familie haben. Mindestens drei Kinder wünsche ich mir, aber ich möchte nicht nur im Haus sitzen. Ich muss etwas Sinnvolles tun, und ich weiß, dass es eine Aufgabe für mich gibt. Ich war im Waisenhaus und habe für die Kinder Geschenke mitgenommen. Ich habe Miss Hunter gefragt, ob ich nicht ehrenamtlich für das Heim arbeiten könnte.
Die Maori-Kinder nennen mich »die Pakeha«. Inzwischen weiß ich, was das bedeutet. So nennen die Maori die Weißen. Das habe ich bereits auf der Überfahrt von der Nord- auf die Südinsel erfahren. Von dem ersten Maori, den ich zu Gesicht bekommen habe.
Manchmal muss ich an ihn denken und an die Fahrt durch die Marlborough Sounds. Es war atemberaubend. Nach dem stürmischen Meer kamen wir in die Stille der Fjorde, die hier Sounds heißen. Das Wasser war spiegelglatt. Wo das Auge hinsah, überall grüne Küsten und winzige Inseln. Hier sind die Feen zu Hause, dachte ich. Es lag ein leichter Nebel über dem Wasser. Ich stand am Bug und starrte die Schönheit der Natur an, da gesellte er sich zu mir. Ein hochgewachsener Fremder, der keine ganz dunkle Haut besaß, aber auch nicht so weiß war wie wir. Seine Augen waren schwarz wie Kohle. Ich erschrak ein wenig, aber er lachte und sagte, an den Anblick der Maori müsse ich mich gewöhnen, im Norden der Südinsel gäbe es viele von ihnen. Ich versicherte ihm, dass ich keine Angst vor ihm hätte, zumal er mit seinem Anzug eher wie ein feiner Mann aussähe. Nachdem ich inzwischen viele Maori kennengelernt habe, vermute ich, dass er ein Mischling ist. Das verriet seine schmale Nase. Sie hat nicht diese typisch polynesische Ausprägung. Wie dem auch sei, er war von außerordentlicher Höflichkeit.
Davon könnten sich die Burschen, die im Pub herumhängen, eine Scheibe abschneiden. Die haben keinen Schimmer, wie man sich einer Dame gegenüber verhält, und saufen noch mehr als Richard. Besonders sein neuer Kumpel Sam Snyder ist mir schrecklich unangenehm. Wie gut, dass sie in der verrauchten Kneipe saufen und er mir diese Kerle nicht ins Haus holt. Nein, diese ungehobelten Gesellen können dem Mann vom Schiff nicht das Wasser reichen. Selbst als er mich intensiv musterte, tat er das mit Respekt, und es war mir kein bisschen unangenehm. Während in Sam Snyders Blick immer etwas Anzügliches liegt. Ich wundere mich, dass Richard das bislang nicht bemerkt hat. Nein, »mein erster Maori«, wie ich ihn insgeheim nenne, war von ausgesuchter Höflichkeit. Er betonte, dass ich für eine Pakeha sehr dunkles Haar besitze. »Pakeha?«, fragte ich. »Was ist das?« Er lächelte. Ein schönes offenes Lächeln, als würde die Sonne aufgehen. »So nennen wir Maori die Weißen.«
Ich hätte gern noch ein wenig mit ihm geplaudert, aber da rief Richard nach mir und meinte, ich würde mir draußen den Tod holen. Ich versicherte ihm, dass die milde Luft mir guttue, aber er wurde regelrecht wütend und zog mich auf die Bank hinunter, dass mir Hören und Sehen verging. Seit wir in unserer neuen Heimat sind, ist er ohnehin schroffer mir gegenüber. Deshalb bin ich froh, dass er sich nachts nur noch selten an mich heranrobbt, um mit mir zu schlafen. Viel Spaß macht es ohnehin nicht. Manchmal liege ich stundenlang wach und nehme mir vor, Richard nicht im Pub abzuholen. Soll er sich doch in seinem Suff allein nach Hause schleppen oder am Straßenrand nächtigen. Und immer, wenn ich so daliege, muss ich an den Mann von der Fähre denken. Er hat mich in einer Art angesehen, wie ich es nie zuvor bei einem Mann erlebt habe. Ein Blick, der mich verzaubert hat und Sehnsüchte in mir weckt, die sich niemals erfüllen werden. Ich versuche dann, diesen magischen Augenblick zu vergessen, aber er hat sich in mein Herz eingebrannt. Ich brauche nur die Augen zu schließen; und sein Gesicht taucht in all seiner fremdartigen Schönheit vor mir auf.
Wie soll ich jetzt bloß einen Brief an meine Familie schreiben, wo mir schon wieder das Herz bis zum Halse klopft, wenn ich nur an ihn denke?
Für mein Tagebuch werde ich mir ein ganz besonderes Versteck suchen. Nicht auszudenken, dass Richard es findet und liest. Wenn er es betrunken in die Hände bekommt, kann ich für nichts garantieren …
HAMBURG, NOVEMBER 2012
Marie hielt vor dem Pförtnerhaus des Universitätskrankenhauses. Als der Mann nach ihrem Ziel fragte, fiel ihr ein, dass sie keine Ahnung hatte, wohin man ihre Schwester gebracht hatte. Nachdem sie ihm Amelies Namen genannt und den Fall geschildert hatte, griff er zum Telefon.
»Therapie-Zentrum für Suizidgefährdete.« Er zeigte ihr auf dem Plan, wo sich diese Abteilung befand. Kompletter Schwachsinn, dachte Marie. Ihre Schwester war doch die Letzte, die sich umbringen würde. Amelie war die geborene Kämpferin. Wie ihr Vater setzte sie alles durch, was sie sich vornahm. Ich muss sie da rausholen, ging es Marie durch den Kopf. Sonst weisen sie sie womöglich noch in die geschlossene Abteilung ein.
Mit energischem Schritt betrat Marie den Warteraum der Ambulanz. Sie dachte nicht daran, sich auf einen der Stühle zu setzen und zu warten, sondern sie pochte ungeduldig gegen die Tür zu den Behandlungszimmern. Eine Schwester öffnete mit genervter Miene.
»Ich suche Amelie Jaspers«, kam Marie der Frau zuvor.
»Die ist gerade im Untersuchungszimmer. Warten Sie bitte, bis sie fertig ist«, erwiderte die Krankenschwester und machte Anstalten, die Tür wieder zu schließen, doch Marie stellte den Fuß dazwischen. »Ich muss zu ihr. Bitte!«
»Sind Sie eine Angehörige?«
»Ich bin ihre Schwester, und ich muss mal eines richtigstellen: Sollte hier von Selbstmordabsichten gesprochen worden sein, wäre das ausgemachter Unsinn. Meine Schwester wollte sich ganz bestimmt nicht umbringen.«
»Na gut, dann kommen Sie! Am besten wird es sein, Sie reden zunächst mit dem Doktor.« Die Schwester führte Marie lange Gänge über beige Linoleumböden zu einem Besprechungszimmer und bat sie, dort zu warten.
Während Maries Augen in dem kühl gestalteten Raum umherwanderten, überschlugen sich ihre Gedanken. Konnte sie sich wirklich so sicher sein, dass Amelie nicht selbstmordgefährdet war? Sie kannte ihre Schwester doch gar nicht mehr. Das letzte persönliche Gespräch mit ihr hatte sie vor dem Tod der Mutter geführt. Danach war es ausschließlich um geschäftliche Belange gegangen und die Frage, zu welchen Bedingungen Marie bereit war, Amelie das Geschäft zu überlassen. Was, wenn sich Marie getäuscht und etwa der Unfall Spätfolgen bei Amelie hatte? Vielleicht war sie gar nicht so cool, wie sie tat?
Diese Gedanken verflüchtigten sich in dem Augenblick, als Marie ihre Schwester im Nachbarraum lauthals schimpfen hörte: »Nein, wo denken Sie hin? Ich bin doch nicht so blöd und springe aus dem vierten Stock! Ich weiß auch nicht, was mit mir los war. Ich habe noch nie vorher so gezittert, und dann drohte mir der Kopf zu platzen, ich hatte das Gefühl, durch meine Adern fließe Champagner. Aber wer hat behauptet, dass ich springen wollte? Ich ahne schon, mit wem da die Fantasie durchgegangen ist. Meine Sekretärin übertreibt immer, müssen Sie wissen.«
Nein, das klingt nicht suizidgefährdet, dachte Marie, im Gegenteil, das ist typisch Amelie. Sie sucht die Schuld immer bei den anderen. Ihr tat die arme Svenja leid. Marie spürte, wie sie bereits der herrische Ton in der Stimme ihrer Schwester wütend machte, obwohl sie auch ein wenig erleichtert war. Trotzdem wäre sie am liebsten aufgesprungen und hätte die Klinik auf schnellstem Weg verlassen. Amelie brauchte keine Hilfe, jedenfalls nicht von ihr! Aber was sollte sie ihrer Großmutter erzählen, wenn sie ohne ihre Schwester nach Winterhude zurückkam? Nein, sie hatte es Anna versprochen, und sie würde ihre Schwester mitbringen.
In diesem Augenblick betrat der Arzt den Raum. Die Ratlosigkeit stand ihm förmlich ins Gesicht geschrieben.
»Meine Schwester scheint wieder ganz obenauf zu sein«, bemerkte Marie spöttisch.
»Ich möchte kurz mit Ihnen unter vier Augen sprechen«, erwiderte er freundlich und bot Marie, die immer noch ruhelos auf und ab ging, den Besucherstuhl an. »Ich bin Doktor Beermann.«
»Was ist mit ihr, Herr Doktor?«, fragte sie. »Ganz im Ernst. Ihrem Ton nach zu urteilen, ist sie wieder ganz die Alte.«
»Wie ist sie denn dann so?«, hakte der Arzt nach. Er war mittleren Alters, grau meliert und hatte eine vertrauenerweckende Ausstrahlung.
»Sie bestimmt alles, lässt keinen Widerspruch zu und glaubt, der Rest der Welt gehöre zu ihren Untergebenen. Ansonsten arbeitet sie vierundzwanzig Stunden am Tag und verachtet alle, die das nicht tun.«
»Das klingt bitter«, kommentierte Dr. Beermann lächelnd. »Sie scheinen Ihre Schwester gut zu kennen …« Er stockte. In seine Miene trat Besorgnis. »Der Erschöpfungszustand Ihrer Schwester hat solche Ausmaße erreicht, dass ich sie am liebsten einweisen würde. Selten habe ich eine Patientin erlebt, die so schnell wieder die Fassung zurückgewinnt und deren Zustand zugleich so bedenklich ist. Ich glaube nicht, dass sie selbstmordgefährdet ist, aber die Symptome, die die Sekretärin schildert, scheinen Hinweise auf Nebenwirkungen der Tabletten zu sein, verbunden mit einem Serotoninsyndrom. Der Körper reagiert mit Kopfschmerz, Schwindel und Anstieg des Blutdrucks. Das heißt, Ihre Schwester wird ohne ärztliche Diagnose diverse Mittel gegen ihren Zustand eingenommen haben. Und auch kein Wunder, dass sie das Fenster aufgerissen hat. Vom Moclobemid hat sie Hitzewallungen bekommen. Kurz, wir müssen ihre Depressionen nun unter ärztlicher Aufsicht behandeln.«
Marie lachte kurz. »Meine Schwester und Depressionen, das ist wohl ein Witz.«
»Und was ist das hier?«
Marie zuckte die Achseln. Er reichte ihr eine Tablettenschachtel mit dem Aufdruck Aurorix.
»Das trug sie bei sich. Sie behauptet, die Tabletten habe sie von einer befreundeten Ärztin bekommen. Das sind schwere Antidepressiva.«
»Und was heißt das?«
»Ich befürchte, Ihre Schwester leidet unter einem schweren Burnout und sollte dringend in eine Klinik.«
»Haben Sie ihr das gesagt?«
»Sagen wir mal so: Wir brauchen Ihre Verstärkung. Mein Eindruck ist, dass so eine, pardon, Workaholic wie Ihre Schwester schlicht einmal Ruhe braucht. Und dafür haben wir entsprechende Einrichtungen. Ich würde sofort dafür sorgen, dass sie einen bevorzugten Therapieplatz bekommt. Es ist jedenfalls keine Lösung, sich von irgendeiner Ärztin Mittel geben zu lassen, die wir den Patienten nur bei strenger Kontrolle verordnen, weil Wechselwirkungen nicht selten sind. Mit dem Wirkstoff Moclobemid ist wirklich nicht zu spaßen.«
»Und ich soll ihr nun zur Behandlung raten? Und zur Ruhe? Meiner Schwester, die nicht mal zwei Minuten still auf einem Stuhl sitzen kann, ohne nervös auf ihr BlackBerry zu stieren?«, fragte Marie zweifelnd. »Ganz ehrlich, ich bezweifle überdies, dass ich die Richtige bin. Meine Schwester und ich stehen uns nicht besonders nahe.«
»Versuchen Sie es wenigstens«, bat der Arzt inständig und erhob sich. »Ich hole sie jetzt dazu!«
Maries Pulsschlag beschleunigte sich bei der Vorstellung, auf Amelie zu treffen. Und da trat sie auch schon ins Behandlungszimmer. Ihre Gegenwart raubte Marie förmlich die Luft zum Atmen. Wenn Amelie einen Raum betrat, war er ausgefüllt, und es blieb kein Platz für andere. Das jedenfalls hatte Marie in ihrer Jugend so empfunden, und das fühlte sie auch in diesem Augenblick mit einer unglaublichen Intensität.
Amelie aber schien von alledem nichts wahrzunehmen. Als wäre das hier eine Party, kam sie überschwänglich auf Marie zu und umarmte sie. »Schön dich zu sehen, Kleines!«
Wie Marie das hasste, von ihrer Schwester so genannt zu werden. »Hallo, Amelie«, gab Marie gequält zurück und ließ die Küsschen links und rechts über sich ergehen.
»Lass dich mal anschauen!« Amelie war einen Schritt zurückgetreten und musterte ihre jüngere Schwester von Kopf bis Fuß. »Du siehst ja noch ganz nach Hippie-Reise aus«, lachte sie eine Spur zu schrill und befühlte nun das bunte Tuch, das Marie um den Hals trug.
Marie wurde abwechselnd heiß und kalt. Es hatte sich nichts geändert. Kaum war ihre Schwester in der Nähe, schrumpfte sie innerlich zum Mauerblümchen. Da halfen alle Massagen und Meditationen nichts, die sie auf ihrer Indienreise genossen hatte. Wenn Amelie auftauchte, fühlte sich Marie klein und hässlich. Ihre Schwester sah, obwohl man sie im Krankenwagen hergebracht hatte, wie aus dem Ei gepellt aus. Ihr langes blondes Haar war akkurat zu einer Hochfrisur gesteckt, die Lippen leuchteten in einem dezenten Rosé, und nicht mal ihre Wimperntusche war verschmiert. Aber sie war erschreckend dünn geworden. Wahrscheinlich findet sie das normal, ging es Marie durch den Kopf.
»Amelie, Dr. Beermann meint, du brauchst dringend eine Pause«, begann Marie, ohne sich mit unnötigem Vorgeplänkel aufzuhalten.
Amelie blickte von ihrer Schwester zu dem Arzt, der das Ganze interessiert beobachtet hatte.
»Pause wovon?«
»Du bist überarbeitet und das schon seit Jahren. Du musst kürzertreten.«
Amelie blickte ihre Schwester zweifelnd an. »Ich war gerade eine Woche in Dubai zum Shoppen.«
Marie rollte mit den Augen. »Da hast du dich sicherlich hervorragend erholt in der Gluthitze und den vollklimatisierten Shoppingcentern. Nicht zu vergessen, der Flug hin und zurück.«
»Du bist lustig. Ich kann nicht länger als eine Woche am Stück weg. Das weißt du genau. Du hast mich schließlich im Stich gelassen und dich aus dem Geschäft zurückgezogen.«
»Willst du mir das etwa vorwerfen?«
Dr. Beermann räusperte sich. »Meine Damen, bitte! Ich kann nur noch einmal wiederholen, was ich Ihnen beiden gesagt habe. Frau Jaspers, Sie können so nicht weitermachen. Ich hätte da eine wirklich gute Klinik für Sie …«
»Klinik? Ich bin nicht krank.«
»Doch, das sind Sie.« Er hielt ihr die Tablettenschachtel unter die Nase. »Aurorix. Wissen Sie, dass es das stärkste Mittel gegen Depressionen ist, das zurzeit auf dem Markt ist? Das verschreiben wir nur unter ärztlicher Aufsicht. Wegen der Wechselwirkungen. Sie haben übrigens bereits ein Ekzem am Hals. Und auch der Asthmaanfall kann von den Tabletten verursacht worden sein. Was haben Sie noch genommen? Alle Anzeichen deuten darauf hin, dass Sie nicht nur zum Aurorix gegriffen haben, sondern dass Ihr Körper auf das stark erhöhte Serotonin in Ihrem Körper reagiert hat.«
Amelies Miene versteinerte.
»Was ist das denn für eine Unterstellung!«
»Ich will Sie nicht ärgern, Frau Jaspers, aber Ihr Körper hat so reagiert, als hätten Sie noch ein zweites Mittel genommen.«
»Bitte schauen Sie nach. Was für ein Blödsinn!« Sie streckte ihm ihre Handtasche entgegen. »Das Zeugs da, dieses Aurorix, habe ich Ihnen freiwillig gezeigt. Warum sollte ich Ihnen ein weiteres Mittel vorenthalten? Es geht schließlich um meine Gesundheit!«
»Genau!«, erwiderte der Arzt. »Also zeigen Sie mir bitte einfach, was Sie noch dabeihaben.«
Widerwillig nahm Amelie ihre Handtasche und zog neben diversen anderen Dingen eine Packung Johanniskrautkapseln hervor.
»Da haben wir ja den Übeltäter!«
»Es wird ja wohl nicht verboten sein, Johanniskraut zu nehmen«, bemerkte Amelie schnippisch.
»Richtig, aber die Kombination macht es. Es ist wie bei allem. Zu viel ist schlecht. Wenn serotonergene Arzneistoffe mit MAO-Hemmern zusammentreffen, wird das Serotonin im Körper in ungesunder Weise erhöht. Unverantwortlich von der Kollegin, Ihnen ein solch starkes Mittel als Freundschaftsdienst zu überlassen. Man müsste sie vor die Ärztekammer bringen.«
Ein Zucken ging durch Amelies Gesicht. »Ich habe es mir genommen, als sie im Bad war. Ich weiß, dass es nicht in Ordnung war, aber ich wusste mir keinen Rat mehr. Sie bewahrt die Mittel stets verschlossen auf, aber an diesem Tag war der Schrank offen. Sie konnte ja nicht damit rechnen, dass ich sie beklaue.«
Amelie ließ sich bei diesen Worten auf einen Stuhl fallen und senkte den Kopf. »Es wurde immer schlimmer«, gab sie leise zu. »Es fing mit Appetitlosigkeit an. Ich konnte nicht mehr schlafen, befürchtete, meine Arbeit nicht mehr zu bewältigen. War nicht mehr so effizient. Manchmal wachte ich morgens in einem Nebel auf. Als ich dann einmal an meinem Bürofenster stand und eine gewisse Gleichgültigkeit verspürte bei dem Gedanken zu springen, da wusste ich, ich musste etwas unternehmen. Und da habe ich die Tabletten aus der Praxis meiner Freundin mitgehen lassen.«
Amelie hob den Kopf. Sie hatte Tränen in den Augen.
»Siehst du, es wird höchste Zeit, das zu tun, was Dr. Beermann vorschlägt. Der Laden läuft auch mal eine Weile ohne dich«, bemerkte Marie sanft. Auf einmal fühlte sie sich in ihre Kindheit zurückversetzt. Damals, als der Hund Amelies Lieblingspuppe zerbissen hatte. Damals, als sie noch echtes Mitgefühl für Amelie hatte entwickeln können.
»Aber ich möchte nicht in solch eine Klinik. Ich würde erst recht krank werden mit all den Psychos auf einem Haufen«, protestierte Amelie.
»Ich kann Sie nicht zwingen«, seufzte der Arzt. »Aber ich kann Ihnen versichern, liebe Frau Jaspers, wenn Sie so weitermachen und sich derartigen Selbstversuchen unterziehen, kann ich für nichts garantieren.«
»Ich will mich ja nicht in Gefahr bringen«, räumte Amelie kleinlaut ein.
Marie sah für einen Augenblick in ihrer Schwester das kleine Mädchen, das sie einmal gewesen war.
»Herr Dr. Beermann, ich nehme Amelie jetzt mit zu unserer Großmutter. Dort wird sie ein paar Tage ausspannen«, schlug Marie vor.
»Aber ich muss sofort in die Firma«, widersprach Amelie energisch.
»Ich habe Sie gewarnt«, erklärte der Arzt unwirsch. »Ich hatte kürzlich einen ähnlichen Fall. Die Patientin hat in ihrem Job weitergemacht, als gäbe es keinerlei Anzeichen für ein Burn-out. Sie hat schließlich Schlaftabletten genommen.«
»Schon gut, ich rufe meine rechte Hand an und nehme mir eine Woche frei«, knurrte Amelie. »Bevor Sie mir noch mehr Horrorgeschichten auftischen.«
»Das ist mal ein Anfang, aber wenn Sie danach so weitermachen, sind Sie schnell wieder am Ende.« Der Arzt blickte Marie beschwörend an. »Ich zähle auf Sie! Vielleicht können Sie Ihre Schwester umstimmen. Ich gebe Ihnen jedenfalls die Prospekte der besten Kliniken mit.«
Dr. Beermann drückte Marie einen Stapel mit Hochglanzbroschüren in die Hand.
»Sie müssen mich nicht behandeln, als sei ich unmündig«, bemerkte Amelie schnippisch, griff sich die Prospekte und stopfte sie hektisch in ihre Handtasche.
»Ändern Sie grundsätzlich etwas«, bat Dr. Beermann mit Nachdruck, während er Amelie zum Abschied die Hand schüttelte.
Amelie stieß einen tiefen Seufzer aus. »Ich werde etwas ändern. Das verspreche ich hoch und heilig.« Ihre Stimme klang plötzlich ungewohnt versöhnlich.
Schweigend verließen die Schwestern die Ambulanz und steuerten auf Maries Wagen zu.
»Oh«, entfuhr es Amelie, als Marie sie aufforderte einzusteigen.
Marie war verwundert, dass Amelie ihr keinen Vortrag über die Autos hielt, die man in ihren Kreisen fahren musste. Mit einem Seitenblick stellte sie fest, dass ihre Schwester sehr nachdenklich wirkte. Ob die Worte des Arztes sie tatsächlich erreicht hatten?
»Man müsste zur Abwechslung mal so relaxed leben wie du«, ließ Amelie schließlich verlauten.
»Ach, Amelie, ich glaube nicht, dass du freiwillig ans andere Ende der Welt, nach Neuseeland, reisen willst«, seufzte Marie.
»Neuseeland klingt unglaublich entspannend. Nach Schafen und Natur. Genau das Richtige, um eine Weile dem Dauerstress zu entkommen. Das ist bestimmt besser als jede Klinik. Fliegst du wirklich dorthin?«
Marie schluckte. Hätte sie das bloß nicht angesprochen. Der Gedanke, Amelie könnte womöglich auf die Idee kommen, sie zu begleiten, behagte ihr ganz und gar nicht. Sie zog es vor, so zu tun, als hätte sie die Frage überhört. Um einen abgelenkten Eindruck zu machen, fluchte sie auf den Fahrer, der ziemlich knapp vor ihr einscherte.
»Wann geht dein Flug nach Neuseeland?«, hakte Amelie nach einer Weile nach. »Das wäre doch ideal. Ein langweiliges Land, und ich bin nicht allein. Was meinst du?«
Marie biss sich auf die Lippen. Sie konnte ihrer Schwester in dem Zustand, in dem sie sich befand, unmöglich an den Kopf werfen, dass sie niemals mit ihr verreisen würde. Deshalb war sie erleichtert, als sie vor Annas Haustür einen Parkplatz fand.
»Du legst dich am besten gleich hin, und ich kümmere mich um alles«, ordnete Marie eifrig an, um zu vermeiden, dass das Thema Reise noch einmal aufkam. »Großmutter hat sich große Sorgen um dich gemacht. Sie musste sich hinlegen. So sehr hatte sie das alles aufgeregt.«
Amelie fixierte ihre Schwester. »Wie findest du die Idee, dass ich mich in Neuseeland regeneriere?«
»Ja, wäre sicher eine Möglichkeit, aber du würdest es bestimmt entsetzlich öde finden«, entgegnete Marie ausweichend. Oder sollte sie ihrer Schwester etwa vorschwärmen, dass Neuseeland ein Land war, in dem man sich ganz bestimmt nicht langweilte? Und dass es dort jede Menge Kultur und zudem ein spannendes Nachtleben gab? »Und in einer Klinik wirst du viel besser betreut. Da sind die auf solche Fälle spezialisiert«, fügte sie hinzu.
»Wenn du meinst«, entgegnete Amelie scheinbar überzeugt.
Marie atmete auf. Das Thema gemeinsame Reise schien damit erledigt zu sein.
UPPER MOUTERE, MÄRZ 1931
Ich schreibe im Schein einer Kerze auf der Veranda. Richard darf mich auf keinen Fall erwischen. Die Sonne ist gerade erst untergegangen, und doch fühle ich mich, als sei es bereits tiefe Nacht. Es liegt daran, dass Richard sich heute schon am Tag betrunken hatte. Wenn ich nicht niederschreibe, was mir heute widerfahren ist, glaube ich es später selbst nicht mehr. Ist Richard noch der Mann, der in Hamburg nach allen Regeln der Kunst um mich geworben hat? Und für den ich mich schließlich entschieden habe, weil ich glaubte, hinter seinem mitunter groben Gehabe stecke ein großes Herz? Wie ich ihn an diesem Nachmittag in meinem Haus erlebt habe, war von einem Herzen nicht viel zu merken, aber ich will dir, liebes Tagebuch, eines nach dem anderen erzählen.
»Meine Maori-Kinder« und ich haben begeistert Plätzchen gebacken. »Meine Maori-Kinder«, das sind Kinder aus einem Waisenhaus. Ich suchte händeringend eine sinnvolle Nebenbeschäftigung und habe bei Miss Hunter, der Leiterin des Heimes, vorgesprochen. Sie hat mir angeboten, die Kinder gelegentlich nachmittags in meinem Haus zu betreuen, damit sie mit unserer Kultur in Berührung kommen. Wir haben gar nicht genau besprochen, was Miss Hunter eigentlich mit »unserer Kultur« meint, denn ich bin Deutsche und das Heim wird von britischen Ordensschwestern geführt, aber ich vermute, sie meint die europäische im Gegensatz zu der Maori-Tradition. Ich lasse mir aber im Gegenzug dafür, dass ich mit ihnen backe oder koche, gern von den Mythen und Legenden der Maori erzählen. Die Kinder sprechen in der Regel kein perfektes Englisch. Da ich meine neue Sprache auch noch nicht vollkommen beherrsche, verstehen wir uns hervorragend. Meine Lehrerin, die alte Miss Brown aus Motueka, sagt, ich wäre ein Sprachtalent, aber dieses Lob kann ich gar nicht annehmen. Ich finde, ich müsste der Sprache längst mächtig sein, zumal ich in der Schule ein paar Jahre Englisch gelernt habe. Richard hingegen ist zu faul zum Lernen. Er drückt sich mit dummen Ausreden vor dem Lernen. Es reicht doch, wenn einer in der Familie Englisch kann, sagt er immer. Das sehe ich anders. Aber hinter dem Tresen braucht er tatsächlich kein Englisch. Kein Wunder, dass er sich einen Freund gesucht hat, dessen Vorfahren aus Deutschland stammen und in dessen Familie die Sprachtradition seit neunzig Jahren gepflegt wird. Sam Snyder spricht zwar ein scheußliches Deutsch, aber zum gemeinsamen Saufen genügt es.
Jedenfalls waren die Kinder und ich vergnügt dabei, Plätzchen zu backen, als ich ein Poltern vernahm. Es kam von der Veranda. Ich wollte gerade nach der Ursache sehen, da stolperte mein Mann in die Küche. Ich roch es sofort. Er stank wie eine ganze Kneipe. Und er konnte nicht mehr aufrecht gehen.
»Mein Liebling«, lallte er. »Mein kleiner Liebling!«
Die Kinder umringten mich wie ein Schutzwall. Einige von ihnen krallten sich in meine Schürze vor Angst. Sechs Paar weit aufgerissene kohlschwarze Augen starrten den Eindringling an.
»Was ist das?«, fragte er mit schwerer Zunge und deutete auf die Kinder, wobei er einen bedrohlichen Eindruck auf mich machte.
»Das sind meine kleinen Freunde aus dem Waisenhaus«, erwiderte ich mit fester Stimme.
»Was heißt hier Freunde?« Er war kaum noch zu verstehen. So verwaschen klang seine Stimme.
»Wir backen«, erwiderte ich betont locker, obwohl er sich das selbst denken konnte. Der Duft von frischem Gebäck dürfte selbst ihm in seinem Zustand nicht entgangen sein.
»Wirf sie raus!«, verlangte er, trat einen weiteren Schritt auf mich zu und sah mich aus seinen glasigen Augen wütend an.
»Ich denke gar nicht daran«, entgegnete ich und trat ihm mutig entgegen. »Sie sind mein Besuch!«
»Raus hier! Alle!«, brüllte er, woraufhin die Mädchen zu weinen begannen. Sie verstanden kein Wort Deutsch, aber sein aggressives Gebaren und der Ton ließen keinen Zweifel an seiner feindseligen Haltung. So standen wir uns einen Augenblick gegenüber. Meine kämpferische Haltung hatte ihm offenbar die Sprache verschlagen. Schließlich geriet er ins Schwanken und ließ sich auf einen der Küchenstühle fallen. »Ich zähle bis drei, dann sind die schwarzen Bastarde draußen«, lallte er.
Mir wurde flau im Magen. Ich durfte die armen Kinder nicht diesem betrunkenen Wüterich ausliefern. Also drehte ich mich zu ihnen um und erklärte ihnen sanft, dass wir das Backen morgen fortsetzen würden. Ich bat sie, einander an den Händen zu fassen. Ich ergriff die Hand des Jungen Wirimu, dem ältesten der Kinder, und führte meine Schützlinge schweigend aus der Küche durch den Flur bis auf die Veranda. Draußen an der frischen Luft atmete ich ein paar Mal tief durch.
»Mister Bruhns fühlt sich nicht wohl«, sagte ich schließlich mit belegter Stimme. »Er ist krank, und ich muss ihn ins Bett bringen«, fügte ich beschwörend hinzu. Die kleinen Maori-Kinder sahen mich weiterhin verschreckt an. »Morgen Nachmittag kommt ihr wieder? Versprochen?«, fragte ich fast flehentlich und blickte aufmunternd in die Runde. Ich bekam keine Antwort, bis ich spürte, dass Wirimu, den ich immer noch festhielt, meine Hand drückte. »Misses Lisa, dein Mann ist böse«, flüsterte er mir zu. Diese Worte aus dem Mund des Achtjährigen berührten mich so stark, dass mir beinahe die Tränen kamen.
»Geht schnell«, sagte ich mit heiserer Stimme. Da fiel mir jedoch ein, dass wir ja schon zwei Bleche mit Plätzchen gebacken hatten. »Wartet! Ich bringe euch ein paar Kekse!«
Mit klopfendem Herzen ging ich in die Küche zurück und schüttete die Kekse in eine Schale. Mit einem Seitenblick auf meinen Mann stellte ich fest, dass er eingeschlafen war. Er bot einen erschreckenden Anblick. Der Mund stand offen, Speichel lief ihm aus dem Mundwinkel, und er fing laut zu schnarchen an. Trotzdem war ich erleichtert. So konnte ich ihn gleich ins Bett bringen, und er würde hoffentlich bis morgen früh seinen Rausch ausgeschlafen haben. Aber dann musste ich ein ernstes Gespräch mit ihm führen. So ging es nicht weiter. Die Sauferei war schlimm genug, aber dass er nun im Suff die armen Kinder verschreckte: das ging zu weit. Ich verließ die Küche und brachte meinen Schützlingen das Gebäck. Endlich lächelten sie wieder. Mir tat es in der Seele weh, dass Richard sie derart verängstigt hatte. Ich lächelte tapfer zurück.
»Kommt ihr morgen wieder?«, fragte ich.
»Und ob, Misses Lisa. Ich werde Sie beschützen, wenn es sein muss«, erklärte Wirimu im Brustton der Überzeugung. Was für ein tapferer kleiner Kerl, dachte ich, während ich mich bemühte, meine Tränen zurückzuhalten. Erst als die kleine Gruppe um die Ecke gebogen war, ließ ich sie fließen. Nein, so geht es nicht weiter, dachte ich entschieden.
Ich blieb eine Weile auf der Veranda stehen. Es war ein warmer Tag, obwohl auch hier bald der Herbst Einzug halten würde, wie mir meine Englischlehrerin versichert hatte. Davon war allerdings noch gar nichts zu merken. Die Luft war weich, und der Wind streichelte sanft um meine Wangen. Von allen Seiten erklang das Gezwitscher der exotischen Vögel, die in unserem Vorgarten wohnten. Ich kannte bislang keinen von ihnen mit Namen, aber immer, wenn ich einen zu Gesicht bekam, war ich angetan von dem bunt schillernden Gefieder. Ich werde Miss Brown bitten, mir eine Liste der einheimischen Vögel zu erstellen, damit ich deren Namen auf Englisch lernen konnte, nahm ich mir vor.
Ich konnte mich nicht dazu durchringen, gleich zurück in die Küche zu gehen. Hier draußen war das Paradies, aber dort drinnen lauerte der Abgrund. Was ist nur in meinen Mann gefahren?, fragte ich mich wiederholt. Statt ins Haus zu gehen, setzte ich mich auf einen der Korbstühle, die ich in Nelson für unsere Veranda erstanden hatte, wie ich überhaupt unser ganzes Haus in eine kleine Puppenstube verwandelt hatte.
Richard lässt mir beim Einkaufen stets freie Hand, und ich nutze jede Gelegenheit, nach Nelson zu fahren. Leider besitze ich keinen Führerschein, sodass ich auf Richards Bereitschaft angewiesen bin, mich zu fahren. Einmal am Tag fährt ein Bus, den ich auch mitunter benutze. Es ist jedes Mal ein Vergnügen, in die schöne kleine Stadt zu kommen. Ich liebe die nette Einkaufsstraße mit ihren einstöckigen Holzhäusern. Auf mich, die ich aus einer Stadt wie Hamburg komme, wirkt alles so anheimelnd und gemütlich, ohne dass es langweilig ist. Wie gern würde ich in Nelson wohnen, um die Stadt auf eigene Faust zu erkunden. So fahren wir nur zum Einkaufen her oder in das große Lichtspielhaus.
Wobei wir dort bisher nur einen einzigen Film gesehen haben. Im Westen nichts Neues, ein Film über die Grauen des Ersten Weltkrieges, der bei uns in Deutschland verboten war. Es kostete mich einige Überzeugungskraft, Richard am Verlassen des Kinos zu hindern. Den ganzen Film über schimpfte er über den »vaterlandslosen Unsinn«. Immerhin blieb er. Wie gern würde ich all die schönen amerikanischen Filme angucken, aber seit dem Kinobesuch weigerte sich Richard, mich erneut zu begleiten. Und allein würde er mich nicht gehen lassen. Wie auch? Die Vorführungen finden abends statt, und um die Zeit fährt kein Bus mehr nach Upper Moutere. Es wird höchste Zeit, dass ich das Autofahren erlerne. Besser wäre es natürlich, wir würden umziehen. Es gibt einen leisen Hoffnungsschimmer, dass meine Wünsche wahr werden. Richard streitet sich in letzter Zeit ständig mit dem Kerl, dessen Pub er eigentlich kaufen will. Sie können sich offenbar partout nicht über den Preis einigen. Neulich hat Richard angedeutet, dass er sein Vermögen lieber in einer Obstplantage anlegen sollte. Ich habe ihm eifrig zugeredet, als ich erfahren habe, dass sie am Ortsrand von Nelson liegt. Schließlich stammt Richard von einem Apfelhof aus dem Alten Land. Er hat stets darunter gelitten, dass sein älterer Bruder allen Grund geerbt hat. Nur aus Not ist er schließlich nach Hamburg gegangen und hat eine Lehre zum Zimmermann gemacht. Wirklich wohlgefühlt in seinem Beruf hat er sich nie. Und als ihm im letzten Jahr sein Erbteil ausgezahlt worden ist, hat sein Entschluss festgestanden, dass er es fern der Heimat zu etwas bringen wollte. Zunächst war sein Ziel Kanada, aber der Brief des Cousins eines Schulkameraden hat ihn auf Neuseeland gebracht. Er war wie besessen von dem Gedanken, den Pub dieses Cousins zu übernehmen, der unbedingt nach Deutschland zurückkehren wollte.
Ich wünsche mir von Herzen, dass Richard sich für diese Obstplantage entscheidet. Aber wie sollte er je einen halbwegs vernünftigen Entschluss fassen, wenn er kaum je nüchtern bleibt? Wieder überkommt mich das schlechte Gewissen, dass ich immer noch kein Lebenszeichen nach Hause geschickt habe, aber ich bin oft so schrecklich deprimiert, und ich befürchtete, Anna, das schlaue Kind, würde zwischen den Zeilen lesen, wie unglücklich ich eigentlich bin. Trotzdem bleibt mir nichts anderes übrig.
Das Schreibpapier lag ja bereits vor mir auf dem Verandatisch. So schnell wie meine Feder über deine Seiten fliegt, liebes Tagebuch, so langsam kam ich mit dem Brief voran. Mir wollte partout nichts einfallen. Ich las noch einmal mein Tagebuch, aber wirklich Ermutigendes, was man den Lieben daheim berichten konnte, stand nicht darin. Plötzlich erwischte ich mich dabei, wie ich ihnen von meiner ersten Begegnung mit einem Maori berichtete. Es klang zu viel Begeisterung aus meinen Zeilen, stellte ich fest, nachdem ich den Brief erneut studiert hatte. Also schrieb ich ihn um und hielt meine Begegnung mit dem faszinierenden fremden Mann auf der Fähre kürzer und unverfänglicher. Nachdem ich den Brief in einen Umschlag gesteckt und beschriftet hatte, fühlte ich mich wohler. Ich legte ihn zurück auf den Tisch und widmete mich wieder meinem Tagebuch. Es gibt nämlich eines, das ich dir noch anvertrauen möchte. Ich glaube, etwas könnte ein wahres Wunder in meinem Leben bewirken: ein Kind! Das wünsche ich mir von Herzen, und ich glaube, dann würde Richard auch weniger trinken, und wir könnten vielleicht eine ganz normale Familie werden …
HAMBURG, NOVEMBER 2012
Als Marie und Amelie in der Wohnung ihrer Großmutter ankamen, wurden sie bereits ungeduldig von Anna erwartet. Sie hatte die Haushaltshilfe bereits nach Hause geschickt und eigenhändig einen kleinen Imbiss für ihre Enkelinnen vorbereitet. Als Erstes nahm sie Amelie in den Arm. »Was machst du bloß für Sachen, meine Kleine? Du hast doch nicht wirklich am Fenster gestanden, um …«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!