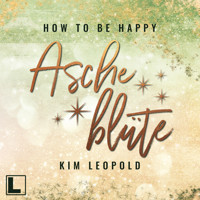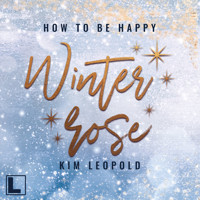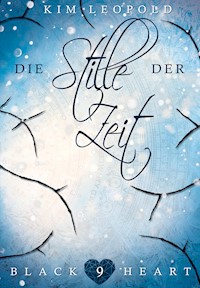
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Nach dem Angriff der Hexenjäger liegt der Palast der Träume in Schutt und Asche. Der Rat ist zerschlagen, geliebte Menschen gestorben. Mittendrin versucht Ivan zu retten, was noch zu retten ist: seinen Bruder, den Rat und sich selbst. In der Zwischenzeit unterstützt Azalea ihren Freund Melvin auf dem harten Weg in sein neues Leben und bekommt eine Lektion in der Kunst der Ablenkung. Währenddessen entdecken Emma und ihr Entführer ihre gemeinsame Vergangenheit und machen Pläne für die Zukunft … Kim Leopold hat eine magische Welt mit düsteren Geheimnissen, nahenden Gefahren und einem Hauch prickelnder Romantik erschaffen, bei dem Fantasy-Lover voll auf ihre Kosten kommen. Die Stille der Zeit – Der Auftakt der 2. Staffel der Urban Fantasy Serie Black Heart!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Black Heart 09
Die Stille der Zeit
Kim Leopold
Für dich, weil du nach dem Angriff auf den Palast der Träume aufstehst und weiterkämpfst.
❤
Nur in der Dunkelheit kannst du die Sterne sehen.
[was bisher geschah]
Der Angriff der Hexenjäger auf den Palast der Träume hat große Folgen für alle. Es sind nicht nur Schüler wie Zoe und Louisa gestorben, sondern auch Lehrer wie Silas und die Schuldirektorin Freya.
Die Kontrolle der Schule auf den entflohenen Gestaltwandler aus Lille hat außerdem einen anderen Schüler auffliegen lassen, der aus der Not heraus die Lehrerin Emma entführt hat.
Nun versuchen sowohl Lehrer als auch Schüler mit den Folgen des Angriffs zurechtzukommen.
[talamh fuar]
Louisa
Irgendwo, irgendwann
Ich schmecke Salz auf meinen Lippen und habe den Duft von frisch gemähtem Gras in der Nase. Mein Blick gleitet in die Ferne, über den Klippenrand hinaus, auf das blau glitzernde Meer, das ruhig vor mir liegt. Die Sonne wärmt meine Haut, und als hätte er meinen Namen gesagt, spüre ich Alex in meinem Rücken. Lächelnd drehe ich mich um und sehe ihn unter einer alten Eiche stehen.
Er schmunzelt und fährt sich durch die zerzausten Haare.
»Du hast auf mich gewartet.«
»Ich würde immer auf dich warten«, entgegnet er und streckt eine Hand aus. Mit schneller schlagendem Herzen gehe ich auf ihn zu, nehme seine ganze Gestalt in mir auf, das Funkeln in den Augen, die Grübchen, die sich mit jedem meiner Schritte vertiefen, seine starken Hände, die mich jetzt schon ein paar Mal gerettet haben. Manchmal kann ich mein Glück kaum fassen, dass er mich wirklich so toll findet. Kurz bevor ich ihn erreiche, schließe ich für einen Moment meine Augen und wünsche mir, dass dieses Glück niemals endet.
Ich öffne sie wieder, hebe die Hand und greife nach seiner, doch –
Ich greife ins Leere.
Mit einem heiseren Aufschrei verliere ich das Gleichgewicht und stolpere nach vorn. Verwirrt öffne ich die Augen. Sind das ... Ich kneife die Augen nochmal zusammen und öffne sie wieder, aber die Fliesen vor mir bleiben die gleichen.
Ich kauere auf dem Boden des Speisesaals, und um mich herum herrscht Chaos. Da sind so viele leblose Körper, so viel Blut, so viel Atem anhalten und bangen, dass mir augenblicklich übel wird.
»Ivan. Ivan!« Eine Stimme reißt mich von dem Anblick vor mir los. Ein Mann löst sich aus der Menge – Dr. Kaminski, erinnere ich mich vage. Von seinem weißen Hemd ist nicht mehr viel zu sehen. Es ist blutgetränkt und hängt ihm in Fetzen vom Leib. Er lässt das Kurzschwert in seiner Hand auf den Boden fallen und läuft an mir vorbei.
Ich blicke ihm hinterher und atme erschrocken ein.
Bin ...
Bin ich das?
Nein.
Kopfschüttelnd weiche ich zurück. Das Bild vor mir ist so surreal. Das kann nicht sein. Ich hebe meine Hand vor Augen, um mich zu vergewissern, dass sie nicht schwarz ist. Dass ich nicht aussehe wie das leblose Mädchen in Ivans Armen, das nicht nur meine Frisur, sondern auch meine Kleidung trägt.
»Ivan, sie ist tot.« Dr. Kaminski legt eine Hand auf Ivans Schulter, doch er reagiert gar nicht. Sein Blick ist immer noch auf das Gesicht des leblosen Mädchens gerichtet. Er ist blass wie ein Gespenst. »Wir brauchen dich jetzt. Du musst dich zusammenreißen. Ich übernehme das.«
Ich übernehme das?
Was will er übernehmen? Die Trauer? Den Schock?
Ivan schluckt und hebt seine freie Hand, um dem Mädchen in seinen Armen die Augen zu schließen. Dann reibt er sich mit dem Handrücken über die Stirn und verschmiert dabei noch mehr Blut in seinem Gesicht. Aber es wirkt, als wäre es ihm egal. Als wäre ihm alles egal.
»Ivan«, wispere ich ängstlich. Wieso steht er nicht auf? Wieso lacht er nicht und erklärt mir, dass das hier nur ein Traum ist? »Sag doch was.«
Dr. Kaminski erhebt sich und dreht sich um. In seinen grauen Augen schimmert die Sorge, es wirkt, als wäre er der Situation nicht gewachsen, und trotzdem erhebt er die Stimme.
»Alle Verletzten neben das Podest, die ... Toten auf die Seite.« Er deutet erst auf die eine Seite des Raumes, dann auf die andere. »Die Hexenjäger dorthin. Keiner verlässt den Speisesaal, bevor nicht klar ist, ob wir in Sicherheit sind.«
Seine Anweisung bringt Leben in die Leute, die wie versteinert darauf gewartet haben, dass etwas geschieht. Dr. Kaminski setzt sich in Bewegung und kommt genau auf mich zu. Bevor ich reagieren kann, ist er bei mir und ... läuft einfach durch mich durch.
Mir wird schlecht. Die Haare auf meinen Armen stellen sich auf, und ich drehe mich blitzschnell um, um ihm hinterherzusehen. Dann schaue ich an mir herunter.
Wie kann das sein?
»Ein merkwürdiges Gefühl, nicht wahr?« Die Stimme jagt mir einen Schauder über den Rücken. Mir ist sofort klar, dass sie nicht aus der Welt kommt, in der sich Ivan befindet.
Sie spricht mit mir. In dieser Welt.
Ich sehe mich um, doch zwischen all den Schülern und Wächtern kann ich zunächst nichts Ungewöhnliches entdecken, aber dann löst sich eine Frau aus der Menge, die bisher unauffällig an der Wand gelehnt hat.
Sie hat braunes Haar und ein blasses Gesicht. Hätte sie mich nicht angesprochen, wäre sie mir überhaupt nicht aufgefallen. Aber jetzt geht sie durch die Menge, weicht niemandem aus, zuckt nicht einmal zusammen, während sich ein paar der Körper für einen Moment mit ihrem verschmelzen.
»Wer bist du?«, frage ich sie argwöhnisch und weiche zurück. Wenn ich eins gelernt habe, dann dass ich niemandem einfach so vertrauen sollte. Sie sieht vielleicht gewöhnlich aus, aber allein die Tatsache, dass sie mich als Einzige sehen kann, sollte mir schon zu denken geben.
»Jemand, der sich sehr über deine Anwesenheit freut.« Sie hebt eine Braue, bleibt ein paar Meter vor mir stehen und verschränkt die Arme vor der Brust. An ihrem Gürtel blitzt ein Dolch auf. »Ich war hier viel zu lang alleine.«
Das teuflische Grinsen in ihrem Gesicht bringt mein Herz zum Stolpern. Ich zögere nicht lange, sondern renne los, direkt auf den Seitenausgang zu, der normalerweise abgeschlossen ist. Heute bete ich dafür, dass die Tür offen ist und strecke eine Hand aus, um an der Türklinke zu rütteln, doch als ich sie berühren will, falle ich einfach nach vorne. Ich kann mich gerade so auffangen und laufe blind für meine Umgebung weiter, weg von der Frau mit dem Dolch und dem irren Blick. Doch ihre Stimme bleibt mir trotzdem im Ohr.
»Och, komm schon, der Spaß hat doch gerade erst angefangen!«
[prolog]
Ichtaca
Mechtatitlan, 1448
Ich unterdrücke ein Schaudern, während der leblose Körper eine um die andere Stufe hinunterfällt. Er sieht seltsam verzerrt aus mit den gebrochenen Knochen, aber ich kann nicht wegschauen.
Ich darf nicht wegschauen.
Mein Herzschlag gleicht sich dem aufreibenden Rhythmus der Trommeln an, in meinem Blickfeld verschwimmt das Leuchten der Fackeln. Ein paar Männer lösen sich aus der Menge, Krieger, einer stärker als der andere. Sie alle tragen die gleichen Masken, um ihr wahres Gesicht vor dem Gott zu verbergen, dem der Priester heute diese Frau als Opfer dargebracht hat.
Ich weiß dennoch, dass Nanauatzin unter ihnen ist.
Ich spüre seine Anwesenheit in jeder Bewegung, in jedem Tanz, jedem grellen Schrei der Sängerinnen - und ich weiß, ich sollte mich für ihn freuen, weil er an diesem Ritual teilnehmen darf. Weil er ausgewählt wurde, mit den anderen Kriegern die leblose Frau vom Boden zu heben und sie durch die Menge zu tragen, als wäre sie der Sarkophag unseres Königs und nicht eine Kriegsgefangene, die man für wertvoll genug erachtet hat, um sie zu opfern.
»Ichtaca.« Mein Vater stupst mich sanft an und deutet auf die Krieger, die immer näherkommen. Die Menge weicht zurück, genau wie wir. Ich will gar nicht so genau hinsehen, doch es fällt mir schwer, den Blick von den Kriegern zu lösen, die nur mit einem Lendentuch bekleidet an uns vorbeischreiten. Ihre Körper sind mit Malereien verziert, Bilder, die sie vor der nächsten großen Schlacht schützen sollen. Ich halte Ausschau nach Nanauatzin, vergleiche die Männer vor mir mit seiner starken, großen Gestalt, die mir so vertraut ist, und erkenne ihn in einem der Krieger ganz am Ende der Gruppe. Er hat den Blick starr geradeaus gerichtet, doch das goldene Licht, das von ihm ausgeht, würde ich in ganz Mechtatitlan erkennen.
Ich frage mich, ob er sich genauso schrecklich fühlt wie ich. Er wirkt nicht so stolz wie der Anführer der Gruppe. Im Gegenteil, ich denke, er wäre froh, wenn einem anderen Mann die Ehre gebührt hätte, vor den Gott zu treten und an der Opferung teilzunehmen. Nach all den Gesprächen, die wir über die Zeremonien geführt haben, weiß ich, dass er - ebenso wie ich - nicht daran glaubt, dass das alles hier die Götter milder stimmt.
Wenn es so wäre, müssten wir keine Kriege führen.
Dann müssten wir nicht in regelmäßigen Abständen zu unseren Göttern beten, damit sie unsere Krieger in der Schlacht schützen. Wir würden in Frieden leben. In Häusern, über denen der Verlust von Familienmitgliedern nicht wie ein großer, schwarzer Schatten schwebt.
Die Menge gerät ein weiteres Mal in Bewegung, die Musik schwillt an und streichelt rau über meine Haut, bis sich die feinen Härchen an meinen Armen aufstellen. Mein Vater greift nach meiner Hand, um mich im Gewühl der Menschen nicht zu verlieren, und gemeinsam folgen wir den Kriegern zum großen Platz im Zentrum der Tempelanlage. Die Fackelträger stellen sich in einem großen Kreis um den dort errichteten Altar auf, dazwischen die Trommler, deren Schläge immer schneller, immer hektischer werden, bis sie plötzlich vollkommen verstummen.
Einer der Krieger lässt einen wilden Schrei los, woraufhin die anderen die Dolche aus ihren Gürteln ziehen und stolz in die Luft recken. In den Klingen spiegeln sich für einen Moment die Flammen der Fackeln, bevor die Männer an den Altar treten und sich an die Arbeit machen.
Mein Blick wird starr, ich schaue hin, aber irgendwie auch nicht, während sie den leblosen Körper häuten und in kleine Stücke schneiden, bevor sie schließlich einen großen Teil des Fleisches verspeisen. Zu sehr erinnert mich die Szene an das Opfer, das meine Mutter vor sieben Jahren erbringen musste.
Meine Kehle schnürt sich zu, während mein Kopf mir wieder und wieder die Bilder vorspielt, die sich in meine Erinnerung eingebrannt haben. Mir wird schlecht, und es fällt mir schwer, gegen die Übelkeit anzuatmen. Ich würde am liebsten davonlaufen und niemals wieder umkehren. Und als würde er meinen inneren Kampf spüren, legt Vater mir seinen Arm um die Schulter und drückt mich an sich.
Seine Hand ist das Einzige, was mich an Ort und Stelle hält.
❤
Fröstelnd schlinge ich das Tuch enger um meine Schultern, bevor ich den Korb aufhebe und mich auf den Weg zum Fluss mache. Es ist noch ruhig, die Sonne geht gerade erst auf und taucht den Himmel in ein zartes Rosa. Ich mache einen Bogen um den großen Platz, weil ich ahne, dass dort noch niemand die Überreste der Zeremonie weggeräumt hat, und ich bin mir nicht sicher, ob mein Magen diesen Anblick so früh überstehen würde. Immer noch habe ich die Schläge der Trommeln im Kopf, den Schrei des Kriegers, das Jubeln und die Musik, nachdem das Opfer verspeist war und die Menge unseren Gott gefeiert hat.
Die Frau konnte kaum älter als ich gewesen sein, und sie hatte Angst. Ihr Licht war so getrübt, so panisch, dass ich am liebsten zu ihr gestürmt wäre, um sie von den Fesseln zu befreien, mit denen man sie auf den Altar des Tempels gebunden hat, bevor der Priester ihr das Herz aus der Brust schnitt. Ich kannte sie nicht, und doch fühle ich mich, als wären wir miteinander verbunden gewesen.
Seufzend streife ich durchs hohe Gras, um zu einer Stelle zu gelangen, an der ich ungestört die Wäsche machen kann. Später, wenn die Sonne die Luft erhitzt, wird es hier von Frauen wimmeln. Ich mag die Unterhaltungen, die Lieder, die Erzählungen der alten Geschichten, all das, womit wir uns die Zeit vertreiben, während wir die Stoffe im Wasser walzen und anschließend trocknen. Doch heute brauche ich die Ruhe, denn in meinem Kopf ist es noch viel zu laut.
Mühsam klettere ich über ein paar Felsen und atme überrascht aus, als sich in mir ein warmes Gefühl ausbreitet.
»Nanauatzin«, murmle ich und erklimme das letzte Gestein, bevor ich einen Blick auf die geschützte Bucht werfen kann. Mein bester Freund steht bis zu den Knien im Wasser und sieht hinaus auf das andere Flussufer.
Freude erfüllt mein Herz, während ich mir den Weg nach unten suche. Ich versuche möglichst leise zu klettern, um ihn zu überraschen, und denke für einen Moment tatsächlich, dass es mir gelingt, doch da dreht er sich um.
»Ichtaca«, begrüßt er mich mit einem sanften Lächeln. Erleichtert stelle ich fest, dass sich durch das Ritual nichts verändert hat. Er hat nichts mehr gemein mit dem mysteriösen Mann mit der Maske und den Malereien, der mit seinem Dolch die Haut einer Frau durchschnitten hat. Nein, heute ist er der Mann, mit dem ich aufgewachsen bin. Der, der mein Knie pustet, wenn ich hinfalle, und mir Blumen bringt, um mich aufzuheitern. Der, der immer da ist, wenn ich ihn brauche.
»Nanauatzin.« Ich stelle den Korb ab, sehe mich um, dann trete ich zu ihm ins Wasser und schließe meine Arme um seinen Körper. Mit meinem Ausatmen fällt die ganze Anspannung von mir ab.
Er vergräbt seine Nase in meinem Haar und drückt mich kurz an sich. Seine Haut duftet nach diesem ungewöhnlichen Geruch, der ihn ausmacht. Seine Arme fühlen sich bei jeder Umarmung stärker an, doch leider werden unsere Umarmungen mit jedem Mal kürzer.
»Du hast mich schon wieder kommen gehört«, stelle ich fest, während er mich loslässt und auf Abstand geht.
»Das ist keine Herausforderung, wenn deine Gedanken so laut sind.« Er streicht sich das dunkle Haar aus der Stirn. Seine grünen Augen leuchten besorgt auf. »Du solltest das wirklich üben.«
»Ich weiß.« Ich verlasse das Wasser, um meinen Korb zu holen und mich damit auf den Felsen niederzulassen, von dem aus ich gut die Kleidung ins Wasser tauchen kann. »Es fällt mir nur so schwer.«
»Früher oder später wird es auffallen, Ichtaca.«
Ich beiße mir schuldbewusst auf die Unterlippe. Nanauatzin sucht sich einen Platz in meiner Nähe. Sein Blick glüht auf meiner Haut.
»Du weißt, dass ich das nicht böse meine, oder?«
Ich lächle und tauche den ersten Stoff ins Wasser. »Wie könntest du jemals etwas böse meinen?«
»Ich will nur nicht, dass sie dich finden.« Seine Stimme ist ungewohnt ernst und lässt mich aufhorchen. »Ich will nicht, dass es dir wie deiner Mutter ergeht.«
»Wird es nicht.« Ich konzentriere mich auf die Wäsche, weil ich ansonsten wieder an die Nacht ihres Todes denken muss. »Sie haben schon eine Weile keine Priesterinnen mehr geopfert, und abgesehen davon bin ich keine Priesterin.«
»Noch nicht.«
»Was soll das heißen? Noch nicht?« Ich halte inne und sehe zu Nanauatzin, der die Beine im Wasser baumeln lässt und ganz entspannt aussehen würde, wäre sein Licht nicht so gedämpft.
Er seufzt. »Du weißt genau, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis du so laut bist, dass sie dich nicht mehr überhören werden.«
Der Gedanke lässt mich erschaudern. Eine Priesterin zu werden ist die eine Sache. Geopfert zu werden, um einen Gott glücklich zu stimmen, eine ganz andere.
Ich will noch nicht sterben.
Eigentlich will ich mehr von diesem Leben.
»Du könntest immer noch mit mir davongehen«, murmle ich leise, doch er schüttelt den Kopf. Ich stecke das Baumwollhemd wieder ins Wasser und beginne es zu schrubben, um die Flecken daraus zu entfernen.
»Du weißt genau, dass ich Verpflichtungen habe. Ohne meinen Verdienst als Krieger würde meine Familie nicht mehr überleben können.«
Weil es keinen Sinn hat, gegen seine Worte anzureden, bleibe ich stumm und arbeite weiter. So oft haben wir uns ausgemalt, wie wir ein Pferd stehlen würden, um damit dem Horizont entgegenzureiten. So oft haben wir davon geträumt, wie der Sternenhimmel an einem anderen Ort aussieht. Und so oft ist uns unser Leben in die Quere gekommen.
Er ist nicht der Einzige, der Verpflichtungen hat. Mir würde es genauso schwerfallen, meinen Vater zurückzulassen. Er hat ja nur noch mich.
»Taca.« Nanauatzin klingt zärtlich, fast wie eine unserer flüchtigen Berührungen. Er sieht mich an, als wäre ich das Schönste und zugleich Gefährlichste in seinem Leben. Ich liebe diesen Blick. Ich habe ihn schon geliebt, seit er ihn mir das erste Mal geschenkt hat.
Sein goldenes Licht breitet sich um ihn herum aus. Ich spüre, wie es zu mir kommt, mich berührt, in mir kribbelt, wie es sich mit meinem eigenen Licht verwebt, und die Intensität der Berührung jagt ein wohliges Schaudern durch meinen Körper.
»Nanauatzin«, flüstere ich, und sein Blick geht tiefer und tiefer. Ich schlucke die Enge in meinem Hals hinunter.
Ich wünschte, er würde mich nie wieder loslassen. Mich für alle Monde berühren, halten, mit mir verwoben sein.
Doch wie immer zieht er sich viel zu schnell zurück und reißt damit das Loch der Sehnsucht in meinem Herzen immer weiter auf, bis ich eines Tages nicht mehr weiß, wie ich es noch zusammenhalten soll.
Sechs Stunden nach dem Angriff der Hexenjäger
[1]
Ivan
Österreich, 2018
Fünfzehn zerbrochene Fenster.
Sechs eingetretene Türen.
Malerarbeiten in zehn Räumen, um das vergossene Blut zu übertünchen.
Viel zu viele Urnengräber.
Der Geruch von wütender Magie, der sich im Gemäuer eingenistet hat.
Unzählige Menschen, die in einer Trauerfeier den Verlust eines Familienmitglieds beweinen werden.
Ein freier Gestaltwandler, der seit Tagen im Schloss umherirrt.
Drei tote Freunde.
Eine entführte Hexe.
Die Einzige, die den Fluch unter meiner Haut aufhalten kann.
Eine junge Frau, die in meinen Armen gestorben ist.
Ein Bruder, dem ich genauso gut das Herz aus der Brust hätte reißen können.
Ich.
Ich und die Regentropfen auf dem Fenster, die zu viele sind, um sie zu zählen.
Warum habe ich überlebt?
[2]
Ivan
Österreich, 2018
Jemand klopft an die Tür. Mein Herz beginnt zu rasen.
»Ivan? Ich bin’s, Lotta.« Ich halte inne und lege den Lappen zurück in den Eimer, bevor ich langsam aufstehe. Mein Herzschlag normalisiert sich wieder.
Sie klopft noch einmal. »Komm schon. Ich weiß, dass du da drin bist. Du kannst dich nicht ewig verstecken.«
Kurzentschlossen öffne ich die Tür und ziehe sie in mein Quartier. Sie quietscht erschrocken auf, doch da habe ich die Tür schon wieder geschlossen. Ihre blauen Augen öffnen sich weit, als sie das Chaos in meinem Zimmer sieht. »Was zum ...? Was machst du hier? Mistest du etwa aus?«
»Meine Wohnung brauchte dringend einen Frühjahrsputz«, krächze ich, und es fühlt sich an, als hätte ich wochenlang nicht gesprochen. Dabei sind gerade mal ein paar Stunden verstrichen, seit ...
Ich würge den Gedanken ab und lasse Lotta im Eingangsbereich stehen, um zurück zu meinem Eimer mit dem lauwarmen Wasser zu gehen. Dort wringe ich den Lappen aus und wische damit über die Kommode unterm Fernseher, die meine Spielekonsole und eine beachtliche Sammlung an Spielen und Filmen enthalten hat.
Über die Hälfte davon stapelt sich nun auf dem kleinen runden Esstisch. Gleich neben ein paar Kleidungsstücken, die ich nicht mehr brauche, und den Psychologie-Wälzern, die ich während meines Fernstudiums in- und auswendig gelernt habe.
»Der Palast liegt in Schutt und Asche, und du ... putzt?« Ich spüre Lottas entgeisterten Blick auf meinem Rücken, schenke ihr aber keine Beachtung. Was soll ich auch groß sagen? Dass ich gerade mein Bestes gebe, nicht die Nerven zu verlieren? Dass ich mich mit möglichst menschlichen Dingen beschäftige, um nicht zu vergessen, dass ich ein Mensch bin?
Ich wasche den Lappen aus, wringe ihn ein weiteres Mal aus und putze über die blitzblanke Oberfläche. Es ist das letzte Möbelstück in diesem Quartier, das ich saubermachen musste.
Ich bin fertig.
Aber wenn ich fertig bin, bedeutet das, dass ich mich anderen Dingen widmen muss.
»Verdammt nochmal!« Ehe ich mich versehe, steht Lotta neben mir und reißt mir den Lappen aus der Hand, um ihn wütend in den Eimer zurück zu pfeffern. Sie zerrt mich zu sich herum. »Wie siehst du überhaupt aus? Oh mein Gott, Ivan. Ist das etwa noch Blut?«
Sie beugt sich vor, zerrt an dem Ausschnitt des T-Shirts, das ich angezogen habe, kurz nachdem ich zurück auf mein Zimmer gegangen bin, und verzieht das Gesicht. »Ausziehen und duschen, na los. Ich kann nicht glauben, dass du dir das Blut nicht abgewaschen hast.«
Ich grummle, doch sie macht nicht den Anschein, zu verschwinden, bevor sie erreicht hat, wofür sie hier ist. Wenn ich meine Ruhe will, mache ich lieber, was sie sagt.
An Ort und Stelle streife ich mein Oberteil ab und bestrafe sie mit einem provozierenden Blick. Sie hält ihm stand, schluckt jedoch, als ich mich auch meiner Hose und der Unterwäsche entledige. Nackt schlurfe ich schließlich ins Badezimmer und stelle die Dusche an. Die Armaturen blitzen mir poliert entgegen und scheinen mich zu verhöhnen.
In den Spiegel sehe ich gar nicht erst. Mein eigenes Gesicht erinnert mich zu sehr an das meines Bruders.
Alex.
In meiner Brust lodern Schmerzen auf, also steige ich unter die Dusche, obwohl das Wasser noch eiskalt ist. Ein Schmerz betäubt den anderen.
Die Kälte rinnt über meinen Körper, aber ich spüre sie kaum. Dafür bin ich zu weit weg. Geistesabwesend wasche ich mich, beobachte, wie das Wasser sich erst rot färbt und dann wieder durchsichtig wird, und drehe irgendwann das mittlerweile viel zu heiße Wasser wieder ab. Ich öffne die Duschkabine und greife nach meinem Handtuch, um es mir um die Hüften zu schlingen. Dabei fällt mein Blick auf den schwarzen Fleck, der sich langsam, aber sicher unter meiner Haut ausbreitet.
Ich kann den Fluch nur einsperren, und dann versuchen wir ihn später zu heilen.
Emmas besorgtes Gesicht flackert vor meinem inneren Auge auf. Ich zwinge mich dazu, den Blick von meinem Körper abzuwenden und mit meinen Bewegungen fortzufahren. Wenn der Fluch nicht an Tempo zulegt, habe ich vielleicht noch ein oder zwei Wochen, bevor er sich in meine Organe gefressen hat. Und dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis ich die Schmerzen nicht mehr ertrage und diesem Witz namens Leben ein Ende bereiten werde.
Lotta hat sich auf mein Sofa gesetzt und wartet auf mich. Sie hebt den Blick und reißt die Augen auf. »Ist das ... Oh Gott, Ivan. Ist das etwa ein Fluch?«
Jetzt ärgere ich mich darüber, mich wie ein trotziger Teenager verhalten zu haben, statt frische Kleidung anzuziehen und Lotta das zu ersparen. »Es ist halb so wild«, grummle ich und hetze aus dem Wohnzimmer, wobei ich mein Handtuch festhalten muss, damit es mir nicht von den Hüften rutscht. Ich schließe die angrenzende Tür und werfe das Handtuch auf mein Bett, bevor ich mir etwas zum Anziehen raussuche.
Frisch angekleidet fühle ich mich beinahe wie ein anderer Mensch.
Aber nur beinahe.
Die Last auf meinen Schultern ist zu erdrückend, als dass ich sie mit einer Dusche einfach abspülen könnte.
Zurück im Wohnzimmer stelle ich fest, dass Lotta nicht länger auf dem Sofa sitzt, sondern an der schmalen Küchenzeile steht und Kaffee kocht. »Der Rat hat eine Sitzung einberufen. Es geht in einer halben Stunde los, und du musst dort sein.«
»Warum?« Ich schnaube auf. »Was soll ich da? Haben wir nichts Wichtigeres zu tun, als uns dort die Köpfe einzuschlagen?«
Sie dreht sich um und mustert mich mit zusammengepressten Lippen. »Ich weiß, dass das hart für dich ist. Ich weiß, dass Silas dein bester Freund und Tyros wie ein Vater für dich war. Ich weiß, dass es Alex, aus welchem Grund auch immer, nicht gut geht. Aber Ivan, Silas würde wollen, dass du das weiterführst, was ihr angefangen habt. Das hier ist deine Chance.« Sie hält inne, und ihr Blick wird weich.