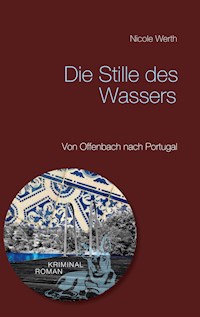
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es geht um Narben im Fell, kontroverse Sichtweisen, die Sehnsucht nach Wahrheit und darum ungewollt zum Spielball der Gesellschaft zu werden. Um Aufbruch, das Ankommen in fernen Welten, Einsamkeit und die Chance der Kunst den Blick zu erweitern. Kommissarin Nast ermittelt im Mordfall des elfjährigen Thiagos. Dabei stösst sie auf eine Neonazigruppe, die bis in die Reihen der Polizei reicht. Der Fall führt zurück in die 30er Jahre. Der kleine Karl Dahlheimer, jetzige Grossvater des toten Kindes, erlebt in der eigenen Familie die Spaltung der Gesellschaft, der Vater Hitleranhänger, die Mutter kommunistische Bildhauerin. Als er vom Tod der Mutter erfährt, die sich dem Widerstand angeschlossen hatte, beginnt der junge SS Mann, seine Welt infrage zu stellen. Er ergreift die Gelegenheit zur Flucht, die ihn zu Fuss durch Europa bis nach Portugal führt. Doch diese Flucht weckt das Interesse des 1950 geborenen Leningrader Buchhändlersohns Nikolai Popow. Dieser europäische Kriminalroman lädt ein, die authentischen Schauplätze zu bereisen. Er wirft einen Blick vom Wirken der Vergangenheit bis in die gesellschaftlichen Strukturen der Gegenwart im Sinne einer kritisch, künstlerischen Betrachtung der zwischenmenschlichen Verhältnisse.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 325
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
„Gewöhnung verschlingt Werke, Kleider, Möbel, die eigene Frau und die Angst vor dem Krieg ... die Kunst existiert, damit man das Gefühl für das Leben zurückgewinnen kann; sie existiert, damit man Dinge fühlt, damit der Stein steinig wird. Der Zweck der Kunst ist es, das Gefühl für die Dinge so zu vermitteln, wie sie wahrgenommen werden können, und nicht, wie man sie schon kennt.“
Viktor Sklovskij
Inhalt
Wellensanft
Der Aufbruch
Mütterchen Russland
Azeitonas e Caroços
Karl
Der Finger
Netzwerke
Unterwegs
Diebe im Gesetz
Der Kollege
Unter Tage
Verhör
Auf der Flucht
Palasthotel
Dina
Russische Verbindungen
Im Baskenland
Die Wege der Babuschka
Endlich in Portugal
Lose Fäden
Westküste
Der Adler
Kartoffeln überall
Jenseits des Tejo
Fliegende Seifenblasen
Die Flamme
Raw Culture Art
Das Mauseloch in der Mauer
Verschwommene Botschaft
1.
Wellensanft
Die Wasserdecke schloss sich über ihr. Dumpf sackte sie tiefer und tiefer, rang verzweifelt nach Luft – und erwachte schweißnass in ihrem Bett. Fröstelnd wälzte sie sich hin und her, überlegte, ob sie aufstehen sollte, zog dann die Decke bis über beide Schultern hoch und zwang sich weiterzuschlafen. Schon im Halbschlaf, zuckte sie zusammen. Ihr Telefon läutete so lautstark, als läge es direkt unter ihrem Ohr. Es musste sehr früh am Morgen sein, draußen begann mattgraues Licht die Dunkelheit zu verdrängen.
„Ja, hallo“, meldete sie sich verschlafen. Es war die Kollegin vom 1. Revier.
„Guten Morgen, verzeih, aber du musst kommen, Fähre Rumpenheim.“
„Okay, alles klar, ich mach mich auf den Weg. Danke.“
Wenn ein solcher Anruf kam, war es wichtig. Das musste nicht extra gesagt werden. Es hatte gedauert, bis sie allen beigebracht hatte, dass sie beim Erstanruf nicht wissen wollte, was geschehen war. Sie wollte sich auf dem Weg zu einem Tatort noch kein Bild machen, nein, sie wollte unvoreingenommen an die Dinge herangehen, sich den Moment der ersten Betrachtung in Unbefangenheit erhalten.
Die LED-Ziffern ihres Weckers sprangen von 5.57 auf 5.58 Uhr um. „Shit“, murmelte sie, glitt aus dem Bett, lief nackt ins Nebenzimmer und sah nach Jordi, die ruhig schlief. Sie strich ihr über die Stirn und streifte eine Lockensträhne aus dem Gesicht. Dann griff sie am Schreibtisch nach Papier und Bleistift und schrieb:
FALLS ICH NOCH NICHT ZURÜCK BIN, BITTE JORDI WECKEN UND ZUR SCHULE BRINGEN. DANKE! NAST
Diesen Zettel legte sie für alle gut sichtbar auf den Küchentisch, sprang in ihre Klamotten, kämpfte die wildlockigen Haare unter die bunte Häkelmütze, schnappte im Laufen Tasche und Schlüssel und rannte zu ihrem Wagen. Das Schloss klemmte wieder einmal, es sollte längst ausgetauscht sein, doch es war schwer, für diesen betagten R4 bezahlbare Ersatzteile zu bekommen. Selbst auf den Schrottplätzen in der näheren und weiteren Umgebung waren die Stücke rar geworden.
Aus dem alten Radio krächzte Gloria Gaynor.
At first I was afraid, I was petrified
Kept thinking I could never live without
you by my side
But then I spent so many nights thinking
how you did me wrong
And I grew strong ...
In voller Lautstärke sang Nast mit, nicht alle Worte stimmten, doch das „And I grew strong“ war perfekt und sicher im Ton.
Sie fuhr zu schnell, doch um diese Uhrzeit war kaum jemand auf der Straße. Der R4 ging in den Kurven gerne etwas in die Knie, deshalb fuhr sie, wenn möglich, Ideallinie und schnitt dabei immer wieder leicht die Gegenfahrbahn. Sie liebte das, sie war in ihrem Element, früher hatte sie immer Autorennen fahren wollen. Damals hatten ihre Eltern noch so großen Einfluss auf sie gehabt, dass sie es sich verbieten ließ, „zu deinem eigenen Schutz“, und heute war ohne Frage der R4 das falsche Auto dafür.
Sie fuhr am Main entlang, durch Bürgel in die Rumpenheimer Straße, die kerzengerade die beiden Stadtteile Bürgel und Rumpenheim verband. Der Letztere, direkt am Mainbogen gelegen, war etwas Besonderes. Ein Ortsteil von Offenbach, der kleinsten Großstadt Deutschlands, der Stadt mit dem höchsten Anteil an Menschen „mit Migrationshintergrund“. Ein ganz eigener, um nicht zu sagen eigensinniger Stadtteil, anders als das restliche Offenbach.
Während die Sonne aufging, fiel Nast an einer Hauswand ein farblich in Grün und Grau geschriebener Schriftzug ins Auge:
Auf einander
Zu gehen
Dieser Text gehörte zur Rumpenheimer Hauswandpoesie. Man konnte statt „Auf einander - zu gehen“ auch „Aufgehen“ oder „Zueinander“ lesen. An einem anderen Haus stand:
FARBE
ist eine
FRAGE
der Kunst
NICHT
der Hautfarbe
Das Haus mit dieser Aufschrift musste das der Malerin Anja Hantelmann sein, sie hatte dieses Projekt initiiert. Bürger, Handwerker und Kunstschaffende hatten sich zu dieser Gemeinschaftsarbeit zusammengeschlossen, um sich offen zu zeigen und andere zum Nachdenken anzuregen über Vielfalt und kulturelles Miteinander. Am Haus einer Lehrerin stand:
ALLES
WAS WIR
LERNEN IST
UNS ZUNÄCHST
FREMD
Ihr ging durch den Kopf, dass es nicht immer so gewesen war. Hier hatten die Bürger einst „ihrem Führer“ zugejubelt, an der Straße, durch die sie gerade gefahren war und die damals Adolf-Hitler-Straße hieß. Damals war das ein vorbildlich angepasster Ort gewesen, der sich schon in den frühen 1930er-Jahren mit einem Schild „Rumpenheim ist judenfrei“ gebrüstet hatte. Brrrr – sie schüttelte den Kopf –, was die Leute sich nur dabei gedacht hatten? Wie konnte man so unmenschlich sein oder werden? Wo war das Gewissen dieser Menschen? Glaubten sie tatsächlich, sie seien besser als andere? Und was ging heute in vielen von ihnen vor? Was dachten sie über die Flüchtenden aus den Kriegsgebieten in Syrien? Die ihr Zuhause verloren hatten, weil sie um ihr Leben fürchteten und keinerlei Perspektive in den zerbombten Gebieten sahen. Hätte nicht jeder so gehandelt in einer vergleichbaren Situation? Wer hatte das Recht, das infrage zu stellen?
Sie fuhr wie mechanisch, ihr Kopf arbeitete. Wir leben in einem Europa, das es uns seit Jahrzehnten ermöglicht, in Frieden und Wohlstand zu leben. Und was passiert? Wir verlieren das Mitgefühl, drehen uns nur noch um uns selbst. Der Blick über den Tellerrand bleibt auf der Strecke. Wer entscheidet eigentlich, wer wo leben darf? Wer entscheidet, welcher Mensch welchen Wert hat?
Nenas Stimme im Radio riss sie aus ihren Gedanken.
Im Sturz durch Raum und Zeit
Richtung Unendlichkeit
Fliegen Motten in das Licht
Genau wie du und ich
Irgendwie fängt irgendwann
Irgendwo die Zukunft an
Ich warte nicht mehr lang
Liebe wird aus Mut gemacht
Ja – Liebe wurde aus Mut gemacht, Mut und Verantwortungsbewusstsein, das war es, was die Menschen brauchten. Das Ruckeln des Basaltpflasters erinnerte sie daran, dass sie ihrem Ziel näherkam. Sie war schon am Marstall angekommen, einer der Vorbauten des Schlosses, einst Bedienstetengebäude mit Ställen und Remisen. Das Schloss stand erhaben direkt am Maindamm, mit Blick auf das Wasser und die Fähre. Es war im Krieg ausgebombt worden, nur noch die zerfallenden Außenmauern standen. Doch man hatte sich daran gewagt, es wieder aufzubauen. Hochwertiges Eigentum wurde geschaffen, historische Böden nachempfunden, dem Denkmalschutz gehuldigt, und mehrere neue Schlossherren teilten sich heute den Prachtbau mitten im kleinen, alten Ortskern mit seinen engen Straßen, die für die SUVs unserer Zeit viel zu eng waren. Nicht selten stritten die Autolenker in der schmalen, holprigen Gasse, die ans Flussufer führte, wer zuerst fahren durfte.
Unten angekommen, wurde sie von einem Gewirr durcheinanderlaufender Menschen und abgestellter Fahrzeuge empfangen. Ein Krankenwagen wendete auf engstem Raum. Für ihn gab es keine Arbeit mehr. Nast parkte auf sandigem Boden an einer Trauerweide. Philipp und Gianna, ihre Kollegen und Freunde, winkten sie hinüber zur Fähre.
„Guten Morgen!“
„Guten Morgen“, war ihre knappe Antwort.
Sie ging an den beiden vorbei auf den Fähranleger zu und sah im seichten Uferwasser einen weißen Plastiksack, verfangen in Gräsern und Schilf. Das Plastik war aufgeschnitten, im Inneren sah man ein Kind, einen Jungen mit hübschen, fast zu weichen Gesichtszügen, nicht entstellt, ohne Wunden, nicht verwest – von den Wellen vorbeifahrender Schiffe leicht geschaukelt, als wolle man ihn in den Schlaf wiegen. Er konnte in Jordis Alter sein.
Sie sank neben dem Sack auf die Knie, um genauer zu sehen, was sie ahnte. Der Uferschlamm gab nach, als wolle er Platz machen für eine lang ersehnte Hilfe, die doch schon viel zu spät kam. Zunächst war sie sich unsicher, das stille Gesicht mit den geschlossenen Augen erschien ihr fremd – und doch, sie kannte ihn. Ein Gefühl des Unwohlseins bohrte sich wie ein Nagel in ihr Gehirn. Es war Thiago, der Junge aus Jordis Klasse.
Nast richtete sich auf und blickte über die graue, schnell dahinfließende Wasserfläche. Der Nagel in ihrem Kopf bohrte weiter, dieses schmerzende Gefühl, dass etwas Schlimmes, nicht wieder Gutzumachendes passiert sei. Als Kommissarin hatte sie schon viele Tote gesehen, auch Kinder waren darunter gewesen, aber diesmal war es etwas ganz anderes. Sie versuchte, ihre Gedanken zu ordnen. Sollte sie den Fall überhaupt übernehmen, war sie nicht befangen? Es wäre ein Leichtes gewesen, sich damit aus der Verantwortung zu ziehen. Aber wollte sie das? Und wollte sie es für sich – oder um Jordi zu schützen? Nein, sie würde nicht die Flucht antreten, sie nahm die Verantwortung an. Das war sie dem Jungen, der so friedlich zu schlafen schien, einfach schuldig.
Gestern war er vermisst gemeldet worden, doch sie hatten das alle nicht ernst genommen. Man hatte ihn für einen Ausreißer gehalten, der noch am Abend oder am nächsten Tag grinsend in der Tür stehen würde. Sie wusste, wie schwer es war, bei solchen Vermisstenmeldungen einzuschätzen, wie ernst die Lage war. Wie viele Kinder machten sich nur einen Spaß daraus, brachen trotzig oder von der Sehnsucht nach Freiheit getrieben auf und erkannten nicht, was sie damit bei anderen anrichteten. Welche Ängste sie auslösten. Niemand hatte damit gerechnet, dass man so schnell Gewissheit über das Schlimmstmögliche haben würde. Dass man Thiago einen Tag nach seinem Verschwinden tot an der Fähre finden würde.
Was konnte ihm passiert sein? Er war nicht einfach ins Wasser gefallen und ertrunken. Dass der Leichnam in einem Plastiksack steckte, sprach für sich. Wer hatte ihm das angetan? Was wusste sie über Thiago? Sie erinnerte sich an einen lebhaften kleinen Jungen, der auf einem Klassenfest aus ziemlicher Höhe von der Schaukel gefallen und sofort aufgestanden war, ohne zu weinen. Aber viel wusste sie nicht über ihn. Zum Spielen und an Kindergeburtstagen hatte Jordi sich vor allem mit ihren Freundinnen getroffen.
Nast riss sich zusammen und ging hinüber zu ihren Kollegen. Philipp und Gianna sahen ihr mit ernsten Gesichtern entgegen.
„Ich kenne den Jungen.“ Nasts Stimme klang seltsam dünn. „Thiago Dahlheimer, etwa 11 Jahre alt, aus Rumpenheim. Er ging in Jordis Klasse.“
„Oh je“, sagte Gianna voller Mitgefühl und legte Nast tröstend eine Hand auf die Schulter.
„Meint ihr, er ist ermordet worden?“, fragte Philipp. „Allein ist er wohl kaum in den Sack gekommen. Oder könnt ihr euch irgendein mögliches Unfallszenario dazu vorstellen? Könnte es sich um eine Entführung handeln? Sind seine Eltern reich genug dafür?“
Nast zuckte mit den Schultern. Das glaubte sie nicht, aber genau wusste sie es nicht. Was wusste sie überhaupt über Thiago und seine Familie?
„Das Erste, woran ich bei einem Jungen in diesem Alter denke, ist Missbrauch“, sagte Gianna mit einem Seitenblick auf Nast. „Da kommt Dr. von Gruben, vielleicht wissen wir bald mehr.“
Der Gerichtsmediziner winkte zu ihnen herüber. Er sprach kurz mit zwei Beamten von der Spurensicherung, dann gingen alle drei zum Mainufer hinunter. Die beiden Beamten zogen den toten Jungen vorsichtig aus dem Wasser. Sie öffneten den bereits aufgeschnittenen Plastiksack. Dr. von Gruben beugte sich über die Leiche. Er zog hier und dort ein Stück Plastik oder Kleidung weg, drehte den kleinen Körper behutsam in verschiedene Richtungen und untersuchte nacheinander die Hände des Kindes. Schließlich richtete er sich auf, zog die Handschuhe ab und kam zu Nast und ihren Kollegen herüber, während die Spusi-Beamten ihren Teil der Untersuchung fortsetzten.
„Schlimm, so ein totes Kind!“ Er schüttelte den Kopf. „Ein Junge, 10 bis 12 Jahre alt, schätze ich. Über die Todesursache kann ich noch nicht viel sagen. Äußere Verletzungen sind auf den ersten Blick keine zu sehen. Er ist vollständig bekleidet. Auf Missbrauch deutet zunächst auch nichts hin. Ein paar Fingernägel sind abgebrochen. Das könnte auf einen Kampf hindeuten, aber es ist bei Jungs in diesem Alter auch nicht ungewöhnlich, denke ich. Mehr kann ich euch erst sagen, wenn ich ihn auf dem Tisch hatte. Ich schicke euch dann den Bericht. Das wird ein, zwei Tage dauern.“
Und schon war der viel beschäftigte Frankfurter Gerichtsmediziner, der Offenbach nebenbei mitbetreute, wieder verschwunden. Nast hatte ihm absichtlich nicht erzählt, was sie über Thiago wusste. Er sollte den toten Jungen vollkommen unbeeinflusst untersuchen.
„Wir müssen herausfinden, wann genau er verschwunden ist, wo und von wem er zuletzt gesehen wurde, was er zuletzt getan oder beabsichtigt hat. Und was seine Neigungen und Gewohnheiten waren. Wo er sich gern aufhielt, wer seine Freunde waren“, fasste sie zusammen. Sie hatte sich inzwischen wieder im Griff. „Ich werde zu seinen Eltern fahren.“ Der erleichterte Blick, den Gianna und Philipp bei diesen Worten wechselten, entging ihr nicht. Niemand überbrachte gern eine Todesnachricht, noch dazu den Eltern eines toten Kindes.
„Könntest du in seine Schule fahren und Lehrer und Freunde befragen, Philipp? Er ging in das Leibnizgymnasium im Offenbacher Westend. Du kannst dir vorher noch mal die Vermisstenmeldung ansehen, da steht sicher schon einiges drin.“ Philipp nickte kurz. „Und wir müssen die Anwohner hier am Mainufer befragen, ob jemand etwas gesehen hat. Gianna, kannst du das übernehmen?“
„Klar, mach ich.“
„Wir bleiben telefonisch oder über WhatsApp in Verbindung. Und sehen uns später im Revier.“
Nast verabschiedete sich und ging zu ihrem Wagen. Thiagos Mutter kannte sie gut, auch wenn sie ihr nie nahegestanden hatte. Mit Martina war Nast, damals noch Anastasia, in derselben Grundschulklasse gewesen. Später, in der Förderstufe, waren sie in Parallelklassen gegangen und hatten sich hin und wieder in Kursen getroffen. Dann hatten sie sich lange, vielleicht jahrzehntelang nicht gesehen. So kam es ihr zumindest vor. Erst an den Elternabenden waren sie sich wiederbegegnet. Einige Freundschaften waren so entstanden, doch mit Martina war sie auch da nicht richtig warm geworden. Martina, so empfand sie es, war und blieb gefangen in den engen Strukturen ihres konservativen, katholischen Elternhauses, in dem sie noch lange und behütet gewohnt hatte. Hier ging man noch jeden Sonntag in die Kirche, meist im ganzen Familiengespann. Auf einem Kirchenfest hatte Martina auch ihren Mann kennengelernt, der einige Jahre zuvor aus Portugal hierhergekommen war. Für ihn war die erste Anlaufstelle die Comunidade Católica de Língua Portuguesa de Offenbach gewesen, die portugiesischsprachige katholische Gemeinde. Erstaunlich schnell hatte er Deutsch gelernt, aber er trug auch – ungewöhnlich für einen Immigranten aus Portugal – einen deutschen Nachnamen: Dahlheimer. Nach einer kurzen Verlobungszeit hatten schon die Hochzeitsglocken geläutet. Zum ersten Mal fiel Nast auf, wie geheimnisvoll das war: ein Portugiese mit deutschem Namen. Welche Familiengeschichte steckte dahinter? Warum war er nach Deutschland gekommen? Konnte seine Herkunft etwas mit dem Tod seines Sohnes zu tun haben? Unwahrscheinlich. Aber Nast hatte gelernt, dass man nie etwas ausschließen sollte, so unwahrscheinlich es auch schien.
Nast räusperte sich und fragte sich, warum sie sich mit Martina nie angefreundet hatte. Sie waren zu verschieden gewesen. Anders als Martina hatte sie sich früh von ihrer Familie emanzipiert. In jungen Jahren schien ihr Weg vorgezeichnet, ihr Werdegang klar voraussehbar. Ihre Familie hatte sich mit einem ortsansässigen Geschäft etabliert, seit 100 Jahren in Familienbesitz. In der kleinen Stadt, in der jeder jeden kannte, war es gleich, wohin sie ging und wen sie traf – alle wussten sie einzuordnen. Besser als sie sich selbst. Sie verachtete die Menschen dafür und fühlte sich in eine Schublade gesteckt. Sie war das einzige Kind, „die Tochter des Drogeriemarkts“, und es war klar, dass sie einmal an die Stelle ihrer Eltern treten, heiraten und dann selbstverständlich den Laden übernehmen würde. Die Eltern hatten den Betrieb in die neue Zeit geführt. „Vom Drogeriegeschäft zur respektablen Parfümerie“, wie ihr Vater immer sagte. Der Laden hatte sich gemausert, der Umsatz vervielfacht. Die Familie schwamm auf der Sahnehaube der Gesellschaft und fühlte sich entsprechend. Gern zementierten sie diese Haltung, indem sie das Kinn leicht nach oben reckten und jederzeit wussten, sich von anderen abzugrenzen. Selbstverständlich war dieser Weg auch für ihr Kind der einzig erstrebenswerte, dachten sie, ohne sich je zu hinterfragen. Es wäre doch dumm, sich nicht ins gemachte Nest zu setzten und die Vorteile zu genießen, die das mit sich brachte. Doch da hatten sie sich getäuscht. Nast hielt nichts vom gemachten Nest.
Sie wollte am liebsten untertauchen, sich der Gesellschaft entziehen, in der sie sich fühlte, als habe sie einen Stempel auf der Stirn. Sie verachtete das kleinstädtische Prominenzgehabe, wollte sich unerkannt bewegen, ihre eigenen Bahnen ziehen.
Für einen Moment zuckte ein schlechtes Gewissen in ihr auf. Aber sie hatte richtig gehandelt, sie musste sich der Gesellschaft nicht beugen. Sie war sie selbst, machte ihr Ding und ging ihren Weg.
Zum Glück hatte sie nie dem Wunsch ihres Vaters entsprochen und sich zum Heiraten drängen lassen. Hielt Ehen sowieso für überflüssige Fesseln, traute Familien-Konstrukten nicht. Sie wollte frei sein, für sich selbst verantwortlich, wollte reisen, in Europa, nach Israel, Nepal und Indien, wollte die Welt erkunden, und zwar am liebsten die ganze. Sie hatte Menschen von allen Kontinenten kennengelernt, Menschen mit ganz unterschiedlichen Zielen und Bedürfnissen. Viele von ihnen waren zu Freunden geworden. Das war ihr Gefühl der Sicherheit, überall auf der Welt jemanden zu kennen. Überallhin unsichtbare Verbindungen zu haben. Menschen, die ihr so nahe standen, dass sie sich über Jahre nicht zu sehen brauchten und trotzdem beim Wiedersehen genau da weitermachten, wo sie beim letzten Mal aufgehört hatten. Eine innere Verbindung bleib bestehen, wie ein unsichtbarer Faden.
Nast hatte niemals an eine feste Bindung gedacht – oder auch nur daran, monogam zu leben. Die Welt war voller aufregender Impulse und Überraschungen. Sie wollte, nein, sie musste weg aus dem Kleinstadtmief. Nach jeder Rückkehr waren mehr von ihren alten Freunden verheiratet gewesen, erstaunlich wenige fanden den Weg in andere Städte, noch weniger in andere Länder. Die meisten waren zu Hause geblieben. Es fing schon damit an, dass sie nicht in einer anderen Stadt studieren wollten, um das Geld für das Zimmer zu sparen. Je weiter von der Großstadt entfernt sie wohnten, so schien es Nast, desto größer war ihre Angst, den Heimathafen zu verlassen, sich frei zu bewegen.
Und doch war auch sie selbst irgendwann zurückgekehrt und „sesshaft geworden“, gar nicht so weit von ihrem ehemaligen Hafen entfernt. Nast musste lächeln. Eigentlich war es nur ein Spaß gewesen, als sie sich damals bei der Polizei beworben hatte, kurz bevor sie wieder einmal aufgebrochen war, diesmal nach Kathmandu. Polizistin – eigentlich hatte das gar nicht zu ihr gepasst. „Gehobener Dienst“, „Beamtenverhältnis auf Widerruf“ – wie spießig das alles geklungen hatte. Bei ihrem unsteten Lebenswandel und dem schlechten Abiturzeugnis rechnete sie sich wenig Chancen aus. Dennoch schickte sie die Bewerbung ab.
Die Aufklärung von Verbrechen hatte sie schon als Kind fasziniert. Als sie vier oder fünf Jahre alt gewesen war, hatte sich in der Nachbarschaft etwas Sonderbares ereignet. Sie selbst hatte damals noch nicht viel verstanden, das meiste war ihr verschwiegen worden, vieles hatte sie sich erst später zusammengereimt oder in alten Zeitungsartikeln nachgelesen. Damals hatte sie nur gemerkt, dass etwas passiert war, das die Menschen in ihrem Umfeld sehr aufregte. Sie waren ganz anders als sonst. Durcheinander, kopflos. Und sie waren stumm. In sich gekehrt. Rituale, die zum Wochenablauf gehörten, wie das übliche Straßenkehren am Samstag, wurden einfach vergessen. Das war noch nie vorgekommen. Die Nachbarin stand plötzlich im Fokus aller Aufmerksamkeit. Auch der kleinen Anastasia war kaum noch Beachtung geschenkt worden. Es war das erste Mal gewesen, dass sie so etwas wie Freiheit gespürt hatte, dass sie dem Radar der Eltern entkam und Dinge allein in die Hand nehmen konnte. Das gefiel ihr, obwohl die Rätselhaftigkeit der Ereignisse und deren Brutalität, die sie ahnte, sie zugleich tief beunruhigte. Dieses aufregende, ambivalente Gefühl hatte sie nie mehr losgelassen.
Die Nachbarin hatte in Heimarbeit gearbeitet, für eine Firma, die Kleinlederwaren, Geldbörsen, Gürtel und Brieftaschen herstellte – Zuschnitte, Klebe- und Stepparbeiten. Es gab eine Tochter und einen Sohn, 9 und 10 Jahre alt, der Vater war Angestellter bei der Stadt. Sie waren sehr freundliche Menschen. Ab und zu war Nast dort gewesen, hatte die handwerkliche Arbeit bestaunt und den Geruch von Leder und Klebstoffen geschnuppert. Eines Tages waren die Nachbarn zum Geburtstag einer Cousine eingeladen, zwei Orte weiter. Der Vater hatte das Fest etwas früher verlassen und war nach Hause gefahren, um noch etwas zu arbeiten. Sie bauten gerade in Eigenkonstruktion eine Garage. Als die Frau mit den Kindern gegen 21 Uhr nach Hause kam, fehlte von ihrem Mann jede Spur. Irgendwann wurde die Polizei eingeschaltet. Man fand verwischte, fast unsichtbare Blutspuren im Hof und einige Tage später auch das fehlende Auto, ein paar Ecken weiter abgestellt, mit Blutspuren im Kofferraum. Es gab keine weiteren Spuren, nichts fehlte, ein Einbruch war nicht nachweisbar, er hatte keine bekannten Feinde gehabt, sich nichts zuschulden kommen lassen. Bis heute, nach mehreren Jahrzehnten, war über den Verbleib des Mannes nichts bekannt. Niemand wusste, ob er sich nur abgesetzt und die Familie verlassen hatte oder ob er tot war, ob ein Verbrechen geschehen war. Der Fall war ein großes Rätsel geblieben. Ja, dachte Nast, das hatte ihr Interesse an der Kriminalistik geweckt. Und an Psychologie. Es interessierte sie, wie Menschen tickten und reagierten, warum sie Straftaten verübten, wie sie dazu kamen, Grenzen auszuloten und zu über-schreiten.
Zwangsläufig, ohne es bewusst zu wollen, analysierte sie Situationen und Charaktere. Ihr Instinkt, ihr Auffassungsvermögen war so fein entwickelt, dass sie sensibel jede Schwingung aufnahm, aber auch komplexe Zusammenhänge erfasste. Sie spann sofort Fäden, sah Berührungspunkte, selbst wenn es so aussah, als hätten die Dinge nichts miteinander zu tun. Nast spürte die Zusammenhänge im Untergrund. Die paar Freunde, die sie wirklich gut kannten, bescheinigten ihr lächelnd einen gewissen Autismus in dieser Beziehung. Sie konnten jedoch nicht verbergen, dass Nasts Gabe ein Faszinosum für sie war. Wie oft hatte sich ihr für andere nicht nachvollziehbares, zu früh ausgesprochenes Bauchgefühl bewahrheitet.
Nast parkte in den engen Gassen des Rumpenheimer Ortskerns und lief ein paar Schritte bis zu einem größeren Innenhof. Das Haus war als einziges in der Straße etwas zurückgesetzt. Einige der rosafarbenen Sandsteinfensterbänke hatten bereits zu bröckeln begonnen. Es war noch immer früh am Morgen, als sie den Knopf neben dem schäbig wirkenden Klingelschild drückte. Alles blieb still. Nach einer Weile überlegte sie, ob sie noch einmal klingeln sollte. Sie zögerte. In einer solchen Situation wollte sie nicht einmal ansatzweise ein Gefühl von Ungeduld aufkommen lassen. Da wurde die Tür plötzlich geöffnet. Martina sah ihr starr in die Augen; sie schien sofort zu begreifen, was los war, hatte als Mutter vielleicht längst das Unverrückbare gespürt. Nasts trauervoller Blick ließ keine Fragen offen. Es war ein steifer, unbeholfener Moment. Sie umarmten sich, sprachen nicht und trotzdem war alles gesagt. Es gab Dinge, die musste man nicht aussprechen, und dennoch wusste jeder Bescheid. Die beiden Frauen weinten stumm. Noch nie waren sie sich näher gekommen als in diesem Augenblick. Mit einer Geste bat Martina Nast in die Wohnung. Luis, Thiagos Vater, kam die Treppe herunter, sah die beiden an und war hineingezogen in den Strudel der sprachlosen Befangenheit.
„Wo – wo ist er?“ Die Worte quälten sich tonlos zwischen seinen Lippen hervor.
„An der Fähre hat man ihn gefunden.“ Auch Nast fiel das Sprechen schwer.
„Wie? Gleich hier an der Fähre? Was ist mit ihm? Wir müssen hin. Los, komm!“
„Er ist tot.“
„Nein, das ist nicht wahr! – Das ist eine Lüge!“, rief Luis ärgerlich und drehte den Kopf zur Seite.
Martina sank auf einen Stuhl am Esstisch. Luis‘ Augen waren aufgerissen und starr, dann sagte er versöhnlicher: „Aber wie – tot? Ist er in den Main gestürzt und ertrunken? – Los, wir gehen dort hin! Martina, anda, komm jetzt.“
„Nein. Er wurde wahrscheinlich umgebracht. Es macht keinen Sinn, dort hinzugehen, ihr dürft nicht an den Tatort und er wurde schon in die Gerichtsmedizin gefahren.“
„Was? Thiago, was machst du? Thiago, wo bist du? … Wer bringt denn ein Kind um? – Wurde ihm etwas angetan?“ Starr und wütend sah er wie durch Nast hindurch.
„Du meinst, ob er missbraucht wurde? Soweit wir bis jetzt wissen – nein.“
„U... und wie soll es jetzt weitergehen? Wir müssen etwas unternehmen. Los, komm, Martina!“ Sein Ton war aufgebracht und resigniert zugleich.
Nast schwieg.
Nach einer Weile sagte sie: „Es tut mir so unendlich leid. – Wir werden alles tun, um die Dinge zu klären. – Denkt ihr, ihr könnt mir ein paar Fragen beantworten? Sicher ist es jetzt ein schwerer Zeitpunkt für euch, doch je früher wir die Fährte aufnehmen, desto besser sind unsere Chancen.“ Und nach einer Pause: „Aber ich verstehe, wenn ihr jetzt erst mal für euch sein wollt.“
„Nein! – Frag nur.“ Luis setzte sich zu Martina und bot zuvor Nast einen Stuhl an.
„Wir müssen wissen, wann ihr ihn zuletzt gesehen habt, wo er hinwollte, was er in seiner Freizeit so gemacht hat, mit wem er befreundet war. Sicher habt ihr das alles schon bei der Vermisstenmeldung zu Protokoll gegeben. Ist es euch lieber, wenn ich es dort nachlese? Aber lieber würde ich es von euch noch einmal hören. Dann kann ich mir ein besseres Bild machen.“
„Nein, nein, wir können es dir erzählen. – Aber bring mein Kind zurück.“ Luis‘ Worte klangen seltsam ausdruckslos, wie auswendig gelernt, und tief verzweifelt. War er sich doch im Klaren, dass er Thiago nie wieder sprechen hören, ihn nie wieder lebendig berühren können würde.
„Thiago ist gestern nicht von der Schule heimgekommen. – Er ist fast jeden Tag mit Moritz zusammen – das ist sein bester Freund.“ Nach langer Pause begann er erneut, zähfließend kamen die Worte aus seinem Mund: „Er kommt immer erst mal heim – isst zu Mittag – und macht Hausaufgaben. – Gestern nicht. – Wir haben bei Moritz angerufen – der wusste nichts. – Thiago wäre nach der Schule ganz normal heimgegangen, hat er gesagt.“
„Könnt ihr mir die Adresse und Telefonnummer von Moritz geben?“ Luis schrieb beides auf einen Einkaufsblock, riss den Zettel ab und reichte ihn ihr. Tränen quollen aus seinen Augen.
„Ich will Thiago sehen“, presste Martina plötzlich hervor.
„Das geht leider im Moment nicht, wir haben ihn in die Gerichtsmedizin gebracht. Ich gebe euch Bescheid, wenn ihr ihn sehen könnt.“
Martina nickte.
„Darf ich mich noch kurz in Thiagos Zimmer umsehen?“
„Selbstverständlich, oben rechts, zweite Tür.“ Martina senkte den Kopf auf ihre Brust und ließ die Tränen fließen.
„Danke.“ Nast ging nach oben. Sie fand ein Jungenzimmer, ordentlich – vielleicht ein wenig zu ordentlich. Bettwäsche mit „Drachenzähmen leicht gemacht“-Motiven,
Bücherregal, Schreibtisch, Computer, Schrank, ein paar Poster an den Wänden: Shaun, das Schaf, ein Rentierjunges im Schnee – ein ungewöhnliches Bild für einen Jungen. Wieder kamen ihr die Tränen. Sie konnte sich nicht konzentrieren, hatte immer wieder den sich in den Wellen wiegenden Thiago vor Augen. Es hatte keinen Sinn, sich jetzt weiter hier umzusehen, sie musste raus aus dieser drückenden Situation, um wieder frei denken zu können. Nast ging die Treppe hinunter, verabschiedete sich von Thiagos Eltern, die ihr wie zwei synchronisierte Roboter zunickten, und fuhr ins Präsidium.
„Puh – das war ein harter Tag.“ Nast sah auf die Uhr. Es war schon 18.30 Uhr. „Mensch! Mist!“
Sie hatte den Kopf so voll gehabt, dass sie gar nicht an Jordi gedacht hatte. Aber dann kam ihr ein zuversichtliches kleines Lächeln auf die Lippen. Sie war dankbar, dass sie so wunderbare Menschen um sich hatte, dass in diesem Umfeld für Jordi immer gesorgt war. Das war ein großes Glück. Sie hatten ein Zuhause, das wie blind funktionierte, ohne dass größere Absprachen nötig waren. Irgendjemand war immer da und jeder der Mitbewohner fühlte sich unmittelbar verantwortlich. Sie waren eine große Familie, nur unkomplizierter.
Vom Revier aus hatte sie es nicht weit, sie bewohnten eine alte Fabrikhalle im Isenburgring, in einem der unscheinbaren Offenbacher Hinterhöfe, die ihr Potenzial erst auf den zweiten Blick entfalteten. Als Nast auf den Hof fuhr, begegnete ihr Vlado. Seit sie ihn kannte, sah er nahezu gleich aus. Sandalen mit nur zwei Riemen, die im Winter durch Wollsocken upgegradet wurden. Eine abgetragene, schlaff hängende Jeans, die nach ¾ Länge abgeschnitten war, lose Webfäden baumelten ungleichmäßig um die Knöchel. Darüber meist ein blass kariertes Hemd und ein halblanger, grauer Kittel. Doch das Besondere an ihm war sein Faible für Putzlappen. Er hatte immer einige bei sich, mal mehr, mal weniger. Sie steckten in allen seinen Taschen und waren manchmal mittels Sicherheits- oder Anstecknadeln an seiner ganzen Montur befestigt. Fast wie ein Fell, alles wippte, wenn Vlado sich bewegte.
Sie blieb noch einen Moment im Wagen sitzen und beobachtete ihn schmunzelnd. Aus den beiden Taschen des Kittels hingen drei musterlose Baumwolltücher in fahlen Farben, sie mussten in vergangenen Tagen Bettlaken gewesen sein. Die linke Hosentasche hatte ein altes, roséfarbenes Kinderhandtuch mit rostigen Flecken zu bieten, aus der Brusttasche seines Hemds lugten zwei kleine, weiße Frotteelappen, die sich an den Rändern auflösten, und in der hinteren Hosentasche musste ein grauer Putzlumpen stecken, der den Kittel ausbeulte und ein Stück unter ihm hervorlugte. Vlado ging, vor sich hin redend, hinüber zu den Mülltonnen.
Sie hatten ihn auf der Straße aufgesammelt, genauer gesagt war er Knöcke zuerst aufgefallen, dem Künstler der Wohngemeinschaft, der sein Atelier im Dachgeschoss des Vorderhauses hatte. Er war gerade mit einer Skizze für seine Ausstellung „Rund ums Offenbacher Wasserhäuschen“ beschäftigt und schaute immer wieder aus dem Fenster auf das gegenüberliegende Kiosk Sprendlinger Landstraße / Ecke Starkenburgring. Zunächst beiläufig, dann genauer beobachtete er diesen verschrobenen alten Mann, der im Grunde schon zum täglichen Stadtbild in diesem Viertel gehörte. „Hm, betriebsblind“, murmelte er vor sich hin und meinte, dass er diesen Menschen zum ersten Mal so richtig wahrnahm. Auf den ersten Blick unscheinbar, doch bei genauerer Betrachtung ein Wunder, dachte Knöcke. Ein in Gänze grau wirkender alter Mann, an dessen Kleidung Anhängsel in Form unterschiedlichster Tücher wippten, wie eine zweite Haut, ein beweglicher Schutzschild. Auf einmal war er da gewesen. Er schien kein Zuhause zu haben, schlief auf der Parkbank auf dem kleinen Spielplatz zwischen Buchrainweg und Sprendlinger Landstraße. Und es fiel den Anwohnern auf, dass er sich nützlich machte, indem er den umliegenden Geschäften seine Hilfe anbot – putzte, Botengänge machte, ihnen die eine oder andere kleine Handwerkstätigkeit abnahm. Nahezu ständig brabbelte er vor sich hin. Wer genau zuhörte, vernahm die immer gleichen Worte: „Nein, nein, nein – so mache ich nicht! Mit mir nicht – nein. Nein, nein. – So will ich nicht.“ Seit Nast ihn kannte, musste er diese Sätze schon millionenmal wiederholt haben.
Er tauchte immer wieder an unterschiedlichen Stellen im Viertel rund um das Krankenhaus auf. Mal in der Reinigung beim Putzen der Fenster, mal am Kiosk, mal an der Pizzeria Tevere – einem Familienbetrieb, dem man die besten Pizzen im ganzen Rhein-Main-Gebiet nachsagte. Dort bekam er regelmäßig eine Pizza, einen Teller Pasta oder worauf immer er Lust hatte. Die netten Signoras und Signores ließen ihn nicht verhungern und er revanchierte sich durch Hilfsdienste. Hin und wieder durfte er auch ein paar ausgediente Lappen mitnehmen – oder er nahm sie einfach mit. Da wurde er jedes Mal schwach und konnte seine Finger nicht kontrollieren.
Als er eines Nachmittags mit einem Pizzakarton auf seiner Bank saß, war Knöcke zu ihm hinübergegangen und hatte ihn gefragt, ob er nicht mit in die Haus-WG ziehen wolle. Abends hatte er die anderen dann vor vollendete Tatsachen gestellt, indem er Vlado zum Abendessen mitgebracht hatte. Und alle hatten zugestimmt, dass Vlado bleiben sollte.
Jeden Abend fanden sich die Bewohner nach und nach in dem großen Saal im Hinterhaus ein, der zugleich die Wohnküche der WG war. Es wurde gekocht, erzählt, gelacht und mal mehr, mal weniger getrunken. Das waren Momente, die jedem guttaten, ein Stück intensives Leben, eine Art Supervision für alle Beteiligten, man sprach über das am Tag Erlebte und wer wollte, gab seinen Standpunkt dazu preis. Jeder nach seinem Gusto. Wer kam, war da, das sicherte ständig wechselnde Zusammensetzungen und stetig neue Impulse.
Sie waren Menschen aus ganz unterschiedlichen Orten, Berufen, Kulturen. Nast, die Kommissarin, ihre 11-jährige Adoptivtochter Jordi, die als 6-Jährige aus Angola kommend allein auf dem Frankfurter Flughafen gestrandet war, Knöcke, der schräge bildende Künstler, der zur Hälfte in Amsterdam und zur Hälfte in Offenbach lebte, José, ein portugiesischer Allroundhandwerker, der leidenschaftlich gern kochte und noch leidenschaftlicher fluchte, die Filmprofessorin Ada, ein unglaublich kluger und inspirierender Mensch, und Sabine, die Jugend-richterin war und damals dafür gesorgt hatte, dass Nast die kleine Jordi bei sich aufnahm. Und all die Freundinnen und Freunde, die diese ohne Konkurrenzen oder Hierarchien zusammenlebende „Kernfamilie“ wie Satelliten umkreisten.
Und natürlich Vlado. Immer noch schmunzelnd zog Nast den Schlüssel ab. Man musste Vlado einfach gern haben. Er war liebenswert in seiner Art und hatte nichts, aber auch gar nichts Böses an sich. Langsam, in kleinen Bruchstücken, hatten sie über die Jahre herausbekommen, dass er ein Trauma aus dem Kosovo-Krieg in sich trug. Bisher hatte er es niemandem anvertraut. Alle hatten mit unterschiedlichsten Methoden versucht, ihn zum Sprechen zu bringen, jeder auf seine Weise – von sanfter Einfühlsamkeit bis zu direkter, offener Ansprache –, doch er war noch nicht so weit, er trug sein Geheimnis fest in sich verschlossen.
Jetzt stand er im Garten wie angewurzelt vor einem großen Lavendelstrauch. „Nein, nein, nein, so mache ich nicht – aber ist doch komisch – immer zu dritt!“
Nast näherte sich ihm. „Hallo Vlado, alles klar? – Ist Jordi da?“
„Ja, ist drinnen mit Ada.“
Wieder schüttelte er leicht den Kopf und sagte: „Nein, nein, nein, so mache ich nicht, mit mir nicht, aber guck doch mal, immer zu dritt. Nein, nein, nein, so nicht ...“
Nast kam noch einen Schritt näher. „Was machst du da? Was meinst du, Vlado?“
„Schau mal da, Nast – immer zu dritt die weißen Schmetterlinge, nein, nein, nein, so mache ich nicht ...“
„Stimmt, Vlado, sie fliegen oft zu dritt. – Schön oder?“
„Ja! Aber so mache ich nicht, mit mir nicht, nein, nein, nein.“
Nast schlug die Augen auf und fühlte sich wie gerädert. Sie hatte unruhig geträumt von großen Flüssen, in denen Puppen schwammen, wie Leichen mit ausgebreiteten Armen an der Oberfläche treibend, doch sie reckten nacheinander die Köpfe aus dem Wasser und begannen laut zu lachen. Sie wollte sich nicht auslachen lassen. Ihr war mit einem Schlag klar, dass ihre Entscheidung die richtige war: Sie würde die Ermittlungen übernehmen. Fast jeder im Präsidium würde es ihr danken. Ihr Chef wusste, dass dann alles gewissenhafter erledigt würde, als wenn er es selbst in die Hand nahm. Er brauchte es nur noch nach außen zu vertreten. Das konnte er gut. Sie hatte sich immer gefragt, warum er diesen Posten innehatte, doch er hatte genau das Selbstbewusstsein, das denen, die ihre Arbeit so gut wie möglich erledigen wollten, die sich immer wieder hinterfragten und dabei den Fortgang der Ermittlungen vorantrieben, oft fehlte. Er strahlte gerne mit der Arbeit, die andere für ihn erledigt hatten.
Jordi kam im Schlafhemd durch die Tür, stieg über die Mischlingshündin Jule, die neben dem Bett schlief, und kuschelte sich zu Nast unter die Decke.
„Guten Morgen, mein Engel, hast du gut geschlafen?“
„Guten Morgen, noch weiterschlafen“, murmelte Jordi, drehte sich um, ruckelte sich an Nast und schlief direkt wieder ein. Nast lächelte, fuhr ihr durch das krause Haar und war voller Liebe für ihre Tochter, die vielleicht auch noch eine Mutter in Afrika hatte. Jordi war ein Geschenk. Nast hatte nicht mehr damit gerechnet, dass sie noch einmal einem Wesen so nahe stehen würde. Es war wunderbar zu sehen, wie dieses Geschöpf aus einem ganz anderen Kulturkreis sich hier entwickelte. Wie lernwillig und wissbegierig sie war, wie flink sie die Sprache gelernt hatte. Zunächst durch Nachahmen der Laute, dann in ersten, holprigen Sätzen, dann immer flüssiger. Alle in der Wohngemeinschaft nahmen Anteil daran und übten mit ihr in jeder Situation. Sie lernte in rasender Geschwindigkeit. Bei der Einschulung war sie eine Exotin in der Klasse, die Einzige mit schwarzer Haut. Es passierte, dass Kinder ihre Finger in Jordis Haut drückten und sie fragten, ob sie sich angemalt hätte. Nach einem halben Jahr kam ein Junge aus Pakistan in die Klasse, dessen Haut auch dunkler war. Da war das Thema schon vertraut. Nast stellte fest, dass die Kinder ohne Vorurteile waren. Sie wollten einfach die Unterschiede wahrnehmen, wollten sie erspüren. War das erledigt, war es kein Thema mehr.
„He Süße, aufstehen.“
„Mmm, ja – ja.“
„Ich kann dich heute zur Schule begleiten.“
„Oh ja, fein, wenn du mitgehst, dann stehe ich jetzt sofort auf.“
Nast begleitete Jordi zur Schule und ging weiter zum Präsidium. Der Chef überließ es ihr, sich ein Ermittlungsteam zusammenzustellen. Das waren natürlich Gianna und Philipp. Da zunächst zeitintensive Befragungen anstanden, holte Nast noch drei Beamte vom Bereitschaftsdienst dazu. Nast bat alle in ihr Büro und sie tauschten erste Ermittlungsergebnisse aus. Peter Müller von der Spusi referierte kurz, welche Fundstücke am Tatort sichergestellt worden waren. Die übliche Sammlung von Zigarettenkippen, Knöpfen, Plastik- und Zettelfragmenten. Nast stellte Kleinteams zusammen, die sich genauer mit den verschiedenen Gegenständen befassen sollten. War etwas Ungewöhnliches, Aussagekräftiges darunter, etwas, das als Spur oder Indiz infrage kam?
Philipp hatte von Nast erfahren, dass Thiagos bester Freund Moritz hieß und wo er wohnte, hatte ihn am Vortag aber nicht zu Hause angetroffen. Am Nachmittag würde er ihm und seinen Eltern erneut einen Besuch abstatten. Gianna hatte Stunden damit verbracht, systematisch die Anwohner des Mainufers zu befragen, aber niemand hatte irgendetwas gesehen, das ihnen weiterhalf.
Für 11 Uhr war eine erste Pressekonferenz angesetzt. Nast nahm daran teil, ließ aber ihren Chef reden. Er konnte noch keinerlei Ermittlungsfortschritt vermelden, aber das wie immer sehr eloquent.
2.
Der Aufbruch
„Heute ist Donnerstag, der 16. Juni 1932“, krächzte es aus dem Volksempfänger.
„Guten Tag, es folgen die Kurzmeldungen. Schweiz: In Genf wird heute der Weltbasketballverband FIBA gegründet. Deutschland: In Berlin werden die Vorbereitungen zur 9. großen Deutschen Funkausstellung im August getroffen. Hessen: In Offenbach findet eine Kundgebung der NSDAP statt – Adolf Hitler spricht auf dem Bieberer Berg. Anschließend Fackelmarsch durch die Innenstadt.“ Eine kurze Pause folgte. „Sehr geehrte Damen und Herren, wir müssen den soeben gesendeten Beitrag berichtigen. Die Kundgebung der NSDAP findet nicht wie angekündigt auf dem Bieberer Berg statt, sondern muss zum SV Offenbach 03 ausweichen. Der Mietvertrag wurde kurzfristig von Vorstandsmitglied Rechtsanwalt Dr. M. Weinberg für ungültig erklärt. Wir bitten um Ihr Verständnis.“
„Was?!“, empörte sich Johann, der gerade zur Tür hereingekommen war und die Gummistiefel abstreifte, während er sich, nach vorne gebeugt, mit beiden Händen am Buffet festhielt. Mit einem aufeinanderfolgenden Plopp und Plupp fielen die Stiefel zu Boden und blieben dort stehen. „Das darf doch nicht wahr sein. Sie lassen ihn nicht auf dem Berg reden?“
„Gut so! Was für ein Glück, dass sie diesen Hetzer nicht auf den Kickers sprechen lassen. Schon schlimm genug, dass er überhaupt vor den Landtagswahlen hier aufmarschieren muss. Auf den hätten wir gut verzichten können“, gab seine Frau Käthe zurück.





























