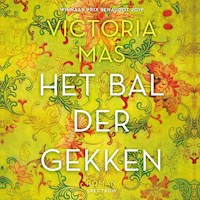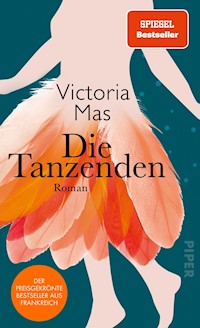
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Deine beste Eigenschaft wird auch immer dein größter Makel sein: Du bist frei.« Brillante junge Literatur zwischen Feminismus, historischem Lehrstück und Unterhaltung: Der engagierte und aufwühlende Bestseller von Victoria Mas begeistert Leserinnen und Leser auf der ganzen Welt! Die Geschichte in »Die Tanzenden« scheint unglaublich: In der Pariser Nervenheilanstalt La Salpêtrière findet Ende des 19. Jahrhunderts ein jährlicher Ball statt, bei dem sich die Insassinnen verkleiden und vor großem Publikum als Hysterikerinnen und Epileptikerinnen erniedrigen müssen. Denn für die Pariser Hautevolee sind diese Frauen so faszinierend wie Zootiere. Die neunzehnjährige Eugénie will das nicht mehr hinnehmen – und plant gemeinsam mit anderen ihren Ausbruch. Die Protagonistinnen dieses gefeierten Debütromans mögen eine literarische Erfindung sein, ihre Geschichte aber ist es nicht. Denn die Salpêtrière existiert bis heute. Hier wurden im 19. Jahrhundert Frauen eingeliefert, die der Gesellschaft zu vorlaut, zu selbstbestimmt, zu freiheitsliebend waren. Die Diagnose »Hysterie« bedeutete für viele ein Leben inmitten kranker, mittelloser und vergessener Frauen, abgeschnitten und ohne jede Chance auf Selbstverwirklichung. »In einer glasklaren Sprache, leicht wie ein Pastell, schreibt Victoria Mas gegen die männliche Norm an und gibt denen eine Stimme, die man mundtot gemacht, unterdrückt, hypnotisiert hat.« – L'Obs »Die Tanzenden« wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet und für Amazon Prime verfilmt. Victoria Mas ist mit ihrem Debütroman auf Anhieb zu einer jungen Stimme des kämpferisch-modernen Feminismus geworden. Es ist die Kraft ihres einfühlsamen und mitreißenden Erzählens, die ihn zum Bestseller werden ließ – und das nicht nur in Frankreich! Wer das Ringen um Freiräume in einer viel zu engen Welt verstehen will, sollte diesen Roman lesen. »Starke Frauenfiguren, dazu diese wundersam zarte Sprache: ein wirklich beeindruckendes Debüt von Victoria Mas!« – Freundin
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhalt
Cover & Impressum
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Epilog
2
Eugénie
20. Februar 1885
Seit drei Tagen schneit es. In der Luft sehen die Flocken wie Perlenvorhänge aus. Auf den Gehwegen und in den Parks liegt eine weiße, knirschende Schicht aus Schnee, der kleben bleibt an den Pelzmänteln und den Stiefeln, die durch ihn hindurchstapfen.
Die Clérys, mit dem Abendessen befasst, achten nicht mehr auf die Flocken, die gemächlich hinter den Fenstertüren fallen und auf dem weißen Teppich des Boulevards Haussmann niedergehen. Auf ihre Teller konzentriert, zerschneiden die fünf Familienmitglieder das rote Fleisch, das der Diener ihnen serviert hat. Die Decke über ihren Köpfen ist mit Stuck verziert. In der Wohnung, die der Pariser Bourgeoisie alle Ehre macht, drängen sich Möbel und Gemälde, Kronleuchter, Kerzenhalter und Gegenstände aus Marmor und Bronze. Es ist ein früher Abend, wie die Clérys ihn oft begehen: Auf den Porzellantellern klappert das Besteck, die Stuhlbeine knarzen unter den Bewegungen der Sitzenden, und im Kamin prasselt das Feuer, das der Diener immer wieder mit dem Haken schürt.
Schließlich ertönt in der Stille die väterliche Stimme.
»Ich hatte heute Besuch von Fochon. Die Erbschaft seiner Mutter hat ihn nicht sonderlich zufriedengestellt. Er hatte gehofft, das Schloss in der Vendée zu bekommen, aber das hat seine Schwester geerbt. Seine Mutter überlässt ihm nur das Appartement in der Rue Rivoli. Was für ein armseliges Trostpflaster!«
Der Vater sieht nicht von seinem Teller auf. Nun, da er gesprochen hat, dürfen auch die anderen das Wort ergreifen. Eugénie schaut kurz zu ihrem Bruder, der ihr mit gesenktem Kopf gegenübersitzt. Sie nutzt die Gelegenheit.
»In der Stadt erzählt man sich, Victor Hugo sei gesundheitlich sehr angegriffen. Weißt du irgendetwas darüber, Théophile?«
Überrascht sieht ihr Bruder auf, während er weiter sein Fleisch kaut.
»Nicht mehr als du.«
Auch der Vater blickt nun seine Tochter an. Er bemerkt ihren vor Ironie sprühenden Blick nicht.
»Wo in Paris hörst du solche Sachen?«
»Bei den Zeitungsverkäufern. In den Cafés.«
»Ich schätze es nicht, dass du dich in Cafés herumtreibst. So etwas schickt sich nicht.«
»Ich gehe nur zum Lesen dorthin.«
»Selbst wenn. Und erwähne gefälligst nicht den Namen dieses Mannes in unserem Haus. Er ist alles andere als ein Republikaner, auch wenn gewisse Leute das behaupten.«
Die Neunzehnjährige verkneift sich ein Lächeln. Würde sie ihren Vater nicht provozieren, ließe sich dieser nicht mal dazu herab, sie anzusehen. Sie weiß, dass ihr Leben den Patriarchen erst interessieren wird, wenn jemand aus ebenso gutem Hause wie ihrem, was heißt aus einer Anwalts- oder Notarsfamilie, um ihre Hand anhält. Das ist der einzige Wert, den sie in den Augen ihres Vaters je haben wird – ein Wert als Ehefrau. Eugénie kann sich schon jetzt seine Wut vorstellen, wenn sie ihm beichten wird, dass sie nicht vorhat zu heiraten. Ihre Entscheidung steht seit Langem fest. Denn nichts liegt ihr ferner, als ein Leben zu führen wie das ihrer Mutter, die zu ihrer Rechten sitzt – ein Leben, das sich auf die Wände eines bürgerlichen Appartements beschränkt, das dem Zeitplan und den Entscheidungen eines Mannes unterworfen ist, ein Leben ohne Ambition oder Leidenschaft, ein Leben, in dem man stets nur das eigene Bild im Spiegel betrachtet – vorausgesetzt, sie erkennt sich dann noch –, ein Leben, dessen einziger Zweck es ist, Kinder zu bekommen, und in dem es höchstens noch darum geht, die Kleidung für den jeweiligen Tag auszuwählen. Das alles will sie auf keinen Fall. Stattdessen will sie alles andere.
Links neben ihrem Bruder sitzt ihre Großmutter väterlicherseits und lächelt ihr zu. Der einzige Mensch in der Familie, der sie so sieht, wie sie wirklich ist: voller Zuversicht und Stolz, blass und dunkelhaarig, mit einer Denkerstirn, wachen Augen und einem dunklen Fleck in der linken Iris, eine stille Beobachterin, die sich alles merkt – und vor allem nicht eingeschränkt werden will, weder in ihrem Wissensdrang noch in ihren Zukunftsabsichten – und die in diesem Punkt derart kompromisslos ist, dass es einem zuweilen ganz bange um sie wird.
Vater Cléry sieht zu Théophile, der noch immer mit großem Appetit isst. Wenn er sich an seinen Ältesten wendet, wird der väterliche Ton milder.
»Théophile, konntest du die neuen Bücher durcharbeiten, die ich dir gegeben habe?«
»Nicht ganz, ich habe noch ein bisschen Lesestoff aufzuholen. Ich fange im März damit an.«
»In drei Monaten beginnt deine Ausbildung in der Kanzlei, ich will, dass du den Stoff bis dahin wiederholt hast.«
»Wird erledigt. Da fällt mir ein, morgen Nachmittag bin ich nicht hier. Ich gehe in einen Debattiersalon. Der junge Fochon wird übrigens auch da sein.«
»Aber gewiss doch, betätige deinen Geist. Frankreich braucht eine Jugend mit Verstand. Erwähne bloß nicht die Erbschaft seines Vaters, das würde ihn nur belasten.«
Eugénie blickt ihren Vater an.
»Wenn Sie von einer Jugend mit Verstand sprechen, meinen Sie Jungen und Mädchen, nicht wahr, Papa?«
»Ich habe dir schon einmal gesagt: Frauen haben in der Öffentlichkeit nichts zu suchen.«
»Wie traurig wäre ein Paris, das nur aus Männern besteht.«
»Genug, Eugénie.«
»Männer sind immer so ernst, sie wissen nicht, wie man sich amüsiert. Frauen können ernst sein, aber sie können auch lachen.«
»Widersprich mir nicht.«
»Ich widerspreche Ihnen ja gar nicht: Wir diskutieren. Genau das sollen Théophile und seine Freunde Ihrer Meinung nach morgen tun …«
»Es reicht! Ich habe dir schon einmal gesagt, dass ich derlei Unverschämtheiten in meinem Haus nicht dulde. Du darfst den Tisch verlassen.«
Der Vater schlägt sein Besteck klirrend gegen den Teller und blickt Eugénie herausfordernd an. Er ist derart gereizt, dass sich die Haare seines Backenbartes und seines dichten Schnurrbarts aufrichten. Stirn und Schläfen laufen rot an. Immerhin hat es Eugénie heute Abend geschafft, ihm eine Gefühlsregung zu entlocken.
Die junge Frau legt ihr Besteck auf den Teller und die Serviette auf den Tisch. Nicht unzufrieden mit der kleinen Verwirrung, die sie angerichtet hat, steht sie auf, grüßt unter dem bekümmerten Blick der Mutter und dem amüsierten ihrer Großmutter mit einem kurzen Nicken in die Runde und verlässt das Esszimmer.
»Du konntest dich vorhin wirklich nicht beherrschen, nicht wahr?«
Es ist Nacht geworden. In einem der fünf Zimmer der Wohnung schüttelt Eugénie das Bettzeug auf. Hinter ihr steht die Großmutter im Nachthemd und wartet darauf, dass sie schlafen gehen kann.
»Ich wollte nur, dass wir uns ein bisschen amüsieren. Dieses Abendessen war so unsäglich trist. Setzt Euch, Großmutter.«
Sie nimmt die runzlige Hand der alten Frau und hilft ihr, sich aufs Bett zu setzen.
»Noch beim Dessert war dein Vater verärgert. Du solltest seine Laune nicht überstrapazieren. Ich sage das dir zuliebe.«
»Macht Euch keine Sorgen, was mich betrifft. Noch tiefer kann ich in Papas Ansehen nicht sinken.«
Eugénie hebt die nackten, dürren Beine ihrer Großmutter an und hilft ihr, unter die Bettdecke zu schlüpfen.
»Ist Euch kalt? Soll ich noch eine Decke holen?«
»Nein, Liebes, alles gut.«
Die junge Frau kauert sich vor das wohlmeinende Gesicht der Alten, die sie jeden Abend zu Bett bringt. Ihr Blick tut ihr gut. Das Lächeln, wenn ihre Runzeln sich heben und ihre blassen Augen schmaler werden, ist das zärtlichste auf der ganzen Welt. Eugénie liebt sie mehr als ihre eigene Mutter, vielleicht zum Teil auch deshalb, weil ihre Großmutter sie mehr liebt als eine eigene Tochter.
»Meine kleine Eugénie. Deine beste Eigenschaft wird auch immer dein größter Makel sein: Du bist frei.«
Ihre Hand kommt unter der Bettdecke hervor, um über das dunkle Haar der Enkelin zu streichen. Doch all das sieht Eugénie längst nicht mehr: Ihre Aufmerksamkeit hat sich etwas anderem zugewandt. Sie starrt in eine Ecke des Zimmers. Nicht zum ersten Mal fixiert sie regungslos einen unsichtbaren Punkt. Diese Momente dauern nie so lange, dass es wirklich beängstigend wäre. Geht ihr ein Gedanke oder eine Erinnerung durch den Kopf, etwas, das sie aufwühlt? Oder ist es wie damals, als Eugénie zwölf war und schwor, sie würde etwas sehen? Die alte Frau wendet den Kopf in die Richtung, in die ihre Enkelin blickt: In der Ecke des Zimmers befinden sich eine Kommode, eine Blumenvase und ein paar Bücher.
»Was ist, Eugénie?«
»Nichts.«
»Siehst du etwas?«
»Nein, nichts.«
Eugénie kommt wieder zu sich und streichelt lächelnd die Hand ihrer Großmutter.
»Ich bin müde, mehr nicht.«
Sie wird ihr nicht erzählen, dass sie tatsächlich etwas sieht – besser gesagt jemanden. Dass sie ihn schon längere Zeit nicht mehr gesehen und dass seine Anwesenheit sie überrascht hat, auch wenn sie sein Kommen spüren konnte. Seit ihrem zwölften Lebensjahr sieht sie ihn. Er war zwei Wochen vor ihrem Geburtstag gestorben. Kaum ein paar Tage später saß die ganze Familie im heimischen Salon beisammen. Und ebenda war er ihr zum ersten Mal erschienen. Überzeugt, dass die anderen ihn ebenfalls sahen, hatte Eugénie gerufen: »Schaut doch, Großvater ist hier, er sitzt im Sessel, schaut!« – und je mehr man ihr widersprach, desto mehr beharrte sie darauf: »Großvater ist hier, ich schwöre es!« Bis ihr Vater sie so scharf und heftig zurechtwies, dass sie es später nie mehr wagte, die Anwesenheit des Verstorbenen zu erwähnen. Seine Anwesenheit und die der anderen.
Denn neben ihrem Urahn erschienen ihr auch andere. Als hätte die Tatsache, dass sie ihn einmal gesehen hatte, etwas in ihr aufgebrochen. Eine Art Durchgang, den sie in Höhe des Brustbeins verortet – jedenfalls spürt sie es dort –, ein Durchgang, der bis dahin versperrt und mit einem Mal frei war. Die anderen, die ihr erschienen, kannte sie nicht. Es waren Fremde, Frauen wie Männer jeden Alters. Sie tauchten nicht plötzlich auf – immer merkte Eugénie, wie sie allmählich näher kamen: Ihr wurden die Glieder schwer, sie spürte, wie sie in einen Halbschlaf sank, als wäre sie plötzlich ihrer Kraft beraubt, zugunsten von etwas anderem. Dann wurden sie sichtbar. Sie befanden sich im Salon oder saßen auf einem Bett, standen neben dem Esstisch und schauten ihr beim Essen zu. Als sie noch kleiner war, fürchtete sie sich vor diesen Visionen, die sie zu einer wortlosen Einsamkeit verdammten. Wenn sie gekonnt hätte, hätte sie sich in die Arme ihres Vaters gestürzt und ihr Gesicht in seiner Jacke vergraben, bis die- oder derjenige sie in Ruhe ließ. So verwirrend das alles war, eines wusste sie genau: Es handelte sich nicht um Halluzinationen. Das Gefühl, das die Erscheinungen in ihr auslösten, ließ keinen Zweifel zu. Diese Leute waren tot, und jetzt besuchten sie sie.
Ende der Leseprobe