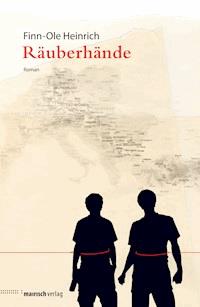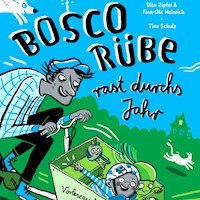7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: mairisch Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein kleiner Junge steigt aus dem See, aus seinen viel zu großen Badeshorts läuft das Wasser in den Kies. Nichts ist passiert, könnte man leichthin behaupten. Aber Finn-Ole Heinrich sieht neun Erzählungen lang genauer hin und schafft es, den Leser dabei an allen kleinen Details, allen Wendungen teilhaben zu lassen. Ihn spüren zu lassen, dass die Fingerspitzen runzelig und die Lippen blau geworden sind und der Kies seine ganz eigene Weite besitzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 180
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Gummistiefel
Emilie
Was es heißt
Sein längster Gedanke
Soweit kein ungewohntes Wort
Mutters Hund
Letzte Wünsche
Schwarze Schafe
Die Welt ist kurzbeinig
Danksagung
Finn-Ole Heinrich
Impressum
Gummistiefel
Immer Gummistiefel. Die trägt sie durch die ganze Welt oder die tragen sie durch die ganze Welt. Und bei ihr sieht’s noch nicht mal blöd aus. Und wenn sie ‘nen Rock dazuträgt sogar richtig sexy.
Lucy war gar nicht lange hier, die letzten beiden Jahre vorm Abi. Dann ein Jahr gar nicht. Jetzt kommt sie einmal pro Jahr. Zu mir. Und bleibt ein oder zwei Wochen. Dann bringt sie alles durcheinander. In ein oder zwei Wochen. Und es dauert fast ein halbes Jahr, bis alles wieder ist, wie es gehört.
Währenddessen ist sie unterwegs und fehlt mir. Solange bis ich froh bin, dass sie wegbleibt und ich mich mit allem anfreunde, was ohne Lucy geschehen kann. Dann kommt sie wieder.
Ich weiß noch, es war der Tag, an dem ich sie mit Fingern essen sah. Da mag sie schon bald ein halbes Jahr mit ihren Gummistiefeln durch unsere Flure gelatscht sein. Da hatte ich mich wohl schon an ihre immermüden Augen und ihre immerwachen Mundwinkel gewöhnt.
Irgendwann war sie einfach da. Keiner stellte sie vor und keinem stellte sie sich vor. Sie war da, das reichte, mit ihrer Schnute und den Augen und den Mundwinkeln, die immer einen Zweifel ließen.
Als sie das erste Mal ihren Namen sagte, weil das Klassenbuch vervollständigt werden sollte, ich weiß noch: da hat sie geschmunzelt und laut und fest »Lucy« gesagt. Das konnte sie. Und plötzlich war es still im Raum, alles Schreiben, Rascheln, Flüstern wie eingefroren. Woher sie komme. Wir waren sicher: mindestens Bremen oder Hamburg oder Berlin. Wahrscheinlich Berlin. Es dauerte ein halbes Jahr, bis einer danach fragte. Und alles war wieder wie eingefroren und Lucy sagte »Bremerhaven«. Und es war nicht zu fassen. Für niemanden. Dass eine wie sie keine dreißig Kilometer von uns aufgewachsen sein soll. Dass sie dieselben Sommer gehabt und die gleichen Winde ins Gesicht gepustet bekommen hat. Eine wie sie, die sich nichts sagen ließ.
Sie stopfte sich einfach ihren Mund voll. Sowas von genüsslich, so hin und weg, so weltenfern und selbstverständlich. Ihre Mundwinkel suchten das Weite. »Essen«, sagte sie laut und fest und schmunzelte. Wir saßen da und staunten. »Ich habe Geburtstag«, sagte sie weiter, »also essen wir«. Und natürlich aßen alle. Einige wollten den Kopf schütteln, darüber, dass Lucy einfach auf jeden Platz ein großes Stück Kuchen gelegt hatte und nun alle aßen wie befohlen und sie nicht aufhörte zu schmunzeln. Einige wussten nicht, worüber und ob nicht vielleicht über sie. Ich musste lachen. Und Lucy lächelte zurück. Mich an. Ich weiß noch, es war der Tag, an dem ich sie mit Fingern essen sah.
An Lucy habe ich die Dinge, von denen man immer redet, schließlich verstanden. Mit Fingern essen. Ja, das tun auch andere, aber bei ihr habe ich verstanden, worum es geht: um das Gefühl, ums Sich-Nicht-Hinhalten-Lassen, um einfach machen, um Kuchen in den Fingern kneten und mehr fühlen als alle, die mit Gabeln essen.
Für Lucy bräuchte man mehr als zwei Augen, die auch noch in dieselbe Richtung starren. Das hab ich nicht nur einmal gedacht. Es liegt daran, vielleicht, dass sie wie aus wundervollen Einzelteilen ist. Zusammengezaubert oder so. Der watschelige Gang, die Riesenschnute und der Geruch ihrer Haare. Die wackelnde Nasenspitze. Dass sie immer vorläuft und gegen den Wind redet, die zu kleinen Ohren und die breiten Augenbrauen. Ihre Fingernägel, die aussehen wie Pfennigstücke und ihr Morgendurst nach Milch. Da braucht man schon ein paar Augen mehr, um sie ganz zu erfassen.
Ein paar Tage später dann stand ich nach der Stunde auf und packte meine Sachen gar nicht erst zusammen, sondern ging gleich zu ihr rüber. Sonst wär sie schon längst weg gewesen. Sie sitzt ja immer auf gepackten Sachen und hält’s nirgendwo lang aus.
Dass ich mich gern mit ihr treffen würde, habe ich gesagt, und es war die Wahrheit. Ich hatte keine Idee, was ich mit ihr anfangen sollte. Was macht man mit so einer. Treffen wollte ich mich mit ihr, Zeit verbringen oder so. Und sie zuckte die Schultern und sagte »okay«. Dann gingen wir los.
Ich wüsste gern, wo ihre ständigen Ideen herkommen. Lange habe ich vermutet, aus ihrem Kopf, irgendwo in der Mitte zwischen ihren Ohren oder vielleicht ein kleines Stückchen darüber, ungefähr hinter den Augen. Aber dann irgendwann hab ich gedacht: Das ist doch Unsinn. Warum grad der Kopf, das würde nicht zu ihr passen. Warum nicht die Kniekehle oder der Hüftspeck oder die Stelle zwischen Daumen und Zeigefinger, die keinen Namen hat. Irgendein Ort jedenfalls, auf den man eben nicht sofort kommt. Irgendwo da, wo sonst keiner Ideen her hat und irgendwo, wo es kein Aufsehen erregt.
Warum sie Gummistiefel trägt, wollte ich wissen. »Praktisch«, hat sie gesagt. Da muss man morgens nicht nachdenken, was es für einen Tag geben könnte, wenn man eh mit Gummistiefeln losläuft und einem also nichts passieren kann. Stimmt, hab ich gedacht, mit Gummistiefeln ist irgendwie alles machbar. Wenn man will sogar Heiraten. Man muss sich ja nur trauen.
»Piefich«, hat sie gesagt. Und dann habe ich es mit ihr gesagt: »piefich«. Piefich fanden wir es hier und wollten immer weg. Und sie ist dann gegangen. Sobald wie möglich: Abi und los. Sie saß mit Rucksack bei der Zeugnisvergabe. Sie hat mir zugenickt und dann war sie weg.
Ich weiß, auf gepackten Sachen sitzen ist einfach nicht mein Ding und immer unterwegs sein noch viel weniger. Und ich weiß, dass ich gar nichts von dem will, was Lucy macht und trotzdem denk ich einzwei Wochen im Jahr: piefich. Das kam auch mal aus meinem Mund. Dann fährt Lucy wieder und ich bin der einzige hier, der noch weiß, dass man alles auch anders machen könnte.
Keine Ahnung, wo sie jetzt schon überall gewesen ist. Sowas frag ich nicht und sowas reden wir nicht. Sie fragt auch nicht, was ich gemacht hab.
Emilie
Kurz nachdem mir dieser Geschmack ein zweites Mal in die Kehle gestiegen war, diesmal von der anderen Seite her, lag er vor mir in der Kloschüssel, mein erster Sieg des Tages. Wie um ein Vakuum in mir zu füllen, hatte ich mir zwei Croissants mit soviel Butter und Schokolade wie nur möglich in den Leib gepflanzt, hatte alle Säfte und Kaffee und Wasser durcheinandergetrunken. Nur um mein hässliches Kind in der Wärme meines Magens über den kalten Flur zu geleiten und es dort keine fünf Minuten später in die Welt zurückzuspucken, in eine Kloschüssel.
Das war der erste Sieg meines Tages. Denn kniend auf dem Fußboden, die Arme auf dem mit Urin und Schamhaaren beschmierten Porzellanrand aufstützend, wurde L in meinem Rücken, auf der anderen Seite der Wand, fetter.
Drüben, in der Küche. Dort warfen sie sich kleine Ferkeleien oder Beschimpfungen zu, spielten mit ihren Füßen in den Genitalien des Gegenübers oder schwiegen sich mit einer Boshaftigkeit an, die in den Ohren stach. Wie immer. Und ich kniete hier und erbrach mir meinen Sieg, erbrach mich ein Stückchen weiter in Richtung Ziel.
Wie immer öffnete ich die Badezimmertür, kurz nachdem ich ihren Namen für mich gehört hatte, Emmi, so nannten sie mich. Zum Abschied, jeden Morgen, sonst hörte ich ihren Namen für mich nur selten.
Wenn ich zurückkam in die Küche, waren sie schon weg. Ich musste eine Stunde später aus dem Haus, stand aber nur eine halbe Stunde später auf, damit ich noch mit ihnen frühstücken konnte.
Sie wachten auf, deckten den Frühstückstisch und duschten, zogen sich an, bereiteten sich jeder auf seine Weise auf den bevorstehenden Tag vor, schminkten sich oder machten Liegestütze, taten all das in einer halben Stunde. Ihrer halben Stunde; in einem geheimen Rhythmus, der nur ihnen gehörte, den ich nicht kannte, obwohl er so perfekt und harmonisch war, so eingespielt und sicher, dass er nie versagte und alles immer rechtzeitig fertig wurde. Seit fast vier Jahren, die wir drei nun zusammen wohnten, bestand dieser Rhythmus, und nie gab es eine Änderung, eine Verzögerung, eine Verschiebung, ausgenommen Urlaube, Dienstreisen, Feiertage. Bereits in der Schule hatten L und ich uns zum gemeinsamen Wohnen entschieden. Vielmehr hatte L entschieden, aber ich war froh über ihre Entscheidung, froh, die Zukunft nicht allein bestreiten zu müssen. Ein halbes Jahr lag zwischen Schule und Beginn unserer Ausbildungen, ein halbes Jahr, das wir nicht teilten, ein halbes Jahr, das ich mit Urlaub verbrachte und L mit Männern. Von einem, Hauke, konnte sie sich dann nicht trennen und so mussten wir eine Wohnung suchen, in der auch er Platz fand.
So aßen wir Morgen für Morgen miteinander. Sie frühstückten, trugen dabei irgendwelche Kämpfe aus, die in der letzten Nacht begonnen worden waren, liebten sich über den Tisch hinweg, ihre schlecht gespielte Leidenschaft nur sporadisch zurückhaltend. Ich beobachtete und sorgte dafür, dass gegessen wurde. Ich war die, die in ihren Augenwinkeln am Rande saß. Die, wann immer sie nicht da war, das Gleichgewicht des Bildes störte, so stellte ich es mir vor. Ich saß und wohnte im toten Winkel ihrer Aufmerksamkeit. Aber das machte ich mir zu Nutze, denn dort bereitete ich meinen Auftritt vor.
Sie saßen sich gegenüber, damit sie den Kopf nicht wenden mussten. Sie saßen sich gegenüber, damit sie keine Blicke verschwendeten, damit keine Augenzeit auf mich verfiel. Sie saßen sich gegenüber, damit sich ihre Füße unter dem Tisch problemlos finden konnten.
Ich hätte am Kopfende sitzen können, doch da war, ich weiß nicht warum, kein Platz für mich. So saß ich neben L, wie kleiner, wie unwichtiger, wie Emilie. Hauke wendete seinen Kopf nicht. Dafür sorgte sie schon.
Und wenn wir uns trafen, Hauke und ich, vor oder nach dem Frühstück und sogar, wenn er mich ansprach, endlich einmal, sahen wir uns nicht an, sondern meist beschäftigt zu den Seiten und im Notfall auf die Füße. Dabei liebte ich seine grünen Augen unter den dichten schwarzen Brauen. Ich kannte sie von ihren Fotos. Es sind meine.
Meine Aufgabe war es, den Tisch abzuräumen, den sie sorgsam angerichtet hatten. So prüfte ich Morgen für Morgen die Anordnung der Dinge auf dem Tisch, diesem Ergebnis ihres geheimen Rhythmus’, als könnte ich, wie bei einer Bildanalyse, an jedem achtlos dahingeworfenen Stück Gurke, jeder ausgedrückten Zigarette, den Gedanken hinter dem Pinselstrich erkennen, wenn ich nur lang genug nachdächte. Und so kam ich oft zu spät zur Arbeit, weil ich da saß, auf ihrem Platz, mit geschlossenen Augen, mich an ihre Bewegungen erinnerte und sie vorsichtig nachzeichnete. Ich erinnerte mich an seine Reaktionen, filterte und übte. Ich nahm den Rest ihrer Zigarette aus dem Aschenbecher, prüfte die Farbe ihres Lippenstiftes, betrachtete die Bissspuren ihrer Schneidezähne im Filter und sagte mir ihren Rhythmus auf: Kaffee, Zigarette und erst dann das Frühstück.
Ich hasste es, wie sie dasaß und mich lächelnd betrachtete, den schwarzen Kaffee in der einen, die Zigarette in der anderen Hand, und wie sie beides in umständlichen Gesten abwechselnd zum Mund führte, während ich, wohl ein bisschen verschämt vornübergebeugt, fraß. Hinter ihrem Lächeln, das so wohlwollend aussah, verbarg sich eine gehässige Freude über die Menge der Kalorien, die Einlass in mich fand. Aber die Freude würde ihr irgendwann im Halse stecken bleiben, denn ich gebar mein hässliches Kind keine fünf Minuten später, ehe irgendwelche Enzyme irgendwelche Bausteine aus ihm herausspalten konnten, die sie mir anhängen wollte.
Hauke hingegen, da war ich mir sehr sicher, liebte sie für ihren Rhythmus. Grund genug, ihn immer und immer wieder von innen gegen meine Lider zu werfen.
In seinen Augen muss sie großartig ausgesehen haben. Eine über Jahre eingeübte Choreografie, virtuos vorgespielt, in Varianten, jeden Morgen.
»Kitti, Kitti«, sagte sie von Zeit zu Zeit, und die graue, dürre Katze streifte schnurrend um Tisch- und Stuhlbeine, bis sie vor ihr stehen blieb, hob dann den Kopf und setzte zum Sprung an, landete sanft auf ihrem Schoß und Hand und Katzenkopf fuhren in einer eingeübten Gegenbewegung eine Zeitlang aneinander, begleitet von eben diesem Schnurren, das immer lauter wurde und direkt aus Ls Kopf zu stammen schien. Diese Katze schien ein ausgelagerter Teil ihrer Seele zu sein, ein externes Ich, das ihr zu Hilfe eilte, sobald ihr Langeweile drohte, es ließ sie nie im Stich, gehorchte, als sei es gedankengesteuert. Es rundete alles an ihr ab, jede Bewegung, ließ sie geschmeidig erscheinen wie die Katze selbst, wenn sie über das Waschbecken sprang etwa, oder lautlos durch angelehnte Türen schlich.
Die Katze war ihr eine Sicherheit, mit der im Rücken sie eine Ruhe haben konnte in allem, eine Ruhe, in der ich ihr nicht nachkam. Sollte sie je in eine Verlegenheit geraten, hatte sie immer noch ihre Katze. Und sie kam so gut wie nie in eine Verlegenheit. Als gäbe es keine unbeholfenen Bewegungen, kein verlegenes Gähnen, das dann doch keins wurde und in Peinlichkeit hätte enden können, kein hilfloses Umherblicken, als wüsste sie immer, wohin mit ihren Augen, als gäbe es immer etwas zu sagen.
So hatte sie also immer etwas zu tun, strich sich Haare ins Gesicht, zwirbelte Strähnen zurecht, dann die Haare wieder aus dem Gesicht; auch die Zigarette in der Hand gab Sicherheit; eine Zigarette, damit die Hand nicht nutzlos herumhängen möge oder eben: es rettete die Katze, führte ihre Hand, zog banal alle Aufmerksamkeit auf sich, befreite von angespanntem Schweigen. Ihr Rauchen war den Anblick wert: Sie legte den Ellbogen auf der Lehne ab, verdrehte dabei den Oberkörper, so dass das T-Shirt an ihren Brüsten spannte. Die Zigarette hing lässig zwischen Zeige- und Mittelfinger, während sie über ihre Schulter blickte und tat, als schaue sie nach etwas Bestimmtem, dort, hinter ihrer Schulter, dabei justierte sie nur ihr Gesicht neu: kaschierte ihren Überbiss, indem sie die Zahnreihen aufeinander schob, schürzte die Lippen leicht, wie lüsterne Frauen in einer Coke-Light-Werbung; sie spannte die Nasenflügel, ganz leicht nur, zog sie kaum merklich Richtung Mund, gefiel sich allem Anschein nach mit Stupsnase besser. Dazu der leicht gelangweilte, teilnahmslose Blick, auch die Lider in Feinarbeit: ganz leicht gesenkt, darin irgendetwas zwischen Versprechen und Erinnerung an eine gemeinsame Nacht.
Sie verstand es, morgens, wenn die Blicke noch langsam sind, die Zeit für sich zu nutzen, und sich einzubrennen in die verschlafenen Pupillen ihrer Mitmenschen wie ein zu langes Schauen in die Sonne. Sie legte sich mit ihrer Schönheit wie eine Schablone über fremde Netzhäute, um sie zu begleiten, bereit, alle zufälligen Begegnungen, die der Tag mit sich brachte, in den Schatten zu stellen. Und ich verstand, warum Hauke ihre Show so sehr genoss: sie war für ihn und eigentlich nur für ihn. Ich war eine zufällige Zuschauerin, eine ständige zwar, aber dennoch eine zufällige, austauschbare, ja: ungewollte. Sicher, mit mehr Zuschauern im Rücken fiel es ihr leichter, das Posieren, und doch beachtete sie mich nicht. Und er noch viel weniger. Und das war meine Chance.
Ich wischte meinen Mund mit Klopapier sauber, danach die Tränen von den Wangen, trocknete die Augen. Ich stand auf, spülte den Mund aus, putzte lange meine Zähne. Sie hatte weiße Zähne.
Unter meinen Achseln bildete sich in regelmäßigen Abständen ein Geruch, der mich an früher erinnerte. Ich nahm die Sprühflasche mit ihrem Duft von dem kleinen Holzregal und verteilte ihn großzügig unter meinen Armen. Danach stellte ich ihn behutsam zurück, es gab dabei eine feste Reihenfolge: Links die Bürste mit ihren kastanienbraunen Haaren, darin, kopfüber, ein Kamm, daneben ein kleines Täschchen mit Manikürezubehör, Tuben und Sprühdosen für das Haar und ganz rechts am Rand, mit dem meisten Platz, als seien sie besonders wichtig, das Fläschchen Achselduft und ihr Parfüm daneben.
»Luise«, so lasse ich mich nennen auf der Arbeit, »Luise!«, rufen sie. »Komm, wir machen Pause.« Ich stecke den Pinsel in das Glas mit Terpentin, ich lege den Deckel locker auf den Eimer mit Farbe, ich schließe kurz die Augen. Ich überlege.
Erst umdrehen und zu ihnen laufen, mich hinsetzen, nach einer Lehne suchen, den Oberkörper leicht verdrehen, dann die Zigarette und im Notfall die Haare. Gelangweilt umherblicken, ich bin Interessanteres gewohnt. Bis man mich fragt, bis man wissen will, von mir, irgendwas, man mich hören will, nicht ertragen kann, dass ich mich langweile mit ihnen, denn das wirft schlechtes Licht auf sie: So eine wie ich, sich langweilend mit ihnen, also bitten sie mich freundlich zu sich. Ich kann es mir aussuchen, ein wenig lächeln zum Beispiel oder eine Augenbraue heben, verächtlich. »Erzähl«, sagen sie, »Luise, was hast du gemacht am Wochenende.« Und ich blicke in die Runde: Jan und Claas und Sandra, die mit mir eingestellt wurde. Claas, der Vater, und Jan, der mich verschlingt mit seinen Blicken, Lehrling, der unser Geheimnis teilt, dem ich von Zeit zu Zeit einen Blick zuwerfe, um mich mit ihm zu verbünden. Es ist immer gut, Verbündete zu haben, hatte sie gesagt, einmal, und sich verraten. Was ich nicht sage: Abgenommen und geübt, fließende Bewegungen im Tanz zu ihrem Lied. Was ich sage: »Prag ist eine andere Welt.« Was ich nicht sage: hinterher denken, folgend Schritt für Schritt, Finger auf der Landkarte und dem Stadtplan, wo und was sie gegessen haben, wie sie geschlafen und was sie geredet haben. Ich führe die Zigarette zum Mund, sie genießen die Pause, es klappt immer besser. Ihr verrauchter Duft aus meinem Mund, was ich sage: »Naja, Karlsbrücke Hand in Hand, ihr wisst schon, traumhaft, für mich ist Prag die Stadt der Liebe, nicht Paris, nicht Venedig.« Was ich nicht sage: Einmal mit Mutter München für ein Wochenende, Oma wohnt in Hildesheim, im Sommer manchmal Ostsee, einmal Dänemark, nicht Frankreich, nicht Italien. Nie Tschechien. Was ich sage: »Und ihr?« Oberkiefer auf dem Unterkiefer verziehen sich meine leicht geschürzten Lippen zu ihrem Lächeln, ich drehe eine Strähne zwischen Daumen und Zeigefinger, ich blicke um mich. »Och«, sagt Claas, »bis Prag hab ich’s nicht geschafft«, er lächelt und blickt entschuldigend, »aber, na ja, hier war ja auch sehr schönes Wetter.« Jan und Sandra, vorsichtig nickend, sehen nur wenig in meine Richtung. Ich drücke die Zigarette in einer Drehbewegung aus, beuge mich dabei vor mit angespanntem Gesicht, Jan besieht meine Brust, das ist mein Geschenk, das ihn an mich bindet, ich blicke ihn wimpernschlaglang an, mein Mundwinkel zuckt: war es ein Lächeln oder ein Versehen. Ich stehe auf, mein Hohlkreuz lässt den Stoff an meinem Hintern sich spannen, ich fühle es, wie seinen Blick.
Darunter war sie grün, die Wand, und das Grün kommt immer wieder durch, schon der dritte Anstrich. Man sollte das Haus tapezieren, von außen, so stark ist das Grün nicht, dass es auch eine Tapete noch durchdringen könnte, wie jetzt die dritte Schicht des Weiß. Samtmint, ein After-Eight-Kuss. Fassaden kann man nicht tapezieren, nur mühsam die einzelnen Schichten Farbe auftragen, immer in der Hoffnung, dass diese die letzte sein wird, kein alter Farbschimmer sich durch den neuen Anstrich beißt und seine hässliche, verwitterte Vergangenheit verrät.
Sie sitzen immer noch unten, sehen mir zu, wie ich auf das Gerüst steige, in geübten Bewegungen, die nicht ihre sind. Hier ist mein Gebiet. Wie ich den Farbtopf öffne, den Pinsel abstreife, eintauche, abstreife; wie ich die Farbe gleichmäßig auf die vorherige Schicht auftrage in überschaubaren Flächen, um bei so viel Weiß den Überblick nicht zu verlieren; wie ich auf und ab streiche, um die Farbe besser zu verteilen, um Nasen zu vermeiden. Ich hoffe, es ist die letzte Schicht.
»Kitti sieht nicht gut aus«, sagt L, kaum dass sie wieder in der Wohnung ist. Es ist ein Vorwurf. Natürlich sieht Kitti nicht gut aus. Sie hat kein Essen bekommen am Wochenende. »Sie hat nichts essen wollen«, sage ich, »vielleicht solltest du sie mal zum Tierarzt bringen.«
Sie haben mir ein kleines Bildchen von der Karlsbrücke mitgebracht, halb so groß wie eine Postkarte vielleicht, hinter dünnem Glas, es ist auf der Reise schon zweimal gebrochen. Der Rahmen, schwarzes Isolierband, hält es mit letzter Kraft zusammen. Ein schönes Foto, Sepia, Prag im Nebel, als wäre ich nicht dabei gewesen.
Drei Tage Prag. Für mich: Zwei Nächte in ihrem Bett, ihr Morgenkleid auf meiner Haut, Pullover, T-Shirts, Oberteile, Hosen, ihre zweite Haut passt auch mir. Ich habe viel gelernt, während sie turtelten, sich stritten, gelangweilt durch die viel zu schöne Altstadt schritten, ein Pärchen eben, das schon viel zu lang zusammen ist, weniger aus Liebe als aus Obsession. Ich dachte sie mir fickend in ihrem Doppelbett im Zweierzimmer einer immer noch recht billigen Prager Pension, die Matratze weich, Schaumstoff vermutlich, nicht auf einem Rost, sondern auf einem nachgebenden Metallnetz, seine kräftigen Stöße federten allzu sehr nach, da war ich sicher. Ein weißer Vorhang vor dem Fenster zum Hinterhof, vielleicht eine Plastikblume, bräunliche Gardinen, zu jeder Seite ein Nachttisch mit Lampe, ein Kleiderschrank. Ein Schlafzimmer wie zu Hause, in dem ich mich etwa zur selben Zeit räkelte; nur einfacher, hässlicher, ärmlicher.