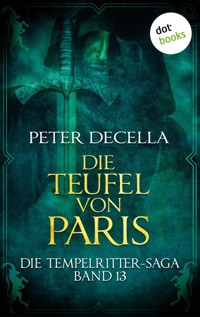Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Die beiden müssen einen Weg finden. Die Liebe muss stärker sein als alle Gebote." – "Die Tempelritter-Saga" jetzt als eBook bei dotbooks. Der muslimische Uthman, Gefährte des Tempelritters Henri de Roslin, ist verzweifelt. In einer Welt religiöser Verfolgungen scheint seine Liebe zu der Christin Madeleine aussichtslos. Doch Henri gibt ihm Hoffnung. So erzählt er Uthman eine dramatische Geschichte, deren Augenzeuge er einst in der lombardischen Stadtrepublik Lodi geworden ist: Anna und Francesco sind die Kinder zweier bis aufs Blut verfeindeter Adelsgeschlechter – und sie lieben sich. Im verzweifelten Kampf um ihre gemeinsame Zukunft werden sie zum Spielball der Reichen und Mächtigen … Die Tempelritter, der mächtigste Orden des Mittelalters: Eine packende Abenteuer-Saga, die mehrere Kontinente und Jahrzehnte umspannt! Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 418
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Der muslimische Uthman, Gefährte des Tempelritters Henri de Roslin, ist verzweifelt. In einer Welt religiöser Verfolgungen scheint seine Liebe zu der Christin Madeleine aussichtslos. Doch Henri gibt ihm Hoffnung. So erzählt er Uthman eine dramatische Geschichte, deren Augenzeuge er einst in der lombardischen Stadtrepublik Lodi geworden ist: Anna und Francesco sind die Kinder zweier bis aufs Blut verfeindeter Adelsgeschlechter – und sie lieben sich. Im verzweifelten Kampf um ihre gemeinsame Zukunft werden sie zum Spielball der Reichen und Mächtigen …
Die Tempelritter, der mächtigste Orden des Mittelalters: Eine packende Abenteuer-Saga, die mehrere Kontinente und Jahrzehnte umspannt!
Über den Autor:
Peter DeCella studierte Geschichte und Archäologie und vertiefte in zahlreichen Reisen nach Norditalien sein Wissen über die Stadtrepubliken des Spätmittelalters. In seiner Heimat Sachsen-Anhalt erforschte er außerdem die weit verstreuten Zeugnisse des Wirkens der Tempelritter im Raum Elbe-Saale.
Der Autor lebt inzwischen in Italien.
Für die Tempelritter-Saga schrieb Peter DeCella folgende Bände:
»Die Tempelritter-Saga – Band 13: Die Teufel von Paris«
»Die Tempelritter-Saga – Band 14: Die Liebe im Schatten«
***
eBook-Neuausgabe Februar 2016
Dieses Buch erschien bereits 2006 unter dem Titel »Liebe in Zeiten des Hasses« bei Pabel Moewig Verlag
Copyright © der Originalausgabe 2006 by Pabel-Moewig Verlag KG, Rastatt
Copyright © der Neuausgabe 2015 bei dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von Bildmotiven von shutterstock/artforce und shutterstock/Kiselev Andrey Valerevich
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95520-825-7
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Liebe im Schatten« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Peter DeCella
Die Liebe im Schatten
Die Tempelritter-Saga
Band 14
dotbooks.
1
September 1318. In Nordfrankreich
Die kleine fünfköpfige Reitergruppe war vor Sonnenaufgang aufgebrochen. Am Morgen lag weißer Nebel über den Wäldern. Nur allmählich zeichneten sich die Umrisse der baumreichen Landschaft hinter dem sich langsam auflösenden Dunstschleier ab. Die nasskalte Feuchtigkeit bei Tagesanbruch kündete den bevorstehenden Herbst an. Das Licht verdrängte nur langsam die Geister der Nacht, doch letztlich triumphierte die Sonne. Erst durchstachen ihre Strahlen wie mit spitzen Fingern die Dunkelheit, dann wischte sie den Nebel mit beiden Händen fort.
Ein heimlicher Beobachter hätte den Eindruck gehabt, dass Wetter und Landschaft mit den Geschicken der Reiter spielten. Und tatsächlich stand die Reise der fünf unter wechselnden Sternen – so wie ihr gesamtes bisheriges Leben. Jeder Schritt war ein Schritt ins Ungewisse mit stets unabsehbaren Folgen.
An einer sonnenüberfluteten Lichtung hielten die Reiter an und genossen für einen kurzen Moment die Wärme.
Ihr Anführer war groß gewachsen. Obwohl er in ein schmuckloses Kaufmannsgewand gekleidet war, hielt er sich so aufrecht und stolz wie ein Ritter. Sein gestutzter Bart war ebenso dunkel wie sein welliges Haar. Auf dem Ross neben ihm saß ein junger Mann in farbenfroher Kleidung, dessen lange, blonde Haare trotz des Stirnbands, das er trug, im leichten Wind wehten; aus der Leinentasche, die er wie ein Troubadour vor der Brust trug, lugte eine Flöte hervor. Hinter diesem Jüngling ritt ein schmächtiger bebrillter Mann mit lockigen schwarzen Haaren, er trug einen hohen und breitkrempigen Hut und blickte hin und wieder aus verträumten Augen zum Himmel hinauf. Das Ende der Gruppe bildete ein Paar. Die junge, sehr schöne Frau hatte weißgoldenes Haar, das mit den Sonnenstrahlen um die Wette schimmerte, der Teint ihres reizvollen Gesichts wirkte zart und war leicht gebräunt, und ihre leicht schräg stehenden Augen betrachteten die Umgebung mit einer Mischung aus Unsicherheit und Neugier. Der Begleiter dieser jungen Frau trug einen Säbel und im Gürtel einen Dolch. Sein rabenschwarzes, halblanges Haar fiel über einen hohen Kragen. Er lenkte sein Pferd nur mit Druck seiner Schenkel und suchte hin und wieder die Hand der jungen Frau mit der seinen. Sein schlankes, aristokratisches Gesicht mit der scharf gezeichneten Nasenlinie strahlte Glück und Zufriedenheit aus, und seine vollen Lippen umspielte ein fast unmerkliches Lächeln.
Die gesamte Reisegruppe schien in einer heiteren, entspannten Stimmung zu sein. Sie sprachen nicht viel, doch sie ritten unbeschwert dahin. Es war, als hingen sie in Gedanken vergangenen Ereignissen nach. Auch ihre Pferde schienen besonders leicht und sacht dahinzutraben – oder lag es nur am Nebel, dass kaum ein Laut zu hören war?
Mit einem Mal zogen wieder dichte Schwaden von der Küste her heran und hüllten die Reiter in sich ein. Im Nu waren diese darin verschwunden. In den vom Nebel erzeugten Dunstwirbeln meinten sie tanzende Gestalten zu erblicken, die aufstoben und sich dann ins Nichts verflüchtigten.
Als die Reiter erneut aus dem Nebelfeld auftauchten, schienen sie von diesem unheimlichen Naturschauspiel allerdings völlig unbeeindruckt zu sein, sodass man meinen könnte, nichts und niemand könne ihnen etwas anhaben. Sie saßen so ruhig in den Sätteln wie Traumgestalten, als kämen sie aus einer anderen Zeit. Und doch waren sie vollkommen real.
Als ihr Anführer plötzlich die Hand hob, blieb die gesamte Gruppe stehen. Die Silhouetten der Reiter zeichneten sich deutlich gegen die noch tief stehende Sonne ab. Ein Kranz aus Licht und Nebel umgab jede einzelne Gestalt. Die Pferde warfen ungeduldig die Köpfe herum und scharrten mit den Hufen. Dann verflüchtigten sich allmählich auch die letzten Nebelschwaden im Wind. Es wurde hell, und die Hügellandschaft, die die Reiter umgab, bot einen Anblick der Ruhe und der Einsamkeit. Hier drohte den Reisenden keine Gefahr.
So ritten sie weiter, und bald schon zeichneten sie sich nur noch als kleine, dunkle Punkte auf dem Grün der Wiesen und vor dem sich bereits leicht verfärbenden Laub der Bäume ab. Ein Vogelschwarm flog weit über ihren Köpfen in die gleiche Richtung davon. Es ging nach Osten.
*
Madeleine hatte sich entschlossen, bei Uthman zu bleiben Uthman ibn Umar, dem stolzen Sarazenen. Obwohl ihr Heimweh nach Notre-Dame, dem kleinen bretonischen Dorf, in dem sie geboren war und in dem ihre Eltern noch lebten, groß war, konnte sie sich ein Leben ohne diesen stattlichen, tatkräftigen Mann an ihrer Seite nicht mehr vorstellen. Und Uthman war glücklich mit ihr. Er genoss die Gegenwart der schönen Frau, obwohl er sorgenvoll in die Zukunft blickte. Der Weg, der vor ihnen lag, war steinig und steil, ob sie ihn gemeinsam bis zum Ende gehen würden, konnte nur die Zeit zeigen. Und wann dieses Ende kam, war ebenso ungewiss. Vielleicht lagen ihre Körper bald schon irgendwo in einer Schlucht, ermordet und geschändet von ihren Feinden. Aber wenn Allah, der Allerbarmer, es so wollte, dann sollte es so sein.
Joshua ben Shimon, der kleine bebrillte Mann mit den dunklen Locken, war ein Gelehrter von ganz besonderer Art. Noch während des Ritts las er im Talmud. So frischte er sein Gedächtnis auf. Manchmal schien es ihm, als läse er das Buch zum ersten Mal, dann wieder konnte er ganze Kapitel auswendig hersagen. Der Talmud war für ihn und seine Glaubensbrüder wie ein Wegweiser durch die schwierige Zeit. Manchmal glaubte Joshua, dass er das einzig Lebendige und Wahrhaftige in seinem Leben geblieben war.
Sean of Ardchatten, der junge blonde Mann mit dem Stirnband, liebte Musik, doch im Augenblick hatte er weder Lust, auf seiner Knochenflöte zu spielen, noch zu singen. Die Gedanken an die Liebe, die ihn in letzter Zeit so oft beglückt, aber auch gequält hatten, waren verstummt. In den vergangenen Monaten war so viel geschehen, dass er zum ersten Mal in seinem noch jungen Leben die Last des Daseins spürte. Etwas in seinem jugendlichen Bewusstsein – die schwärmerischen Gefühle, die überbordende Begeisterung – hatte sich verflüchtigt wie der Nebel über der Landschaft, stattdessen breitete sich nun eine lichte Klarheit aus, die ihm die Welt zeigte, wie sie wirklich war.
Sean blickte seinen Herrn lange an und versuchte zu verstehen, wie dieser so viel Geduld mit ihm gehabt haben konnte. Ich sollte endlich erwachsen werden, dachte er bei sich, die Zeit dafür ist überreif.
Henri de Roslin, der Anführer der kleinen Gruppe, vergegenwärtigte sich indes die Möglichkeiten, die ihm blieben. Manchmal glaubte er, seine Ordenskleider, die er in seinen Satteltaschen versteckt hielt, seien sein größter und strahlendster Schatz, und er dürfe ihn nicht länger verbergen. Dann stellte er sich vor, wie er im vollen Ornat des Templerordens einherritt. Angetan mit Pumphosen, weißem Rock, roter Schärpe, weißem Umhang mit rotem Tatzenkreuz und dem breiten Schwert an der Seite, würde er auf sein Pferd steigen und mit seiner voll tönenden, Angst einflößenden Stimme zum Sturm auf die Feinde der Freiheit aufrufen.
Doch obwohl er stolz auf sein Geschlecht und auf seine Zugehörigkeit zum verbotenen Templerorden war und sich in der Hand eines strafenden, aber gerechten Gottes wusste, übersah er nicht die Gefahren, die mit seinem Traum einhergingen. Seine Zeit würde kommen, das war gewiss, aber noch war sie nicht da. Noch war jeder Schritt, den er und seine Freunde machten, ein Schritt durch Feindesland. Und er war es seinen Freunden schuldig, dass er sie nicht unnötig in Gefahr brachte.
Die kleine Reisegruppe passierte Flüsse, Seen und sprudelnde Bäche mit glasklarem Wasser. Oft machten sie an deren Ufern Halt, wuschen sich und tränkten ihre Pferde. Madeleine sprang in der warmen Mittagssonne häufig auch nackt ins Wasser, und Uthman tat es ihr nach. Doch die beiden wussten, dass sie sich noch nicht gehörten. Noch waren sie nicht Mann und Frau.
Uthman konnte seine Ungeduld nur schwer zügeln. Er begehrte das schöne Mädchen. Eines Tages sagte er zu ihr: »Wir sollten bald heiraten. Denn dass wir zusammenbleiben, haben wir doch beschlossen, nicht wahr?«
Madeleine schmiegte ihren weichen Körper an den seinen und schwärmte: »Oh, wie gerne würde ich dich heiraten. Ich kann mir schon richtig vorstellen, wie wir in eine dieser neuen, hoch aufragenden Kathedralen einziehen, durch deren kunstvolle Glasfenster sich das einfallende Licht in den schillerndsten Farben bricht. Und der Priester verbindet unsere Hände mit einem Seidentuch und gibt uns seinen Segen. Auf diesen Tag warte ich so sehnlich wie auf keinen anderen zuvor.«
»Aber nein«, seufzte Uthman. »Ich kann dich nicht in einer christlichen Kirche heiraten! Die Kirche wird auch gar nicht dulden, dass ein Ungläubiger, wie sie uns Muslime nennen, ihr Gotteshaus entweiht. Es ist unmöglich.«
»Dann werden wir niemals Kinder haben«, stellte Madeleine enttäuscht fest.
»Ich kann dich nur in Liebe berühren, wenn wir vor Gott Mann und Frau sind«, sagte Uthman
»Und ich kann mich dir nur hingeben, wenn wir den Segen meiner Kirche haben«, entgegnete Madeleine.
»Ja, so liegen die Dinge. Was sollen wir bloß tun?« Erneut stieß Uthman einen tiefen Seufzer aus. »Kannst du uns keinen Rat geben, Joshua?«, fragte er dann plötzlich. »Du kennst dich doch sonst so gut in Glaubensfragen aus.«
Der Jude blickte die beiden Verliebten über die Ränder seiner runden Brille hinweg an. Doch auch er wusste in ihrem Fall nicht weiter. Langsam schüttelte er den Kopf.
»Es ist ausweglos«, sagte er. »Es sei denn, ihr konvertiert beide zum Judentum. Das wäre ein Kompromiss, über den ihr nachdenken könntet.«
»Aber nein!«, rief Madeleine sofort. »Die jüdische Religion ist verdammt! Die Juden haben unseren Heiland ermordet.«
»Sprich nicht so«, ermahnte sie Uthman. »Joshua ist selbst Jude, das weißt du doch, also beleidige ihn nicht. Darüber hinaus wurde Jesus von den Römern ermordet, und er war selbst Jude, ein Mann aus dem auserwählten Volk Israels. Das hat die römische Kirche im Lauf der Geschichte allerdings geflissentlich vergessen.«
»Jetzt gehst du allerdings zu weit«, mischte sich Henri in das Gespräch ein. »Unsere christliche Religion geht auf den alten israelischen Glauben zurück. Propheten, Evangelisten und andere Männer gaben diesen Glauben an uns weiter. Wir nahmen ihn an und verwoben ihn mit der Lehre Jesu. Das ist der römischen Kirche durchaus bewusst.«
»Ach, warum musst du nur an Allah glauben?«, empörte sich Madeleine. »Ihr Muslime wollt doch nur Recht behalten, darum habt ihr euch einen eigenen Gott geschaffen und ihn neben den einzig wahren gesetzt! Warum nur? Ihr erscheint damit wie ungezogene, trotzige Kinder, die ihre Eltern ärgern wollen! «
Jetzt musste Uthman lachen. »Es gibt nur einen einzigen Gott. Wir besitzen keinen Nebengott. Er heißt bei uns nur anders. Und seinen Propheten Mohammed, Friede sei mit ihm, betrachten wir als Menschen, während ihr Christen behauptet, euer Prophet Jesus sei der Sohn Gottes gewesen. Aber gläubig sind wir alle.«
»Nur heiraten können wir nicht. Die Macht unserer Kirchen ist stärker als unser Gefühl füreinander.« Madeleine blickte in das Lagerfeuer. Ihre Augen waren feucht geworden.
Sean holte seine Flöte aus seiner Leinentasche und begann zu spielen. Es war ein melancholisches Lied. Und nach einer Weile war der Streit vergessen, und die Gegensätze verflogen. Man aß und trank, und dann schickte jeder ein Gebet zum Abendhimmel hinauf. Uthman verbeugte sich dazu auf seinem kleinen grünen Damaszenerteppich, bis er ihn mit seiner Stirn berührte. Joshua band sich seine Gebetsriemen um und las mit bebenden Lippen Abschnitte aus seinem geliebten Talmud. Henri, Sean und Madeleine wiederum falteten die Hände und vertrauten ihre Wünsche und Sorgen stumm dem Vater im Himmel an.
Für sie alle ging bald die einzige Sonne am Horizont unter. Und für alle brach dieselbe Dunkelheit herein. Sie waren Geschöpfe eines einzigen Gottes. Und einen Moment lang, kurz bevor sie einschliefen, fühlten sie sich auch so.
*
Am nächsten Tag ging es weiter durch menschenleere Landschaften. Im Norden lag das Meer, und um sie herum breiteten sich Wiesen und Hänge aus, die nicht bewirtschaftet wurden. Wem dieses Land wohl gehörte?, fragten sich die Freunde im Stillen.
Sie erfuhren es in einem Dorf, in dem sie Kleider und Schuhe für Madeleine kauften. Das Land gehörte der Krone. Und ihre Gefolgsleute – Pächter und Seigneurs – führten vor Ort ein hartes Regiment, wogegen sich die Bauern oftmals auflehnten. Viele Felder lagen seit den sintflutartigen Regenfällen brach, die drei Jahre zuvor zu erheblichen Missernten geführt hatten. Seitdem trieben immer mehr Räuber ihr Unwesen in dieser Gegend.
Die Gefährten hatten zu Beginn ihrer Reise beschlossen, fern der Städte und Dörfer zu reisen, da die Natur ihnen alles bot, was sie brauchten. Eines Abends sehnten sie sich jedoch nach einem richtigen Lager. Und Madeleine wollte nach langer Zeit endlich wieder einmal in ein Spiegelglas schauen.
Am Rande der Ortschaft Brouilly kamen die Gefährten zu einem Kloster. In dessen Hof hatten sich mehrere Franziskaner um eine lange Tischplatte versammelt, von wo aus sie Brotfladen und Würzwein an bedürftige Ortsbewohner verteilten. Zahlreiche Menschen aus Brouilly oder den Nachbargemeinden standen geduldig in einer langen Schlange in der Abendsonne, um ihr Almosen zu erbitten. Die meisten trugen zerlumpte Kleidung. Die Freunde wunderte es, dass hier so viele Menschen auf die Hilfe der Klosterbrüder angewiesen waren, denn die umliegenden Ländereien schienen ihnen sehr fruchtbar zu sein.
Der Prior des Klosters, Abbé Pierre, war ein hagerer Mann mit bedächtiger Stimme. Von ihm erfuhren die Gefährten, wie es um die Lage im Land bestellt war. Beinahe jeden Tag erhöhte die Krone die Abgaben und Sonderleistungen. Hinzu kamen ständige Fehden zwischen den hiesigen Adelsgeschlechtern, bei denen die Bauern ohne Sold zu den Waffen greifen mussten. So kam es, dass sie ihre Felder nur unzureichend bestellen konnten. Auf manchen Äckern gab es inzwischen mehr Wölfe als Landarbeiter.
Der Prior wies den Gästen eine Schlafstatt zu. Madeleine wurde im Frauenbau des Hospitals untergebracht. Henri und seine Gefährten wurden in ein scheunenartiges Gebäude geführt, das von Binsenlichtern erhellt wurde und sauber war. Es roch nach Obstessig und frischen Holzspänen.
Außer ihnen übernachteten hier zwanzig andere Durchreisende. Henri vermutete aufgrund ihrer Kleidung, dass es Pilger waren, die zu den heiligen Stätten am Meer zogen. Zwei oder drei Kaufleute waren ebenfalls darunter, ihre prall gefüllten Taschen standen bei ihren Strohsäcken.
Henri hätte ohne weiteres ein besseres Lager erbitten können, aber er hatte Menschen, die bessere Bedingungen für sich allein forderten, immer verachtet. Als ehemaliger armer Ritter Christi, wie die Templer sich im Heiligen Land genannt hatten, war er Einfachheit gewohnt, und so akzeptierte er das Strohlager in der Massenunterkunft ebenso wie die Gefährten, ohne zu murren.
Dennoch fand Henri, während sich langsam die Nacht herabsenkte, keinen Schlaf. Er trat an die Fensteröffnung des Laiendormitoriums, das dem der Klosterbrüder gegenüberlag. Als er auf den Hof hinausblickte, sah er, dass dort viele Menschen auf dem nackten Boden übernachteten, unter ihnen auch einige Handwerker, die Henri an den Werkzeugen erkannte, die sie bei sich trugen. Dann erregte ein Paar mit zwei kleinen Kindern Henris Aufmerksamkeit. Die Kinder waren recht unruhig und mussten mehrmals auf den locus secretus geführt werden; einige Schläfer, an denen sie auf dem Weg dorthin vorbeikamen, murrten vernehmlich und zogen ihre Umhänge fester um sich.
Auch in anderen Ecken des Hofs herrschte Unruhe. Jetzt, da sich die Wolken verzogen hatten, strahlte das weiße Licht des Vollmonds über dem Kloster, das viele vom Einschlafen abhielt. Henri beugte sich ein wenig weiter zum Fenster hinaus. Aus der Kirche klang der Nachtgesang der Franziskaner zu ihm herüber. Der Choral nahm ihn sofort gefangen und rührte sein Herz. Spontan beschloss er, ebenfalls in die Kirche zu gehen.
Als er in den Kreuzgang trat, spürte er die nächtliche Kühle. Henri war die Frische des Spätsommers und Herbstes lieber als die Sommerhitze. Er war seit seiner Kindheit in der schottischen Grafschaft Midlothian daran gewöhnt.
Die Kirche war schmucklos, eine Basilika mit mächtigen Säulen, die ein Satteldach trugen. Der Weihrauchkessel schwang hin und her, und die Mönche unterbrachen einige Male ihren Nachtgesang, um der Jungfrau Maria zu huldigen, deren Geburt an diesem Tag gefeiert wurde. Henri hielt vor dem Lettner inne und kniete nieder, obwohl er als Rittermönch auch zusammen mit den Mönchen hätte beten dürfen. Die Fußbank war hart, aber es störte ihn nicht. Er konzentrierte sich auf das Gebet des Tages, das von Marias Geburt und Erwählung handelte. In sein eigenes Gebet schloss er Uthman und Madeleine ein. Liebende sollten zueinander kommen dürfen, dachte er.
Das Gebet zog sich in seinem melodiösen Klang durch die Kirche, die nur von Binsenlichtern zwischen den mächtigen Sockeln der Säulen erleuchtet war. Flackernde Schatten tanzten über die hoch aufragenden Wände des Gotteshauses, während Henri den Worten der Mönche folgte.
Du hast Maria aus allen Menschen erwählt und gesegnet vor allen Frauen. In ihr leuchtete die Morgenröte der Erlösung, sie hat uns Christus geboren, die Sonne der Gerechtigkeit .
Sind nicht alle Frauen auserwählt, dadurch, dass sie uns Liebe und damit neues Leben geben?, fragte sich Henri.
Seine, des Heilands Geburt, hat die Jungfräulichkeit der Mutter nicht gemindert, sondern sie geheiligt …
Und wenn wir ein Fest zum Gedächtnis der Schmerzen Mariens feiern, dachte Henri weiter, dann ehren wir alle Frauen. Die Frauen sind das Salz der Erde, daher soll Madeleine auch glücklich werden, und sie soll bei uns bleiben. Wir werden einen Weg finden.
Und als die Franziskaner begannen, ihr Nachtgebet zu sprechen, fiel Henri plötzlich ein, wie er dem Paar helfen konnte. Er würde ihnen eine Geschichte erzählen, die er selbst erlebt hatte. Uthman und Madeleine würden daraus Mut schöpfen können, denn die Geschichte zeigte ihnen, dass es immer einen Ausweg gab, auch in den schwierigsten Situationen.
Henri blieb so lange in kniender Stellung, bis alle Mönche die Kirche verlassen hatten. Sie zogen in einer langen Reihe über eine Steintreppe ins Dormitorium, das sich direkt an die Kirche anschloss. Als der letzte Mönch durch die kleine Pforte am Ende der Treppe hindurchgeschlüpft war, schloss er diese langsam hinter sich.
*
Der Tag war noch nicht angebrochen, da tischten die Franziskaner bereits eine bescheidene Frühmahlzeit auf. Die Gäste wurden geweckt, denn die Mönche erwartete ein hartes und langes Tagwerk, von dem sie nicht abgehalten werden wollten. Henri hatte in der Nacht nur wenig Schlaf gefunden.
Der warme, gesalzene Haferbrei schmeckte nicht jedem, aber mit dem frischen Brot und dem Dünnbier, das dazu gereicht wurde, füllte er doch angenehm den Magen. Henri aß langsam und mit Genuss. Er hatte Zeiten erlebt, in denen er tagelang gehungert und gedurstet hatte – in modrigen Kerkern und dunklen Gefängnissen und als Knappe im Heiligen Land. Dort hatte er, während der furchtbaren Schlachten, manchmal sogar Hundefleisch gegessen.
Während des Mahls kam der Prior ins Refektorium und warnte die Reisenden noch einmal eindringlich vor Räubern, die in der Umgebung des Klosters ihr Unwesen trieben. Hinter Brouilly sei es besonders gefährlich, erklärte er, weil dort viele Kaufleute reisten, die für die Ganoven eine besonders interessante Beute darstellten.
Henri blickte zu Madeleine hinüber, die in diesem Moment den Hospitalbau verließ und in den Hof trat. Bald würde er den Freunden die Geschichte erzählen, an die er sich in der vergangenen Nacht erinnert hatte. Er hoffte, dass sie der jungen Frau helfen würde, einen Weg zu einer glücklichen Beziehung mit Uthman zu finden.
Während er darüber nachdachte, fragte Madeleine mit einer Geste, wo sie sich Gesicht und Hals waschen konnte. Henri nickte ihr verständnisvoll zu. Dann erhob er sich, ging ihr entgegen und führte sie zu einer Wasserleitung. Frisches und klares Wasser, das zudem köstlich schmeckte, floss daraus in den Sand. Es wurde auch zum Bewässern des Kräutergartens genutzt.
Bald waren die Gefährten zum Aufbruch bereit. Sie holten ihre Reittiere, die von einigen Novizen versorgt worden waren, aus dem Stall und saßen auf. Während die Kaufleute und die Familien, die ebenfalls im Kloster übernachtet hatten, noch ihr Hab und Gut zusammenpackten, ritten sie bereits durch das große Klostertor. Der Prior winkte ihnen hinterher.
Jenseits des Klosters erhob sich eine stattliche Burg auf einem Hügel. Auf dem Donjon wehte eine blaurote Fahne, die ein Wappen zeigte, das die Gefährten wegen der großen Entfernung allerdings nicht genau erkennen konnten. Sie ritten daher in einem großen Bogen um die Festung herum. Kurze Zeit später befanden sie sich wieder in der Ebene, die jener glich, die sie bereits in den Tagen zuvor durchquert hatten.
Hinter Brouilly lagen fruchtbare grüne Täler, und die Reiter staunten sehr, als sie in einem Tal einen prächtigen Bischofspalast erblickten. Die nächste größere Stadt musste Amiens sein, und wenn dies der Sitz des dortigen Bischofs war, musste dieser besonders mächtig und reich sein. Henri konnte sich vorstellen, dass die Eintreibung von Pachtgeldern in dieser Region sehr einträglich war, sodass sich der Bischof von Amiens diesen einsamen Außenposten wohl leisten konnte. Vielleicht war er ja, wie einige andere Bischöfe, die Henri kennen gelernt hatte, auch ein leicht verschrobener und empfindsamer Mann, der das lebhafte Treiben in der Stadt nicht schätzte.
Henri war neugierig, den Gottesmann kennen zu lernen, und schlug vor, dem Palast einen Besuch abzustatten. Uthman verspürte nicht die geringste Neigung dazu, aber da Madeleine in der Hoffnung, dort eine bequeme Unterkunft und gutes Essen zu bekommen, begeistert zustimmte, äußerte er keine Einwände. Sean schloss sich der allgemeinen Meinung an. Und auch Joshua kam mit, wobei er vor sich hin murmelte: »Einer eurer christlichen Bischöfe ist doch wie der andere …«
»Im Palast erfahren wir vielleicht genauer, wie es um die Lage hier oben im Norden Frankreichs bestellt ist«, sagte Henri.
Als die Gefährten den herrschaftlichen Palast erreicht hatten, waren dunkle Wolken aufgezogen. Das bis dahin beständige Septemberwetter schien sich vorerst zu verabschieden, vom nahe gelegenen Meer wehte bereits eine kräftige kühle Brise herüber.
Der Palast war von einem weißen Holzzaun umgeben, die Wiesen davor hatte man von jedwedem wild wuchernden Gestrüpp befreit. Hinter dem Zaun befand sich ein Wassergraben, der mit grauem Regenwasser gefüllt war. Eine schmale Brücke, die gerade breit genug war, um sie mit den Pferden zu überqueren, führte zum Tor. Zwei Wachmänner mit finsteren, bärtigen Gesichtern fragten nach ihrem Begehr.
Henri gab sich als reicher schottischer Kaufmann aus, der dem Bischof seine Aufwartung machen wollte.
Die Gesichter der Soldaten hellten sich auf, und einer von ihnen sagte: »Bischof Magan wird euch gern willkommen heißen! Er schätzt Besucher, die keine Bittsteller sind.«
Und so öffneten sich den Gefährten die Tore zum Bischofspalast. Linker Hand befanden sich Küchenbau, Backhaus und Brauhaus, an Letzteres schloss sich ein flacher Schlafsaal für die Bediensteten an. Gegenüber stand eine Kapelle. Auf dem Hof selbst herrschte reges Treiben. Halb beladene Karren mit Fässern und Säcken, die Männer mit groben Lederschürzen be- oder entluden, standen herum. Dazwischen tummelten sich einige Knappen, die sofort angelaufen kamen, als sie die eintreffenden Gefährten erblickten, um ihnen die Pferde abzunehmen und in den Stall zu führen.
Als die Freunde abgesessen waren, schauten sie sich das Palastgebäude genauer an. Bis zum ersten Stock war es aus Stein erbaut. Weiter oben waren mehrere Reihen von Glasfenstern zu entdecken. Unten befand sich eine schwere Tür, die zwar geöffnet war, vor der jedoch ein Soldat Wache hielt.
Auch diesem Wachmann stellte Henri sich vor, woraufhin er und die Gefährten anstandslos eingelassen wurden. Im Inneren des Palasts umfing sie Fackelschein. Rechter Hand erblickten sie die Wendeltreppe, von welcher ihnen der Soldat am Eingang gesagt hatte, dass sie sie hinaufsteigen sollten. An deren Ende befand sich hinter einer prächtigen Holztür ein niedriger, lang gestreckter düsterer Saal. Die Gefährten mussten ihre Augen zuerst an das dortige Zwielicht gewöhnen, um etwas erkennen zu können, denn die Fenster des Saals waren mit Läden geschlossen oder mit Tierhäuten verhängt. Der einzige Lichtschein kam vom Kamin, in dem ein kleines Feuer brannte.
»Kommt nur näher«, vernahmen sie plötzlich eine amüsiert klingende Stimme. »Ich habe sehr empfindliche Augen, deshalb ist es hier so dunkel.«
Die Freunde blickten in die Richtung, aus der die Stimme gekommen war. Da erkannten sie den Bischof, der in seinem Ornat auf einem Polster saß und von Kissen gestützt wurde. Zu seinen Füßen kauerte ein schwarzer Hund mit glattem Fell. Bischof Magan war ein alter Mann mit dem Gesicht eines Bauern, gegerbter Haut und tief liegenden Augen. Er streckte seinen Besuchern seine kräftige Hand entgegen, an der einige prachtvolle Ringe steckten. Henri trat heran und beugte sich über die Hand, ohne sie zu berühren. Seine Gefährten warteten ab.
»Wir sind fremd hier, Euer Exzellenz. Wir sind Kaufleute aus dem hohen Norden und hörten von Eurer Gastfreundschaft. Mylady würde sich hier gern ein wenig ausruhen, wenn Ihr erlaubt.«
»So kommt und setzt Euch. Ich lasse auftischen. Und erzählt mir, was draußen in der Welt geschieht. Ich habe meinen Palast schon lange nicht mehr verlassen. Die Welt ist mir leid geworden.«
Der Bischof lachte matt, aber spitzbübisch über diese Offenbarung. Er war Henri nicht unsympathisch.
Henri stellte seine Begleiter vor. Sie nahmen im Halbkreis um das Lager des Gottesmannes herum Platz, der sie aus kleinen, geröteten Augen der Reihe nach anblickte. Der Hund rührte sich nicht. Henri ergriff wieder das Wort und erzählte dem Bischof, woher sie kamen.
»Ihr besitzt somit Geld und könnt für meine Gastfreundschaft zahlen?«, wollte der Bischof daraufhin wissen. »Versteht mich bitte nicht falsch. Aber wir benötigen im Moment jeden Sou für den Neubau unserer Kirche. Sie soll größer und schöner werden als jede andere.«
»Ihr sprecht von der Kirche in Amiens?«
»Aber natürlich, ich bin der Bischof von Amiens.«
»Es ist ungewöhnlich, dass ein Bischof nicht im Zentrum seines Sprengels residiert«, meinte Henri.
»Ich bin auch kein gewöhnlicher Bischof, meine Freunde! Ich bin sogar ein ganz und gar ungewöhnlicher Bischof, denn die Leute lieben mich. Und wie viele andere Geistliche, die Ihr kennen gelernt habt, können das von sich sagen?«
Erst jetzt bemerkte Henri, dass sich weiter hinten im Saal einige Männer aufhielten. Sie saßen im Zwielicht an den Wänden, einige mit Waffen auf den Knien. Sie bewegten sich nicht, schienen mit dem Raum verwachsen und starrten in ihre Richtung.
Der Bischof gab einem Dienstboten ein Zeichen. Kurze Zeit später wurden Krüge und Schüsseln hereingetragen.
»Stärkt Euch, es kommen vielleicht harte Zeiten auf uns zu«, sagte Bischof Magan. Er vollführte eine einladende Geste und nickte dazu mit dem Kopf wie ein pickendes Huhn.
Sean griff freudig zu. Die Mahlzeit bestand aus kaltem Braten, Brot und einem Käse mit einer würzigen Rinde, dazu gab es schwarzes Bier.
Henri fragte nicht, was der Bischof mit seiner Bemerkung über die harten Zeiten gemeint hatte. Vielmehr überlegte er sich, in welche Richtung er das Gespräch mit dem Gottesmann lenken könnte. Interessierte er sich für die politische Lage in der Normandie? Hoffte er, etwas über seine Feinde zu erfahren? Sicher war es nützlich, mit einem einflussreichen Mann zu sprechen. Aber war er tatsächlich deshalb hierher gekommen? Wenn er sich selbst gegenüber ehrlich sein wollte, musste er eingestehen, dass er mit seinem Besuch im Bischofspalast eigentlich nur Madeleine einen Gefallen hatte tun wollen. Er ahnte, wie sehr das Mädchen die Annehmlichkeiten eines häuslichen Lebens vermisste. Wenn sie länger bleiben würden, könnte sie hier sogar endlich einmal wieder auf weichen Matratzen schlafen.
»Euer Land scheint reich zu sein, Euer Exzellenz«, sagte Henri schließlich. »Zumindest sah es überall, wo wir bisher waren, danach aus. Wie ist die Lage hier für einen tüchtigen Kaufmann, der eine Niederlassung gründen will?«
»Oh, sehr gut!« Der Bischof räusperte sich, was wie ein Hustenanfall klang. Als seine Stimme wieder frei war, fügte er hinzu: »Die Pachten für Diözesanland steigen. Und es haben sich auch schon einige Kaufleute hier niedergelassen, die Fernhandel treiben. Auch davon profitiert die Kirche. So kann unsere Baustelle wachsen. Außerdem ist die Krone weit weg. Hin und wieder versuchen gräfliche Autoritäten, ihre Rechte geltend zu machen. Aber darüber setze ich mich hinweg.«
»Sind Juden in dieser Gegend willkommen?«
Der Bischof zwinkerte. »Wenn sie Geld mitbringen und ihre alten Besitztümer und Synagogen zurückkaufen!«
Joshua rutschte bei dieser Bemerkung unruhig auf seinem Hocker hin und her, sagte aber nichts.
»Somit ist es in dieser Gegend also weitgehend ruhig?«
»Wir befrieden das Land, wo wir nur können.«
Henri beherrschte das normannische Französisch, in dem sie sich unterhielten, nicht perfekt, aber er versuchte, sein Bestes zu geben. Der Bischof, der ein geselliger Mann zu sein schien, warf ein paar Brocken Schottisch ein. Dann lachte er, warf den Kopf zurück und nickte anschließend wieder wie ein pickender Hahn.
»Der Segen des Herrn scheint auf Eurem Tun zu liegen, Exzellenz«, sagte Henri. »Wir sahen unterwegs allerdings auch, dass viele Felder in Eurem Herrschaftsgebiet brachliegen. Was ist mit den Bauern, die sie bestellen sollten?«
Augenblicklich bekam die Stimme des Bischofs etwas Schneidendes. »Diese Lumpen! Sie faulenzen von morgens bis abends. Und des Nachts geben sie sich wie Tiere den Vergnügungen des Fleisches hin! Man sollte ihnen … Aber nein, ich rege mich zu sehr auf. Eigentlich liebe ich ja alle meine Schäfchen. Und ich bin dafür verantwortlich, dass gerade die Menschen auf dem Land ihr Seelenheil nicht einbüßen. Doch dieses Land muss aufpassen, dass es nicht in den Abgrund stürzt.«
»Was meint Ihr damit?«
»Rebellion! Könnt Ihr Euch das vorstellen? Sie klagen die Vögte an, was nicht einmal falsch ist, drohen jedoch im gleichen Atemzug der Geistlichkeit! Unsere Steuereintreiber werden angegriffen und geschlagen, sogar wir Bischöfe sind unseres Lebens nicht mehr sicher. Kirchenrektoren verbünden sich mit Rittern und dem gemeinen Pöbel! Und schuld daran hat allein dieser Aufrührer!«
»Welcher Aufrührer?«, wollte Sean plötzlich wissen, der dem Gespräch gespannt gefolgt war, obwohl es zunächst so ausgesehen hatte, als interessiere er sich in erster Linie für das gute Essen im Bischofspalast. Als ihm bewusst wurde, dass er mit seiner vorwitzigen Zwischenfrage die Regeln des Anstands verletzt hatte, hielt er sich schuldbewusst die Hand vor den Mund.
»Du scheinst mir ja ein sehr aufgewecktes Kerlchen zu sein, mein Sohn!«, sagte der Bischof, während er Sean aus zusammengekniffenen Augen gründlich musterte. »Nun, der Mann heißt Guy d’Artac, er ist ein Lumpensohn vom Land, der Sohn eines Schinders. Rund um Amiens führt er Räuberbanden gegen alle Kirchentransporte. Er ist Christ – so sagt er jedenfalls –, aber eigentlich ist er nur ein habgieriger Halsabschneider. Auch wenn er das Geraubte nicht für sich verwendet, sondern es den Armen überlässt.«
»Er beschenkt die Armen?«, fragte Henri erstaunt. »Das muss ein ziemlicher Schlag für die Kirche sein. Immerhin muss sie sich jederzeit an den Armutsgeboten der Mönche messen lassen können. Das Heil liegt in Gott, und Erlösung ist nur durch Verzicht auf irdische Genüsse, Reichtum und Ehre zu erlangen.«
»Das glaubt Ihr wirklich?«
»Mein christliches Ideal ist die Askese«, bekannte Henri. »Obwohl ich Kaufmann bin, weiß ich, dass Geld, Schönheit, Ruhm und Ehre vergänglich sind. Ehrgeiz, Hoffahrt und Habsucht führen niemanden zum Seelenheil. Und wenn die Kirche das nicht beherzigt, ist sie am Unmut ihrer Schäfchen selbst schuld.«
»Ach was!«, schnaubte der Bischof. »So reden nur Ketzer!« Die vormalige Freundlichkeit des Gottesmanns war mit einem Schlag verflogen. »Ich hoffe, Ihr hängt nicht solchen falschen Ideen an, wie sie die Sekte der Francelli in diesen Tagen verbreitet! Seid auf der Hut vor ihren Irrlehren, Kaufmann!«
»Ich kenne die spirituellen Franziskaner. Ihre letzten Anführer wurden gerade in Marseille auf dem Scheiterhaufen verbrannt, wie man hört. Ich teile ihre Ansichten durchaus nicht.«
»Ihre Ansichten? Diese Männer sammelten Waffen und Anhänger, stürmten Burgen und Abteien, verbrannten Rathäuser, öffneten die Gefängnisse und machten sich, als sie die Küste erreicht hatten, von wo aus sie ins Heilige Land aufbrechen wollten, über die Juden her und massakrierten sie bestialisch, obwohl die Krone sie ausdrücklich unter ihren Schutz gestellt hatte! Menschen, die so etwas tun, sind Gesetzlose und Mörder!«
»Auch ich verurteile ihre Gewalt, ebenso wie die anderer Sekten. Dennoch dürfen wir die Gefühle des gemeinen Volks nicht einfach übergehen, wir dürfen sie weder verachten, noch dürfen wir ihren Hass wecken. Wir müssen für sie da sein und ihnen Beistand leisten.«
»Angesichts der Missetaten, die ich Euch gerade genannt habe, kann das nicht Euer Ernst sein. Jeder, der die Gebote verletzt, muss bestraft werden. Wie würde es in unserem Land aussehen, wenn wir dies nicht täten? Schon jetzt sind die Kerker voll!«
Doch Henri blieb hartnäckig. »Wir schaffen uns die Rebellen selbst, wenn wir Adligen und Geistlichen gestatten, sich wie hungrige Wölfe aufzuführen. In diesem Fall darf es niemanden wundern, wenn die Bauern sagen, sie sollen zur Hölle fahren. Wir dürfen nicht vom Blut und vom Schweiß der Armen leben. Zumindest in diesem Punkt werdet Ihr mir doch zustimmen, Euer Exzellenz?«
Der Bischof stöhnte und schüttelte den Kopf. »Für die Erlösung der Menschheit ist es unerlässlich, dass alle Kinder Gottes die Weisungen des Pontifex maximus befolgen. Als dessen Stellvertreter in Amiens habe ich dafür zu sorgen, dass dies in meinem Sprengel beachtet wird. Also handle ich entsprechend, und Nachsicht ist angesichts der derzeitigen Lage gewiss nicht angebracht.«
Henri drehte sich nach den Bewaffneten im Hintergrund um. Er blickte auf eine stumme Front wacher Gesetzeshüter. Oder waren es Söldner, die für jeden kämpften, der sie nur anständig bezahlte? Ihn fröstelte. Es stand wohl doch nicht zum Besten in der Normandie.
»Außerhalb der Kirche gibt es kein Heil«, versuchte Henri einzulenken. »Das muss jeder aufrichtige Christ anerkennen.«
»Jeder Christenmensch«, ergänzte der Bischof, »der nicht nackt, namenlos und vergessen, vom Teufel gefesselt, zu flammenden Kesseln geführt werden will! Salvandorum paucitas, damnandorum multitudo! Wenige werden gerettet, viele verdammt!«
»Aber wie steht es mit der weltlichen Herrschaft? Wir hörten darüber sehr Unterschiedliches. In der Bretagne sind die weltlichen Herren sehr streng und allgegenwärtig. In der Provence hingegen kann man sich nicht auf sie verlassen, was allerdings daran liegen mag, dass dieses Gebiet ein Lehen des fernen Königs von Neapel und Sizilien ist. Wie aber sieht es in der Normandie aus? Greifen hier die französischen Gesetze, und stehen genug Büttel zur Verfügung, um sie durchzusetzen? Als Kaufmann bin ich auf den Schutz und die Verlässlichkeit der Obrigkeit angewiesen.«
»Selbstverständlich seid Ihr das. Und Ihr werdet auch erhalten, was Ihr verlangt. Ihr bekommt allen Schutz, den Ihr benötigt. Wenn hier bei uns in der Normandie etwas funktioniert, dann ist es der Schutz des Geldes! Denn das Geld ist unsere Zukunft, das werdet sicher auch Ihr nicht anders sehen. Nur wer etwas schafft, ist es wert, in den Genuss von Privilegien zu gelangen. Wer hingegen nur prasst, hat keine Vorteile verdient, ganz gleich, welcher Art sie auch seien.«
Henri nickte. Die Habgier und Selbstgefälligkeit des Bischofs widerten ihn mehr und mehr an.
»Dann werdet Ihr Euch also in Amiens niederlassen, Kaufmann?«, fragte der Bischof.
»Wenn Euer böser Bube Guy d’Artac mich lässt.«
»Was? – Nun, Guy wird bald hängen, das ist gewiss. Kümmert Euch nicht um ihn. Reitet nach Amiens, ich gebe Euch einen Begleitschutz mit auf den Weg. Denn wir können jeden gebrauchen, der hier Geschäfte macht. Womit handelt Ihr übrigens?«
»Ich bin Tuchhändler«, entgegnete Henri, ohne zu zögern. »In Quimper und Brest besaß ich gut gehende Niederlassungen. Dann brach die Pest aus, und wir mussten das Land verlassen.«
»Ja, die Gottesstrafe! Bis hierhin ist sie glücklicherweise nicht vorgedrungen. Wir sind allerdings auch zu gottesfürchtig, als dass diese Geißel uns schlagen könnte. Im Westen sind aber viele daran gestorben, wie ich hörte.«
»Wie steht es in der Normandie mit Ketzern? Sind sie alle geschlagen?«
»Wen meint Ihr? Kleine Lumpen wie Guy oder die wirklich gefährlichen wie die Barfußmönche, die überall herumziehen und falsche Lehren verbreiten?«
»Ich meine zum Beispiel den Templerorden.«
Der Bischof starrte Henri einen Moment lang entgeistert an. Dann fragte er misstrauisch: »Warum interessieren Euch gerade diese Leute?«
Henri antwortete vorsichtig: »Ach, so sehr interessieren sie mich gar nicht. Ich habe nur gehört, dass der Templerorden in der Normandie einst sehr mächtig gewesen sein soll. Und nun ist er spurlos verschwunden. Daher frage ich mich …«
»Spurlos verschwunden ist er gewiss nicht, mein Sohn, das könnt Ihr mir glauben. Überall gärt es. Hier und da tauchen immer wieder kleine Zellen auf. In Amiens haben wir erst vor ein paar Wochen vier von diesen Ketzern verbrannt.«
»Ihr habt Templer verbrannt?«, entfuhr es Henri. Er musste sich beherrschen, wenn er seine innere Ergriffenheit weiterhin gut verbergen wollte. Auch die Gefährten waren jetzt sehr aufmerksam geworden.
»Ihr sagt es, mein Sohn«, entgegnete der Bischof stolz. Offenbar hatte er Henris Betroffenheit tatsächlich nicht bemerkt. »Unter ihnen befand sich sogar der Neffe des ehemaligen Präzeptors, ein Kerl namens Villefranche. Er hat das Volk aufgehetzt. Für solche Leute haben wir hier keinen Platz. Die Mauern des Tempels sind längst eingestürzt, und so soll es auch bleiben. Wir brauchen hier keine Gotteslästerer, die undurchsichtige Geldgeschäfte treiben, was wir bauen, sind Kirchen, hoch aufragende Gotteshäuser im neuen Stil, durch die das Licht Gottes flutet, auf dass es den Glauben unserer Gemeinden stärke und festige.«
Villefranche! Henri hatte die letzten Worte des Bischofs gar nicht mehr gehört. Er hatte nur an den jungen Ritter gedacht, den er ihn in Paris kennen gelernt hatte. Dessen Onkel, Geoffroy de Charney, hatte ihm sogar fast so nahe gestanden wie sein eigener Vater. Er hatte erlebt, wie der Präzeptor vor vier Jahren öffentlich hingerichtet worden war. Wären wir nur früher nach Amiens gekommen, dachte er, dann hätten wir die jungen Brüder vielleicht retten können. Warum haben wir, als es uns noch möglich war, auch keine Namenslisten der versprengten Brüder angelegt, die den Sturm gegen den Orden überlebt haben? So, wie es jetzt steht, werden wir uns, wenn überhaupt, nur zufällig wieder sehen. Auf diese Weise wird der Tempel niemals mehr wieder errichtet werden.
»Ihr wirkt plötzlich so in Euch gekehrt, mein Sohn. Offenbar denkt Ihr doch zu viel über den Tempel nach. Ich rate Euch allerdings, solche Gedanken fahren zu lassen. Die Templer sind Ketzer! Zwar waren sie einst der bewaffnete Arm unserer Kirche zur Verteidigung des Heiligen Lands, aber dann stieg ihnen ihre Macht zu Kopf, und sie gefährdeten den inneren Frieden.«
Henri blickte kurz zu seinen Freunden hinüber. Sie saßen regungslos im Halbdunkel. Die gelassene Stimmung, die zu Beginn des Gesprächs geherrscht hatte, war mit einem Mal umgeschlagen. Keiner der Gefährten aß oder trank noch etwas. Und im Hintergrund scharrten die Söldner mit ihren Stiefeln über den Holzboden.
»Ihr verlangt viel von mir, Eure Exzellenz«, entgegnete Henri auf die Ermahnung des Bischofs. »Als gläubiger Christ schmerzt mich jedes Menschenopfer, zumal ich, wie ich es vorhin bereits andeutete, Gnade und Vergebung der Gewalt immer vorziehe.«
Das stimmt zwar nicht ganz, dachte Henri insgeheim, denn an den Mördern meiner Tempelbrüder habe ich mich gerne und bitter gerächt. Aber dieses Ausleben meines Hasses ist mir auch eine Lehre gewesen, es hat mich tatsächlich dazu geführt, Gnade und Vergebung zu schätzen, und irgendwie musste ich schließlich auf die Mahnung des Bischofs reagieren.
»Auge um Auge, Zahn um Zahn«, rezitierte Magan. »Jeder, der sich vergeht, muss mit der Härte des Gesetzes rechnen.«
»In diesem Punkt gebe ich Euch vollauf Recht«, warf Uthman ein. »Aber wer macht die Gesetze? Sicher nicht die Armen, die in diesem Land in der Überzahl sind und die nicht mehr verlangen als das, was sie zum Leben benötigen.«
»Hört, hört!«, sagte der Bischof. »Da ist ja noch jemand, der so redet wie Guy d’Artac.« Der Gottesmann nahm den Sarazenen scharf ins Visier. »Aber seid auf der Hut, junger Freund, denn ich erwähnte ja bereits, dass wir solche Reden hier nicht gerne hören!«
»Ihr solltet mir besser nicht drohen, Eure Exzellenz!«, fuhr Uthman ihn an. »Ich bin ein freier Mann! Und als solcher denke und sage ich, was ich will!«
Auf diesen kleinen impulsiven Ausbruch folgte Stille. Die Gefährten hielten den Atem an. Sie befürchteten das Schlimmste, doch was dann geschah, verblüffte sie.
Der Bischof sank in sich zusammen und wirkte von einem Moment auf den nächsten wieder wie der alte Mann, als der er ihnen von Anfang an erschienen war. »Nun gut, ich will mich mit Euch nicht um Eure Meinung streiten. Sie sei Euch gewährt. Ich will nur meinen Frieden. Sollen in der Welt da draußen doch alle tun und lassen, was sie wollen. Nur wenn Verschwörung und Umsturz drohen, muss ich handeln.«
Henri erhob sich. Er hatte es sich anders überlegt, er wollte nicht bleiben. Die Gefährten verstanden sofort, was in ihm vorging, selbst Madeleine konnte seine Geste richtig deuten, wenngleich sie auch in ihrem schönen Gesicht eine Spur Enttäuschung erkennen ließ.
»Wir danken Euch für Eure Gastfreundschaft, Eure Exzellenz. Aber nun zieht es uns weiter. Wenn die Verhältnisse in Eurem Land wirklich so unruhig sind, wie Ihr sie beschreibt, können wir es uns nicht leisten, einen Tag zu vergeuden. Wir reiten sogleich nach Amiens.«
»Wie Ihr wollt«, entgegnete der Bischof. »Ich gebe euch gern eine Eskorte mit auf den Weg.«
»Wir wissen Euer Angebot zu schätzen, aber wir kommen auch allein zurecht. Wir sind es gewohnt, uns selbst zu schützen.«
»Dann geht mit Gott, meine Kinder!«
Magan streckte ihnen erneut seine kräftige Hand entgegen, und Henri ergriff sie halbherzig, ohne die Ringe zu küssen. Dann zogen sich die Besucher zurück.
Als Henri einen Blick zurückwarf, bot sich ihm derselbe Anblick wie bei der Ankunft in diesem großen Raum. Alles war vollkommen ruhig und still. Nicht einmal der Hund hob seinen Kopf. Henri war sich allerdings nicht sicher, ob dieser friedfertige Eindruck echt war oder ob er den Besucher nur täuschen sollte.
*
Auf ihrer nächsten Etappe waren die Gefährten besonders wachsam. Immerhin hatte sie nicht nur der Bischof vor möglichen Raubüberfällen gewarnt. Die Freunde wussten zwar nicht, ob ihnen Räuber wie Guy d’Artac wirklich gefährlich werden konnten, aber Vorsicht war angebracht.
Das Land jenseits von Brouilly, in Richtung Amiens, wohin Henri die Gruppe jetzt führte, um mehr über die hingerichteten Templer zu erfahren, war unübersichtlich. Das Unterholz war äußerst dicht und sehr hoch, zudem erschwerten ausgedehnte Wälder das Vorankommen. Tief ausgeschnittene Hohlwege, die keinen Überblick über die Umgebung erlaubten, stellten eine weitere Gefahr dar. Dennoch blieb glücklicherweise alles ruhig.
Unterwegs besprach Henri sein Vorhaben mit den Gefährten. Nach den Berichten des Bischofs konnte er nicht einfach weiterreiten. Er musste herausfinden, was sich in Amiens zugetragen hatte und wie die Lage dort jetzt aussah.
Etwa eine Meile hinter einem besonders dichten Wald kreuzte der Weg nach Amiens eine Straße. Hier waren einige Kaufleute mit ihren Karren unterwegs. Henri nahm an, dass dies der Weg war, den Räuber beobachteten, um im geeigneten Moment eine Gruppe zu überfallen, die reiche Beute versprach. Von diesen Räubern, allen voran diesem Guy d’Artac, würde er sicher am ehesten etwas über die ermordeten Brüder und eventuell sogar auch über noch lebende Templer in der Nähe von Amiens erfahren können. Doch wie sollte er Guy d’Artac und seine Männer finden? Henri fragte einige Bauern auf den Feldern nach ihnen. Doch diese zeigten sich nicht wirklich gesprächig, nur einer deutete grob in Richtung Amiens und sagte, er solle dort nach ihnen suchen.
Und eine junge Frau meinte: »Guy d’Artac ist ein Heiliger, kein Räuber.«
Henri dachte an die hingerichteten Brüder in Amiens. Einmal mehr stellte er sich die Frage, wie es möglich gewesen war, dass König und Papst den Orden in einer einzigen Nacht des Jahres 1307 hatten zerschlagen können. Warum haben wir es damals versäumt, uns mit den einfachen Menschen zu verbrüdern?, fragte sich Henri. Hätten wir uns mit Männern wie Guy d’Artac verbünden sollen? Aber Guy war vogelfrei, ein Gesetzloser. Mit solchen Gestalten hatten er und seine Mitbrüder sich nie abgegeben. Vielleicht war das falsch gewesen.
Henri hoffte, ihm bald zu begegnen. Denn nur so würde er entscheiden können, ob Guy mehr war als ein Wegelagerer. Sollte er tatsächlich edle Absichten verfolgen, könnte er ihn vielleicht sogar als Bundesgenossen gewinnen.
Je näher Amiens kam, desto weiter rückten Henris Gedanken an den Räuber allerdings in die Ferne. Er dachte an die Scheiterhaufen von Paris, auf denen zahlreiche Templer den Tod gefunden hatten. Er roch ihr verbranntes Fleisch und sah ihre entsetzten, schmerzverzerrten Gesichter, die von den Flammen verschlungen und ausgelöscht wurden. Jahrelang hatten Henri diese Bilder verfolgt. Sie hatten ihm den Schlaf geraubt und ihm die Tage zur Hölle gemacht. Und jetzt waren sie wieder da.
Noch immer verbrannten die Feinde des Tempels seine Brüder! Er musste nach Amiens! Vielleicht war es doch falsch, Gnade walten zu lassen und die Rache zu vergessen.
Plötzlich erblickten die Freunde mehrere Bauernhöfe in der Ferne, die Felder vor Amiens lagen sorgfältig abgeerntet in der Sonne. Alles schien so, wie man es erwarten konnte. Das Leben lag in Gottes Hand. Nichts deutete auf Unruhe hin.
Die Räuber standen so plötzlich vor ihnen, dass sie zunächst gar nicht wussten, wie sie reagieren sollten. Kein Laut hatte sie angekündigt. Sie hatten sich an der Böschung eines Flusses versteckt, den die Reisenden gerade überquerten. Die fünf bewaffneten Männer tauchten ganz unvermittelt zwischen den knorrigen Weiden auf, deren Äste bis ins Wasser reichten. Die Dämmerung hatte bereits eingesetzt, sodass die Wegelagerer zunächst nur schwer zu erkennen gewesen waren. Als Henri sich umdrehte, bemerkte er, dass auch am jenseitigen Ufer ein paar grimmig dreinblickende, hoch zu Ross sitzende Gesellen standen, die ihnen den Rückzug versperrten.
Henri blieb ruhig. Ganz langsam taxierte er die Gesichter der Gesellen, die ihm und den Freunden gegenüberstanden. Er suchte nach ihrem Anführer, von dem er glaubte, dass er sich durch irgendeine Besonderheit auszeichnen würde; vielleicht hatte er Glück, und es war Guy d’Artac. Doch Henri erblickte überall nur die gleichen verwahrlosten Gesichter, Männer, die vor Schmutz starrten und zerlumpte Kleidung trugen, die ihre ausgemergelten Körper umhüllten. Keiner von ihnen stach besonders hervor.
Kurz entschlossen zog Henri sein Schwert. Uthman und Sean taten es ihm nach. Madeleine schrie leise auf. Joshua schob sein Buch in die Satteltasche und richtete sich kerzengerade auf.
Henri richtete sein Schwert gegen die Wegelagerer und rief: »Wer seid ihr? Wenn ihr unlautere Absichten habt, solltet ihr uns besser aus dem Weg gehen, sonst müssen wir Gewalt anwenden!«
Einer der Räuber stieß daraufhin ein raues, spöttisches Lachen aus, sagte ansonsten aber nichts. Auch seine Gefährten schwiegen. Und keiner von ihnen rührte sich, auch nicht die Männer am jenseitigen Ufer.
Da gab Henri seinem Pferd die Hacken und preschte vorwärts, direkt auf die Wegelagerer zu. Uthman folgte ihm, ohne zu zögern, dicht auf den Fersen.
»Hehehe!«, schrie Henri angriffslustig. Und dann: »Beausant!« Es war der alte Schlachtruf der Tempelritter.
Zwei der Wegelagerer machten daraufhin kehrt und stoben davon. Die anderen drei erhoben Keulen gegen die Angreifer, die sie bislang versteckt gehalten hatten. Einer von ihnen versuchte, nach Henris Pferd zu greifen. Henri trat mit dem Stiefel nach ihm und traf ihn mitten im Gesicht. Das hässlich knirschende Geräusch, das dabei ertönte, ließ darauf schließen, dass er seinem Gegner die Nase gebrochen hatte.
Henri durchbrach die gelichteten Reihen. Dann wendete er sein Pferd und griff die Räuber von hinten an. Diese schwangen ihre Keulen und schlugen wild um sich, aber Henri und Uthman konnten ihren unkontrollierten Schlägen gut ausweichen. Als die beiden Freunde zu einem weiteren Angriff ansetzten, nahm Henri aus den Augenwinkeln wahr, dass jetzt auch die Räuber vom jenseitigen Ufer heranpreschten.
Erneut entfuhr Madeleine ein Schrei, diesmal ein etwas lauterer. Das Wasser um sie herum spritzte hoch auf. Sean verteidigte das Mädchen, Joshua und sich, konnte allerdings nicht verhindern, dass sie alle drei von den Räubern umzingelt wurden. Henri bedeutete Uthman, den Freunden zu Hilfe zu eilen. Der Sarazene nickte zur Bestätigung, dass er verstanden hatte, und hieb sogleich auf die Banditen ein.
Nun erreichte auch Henri die Mitte des Flusses, wo Sean, Joshua und Madeleine eingekeilt waren. Die Wegelagerer ritten in einem so dichten Kreis um sie herum, dass sie keine Chance hatten, zu entkommen. Plötzlich beugte sich einer der Banditen vor, schlang seinen Arm um Madeleines Taille und zog die um sich schlagende Frau von ihrem Pferd auf das seine hinüber. Dann machte er kehrt und stob davon.
Henri drehte sich nach Uthman um. Dieser hatte inzwischen noch einen zweiten Angreifer zu Boden geschlagen und trieb gerade sein Pferd in den Fluss zurück. Offenbar wollte er dem Flüchtenden hinterher.
»Bleib du hier und kämpfe, ich verfolge den Flüchtenden«, rief Henri ihm zu, da er befürchtete, der Sarazene könne angesichts der Entführung seiner Geliebten zu unbedacht handeln.
Doch Uthman war nicht zu bremsen. »Nein!«, schrie er außer sich vor Zorn. »Das ist meine Sache!«