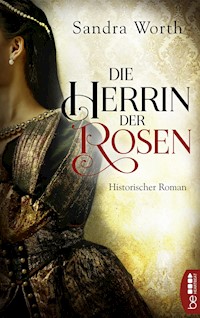4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Rosenkriege
- Sprache: Deutsch
Elizabeth, die Gute - die Königin, die England den Frieden brachte
Der König ist tot, es lebe der König! Nach dem Tod ihres Vaters Edward IV. ist Elizabeth of York dem neuen König, ihrem Onkel Richard III., treu ergeben. Doch Richards Herrschaft ist von kurzer Dauer: Er wird von seinem stärksten Widersacher Henry Tudor im Kampf getötet. Nur eine Vereinigung der verfeindeten Häuser York und Lancaster könnte dem blutigen Krieg um die Krone ein Ende setzen. Ist Elizabeth bereit, eine lieblose Ehe mit dem Mörder ihres Onkels einzugehen, um England den langersehnten Frieden zu bringen?
"Ein weiterer hervorragend geschriebener und gut recherchierter Roman von Sandra Worth. Eine wundervolle Hommage an die Mutter von Heinrich VIII. und die Großmutter von Elizabeth I." Romance Reviews Today
"Mit diesem brillanten Porträt von ‚Elisabeth der Guten‘ erweckt Worth eine der unbekannteren Königinnen Englands zum Leben." Publishers Weekly
Ein fesselnder historischer Roman über die weniger bekannte Königin Elizabeth - für alle Leserinnen von Philippa Gregory, Elizabeth Chadwick und Mari Griffith.
Dieser Roman ist in einer früheren Ausgabe unter dem Titel "Elizabeth - Tochter der Rosen" erschienen.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 690
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhalt
Cover
Über dieses Buch
Über die Autorin
Titel
Impressum
Widmung
Motto
Kapitel 1: Die Tochter des Königs · 1470
Kapitel 2: Am Hof König Edwards · 1471–1478
Kapitel 3: Die Schwester des Königs · 1482–1483
Kapitel 4: Das Kirchenasyl · 1483
Kapitel 5: Nichte des Königs · 1483
Kapitel 6: Von Königen und Prinzen · 1483–1484
Kapitel 7: König Richards Hof · 1484
Kapitel 8: Die gute Königin Anne · 1484
Kapitel 9: Sonnenfinsternis · 1485
Kapitel 10: Die Trennung · 1485
Kapitel 11: Der Sieger · 1485
Kapitel 12: Gefährtin des Königs · 1486
Kapitel 13: Eine Rose, sowohl rot als auch weiß · 1486
Kapitel 14: Von Rosen und Dornen · 1486–1487
Kapitel 15: Kriegsfanfaren · 1487
Kapitel 16: Königin von England · 1487
Kapitel 17: Henry Tudors Hof · 1488
Kapitel 18: Die Straußenfeder · 1489–1491
Kapitel 19: Rad des Schicksals · 1492
Kapitel 20: Wahrheit und Lüge · 1493–1495
Kapitel 21: Ein göttlicher Prinz · 1495
Kapitel 22: Rebellion · 1495–1497
Kapitel 23: Fortuna lächelt · 1497
Kapitel 24: Die weiße Rose · 1498
Kapitel 25: Blut der Rosen · 1499
Kapitel 26: Die verlorene Prinzessin · 1500
Kapitel 27: Ein Pfad im Zwielicht · 1500
Kapitel 28: Leuchtender Stern von Spanien · 1501–1502
Kapitel 29: Elizabeth die Gute · 1502
Epilog
Anmerkungen der Autorin
Ausgewählte Literatur
Historische Figuren
Danksagung
Fußnoten
Über dieses Buch
Elizabeth, die Gute – die Königin, die England den Frieden brachte
Der König ist tot, es lebe der König! Nach dem Tod ihres Vaters Edward IV. ist Elizabeth of York dem neuen König, ihrem Onkel Richard III., treu ergeben. Doch Richards Herrschaft ist von kurzer Dauer: Er wird von seinem stärksten Widersacher Henry Tudor im Kampf getötet. Nur eine Vereinigung der verfeindeten Häuser York und Lancaster könnte dem blutigen Krieg um die Krone ein Ende setzen. Ist Elizabeth bereit, eine lieblose Ehe mit dem Mörder ihres Onkels einzugehen, um England den langersehnten Frieden zu bringen?
Ein fesselnder historischer Roman über die weniger bekannte Königin Elizabeth – für alle Leserinnen von Philippa Gregory, Elizabeth Chadwick und Mari Griffith.
eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.
Über die Autorin
Sandra Worth hat in Toronto Politikwissenschaft und Wirtschaft studiert und lebt heute in Houston, Texas. Sie ist Spezialistin für die englischen Rosenkriege und hat fünf historische Romane über den Niedergang der Plantagenet-Dynastie und den Aufstieg der Tudors geschrieben. Ihre Romane wurden mir zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Besuchen Sie die Homepage der Autorin: https://sandraworth.com/.
Sandra Worth
Die Tochterder Rosen
Historischer Roman
Aus dem amerikanischen Englischvon Sabine Schilasky
beHEARTBEAT
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2008 by Sandra Worth
Titel der amerikanischen Originalausgabe: »The King’s Daughter«
Originalverlag: Berkley Books, New York
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2014/2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Titel der deutschsprachigen Erstausgabe: »Elizabeth – Tochter der Rosen«
Covergestaltung: Guter Punkt, München unter Verwendung von Motiven von © Mark Owen / Trevillion Images
eBook-Erstellung: Jilzov Digital Publishing, Düsseldorf
ISBN 978-3-7517-1026-8
be-ebooks.de
lesejury.de
Dieses Buch widme ich meiner Tochter Emily
»Vier Dinge lassen sich nie zurückholen:
das ausgesprochene Wort,
der abgeschossene Pfeil,
die versäumte Gelegenheit
und die Vergangenheit.«
Alte Redensart von ca. 750 a.d.
KAPITEL 1
Die Tochter des Königs · 1470
BLINDE KUH machte einen solchen Spaß mit meinem Vater! Ich versteckte mich hinter einer Säule und linste vorsichtig um sie herum. Er kam mit ausgestreckten Armen auf mich zu und schlurfte im Gehen wie ein Blinder. »Elizabeth, Elizabeth!«, rief er. »Wo bist du? Ich kann dich nicht sehen.«
Ich lachte. Natürlich konnte er mich nicht sehen, denn ich hatte ihm die schwarze Augenbinde ja fest um den Kopf gewunden. Ich lief durch den Raum, kreischte vor Vergnügen und wich seinen tastenden Händen aus. Dann verbarg ich mich wieder hinter der Säule.
Als er in meine Richtung tappte, kam ich aus meinem Versteck hervor und flitzte um den großen Tisch in der Zimmermitte herum zur Fensterbank. Dort wartete ich. Ich strengte mich an, still zu sein, musste aber wieder und wieder kichern, wenn mein Vater gegen eine Wand stieß oder einen Leuchter umwarf. Mit niemandem wollte ich lieber spielen, nicht einmal mit meinen Schwestern Mary und Cecily, die jünger waren als ich. Sie weinten mir zu viel. Mein Vater hingegen lachte immerfort. Er war beinahe so groß wie der Drache, von dem eines seiner Märchen erzählte, nur dass Papa schön war, nicht furchterregend. Nein, er sah überhaupt nicht wie ein Drache aus, so wie ihm das blonde Haar über die Augenbinde fiel. Auch wenn ich das Blitzen in seinen blauen Augen hinter dem Schal nicht sehen konnte, umfing mich seine Liebe wie meine Lieblingsdecke, als er mich durch das Zimmer jagte.
Papa war nun nahe, als wüsste er, dass ich auf der Fensterbank stand. Ich blickte mich um, wo ich als Nächstes hinlaufen könnte. In die Ecke, hinter die Rüstung! Hastig kletterte ich von der Fensterbank und lief dorthin, quiekend vor Aufregung. Schmunzelnde Diener traten beiseite, um mich vorbeizulassen. Auch die Adligen, die sich in der letzten Stunde eingefunden hatten, lächelten mir zu.
Mein Vater drehte sich um. Hatte er Augen im Hinterkopf, dass er mich gesehen hatte? Wieder kam er in meine Richtung. Ich kreischte und rannte zur Silbervitrine an der gegenüberliegenden Wand. Dort kauerte ich mich neben die Kommode und machte keinen Mucks. Ich wagte nicht einmal zu atmen. Die Landsknechte an der Tür wandten sich zu mir und warfen mir ermunternde Blicke zu.
Noch mehr Adlige erschienen auf dem Gang. Das war ein schlechtes Zeichen. Bald würde mein Vater unser Spiel abbrechen und sich mit ihnen bei geschlossenen Türen am großen Tisch besprechen müssen. Aber vorerst legten sie ihre finsteren Mienen ab und schenkten mir ein freundliches Lächeln, als ich an ihnen vorbei in die Privatgemächer meines Vaters lief. Trotz seiner Augenbinde schien mein Vater genau zu wissen, wo ich war, denn er folgte mir. Mehrere Male erhaschte er mich fast, doch ich duckte mich weg, sodass er ein Stuhlbein anstelle meines Armes erwischte oder gegen eine Tischecke stieß. Ich war froh, mit ihm allein zu sein. Fern von seinen Lords, vergaß Papa sie vielleicht, und wir konnten noch ein wenig länger spielen.
In dem Zimmer standen nur das Bett mit den hohen Pfosten, eine große Kommode und einige breite Stühle. Vor dem Kamin lagen dicke Kissen. Auf dem Bett könnte Papa mich nie fangen, weil es riesig war und ich ihm dort mühelos ausweichen konnte. Also packte ich einen der Pfosten und sprang hinauf.
»Edward!«
Die scharfe Stimme meiner Mutter ließ mich erstarren. Ich hörte auf zu kichern, stand mucksmäuschenstill auf dem Bett und versuchte, auf der weichen Federmatratze das Gleichgewicht zu halten. Über das Bett war eine schimmernde Seidendecke mit goldenen Sonnen und weißen Rosen, dem Wappen meines Vaters, gebreitet. Ich lächelte nicht mehr, und auch mein Vater war ernst geworden. Er nahm die Augenbinde ab und sah meine Mutter an. Mit strengem Blick stand sie in der Tür. Ihr goldenes Haar umrahmte ihren Kopf wie ein Heiligenschein unter der kegelförmigen Samthaube mit dem dünnen Schleier. Im Gegensatz zu meinem Vater lächelte meine Mutter nur selten. Und nun, als sie ins Zimmer kam, wusste ich gleich, dass sie wegen etwas verärgert war.
»Edward, bisweilen verwunderst du mich! Du spielst Blinde Kuh mit Elizabeth, als plagten dich keinerlei Sorgen. Dabei wartet dein Rat auf dich, um dringende Angelegenheiten mit dir zu bereden.«
»Meine liebe Bess, welche Sorgen habe ich denn schon? Welche dringenden Angelegenheit dulden keinen Aufschub?« Papa lachte. »Herrscht nicht Frieden in meinem Königreich? Lieben die Adligen mich nicht ausnahmslos?« Er ging zu meiner Mutter und beugte sich vor, um sie auf die Wange zu küssen; denn obgleich sie groß war, überragte er sie um mehr als irgendein anderer Mann, den ich kannte.
»Ach, Edward, du bist eine Prüfung für meine Geduld«, seufzte sie.
Er kniete sich vor sie und nahm ihre Hand, als wäre er Sir Lancelot und sie seine Königin Guinevere. »Meine Liebste, verrate mir, wie ich dir ein Lächeln entlocke?«
Ihre Lippen bogen sich ein klein wenig. »Da gibt es eine Möglichkeit, Edward.«
»Wusste ich’s doch, dass es die gibt, Bess«, sagte er und stand wieder auf. »Es gibt immer eine.«
Alle Freude war von ihm abgefallen, und er wirkte anders. Ich wusste nicht, woran ich es erkannte, doch ich begriff, dass etwas nicht stimmte.
»Lass uns allein, Elizabeth!«, sagte meine Mutter.
Ich sprang vom Bett. Meine Eltern blickten mir ernst nach, als ich das Zimmer verließ und die Tür hinter mir schloss. Auch ich empfand keinerlei Glück mehr.
Draußen beobachteten mich die um den Tisch versammelten Adligen, die ebenfalls nicht mehr lächelten.
~
Später an dem Abend kam mein Vater zu mir. Ich war in meinem Nachthemd, und die Amme bürstete mir das Haar, um mich fürs Bett bereit zu machen. »Papa!«, rief ich und eilte erfreut auf ihn zu. Er hob mich in seine starken Arme. Dort fühlte ich mich sicher. Als er mich küsste, roch sein Atem nach Wein. Mit einem Nicken bedeutete er der Amme, uns allein zu lassen. Sie machte einen Knicks, ging hinaus und schloss leise die Tür hinter sich.
»Meine Süße, heute hatten wir es lustig, nicht?«
Ich nickte fröhlich. »So, so viel Spaß, Papa!« Ich umarmte ihn fest und küsste ihn auf die Wange.
»Mal amüsieren wir uns, und mal müssen wir uns gewichtiger Dinge annehmen«, sagte er und setzte sich mit mir auf den Stuhl neben meinem Bett.
Ich schmiegte mich an ihn, einen Arm um seinen Hals, und wartete, dass er weitersprach, doch er schwieg.
»Deine Mutter wünscht, dass ich dich nicht unterrichte«, erklärte er schließlich. »Aber ich habe entschieden, dass du es wissen solltest.«
»Was wissen, Papa?«
»Ich habe dich George Neville versprochen, dem Neffen des Earl of Warwick.«
»Warwick, dem Königsmacher?«
»Warwick«, korrigierte mein Vater. »Es ist falsch, ihn den ›Königsmacher‹ zu nennen. Ich verdanke meine Krone niemandem.«
Papa musste spüren, wie elend ich mich fühlte, denn er küsste mich auf die Stirn und klang weicher, als er fortfuhr: »George ist ein netter Junge, ungefähr in deinem Alter. Ich bin gewiss, dass du ihn mögen wirst, und falls nicht, vergib mir bitte, Elizabeth! Ich musste es tun.«
»Warum, Papa?«
»Das ist schwierig zu erklären, doch ich will es versuchen. Der Earl of Warwick hat einen Bruder, der ein großer Feldherr ist. Er ist mir treu, obwohl Warwick den Aufstand gegen mich anführt.«
»Sein Bruder, der Earl of N-North-umber-land?« Ich geriet ins Stolpern über das lange Wort, und Papa lachte.
»Northumberland. Du bist klug für dein Alter, Elizabeth. Deine Mutter sagte, du würdest es nicht verstehen, aber das tust du sehr wohl, nicht wahr?«
Ich nickte eifrig. Meine Mutter mochte mich nicht, weil ich ein Mädchen und kein Junge war, und sie dachte, ich wäre dumm. Dabei sagte ich nur nicht viel, denn ich hörte lieber zu. Ich streckte einen Arm aus und zog mir meine Lieblingsdecke vom Bett. Sie war aus weinrotem und blauem Samt, und wenn ich mit den Fingern über den Samt strich, beruhigte und tröstete es mich.
»Warwick hat mir die Gefolgschaft aufgekündigt«, sagte Papa und schwieg wieder.
Wegen Mama, ging es mir durch den Kopf, was ich jedoch nicht aussprach.
»Und sein Bruder Northumberland führt meine Truppen«, erklärte Papa. »Er muss für mich gegen seine eigenen Leute kämpfen. Ich kann nicht darauf vertrauen, dass er es auch wirklich tut, deshalb musste ich ihm seinen Titel nehmen. Zum Ausgleich habe ich seinen Sohn mit dir verlobt, auf dass er den Eindruck gewinnt, er würde etwas Kostbares bekommen, nachdem ihm schon seine Macht genommen wurde.«
Ich zog meine Decke dichter an mich und überlegte. Zu meiner Scham musste ich zugeben, dass ich meine Samtdecke noch zum Schlafen brauchte, auch wenn es sich für ein Mädchen von fast fünf Jahren nicht mehr ziemte. Eines aber wusste ich sicher: Meine Decke mochte ich eines Tages nicht mehr brauchen, meinen Vater aber immer. Glück erlebte ich einzig in seiner Nähe. Ich fühlte es, wenn ich auf seinem Knie saß und er mir eine Geschichte erzählte oder wenn er mich auf den Schultern durch die Burghallen trug. Und selbst wenn ich manchmal glaubte, ich würde hinunterrutschen, bekam ich keine Angst, weil ich wusste, dass er mich niemals fallen lassen würde. Wie also sollte ich jemals ohne ihn sein?
»Werde ich dich verlassen müssen, Papa?« Ich hielt den Atem an und wartete auf seine Antwort.
»Nein, noch lange, lange nicht, meine Süße.«
Sogleich wurde mir wieder wärmer. »Das ist gut. Ich möchte dich nicht verlassen, Papa. Ich möchte, dass wir für immer zusammenbleiben, immer.«
Mein Vater lachte, bevor er wieder ernst wurde. »Ich liebe dich, meine bezaubernde Elizabeth. Möge Gott in seiner Gnade dir allzeit Glück und Freude schenken, mein kleines Mädchen!«
Es war ein Segen, doch die Art, wie mein Vater ihn sprach, machte mich traurig.
~
Auf einmal veränderte sich das Leben. Mein Vater zog in die Schlacht, und meine Mutter weinte und rief: »O weh! Weh mir!«
Großmutter Jacquetta sagte ihr in einem fort: »Alles wird gut, mein Kind. Ich weiß es.« Doch Mutter schien sie nicht zu hören, denn sie jammerte bloß noch lauter. Um mich herum huschten ängstliche Bedienstete, als wäre ihnen der Leibhaftige auf den Fersen, bekreuzigten sich und riefen die Heilige Mutter Gottes an, sie möge sie retten. Aber keiner wollte mir sagen, was vor sich ging.
»Wann kommt mein Vater zurück?«, fragte ich sie, doch sie brachen nur erneut in Tränen aus, bedeckten ihre Gesichter und liefen davon. Dies waren dieselben Leute, die im Februar an meinem vierten Geburtstag mit mir gelacht und Späße gemacht hatten, und ich begriff nicht, wie alles jetzt so anders sein konnte. Ich fühlte mich einsam und fürchtete mich.
Eines Tages kam meine Mutter in das Zimmer gestürmt, in dem ich meine Musikstunde hatte, und sagte, ich solle mich beeilen, weil wir fliehen müssten.
»Wohin wollen wir, Mama?«, rief ich, als ich ihr mit meiner Laute in den Händen nachlief.
Aber »Beeil dich! Schnell!« war alles, was sie antwortete.
Wir eilten die Burgflure entlang, angeführt von meinen Halbbrüdern Tom und Dick Grey und gefolgt von Bediensteten, die meine Schwestern Mary und Cecily trugen. So flohen wir die Turmtreppe hinunter, über den windigen Hof und ins Kloster Westminster Abbey. Eine Gruppe von Mönchen erwartete uns bereits, warf die Tür zum Kapitelsaal auf, und wir rannten hinein.
»Hier seid ihr in sicherem Refugium«, sagten die Mönche. »Egal, was geschieht.« Sie entzündeten einige Kienspane, weil es zu dämmern begann.
Der achteckige Saal war groß, kalt und leer. Meine Mutter sank auf den strohbedeckten Boden und schluchzte.
Großmutter Jacquetta kniete sich neben sie. »Hab Gottvertrauen, Bess! Sei stark! Denk an das Kind, das du unter dem Herzen trägst! Edward wird zurückkommen, und du wirst ihm, so Gott will, einen Sohn schenken.«
»Mama, ich habe Hunger«, sagte ich.
»O weh! O weh mir!«, weinte meine Mutter.
»Wir haben nichts zu essen, Elizabeth«, erklärte Großmutter Jacquetta. »Wenn du brav bist, bringen uns die Mönche morgen früh vielleicht etwas Brot. Jetzt schlaf!«
Gehorsam rollte ich mich auf dem Stroh zusammen. In jener Nacht und in vielen darauffolgenden träumte ich von meinem Vater.
Während die Wochen vergingen, wurden meine Brüder Tom und Dick Grey beständig gemeiner zu mir. Sie verachteten mich schon seit Langem, weil mein Vater ein König und ihrer nur ein Ritter war. Die beiden entstammten der ersten Ehe meiner Mutter mit Sir John Grey, der auf dem Schlachtfeld gestorben war, bevor Mutter Papa heiratete. Ihrem Betragen nach wollte man kaum glauben, dass Tom mit seinen dreizehn Jahren schon beinahe ein Mann war und der nur zwei Jahre jüngere Dick ebenfalls; anstatt wie junge Höflinge benahmen sie sich wie ungezogene kleine Jungen.
»Das ist alles die Schuld deines Vaters!«, schimpften sie. »Er hat seinen Thron verloren und ist davongelaufen.«
»Hat er nicht! Ist er nicht!«, erwiderte ich empört und brach in Tränen aus. Aber ich erfuhr, dass sie recht hatten. Der Bruder des Königsmachers, dessen Sohn George Neville mein Verlobter war, hatte sich gegen Papa gewandt und ihn gezwungen, aus England zu fliehen. Nun war Papa im Burgund, wo er versuchte, eine Armee zusammenzustellen, mit der er um seine Krone kämpfen konnte.
Die Tage waren hart für uns. Wir froren und hungerten immerzu und hatten wenige Besucher. Einer, der zu uns kam, war ein Metzger namens John Gould. Er trug eine blutige Schürze, doch das Fleisch, das er uns aus purer Wohltätigkeit brachte, erfreute mein Herz und linderte mein Bauchgrimmen. Aus Dankbarkeit nahm ich seinen Namen in meine täglichen Gebete auf. Ein anderer häufiger Besucher war Bruder Bungey, den ich nicht so gern mochte, weil etwas an ihm sonderbar war. Meine Mutter und Großmutter fanden es anscheinend nicht, denn sie begrüßten ihn jedes Mal herzlich, wenn er Neuigkeiten brachte. Sie kauerten sich mit ihm in einer Ecke zusammen und tauschten flüsternd Geheimnisse aus.
Am Abend vor Allerheiligen, als meine Mutter kurz vor der Niederkunft war, luden meine Brüder mich ein, mit ihnen zu spielen. Dann schlossen sie mich im Weinkeller ein. Dort war es dunkel und feucht, und ich hatte Angst allein. Ich hämmerte an die Tür und schrie um Hilfe, solange ich konnte, nur nützte es nichts, denn niemand kam. Schließlich wurde ich müde und schlief zwischen den Weinfässern auf dem Steinboden ein.
Seltsame Geräusche weckten mich in der Nacht. Ich setzte mich auf und rieb mir die Augen.
Es war ein feierlicher Gesang von irgendwo hinter den Weinfässern, am anderen Ende des Kellers. Fackeln warfen lange Schatten, doch ich konnte drei dunkle Gestalten mit Kapuzenumhängen ausmachen.
»Anu, Enlik, Enk … Anu, Enlik, Enk …
la Nergal-ya! La zi annga kampa …”
Ich wollte weglaufen, hatte jedoch viel zu viel Angst und wagte nicht, mich zu rühren. Nachdem ich all meinen Mut zusammengenommen hatte, krabbelte ich ein wenig näher und lugte um ein Fass herum in die Schatten weiter hinten. Obwohl der Gang zwischen den Fässern eng war, konnte ich bis zu dem kleinen, fackelbeleuchteten Bereich zwischen den Steinbögen und den Treppen sehen, die hinauf in den Kapitelsaal führten. An einer Mauer stand ein Altar. Er war mit schwarzem Tuch bedeckt, und auf ihm konnte ich eine metallene Opferschale und eine Feuerschale ausmachen. Einige Kerzen flackerten auf dem Boden um die Gestalten, sodass es schwierig war, ihre Gesichter im unsteten Licht zu erkennen. Aber ich sah, dass mit Kreide ein Tor auf den Steinboden zu ihren Füßen gemalt war. Vier Kerzen brannten auf dem Boden, in jeder Ecke der Torzeichnung eine.
Ich blickte sehr angestrengt zu den drei Leuten in den schwarzen Umhängen. Der Dicke könnte Bruder Bungey sein, überlegte ich. Die anderen zwei kamen mir bekannt vor, auch wenn ihre Umrisse durch die Capes verschleiert waren. Sie standen gegen das Licht im tiefsten Schatten und mit dem Rücken zu mir.
»Im Namen des Paktes, der zwischen Dir und der Menschheit geschlossen wurde, rufe ich Dich an! Höre und erinnere! Von den Höllenpforten her rufe ich Dich!«
Bei der schneidenden Stimme des Kapuzenmannes fröstelte es mich. Er warf eine Handvoll von irgendwas in die Feuerschale, worauf Flammen und eine Rauchwolke aufstoben. Einen Moment später roch die Luft nach Weihrauch.
»Nergal, Gebieter über Schlachtenopfer, Zerstörer feindlicher Städte, Vernichter menschlichen Fleisches, erinnere Dich!« Er legte sich flach auf den Boden. »Denn was mit dem Wind kommt, kann nur von dem besiegt werden, der den Wind kennt, und was vom Meer kommt, kann nur von dem besiegt werden, der das Meer kennt. So steht es im Pakt aus Vorzeiten geschrieben.«
Er stand wieder auf, nahm die Opferschale und stellte sie auf den Boden, bevor er etwas hinter dem verhangenen Altar hervorholte. Ein weißes Kaninchen fiepte, weil er es im Nacken hielt. Der Mann kniete sich hin und erhob ein Messer. Das Tier schrie und wollte sich von ihm frei strampeln. Im Fackelschein blitzte die Messerklinge auf, als er sie fest nach unten rammte.
»Nergal, Gebieter der Opfer, erinnere Dich!« Er hob die Opferschale hoch in die Luft, stellte sie wieder ab und streute zweimal weißes Pulver, vielleicht Mehl, im Kreis um sich aus. Danach drehte er sich zurück zum Altar und reckte beide Hände in die Höhe. Ich schlich mich etwas weiter nach vorn zu dem Fass vor mir und blinzelte in die Schatten. Mein Herz klopfte wild, denn ich wusste, dass ich nicht hier sein dürfte.
»Wisse, dass die bösen Geister sieben sind, entsprechend den sieben Plejaden, die das Herz eines Menschen herausreißen und seinen Göttern höhnen.«
Ich wich zurück hinter das Fass und hielt mir den Mund mit einer Hand zu, damit ich nicht aufschrie. Der Mann hatte sich ein Eselsfell übergehängt! Für einen Moment fürchtete ich, dass sie mich gehört haben könnten. Der Kapuzenmann stellte die Opferschale auf die Kohlenpfanne, bewegte sie dort eine Weile hin und her und nahm sie wieder herunter. Dann hob er eine Wachsfigur aus der Schale und hielt sie in die Höhe. Ich hatte Mühe, sie durch den Rauch zu erkennen. Ein Bär? Er warf die Figur in die Schale.
»Koche! Koche! Brenne! Brenne! Ich rufe Euch an, Götter der Nacht! Der Bär ist von Schmerzen geplagt. Er kann nicht aufrecht stehen oder sich hinlegen, weder bei Tag noch bei Nacht. Sein Maul ist mit Band gestopft! Seine Freude ist Trauer, sein Vergnügen ist Kummer!« Er warf verknotetes Band in die Flammen. »Das Wort seiner Verdammnis ist gesprochen. Sein Knoten wurde durchtrennt. Sein Werk ist zerstört …«
Meine Zähne fingen an zu klappern. Wer war der Bär? Warum wollten sie seinen Knoten durchtrennen? Was sollte das bedeuten? Ich verstand nichts von alldem, auch wenn ich wusste, dass ich keinen Mucks von mir geben durfte. Denn falls sie mich entdeckten, würden sie vielleicht auch mich in die Opferschale werfen. Deshalb krümmte ich mich ganz klein zusammen und umfing meine Knie mit beiden Armen, um mich ja nicht zu rühren.
Die drei Gestalten wanderten nun singend im Kreis. Ihre Köpfe waren geneigt, und sie schienen das Bild anzuschauen, das sie auf den Boden gemalt hatten. Ihr Gesang wie auch ihr Kreistanz wurden schneller und schneller. Bald schrien sie die Worte:
»Meine Bilder haben dich auf den Grund der Toten geworfen.
Meine Bilder haben dich in einem Sarg bei den Toten begraben.
Meine Bilder haben dich der Vernichtung preisgegeben!«
Den beiden Gestalten in den Umhängen rutschten die Kapuzen herunter. Es waren Frauen, eine mit grauem, die andere mit hellem Haar. Sie folgten dem Eselsmann, ihre schwarzen Umhänge wirbelten herum, weil sie ihre Arme wild in die Höhe warfen. Ich hatte nun solche Angst, dass ich nicht mehr zu atmen wagte. Diese Frauen waren Hexen, und jeder wusste, dass Hexen den Leuten die Herzen herausschnitten und sie aßen.
»Gott der Nacht, wirke einen Zauber, der den Feind wirr macht und seine Gedanken irreführt! Einen Zauber, der endgültige Vernichtung wirkt! Geist der Gräber, erinnere Dich! Sein seien die dunklen Zeiten!« Der Eselsmann hielt ein Buch in einer Hand und sprenkelte mit der anderen Wasser um sich. Eine der beiden anderen Gestalten trat aus dem Schatten. Der Rauch klärte sich. Ihr Gesicht war weiß angemalt, und sie grinste wie eine Wahnsinnige. Immer wieder wirbelte sie aus dem Schatten in den Lichtkreis, und plötzlich stand sie mitten in einem Torbogen. Fackelschein erhellte ihr Gesicht, und mein Mund öffnete sich zu einem Schrei, der in meiner Kehle erbebte und nie zu einem Laut wurde. Die Hexe mit dem weißen Gesicht …
Sie war meine Mutter.
~
Niemand wusste, was ich gesehen hatte, denn Tom und Dick hatten meiner Mutter gesagt, ich wäre auf dem Abort, als sie nach mir fragte. Kurze Zeit später, am zweiten November, griff meine Mutter sich an den gewölbten Bauch, stieß einen Schmerzensschrei aus und fiel beinahe hin. Meine Großmutter eilte zu ihr.
»Komm, Bess!«, sagte meine Großmutter und führte sie hinter den weißen Seidenvorhang, der den Raum teilte.
»O weh mir!«, schluchzte meine Mutter hinter dem Vorhang. »Weh, o weh! Ein Strohlager anstelle meines schönen Gemachs im Tower für die Ankunft meines Kindes. Wie kann das sein? Wie, Mutter?«
»Ruhig, Kind. Wenn Edward die Schlacht gewinnt, bist du bald wieder im Tower.«
»Es ist die … Schuld der … Nevilles«, keuchte meine Mutter. »Das vergesse ich ihnen nicht.«
»Nein, wir vergessen es nicht.«
»Wäre Warwicks Bruder nicht … nicht zurückgegangen … an seine Seite … nichts von diesem hier … wäre geschehen … und … Edward noch König.«
»Ich weiß, mein Kind, ich weiß.«
»Ein Fluch komme über dieses Untier … diesen Bären, Warwick … Königsmacher nennt er … sich! Wenn ich wieder im Tower bin … und wieder Königin, wird Warwick … ich wünschte, er wäre tot!«
»Schhh!«, machte meine Großmutter. »So wird es sein. Hat der Bruder es uns nicht versichert? Nun musst du das Kind gebären, und möge es ein Sohn sein!«
»Ein Sohn!«, schrie meine Mutter. »O Gott, gib mir einen Sohn!« Ihre Stimme wurde sehr laut und klang so schrecklich flehend, dass ich Angst bekam. Dann schwieg sie und wimmerte nur noch vor Schmerz.
Es erklang ein Klopfen von der Tür des Kapitelsaals. Ich rannte hin, um zu öffnen. Draußen stand eine alte Frau mit gelben Zähnen, die einen Knicks vor mir machte. »Marjorie Cobb, Hebamme, meine kleine Dame«, stellte sie sich vor.
Ich öffnete die Tür weit. Nachdem sie noch einen Knicks vor mir und meinen Schwestern gemacht hatte, eilte sie zu meiner Mutter und meiner Großmutter hinter den Vorhang.
»Eure Hoheiten«, sagte sie, »mich schickt Doktor Sergio. Sein Pferd ist lahm und muss neu beschlagen werden. Er kommt, sobald er ein anderes aufgetrieben hat, M’ladys.«
Ich hörte Geflüster und wusste, dass meine Großmutter der Hebamme erklärte, wie es meiner Mutter ging.
»Gut, gut«, murmelte Marjorie Cobb mehrmals. Nach kurzer Stille, einzig unterbrochen vom Stöhnen meiner Mutter, sagte sie: »Es sieht recht gut aus. Bald sollte es so weit sein.«
Ich saß im Stroh in der Ecke des Saals, nahe der Tür, hielt meine Knie umschlungen und wiegte mich hin und her, während meine Mutter hinter dem Vorhang jammerte. Keine Stunde war vergangen, ehe es abermals an der Tür klopfte. Ich sprang auf und zog den Riegel zurück. Dr. Sergio kam hereingestürzt. Sein Umhang war nass, denn draußen regnete es. Die Erwachsenen murmelten untereinander, meine Mutter schrie weiter und schluchzte.
»Pressen!«, rief die Hebamme. »Jetzt feste pressen!«
»Feste!«, sagte auch Dr. Sergio. »Noch ein Mal!«
Meine Mutter schrie wieder, viel lauter diesmal. Mir war nicht wohl dabei, dass sie solche Schmerzen hatte, genauso wenig meinen Schwestern. Sie weinten, und ich konnte sie nicht trösten, also gab ich es auf und hielt mir die Ohren zu, doch es half nichts. Cecily riss Mary an den Haaren und schrie nach ihrer Mutter. Sie wollte hinter den Vorhang rennen, aber ich lief ihr nach und umklammerte sie. Sie wollte sich von mir befreien und schrie lauter. Hätte meine Großmutter mir nicht verboten, den Kapitelsaal zu verlassen, wäre ich ins Kloster zu meinen Brüdern Tom und Dick geflohen. Durch das Fenster konnte ich hören, wie sie Ball spielten, denn ich hatte es einen Spaltbreit geöffnet, um frische Luft hereinzulassen. Ich gab Cecily einen Kamm, mit dem sie spielen konnte, und setzte sie hin. Dann senkte ich meinen Kopf und versuchte, mich an das Lied zu erinnern, das mein Vater mir früher zum Einschlafen vorgesungen hatte.
»Gott sei Dank!«, rief die Hebamme. »Es ist ein Junge!«
»Ein Sohn«, sagte meine Großmutter voller Staunen. »Ein Erbe!«
»Ein Sohn und Erbe!«, schrie meine Mutter. Ihre Stimme war wieder kräftiger und voller Stolz. »Ein König!«
Während der nächsten Wochen wurde viel Aufhebens um den Säugling gemacht. Meine Mutter gab ihm selbst die Brust, weil wir keine Amme hatten und wenig Essen bis auf das Fleisch, das John Gould, der Schlachter, uns brachte. Er gab es uns aus reiner Barmherzigkeit, denn wir besaßen weder Geld noch Gold. Dr. Sergio kam oft, um nach dem Kind zu sehen, und sagte, der Junge erfreue sich bester Gesundheit. Er brachte außerdem Nachricht von Papa.
»König Edward ist noch in Brügge, Eure Hoheit, und sein Schwager, Charles von Burgund, weigert sich, ihn zu empfangen. Aber bald wird König Edward obsiegen. Das tut er immer.«
Als Dr. Sergio ging, kam er an mir vorbei, denn ich hockte in der Ecke an der Tür, und nahm meine Hand. »Kind, warum bist du so kalt? Warum sitzt du an der Tür, als wolltest du vor deiner Familie fliehen? Na komm, setz dich näher an die Feuerschale, damit du warm wirst!«
Ich schüttelte den Kopf, riss mich los und wich zurück. Die Feuerschale erinnerte mich zu sehr an den Weinkeller.
»Sie benimmt sich in letzter Zeit wunderlich«, sagte meine Großmutter. »Wir können nichts mit ihr anfangen. Sie weigert sich sogar, das Fleisch zu essen, das der Metzger uns bringt, und hält sich von uns allen fern.«
Dr. Sergio ging zu ihr, neigte den Kopf und murmelte ihr etwas zu, von dem ich nur ein Wort verstand: Eifersucht.
Sollten sie doch denken, was sie wollten!
~
Eines verschneiten Tages, es war kurz vor Weihnachten, öffnete ich auf ein schweres Klopfen hin die Tür. »Abt Milling!«, rief meine Mutter, ehe ich den Besucher begrüßen konnte.
Ich trat beiseite, und er stürmte an mir vorbei zu ihr. Abt Thomas Milling war ein vertrautes Gesicht, und meine Mutter stellte ihm stets dieselbe Frage, sobald sie ihn sah.
»Was haben Sie an Neuigkeiten?«, fragte sie atemlos.
Ich wusste, dass sie neugieriger auf die Nachrichten war, die er brachte, als auf die Nahrung für unsere Seelen, die sein Kommen versprach, und bei dieser Gelegenheit wollte er auch sofort mit seinen Neuigkeiten herausplatzen.
»Gott sei gelobt! Karl der Kühne hält es für geboten, König Edward beizustehen. Er rüstet in diesem Moment, in dem wir sprechen, eine Flotte für ihn.« Er senkte die Stimme zu einem Flüstern und blickte sich vorsichtig um. »Kommen Sie, meine Töchter, lassen Sie uns zusammen beten, dass König Edward gegen Warwick obsiegt …«
Ich verschloss meine Ohren. Niemand würde inniger für den Sieg meines Vaters gegen Warwick beten als ich. Meinen Vater wieder bei mir zu haben, mit ihm durch die Burgflure zu laufen! All das erschien mir wie ein Traum, als wäre es nie wahr gewesen, so lange war es her …
Abt Milling nahm meiner Mutter und meiner Großmutter die Beichte ab und ging wieder.
An meinem fünften Geburtstag, dem elften Februar 1471, drei Tage vor Sankt Valentin, brachte mir Abt Thomas Milling ein kleines Stück Kuchen. Ich teilte es in acht gleich große Scheiben, zwei für meine Schwestern, zwei für meine Brüder, zwei für meine Mutter und meine Großmutter, eine für den Abt und eine für mich. Auf die Weise bekam keiner mehr als ein paar Krumen, aber wie köstlich sie schmeckten! Der Abt schenkte uns Wein ein, ehe er uns seine Neuigkeiten mitteilte.
»König Edward hat Burgund verlassen und ist auf dem Weg nach England. Er erwartet, bald hier einzutreffen und in die Schlacht zu ziehen. Aber die französische Königin von Henry VI., Marguerite d’Anjou, hat Frankreich bisher nicht verlassen. Es heißt, dass sie Warwick nicht traut, obwohl er sein Wort gehalten und ihren wahnsinnigen Mann wieder auf den Thron gesetzt hat. Man sagt, sie würde sich lieber in Frankreich vergnügen, als hier an der Seite ihres Gemahls zu kämpfen.«
Diese Nachricht beglückte meine Mutter und meine Großmutter. Sie stießen mit ihren verbeulten Eisenbechern an und lachten fröhlich, als sie tranken. Auf die Schreie des Säuglings, seine ersten seit der Geburt, achteten sie gar nicht.
»Lasst uns nun gemeinsam beten! Das Gebet ist Nahrung für die Seele, und die Seele will mindestens so dringend genährt werden wie der Leib, ist es nicht so?«, sagte Abt Milling, weil es seine Berufung war.
Dr. Sergio und Abt Milling kamen oft, brachten kleine Gaben und flüsterten, was sie an Nachricht hatten. Dann, eines stürmischen Märztages, kam Bruder Bungey. Ich öffnete ihm auf sein Klopfen und schrak zurück, als ich sah, wer es war. Die offene Tür schlug wieder zu, weil ich in die andere Ecke des Raumes floh und den Kopf in meinen gebeugten Armen vergrub.
»Elizabeth! Wie ungezogen von dir!«, schalt meine Großmutter mich, während meine Mutter dem Bruder aufs Neue öffnete. Meine Großmutter kam zu mir und blickte tadelnd auf mich herab. »Was ist nur mit dir, Kind? Komm und entschuldige dich sofort!«
Ich rührte mich nicht. Ich hob nicht einmal den Kopf, um sie anzusehen. Dann fühlte ich den Schatten meiner Mutter auf mir. Zaghaft blickte ich zu ihr auf.
Sie riss meinen Kopf an den Haaren nach hinten und ohrfeigte mich kräftig. »Du kommst sofort, Elizabeth«, befahl sie scharf, während es noch in meinem Ohr schrillte, »sonst verdresche ich dich, dass du es nie wieder vergisst.« Sie packte meine Hand und zerrte mich auf die Knie. Ich hatte solche Angst, dass ich mich einnässte. Beschämt und elend verbeugte ich mich vor Bruder Bungey und hoffte, dass es niemand bemerkte. Der Bruder nickte und machte ein Kreuzzeichen über meinem Kopf, obgleich er mich nicht recht zu sehen schien. Seine Augen hatten einen seltsamen Glanz, und er blickte nur meine Mutter an.
»Die Schlacht wird bald geschlagen, Hoheit. Warwick hat sich geweigert, die Waffen im Austausch gegen königliche Amnestie niederzulegen. Aber nicht alle Nachrichten sind schlecht. Der Bruder des Königs, George, Duke of Clarence, hat Warwicks Seite verlassen und sich auf die König Edwards geschlagen – wo er von Anfang an hingehörte. Gott sei Dank!«
»Amen!«, riefen meine Mutter und meine Großmutter gleichzeitig.
»Beide Seiten marschieren in die Schlacht. Ihr müsst beten.«
Es wurde sehr still in dem Saal, nachdem er gegangen war. Meine Mutter und meine Großmutter sagten kein Wort und gingen ihren Pflichten nach, ohne miteinander zu sprechen. Meine Schwestern und der Säugling weinten, doch ich kümmerte mich um sie, so gut ich konnte. Derweil hing ich meinen eigenen Gedanken nach. Die waren bei meinem Vater. Ich sprach nicht, sofern ich nicht angesprochen wurde. Als die Mönche ihre Vespergesänge anstimmten, knieten wir uns alle zum Gebet. Selbst meine kleinen Schwestern legten ihre Hände zusammen und murmelten mit uns.
Die Tage verstrichen, aber erst nach Ostern erreichte uns wieder Nachricht. Eines Abends, als wir auf dem Stroh beim Essen hockten, brach auf einmal ein Tumult draußen los. Dann ging die Tür auf, und Soldaten kamen hereingestolpert. Wir sprangen auf und starrten sie an, denn wir alle wussten, dass sie Nachricht von der Schlacht brachten.
»York hat verloren!«, schrie einer der Männer, ehe er an einer der Mauern zu Boden sank. »York hat verloren …«
Ich sah meine Mutter und meine Großmutter an. Beide waren so bleich wie die Laken geworden, auf denen wir früher schliefen. Langsam sank meine Großmutter zu Boden und blieb schweigend dort sitzen. Meine Mutter stand mitten im Raum, sah verwirrt aus, als hätte sie nicht verstanden, was gesagt worden war, und bewegte die Lippen, ohne dass ein Wort herauskam.
Dann fiel sie schluchzend zu Boden.
~
Die ganze Nacht lag ich wach und an meine Schwestern geschmiegt auf dem Stroh in meiner Ecke. Meine Mutter weinte, meine Großmutter versuchte, sie zu trösten, und die Kirchenglocke schlug die Stunde, während sie ihre Psalmen sangen.
»Wir sind ruiniert«, schluchzte meine Mutter ein ums andere Mal. »Warwick wird uns abschlachten.«
»Schhh, mein Kind. Warwick würde so etwas niemals tun. Er ist ein Ritter und nimmt seinen Schwur sehr ernst.«
»Er kann uns nicht davonkommen lassen!«
»Er mag uns gefangen halten, aber er wird uns nicht töten. Wir sind keine Bedrohung für …« Hier brach ihre Stimme ab, und die Stille hing bleiern in der Luft.
»Sind wir nicht«, bestätigte meine Mutter, »das Neugeborene jedoch schon.« Sie brach in Tränen aus.
»Mein Kind, wir wissen noch nicht sicher, was in Barnet geschehen ist. Die ersten Berichte von der Schlacht sind oft falsch. Edward könnte noch leben, hat vielleicht sogar gewonnen. Ich erinnere mich, dass bei Agincourt …«
Meine Mutter schluchzte lauter.
So ging es die ganze Nacht: Meine Mutter gab sich finstersten Gedanken hin, und meine Großmutter erzählte aus ihrem Leben. Sie war eine Prinzessin von Luxemburg gewesen und hatte schon vieles erlebt. Bei ihrer Heirat mit dem Duke of Bedford war König Henry noch ohne Königin gewesen, sodass meine Großmutter zur obersten Dame im Lande wurde. Das war lange bevor sie meinen Großvater, Richard Woodville, heiratete.
Der Morgen brach an und füllte den Raum mit Licht. Meine Schwestern wachten auf, und dann regte sich der Säugling und schrie nach Essen. Meine Mutter gab ihm die Brust. Als eine Gruppe von Mönchen mit einigen Eiern, etwas Käse und Brot an unsere Tür kam, sprachen wir unsere Gebete und setzten uns anschließend zum Frühstück. Wir hatten gerade erst die Eier gegessen und ein wenig Wein getrunken, als auf dem Klosterhof Lärm ausbrach. Pferde schnaubten, Männer riefen, und Rüstungen schepperten.
»Dürfen wir hingehen und nachsehen, was passiert?«, fragte Tom.
»Dürfen wir hingehen und nachsehen, was passiert?«, wollte auch Dick wissen, der ständig wiederholte, was sein Bruder sagte, weil er so groß wie Tom erscheinen wollte.
»Geht«, flüsterte meine Mutter, »aber seid sehr vorsichtig und haltet euch fern von ihnen! Sie könnten Lancastrianer sein und euch gefangen nehmen.«
Die Jungen rannten zur Tür.
»Vergesst nicht zurückzukommen und uns zu berichten, was ihr erfahrt!«, sagte meine Großmutter.
Meine Mutter und meine Großmutter hielten sich wartend bei den Händen und neigten die Köpfe zum Gebet: »Ave Maria gracia plena dominus tecum …«
Als die Stimmen und das Scheppern der Rüstungen lauter wurden und die Schritte näher kamen, sah ich zu meiner Mutter. Sie war sehr blass geworden und murmelte ihr Gebet nur noch. Plötzlich flog die Tür auf, und mein prächtiger Vater stand da – lachend. Er strahlte wie ein König aus einem farbenfrohen Manuskript. Seinen mit Federn verzierten Helm mit dem goldenen Sonnen-und-Rosen-Wappen trug er unter seinem Arm, und das Haar fiel ihm auf die Schultern. Er grinste von einem Ohr zum anderen, sodass er unsere düstere Kammer einer Fackel gleich erleuchtete.
»Papa, Papa!«, rief ich tränenblind. Ich lief zu ihm und sprang in seine Arme. Wie herrlich es sich anfühlte, wieder von ihm gehalten zu werden! Fest umklammerte ich ihn. Er war meine Sonne, mein Mond, meine Sterne am Himmel, der Regenbogen, das Lachen und das Licht. Ich wagte nicht zu blinzeln, weil ich fürchtete, er könnte wieder verschwinden. Meine Mutter schrie auf vor Freude, und meine Schwestern kicherten, als sie sich gegen seine Beine warfen.
»Fortuna hat ihr Rad gedreht und lächelt wieder auf uns herab«, sagte meine Großmutter staunend. »Willkommen, König Edward!«
Meine Mutter hielt meinen Bruder in die Höhe. »Sieh nur, dein Sohn! Ich habe ihn Edward genannt.«
Nie werde ich den freudigen Ausdruck meines Vaters vergessen, als er zum ersten Mal meinen Bruder sah.
~
An jenem Abend zogen wir in den Palast. Es war wunderbar, Süßigkeiten zu haben, in weichen Laken zu liegen und von Samt statt Stroh umgeben zu sein! Wir saßen am Feuer, ich auf dem Schoß meines Vaters, meine Brüder und Schwestern zu seinen Füßen, und hörten uns an, was in der Schlacht von Barnet geschehen war.
»Wir waren in der Unterzahl, wie immer«, berichtete mein Vater lachend. »Und wir siegten – wie immer.«
»Wie, Papa? Erzähle uns, wie!«, bat ich ihn und wippte aufgeregt auf seinem Schoß, und meine Geschwister stimmten ein.
»Ihr werdet es nicht glauben, denn es war beinahe magisch«, sagte mein Vater mit staunendem Blick. »Am Ostersonntag, kurz bevor wir in die Schlacht zogen, senkte sich ein dichter Nebel übers Land. Er verhüllte das gesamte Schlachtfeld, verwirrte unsere Feinde, sodass sie nicht mehr wussten, wer Feind und wer Freund war. Sie schlachteten sich gegenseitig ab, denn sie sahen nicht, nach wem sie hieben. So gewannen wir!«
Mich fröstelte.
»Und Warwick?«, fragte meine Mutter leise.
»Warwick ist tot.«
Meine Mutter lächelte. »Und sein Bruder, John Neville?«
»Tot.«
Mein Vater hob mich von seinem Schoß, stand abrupt auf und wurde sehr ernst.
Er ritt noch vor Morgengrauen am nächsten Tag fort, denn er hatte noch eine weitere Schlacht zu kämpfen.
KAPITEL 2
Am Hof König Edwards · 1471–1478
WIR SCHAUTEN uns den Siegesmarsch unseres Vaters durch London vom Fenster unseres Gemachs in Westminster Palace an. Die Leute waren außer sich vor Freude. Sie jubelten, warfen weiße Rosen in die Luft, tanzten, sangen und tranken Wein aus Fässern, die an allen Straßenecken aufgestellt waren. Meine Großmutter saß neben mir am offenen Fenster und sah sich alles lächelnd an.
»Sind die Feinde meines Vaters jetzt alle tot?«, fragte ich.
»Ja. König Henrys Sohn, Prinz Edward, starb in der Schlacht.« Sie wechselte einen Blick mit meiner Mutter.
»Mich würde nicht wundern, wenn die Nachricht vom Tod seines Sohnes den alten Henry umbringt«, sagte sie mit einem merkwürdigen Schmunzeln.
Mein Vater erschien. Er ritt auf seinem schimmernden Rappen, umgeben von meinen Onkeln, George of Clarence und Richard of Gloucester, sowie einer Schar Adliger. Hinter ihnen ritten Soldaten, so weit das Auge reichte.
»Papa! Papa!«, rief ich und winkte wild. Doch in dem Lärm ging meine Stimme unter, sodass er mich nicht hörte. Er war in seiner Rüstung, allerdings ohne Helm. Ein breites Lächeln strahlte auf seinem Gesicht, als er den Menschen zuwinkte. Er fing eine weiße Rose aus den unzähligen auf, die vom Himmel regneten, und warf sie jemandem in der Menge zu. »Wer ist das Mädchen?«, fragte ich Großmama Jacquetta.
»Niemand«, antwortete meine Mutter.
»Sie ist hübsch«, sagte ich.
Auf einmal änderte sich die Stimmung in der Menge, und aus dem Jubel waren hässliche Beschimpfungen und Hohnlaute zu hören.
»Was ist?«, rief ich ängstlich.
»Die Leute haben Henrys Königin gesehen, Marguerite d’Anjou«, erklärte meine Großmutter. »Sieh nur, sie ist ganz am Ende der Prozession, auf dem Holzkarren.« Sie wies in die Ferne.
»Warum wird sie mit Sachen beworfen?«, fragte ich.
»Weil sie verhasst ist. Sie hat Dinge getan, die schlecht für England waren.«
»Was für Dinge?« Ich war neugierig, doch meine Großmutter antwortete bloß: »Das ist schwer zu erklären. Du wirst es verstehen, wenn du größer bist.«
Das Höhnen und Schimpfen in der Menge wurde so laut, dass es mir in den Ohren wehtat. Ich verließ die Fensterbank. Mein Vater würde ohnedies gleich im Palasthof sein, und ich konnte es nicht erwarten, ihn zu begrüßen.
~
Das Leben fand in seine geregelten Bahnen zurück. Mein Vater schenkte mir einen Terrierwelpen, den ich Blossom nannte, und die kleine Hündin folgte mir überallhin. Unsere Tage waren von Musik, Festen und Lachen erfüllt. Nur meine Onkel trübten die Freude, wenn sie an den Hof kamen, denn sie stritten sich untereinander. An einem Tag, nachdem mein Onkel George of Clarence abgereist war, fand ich meinen Vater allein am Fenster stehend in einem Raum voller Leute vor. Alle schwiegen, und die Minnesänger waren ebenfalls verstummt. Mein Vater hielt ein Buch in der Hand. Als ich zu ihm kam, hob er mich hoch und setzte mich auf die Fensterbank. Aber er lächelte nicht.
»Warum bist du traurig, mein lieber Vater?«, fragte ich.
»Wegen dieser Prophezeiung, gutes Kind«, flüsterte mein Vater, wobei seine Stimme brüchig klang, wie ich sie nie zuvor gehört hatte. Er zeigte mir das Buch. »Kannst du lesen?«
Ich schüttelte den Kopf. Dass ich in dem Kloster keinen Unterricht gehabt hatte, erwähnte ich nicht.
Für einen Moment sah mein Vater aus, als wollte er lächeln, wurde jedoch gleich wieder traurig. »Es heißt, mein liebes Kind, dass kein Sohn von mir zum König gekrönt werden wird, doch dass du Königin sein und an ihrer statt die Krone tragen wirst. Hier steht es.«
Mir wurde warm ums Herz. Mein Vater liebte mich so sehr, dass er sich sogar sorgte, ob ich als Erwachsene glücklich würde! »Meine Mutter ist gern Königin«, sagte ich, um ihn zu beruhigen, »also gefällt es mir vielleicht auch, Papa.«
Er lächelte und strich mir sanft übers Haar.
Doch immer wieder kamen meine Onkel, die meinen Vater aufs Neue traurig und meine Mutter wütend machten. Die Amme sagte, meine Onkel seien einander böse, weil mein Onkel Richard of Gloucester Anne Neville heiraten wollte, die Schwester von Onkel Georges Frau Bella, und George wollte es nicht.
»Warum nicht?«, fragte ich die Amme. Ich hielt Blossom auf dem Arm und streichelte sie.
»Wenn Euer Onkel Richard of Gloucester Anne heiratet, muss Euer Onkel George of Clarence das Erbe seiner Frau Bella mit ihm teilen, und das missfällt ihm. Er möchte das Vermögen seiner Frau für sich. Euer Onkel George liebt Geld.«
»So wie Mama«, sagte ich.
Die Amme lächelte stumm.
»Ich mag Onkel Richard lieber als Onkel George«, bekannte ich.
»Genau wie Euer Vater, meine Süße«, antwortete die Amme. »Und jetzt setzt Euren Hund herunter, damit ich Euer Haar flechten kann!«
Ich gehorchte. »Ich mag Onkel Richard, weil er mir Geschenke mitbringt und mit mir spielt, wenn er hier ist.«
»Er mag Kinder«, sagte die Amme, während sie mein Haar kämmte.
»Du magst ihn auch, nicht?«, fragte ich sie, weil mir ihr veränderter Tonfall auffiel.
»Euer Onkel Richard of Gloucester ist ein großzügiger Prinz.« Sie lächelte. »Er gibt mir immer ein Goldstück, wenn er zu Besuch ist.«
Der Bauch meiner Mutter rundete sich abermals, und wir zogen für die Niederkunft nach Shrewsbury. Dort blieb sie in ihrem Gemach, und wir sahen sie kaum. Während meine Mutter das Bett hütete, kam die Mutter meines Vaters, Cecily, Duchess of York, unerwartet zu uns. Sie reiste von ihrer Burg Berkhamsted an. Ich spielte gerade mit meinem kleinen Hund, als es draußen auf dem Burghof eine große Unruhe gab und ich hörte, wie mein Vater vom Korridor aus rief. Sofort lief ich aus meinem Zimmer. Eine Magd floh aus dem Privatgemach meines Vaters, und hinter ihr kam mein Vater heraus, auf einem Bein hüpfend, da er sich im Laufen die Stiefel anzog. Das Hemd hing ihm aus der Hose.
»Teufel auch, steht da nicht so herum!«, schrie er seine Ritter und Leibgarden an, die erschrocken dreinblickten. »Räumt hier auf! Ihr wisst doch, wie sie ist. Elizabeth!«, rief er, als er mich sah. Ich ging zu ihm, und er packte mich bei den Schultern. »Sei ein Engel und tu deinem Vater einen Gefallen, ja?«
Ich nickte eifrig.
»Geh und halte deine Großmutter auf! Rede mit ihr, über irgendwas, mach einen Kopfstand, egal, was, aber halte sie auf!«
Er kehrte in sein Gemach zurück, und ich eilte ohne Zögern zur Turmtreppe, dicht gefolgt von der wild kläffenden Blossom. Mein Vater brauchte meine Hilfe, und ich tat alles für ihn.
»Großmama! Großmama!«, rief ich und ergriff ihre Hand, als sie die Turmtreppe heraufkam. Dann machte ich artig einen Knicks. »Ach, Großmama, wie schön, dich zu sehen!«
»Elizabeth«, sagte sie. »Und wieder einmal furchtbar ungepflegt. Denkt deine Mutter jemals daran, dir ein neues Kleid zu bestellen?«
»Großmama, ich habe dieses erst im letzten Monat bekommen«, erwiderte ich und blickte ungläubig an meinem schönen blauen Seidenkleid mit dem Biberpelzbesatz herab.
»Dann wächst du zu schnell. Hör auf, so viel zu essen.«
Ich machte einen Knicks. »Ja, Großmama.«
Leider fiel mir nichts mehr ein, womit ich sie länger hinhalten könnte, deshalb trat ich beiseite, und sie rauschte an mir vorbei den Korridor hinunter. »Und lass diesen Hund hin und wieder trimmen«, rief sie, ohne sich zu mir umzudrehen. »Er sieht zottelig aus.«
Mary und Cecily erschienen in der Kinderzimmertür, Hand in Hand mit ihren Ammen, die sich tief vor Großmama verbeugten.
»Gibt es in dieser ganzen Burg keinen Kamm?«, fragte Großmama Marys Amme.
»Doch, gibt es, Durchlaucht«, antwortete sie eingeschüchtert und blieb tief gebeugt.
»Dann benutzt ihn! Diese Kinder sehen aus wie Trolle.« Die kleine Cecily begann zu weinen, was Großmama nicht beachtete. Sie wandte sich bereits den Männern zu, die vor den Gemächern meines Vaters auf die Knie gefallen waren, als wollten sie ihn mit ihrem Leben vor ihr schützen.
»Die königliche Garde meines Sohnes, nehme ich an?«
Die Männer murmelten etwas. »Ihr riecht wie eine Horde Kneipenwirte. Schämt euch!« Großmama zeigte mit ihrem silbernen Gehstock auf einen der Ritter. »Sie da schauen genauso zottelig aus wie Elizabeths Hund. Wer sind Sie?«
»Sir William Norris, Durchlaucht.«
»Ah, ein Lancastrianer«, schnaubte sie. »Nun, Sie sind nicht mehr bei Henry VI., also gehen Sie, nehmen Sie ein Bad und ziehen Sie sich anständig an!«
»Jawohl, Durchlaucht«, antwortete Sir William und errötete, als die anderen kicherten.
»Ich werde nie begreifen, warum mein Sohn sich unbedingt mit solchem Gesindel abgeben will, Lancastrianer und …« Sie wollte gerade mit ihrem Stock auf jemand anderen zeigen, als Papa erschien.
»Ah, Mutter«, sagte mein Vater fröhlich. In einem knittrigen roten Samtwams und hohen schwarzen Stiefeln ging er auf Großmama zu, um sie zu umarmen. »Ich bin sehr erfreut über diesen netten und unerwarteten Besuch!« Er schenkte ihr ein breites Grinsen.
»Nein, bist du nicht«, erwiderte sie. »Du hast getrunken. Dein Atem stinkt nach Wein. Aber du warst schon immer ein Säufer, Edward. Die Burg ist eine Schande. Du lernst einfach nicht dazu und bist viel zu nachlässig mit deinen Leuten.« Sie entdeckte meinen ältesten Bruder Tom hinter Papa. »Und du bist jetzt Earl of Huntingdon, was, Thomas? Du und deine endlose Verwandtschaft werden bald sämtliche Titel und Vermögen des Landes besitzen, sodass nichts mehr für andere bleibt.«
Tom verneigte sich.
»Komm mit, Edward! Ich habe ernste Angelegenheiten mit dir zu besprechen. Richard und George gehen sich wegen Anne Neville gegenseitig an die Gurgel. Ach ja, und was höre ich da über deine neue Hure?«
Mein Vater erstarrte und wechselte einen erschrockenen Blick mit meinem Bruder. Alle Ritter und Knechte sahen Papa mit offenem Mund an.
»Was ist eine Hure?«, fragte ich meine Amme.
»Zeit, im Garten zu spielen«, erklärte sie, nahm mich bei der Hand und zog mich fort. Die anderen Ammen folgten uns mit meinen Schwestern und meinem kleinen Bruder Edward.
Sechs Wochen später, am siebzehnten August 1473, brachte meine Mutter noch einen Sohn zur Welt. Wir zogen wieder nach London zurück, und im Palast herrschte große Freude. Mein Bruder wurde Richard nach unserem Onkel und unseren beiden Großvätern, dem Duke of York und Richard Woodville, genannt. Mein Vater war so erfreut, dass er meiner Mutter gewährte, worum sie ihn schon lange bat, was sie jedoch bisher nie hatte erreichen können: Er ernannte ihren Bruder, meinen Onkel Anthony Lord Rivers, den Paten meines kleinen Bruders Edward, zum Prince of Wales. Lord Rivers begab sich mit seiner Familie nach Ludlow.
~
Die Jahreszeiten kamen und gingen. Im Winter tollte ich mit meinen Schwestern Mary und Cecily auf der vereisten Themse. Im Sommer wurden große Landpartien mit dem Hofstaat unternommen, und im Herbst ritt ich auf meinem Zelter durch den Wald von Windsor. Das Leben war wunderbar. Überall wurde gelacht, und wohin wir auch kamen, wurden wir von den Leuten bejubelt.
Heute aber, als ich mit meinen Schwestern Mary und Cecily sowie meinem zweijährigen Bruder Dickon im Sonnenschein am Burgtor stand, waren alle stumm, und mir wurde das Herz in der Brust schwer wie eine Bleikugel. Papa zog in den Krieg. Er sollte gegen König Ludwig von Frankreich kämpfen.
Seine Rüstung blinkte in der Sonne, und die dunkelroten Federn auf seinem Helm wippten im Wind, als er seine Männer den Hügel hinab anführte. Onkel Anthony ritt an seiner Seite. Papa strahlte wie ein Gott, doch mit jedem Schritt, den sein Pferd tat, brannten mehr Tränen in meinen Augen. Dickon heulte, doch Mary und ich wagten nicht, unseren Kummer laut herauszuweinen. Mary war nun acht Jahre alt und ich neun, und wir mussten uns wie Prinzessinnen benehmen. Zeigten wir Gefühle, würden meine Brüder Tom und Dick Grey uns erbarmungslos verspotten – ebenso wie Cecily, die mich ungerührt beobachtete.
Es kam mir seltsam vor, dass meine Mutter allein dastand, um Papa nachzuwinken. Meine Großmutter Jacquetta war bald nach Papas Sieg über den Königsmacher gestorben.
»Wird Papa sterben?«, fragte Cecily mich. »Werden die Franzosen ihn niederschlagen?«
Ich verstand meine jüngste Schwester nicht. Sie besaß ein sicheres Gespür dafür, meine schlimmsten Ängste auszusprechen, und manchmal hatte ich das unheimliche Gefühl, dass sie bestimmte Dinge nur sagte oder tat, um mich zu kränken. Hatte sie die Tränen in meinen Augen gesehen und wollte, dass sie mir über die Wangen liefen? Wortlos kehrte ich ihr den Rücken zu und ging zur Kapelle. Der Sommerwind trug mir die Worte meiner Schwester Mary hinterher:
»Papa ist der größte Krieger der Welt und hat noch nie eine Schlacht verloren. Die Franzosen können ihm nichts anhaben. Das kann keiner.« Mary war mir nicht bloß eine Schwester, sondern auch eine gute Freundin.
Und sie sollte recht behalten. Im September, früher als irgendjemand erwartet hatte, kam Papa zurück und brachte wunderbare Nachricht.
»Meine Damen«, sagte er lachend und verneigte sich übertrieben vor mir und meinen Schwestern sowie vor meiner Mutter, »ich kehre als reicher König heim zu euch, denn ich habe den Krieg gegen Frankreich gewonnen.«
»Reich?«, wiederholte meine Mutter, wobei sie ausnahmsweise lächelte. »Was meinst du mit reich, Edward?«
»Du, Madame – oder vielmehr du und ich werden den Rest unseres Lebens tanzen und in Wohlstand genießen, denn Ludwig hatte solche Angst vor mir, dass er mir eine königliche Summe zahlte, damit ich Frankreich in Frieden lasse und nach England zurückkehre. Eine königliche Summe …« Er lachte wieder. »Und er wird noch weitere zwanzig Jahre bezahlen.«
»Wie viel, wie viel?«, fragte meine Mutter mit blitzenden Augen.
»Fünfzigtausend Goldkronen jährlich!«
Zunächst wirkte meine Mutter ungläubig und streckte meinem Vater beide Hände entgegen, weil es ihr die Sprache verschlug. Lachend wirbelten sie im Kreis herum, wie Mary und ich es als kleine Kinder getan hatten. Schließlich sank meine Mutter schwindlig und froh auf einen Stuhl und hielt sich die Seiten vor Lachen. Es war verblüffend, sie so zu sehen. Als wäre sie ein junges Mädchen.
»Und was dich betrifft, meine Prinzessin«, sagte Papa, kniete sich halb vor mich und ergriff meine Hände, »dir habe ich das kostbarste Geschenk gebracht.«
Mir flatterte das Herz in der Brust, und ich strahlte ihn an. »Was, Papa? Was kannst du mir bringen, das noch besser ist, als dich wieder bei mir zu haben?«
»Ach, geliebte Tochter, ich bringe dir deine eigene Krone.«
Meine Mutter stieß einen verwunderten Laut aus und stemmte sich von ihrem Stuhl hoch. »Eine eigene Krone? Was soll das bedeuten, Edward?«
»Um meinen Vertrag mit Ludwig zu besiegeln, versprach ich Ludwigs Sohn die Hand unserer Tochter Elizabeth.« Er richtete sich wieder auf. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne in seinem Wappen. »Ich habe dich mit dem Dauphin Charles verlobt. Du wirst eines Tages die Königin von Frankreich sein.«
Meine Mutter hielt eine Hand auf ihr Herz. »Königin von Frankreich? Ich werde die Mutter der Königin von Frankreich?« Sie sah mich mit blitzenden Augen an. »Dann muss sie Französisch lernen. Und von nun an wird sie nur noch mit Madame la Dauphiness angeredet!«
Ich starrte meine Eltern verwirrt an. »Aber wisst ihr denn nicht mehr, dass ich George Neville, dem Duke of Bedford, versprochen bin?«
Meine Mutter schnaubte verächtlich. »Hat es dir keiner gesagt? Jene Verlobung hätte nie geschlossen werden dürfen. Der junge Neville hat keinerlei Mittel. Wir mussten ihm sogar sein Herzogtum wegnehmen, weil er es nicht unterhalten konnte. Wir können dich unmöglich mit einem Niemand vermählen.«
»Komm, Blossom!«, sagte ich und nahm meine Hündin auf den Arm.
»Ihr Name ist Jolie.«
»Wie bitte?«
»Ich habe sie soeben umbenannt. Es ist das französische Wort für ›hübsch‹.«
Im November 1475 kam Mutter mit einem weiteren Kind nieder, das sie Anne nannte, und wieder hatten wir Anlass zu feiern. Meine Verlobung mit dem Dauphin hingegen trieb einen neuen Keil zwischen meine Schwester Cecily und mich. Sie trat mir nun noch häufiger als zuvor auf den Kleidersaum, wenn sie hinter mir ging.
Jedes Mal, wenn Mutter sie dabei ertappte, dass sie mich nicht mit »meine Dauphiness« ansprach, schimpfte sie mächtig mit Cecily. Die wiederum zahlte es mir heim, indem sie, während ich Französisch übte, hinter meinem Stuhl hockte, meine Hündin streichelte und ihr leise zuflüsterte: »Ma dauphin-ess, notre dauphin-ess, votre dauphin-ess …«
»Sei still, Cecily! Ich kann mich nicht konzentrieren.«
»Ich habe nichts gemacht«, erwiderte sie, »außer mein Französisch an deinem Hund zu üben.«
Eines Tages widersprach ich schließlich, als meine Mutter Cecily mal wieder energisch zurechtwies. »Mutter, lass sie, bitte! Es kümmert mich nicht, wenn sie mich nicht Dauphiness nennt.«
Meine Mutter versetzte mir eine schallende Ohrfeige. »Dich kümmert es vielleicht nicht, aber mich sehr wohl. Lass dir das eine Lehre sein! Wir müssen von jedem Respekt fordern, sonst achtet man uns nicht. Und da wir gerade dabei sind, ich möchte, dass ihr euren Bruder Tom mit seinem neuen Titel ansprecht: Marquess of Dorset. Habt ihr das verstanden?«
Ich verbeugte mich stumm und hielt mir die brennende Wange. Es war sinnlos. Mutter liebte Titel viel zu sehr, weil ihr Vater nie einen gehabt hatte, bevor er meine Großmutter Jacquetta, Duchess of Bedford, heiratete. Deshalb beschloss ich, mich an meinen Vater zu wenden.
»Papa, ich bitte dich, sag Mutter, dass Mary und Cecily mich nicht mit ›Dauphiness‹ ansprechen müssen. Es gefällt ihnen nicht, und Cecily macht mir deswegen das Leben schwer.«
»Liebes Kind«, seufzte Papa, »du musst lernen, deine Mutter nicht zu verstimmen, genau wie ich es gelernt habe. Sie ist sehr willensstark und verlangt nun einmal, dass alles so gehandhabt wird, wie sie es wünscht. Sich gegen sie zu wehren ist zwecklos.«
Er sah wieder so traurig aus, dass ich zu ihm an seinen Schreibtisch tat, wo er über Papieren saß, und ihn umarmte.
~
Das Jahr 1477 begann mit viel Jubel. Im Februar feierte ich meinen elften Geburtstag, und bald darauf, im März, wurde ein weiterer Bruder geboren. Wir feierten Bankette und Maskenbälle, auf denen ich mit Papa tanzte und viel lachte.
Meine Eltern tauften meinen neuen Bruder nach unserem Onkel George und verliehen ihm den Titel des Duke of Bedford, den Papa meinem früheren Verlobten, George Neville, weggenommen hatte. Onkel George of Clarence, der sehr gekränkt gewesen war, als mein zweiter Bruder nach Richard of Gloucester genannt wurde, schien die Ehre gar nicht wahrzunehmen, die meine Eltern ihm damit erwiesen. Jedes Mal, wenn er an den Hof kam, brachte er seinen eigenen Koch und seine Vorkoster mit. Er veranstaltete einen furchtbaren Lärm, brüllte herum, schrie meine Eltern an und behauptete, meine Mutter hätte ihn bei einem seiner vorherigen Besuche vergiften wollen.
»Warum ist Onkel George so wütend?«, fragte ich eines Morgens die Amme, als sie mir mein Kleid zuband.
»Seine Frau starb bei der Niederkunft und sein Kind wenige Tage später. Er trauert und gibt Eurer Mutter die Schuld an ihrem Tod.«
»Warum?«
Anfangs zögerte sie, doch dann sagte sie: »Ich nehme an, er muss jemandem die Schuld geben, der arme Mann.«
Obwohl ich schöne Zeiten mit Mary und meinem dreieinhalbjährigen Bruder Dickon erlebte, war mir wohlbewusst, dass im Königreich meines Vaters nicht alles zum Besten stand. Bei jedem Wetter eilten Männer mit ernsten Mienen über die Rasenflächen und Wege von Tower, Westminster Palace und Windsor und brachten Nachrichten für meinen Vater. Diesmal war es nicht der Königsmacher, sondern mein Onkel George, der Papa Schwierigkeiten bereitete. Als mein Vater ihm untersagte, Mary von Burgund den Hof zu machen, es meinem Onkel Anthony indes erlaubte, wurde Onkel George schrecklich böse. Ich tröstete meinen Vater in seiner Kammer, spielte ihm mal auf meiner Leier, mal auf meiner Laute vor. Oft sang ich für ihn, weil er sagte, ich hätte eine Engelsstimme; doch ihn gramgebeugt auf seinem Stuhl sitzen zu sehen schmerzte mich. Eines Tages massierte ich ihm die breiten Schultern, als er plötzlich nach meiner Hand griff.
»Warum ist Onkel George so böse auf dich, Papa?«, fragte ich ihn leise.
Er zog mich auf seinen Schoß. »George hat sich stets für den rechtmäßigen König von England gehalten, Elizabeth. Er nennt mich einen Bastard.«
Vor Entsetzen stieß ich einen stummen Schrei aus. »Papa, jeder weiß, dass du der rechtmäßige König bist. Wieso sagt er solche furchtbaren Dinge?«
»Wir wissen es nicht. Wir glauben, dass etwas mit ihm nicht stimmt. Er hat schreckliche Sachen gesehen, als er ein kleiner Junge war. Henrys Königin, Marguerited’Anjou, nahm die Stadt Ludlow ein und zwang ihn mitanzusehen, was ihre Soldaten mit den Bürgern machten. Es könnte seinen Verstand angegriffen haben. Wir wissen einfach nicht …«
Für einen Moment verlor er sich in seinen Gedanken. Schließlich sagte er: »Und jetzt beschuldigt er deine Mutter der Hexerei.«