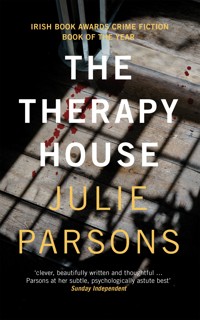Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Irische Hochspannung: Der düster-fesselnde Sammelband »Die Toten von Irland« von Julie Parsons jetzt als eBook bei dotbooks. Drei Frauen, die den Schatten ihrer Vergangenheit hilflos ausgeliefert scheinen – bis die Jäger zu Gejagten machen … Es ist der Albtraum jeder Mutter: Als ihre Tochter vermisst gemeldet wird, hofft und bangt Margaret jeden Tag. Als dann das Unfassbare wahr wird und man die Leiche ihres Kindes findet, hält Margaret nur noch eines am Leben: Den Mörder zu finden. Doch der scheint sie bereits im Visier zu haben … Zwölf Jahre hat Rachel unschuldig hinter Gittern gesessen: Jetzt, am Tag ihrer Entlassung, hat sie nur noch einen Gedanken – den wahren Täter finden, auch wenn sie dafür all das Schlimme, was ihrer Familie widerfahren ist, nicht ruhen lassen darf … Auch Lydia hat einen schrecklichen Preis gezahlt, als sie ihrer Tochter den Rücken kehrte. Nun will Lydia sie wiederfinden – doch die Suche nach ihrer Tochter vertraut sie genau dem Falschen an … Abgründige Irlandspannung für alle Fans der Serie »The Fall – Tod in Belfast«: »Julie Parsons hat ein ungewöhnliches Gespür für das Böse, ein sublimes Talent, Angst aufzubauen«, urteilt Die Welt. Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Thriller-Sammelband »Die Toten von Irland« von Julie Parsons vereint die drei Spannungs-Highlights »Mörderspiel«, »Eiskönigin« und »Sündenherz«. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1638
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
Drei Frauen, die den Schatten ihrer Vergangenheit hilflos ausgeliefert scheinen – bis die Jäger zu Gejagten machen … Es ist der Albtraum jeder Mutter: Als ihre Tochter vermisst gemeldet wird, hofft und bangt Margaret jeden Tag. Als dann das Unfassbare wahr wird und man die Leiche ihres Kindes findet, hält Margaret nur noch eines am Leben: Den Mörder zu finden. Doch der scheint sie bereits im Visier zu haben … Zwölf Jahre hat Rachel unschuldig hinter Gittern gesessen: Jetzt, am Tag ihrer Entlassung, hat sie nur noch einen Gedanken – den wahren Täter finden, auch wenn sie dafür all das Schlimme, was ihrer Familie widerfahren ist, nicht ruhen lassen darf … Auch Lydia hat einen schrecklichen Preis gezahlt, als sie ihrer Tochter den Rücken kehrte. Nun will Lydia sie wiederfinden – doch die Suche nach ihrer Tochter vertraut sie genau dem Falschen an …
Über die Autorin:
Julie Parsons wurde 1951 als Tochter irischer Eltern in Neuseeland geboren. Sie war noch ein Kind, als ihr Vater unter ungeklärten Umständen auf hoher See verschwand – ein Trauma, das sie nie loslassen sollte: »Ich werde niemals herausfinden, was mit meinem Vater geschehen ist, und vielleicht erzähle ich auch deswegen Geschichten, in deren Mittelpunkt Geheimnisse stehen – um sie selbst aufklären zu können.« Julie Parsons studierte in Dublin und arbeitete später als Radio- und TV-Produzentin, bevor sie als Schriftstellerin erfolgreich wurde. Ihr Debüt »Mörderspiel«, auch bekannt unter dem Titel »Mary, Mary«, wurde in 17 Sprachen übersetzt und ein internationaler Bestseller. Julie Parsons lebt heute in der irischen Hafenstadt Dun Laoghaire.
Bei dotbooks veröffentlichte Julie Parsons auch ihre psychologischen Thriller »Todeskälte – Der zweite Roman um Marys Tod«, »Giftstachel« und »Sündenherz«.
***
Sammelband-Originalausgabe Juni 2023
Copyright © der Sammelband-Originalausgabe 2023 dotbooks GmbH, München
Unter dem Titel »Mary, Mary« erschien die englische Originalausgabe von »Mörderspiel« bei Macmillan, London, und die deutsche Erstausgabe 1998 bei Lichtenberg. Copyright © der Originalausgabe 1998 by Julie Parsons; Copyright © der deutschsprachigen Erstausgabe 1998 bei Lichtenberg Verlag GmbH, München; Copyright © der Neuausgabe 2018 dotbooks GmbH, München
Die englische Originalausgabe von »Eiskönigin« erschien unter dem Titel »Eager to Please« bei Macmillan, London, und die deutsche Erstausgabe erschien 2001 unter dem Titel »Rache kennt kein Gebot« im Droemer Verlag. Copyright © der Originalausgabe 2001 by Julie Parsons; Copyright © der deutschsprachigen Erstausgabe 2001 bei Droemersche Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf., München; Copyright der Neuausgabe © 2018 dotbooks GmbH, München
Die englische Originalausgabe von »Seelengrund« erschien 2005 unter dem Titel »The Hourglass« bei Macmillan, London, und die deutsche Erstausgabe erschien 2006 unter dem Titel »Zähl die dunklen Stunden nur« im Droemer Verlag. Copyright © der Originalausgabe 2005 by Julie Parsons; Copyright © der deutschsprachigen Erstausgabe 2006 bei Droemer Verlag. Ein Unternehmen der Droemerschen Verlagsanstalt Th. Knaur Nachf. GmbH & Co.KG, München; Copyright © der Neuausgabe 2019 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Wildes Blut – Atelier für Gestaltung Stephanie Weischer unter Verwendung mehrerer Bildmotive von © shutterstock
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (rb)
ISBN 978-3-98690-621-4
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Sind Sie auf der Suche nach attraktiven Preisschnäppchen, spannenden Neuerscheinungen und Gewinnspielen, bei denen Sie sich auf kostenlose eBooks freuen können? Dann melden Sie sich jetzt für unseren Newsletter an: www.dotbooks.de/newsletter (Unkomplizierte Kündigung-per-Klick jederzeit möglich.)
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Die Toten von Irland« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
www.instagram.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Julie Parsons
Die Toten von Irland
Drei Thriller in einem eBook
Aus dem Englischen von Doris Styron
dotbooks.
Mörderspiel
Marys Tod – Erster Roman
Aus dem Englischen von von Doris Styron
Er will mit ihr spielen. Er will sie besitzen. Er will sie töten … Zuerst sind es nur ein paar Stunden. Margaret weiß, dass sie sich keine Sorgen machen sollte: Ihre Tochter ist alt genug, sie darf später als verabredet nach Hause kommen. Doch dann vergeht ein Tag. Und noch einer. Und noch einer. Viel zu spät beginnt die Polizei zu ermitteln. Als Marys Leiche gefunden wird, scheint die Zeit still zu stehen. Der Schmerz und die Verzweiflung reißen Margaret in einen düsteren Abgrund. Und dann sind da auf einmal diese rätselhaften Anrufe und Botschaften. Margaret weiß, wer dahinter steckt: der Killer, der ihr das Kind genommen hat. Der Sadist, der sich an ihrem Elend weiden will. Das Tier, das sie jagen muss, um zu überleben …
Für Harriet, Sarah und John, mit meiner ganzen Liebe
Teil 1
Kapitel 1
Man könnte sagen, daß alles mit einem Anruf begann. Schließlich fangen die meisten Fälle so an. Und man stellt sich dann rückblickend die Frage, ob es irgend etwas gab, das einen vorgewarnt, das einen gepackt und einem gesagt hat: Paß auf, die Sache ist ernst.
Aber damals schien es sich nur wieder einmal um eine ängstliche Mutter zu handeln, die besorgt und unsicher war. Sie wußte nicht genau, ob sie überhaupt hätte anrufen sollen. War nicht sicher, ob sie das Richtige tat. Dann wurde aus ihrer Angst Ärger.
»Wenn sie gesagt hätte, daß sie nicht heimkommt, sich gemeldet hätte. Wenn sie mir Bescheid gegeben hätte.«
Das alles hatte er schon oft gehört und kritzelte etwas auf den Rand seiner Zeitung. Waffeltüten mit Softeis, das spitz und cremig nach oben zulief, und altmodische Biergläser mit dem kleinen Wulst, der sich in Dreiviertelhöhe an der Seite des Glases wölbte. Er trug die Zeit im Verzeichnis der Anrufe ein. 21.48 Uhr. Noch zwölf Minuten bis zum Ende seiner Schicht. Sonntag, der 6. August 1995. An einem langen Feiertagswochenende. Es war zu dieser späten Stunde noch warm. Zu warm. Er hatte feuchte Flecken unter den Armen, und in der Leiste juckte es. Bestimmt waren die Krankenhäuser schon voll von Fällen mit Sonnenstich, und in zwei Stunden, wenn die Pubs schlossen, würde es wer weiß wie viele Schlägereien geben. All diese Erregung, die Menschen aufgestachelt durch nackte braune Haut, Arm an Arm, Bein an Bein. Hoffnung flammte auf, Begehrlichkeit, die an die Oberfläche aufstieg wie die kleinen Bläschen im Bier. Und dann das Zucken des hellen weißen Neonlichts – an und aus. Es ist Zeit, werte Gäste, Gentlemen, Ladies, bitte. Zigarettenstummel über den fleckigen Boden verstreut. Lippenstift verschmiert. Der Sonnenbrand juckt, und die Haut beginnt sich schon zu schälen. Seine Hand auf ihrem Bein. Du Nutte, du. He, was soll das? Und dieser Moment purer Wut, der das Glas krachend auf dem Tisch landen läßt.
»Hören Sie mir zu? Machen Sie sich Notizen?«
Er seufzte, reckte den schmerzenden Rücken. Der Schmerz saß zwischen Nacken und Taille. Er vermutete, daß es vielleicht vor ein paar Monaten beim Golfspielen passiert war. Er war nicht mehr so fit wie früher. Zu viel Schreibtischarbeit. Nicht wie in der guten alten Zeit. Als er in Belmullet Dienst getan hatte und auf dem Achill Sound hinausgerudert war, wo die blaßblauen Iniskeen Islands als dunstige Schatten am Horizont lagen und die Makrelen ins Boot sprangen. Da unten waren die langen Wochenenden etwas anderes. Es ging immer um Selbstmorde. Jemand hatte einen Schuß gehört. Überall Gehirnmasse, auf die alte Kommode gespritzt, und der Hund lag winselnd in der Ecke.
»Haben Sie es bei all ihren Freunden versucht? Überall angerufen und gefragt, ob jemand sie gesehen hat?«
Das machte das Maß voll. Er mußte den Hörer vom Ohr weghalten.
»Hören Sie. Sie verstehen anscheinend nicht. Wir sind auf Besuch hier. Meine Tochter kennt hier kaum jemanden. Ich habe Ihnen das doch schon gesagt. Sie ist gestern abend in die Stadt gegangen, um sich mit ein paar jungen Leuten aus dem Ballettunterricht zu treffen. Sie ist schon mehr als vierundzwanzig Stunden weg. Ich hätte Sie nicht angerufen, wenn ich nicht Grund dazu hätte.«
Und die Stimme wurde höher und lauter. »Da stimmt etwas nicht.«
»Wie alt, sagten Sie, ist sie?«
»Zum dritten Mal: Sie ist zwanzig.«
Er mußte es ihr sagen. Gern würde sie es nicht hören. Eltern hörten das nie gern.
»Es ist nur so: In ihrem Alter kann sie, wenn sie will, ihr Elternhaus verlassen. Wir können da nicht viel machen. Sie ist nicht mehr minderjährig. Es tut mir leid, aber junge Leute verschwinden oft.«
Schweigen. Dann tiefes Atemholen. In angespannter Erwartung verzog er. das Gesicht. Er schaute im Raum umher. In der Ecke drüben saß der vertrottelte alte Pat Byrne, hatte die Mütze noch auf dem Kopf, las die Sunday World und kaute an den Nägeln. Systematisch arbeitete er sich knirschend von Finger zu Finger. Durch die offene Tür zur Teeküche sah er Nuala Kenny, die gerade Tee machte. Er winkte ihr zu und machte mit der freien Hand eine Trinkbewegung.
»Hören Sie. Ich verstehe, was Sie meinen. Aber ich mache mir Sorgen. Ich möchte, daß Sie ihre persönlichen Daten aufschreiben und alles unternehmen, um sie zu finden. Haben Sie mich verstanden?«
Scheiße. Noch mehr Papierkram. Er stemmte sich in seinem hohen Stuhl hoch und spürte einen Stich im Rücken, als er sich nach einem Vermißtenformular auf dem obersten Regal ausstreckte. Seine Hose war zu eng. Wenn er sich abends auszog, zeichnete sich über dem Nabel immer ein rotes X von der Gürtelschnalle ab. Wie war das nur passiert, daß er so zugenommen hatte? Wo war nur der dünne junge Kerl geblieben, der vor dreißig Jahren an der Templemore-Polizeischule seinen Abschluß gemacht hatte?
»Also, fangen wir mit dem Wichtigsten an: Name?«
Er setzte sich wieder hin und klemmte den Hörer zwischen Schulter und Ohr. Als er fertig war, trank er seinen lauwarmen Tee, der Zucker lag wie eine dicke Schicht aus feinem Flußsand auf dem Boden der Tasse. Er sah die Seite noch einmal durch und versuchte, sie sich vorzustellen, das Mädchen aus den sorgfältig getippten Worten erstehen zu lassen. Groß. Eins einundsiebzig. Schlank. Zweiundfünfzig Kilo. Dunkelhaarig. Schwarzes, lockiges Haar, blasse Haut, blaue Augen. Auf dem Formular gab es keine Zeile für hübsch, unscheinbar oder häßlich. Danach fragte man nicht. Aber in diesem Fall konnte er es erraten. Er wußte, wie er sich fühlen würde, wenn es sein Kind wäre. Die Jahresstatistik war erschreckend. Acht Frauen ermordet, fast zweihundert Anzeigen wegen Vergewaltigung, fünfhundertmal sexuelle Nötigung. Zu viele. Zu viele unaufgeklärte Fälle. Plötzlich war er froh, daß er am Schreibtisch Dienst tat, daß er nur mit schwarzen Zeichen auf weißem Papier zu tun hatte, nicht mit Fleisch und Blut.
Er heftete die Vermißtenanzeige ab und räumte seinen Schreibtisch auf. Er hatte sie beruhigt, ihr gesagt, sie solle sich keine Sorgen machen, solle erst einmal vierundzwanzig Stunden abwarten. Und wenn ihre Tochter dann noch nicht heimgekommen sei, solle sie ein Bild vorbeibringen, dann würden sie an die Öffentlichkeit gehen. Er trat in die warme Nacht hinaus und ging über den Parkplatz. Von dem Imbißstand her, der immer vor dem großen Pub an der Ecke aufgebaut war, roch es nach Pommes frites. Aber er hatte keinen Hunger. Er sah zum Mond hoch, noch zwei Tage bis Vollmond Immer noch so schön wie in seiner Kinderzeit, wenn der Mondschein ihm auf dem Heimweg in Nächten gefolgt war, die so schwarz waren, daß er die Dunkelheit im Gesicht zu spüren glaubte.
Sie war irgendwo da draußen unter dem graublauen Licht. Mary Mitchell, zwanzig Jahre alt, blaue Augen, schlank. Als sie zuletzt gesehen wurde, trug sie ein schwarzes T-Shirt, einen Minirock aus rotem Wildleder und eine schwarze Jeansjacke. Hat einen neuseeländischen Akzent.
Er ließ den Motor an und fuhr langsam vom Parkplatz auf die Hauptstraße. Vergiß es, sagte er sich. Du kannst eh nichts machen. Und er seufzte tief. Ein langer Seufzer des Bedauerns.
Kapitel 2
Man könnte sagen, daß alles mit einem Anruf anfing, aber mit welchem? Der, mit dem sie sich auf der Polizeiwache gemeldet, oder der andere, der sie vor vier Monaten aus dem Schlaf gerissen hatte, als die roten Zahlen auf dem Wecker 1.02 Uhr zeigten? Automatisch hatte sie die Hand ausgestreckt. Jahre im Bereitschaftsdienst ließen immer noch die Sehnen und Bänder ihres Arms sich in Bewegung setzen, wirkten auf die Nervenenden ihrer Finger. Sie nahm den Hörer ab, fühlte das harte Plastik kalt am Ohr und meldete sich mit ihrer Telefonnummer. Ihre Stimme war ruhig, nüchtern, jede Spur von Schläfrigkeit war verschwunden. Nach einer Pause kam ein Zischen wie das Rauschen der See im Inneren einer Muschel. Und die andere Stimme war mißmutig, aber unverwechselbar.
»Margaret. Komm zu mir. Ich brauche dich.«
Dieselbe Stimme rief sie jetzt wieder.
Sie legte den Hörer auf und betrachtete sich in dem staubigen, goldgerahmten Spiegel, der immer noch über dem kleinen Tisch im Flur hing. Sie löste ihr Haar aus der Holzspange, glättete es mit beiden Händen, befestigte es wieder ordentlich in der Spange. Von den feinen Fältchen zwischen den Augenbrauen wischte sie einen imaginären Fleck und versuchte, ihr Spiegelbild anzulächeln. Aber ihr Mund zitterte, und der Glanz in ihren Augen verriet, daß sie den Tränen nah war.
»Margaret.« Wieder die Stimme, diesmal lauter. Sie wandte sich vom Spiegel ab und trat in das große Zimmer rechts vom Flur. Eine Frau saß in einem Schaukelstuhl neben einem hohen Bett. Sie war sehr klein, ihr Körper versank in dem roten Morgenrock aus Seide, den ein Gürtel um die Taille zusammenhielt. Rund um ihr herzförmiges Gesicht standen die weißen Haare hoch in die Luft. Sie schaukelte unablässig, die Füße in Pantoffeln auf den Boden gestützt, während die Holzkufen des Stuhls laut durch das stille Haus knarrten.
Margaret ging zum Erkerfenster und sah auf die See hinaus. Hoch oben am östlichen Himmel leuchtete das glänzende Gesicht des Mondes auf die Erde herab. Weiter unten am Horizont schimmerte die Venus. Sie lehnte den Kopf gegen die Fensterscheibe. Hinter ihr war immer noch die Stimme zu hören. Eine Reihe von Klagen. Ich habe Kreuzweh. Warum wirken die Tabletten nicht? Wann kommt mein netter Doktor wieder? Ich mag die Schwester von der Sozialstation nicht. Ich werde nicht sterben. Warum muß sie mich besuchen? Kannst du nichts dagegen tun? Deshalb hab' ich dich doch gebeten heimzukommen. Um mir zu helfen. Ich habe gedacht, du würdest mir helfen.
Sie wandte sich von der dunklen Nacht ab, stützte sich gegen das Fenstersims und sah sich um. In ihrer Kindheit war dies hier das Wohnzimmer gewesen, hell und schön mit gelber Tapete und dazu passenden Vorhängen mit Blümchen. Jetzt war es der Zufluchtsort und das Lager ihrer Mutter. Wackelige Zeitungsstöße türmten sich. Pappschachteln standen überall auf dem Boden herum. Sie hatte ein paarmal versucht, sie wegzuräumen, aber ihre Mutter hatte geschimpft und gemurrt, also ließ sie jetzt alles so, wie sie es vorfand.
Das Bett, das ihre Eltern einst geteilt hatten, war in die Ecke gerückt. Dieselbe rosa Steppdecke von damals lag darauf, die jetzt verblaßt und knubbelig war, weil sich die Gänsefedern unter dem angegriffenen Satin zu Klumpen zusammengeknäuelt hatten. Sie erinnerte sich an den Geruch dieses Betts. Das Parfüm ihrer Mutter, Ma Griffe, nahm sie an, und das Haaröl ihres Vaters und ein anderer Geruch, den sie erst viele Jahre später zu benennen wußte. Wenn der Ostwind nachts an den Fenstern rüttelte und Seeungeheuer sich erhoben und über die Küste herzufallen drohten, war sie in dieses Bett gekrochen. Sie hatte sich mit ihrem kalten Körper an die Wärme ihres Vaters gedrückt und sich so klein wie möglich gemacht. Immer hatte sie sich an ihn geschmiegt, niemals an ihre Mutter. Denn die hätte sich aufgesetzt, die Nachttischlampe angeknipst und ihr gesagt, sie solle nicht so albern sein, sofort in ihr eigenes Bett zurückgehen und sie nicht zu nachtschlafender Zeit aufwecken. Aber er schlang einfach die Arme um sie, sein Atem berührte ihr Gesicht.
»Wo ist John? Warum ist er nicht hier? Warum läßt du ihn nicht herein?«
Tot und längst fort, mein lieber Vater.
»Du hörst mir nicht zu, oder?«
»Was?«
»Ich hab's dir doch gesagt. Die Schmerzen. Es ist schlimm.« Tränen rannen über ihr faltiges Gesicht, und sie stieß einen schwachen Laut wie ein verletztes Kätzchen aus. Immer noch schaukelte sie vorwärts und rückwärts und hielt sich mit den winzigen Händen an den Stuhllehnen fest. Margaret fühlte, wie der gleiche Laut in ihrer Kehle aufsteigen wollte. Sie stand auf und sah noch ein letztes Mal zum Mond hinauf. Dann ließ sie die Rolläden herunter und schloß die Nacht aus.
Kapitel 3
»Du hast schönes Haar«, sagte er, wand eine lange Strähne um seine Faust und legte sich das Ende wie einen Schnurrbart über die Oberlippe. »Es wird dir fehlen.«
Die Küchenschere mit dem orangefarbenen Plastikgriff streifte ihre Wange. Sie hielt die Augen zu Boden gerichtet. Die schwarzen Locken fielen wie Federn. Schwanenflaum, dachte sie. Wie Odile in Schwanensee.
»Hier«, sagte er, als er fertig war. Er hielt ihren Kopf mit einer Hand fest und stieß ihr Gesicht mit der anderen vor den gesprungenen Taschenspiegel.
»Warum?« fragte sie, das Wort kam mühsam aus ihrem Mund, der noch voll war von seinem Geschmack und dem nach Blut.
»Warum nicht?« antwortete er und warf sie zu Boden.
»Laß mich gehen.«
»Warum?«
»Weil ...« Ihre Stimme brach, die Worte blieben stecken, als ihre Kehle sich um die Stimmbänder schloß.
»Weil du mir gehörst«, sang er mit lauter Falsettstimme
»Bitte.«
»Aha.« Er lehnte sich im Stuhl zurück, schlug die Beine übereinander und verschränkte die Arme. »Jetzt bittest du mich, hm?«
»Nein.« Sie richtete sich auf und sah ihm in die Augen. Er trat sie mit dem Fuß in den Magen. Wortlos kippte sie nach hinten um, bekam keine Luft. Dann wimmerte sie, lag da wie ein Kleinkind im Mutterleib, Arme und Beine zusammengekrümmt.
Er warf die Schere durchs Zimmer. Mit einem lauten Klirren landete sie auf dem Fliesenboden. Ein Sonnenstrahl fiel auf die Klingen, die einladend blitzten.
Er stand auf, ging zu dem großen Emailspülstein hinüber und drehte den Hahn auf. Das Wasser schoß heraus. Er füllte eine Tasse, ging zu ihr zurück und hockte sich neben sie. Er legte ihr einen Arm um die Schultern, hob sie hoch, bis sie trinken konnte. Da fing sie an zu weinen, das Salz ihrer Tränen brannte auf den wunden, geschwollenen Lippen.
»Was willst du denn? Du weißt doch, daß meine Mutter dir alles geben würde. Sie würde alles tun, was du verlangst.«
Er zog ein Taschentuch heraus und tränkte es mit Wasser. Vorsichtig tupfte er das Blut ab, das um Nase und Mund angetrocknet war. Sein schwerer Atem streifte ihr Gesicht.
»Wirklich alles. Würde sie das tun? Und würdest du das tun? Alles tun, was ich verlange?«
»Habe ich eine andere Wahl?«
Ein langer Seufzer, der in Schluchzen endete.
»Oh, wir alle können wählen. Das unterscheidet uns von den Tieren auf dem Felde. Das macht uns zu Menschen.«
»Menschen.« Sie versuchte, auf die Füße zu kommen, sich mit ihren gefesselten Händen hochzudrücken, aber die Beine gaben unter ihr nach, und sie fiel zurück. Ihre nackten Knie schlugen auf den harten Boden auf, und der Schmerz trieb ihr wieder Tränen in die Augen.
Er stieß sie mit dem nackten Fuß an, ließ seine Zehennägel über die zarte Haut ihrer Wange kratzen. »Aber wenn ich mir's überlege – du siehst eigentlich nicht sehr menschlich aus. Vielleicht hast du doch keine andere Wahl.«
Sie versuchte zurückzuweichen, aber er packte sie an den Haaren und zog sie neben seinen Stuhl.
»Also. Deine Mutter. Eine hübsche Frau. Sehr hübsche Frau. Und auch 'ne Menge Geld, stimmt's?«
Mit geschlossenen Augen nickte sie.
»Und hat sie es ganz allein geschafft, oder ist sie wie die Leute in dem Lied?«
»In welchem Lied?«
»Na, du weißt doch.« Er ließ ihr Haar los, und sie fiel wieder auf den Boden. Er stand auf, atmete tief ein und machte eine Geste, als halte er ein Mikrophon. Dann schloß er die Augen, wiegte sich hin und her und sang mit klarer, melodischer Stimme
»Them that's got shall get. Them that's not shall lose. So the Bible says and it still makes news. Mamma may have, Papa may have. But God bless the child that's got its own, that's got its own.«
»Na, wie wär's mit 'n bißchen Applaus, etwas Anerkennung?«
Am Ende verbeugte er sich tief vor ihr.
Sie hob die Hände und versuchte zu klatschen, aber die eisernen Handschellen verkeilten sich und klemmten die Haut an ihren Handgelenken ein. »Nimm sie ab, Jimmy. Bitte. Du weißt doch, es hat ohne sie mehr Spaß gemacht.«
»Spaß, soso? Spaß für wen?« Er packte sie an den Handgelenken und zog sie hinter sich her in den anderen, kleineren Raum. Er legte sie aufs Bett und zog die Handschellen über die Messingpfosten des Betts.
»Weißt du was, kleine Mary, ich glaube, ich werde deiner Mutter ein Geschenk machen. Du sagst, sie ist Psychiaterin. Sie hilft Leuten, die Probleme haben. Leuten wie mir. Leuten mit Psychosen und Neurosen. Ich werde ihr ein kleines Rätsel aufgeben. Und es hat mit dem Wort ›warum‹ zu tun. Warum tu' ich das, was ich tue, und warum tu' ich es dir an?«
Da erfüllte ein Laut den Raum. Der Klagelaut eines in die Enge getriebenen Tieres, der Schrei, den ein Kaninchen ausstößt, wenn sich das Frettchen mit seinem schlanken, muskulösen Körper durch das Loch in den Bau hinunterzwängt. Ein Kaninchen, erstarrt, bewegungslos, mit leeren Augen, wenn das Frettchen die spitzen Zähne fletscht und die Dunkelheit sich ausbreitet. Ganz langsam.
Kapitel 4
Das Telefon schrillte durch das stille Haus. Margaret hörte es, rührte sich aber nicht. Heute morgen hatte das Telefon schon zweimal geläutet, aber als sie abnahm, hatte sich niemand gemeldet. Also blieb sie sitzen, wo sie war: auf dem Fußboden in Marys Zimmer, ein Bündel mit ihren Trikots in allen Farben auf dem Schoß. Mary hatte sie überall verstreut liegen gelassen, als sie an jenem Abend eilig das Haus verließ. »Ich bin spät dran, ich räume mein Zimmer morgen auf«, hatte sie über die Schulter zurückgerufen, als sie ihre Tasche nahm und die Haustür zufallen ließ. Margaret hatte die Sachen aus Baumwolle und Lycra aufgesammelt. Rot und blau, lila und grün. Wie die Blumen, die Persephone an jenem Tag sammelte, als Hades sie in die Unterwelt entführte, dachte sie. Erst sechs Monate später sollte Demeter sie wiedersehen. Sechs Monate lang betrauerte die Welt jedes Jahr den Verlust ihrer Tochter.
Vier Tage seit Mary verschwunden war. Margaret vergrub ihr Gesicht in dem weichen Kleiderbündel. Marys vertrauter Geruch umgab sie. Sie atmete tief ein. Wie lang würde es dauern, bis der Geruch sich verlieren würde, jede Spur von ihr verschwunden wäre? Sie rutschte zur Seite auf den abgenutzten Teppich und rollte sich zusammen; plötzlich wurde ihr bewußt, daß das Telefon nicht mehr läutete und im Haus wieder Stille herrschte.
Ein neuer Tagesablauf bestimmte ihr Leben. Die normale Zeiteinteilung hatte keine Gültigkeit mehr. Sie maß ihre Tage in Einheiten, die sich aus den Schichten auf der Polizeiwache ergaben. Sie erlaubte sich einen Anruf jeweils im Abstand von acht Stunden. Von sechs Uhr morgens bis zwei Uhr nachmittags. Zwei bis zehn Uhr abends. Und zehn bis sechs Uhr morgens. In einem Spiel mit sich selbst erfand sie verschiedene Taktiken zur Verzögerung, stellte willkürliche Regeln auf. Ich trinke erst eine Tasse Tee, dann rufe ich an. Ich lese vorher noch die Zeitung, dann tue ich es. Ich werde nachsehen, ob Mutter ihre Tabletten genommen hat, dann wähle ich die Nummer. Sie aß wenig, irgendwann. Kaffee und ein Stück Brot mit Käse waren ihr Standardessen. Sie schlief zu unregelmäßigen Zeiten, hier und da. Eher ein paar Minuten als Stunden, nie im Bett, manchmal am Küchentisch oder auf einer Bank im Garten Einmal im Schaukelstuhl im Zimmer ihrer Mutter. Draußen schien die Sonne, ein vollkommener, schimmernder Feuerball an einem Himmel, der das Kornblumenblau des Meeres darunter widerspiegelte. Der kleine Strand bei Seapoint war voller Menschen. Von der Haltestelle der Dubliner Verkehrsbetriebe wanderten sie an ihren Fenstern vorbei die Straße hinunter – Mütter mit ihren Kindern, Freunde und Liebespaare, ein buntgescheckter Zug der Glücklichen. Sie stand am Tor und sah ihnen zu, war ihnen so nah, daß sie sie mit ausgestreckter Hand hätte berühren können, und doch waren sie eine Million Lichtjahre entfernt von ihrer kalten, dunklen Welt.
Um sie herum lief der Haushalt ab, dominiert von der Krankheit ihrer Mutter. Sie hatte Krebs, der acht Jahre zuvor festgestellt und seitdem behandelt worden war. Man hatte ihr die Brust abgenommen und dann eine sechsmonatige Chemotherapie gemacht. Jetzt war der Krebs wieder da. Ein Tumor an der Wirbelsäule. Das erste Mal hatte ein Brief genügt. Aber diesmal war es anders gewesen. In zwölftausend Meilen Entfernung hatte sie im Bett gelegen und Catherines Schluchzen gehört, und sie hatte gedacht: Es ist Zeit, zu ihr zurückzukehren. Abschied zu nehmen, die Geister zur Ruhe kommen zu lassen.
Sie lag jetzt mit einer Wange auf dem Boden und schloß die Augen. Sie spürte die Bewegungen im Zimmer unter sich durch die Wände des Hauses. Der Staubsauger fuhr über die verschossenen Teppiche vor und zurück, und die stetige, rhythmische Erschütterung ließ Marys Make-up-Fläschchen und -Döschen auf der Kommode klirren. Nellie war wohl da, dachte sie. Arme alte Nellie, wie Catherine sie nannte, wobei sie vergaß, daß Nellie, die schon mit vierzehn Jahren bei ihnen gearbeitet hatte, um einiges jünger und gesünder war als sie selbst. Die Türglocke läutete zweimal. Sie hob ein wenig den Kopf, ließ ihn dann wieder fallen. Das vertraute Murmeln, die Stimme des Arztes. Catherine mochte ihn sehr. Er war der jüngste Mitarbeiter der hiesigen Arztpraxis und stattete ihr jeden Tag einen Besuch ab. Manchmal brachte er Blumen oder Schokolade mit. Er flirtete mit ihr, ging auf die koketten Blicke ein, die sie ihm durch ihre dünnen Wimpern zuwarf, gab vor, den verschmierten Lippenstift und die Puderflecken nicht zu bemerken. Wer sonst würde an diesem hellen Morgen kommen? Vielleicht Pater Lonergan mit seinem gütigen Lächeln und den langen, gepflegten Händen. Vielleicht die eine oder andere Nachbarin, die sich an die Zeit erinnerte, als Catherine mit ihren eigens für sie angefertigten Schuhen und maßgeschneiderten Kostümen die bestangezogene Frau der Gemeinde gewesen war.
Margaret rollte sich auf den Rücken und schlang die Arme fest um das Kleiderbündel. Sonnenstrahlen wanderten durchs Zimmer, genauso wie es gewesen war, als sie noch ein Kind war. Ein Apfelbaum wuchs an der Rückwand des Hauses bis direkt an das Fenster ihres Zimmers hoch. Oft war sie über das Fenstersims hinausgeklettert und an den schwachen Zweigen hinuntergeglitten, die letzten Meter zum Rasen gesprungen. Mary hatte es in der ersten Woche nach ihrer Ankunft auch getan. Nur weil ich sehen will, ob alles, was du mir erzählt hast, auch wahr ist. Oh, du Kleingläubige, hatte Margaret sie getadelt, als sie unten auf dem Grasstück stand und zum Fenster hinaufsah. Sei vorsichtig. Tu dir nicht weh. Aber Mary war genauso leicht und wendig, wie sie es gewesen war. Sie landete mit den Zehen im moosigen Gras, wirbelte an Margarets ausgestreckten Armen vorbei, setzte die Füße gezielt, richtete den Körper ganz auf und erreichte mit einer Serie graziler Sprünge mühelos die Steinterrasse, wo Catherine, mit einem großen Gin Tonic vor sich, am Holztisch saß.
Margaret setzte sich langsam auf. Neben ihr stand ein hölzernes Bücherregal. Sie drehte den Kopf und las die Titel. All ihre alten medizinischen Lehrbücher, Vander, Sherman und Lucianos Human-Physiologie, Davidsons Humanmedizin, Grays Anatomie. Wie konnte man die Geheimnisse des menschlichen Herzens ergründen, dachte sie, als sie sie nacheinander herauszog und die vergilbten Seiten umblätterte. Ihre überraschend kindliche Handschrift war überall auf den Seitenrändern zu sehen. Manche Passagen waren unterstrichen, weiterführende Titel notiert, und dann steckte ein von einer Zigarettenschachtel abgerissenes Stück Pappe zwischen der Zeichnung von der Innenseite eines Knies und den Muskeln des Oberschenkels. »ICH LIEBE DICH« stand da in sorgfältig aufgemalten Druckbuchstaben, deren schwarze Tinte verblaßt war.
Tränen traten ihr in die Augen und rannen neben der Nase herab, sammelten sich in den Mundwinkeln und tropften ihr auf die Hände. Lautloses Weinen und wieder das andere, hartnäckige Geräusch. Das Läuten des Telefons. Immer wieder. Ein Ruf, den sie nicht länger überhören konnte. Sie stand auf, faltete das Stück Pappe vorsichtig in der Mitte und steckte es in die Tasche. Sie lief die Treppe zum Flur hinunter, wischte sich das Gesicht mit dem Handrücken ab und hob den Hörer hoch. Neben ihr schlug die Standuhr zwölf Uhr mittags.
»Hallo«, sagte sie. Schweigen. Sie sagte wieder »Hallo.« Dann ein Geräusch. Ein Einatmen.
»Bitte, sagen Sie etwas.«
Und noch ein Geräusch. Ein Pfeifen, hell und klar. Eine Melodie. Zuerst schienen die Töne abgehackt, unzusammenhängend. Panik durchfuhr sie. Was hatte das zu bedeuten? Was war es? Dann erhob sich eine Stimme aus den verschütteten Schichten ihres Gedächtnisses. Ihr Vater rief sie an seine Seite.
Hör zu, Maggie, hör mal. Meine Mutter, deine Oma, liebte diese Platte. Hör sie dir an. Die Hände tasteten an dem knisternden braunen Umschlag der harten schwarzen Scheibe herum. Paß auf, Maggie. Wenn du sie fallen läßt, ist sie kaputt. Paß schön auf. Leg die Nadel ganz vorsichtig auf.
Und jetzt dieselbe Melodie, gepfiffen.
Bring flowers of the fairest, bring blossom the rarest From gardens and woodland and hillside and dale,Our poor hearts are singing, our glad voices bringingOur praise of thee, loveliest Queen of the May.O, Mary, we crown thee with blossoms today,Queen of the Angels und Queen of the May.
Das Pfeifen hörte auf. Schweigen. Kälte umfing ihren Körper. Die Muskeln ihrer Beine gaben nach. Schweiß brach an ihren Handflächen und Fußsohlen aus. Ihre Haare im Nacken sträubten sich. Und ein plötzlicher Schmerz tief im Herzen zwang sie zu Boden und ließ sie ihren Kopf immer wieder aufschlagen, bis sie sich an nichts mehr erinnern konnte.
Kapitel 5
Sie hatte ihn gebeten, ihre Mutter anzurufen. Also hatte er es getan. So einfach war das. War in die Stadt gefahren. Hatte eine freie Telefonzelle gesucht. Geld eingeworfen. Die Nummer gewählt. Und da hatte es auch schon geklappt. Beim ersten und zweiten Mal hatte er nichts gesagt oder getan. Er stand nur da in der Sonne und lauschte. Er mochte den Klang ihrer Stimme mit der seltsamen Mischung von Akzenten. Hauptsächlich Süd-Dublin, aber die Vokale waren etwas anders. So ähnlich wie bei ihrer Tochter. Ausladender, breiter, lockerer, so konnte man es vielleicht beschreiben.
Er hatte noch nie so etwas getan. Jedenfalls nicht seit seiner Kindheit. Und damals waren es nur zufällige Namen gewesen, die er beliebig aus dem Telefonbuch herausgesucht hatte. Deshalb hatte er sich nie richtig vorstellen können, wie sie aussahen, wenn sie den Hörer abnahmen und zuhörten und anfingen, Angst zu bekommen. Aber diesmal hatte er Marys kleines Fotoalbum mitgenommen, und er blätterte darin, bis er das Bild fand, das ihm am besten gefiel. Ihre Mutter. Margaret. Sie saß am Strand. In einem Bikini. Sie beugte sich vor, um aus einer Thermosflasche Tee einzugießen. Eine kleine Brust rutschte fast aus dem Oberteil heraus. Er strich mit dem Zeigefinger über das Bild. Eines Tages würde er diese Haut selbst fühlen. Nicht nur den seidenweichen Glanz auf dem Foto, sondern die echte Haut.
Er war in Versuchung gewesen, Mary mitzubringen. Er hatte gedacht, er könnte auch sie sprechen lassen. Vielleicht hätte sie Margaret überreden können, zu kommen und sie zu treffen. Aber seine Vorsicht siegte über den Einfall. Zu schwierig. Zu gefährlich. Besser so. Nicht so unübersichtlich. Also ließ er Mary mit den Handschellen an den Ring in der Wand gefesselt zurück. Sie versprach, nicht zu rufen oder zu schreien, aber er glaubte ihr nicht. Er holte ein Klebeband und verklebte ihren Mund. Tränen stürzten ihr aus den Augen, als er fertig war. Dummes Mädchen. Sie sollte inzwischen gemerkt haben, daß er unempfindlich dagegen war. Sie rührten ihn kein bißchen.
Der dritte Anruf war der beste. Er hatte gewußt, daß es gut werden würde, aber nicht wie gut. Er war in der Zelle an der O'Connell-Brücke. Die an der Südseite des Flusses, wo Westmoreland Street eine Biegung macht und in den Aston Quay mündet. Es war so heiß, daß das Kaugummi überall auf dem Bürgersteig zu schmelzen begann. Leute standen um ihn herum. Touristen in alberner Sommerkleidung, weiten Bermudashorts und formlosen Hemden mit Mustern aus Palmen und blauen Wellen. Scharen spanischer Studenten kreischten wie wütende Papageien im Gedränge um die Läden mit Postern, wo sie billige CDs und witzige Souvenirs kauften. Zwei Polizisten standen an der Ampel, ein Mann und eine Frau. Er war groß und massig, wippte auf seinen gummibesohlten Schuhen vor und zurück, hatte die Hände in den Taschen und die Ärmel über die braunen Arme hochgerollt. Sie war zierlich und hatte das helle Haar unter der Mütze hochgesteckt. Sie sah zu ihm auf und lächelte, flirtete fast mit ihm. Dann wandte sie sich ab, um auf einen Stadtplan zu sehen, den ihr ein Tourist unter die Nase hielt.
Ein alter Mann kam und lehnte sich an die Telefonzelle. Er hatte langes graues, verfilztes Haar, dessen Strähnen vom Nikotin gelblich gefärbt waren. Er trug einen dunklen Mantel, viel zu dick für das heiße Wetter. Als der rauhe Stoff an der Scheibe kratzte, sah Jimmy sein Spiegelbild, das ihm mit blendend weißen Zähnen entgegenlächelte. Er sah aus wie auf dem Foto, das seine Mutter eingerahmt und im Flur aufgehängt hatte. Sein Bild von der Firmung. Rote Rosette auf grauem Anzug und ein Lächeln, über das, wie seine Mutter sagte, die Engel sich freuen würden. Er wandte sich wieder dem Telefon zu und wartete. Als er die Lippen spitzte und das Lied zu pfeifen begann, fühlte er eine heftige Erregung. Sie brach aus ihm heraus, ein Glücksgefühl, wie er es noch nie empfunden hatte. Er verstand nicht, daß niemand anders es zu bemerken schien.
Es war das Lieblingslied seiner Mutter. Sie schwärmte dafür, wie sie es immer in der Gay Byrne Show am 1. Mai spielten. Noch Tage danach sang sie es vor sich hin. Falsch. Ihre Stimme ruinierte auch den Text. Er hatte es immer gehaßt, bis jetzt.
Und als er fertig war und den Hörer aufgelegt hatte, ging er spazieren. Er schlenderte zur Grafton Street hinauf und betrachtete die hübschen Mädchen. Und da sah er sie – Mary. Eine Reihe von Fernsehern im Fenster des Sony-Ladens. Er hielt kurz an und starrte das Gesicht auf den Bildschirmen an. Eine Frau, die einen Apfel aß, stellte sich vor ihn. Er hörte des Kauen ihrer Kiefer und sah die kleinen Saftbläschen in ihren Mundwinkeln. Er wartete darauf, daß sie weiterging, aber sie blieb stehen. Also ging er in den Laden hinein. Es waren die Mittagsnachrichten. Eine Vermißtenmeldung. Vier Tage, seit sie zuletzt gesehen worden war. Ein Interview mit der Mutter des Mädchens. Sie stand im Garten vor üppig blühenden Rosenbüschen. Sie trug ein einfaches weißes T-Shirt und Jeans und blickte in die Kamera. Sie schaute ihn direkt an. Bitte, sagte sie, bitte, wenn irgend jemand weiß, wo meine Tochter ist, bitte, sagen Sie es der Polizei, oder sagen Sie es mir. Sie hob beim Sprechen die Hand und strich sich übers Haar. Dunkelbraun, glänzend, glatt aus der blassen Stirn gekämmt. Er ging mit dem Gesicht nah an den Bildschirm, und ihr Bild verschwand, löste sich in Streifen von Hell und Dunkel auf. Er trat zurück, und da war sie wieder. Vollkommen und schön, und sie gehörte ihm.
Kapitel 6
Der schwarze Stier wand und drehte sich. Blut lief rot über seinen Rücken und tropfte aus den geblähten Nüstern. Der Matador stand wie eine Mondsichel zurückgebeugt und hielt die steife rote Capa zur Seite ausgestreckt. Mit gesenktem Kopf kam der Stier auf ihn zu. Der Matador sprang zurück. Er senkte die Capa. Der Stier kam näher. Der Matador fiel zu Boden, sein Gesicht sank ins Sägemehl. Die Menge brüllte. Zwei Männer rannten auf den Stier zu, reizten ihn und lenkten ihn von dem kleinen Mann im engsitzenden blaugoldenen Anzug ab, der jetzt unbeholfen und gar nicht elegant hingestreckt auf dem Boden lag. Der verwundete Stier trampelte schwerfällig davon, die Lanzen rissen seine Haut auf, zerrten an den Wunden und hielten ihn auf, bis er mit tief hängendem Kopf hin und her schwankte und strauchelte.
Margaret sah fasziniert und widerwillig zu. Sie wünschte sich, daß der Stier sich behauptete, es seinem Folterer heimzahlte, ihn auf die gekrümmten Hörner nahm und in die Luft schleuderte, bis auch aus seinen Wunden Blut quoll. Aber jetzt kniete ein Arzt neben dem jungen Mann und erklärte ihm auf französisch seine Verletzungen, zu schnell für Margaret. Sie erhob sich von dem harten, geraden Stuhl, auf dem sie zusammengekrümmt gesessen hatte, und griff zum obersten Regal der Anrichte hinauf. Sie holte eine Flasche Whiskey herunter und stellte sie mit einem Glas auf den Tisch. Im Zimmer war es bis auf das Flackern des kleinen Fernsehgeräts dunkel. Es war früh am Morgen des siebten Tages.
Er hatte wieder angerufen. Gestern abend während des Angelusläutens. Wieder hatte er nichts gesagt, aber sie wußte trotzdem, wer es war. Sie rief die Polizei in Dun Laoghaire an und meldete es. Sie schickten jemanden, der mit ihr sprach, einen jungen, dunkelhaarigen, höflichen Mann. Er stand neben ihr auf der Schwelle und hielt seinen Blick auf den Leuchtturm am Horizont geheftet. Er trug alle Einzelheiten mit präziser, sauberer Handschrift in sein Notizbuch ein und fragte, ob er eine Wanze ins Telefon einbauen dürfe.
»Warum nicht?« sagte sie. »Aber er wird wohl kaum von einem leicht identifizierbaren Telefon aus anrufen.«
»Glauben Sie nicht?« fragte er.
»Glauben Sie es denn?«
Er zuckte die Schultern und sah auf die Uhr. »Wir wissen nicht mit Sicherheit, daß, wer immer die Anrufe macht, auch etwas mit dem Verschwinden Ihrer Tochter zu tun hat. Es gibt viele Menschen da draußen, die es fertigbringen, so etwas einfach nur zum Spaß zu tun. Es könnten Jugendliche sein, irgend jemand.«
»Und woher hätten sie meine Telefonnummer bekommen?«
»Hören Sie«, sagte er, »wir werden das Haus im Auge behalten. Unsere Männer werden stündlich hier vorbeikommen. Wenn es nötig ist, können wir in ein paar Minuten hiersein.«
Sie schraubte den Verschluß der Flasche auf und goß die gelbe Flüssigkeit ins Glas, trank und goß nach. Dann beugte sie sich vor und nahm das große schwarze Buch von dem Stoß am Boden. Der Umschlag war genarbt, so daß er wie Krokodilleder aussah. Das Wort »Photographien« war in fließender Goldschrift aufgeprägt. Der Staub auf dem Einband blieb an ihren Fingern haften. Sie hatte die Fotoalben unter dem Schreibtisch ihres Vaters gefunden. Er war in den Erker des Zimmers gerückt, das immer sein Arbeitszimmer gewesen war und auf der anderen Seite des Flurs dem Zimmer gegenüberlag, in dem ihre Mutter nun schlief.
Sie erinnerte sich, wie sie auf seinen knochigen Beinen gesessen hatte. Die Bücher lagen aufgeschlagen auf der glänzenden Platte des Schreibtischs.
»Und das ist meine Mutter, deine Großmutter, und das ist mein Vater, dein Großvater, und das sind Onkel Peter und Tante Bridie.«
Ein gepflegter Finger mit einem dunkelgelben Fleck an der inneren Seite des Fingernagels fuhr über die Familienbilder. Wer war wer, und was war was? Große Häuser von wildem Wein überrankt. Spiegelblanke Pferde, die von kleinen Jungen mit flachen Mützen und Schnürstiefeln an der Trense gehalten wurden.
»Und sieh mal, Daddy, da bist du. Mit Mami.«
»Das stimmt, meine kleine Maggie. Und was haben wir da gemacht?«
»Ihr habt geheiratet.«
»So ist es. Und wir waren sehr, sehr glücklich.«
Sie standen zusammen vor der Kirche. Mutter in einem langen weißen Kleid, dessen Ausschnitt mit Blumen besetzt war, und mit einer Schleppe, die in Falten und Rüschen bis auf ihre kleinen weißen Schuhe herabfiel. Vater in einem grauen Frack und einem Zylinder, den er in der behandschuhten Hand hielt. Sein braunes Haar war glatt zurückgekämmt, und er lächelte, als er Arm in Arm mit seiner jungen Braut dastand.
Und dann ihr Lieblingsbild.
»Wo ist das, Daddy?«
»Das weißt du doch, Maggie, denk mal nach.«
»Ist es, als ihr in den Flitterwochen wart, Daddy?«
»Das stimmt, mein Schatz.«
»Und ist das der Turm mit dem komischen Namen? Der Eivoll-Turm, stimmt's? Ich wollt', ich wär' dabeigewesen. Warum habt ihr mich nicht mitgenommen?«
Sie spürte sein vibrierendes Lachen an ihrem Rücken, und es wärmte sie.
»Ich konnte dich nicht mitnehmen, Liebling. Weil es dich damals noch nicht einmal in Gedanken gegeben hat.«
»Es hat mich nicht gegeben, Daddy? Warum nicht?«
Sie sah jetzt das Foto an. Er stand eingerahmt vom Geflecht der eisernen Füße des Turmes, ein cremefarbenes Leinenjackett hing von den dünnen Schultern herab, den Panamahut hatte er aus der Stirn zurückgeschoben, die Hände tief in die Taschen gesteckt, und er lachte.
Langsam drehte sie die steifen schwarzen Seiten um, sah fragend in die Gesichter und ihr eigenes Gesicht, das sie anblickte. Auch Marys Gesicht? Manchmal, hier und da. Nicht an Farbtönen oder der Form erkennbar, aber manchmal eine Spur von ihr, eine Andeutung, ein Ausdruck, die Linie des Kinns, der Winkel zwischen Schultern und Brust, die Art, wie ein Fuß nach außen gestellt war.
Sie goß sich Whiskey nach und nahm die Fernbedienung, schaltete von Zahl zu Zahl. Die Satellitensender strahlten noch Programme aus, Bilder von Kindern auf einem Sammelplatz zur Verteilung von Essen in Zentralafrika und Vertriebene, die sich verzweifelt dahinschleppten. Sie sah ein paar Minuten zu, der Alkohol milderte und verdeckte die Schreie, beruhigte sie. Dann nahm sie ein anderes Album in die Hand. Bilder aus der Babyzeit, immer das gleiche Baby. Steif hielt ihre Mutter sie im Arm, sie saß in ihrem Hochstuhl und schwenkte einen silbernen Löffel. Sie lächelte breit und mit Zahnlücken zwischen den vorderen Zähnen. Sie fuhr auf ihrem ersten Fahrrad und ritt ihr erstes Pony. Mit langen Beinen, x-beinig im Badeanzug, das Haar wie Rattenschwänze über die Schultern hängend. Erstkommunion und Firmung, sie sah geradezu wie ein Engel aus. Weitere Beweise für Genugtuung und Erfolg. Sie hatte Rosetten und Pokale bei den Festen im Ort gewonnen. Preisverleihung in der Schule. Und dann nichts mehr.
Sie blätterte die restlichen Seiten durch. Alle waren leer, nur die rauhen Stellen der sauberen Quadrate und Rechtecke, wo einmal die Fotos gewesen waren, zeigten ihr, wo die Bilder von dem steifen schwarzen Papier abgerissen worden waren. Mit dem Glas in der Hand stand sie langsam auf, ging durch die Küche hinaus und tastete sich im Dunkeln die unebenen Holzstufen hinauf. Sie stieß die Tür zum Arbeitszimmer auf und schaltete das Licht an. Früher hatte es noch andere Fotos gegeben, die gerahmt auf dem Kaminsims standen und an der Wand hingen. Examensfeier am Trinity College. Eine Skizze, die er für ihren sechzehnten Geburtstag gemacht hatte. Ihre erste Reise nach Griechenland. In einem weißen Kleid stand sie vor der Akropolis. Er hatte dieses Foto sehr gemocht. Das Original trug er immer in der Brieftasche, und sie hatte es als Weihnachtsüberraschung vergrößern und rahmen lassen.
Sie stand mitten im Zimmer und sah sich um. Nellie hatte seine Bücher und Papiere in Kisten packen müssen, die jetzt an der Wand standen. Sie kniete sich daneben, griff in die Sachen hinein und kramte darin herum. Ein Metallstreifen, der vom Rand einer Kiste abstand, verletzte sie am Arm, schürfte die Haut oberhalb des Ellbogens ab. Immer noch suchte und wühlte sie herum, zog eine Handvoll loser, mit Schreibmaschinenschrift bedeckter Seiten heraus, Bündel von Notizbüchern, alte Terminkalender. Endlich saß sie mit steifen Knien still, ihre Hände waren mit Staub und Schmutz bedeckt. Sie stand auf, ging aus dem Zimmer und öffnete die Haustür. Die warme Luft draußen war vom Salzgeruch erfüllt, der über den jetzt bei Ebbe freiliegenden Sand und Schlick herüberwehte. Sie lehnte sich an das Geländer am Ende der Stufen und nahm einen großen Schluck aus dem Glas. Ein großer schwarzer Wagen fuhr vorbei und wand sich vorsichtig an den anderen auf der schmalen Straße parkenden Autos vorbei. Sie sah den roten Rücklichtern nach, als er bis zum Ende der Sackgasse weiterfuhr. Sie hörte auf das aussetzende Motorengeräusch, dann wurde der Rückwärtsgang eingelegt, und der Wagen kam zurück. Sie konnte nicht erkennen, wer darin saß. Eine, vielleicht zwei Personen. Die Polizei, dachte sie. Der Wagen bremste und hielt nur für einen Augenblick an, danach fuhr er weiter. Sie drehte sich um und sah den Lichtern nach, als der Wagen am Martello-Turm um die Ecke bog und den Hügel zur Durchgangsstraße hinauffuhr. Dann ging sie ins Haus zurück und schloß die Tür.
Kapitel 7
Der Hund winselte. Er zog an der ledernen Leine, heiser und stoßweise kam sein Atem aus der offenen Schnauze. Es war Sonntag, der 13. August. Der achte Tag. Halb acht Uhr morgens. Kühler als gestern oder vorgestern, aber helle Sonnenstrahlen fielen schräg durch die Roßkastanien, Eschen und Eichen und wärmten die weißen Wedel des Mädesüß, dessen Honiggeruch schon so früh am Tag in der Luft hing.
Der Hund zog und zerrte wieder, steckte die Schnauze tief zwischen die rauhen Grasbüschel an beiden Seiten des Wegs, der am Kanal entlangführte. Er hielt an, senkte den Kopf, sein schwarzer Schwanz mit den langen Haarbüscheln stand steil und gespannt nach oben, und die Luft trug seiner Nase den Geruch von tausend Möglichkeiten zu.
Der ältere Mann, der mit ihm spazierenging, beugte sich langsam hinunter, in der Morgenstille knackte es in seinen Knien. Knorpel und Knochen rieben schmerzhaft gegeneinander. Mit einer Hand stützte er sich auf seinen Stock. Mit der anderen packt er den Hund am Halsband und zwang seine zitternden Finger, den metallenen Haken an der Leine zu öffnen. Der Hund leckte ihm die Hand, ließ die Zunge über die geschwollenen, arthritischen Knöchel gleiten und folgte dann einer Fährte. Sein Schwanz wedelte jetzt wie ein kleines schwarzes Ruder hinter ihm her.
Der Mann folgte ihm langsam. Er sprach leise vor sich hin, hielt hin und wieder an, stocherte mit seinem Stock in einem Haufen alter Dosen, zog ein großes Büschel Holunderbeeren herunter, die dunkelblau, fast wie kleine schwarze, überreife Weintrauben herabhingen, und sah den Libellen nach, die mit ihren ölig schillernden Flügeln über das trübe Wasser des Kanals dahinschossen.
Sechs Meter vor ihm hatte der Hund angehalten und stand sprungbereit an der Böschung. Erregung durchzuckte seinen kleinen Körper, Schübe der Ungeduld ließen seinen glänzenden schwarzen Rücken erzittern. Mit den Pfoten kratzte er in dem trockenen, staubigen Gras. Er lief von rechts nach links, krümmte und drehte sich, dann winselte er wieder und bellte. Der alte Mann holte ihn ein. In der rechten Hand hatte er einen Holunderzweig. Er hielt ihn über den Kopf des Hundes, schwang ihn hin und her und warf ihn dann in weitem Bogen ins Wasser. Der Hund schlug wieder an, machte sich bereit und sprang hinein; tauchte mit dem Kopf zuerst unter, dann breiteten sich auf beiden Seiten seiner paddelnden Vorderpfoten Wellen aus.
»Komm her, Junge«, rief der alte Mann. »Jude.« Und er pfiff, ein dünner, zitternder Laut.
Der Hund packte den Zweig mit zurückgezogenen Lefzen, so daß die weißen Zähne zu sehen waren. Er drehte sich um und begann, auf seinen Herrn zuzuschwimmen.
»Guter Junge. Guter Hund«, rief der alte Mann.
Und dann verschwand der kleine schwarze Körper unter einer Esche, die über die Böschung hing. Später war der alte Mann sich nicht sicher, und er wußte nicht mehr genau, wann er merkte, was in dem Plastiksack war, den Jude gefunden, an dem er zu zerren begonnen und den er dann aufgerissen hatte. Erst nachdem er Jude gerufen und ihm gepfiffen hatte und er neben ihm auf das Gras gekrochen war und mit dem nassen Schwanz hin und her wedelte, erst da bemerkte er, daß etwas zwischen den Zähnen des Hundes steckte. Und als er ihm die Schnauze öffnete und die schwarzen Büschel herausnahm, erkannte er den Umriß dessen, was da unten im Wasser schwamm, und begann zu laufen, um Hilfe zu rufen, und der Hund rannte und sprang neben ihm her, hüpfte hoch, zog an seiner Jacke und leckte ihm das Gesicht ab.
Kapitel 8
Sie würde sich umziehen, passend für die Gelegenheit. Sie würde Jeans und T-Shirt, die sie jetzt wie eine ständige Uniform trug, ablegen und würde ihr cremefarbenes Hemdblusenkleid mit dem roten Leinenschal anziehen, das sie und Mary zusammen ausgesucht hatten und das sie so mochte. Sie würde sich die Korallenkette um den Hals legen, die Mary ihr zum vierzigsten Geburtstag geschenkt hatte, würde sich frisieren und schminken. Sie würde tun, was getan werden mußte.
Kurz nach elf an diesem Morgen waren zwei Männer gekommen. Sie war gerade dabeigewesen, Catherine beim Baden zu helfen, als es läutete. Sie lief hinunter, noch mit dem Handtuch in der Hand, ihr Hemd voller dunkler Wasserflecken. Der ältere Mann stellte sich vor. Michael McLoughlin, Kriminalinspektor. Er streckte die Hand aus, aber sie nahm sie nicht. Sie stand in der Sonne, trocknete sich ab, hörte die Worte, verstand aber deren Sinn nicht. Der jüngere Mann nahm ihr das Handtuch ab, als sie in den Flur traten, und schloß die Haustür. Er hängte es über das Treppengeländer. »Nicht hier, lassen Sie es nicht da hängen«, sagte sie. »Hängen Sie es auf die Wäscheleine im Garten – dort«, und sie zeigte auf die Stufen, die zur Küche und zur Hintertür führten.
»Wir können warten«, sagte Inspektor McLoughlin. »Nehmen Sie sich Zeit.« Und er setzte sich auf den Stuhl beim Telefon und breitete die Zeitung aus, die in seiner Jackentasche gesteckt hatte.
Die Leiche lag auf einer Bahre und war wie in einem Operationssaal mit einem grünen Tuch bedeckt. Auf dem Weg zur Leichenhalle der Gerichtsmedizin in der Store Street hatten sie nicht viel zu ihr gesagt. Der jüngere Mann – Finney, so glaubte sie, hieß er – saß am Steuer des Wagens, der nicht als Polizeifahrzeug gekennzeichnet war. Er fuhr schnell, zu schnell, überholte alles, was vor ihm war, schaffte es gerade noch bei Gelb. Sie mußte sich mit den Füßen gegen den Boden stemmen, um auf dem glatten Rücksitz nicht hin- und her geschleudert zu werden. Neben ihrem Kopf baumelte ein kleiner grüner Tannenbaum, der die Luft verbessern sollte. Er schlug rhythmisch gegen die Fensterscheibe, als sich der Wagen durch den dichten Sonntagsverkehr wand. Wie das Geräusch eines Bleistifts, wenn man damit auf ein Blatt Papier tippt, dachte sie. Marys Lieblingsbuntstifte. Lakeland. In einer schönen Blechschachtel. Mary kniete auf einem Stuhl am Küchentisch und malte voller Hingabe und Sorgfalt. Sie zog die ausladenden Zickzacklinien des Weihnachtsbaums, füllte sie systematisch aus und hielt den grünen Stift ganz fest in der kleinen Hand. Sie zwang ihn, innerhalb der dicken Begrenzungslinien zu bleiben, wobei die Spitze das dünne Papier durchlöcherte. Draußen in der Hitze der südlichen Halbkugel war es Weihnachten. Drinnen verzierte sie den Baum mit Schnee aus Wattebäuschen, die sie mit einer Paste aus Mehl und Wasser aufklebte. Sie hockte sich auf die Fersen und ließ den Blick über ihr Werk schweifen, auf der Suche nach Unvollkommenheiten. Tip, tip, tip machte der Bleistift auf dem Papier. Schau mal, Mami, ist er nicht schön?
Sie wollte ihm sagen, er solle langsamer fahren. Sie wollte diese letzten paar Minuten auskosten, in denen sie es noch nicht mit Gewißheit wußte. Bis jetzt war eigentlich nichts passiert. Sie war nur an einem heißen, sonnigen Sonntag im August unterwegs, wie all die anderen Leute in all den anderen Autos, die die Straße zwischen Blackrock und Ballsbridge bevölkerten. Aber jetzt bog er schon von der Pearse Street in die Townsend Street ein, die Ampeln waren alle grün, das Wasser im Fluß glitzerte gelb, als sie über die Brücke fuhren und vor einem kleinen, unauffälligen Backsteingebäude hielten, das im Schatten hinter dem mächtigen Busbahnhof der Stadt lag.
Sie stand neben der Bahre. Inspektor McLoughlin sprach mit ihr. Der Angestellte der Leichenhalle würde das Tuch heben, nur für einen Augenblick. Er würde sie bitten, die Leiche anzusehen und sie zu identifizieren. Es sei notwendig, daß sie laut spreche, »für die Unterlagen, verstehen Sie«. Sie nickte. Sie wußte, was getan werden mußte. Vor Jahren hatte sie einmal einen Sommer lang als Studentin in dieser Leichenhalle gearbeitet. Aufräumen, Vorbereitungen, Routinearbeiten. Es war ein guter Job gewesen. Er hatte ihr zugesagt. Das einzige Problem war der Geruch gewesen. Das Formaldehyd, das in ihren Haaren und in ihrer Unterwäsche haftenblieb, weil es durch den grünen Kittel drang. Und die anderen Gerüche, die einen verfolgten, sich in den Schleimhäuten und in der Phantasie festsetzten. Sie ließ den Blick von der zugedeckten Bahre zu den knochenweißen Emailspülen durch den Raum schweifen. Alle Oberflächen waren hart und glänzend. Stahl, Fliesen, Glasbehälter und Flaschen. Die einzigen weichen Dinge, die hier hereinkamen, waren die Körper, die wie dieser hier passiv und wartend dalagen.
McLoughlin räusperte sich. Finney stand hinter ihm und fuhr sich mit der Hand durch eine Strähne seines dunklen Haares, die ihm über die rechte Augenbraue herunterhing; ihre Blicke trafen sich, und er lächelte, die keilförmigen Vertiefungen auf seinen Wangen bildeten tiefe Grübchen.
»Wenn Sie soweit sind, Frau Dr. Mitchell.«
Sie trat vor, näher an die Leiche heran. Entschlossen stemmte sie die Füße gegen den kalten Fliesenboden im Schachbrettmuster. Sie öffnete die Fäuste, zu denen sich ihre Hände geballt hatten, und strich ihr Kleid an den Seiten glatt. Sie nickte.
Später erinnerte sie sich, daß ihre erste Reaktion Erleichterung gewesen war. Dies hier konnte nicht Mary sein. Mary hatte dicke, üppige schwarze Locken. Widerspenstiges Haar, das sich weder mit Bürsten, Kämmen, Gummibändern noch Bändchen zähmen ließ. Haar, das wie Wasser herunterfloß und immer wieder seinen eigenen Weg fand. Nicht wie dies hier, dünn und ungleichmäßig, achtlos abgeschnitten, so daß die weiße Kopfhaut durchschien wie bei einer alten Puppe, die vergessen in der hintersten Ecke des Schrankes liegt. Sie streckte die Hand aus und berührte es, dabei sprang eine schwarze Locke hoch und ringelte sich um ihren Finger. Wie die Seitenschößlinge der Wicken, die ihr Vater jeden Sommer pflanzte und die sich federnd um den Draht wickelten und festhingen, auch wenn Sommergewitter an ihnen zogen und zerrten. Und dann fühlte sie Scham, daß sie sie nicht sofort, auf der Stelle und unleugbar erkannt hatte. Trotz der blauen Flecken unter den Augen und auf den Wangen. Trotz der kleinen, dreieckigen Wunde an der Stirn, wo der Hund ihre Haut verletzt hatte. Trotz der dick geschwollenen Lippen und der schiefen Nase.
McLoughlin sagte wieder etwas. »Können Sie diese Person identifizieren?«
Sie nahm hinterher an, daß ihr Mund die richtigen Worte gesagt hatte. Sie konnte sich nicht daran erinnern. Aber sie hatte sich den Umstehenden zugewandt und sie angeschrien, sie sollten gehen und sie allein lassen. Und der Polizist McLoughlin hatte sich zu den anderen Männern umgedreht, zu dem Angestellten der Leichenhalle und zu Finney, hatte den Finger auf die Lippen gelegt, damit ihre Einwände zum Schweigen gebracht und sie auf den Flur hinausgeschoben.
Sie beobachteten sie durch das runde Fenster in der Tür. Sie hatte sich von der Bahre abgewandt und ging im Raum umher. Sie öffnete und schloß Schubladen. Sie nahm die Gefäße mit den Chemikalien herunter und las die Etiketten. Sie stellte sie ordentlich und vorsichtig der Größe nach wieder an ihren Platz auf dem Regal. Sie öffnete den Sterilisationsapparat aus Stahl und überprüfte mit ausgestrecktem Zeigefinger den Inhalt. Sie sah einen Stapel Röntgenbilder durch, der auf der Bank lag, hielt die Aufnahmen gegen den Röntgenbildbetrachter, beugte sich vor, um die geisterhaften Überbleibsel anderer zu betrachten, die durch diesen Raunt gekommen waren. Sie ging auf und ab, von einer Seite des Raums zur anderen, ihre Füße folgten achtsam der Musterung des schwarzweißen Fußbodens. Ihre Lippen waren in Bewegung, aber man konnte nichts hören. Sie nahm ihren Schal ab und ließ ihn fallen, er breitete sich aus wie ein roter Fleck. Sie setzte sich mit dem Rücken gegen die Wand und wiegte sich vor und zurück. Sie steckte ihre Hand in die Tasche, zog eine gelbe, voll erblühte Rose heraus und roch daran. Dann stand sie auf und ging zur Bahre zurück, hob das Tuch und nahm es weg. Finney, der neben McLoughlin stand, würgte, stieß einen schwachen, röchelnden Ton aus, der in dem stillen Korridor laut hallte, und wollte die Tür öffnen. McLoughlin streckte die Hand aus, hielt ihn am Arm zurück und schüttelte den Kopf.
Sie sahen ihr wieder zu. Sie stand am oberen Ende der Bahre und umfaßte das Gesicht ihrer Tochter mit beiden Händen. Dann ging sie um die Liege herum, blieb daneben stehen, glitt mit ihren Händen über den zerschlagenen Körper des Mädchens, wobei sie die Muster der grünen, gelben, braunen und schwarzen Flecken nachzeichnete. Sie beugte sich hinunter und küßte jeden steifen Finger und versuchte, ihre eigenen Finger in die erstarrten Handflächen zu legen. Dann kehrte sie zum Kopfende zurück. Sie beugte sich über ihre Tochter, küßte sie auf die Lippen und legte die Rose so hin, daß sich ihre Blütenblätter an ihren Hals schmiegten. Dann wandte sie sich ab.
Kapitel 9
Jetzt ist das Rad ins Rollen gebracht, dachte McLoughlin. Ein Stein fällt in einen Bergsee, und die Wellen breiten sich aus. Ein Schuß kracht aus dem Lauf eines Gewehrs, und ein Schwarm Krähen erhebt sich in den Himmel Ein Schmetterling schlägt mit den Flügeln, und am anderen Ende der Welt ergießt sich eine Sturzflut aus dem Meer über das Land. Ein Mädchen wird ermordet, und der Schandfleck des Verbrechens beunruhigt die ganze Stadt, weckt sie auf, mischt die Karten aus früherem Zorn und Verdacht wieder neu.
Er stand am Küchenfenster hoch oben in den Dubliner Bergen und sah zu, wie sich der Glanz der Sonne verlor und vom künstlichen Leuchten Hunderter und Tausender orangefarbener, gelber und weißer Lichter ersetzt wurde. Irgendwo da unten, dachte er, liegen alle Antworten auf alle Fragen. Wer und warum, wie und wo, die grundlegenden Lehrsätze bei der Aufklärung eines Verbrechens. Am Anfang eines Falls stand er dort oft mit einem Glas in der Hand und ging in Gedanken die Fakten durch, die er schon kannte. Dann ließ er sich treiben, ließ seine Phantasie wandern und wie das Licht einer Kerze in alle Ecken dringen, die noch dunkel und schattenhaft von den Spinnweben der Unwissenheit verhangen waren.
Das ist die beste Zeit, dachte er, während das Zwielicht in die Nacht überging. Er prostete seinem Spiegelbild im Fenster zu. Eine Zeit der Erwartung, der Erregung und Hoffnung. Es waren noch keine Entscheidungen getroffen, keine Fehler gemacht worden. Alles da draußen wartete auf ihn.
Er wandte sich ab und machte sich an die abendlichen Aufgaben. Er wollte das Abendessen machen, würde etwas Einfaches essen und es so zubereiten, wie sein Vater das immer getan hatte. Er machte den Kühlschrank auf und nahm ein Stück Fleisch in einer Plastiktüte heraus. Es war ein Filetsteak, das er gestern gekauft hatte. Er war in die Stadt gegangen, um sich die Haare schneiden zu lassen, und danach, als die kleinen, stechenden Härchen noch zwischen Hals und Kragen saßen, in der Sonne ziellos die Grafton Street entlanggeschlendert, war dann in den schmalen Seitenstraßen in verschiedene Läden gegangen und hatte das eine oder andere an Lebensmitteln eingekauft. Das Steak, einen Beutel neue Kartoffeln, zwei Köpfe Grünkohl und ein Körbchen später Himbeeren, von denen er schon auf der Heimfahrt aß. Gute Ware. Keine dieser viel zu teuren, modischen Zutaten, dachte er, als er das Fleisch auf die Anrichte legte und die Kartoffeln erst zum Waschen in die Spüle und dann in einen großen Topf mit fest sitzendem Deckel schüttete.