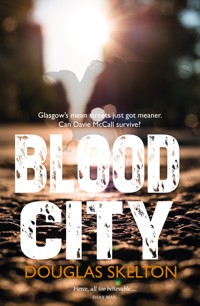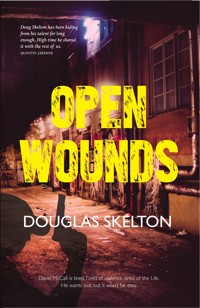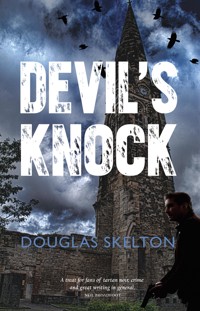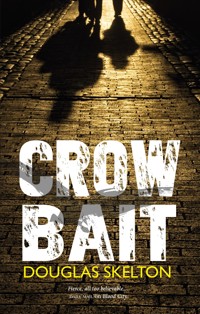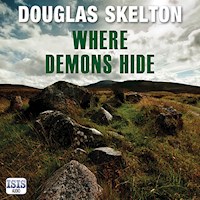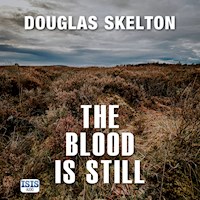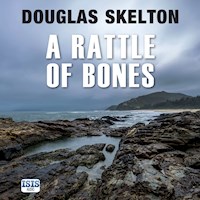Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Rebecca Connolly ermittelt
- Sprache: Deutsch
Eine aufstrebende Reporterin, ein ungeklärter Mordfall und eine schottische Insel voller Geheimnisse Als die junge Journalistin Rebecca Connolly von Roddie Drummonds Rückkehr auf die Insel Stoirm erfährt, wittert sie eine Geschichte: Fünfzehn Jahre sind vergangen, seitdem Drummond wegen des Mordes an seiner Geliebten unter Anklage stand. Aufgrund mangelnder Beweise endete das Verfahren damals mit einem Freispruch. Roddie verließ die eingeschworene Inselgemeinschaft und verschwand. Nun kehrt er für die Beerdigung seiner Mutter zurück – und reißt damit alte Wunden wieder auf. Rebecca schließt sich mit einem befreundeten Fotografen zusammen, um dem Geheimnis des ungeklärten Mordfalls auf den Grund zu gehen. Die mysteriösen letzten Worte der Verstorbenen führen sie nach Thunder Bay, ein abgelegener Ort an der Westküste der Insel, an dem sich den Überlieferungen nach die Seelen der Toten zur Überfahrt ins Jenseits versammeln. Doch ihre Nachforschungen bleiben nicht unbemerkt, und schon bald bringt sich Rebecca damit selbst in Gefahr … Die Rebecca-Connolly-Reihe: Band 1: Die Toten von Thunder Bay Band 2: Das Grab in den Highlands Band 3: Das Unrecht von Inverness Alle Bände sind eigenständige Fälle und können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Als die junge Journalistin Rebecca Connolly von Roddie Drummonds Rückkehr auf die Insel Stoirm erfährt, wittert sie eine Geschichte: Fünfzehn Jahre sind vergangen, seitdem Drummond wegen des Mordes an seiner Geliebten unter Anklage stand. Aufgrund mangelnder Beweise endete das Verfahren damals mit einem Freispruch. Roddie verließ die eingeschworene Inselgemeinschaft und verschwand. Nun kehrt er für die Beerdigung seiner Mutter zurück – und reißt damit alte Wunden wieder auf.
Rebecca schließt sich mit einem befreundeten Fotografen zusammen, um dem Geheimnis des ungeklärten Mordfalls auf den Grund zu gehen. Die mysteriösen letzten Worte der Verstorbenen führen sie nach Thunder Bay, ein abgelegener Ort an der Westküste der Insel, an dem sich den Überlieferungen nach die Seelen der Toten zur Überfahrt ins Jenseits versammeln. Doch ihre Nachforschungen bleiben nicht unbemerkt, und schon bald bringt sich Rebecca damit selbst in Gefahr …
© Douglas Skelton
DOUGLAS SKELTON wurde in Glasgow geboren. Nach mehreren Büchern über wahre Verbrechen schreibt er heute Kriminalromane. ›Die Toten von Thunder Bay‹, der erste Band der Reihe um die Reporterin Rebecca Connolly, stand auf der Longlist für den McIlvanney-Preis als bester Kriminalroman des Jahres. Douglas Skelton lebt im Südwesten Schottlands.
ULRIKE SEEBERGER lebte zehn Jahre in Schottland, wo sie unter anderem am Goethe-Institut arbeitete. Seit 1987 ist sie in Nürnberg als freie Übersetzerin und Dolmetscherin tätig. Sie übertrug Autoren wie Lara Prescott, Philippa Gregory, Vikram Chandra, Alec Guiness, Oscar Wilde, Charles Dickens, Greg Iles und Jean G. Goodhind ins Deutsche.
DOUGLAS SKELTON
DIE TOTEN VON THUNDER BAY
Ein Fall für Rebecca Connolly
Kriminalroman
Aus dem Englischen von Ulrike Seeberger
Die Übersetzung wurde ermöglicht mit Hilfe des Publishing Scotland translation fund
Deutsche Erstausgabe
eBook 2021
DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2019 by Douglas Skelton
Die englische Originalausgabe erschien 2019 unter dem Titel
›Thunder Bay‹ bei Polygon, ein Imprint von Birlinn Ltd., Edinburgh.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die
Literarische Agentur Kossack, Hamburg.
© 2021 für die deutsche Ausgabe: DuMont Buchverlag, Köln
Übersetzung: Ulrike Seeberger
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildung: © plainpicture/Design Pics/John Short
und Cavan Images/Alamy Stock Foto
Satz: Fagott, Ffm
Gesetzt aus der Freight Text und der Plaquette
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN eBook 978-3-8321-7124-7
www.dumont-buchverlag.de
»Wir sind ans Meer gebunden. Und wenn wir zur See zurückgehen … dann kehren wir dahin zurück, woher wir gekommen sind.«
John F. Kennedy
PROLOG
Sie spürte den Sand unter ihren Füßen und die warme Brise auf ihrem Gesicht, rings um sich hörte sie den Wind wild heulen. Sie schlug die Augen auf und sah das Wasser, so blau, ruhiger, als sie es je zuvor gesehen hatte. Wo es auf die Felsen traf, war es eher ein Kuss als ein Klatschen. Selbst die Seevögel schienen weniger gierig. Sie stießen nicht auf Beutezug herab, sondern schwebten vor dem klaren Himmel wie das Mobile eines Kindes, als wäre es die reinste Sünde, die glatte Oberfläche des Wasser zu durchstoßen.
Sie schloss die Augen wieder, sog die Luft ein. Die Luft war süß, ohne salzigen Biss, hatte keinen Hauch des muffigen Gestanks von fauligem Tang.
Hier war sie glücklich. Hier war sie immer glücklich. Als Kinder sind sie oft in die Bucht gekommen, alle fünf, haben frühmorgens das Haus verlassen, um quer über die Insel zu wandern. Sie brauchten Stunden dafür, doch sie schafften es. Und ganz gleich, wie erschöpft sie waren, rannten sie den Pfad von der Klippe hinunter, wollten unbedingt alle als Erste den weichen Sand erreichen, während sich der Wind in ihrem Haar fing und ihr Gelächter forttrug, sodass es in das Echo der Felswand mit einstimmte. Fast immer hat sie dieses Rennen gewonnen, denn sie war stets die schnellste Läuferin, und die Jungs waren zu sehr damit beschäftigt, sich gegenseitig auszustechen, um zu bemerken, dass sie ihnen schon weit voraus war.
Dann verschlangen sie das Mittagessen, das die Eltern – oder in Henrys Fall irgendeine Haushälterin – ihnen eingepackt hatten, und sie planschten am Wasser und spielten auf den Felsen, die die Bucht säumten. Sie suchten nach Meeresgetier und abgeworfenen Muschelschalen und veranstalteten Mutproben, wie nah sie an die Höhlen heranzuschwimmen wagten, doch bis ganz dorthin versuchte es niemand. Sie waren zwar jung, aber sie wussten, dass es zu gefährlich war, selbst für Unsterbliche wie sie.
Aber sie waren nicht unsterblich. Das wusste sie jetzt. Das wussten sie jetzt alle.
Stimmen.
Sie hörte Stimmen.
In der Ferne. Unzusammenhängend. Sie wirbelten um sie herum in dem harschen Wind, den sie nicht spüren konnte.
Die Leute erzählten, dass es Wesen gibt, die in den Winden wohnen. Elementare Geschöpfe, die rings um das Land und die Strände und die Buchten atmen und seufzen. Aber das glaubte sie nicht. Das war nur eine der Geschichten von der alten Insel, genauso wie die von den Hexen auf dem Berg oder von den Wasserwesen oder von den versteinerten Schwestern, die am Strand Wache hielten.
Und doch …
Da waren Stimmen im Wind, die sie umgaben, nach ihr riefen.
Mhairi.
Ihr Name. Sie hörte ihren Namen, gedämpft und aus der Ferne, aber sie hörte ihn. Sie schaute sich in der Bucht um, aber sie war allein, nur ihre Fußabdrücke waren im Sand. Sie erinnerte sich nicht, dass sie den Pfad hinuntergegangen war. Sie erinnerte sich nicht, dass sie hierhin gefahren war. Sie erinnerte sich nicht …
Mhairi.
Jetzt lauter, deutlicher. Die Stimme einer Frau. Sie blickte suchend an der Klippe hinauf, sah aber keine Gestalt, die sich vor dem blauen, so blauen und friedlichen Himmel abzeichnete. Sie blickte aufs Meer hinaus – vielleicht ein Boot? –, aber nichts tanzte auf der seidigen Oberfläche.
Es wirkte so einladend, das Wasser, und zum ersten Mal hatte sie das Gefühl, dass es ihr gelingen würde, über die zerklüfteten Felsen hinauszuschwimmen, hinaus aufs Meer, weit hinaus aufs Meer, wo alles still und sie vom Schmerz befreit sein würde. Und da war Schmerz, das merkte sie jetzt. Dumpf zwar, sicher, aber er war da. Sie hatte ihn nicht wahrgenommen, bis sie die Stimme gehört hatte, aber jetzt war er da. Ein Ziehen, das sich von ihrem Schädel bis zum Gesicht und durch den ganzen Körper ausbreitete. Und nun war da noch etwas Anderes, etwas Warmes, das ihr aus dem Haar sickerte und über die Stirn rann. Sie hob die Hand, wischte es weg, sah das Rot an ihren Fingern. Sie blutete. Sie hatte sich am Kopf verletzt, und sie blutete. Wie war das passiert?
Sie versuchte, die Stimme zu ignorieren, und kniete sich hin, um eine Handvoll Wasser zu schöpfen, das auf den Strand lief. Es fühlte sich so kühl an, so tröstlich. Sie besprengte sich damit das Gesicht, wusch sich das Blut von den Fingern. Die Wellen umspülten sie, aber das machte ihr nichts aus. Sie trugen ein wenig von ihrem Schmerz mit fort. Hier verspürte sie Frieden.
Aber die Stimme rief sie noch immer. Kräftiger jetzt.
Und da waren andere Stimmen. Männer, die redeten, aber nicht mit ihr. Nur die Frau sprach mit ihr. Sagte ihren Namen, immer und immer und immer und immer wieder …
Mhairi.
Mhairi.
Mhairi, kannst du mich hören?
Die Wellen türmten sich um sie herum auf, das Wasser stieg rasch, aber sie machte sich keine Sorgen. Das Wasser war ihr Freund, es beruhigte sie, sie würde eins mit ihm werden, und es würde allen Schmerz wegnehmen. Es würde sie heilen. Sie ließ sich von seiner Kühle nach unten ziehen. Es war tiefer, als sie gedacht hatte. Schon bald umgab es sie ganz, und sie schwebte in dem Halbdunkel, das sie willkommen hieß, schaute auf das Sonnenlicht, wie es auf der Oberfläche spielte, ehe es sich brach und zu ihr hinabstieß. Sie wollte nicht, dass das Licht sie berührte – sie war hier glücklich, sie war in Sicherheit, sie war frei –, doch noch immer konnte sie die Stimme hören, die sie lockte, und sie wusste, wenn nur einer der hellen Strahlen sie berührte, würde er sie zurückzerren. Sie wollte sich abstoßen, weg von hier, durch das sich kräuselnde Wasser davontreiben, aber sie konnte sich nicht bewegen. Sie konnte nur da hängen, und doch fühlte sich ihr Körper nicht frei an. Ein Arm war abgewinkelt, sah seltsam verkehrt aus, der andere lag quer über ihrem Bauch. Sie sah ihre Finger zittern, immer noch mit Blut beschmiert – hatte sie das nicht abgewaschen? –, während ein Bein unter ihrem Körper eingeklemmt war. Sie spürte, wie es fest verkeilt war. Sie war unter Wasser, es gefiel ihr hier, warum schwebte sie dann nicht fort? Wieso konnte sie sich nicht bewegen?
Das Licht langte zu ihr hinunter und berührte sie wie mit Händen. Nicht grob, nicht wie vorhin, sondern sanft. Liebevoll. Tröstend.
Und wieder hörte sie die Stimme, die ihren Namen rief, während ihr verrenkter Körper langsam zurück an die Oberfläche gezogen wurde, zurück ans Licht, das nun härter war, kein Sonnenlicht, nicht warm und angenehm und voller Sommerlachen. Sie wollte bleiben, sie wollte ihren Frieden, aber sie konnte nicht dagegen ankämpfen. Sie musste zurück. Sie wusste, dass sie zurückmusste, wenn auch nur für kurze Zeit.
Der Wind heulte und jaulte, als sie die Oberfläche durchbrach. Da, wo sie nun lag, war es nicht mehr warm und tröstlich und weich, es war hart und unerbittlich. Alles verschwamm ihr vor den Augen. Erst wusste sie nicht, wo sie war, sie wusste nur, dass sie nicht im Meer war. Alles war unscharf, das Licht so grell, dass es ihr in den Augen schmerzte und sie nichts klar erkennen konnte. Und da war der Schmerz, echter Schmerz, quälender Schmerz, der ihr durch den ganzen Körper strömte. Sie wollte schreien, die Qual mit diesem Laut ausstoßen, aber sie konnte es nicht. Sie konnte sich nicht einmal rühren.
Bleib bei uns, Mhairi.
Die Frau war noch in weiter Ferne, aber sie hörte sie deutlich, und ihre Stimme reichte durch das blendende Weiß zu ihr hinunter. Doch dann klang ihre Stimme wieder gedämpft, verschwamm mit den anderen, nur bestimmte Wörter stiegen an die Oberfläche, Wörter, die sie nicht verstand.
Impressionsfraktur.
Jochbein.
Stirnhöhle.
Sie versuchte zu sprechen, aber es kamen keine Worte. Sie wusste, dass die Leute über sie redeten. Sie wusste, dass sie in Schwierigkeiten steckte, und sie sehnte sich in die Bucht zurück, wo sie in Sicherheit war, wo der Schmerz weggespült werden konnte. Aber sie konnte nicht gehen, noch nicht. Etwas kam ihr in den Sinn, ein Name, und sie musste es wissen. Sie zwang sich dazu, sich auf diesen Namen zu konzentrieren, diesen Namen auszusprechen. Und das war wie ein neuer, schmerzlicher Stich, kurz und scharf, und es half ihr.
»Sonya.«
Ein Gesicht tauchte aus dem Licht auf. Es war ein freundliches Gesicht. Ein liebevolles Gesicht.
»Ihr geht es gut«, sagte das Gesicht. »Deinem Baby geht es gut.«
Erleichterung überkam sie und schien einen Teil der Qualen wegzuwaschen.
»Ich habe dir was gegeben, das die Schmerzen lindert«, sagte die Stimme. »Du musst bei mir bleiben, Mhairi.«
»Frag sie, wer das getan hat.« Eine andere Stimme. Ein Mann. Barsch. Sie kannte die Stimme, konnte sie aber nicht zuordnen. Konnte ihn nicht sehen. Nur eine Gestalt hinter der Frau, die ihr half, verschwommen, undeutlich trotz des erbarmungslos blendenden Lichts. Zu grell. Zu unbarmherzig. Sie sah Verärgerung über das Gesicht der Frau huschen.
»Das ist gerade nicht meine größte Sorge, Jim.«
»Es ist wichtig.«
Die Frau wandte den Kopf. Mhairi sah, dass ihr braunes Haar kurz geschnitten war. »Jim, das ist gerade nicht meine größte Sorge.«
Jetzt sah Mhairi ihn, nicht deutlich, aber sie erkannte seine schwere, dunkle Uniform. Sergeant Rankin. Jeder auf der Insel kannte ihn. Sie konnte sein Gesicht nicht sehen, aber sie wusste, dass es gerötet sein würde und dass sich sein Whiskyatem unter einem Hauch Mundwasser verbergen würde. Er rauchte zu viel, und er trank zu viel, das sagte ihre Mum immer. Der würde die Sechzig nicht erleben, sagte sie.
Mhairi auch nicht. Das wusste sie jetzt.
Was immer man ihr gegeben hatte, es brachte sie noch ein Stück weiter in diese Welt zurück. Der Wind, den sie in der Bucht hatte hören, aber nicht spüren können, warf sich gegen das Haus. Sie konnte ein blaues Licht sehen, das flackernd von den Fenstern reflektiert wurde, konnte hören, wie die Scheite im Kamin zischten und knisterten, obwohl sie die Wärme nicht spürte. Bei dem Gedanken zuckte etwas in ihr zusammen. Die Holzscheite …
Sie erinnerte sich.
Der Polizist beugte sich über sie. »Sag mir, wer das getan hat, Mädchen. Wer hat dir das angetan?«
Sie versuchte, den Kopf zu drehen, doch der Schmerz brüllte sie an. Schon eine Bewegung der Augen tat höllisch weh. Was immer man ihr gegeben hatte, es reichte nicht. Aber sie musste nachschauen, ob er da war, sie musste es ihnen sagen.
Und dann sah sie Roddie.
Er stand gleich hinter Sergeant Rankin, ein weiterer Polizist neben ihm. Sie hatte Roddie schon einmal so gesehen, zwischen zwei Polizeibeamte eingeklemmt, als man ihn wegen Ladendiebstahl verhaftet hatte, damals, als sie noch Kinder waren. Er war es nicht gewesen, natürlich nicht, sondern Henry. Es war immer Henry, der sie in Schwierigkeiten brachte und ungeschoren davonkam.
Nein, sie irrte sich. Ganz so wie jetzt war es damals nicht gewesen. Damals hatte kein Blut seine Kleidung und Hände bedeckt. Ihr Blut, das wusste sie. Ihr Blut.
Sie schaute ihn geradewegs an, sah die Angst in seinen Augen, als sie zu sprechen versuchte, als sie versuchte, es ihnen zu sagen, aber die Anstrengung war zu groß. Sie spürte, wie sie fortglitt, konnte das Klatschen der Wellen und die Schreie der Seevögel hören, die sie zur Rückkehr drängten. Und sie sehnte sich danach, zurückzukehren. In dieser Welt war zu viel Schmerz, zu viel Kummer, zu viel Enttäuschung. Sie wollte, dass das Wasser wieder um ihren Körper spülte, wollte, dass es sie liebkoste und alles fortwusch. Sie konnte es ihnen später sagen … ihnen später sagen … Jetzt wollte sie sich einfach nur im Sonnenlicht aalen, weit weg von dem stöhnenden Wind und dem betäubenden Schmerz und der lähmenden Angst.
Doch noch immer hörte sie die Stimme des Polizisten, der sie fragte, wer ihr das angetan hatte, und die Stimme der Frau, die ihn anherrschte, er solle sich verziehen. Mhairi wusste, dass sie ihm etwas über diesen Abend sagen musste – er hatte das Recht, es zu wissen, es war wichtig, dass er es wusste –, aber es fühlte sich so wohlig an, wieder in der Bucht zu sein. Dort gehörte sie hin, dort trug der sanfte Wind das Versprechen von Zufriedenheit mit sich. Dort lebten und lachten die Erinnerungen wie alte Freunde.
Sie brachte zwei Wörter hervor, ehe sie wieder den Sand zwischen den Zehen spürte und vom Wasser willkommen geheißen wurde, das sanft gegen das Land spülte, zurück und vor.
Zurück und vor.
Zurück und vor.
Zurück …
… vor.
1
Gegenwart
Die Frau verzog das Gesicht, rang offensichtlich mit ihren Gefühlen. Ihr Kinn bebte, auf ihren Wangen erschien ein nervöses Zucken, ihr standen Tränen in den Augen. Trotzdem hielt sie das Ritual der Teezeremonie aufrecht. Das vielbenutzte Sieb wurde sorgfältig auf den Rand der Porzellantasse mit dem blauen Blumenmuster gesetzt. Die dazu passende Kanne war unter einem gestrickten Teewärmer verborgen, sodass nur ihr geschwungener Henkel und die Tülle herausschauten. Der Tee, von perfektem Braun, floss in stetigem Strom in die Tasse, obwohl die elektrischen Impulse, die durch die Gesichtsmuskeln der Frau zuckten, auch ihren Arm entlang geleitet wurden und die Kanne zittern ließen.
Rebecca Connolly, die eher tanninbraune Henkelbecher und Teebeutel gewöhnt war, erschien dieser Vorgang altmodisch, beinahe kurios, doch sie begriff, warum all das Maeve Gallagher so wichtig zu sein schien.
»Zucker?« Die Frage wurde ohne jeglichen Blickkontakt gestellt. Maeve konzentrierte sich auf das Tablett vor ihr, als müsse man die Gerätschaften darauf jederzeit genau im Auge behalten.
»Nein, danke«, antwortete Rebecca leise.
»Milch?«
»Nur ein bisschen.«
Die gekünstelte Banalität des Gesprächs war nötig, genau wie die Betonung der Zeremonie. Die Frau brauchte Zeit. Sie musste sich an die kleinen Dinge klammern, die alltäglichen Verrichtungen – Tee zu kochen und in eine Tasse einzuschenken –, nur so konnte sie das Gleichgewicht wahren, die Trauer in Schach halten.
Der Singsang von Kinderlachen wehte von der Straße herein. Es war ein warmer Herbsttag, und die Kinder genossen ihn. Rebecca sah, dass Maeve den Kopf hob und aus dem Fenster ihres ordentlichen, mit Möbeln vollgestellten Wohnzimmers blickte und eine Gruppe von Teenagern beobachtete, die unmittelbar am Haus vorbeispazierten. Hier gab es keinen Vorgarten als Barriere, das Fenster zeigte direkt auf die Straße und den Fluss dahinter. Doch die Frau drückte mit dieser kleinen Bewegung keine Verärgerung aus, eher lag etwas Wehmütiges darin, als wäre dieses Lachen nicht das Lachen, das sie hören wollte.
»Erzählen Sie mir von Edie«, sagte Rebecca. Ihre Stimme war noch immer sanft, aber sie musste Maeve zum Reden bringen. Deswegen war sie hier.
Maeve sagte nichts, als sie ihr die zarte Teetasse reichte. Sie blieb auch stumm, als sie ihr den Kuchenteller mit den angehäuften Schokoladenkeksen hinhielt, die Rebecca mit einem Kopfschütteln ablehnte. Maeve stellte den Teller vorsichtig auf das Tablett zurück, das auf dem breiten Fußschemel balancierte. Zu vorsichtig, so, als wolle sie das Unvermeidliche noch hinauszögern. Rebecca ließ ihr Zeit, nippte an ihrem Tee, wartete ab. Schließlich hatte Maeve sich einverstanden erklärt, mit ihr zu reden. Sie hatte etwas zu sagen, und jetzt, da Rebecca ihr einen sanften Anstoß gegeben hatte, wusste sie, dass sie der Frau Zeit geben musste.
Rebecca schaute sich kurz im Zimmer um. Vier große Sessel und ein langes Sofa waren um einen rechteckigen Couchtisch angeordnet. Unter der Tischplatte war ein Fach mit einer Reihe von Zeitschriften und ein paar Puzzles. In der Ecke neben den breiten Fenstern stand ein großer Flachbildfernseher auf einer schwarzen Vitrine, durch deren Rauchglasscheiben sie einen Satellitenempfänger, einen DVD-Player und ein paar gestapelte DVD-Hüllen erkennen konnte. Der Gasofen im gekachelten Kamin war aus, aber dank eines Heizkörpers unterhalb des Fensters war es warm. Zweifellos benutzte man den Ofen nur im Winter, der in Inverness streng sein kann. Auf dem Kaminsims stand die Nachbildung einer antiken Pendeluhr, doch die Zeiger bewegten sich nicht, als hätte die Zeit um zwölf Minuten nach drei aufgehört. Dieses Zimmer machte keinen bewohnten Eindruck, aber andererseits wohnte ja auch niemand wirklich hier, hier saß man nur gelegentlich, kurz vor dem Aufbruch oder nach der Rückkehr.
Schließlich fiel Rebeccas Blick zwangsläufig auf die schwere Anrichte, die einen großen Teil der Wand neben der Tür einnahm. Das Möbelstück wirkte alt, wie aus zweiter Hand. Es war poliert, aber sie konnte im dunklen Holz der Türen Kratzer und Rillen erkennen, vielleicht im Laufe der Jahre von sorglos gehandhabten Gepäckstücken verursacht. Doch nicht die Anrichte selbst hatte Rebeccas Aufmerksamkeit auf sich gezogen, sondern das Foto, das darauf stand. Es war in einen silbernen Rahmen gefasst, die Aufnahme eines Mädchens im Teenageralter, dem das lange dunkle Haar in Wellen auf die Schulter fiel. Ein hübsches Mädchen, das eine kleine schwarzweiße Katze im Arm hielt. Sie lächelte. Ihre Augen tanzten vor Entzücken. Edie Gallagher.
Rebecca überlegte, wo die kleine Katze wohl jetzt war. Sie wäre älter, aber nicht viel. Rebecca vermutete, dass der Schnappschuss etwa ein Jahr alt war. Die Katze hielt sich wahrscheinlich im hinteren Teil des Hauses auf, wo die Familie lebte. Hier, in dem als Pension genutzten Teil des Gebäudes, war sie bestimmt nicht geduldet, obwohl das Belle View Guest House viele Monate lang keine Gäste mehr beherbergt hatte.
Rebecca richtete ihre Aufmerksamkeit wieder auf Maeve. Die saß kerzengerade auf ihrem Sessel, hielt die Tasse mit beiden Händen umklammert auf dem Schoß, hatte die Augen auf das Fenster fixiert, den Kopf ein wenig zur Seite geneigt, als lauschte sie den verklingenden Stimmen und dem Lachen der jungen Leute nach, die Augen noch immer feucht, weil sie sich danach sehnte, das einzige Lachen zu hören, das sie nie wieder vernehmen würde. Auf der anderen Straßenseite konnte Rebecca den River Ness sehen, in dem sich der blaue Himmel spiegelte. Am anderen Ufer stießen Kirchtürme in den Himmel, doch Rebecca wusste, dass Maeve sie gar nicht wahrnahm. Ein kleiner Seufzer, ein winziges Schaudern, und dann – endlich – brach eine einzelne Träne hervor.
»Sie war mein Mädchen«, sagte Maeve, und diese schlichte Aussage und die einsame Träne brachen Rebecca beinahe das Herz. Sie blinzelte, ermahnte sich, dass sie sich auf die anstehende Arbeit konzentrieren musste. Sie hörte die Stimme ihres Vaters, wie er, noch mit einem Anklang vom Singsang der Inseln, über die Polizeiarbeit sprach, und betonte, dasselbe gelte genauso für den Journalismus. Ein guter Polizist braucht keine Gefühle, aber ein großartiger weiß, wie er sie nutzen kann. Ohne Emotionen können wir nicht mitfühlen. Und wenn wir nicht mitfühlen können, können wir nicht verstehen. Und wenn wir nicht verstehen können, warum zum Teufel machen wir dann diese Arbeit?
Maeve regte sich nicht, als sie weiterredete. »Sie ist immer wie ein Wirbelsturm durch die Tür hier hereingefegt, immer voller Energie, immer voller …«
Sie unterbrach sich, ihr Gesicht bebte wieder. Rebecca wusste, was die Frau um ein Haar gesagt hätte.
Immer voller Leben.
Maeve schluckte das Wort herunter und sprach weiter. »Ich hab ihr immer gesagt, sie soll die Tür hinter sich zumachen, aber das hat sie nie getan. Hat die Tür immer sperrangelweit offen stehen lassen, bei Regen und bei Sonnenschein, und dann ist sie die Treppe hochgeflitzt, konnte es nicht abwarten, die Schuluniform loszuwerden und sich Jeans und T-Shirt oder sonst was anzuziehen. Jedes Mal, wenn ich jetzt höre, wie die Tür aufgeht, glaube ich, sie könnte es sein.« Ihre Augen glänzten, als sie auf die sonnenbeschienene Straße starrte. »Aber sie ist es nicht, natürlich nicht. Sie ist es nie. Wird es nie sein.«
Rebecca stellte ihre Tasse auf das Tablett. Ihr Notizblock war zwischen ihr und der Lehne des breiten Sessels eingeklemmt. Sie hätte zu gern Maeves Worte darauf notiert, wollte aber nichts tun, was die Frau von ihren Gedanken ablenken könnte.
Ihr Chefredakteur hatte sie hergeschickt, um Maeve zu etwas zu bringen, was bisher niemand geschafft hatte. Bring sie zum Reden. Beschaff uns Zitate, etwas, was keine der anderen Zeitungen hat.
Er hatte Rebecca geschickt, weil sie das gut konnte. Leute zum Reden bringen, Leute dazu bringen, dass sie ihr vertrauten. Dieses Talent hatte sie von ihrem Vater geerbt. Zumindest behauptete ihre Mutter das.
Er konnte Leute immer dazu bringen, offen zu reden. Es war eine Gabe.
Diese Gabe hatte Rebecca in den drei Jahren, die sie schon bei der Zeitung arbeitete, gute Dienste geleistet. Die Leute wurden schnell mit ihr warm. Die Leute redeten mit ihr, erzählten ihr Dinge. Leute wie Maeve, die seit dem Tod ihrer Tochter Edie mit keinem einzigen Journalisten gesprochen hatte.
»Ob er wohl an sie denkt?«, fragte Maeve plötzlich. »Dieser Mann …«
Greg Pullman. Der Londoner Börsenhändler, der, benebelt von Alkohol und Kokain, mit seinem Mietauto mit voller Wucht auf Edie geprallt war. Der sie mit tödlichen Verletzungen auf der Straße liegen ließ und in seiner Hochleistungs-Schwanzverlängerung auf und davon röhrte. Dessen Strafmaß heute verkündet werden sollte.
»Ob er wohl über das Leben nachdenkt, das er ausgelöscht hat?«, sagte Maeve mit leiser Stimme, kaum mehr als einem Flüstern. »Ob es ihm überhaupt was ausmacht?« Schließlich schaute sie Rebecca an. »Was meinen Sie, was kriegt er?«
»Eine Freiheitsstrafe, denke ich. Der wird eingesperrt.«
Ein knappes Nicken, zufrieden. »Gut. Ich würde es nicht ertragen, wenn er ungeschoren davonkommt, nur weil er Geld hat.«
Der Mann hatte sich eine Woche in seinem Ferienhaus auf der Black Isle aufgehalten und in Inverness mit ein paar Kumpeln zu einem feuchtfröhlichen Wochenende getroffen. Er hatte entschieden, dass er noch fahrtüchtig war. Er konnte sich nicht einmal daran erinnern, dass er die Teenagerin überfahren hatte. Das behauptete er zumindest.
»Das wird den Richter nicht beeinflussen«, erwiderte Rebecca. »Der wandert hinter Gitter, Maeve. Da bin ich mir sicher.«
Noch ein Nicken, dann glitten Maeves Augen wieder zum Fenster und zum Sonnenlicht und zum Fluss, der auf der anderen Straßenseite vorüberfloss, als hielte sie Ausschau nach den roten Ziegelsteinen des Schlossgebäudes, in dem das Gericht tagte.
»Ralph ist gerade dort. Er meinte, er wollte es selbst sehen. Er will das Gesicht dieses Kerls sehen, wenn er hört, dass er ins Gefängnis muss.« Ihr Blick driftete zu Rebecca zurück. »Sie sind sicher, dass er eingesperrt wird?«
Rebecca nickte.
Maeves Augen verhärteten sich. »Wie viel kriegt er? Ein paar Jahre? Man nimmt ihm den Führerschein ab? Und nach ein paar Jahren ist er wieder draußen und macht mit seinem Leben weiter. Er ist wieder draußen und kann arbeiten und feiern, eine Familie gründen. Wieder trinken, wieder Drogen nehmen, vielleicht sogar wieder Auto fahren, ja?«
Rebecca antwortete nicht. Sie konnte es nicht. Sie wusste, dass alles, was Maeve gesagt hatte, möglich war, aber sie wollte ihr das auf keinen Fall bestätigen. Sie spürte, worauf das alles hinauslief, und wollte den Redefluss nicht unterbrechen.
»Aber meine Edie kann das nicht, oder? Sie kann nicht mit ihrem Leben weitermachen. Er hat es ihr weggenommen. Sie wird nie arbeiten. Sie wird nie eine Familie haben. Sie wird nie alt werden. All das hat er ihr genommen. All das hat er mir und Ralph genommen. Er hat uns einfach alles genommen.« Maeve stellte ihre unberührte Teetasse auf das Tablett, stand auf und ging zum Fenster. Es war eine abrupte Bewegung, als hätte sie sich einfach bewegen müssen, angetrieben von der Wut, die sich in ihr aufbaute. Soweit Rebecca wusste, hatte sie noch nie mit jemandem über ihren Schmerz gesprochen. Sie hatte ihn zurückgehalten, in sich aufgestaut. Rebecca erinnerte sich an einen Schnappschuss, der sie vor dem Gerichtsgebäude zeigte, an dem Tag, als man Pullman schuldig gesprochen hatte. Die Muskeln waren angespannt, der Mund eine straffe Linie, der Kopf so hoch erhoben, dass Rebecca die Sehnen in ihrem Nacken wie Kabel hervorstehen sah. Sie musste geweint haben, aber insgeheim. Nun, da eine einzelne Träne den Damm durchbrochen hatte, drohte er zu bersten. Maeve lehnte sich mit leicht gebeugtem Kopf auf das Fensterbrett, und Rebecca sah, dass ihre Schultern bebten.
»Maeve …« Rebecca wollte aufstehen, doch die Frau hob die Hand, schüttelte den Kopf. Sie wollte Rebeccas Mitgefühl nicht. Sie musste all das Aufgestaute jetzt loswerden. Rebecca lehnte sich wieder zurück, hatte das Gefühl, sie sollte irgendwie Trost spenden, war jedoch gleichzeitig dankbar, dass sie es nicht musste.
Ihr Telefon, das neben dem Notizblock steckte, vibrierte gegen ihren Oberschenkel, aber sie ignorierte es. Wer immer es war, würde warten müssen. Der Redefluss. Es ging nur um den Redefluss.
»Ich hoffe, er stirbt im Gefängnis«, sagte Maeve, und ihre Stimme war fest und nicht von den Tränen verwässert, die ihr nun ungehindert über die Wangen flossen. »Ich hoffe, ein anderer Gefangener bringt ihn um. Ich hoffe, er spürt nur einen Bruchteil des Schmerzes, den Edie gespürt hat, als sie da im Rinnstein lag. Ich hoffe, jemand macht ihn fertig, so wie er mich und ihren Vater fertig gemacht hat.«
Rebecca setzte sich zurück. Da hatte sie ihr Zitat. Die Schlagzeile für diese Woche. Sie hatte, was keine andere Zeitung hatte.
Als Reporterin war sie hocherfreut.
Als Mensch war sie tieftraurig.
Sie überredete Maeve dazu, sich von ihr mit dem Handy fotografieren zu lassen. Sparmaßnahmen bei der Zeitung. Es gab keine Notwendigkeit für Fotografen in Festanstellung; wenn man Glück hatte, konnte ein Freiberufler aushelfen (allerdings war heute keiner verfügbar gewesen). Rebecca war zu jung, um zu wissen, wie es in den alten Zeiten gewesen war – eigentlich waren es keine allzu alten Zeiten, nur ein paar Jahre zuvor –, aber sie hatte von den alten Hasen gehört, wie es früher gelaufen war. Damals hätte man einen Fotografen zusammen mit ihr losgeschickt, oder man hätte zumindest dafür gesorgt, dass während des Termins einer vorbeikam. Aber das Zeitungsgeschäft hatte sich verändert, hatte sich weiterentwickelt, war effizienter geworden, der besseren Profite wegen. Sie war klug genug, um zu wissen, dass »effizient« keineswegs »verbessert« bedeutete.
Ihr Schnappschuss war ein typisches Boulevardbild: Maeve hielt das gerahmte Foto ihrer Tochter in der Hand und schaute untröstlich. Es war kitschig, und es war schlicht. Ein Profi-Fotograf wäre vielleicht kreativer gewesen, aber Rebecca war nur ein Schreiberling. Sie wartete noch fünfzehn Minuten, ehe sie sich verabschiedete. Sie glaubte, dass sich Maeve wegen ihres verhaltenen Gefühlsausbruchs, ihrer beinahe öffentlichen Zurschaustellung von Emotionen schämte und erleichtert war, als sie ging.
Nach dem Gespräch, auf dem Weg zum Auto, war Rebecca die Oktobersonne höchst willkommen. Sie blickte kurz zur Pension zurück und sah die Frau am Fenster stehen, die immer noch das gerahmte Foto ihrer Tochter an die Brust gedrückt hielt. Rebecca winkte ihr verhalten zu, doch sie erwiderte den Gruß nicht. Maeve Gallagher wirkte so einsam, dass Rebecca bezweifelte, ob sie sie überhaupt gesehen hatte. Sie war in den Nebeln des Schmerzes und der Wut und der Erinnerungen an ein geraubtes junges Leben verloren.
Rebecca wandte sich ab und kramte das Telefon aus der Manteltasche hervor. Der verpasste Anruf war von einem Fotografen, Chaz Wymark. Er war zwar jung, hätte aber bestimmt ein weit besseres Foto von Maeve geschossen. Rebecca erreichte ihr Auto, setzte sich auf die niedrige Mauer, die die Straße vom Flussufer trennte, und drückte auf Rückruf. Während der Rufton erklang, reckte sie das Gesicht in die Sonne. Mach das meiste draus, dachte sie, der Winter ist nicht mehr weit.
»Rebecca.« Chaz schien erfreut, von ihr zu hören. Er schien immer erfreut, von ihr zu hören. Sie hatten einander nie von Angesicht zu Angesicht kennengelernt, aber oft miteinander telefoniert.
»Was gibt’s, Chaz?«
»Oh, hier drüben passieren aufregende Dinge, kannst du mir glauben.«
Hier drüben. Chaz sprach von Stoirm, einer Insel vor der Westküste, auf der er lebte. Er lieferte von dort kleine Lokalnachrichten und Fotos gegen eine Bezahlung, die so gering war, dass der Mindestlohn dagegen extravagant wirkte. »Sturm-Insel«, so nannten sie es manchmal. Ihr Vater war dort geboren, doch das Einzige, was er je darüber gesagt hatte, war, dass der Name hervorragend passte. Aber aufregende Dinge? Auf Stoirm? Das konnte sie einfach nicht glauben.
»Was passiert denn, Chaz?«
Er erzählte es ihr. Noch während er sprach, wusste sie, dass sie da einer Sache auf der Spur war. Doch diesmal war noch etwas anderes dabei, ein beschleunigter Herzschlag, ein Flattern im Bauch, Nerven, die sich anspannten und sie zu allem bereit machten.
Diesmal ging es um Stoirm.
2
Es war die längste Zeit, die er je von seiner Frau getrennt war, seit sie geheiratet hatten. Der Berg, auf dem er stand, war Marys Lieblingsort auf der Insel gewesen. Hier kannst du die Welt sehen, hat sie immer gesagt. Zumindest ihre Welt. Unter ihm lag Portnaseil. Das einzige Geräusch war das Grollen der Morgenfähre, die sich bereit machte, über den Sund zu fahren, der an diesem schönen Herbsttag von erfrischendem Tiefblau war. Portnaseil war die größte Siedlung auf Stoirm, die Gebäude schmiegten sich um den geschützten Hafen, während die anderen Dörfer sich an die östliche Küste hielten. Auf der Westseite der Insel gab es nichts Nennenswertes, denn hier peitschten allzu oft Unwetter das Land und die Klippen. Heute jedoch nicht. Er hob den Blick zur dunklen Masse des Festlands jenseits des Wassers, wo die Dörfer wie weiße Farbtupfer den Sonnenschein widerspiegelten. Hinter ihm lag die Insel, die Häuser und Katen waren über das Grasland und die Heide verstreut, bis sie im Westen den welligen Hügeln wichen, die zu beiden Seiten des Inselbergs Beinn nan sìthichean den Himmel schulterten. Da leben die Feen, hatte Mary ihren Kindern immer erzählt. Bei Tag lassen sie euch zu Besuch kommen, doch nicht nach Einbruch der Dunkelheit. Diese Zeit gehört ihnen, und jeder, der in der Nacht am Berg erwischt wird, gehört für immer ihnen.
Eine Brise flüsterte durch die Binsen und das hohe Gras ringsum. Geister, hatte Mary immer gesagt, die uns vom Jenseits etwas zusingen. Er lauschte aufmerksam, konnte jedoch ihre Stimme darunter nicht ausmachen. Er sehnte sich danach, sie noch einmal zu hören, wenn auch nur ein einziges Mal. Eines Tages vielleicht.
Zwei Tage.
So lange war sie fort.
Erst zwei Tage.
Es kam ihm wie ein Leben lang vor.
Die Kirche ragte über Portnaseil auf, die alten Gräber waren darum herum verstreut wie Stehende Steine, der neuere Friedhof an der Seite wohlgeordneter. Bei all ihrer Liebe zu den alten Geschichten war Mary doch eine fromme Gläubige gewesen, hatte nie einen Gottesdienst verpasst. Der Wind mochte so scharf sein, dass er sie hätte durchschneiden können, der Regen mochte so wild wüten, als hätte er es auf sie persönlich abgesehen, trotzdem zog sie jeden Sonntag ihren Mantel über, nahm die Bibel zur Hand und machte sich auf den Weg. Nur zu bald würde sie wieder in der Kirche sein, dachte er. Bloß würde sie dieses Mal nicht nach Hause kommen und den Sonntagsbraten zubereiten. Diesmal würde sie nicht für ein Schwätzchen mit den Damen stehen bleiben. Diesmal würde sie nicht diesen Hang hinaufgehen, wenn das Wetter schön war, um nur einen Augenblick für sich zu sein und den Geistern zu lauschen, die im Gras sangen. Diesmal würde sie für immer auf dem Kirchhof bleiben.
Er schloss die Augen und konzentrierte sich erneut auf das leise Seufzen der Brise. Nur ein Wort, betete er. Nur meinen Namen. Nur noch ein einziges Mal.
»Dad.«
Einen Augenblick lang glaubte er, es wäre Mary. Nur ein kurzes Aufflackern von so etwas wie Hoffnung. Vor den Kindern hatte sie ihn immer Dad genannt. Nie Campbell, nie Liebling, nie irgendwas außer Dad. Doch das würde bedeuten, dass sein Gebet erhört worden war, und er hatte schon vor langer Zeit jede Hoffnung aufgegeben, aus dieser Richtung je Hilfe zu bekommen.
Er drehte sich um und sah seine Tochter Shona den Hang hinaufkommen. Sie hatte ihrer Mutter schon immer geähnelt – dasselbe Lächeln, dasselbe Lachen, derselbe Gesichtsausdruck, wenn sie sich über etwas ärgerte, was er getan hatte –, doch nun, mit Ende dreißig, war sie Marys Doppelgängerin. Selbst ihre eigene Tochter zeigte schon große Ähnlichkeit. Shona hatte ihr einziges Kind entgegen aller modernen Gepflogenheiten Mary genannt. Das gefiel ihm, denn es bedeutete, dass ein klein wenig von seiner Mary weiterleben würde.
Er sagte nichts zu Shona. Er wusste, warum sie zu ihm gekommen war. Er starrte über den Sund, den Kiefer verkrampft.
Als sie zu ihm aufgeschlossen hatte, blieb sie eine Weile neben ihm stehen und folgte seinem Blick.
»Sie ist immer gern hier gewesen«, sagte sie.
»Aye«, erwiderte er.
Wieder herrschte Schweigen zwischen ihnen, während rings um sie herum die Welt ihre eigene Sinfonie spielte. Die leise Melodie der Brise. Das Glissando der Wellen, die den gelben Sand am Fuß des Berges liebkosten. Der rumorende Bass der auslaufenden Fähre. Der kreischende Rhythmus der Möwenschreie.
Shona ließ ihre Hand in seine gleiten und drückte sie. Er drückte zurück. Er liebte sie, aber er wollte nicht hören, was jetzt gleich kommen würde. Er hatte es in ihren Augen gesehen, als sie den Hang hinaufkam. Er hatte es in der Berührung ihrer Hand gespürt. Er wusste es bereits.
Sie sagte es trotzdem, und ihre Worte waren so gedämpft, dass der Wind und die Wellen und das Husten der Fähre sie beinahe fortgeweht hätten.
»Er kommt zurück«, sagte sie.
3
Barry Lennox war seit einem Jahr Chefredakteur des Highland Chronicle. Er war ein massiger Mann, vielleicht war er früher einmal muskulös gewesen, doch die Muskeln hatten sich längst in Fett verwandelt. Sein Haar trug er vorne kurz, hinten lang. Er kleidete sich in Jeans und Jeansjacken und glaubte, dass er aussah wie Mel Gibson in Lethal Weapon. Da irrte er sich. Er war seit über zwanzig Jahren im Zeitungsgeschäft – zuerst bei einigen Tageszeitungen, dann eine Weile bei einer Boulevard-Sonntagszeitung –, und Rebecca vermutete, dass er zum Highland Chronicle gekommen war, um sich einen sonnigen Lenz zu machen, in der Annahme, dass die Arbeit bei einer Wochenzeitung einfach sein würde. Doch kaum hatte er sich mit seinem immer breiter werdenden Hinterteil auf dem Stuhl des Chefredakteurs niedergelassen, da hatte er schon die Aufsicht über zwei weitere Wochenzeitungen im Norden Schottlands am Hals. Die Eigentümer in London hatten beschlossen, ein einziger Chefredakteur sei für alle Blätter am äußersten Rand ihres Imperiums ausreichend. Lennox dachte am Anfang, er könne damit klarkommen, denn zunächst hatte er das Leben bei einer Wochenzeitung im Vergleich mit dem Hauen und Stechen des überregionalen Tagesjournalismus für das reinste Ferienlager gehalten.
Inzwischen wusste er, dass das nicht stimmte.
Er wirkte müde und angegriffen und, wie Rebecca bemerkte, außerordentlich genervt. Das schien dieser Tage allerdings sein Normalzustand zu sein. Man musste ihm zugutehalten, dass er seinen Frust nicht an den Mitarbeitern ausließ, oder vielmehr an dem, was an Mitarbeitern noch übrig geblieben war. Denn die Sparmaßnahmen der Eigentümer machten nicht bei den Redakteuren und Fotografen Halt. Es galt, Gewinnmargen abzusichern, und das bedeutete, dass Leute gehen mussten, obwohl sie das Produkt schufen, das die Gewinne einbrachte. Beim Management schien es allerdings keine Kürzungen zu geben, hatte Rebecca bemerkt: Ständig wurde jemand Neues eingestellt, der ankam und ihnen allen erklärte, wie sie ihre Arbeit zu machen hatten.
Als die ehemalige Chefredakteurin, eine gescheite, taffe und lustige Frau namens Elspeth MacTaggart, endlich beschlossen hatte, dass es ihr reichte, feuerte sie ein bitterböses Memo auf die Anzugträger im Süden ab, in dem sie haarklein erläuterte, was ihrer Meinung nach falsch lief und wie sehr man damit nicht nur das Geschäft, sondern auch den Journalismus als Ganzes schädigte. Die Anzugträger ignorierten die Nachricht und winkten ihr zum Abschied hinterher. Lennox war Elspeths Nachfolger.
Er blickte von seinem Computerbildschirm auf, als Rebecca in sein Büro kam. »Wie war’s?«
Im Auto hatte Rebecca die Zitate auf ihrem Block notiert, ehe sie sie am Ende vergaß. Sie las sie ihm vor und sah, wie sich ein Lächeln auf sein breites Gesicht stahl.
»Schreib’s zusammen, dreihundert Wörter für Seite drei, aber wir bringen auch eine Schlagzeile auf der Titelseite. Ich schick dir einen Rahmen.« Er begann schon wieder, in die Tasten zu hauen. Es war gleichgültig, ob eine Story mehr oder weniger Wörter brauchte – so hatte der Layouter die Seite formatiert, und das war’s. Und Lennox würde ihren Text lesen und daran herumschrauben – so wie sie ihn kannte, würde er ihn reißerischer machen. Er konnte auch das Seitenlayout verändern, wenn es sein musste, aber das war kompliziert und, wenn er ehrlich war, eine Kunst, die er noch nicht vollständig gemeistert hatte. Nur einer in der Redaktion war versiert darin gewesen, sich durch das Labyrinth des Programms für das Seitenlayout zu manövrieren, doch dessen Stelle hatte man vor zwei Monaten gestrichen. Das neue Programm, behauptete das Management, das noch nie auch nur ein Wort auf einer Computertastatur getippt hatte, sei so wunderbar, dass man keine Redakteure mehr brauche. Also gingen die Anzugträger dazu über, sie »Content Manager« zu nennen, und das fanden alle natürlich ganz großartig. Rebecca konnte straffe, saubere Texte verfassen, aber sie hatte dem Management was zu sagen – man braucht Redakteure, ganz egal, wie man sie nennt. Barry hatte zwei Content Manager, aber einer war im Urlaub und die andere kümmerte sich jeden Montag und Dienstag die meiste Zeit um die verschiedenen Sportseiten. Was wiederum bedeutete, dass der größte Teil der Nachrichten auf Barrys Tisch landete. Daher seine augenblickliche Laune.
»Hast du ein Foto?«, fragte Lennox.
Rebecca hielt ihr Handy in die Höhe. »Kein besonders tolles. Ein Fotograf hätte es besser hingekriegt.«
Barry tat es mit einem Achselzucken ab, während er weiter auf seinen Bildschirm starrte. »Solange es scharf ist und wir das Gesicht der Frau erkennen können, ist es in Ordnung. Stell’s ins System, und ich klatsche es auf die Seite.«
»Okay«, antwortete sie und unterdrückte nur mit Mühe einen Seufzer. Sie machte diesen Job erst seit drei Jahren, doch auch sie merkte schon, dass die Standards ins Rutschen gerieten. »Da ist noch was, Barry.«
Seine Augen huschten fragend über den Monitor, doch er hämmerte weiter auf die Tasten ein.
»Auf dem Rückweg habe ich mit Chaz geredet«, sagte Rebecca.
»Mit welchem Chaz?« Er schaute sie noch immer nicht an.
»Mit Chaz Wymark, dem freien Mitarbeiter drüben auf der Insel.«
»Auf welcher Insel?«
Rebecca war zwar noch nie auf Stoirm gewesen, nannte es aber immer nur »die Insel«, als wäre sie dort geboren. Ihr Vater hatte es nie anders genannt, obwohl er die Heimat seiner Kindheit nur selten erwähnte.
»Stoirm«, antwortete sie.
»Gut, okay«, meinte er und erinnerte sich. »Der freie Mitarbeiter.«
Genau das hatte sie ja eben gesagt. »Jedenfalls«, fuhr sie fort, »hat er eine Wahnsinnsgeschichte aufgetan.«
Lennox hörte auf zu tippen und schenkte ihr nun seine volle Aufmerksamkeit. »Okay.«
»Vor ein paar Tagen ist eine Frau namens Mary Drummond gestorben, an einem schweren Herzanfall. Ihr Sohn, Roddie Drummond, stand vor fünfzehn Jahren wegen Mord an seiner Freundin vor Gericht. Freispruch aus Mangel an Beweisen. Seither ist er nicht mehr auf der Insel gewesen, doch es besteht die Möglichkeit, dass er zur Beerdigung zurückkommt.«
»Okay, häng dich ans Telefon und schau, was du rauskriegst. Lass diesen Jungen, diesen Chaz, ein bisschen rumschnüffeln …«
»Chaz meint, dass die Stimmung auf der Insel wegen des Falls noch sehr bitter ist. Es ist eine ziemlich große Insel, aber Portnaseil ist eine kleine Gemeinde, da kennt jeder jeden.« Sie bereute die Worte »kleine Gemeinde« sofort, denn übersetzt würde das »winzige Verkaufszahlen« bedeuten. Sie wusste auch, wie unwahrscheinlich es war, dass sich dort alle untereinander kannten, hatte jedoch das Gefühl, dass dieser Gedanke irgendwie ihre Argumente unterstützen könnte. »Aber ich denke, das ist eine größere Sache – der verlorene Sohn kehrt heim, die Leute vom Ort haben was dagegen. Und dann ist da ja immer noch das ungelöste Geheimnis um den Mord.«
Lennox lehnte sich zurück, nahm einen dolchförmigen Brieföffner in die Hand, der auf seinem Schreibtisch lag, obwohl heutzutage nur noch sehr wenige Briefumschläge aufzuschlitzen waren, und wirbelte ihn in beiden Händen hin und her. Das machte er immer, wenn er nicht gerade auf der Tastatur herumhackte, als wären seine Hände so rastlos, dass sie einfach irgendwas tun mussten. »Was willst du damit sagen, Becks?«
Sie holte tief Luft. »Ich glaube, ich muss da rüber.«
Seine Körpersprache hatte bereits »Nein« gesagt, ehe sie ihren kurzen Satz zu Ende gesprochen hatte. »Ich kann es mir nicht leisten, dich da hinzuschicken«, erwiderte er. »Ich brauche dich hier. In der Zeit, die du für diese eine Story brauchst, kannst du hier zehn schreiben.«
Eine Story ist nur eine Story, wenn man sie am Telefon erledigen kann. Das hatte einer der Idioten verkündet, den sie von London hergeschickt hatten, um dem Personal zu erklären, dass man hier alles falsch machte. Das war während ihres ersten Jahres im Job gewesen, aber schon damals hatte sie gewusst, dass das totaler Schwachsinn war, sobald die Worte aus seinem Mund gekommen waren. Sie hatte das Gefühl gehabt, dass er es nicht einmal selbst glaubte. Das war einfach nur die offizielle Unternehmensdenkart.
»Barry …«, hob sie an.
»Becks«, unterbrach er sie. »Du bist nicht Lois Lane, und wir sind hier nicht beim Daily Planet. Du gehst nicht da rüber und löst diesen mysteriösen Fall …«
»Damit rechne ich auch nicht. Ich habe einfach das Gefühl, dass ich die Leute zum Reden bringen kann, wenn ich ihnen persönlich gegenüberstehe. Du weißt, dass ich das kann.« Ein leichtes Neigen seines Kopfes verriet ihr, dass er ihr das zugestehen musste. Sie fuhr fort: »Überleg doch mal. Wo ist dieser Roddie Drummond die letzten fünfzehn Jahre gewesen? Was hat er gemacht? Wie fühlt er sich, wenn er nach all der Zeit wieder nach Hause kommt und noch immer eine dunkle Wolke über seinem Kopf hängt? Was ist damals passiert? Da springt mehr als eine Story für uns raus. Ich verspreche dir, wir kriegen eine Schlagzeile auf der Titelseite und einen Sonderbericht, gleich aus dem Stand. Und wer weiß, über was ich sonst noch so stolpere. Aber dazu muss ich vor Ort sein. Manche Dinge kann man eben nicht telefonisch erledigen.«
Barry ließ den Brieföffner auf den Schreibtisch fallen und starrte sie an. Sie hörte, wie er schnaufte, während er über ihren Vortrag nachdachte, der in Anbetracht der Tatsache, dass sie ihn aus dem Stegreif gehalten hatte, ziemlich gut war. Das musste ihn eigentlich schon überzeugt haben, doch sie holte noch zu einem letzten Schlag aus. »Und wir sind von Anfang an dran an der Story, Barry. Das wird ein Exklusivbericht. Kein anderer, nicht die Press & Journal, nicht die West Highland Free Press, nicht der Courier, nicht mal die Tageszeitungen wittern was davon. Noch nicht. Aber wir müssen uns ranhalten.«
Sie hatte darauf gesetzt, dass das dem altmodischen Zeitungsmann gefallen würde, von dem sie hoffte, dass er noch irgendwo tief drinnen in Barry schlummerte. Ein Exklusivbericht. Die Chance, groß mit einer Story rauszukommen, die keine andere Zeitung hatte. Journalistenstolz. Ihr liefen freudige Schauer über den Rücken, wenn sie all die Möglichkeiten bedachte. Aber es gab noch einen anderen Grund, warum sie nach Stoirm wollte. Einen, den sie ihrem Chefredakteur nicht verriet. Es war ein persönlicher Grund.
Er schüttelte den Kopf. »Das krieg ich nicht hin, Becks, das weißt du. Schau mal, was du am Telefon rausbekommst. Wenn die Sache so exklusiv ist, brauchst du nicht hinzufahren.«
Verdammt, dachte sie.
Er widmete seine Aufmerksamkeit wieder dem Bildschirm, und sie wusste, dass sie verloren hatte. Enttäuscht wandte sie sich ab, als ihr ein neuer Gedanke kam. »Hast du was von Yvonne gehört?« Yvonne Adams war die zweite noch verbliebene Journalistin im Team des Chronicle. Sie war im Gericht, wo heute das Strafmaß für Greg Pullman verkündet wurde.
Lennox blickte nicht vom Monitor auf. »Er hat zehn Jahre gekriegt, dazu Fahrverbot und eine Geldstrafe von zehn Riesen.«
Rebecca verließ lächelnd sein Büro. Das war zumindest etwas.
Ihr Handy piepste, als sie gerade ihrem Artikel über Maeve Gallagher den letzten Schliff gab. Sie hatte passend zur Geschichte direkt auf das Gemüt der Leser gezielt. Trotzdem machte sie sich nichts vor: Das hier war keine echte Nachricht. An der Universität hatte man ihr die weisen Worte eines längst verstorbenen Pressemoguls vermittelt: Eine Nachricht ist etwas, von dem irgendjemand irgendwo auf keinen Fall will, dass es gedruckt wird. Alles andere ist Werbung. Man könnte vielleicht argumentieren, dass Greg Pullman das nicht gedruckt sehen wollte, aber der hatte jetzt andere Sorgen. Worauf es hinauslief, war Voyeurismus. Sosehr sie auch mit der trauernden Mutter mitfühlte, ihr Artikel bot der Leserschaft die Gelegenheit, sich am Leid eines anderen Menschen zu weiden. Rebecca wusste, dass sie möglicherweise zu streng über die Leserschaft urteilte, aber so war es eben. Und doch lieferte sie persönlich die Lauge für diese Seifenoper. Sie machte ihren Job, weil sie dafür bezahlt wurde, weil sie es gut konnte. Aber es waren nicht Storys wie diese hier gewesen, weswegen sie sich zum Journalismus hingezogen gefühlt hatte.
Sie überflog ihren Text und nahm das Gespräch auf ihrem Handy an, ohne auf dem Display nachzusehen, wer anrief. Ihr wurde bang ums Herz, als sie Simons Stimme hörte.
»Ich bin’s.«
Kurz überlegte sie, ob sie einfach auflegen sollte, entschied sich aber dagegen. So brutal konnte sie nicht sein, obwohl sie Simon mehr als deutlich zu verstehen gegeben hatte, dass Schluss war.
»Becks?«
»Am Apparat.« Ihre Stimme klang gepresst, selbst in ihren eigenen Ohren.
»Ich habe mich gefragt, ob du vielleicht Zeit für einen Kaffee hättest oder für ein Mittagessen. Oder sonst was.«
»Ich hab ziemlich viel zu tun, Simon. Bin bei der Arbeit.«
»Na gut.« Er wirkte ernüchtert, und sie dachte für sich: Was hat er denn erwartet? »Ja, klar, aber … na ja … ich war gerade in der Gegend und hab mir gedacht … nun ja …«
Rebecca schaute sich um, um sicher zu sein, dass niemand mithörte. Aber wer hätte das sein sollen? Yvonne war noch unterwegs, Barry saß in seinem Büro über den Bildschirm gebeugt, die Reporter der anderen Zeitungen, zwei pro Blatt, waren beschäftigt, und die einsame Content Managerin stand am Tisch am anderen Ende des Raumes und machte sich einen Kaffee, während die Werbeabteilung in einem ganz anderen Raum hauste.
»Simon, sieh mal – das ist wirklich keine gute Idee, okay? Du kannst nicht immer wieder bei mir anrufen.«
»Ich weiß, es ist nur …«
»Nein«, sagte sie, in bestimmterem Tonfall, als sie es vorgehabt hatte. Nun sprach sie absichtlich mit sanfterer Stimme: »Das muss aufhören. Du weißt, dass es aufhören muss.«
»Becks, du kennst meine Gefühle. Du weißt, dass ich …«
Sag es nicht, dachte sie.
»… dich liebe.«
Und er sagt es.
»Ich kann nicht zulassen, dass das einfach zu Ende geht, Becks.«
»Aber es ist zu Ende, Simon.«
»Für dich vielleicht.«
»Ja, für mich vielleicht, aber das ist immer noch ein Ende.«
Es trat eine Pause ein. »Es war nicht meine Schuld, Becks. Es war niemand schuld.«
Sie hörte, wie seine Stimme zu beben begann, und sie konnte es nicht ertragen. Sie wusste, dass das, was geschehen war, nicht seine Schuld war. Sie wusste, dass es auch nicht ihre war. Es war einfach geschehen. Sie machte ihm sicherlich keine Vorwürfe, aber danach war ihr klargeworden, dass nichts mehr zwischen ihnen war. Wie man so schön sagt: Es lag nicht an ihm, es lag an ihr. Sie wusste nicht, wonach sie suchte, aber sie wusste, dass es nicht Simon war. Nicht mehr.
Von all dem sagte sie jedoch nichts.
»Simon, bitte lass es gut sein. Es gibt nichts mehr zu sagen. Es tut mir leid, aber ich bin hier voll im Stress. Ich muss wieder an die Arbeit.«
Sie legte auf. Sie fühlte sich schlecht, aber sie konnte sich nicht wieder auf diese Diskussion einlassen. Sechs Monate waren vergangen, seit es geschehen war. Sie versuchte, nicht zu viel darüber nachzudenken, aber seine Stimme brachte alles wieder zurück, und das konnte sie nicht zulassen, nicht hier, nicht in der Redaktion. Sie ging zum Fenster und schaute auf die Straße hinunter, ließ den Blick über die Autos schweifen, die zu beiden Seiten geparkt waren. Ja, da war er, Simons blauer Audi. Simon war Anwalt und hatte seine Kanzlei in Dingwall. Gut möglich, dass er nach Inverness zum Gericht gekommen war, aber es gab keinen Grund, warum er sich hier im Gewerbegebiet aufhalten sollte, wo sich die Redaktion des Chronicle befand.
Sie lehnte sich an die Wand neben dem Fenster und schloss die Augen, sperrte die Erinnerungen aus. Sie hoffte, dass sich das nicht zu einem Problem entwickeln würde. Das durfte sie nicht zulassen.
4
Wenn Rebecca überhaupt ein dunkles Geheimnis hatte, dann war es die Tatsache, dass sie Robbie-Williams-Fan war. Sie hängte das nicht an die große Glocke, er galt nicht als besonders cool in ihrer Altersgruppe, den ach-so-coolen Mittzwanzigern. Seine Musik lief auf ihrem iPod, und er schmachtete gerade Swings Both Ways, während sie in ihrer kleinen Wohnung auf dem Fußboden saß und rings um sich herum gebundene Exemplare des Highland Chronicle aufgeschlagen hatte. Die hatte sie, ehe sie die Redaktion verlassen hatte, aus dem Archiv rausgeholt und unbeobachtet in ihr Auto geschmuggelt. Das digitale Archiv reichte nur neun Jahre zurück, also war über den Mord auf Stoirm online nichts zu finden. Daher die Notwendigkeit, die schweren Bände mit allen Ausgaben des Chronicle aus dem Jahr des Mordes und des Prozesses wenige Monate später zu konsultieren.
Viel brachte ihr das allerdings nicht. Die Berichte im Chronicle waren alles andere als umfassend – vielleicht war in den guten alten Zeiten doch nicht alles so viel besser gewesen –, aber zumindest gab es nach dem Prozess einen sehr guten, gründlich recherchierten Artikel über den Fall. Um fair zu sein, musste man sagen, dass ein solcher Mord, der erste auf der Insel seit fünfzig Jahren, von den Tageszeitungen ausführlich behandelt wurde, und bis die Wochenzeitungen erschienen, hatte es sicher nicht viel Neues gegeben. Auf den Websites der Tageszeitungen fand sie weitere Berichte, doch selbst dort waren die digitalen Aufzeichnungen aus diesen fernen Zeiten ziemlich lückenhaft.
Sie entdeckte einen längeren Eintrag zu dem Fall auf einer Website, die sich mit unaufgeklärten Mordfällen in Schottland beschäftigte, wusste aber, dass man wohl kaum als Evangelium übernehmen konnte, was dort geschrieben stand. Aber rein technisch gesehen war der Fall wirklich unaufgeklärt. Roddie Drummond war angeklagt, »aus Mangel an Beweisen« aber freigesprochen worden. Diese berüchtigte dritte Option, die den Geschworenen offen stand, war in Schottland ein heiß umstrittenes Thema – dieses »Bastard-Urteil«, weder schuldig noch unschuldig. Aber trotzdem freigesprochen.
Sie griff nach dem Weinglas, das neben ihr auf dem Fußboden stand, und lehnte sich ans Sofa. Der A4-Block auf ihrem Schoß war schon mit ihren krakeligen Anmerkungen vollgekritzelt, die niemand außer ihr entziffern konnte, manchmal nicht einmal sie selbst. Sie machte sich gern rasche Notizen, weil sie sich so dem Thema näher fühlte. Dann ließ sie den Blick über die aufgeschlagenen Zeitungsseiten schweifen und schließlich auf den Bildschirm ihres Laptops. Eine körnige Aufnahme von Mhairi Sinclair, eindeutig der Scan eines Zeitungsfotos, starrte zu ihr zurück. Sie war wunderschön, hatte hohe Wangenknochen, das dunkle Haar hinten zu einem Pferdeschwanz zusammengefasst. Offen hätte es ihr wie ein Wasserfall bis zu den Schultern gereicht.
Sie hatte ein Kind, stand in den Berichten. Sie hatte mit Roddie zusammengelebt, obwohl er nicht der Kindsvater war. Rebecca blätterte in ihren handschriftlichen Notizen zurück. Der Vater war ein anderer Mann vom Ort, Donnie Kerr. Auf ihrem Block hatte Rebecca daneben »SUCHEN« geschrieben und unterstrichen. Zweimal.
Sie starrte in Mhairis Augen. Das Bild war schwarzweiß, also konnte sie nicht sehen, welche Farbe sie hatten. Sie wirkten dunkel. Dunkel und tief.
Was ist damals passiert, Mhairi?
Wer hat dich umgebracht?
Rebecca zog den Prozessbericht des Chronicle näher zu sich heran und suchte nach dem Abschnitt, in dem Mhairis letzte Minuten ausführlich beschrieben wurden. Sanitäter aus dem gerade eröffneten Gemeindekrankenhaus hatten auf Roddies Notruf reagiert. Sie hatten Mhairi schrecklich zusammengeschlagen vorgefunden. Rebecca hatte Ausdrücke wie »Impressionsfraktur« gelesen, wobei Haar und Kopfhaut mit dem Gehirn in Berührung gekommen waren, außerdem »Frakturen des Jochbeins und der Stirnhöhle«, was bedeutete, dass jemand so heftig auf sie eingeprügelt hatte, dass die Knochen um ihre Augen zerschmettert waren und sich ihr linkes Auge aus der Höhle wölbte. Dann stand da noch »Cushing-Triade«, eine Steigerung des arteriellen Blutdrucks, wahrscheinlich durch erhöhten Hirndruck verursacht, wobei die Atmung unregelmäßig wurde und die Herzfrequenz abgenommen hatte. Es waren noch weitere tiefe Platzwunden verzeichnet und Quetschungen an Stellen, wo ihr jemand die Kehle zugedrückt hatte. All das wurde zunächst in der trockenen, emotionslosen Sprache der Gutachter konstatiert, bis man den Pathologen zur Art der Verletzungen befragte. »Meiner Meinung nach litt der Mensch, der das getan hat, an einer tiefen und unkontrollierbaren Wut«, antwortete er. Natürlich gefiel das dem Verteidiger kein bisschen, und er erhob Einspruch gegen diese Spekulation, doch da war der Gedanke bereits im Raum.
Die Sanitäter hatten getan, was sie konnten, führten aber einen aussichtslosen Kampf. Mhairi starb noch im Krankenwagen. Sie hatte nur einmal das Bewusstsein wiedererlangt, während sie noch im Cottage waren. Rebecca überflog den Bericht und fand den Abschnitt, den sie gesucht hatte. Sie las ihn erneut:
Der stellvertretende Staatsanwalt fragte die Zeugin: »Und hat die Verstorbene vor ihrem Tod noch etwas gesagt?«
Die Zeugin antwortete: »Ja. Sie hat sich nach Sonya erkundigt.«
»Sonya war ihre einjährige Tochter?«
»Ja.«
»Und wo war Sonya zu diesem Zeitpunkt?«
»Sie war in ihrem Kinderbett im Haus. Sie schlief.«
»Und die Tochter war unverletzt?«
»Es ging ihr gut.«
Dann fragte der stellvertretende Staatsanwalt: »Und hat die Verstorbene sonst noch etwas gesagt?«
Die Zeugin antwortete: »Ja.«
»Und würden Sie dem Gericht mitteilen, was das war?«
»Sie sagte: ›Thunder Bay‹.«
Nun wurde die Sanitäterin gefragt, was das ihrer Meinung nach bedeutete, und sie erklärte, Thunder Bay sei eine wohlbekannte Bucht an der Westküste von Stoirm.
Die Zeugin wurde daraufhin gefragt: »Und was hat sie Ihrer Meinung nach damit gemeint?«
»Ich weiß es nicht«, antwortete sie.
Rebecca hatte in ihren Notizen in Großbuchstaben »THUNDER BAY« eingetragen und auch diese Worte unterstrichen. Dreimal. Thunder Bay. Sie rief Google Maps auf und zoomte heran. Es gab nur ein Satellitenbild, keine Ansicht vom Boden aus. Die Bucht schien ziemlich abgelegen zu sein, und es sah so aus, als führte von der Straße, die längs über die Insel verlief, ein Pfad dorthin, obwohl man das aus dieser Perspektive nicht gut erkennen konnte. Vielleicht war es sogar eine asphaltierte, einspurige Straße. Unter ihre Notizen hatte sie ein Wort geschrieben: »HINFAHREN«.
Wenn sie ehrlich war, hatte sie sich bereits bei ihrem Gespräch mit Chaz dazu entschlossen, auf die Insel zu reisen, um der Geschichte nachzugehen. Es war eigentlich gleichgültig, was Barry sagte. Sie hatte gehofft, dass er begreifen würde, wie wichtig die Story war, und sie hinfahren lassen würde. Doch anscheinend war bei ihm jedes Gespür für Nachrichten, das er vielleicht einmal gehabt hatte, durch die Notwendigkeit erstickt worden, es den Zahlenfressern mit ihren Kalkulationstabellen recht zu machen. In gewisser Weise verstand Rebecca seine Einstellung, aber ihr eigenes Gespür sagte ihr, dass sie dieser Sache mit ein paar Telefonaten auf keinen Fall gerecht werden konnte.
Es stellten sich so viele Fragen. Der Mord von vor fünfzehn Jahren. Das ungelöste Geheimnis. Roddie Drummond.
Und dann war da noch Stoirm.
Die Insel, auf der ihr Vater geboren war. Die Insel, die er mit achtzehn Jahren verlassen hatte. Die Insel, auf die er nie zurückgekehrt war. Die Insel, die sie fasziniert hatte, seit sie zum ersten Mal davon gehört hatte, obwohl sie nie dort gewesen war.
Die Insel war einer der Gründe gewesen, warum sie so froh gewesen war, als sie den Job beim Chronicle an Land gezogen hatte. Obwohl Stoirm am äußersten Rand des Einzugsbereichs dieser Zeitung lag, hatte sie stets gehofft, dass man sie einmal dort hinschicken würde. Doch bisher hatte sich die Gelegenheit nicht ergeben.
Bis jetzt.
Rebecca suchte auf ihrem Handy die Nummer ihrer Mutter heraus und rief an. Sie schaute erst auf die Uhr an der Wand, als sie bereits den Rufton hörte. Zehn Uhr. Mum würde noch wach sein. Das Telefon klingelte weiter. Sie bekam Zweifel. Vielleicht war sie doch schon zu Bett gegangen. Oder vielleicht war sie ausgegangen? Vielleicht …
»Becca, was ist los?«
Die Stimme ihrer Mutter klang besorgt. Rebecca stellte sich vor, wie Sandra Connolly in ihrer geräumigen Küche in Milngavie saß. Der Ton des Fernsehers aus dem Wohnzimmer dröhnte bis zu ihr herüber, irgendeine Comedy-Sendung.
»Nichts, Mum, wieso?«
»Es ist spät.«
»Es ist zehn Uhr, Mum.«
»Trotzdem spät für einen Anruf.«
Rebecca lächelte vor sich hin. Ihre Mutter hasste das Telefon, hatte es nie im Wohnzimmer geduldet. Zuerst stand es im Flur, dann, nach einigem Drängen ihres Ehemanns, in der Küche. Das war ein Sieg für ihn. Zumindest konnte er jetzt am Tisch sitzen, wenn er sich unterhielt.
»Schließlich«, fuhr ihre Mutter fort, »könnte ich ja Herrenbesuch haben.«
Rebecca lächelte. »Aus dem Alter von Herrenbesuch bist du raus, Mum.«
»Ich bin erst zweiundfünfzig, das ist kein Alter. Und außerdem ist das Altersdiskriminierung. Ich dachte, wir hätten dich besser erzogen. Auch Mums haben ihre Bedürfnisse, weißt du.«
»Mums haben keine Bedürfnisse.«
»Natürlich haben wir welche – was denkst du, wie du auf die Welt gekommen bist?«
Rebecca merkte, wie ihr Lächeln breiter wurde. Sie wusste, dass ihre Mutter sie aufzog. »Benimm dich, Mum. Du weißt ganz genau, dass es außer Dad keinen für dich gab.«
Ihre Mutter lachte. »Ja, das hat er auch immer behauptet. Und es hat mir gar nicht gefallen, wenn er recht hatte. Schließlich ist es die Aufgabe eines Ehemanns, im Unrecht zu sein, und zwar immer. Also, warum rufst du mich so spät an?«
»Tut mir leid, Mum, aber das konnte nicht warten. Ich fahre morgen auf die Insel.«
Stille. Als ihre Mutter redete, hörte Rebecca den vertrauten, verhaltenen Tonfall wie immer, wenn dieses Thema zur Sprache kam. »Warum?«
»Eine Story.«
»Was für eine Story?«
Rebecca erklärte es ihr.
Als sie mit ihrer kurzen Zusammenfassung fertig war, sagte ihre Mutter: »Über all das weiß ich überhaupt nichts.«
»Das hatte ich auch nicht erwartet. Was ich wissen wollte, ist: Warum hat Dad nie über die Insel geredet?«
Obwohl sie immer um Geschichten von der Insel gebettelt hatte, hatte ihr Dad nur sehr wenig darüber erzählt, höchstens mal beiläufig. Und all ihren weiteren Fragen war er geschickt ausgewichen. Er hatte keine Fotos vorzuzeigen, nichts aus seiner Kindheit. Es war, als gehörte die Insel nicht zu ihm.
Am anderen Ende der Leitung herrschte erneut Stille, nur vom leisen Gelächter aus dem Fernseher unterbrochen. Rebecca erkannte die Stimme von Stephen Fry. Als ihre Mutter noch immer schwieg, sagte Rebecca: »Mum?«
»Er hat einfach nicht drüber geredet«, antwortete ihre Mutter.
»Nicht einmal mit dir?«
»Nicht einmal mit mir.«