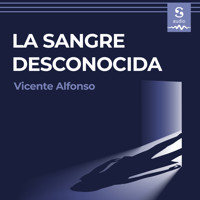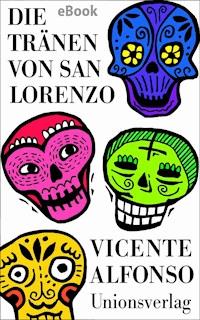
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Torreón, die Stadt in Mexiko, ist im Ausnahmezustand. In einer Bar geschieht ein Mord und der Verdacht fällt auf die Ayala-Zwillinge. Auf beide, denn Remo von Rómulo zu unterscheiden, ist schwierig. Was keiner ahnt: Zwilling zu sein, ist eine Qual. Vor allem, wenn sie identisch scheinen, aber höchst unterschiedlich sind. Rómulo verschwindet und Remo begibt sich in therapeutische Behandlung. Er wirkt verschlossen, doch die bohrenden Fragen des Analytikers bringen ihn zum Reden. Blufft er nur, um sich reinzuwaschen, wie alle Welt glaubt? Warum ist der Bruder, Rómulo, verschwunden, und wer steckt hinter dem Mord an ihrer Mutter? Warum ist ihr Grab leer? Der Therapeut glaubt an Remo und geht auf Spurensuche. Zeitgleich untersucht ein Journalist das Verschwinden der geheimnisvollen, heiligen Niña – hat sie etwas mit den Brüdern zu tun? Und dann ist da noch ein hoher Politiker, der in der Angelegenheit gerne ein Wörtchen mitreden möchte. Dieser virtuose Kriminalroman erzählt seine Geschichte wie ein Puzzlespiel. Die Suche nach der Wahrheit ist verzwickt. Irgendwo verbirgt sie sich, und sie hat bekanntlich viele Gesichter. Erst recht in einem Land, das mit dem Tod auf vertrautem Fuße steht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Über dieses Buch
Einer der Ayala-Zwillinge wird des Mordes verdächtigt. Das Problem: Sie sind identisch. Von Rómulo fehlt jede Spur – Remo ist in therapeutischer Behandlung. Was hat das Verschwinden der heiligen Niña damit zu tun und warum interessiert sich ein hoher Politiker dafür? Wie nah kommt man der Wahrheit, wenn sie wie Perseiden an uns vorbeizieht?
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Vicente Alfonso (*1977) ist ein mexikanischer Schriftsteller und Journalist. Dreizehn Jahre lang ging er auf eine Jesuitenschule, bevor er sich dem Schreiben widmete. Neben seiner Tätigkeit als Romanautor arbeitet er für die mexikanische Zeitung El Universal.
Zur Webseite von Vicente Alfonso.
Peter Kultzen (*1962) studierte Romanistik und Germanistik in München, Salamanca, Madrid und Berlin. Er lebt als freier Lektor und Übersetzer spanisch- und portugiesischsprachiger Literatur in Berlin.
Zur Webseite von Peter Kultzen.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Hardcover, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Vicente Alfonso
Die Tränen von San Lorenzo
Kriminalroman
Aus dem Spanischen von Peter Kultzen
E-Book-Ausgabe
Mit einem Bonus-Dokument im Anhang
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 1 Dokument
Die Originalausgabe erschien 2015 bei Tusquets Editores, México D.F.
Originaltitel: Huesos de San Lorenzo
© by Vicente Alfonso 2015
Diese Ausgabe erscheint in Vereinbarung mit VicLit Agency
© by Unionsverlag, Zürich 2024
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Image Zoo / Alamy Stock Photo
Umschlaggestaltung: Heike Ossenkop
ISBN 978-3-293-30958-6
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 24.06.2024, 21:18h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
DIE TRÄNEN VON SAN LORENZO
Compositio loci — Ein EntfesselungstrickTherapiesitzung I — Der Fall Remo AyalaZum letzten Schluck I — EntscheidungsspielDie Tränen von San Lorenzo I — Die Spur der NiñaUntersuchungsverfahren I — Das Begräbnis der ZwillingeAd maiorem Dei gloriam I — Brand im HühnerstallTherapiesitzung II — Remo Ayala stellt sich vorBrief an Don Bernardo I — Übertünchte GräberBesuchstag I — Festnahme an der GrenzeTherapiesitzung III — Magdas BedingungZum letzten Schluck II — Eine unvollständige AkteDie Tränen von San Lorenzo II — Borrados VersprechenTherapiesitzung IV — Völlig gleich und doch verschiedenAd maiorem Dei gloriam II — Die Nacht der ApostelBrief an Don Bernardo II — Eine HalbwahrheitPolizeimeldungBesuchstag II — MalwerkstattDie Tränen von San Lorenzo III — Die Geheimnisse der NiñaTherapiesitzung V — Ein ÜberraschungsbesuchAd maiorem Dei gloriam III — Erinnerungen an TaniaBrief an Don Bernardo III — Der Richter und sein VorlebenBrief aus Topolobampo — Ismael schlägt zuTherapiesitzung VI — AlbträumeDie Tränen von San Lorenzo IV — Tage der FäulnisTopolobampo – vom Traum zum Albtraum — Gregorio SaldívarKaschierter GroßgrundbesitzDie Situation eskaliertTherapiesitzung VII — Knochen voll SalzUntersuchungsverfahren II — Magdas BerichtBesuchstag III — Keine Spur von RómuloAd maiorem Dei gloriam IV — Die Wahrheit macht uns freiZum letzten Schluck III — Genaueres über das ChaosBesuchstag IV — In den Höhlen der ErinnerungDie Tränen von San Lorenzo V — Die Niña erhört das GebetBesuchstag V — Mit Don Bernardo geht es zu EndeUntersuchungsverfahren III — Unterhaltungen hinter verschlossener TürDie Asche und der FeigenbaumNoch mehr Votivgaben und DanksagungenAnmerkungen
Mehr über dieses Buch
Vicente Alfonso: Von Kindsbeinen an war ich mit meiner Zwillingsexistenz konfrontiert
Über Vicente Alfonso
Über Peter Kultzen
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Zum Thema Mexiko
Zum Thema Kriminalroman
Zum Thema Spannung
Zum Thema Lateinamerika
Für Iliana Olmedo
»Das ist gewiss, das Beste wäre es, wenn all das nicht existierte, wenn nichts Rührendes da wäre und auch keine Zwillinge … Hole der Teufel diese ganze Geschichte! Und wozu war das denn nötig? Was war denn für eine besondere, keinen Aufschub vertragende Notwendigkeit vorhanden? Herr du mein Gott! Was hat uns da der Teufel für eine Grütze gekocht!«
Fjodor Dostojewski, Der Doppelgänger
Compositio loci
Ein Entfesselungstrick
Parras, Coahuila, 10. August 1995
Die Wirklichkeit ist einzigartig, ihre Lesarten sind unbegrenzt. Der Zauberer und sein Publikum deuten die Ereignisse auf unterschiedliche Weise. Für die Zuschauer ist ein Vorgang einmalig und unerklärlich – ein Glaubensakt. Für den, der den Trick ausführt, besteht der ganze Zauber dagegen in Genauigkeit und Übung. Geschmeidigkeit, die sich vielfacher Wiederholung verdankt. Dafür, dass er weiß, wie der Mechanismus funktioniert, das Zusammenspiel von Federn und Seilrollen genau kennt, bezahlt der Zauberer einen sehr hohen Preis – es macht ihn zum Skeptiker. Allerdings nehmen die anderen ihm die Sache gerade deswegen ab.
Am Donnerstagmorgen haben die Festlichkeiten ihren Höhepunkt erreicht. Wie jedes Jahr sind die Straßen voller Fremder. Was wiederum jene Leute anlockt, die Essen oder billigen Ramsch verkaufen oder unter freiem Himmel musizieren. Gläser voll Wein werden herumgereicht, überall sind Trauben zu sehen, in Kisten und Körben, auf Karren und als Stickerei auf den Kleidern der Mädchen, denen die Aufgabe zufällt, sich als Erste ans Traubenstampfen zu machen. In der Vorhalle hält eine Frau Heiligenbildchen, Rosenkränze und Kruzifixe feil. Es riecht nach Asche – wo in der Nacht Feuer brannten, sind jetzt nur noch Gluthaufen zu sehen. Hunde schnüffeln im Müll. Neben dem Eingang des Gebäudes verkündet ein Schild:
DER GROSSE PADILLA, ZAUBERER AUS DEM ORIENT, LÄSST VOR IHREN AUGEN EIN PFERD VON DER BÜHNE VERSCHWINDEN! NIÑA CANDE, WAHRSAGERIN, KENNT ALLE GEHEIMNISSE DER VERGANGENHEIT UNDZUKUNFT! LIEST AUF WUNSCH AUCHKARTEN.
Und darunter eine Herausforderung:
JUAN BORRADO, ENTFESSELUNGSKÜNSTLER. NICHTS KANN IHN AUFHALTEN! BRINGEN SIE SCHLÖSSER, SEILE, KETTEN MIT, WAS IMMER SIE WOLLEN.
VORFÜHRUNGEN TÄGLICH 10.00 UND 18.00 UHR.
Im Saal ist alles bereit. Die mit Zeitungspapier abgedichteten Fenster lassen nur ein stumpfes Licht herein. Einen Meter über der Bühne hängt einer jener orangefarbenen Bottiche, mit denen sich die Bergarbeiter in Múzquiz in die Kohlegruben hinablassen.
Aus zwei Lautsprechern – das viele Hin und Her über Landstraßen und Feldwege hat ihnen merklich zugesetzt – ertönt Prokofjews Tanz der Ritter.
Juan Borrado betritt die Bühne, in Jeans und weißem T-Shirt. Eigentlich ist er noch ein Junge. Ganz in Weiß gekleidet, folgt ihm Padilla – der große Padilla. Der alte Zauberer hebt die Arme, und die Musik verstummt. Jetzt sind bloß noch die Geräusche von draußen zu hören – Trommeln, Kindergeschrei, Raketen. Ein Verkäufer preist Wassereis mit Zitronen-, Kokos- oder Tamarindengeschmack an.
Padilla braucht einen Freiwilligen. Im Publikum erheben sich mehrere Hände. Der Zauberer entscheidet sich für eine dicke Frau mit strubbligen Haaren, die beide Arme in die Höhe reckt. Er bittet sie zu sich auf die Bühne.
»Guten Abend, Señora. Wie heißen Sie?«
»Dolores.«
»Darf ich Sie Doña Lola nennen? Ja? Das hier ist Juan Borrado.«
Die Frau und der Entfesselungskünstler geben sich die Hand.
»Darf ich mal sehen, was Sie mitgebracht haben, Doña Lola?«, erkundigt sich der Zauberer einladend.
Die Frau hält ihm eine Kette mit nicht besonders dicken und dafür umso rostigeren Gliedern entgegen.
»Oje, Doña Lola, daraus könnte sich sogar mein Bügelbrett befreien …«
Unsicher lächelnd, zuckt die Frau die Achseln.
»War bloß ein Witz … Legen Sie ihm die Kette an! Aber nicht dass nachher jemand sagt, wir hätten geschummelt – hat noch wer was dabei?«
Im Publikum werden Seile, Schlösser, ja sogar Säcke in die Höhe gehalten. Der Zauberer wählt ein Paar Handschellen aus.
»Tun Sie ihm die an die Füße, Doña Lola. Und zwar so, dass sie gut verschlossen sind.«
Die Frau legt die Handschellen um die Fußgelenke des Jungen. Dann helfen sie und der Zauberer dem Entfesselungskünstler in den Bottich. Als er hineinsteigt, schwappt ein wenig Wasser über.
»Hast du Angst?«, fragt Padilla.
Der Junge schüttelt den Kopf.
»Gut. Machen wir weiter.« Der Zauberer wendet sich an das Publikum. »Aufgepasst, jetzt geht alles ganz schnell. Für Juan ist das, als ob er für ein paar Sekunden wieder in den Bauch seiner Mutter schlüpfen würde.«
Alle Blicke richten sich auf den Jungen, der tief Luft holt und beim Untertauchen noch mehr Wasser überschwappen lässt. Doña Lola hilft dem Zauberer, den Deckel zu verschließen. Dann klopft dieser gegen den Bottich.
»Manche Wörter haben, nur für sich gesagt, keine Bedeutung.« Padillas Stimme erfüllt den Raum. »Die erlangen sie nur in Begleitung anderer Wörter, zum Beispiel hier oder dort …«
Aus dem Inneren des Bottiches ist ein Klopfen zu hören. Dann noch einmal. Padilla spaziert über die Bühne. Im Publikum macht sich Gemurmel breit.
»Bin ich hier oben und Sie dort unten? Oder sind wir alle hier drinnen und die anderen dort draußen? Wo ist Juan in diesem Augenblick? Vor wenigen Sekunden war er ja noch hier drin …« Er klopft erneut gegen den Bottich, dann geht das Licht aus.
Gleich darauf leuchtet der Scheinwerfer wieder auf. Eigentlich müsste sich der Junge in der Zwischenzeit aus seinem Kerker befreit haben, so sieht es der Entfesselungstrick jedenfalls vor, aber auf der Bühne ist niemand zu sehen. Dann überstürzen sich die Ereignisse: Padilla versucht, den Behälter zu öffnen. Die Zufallsassistentin sieht sich ratlos um. Draußen mischt sich Glockengeläut in das Geräusch der Trommeln. Und das Gesicht des Zauberers verfinstert sich, als spürte er auf einen Schlag die Last all der Jahre harter Arbeit.
Therapiesitzung I
Der Fall Remo Ayala
Torreón, September 2010
Wie bilden sich unsere Erinnerungen? Verändern sie sich, passen sie sich an, reifen sie im Lauf der Zeit? Oder bleichen sie aus wie Zeitungspapier in der Sonne? Vielleicht geht es uns mit den Ereignissen manchmal wie mit trübem Wasser: Erst wenn der aufgewirbelte Schlamm sich gesetzt hat, wird im Gedächtnis sichtbar, was wir die ganze Zeit geahnt haben. Und mithilfe verschiedener Quellen ein Geschehen wiederherzustellen, ist, als würde man sich vor einem zersplitterten Spiegel rasieren – was man dabei zu sehen bekommt, stimmt teilweise überein, teilweise überhaupt nicht.
Wie viele Jahre ich für die Niederschrift dieses Buches gebraucht habe, kann ich nicht genau sagen. Wenn ich bis zu dem Tag zurückrechne, an dem Remo Ayala zum ersten Mal in meiner Praxis erschien – das war im September 1995 –, wären es fünfzehn. Ein schmächtiger, säuerlich dreinblickender junger Mann. Am besten ließe seine Geschichte sich womöglich durch einen Satz beschreiben, den er selbst einmal formuliert hat: »Die Vergangenheit ist wie ein großes Puzzle, dessen Teile nie ganz zusammenpassen.« In diesem Fall ließe sich aus den Bestandteilen geradezu ein Krimi basteln, was ich aber nicht nur wegen des Mordes an Farid Sabag sage, der zudem erst mehrere Jahre später geschah – ich denke dabei auch an die langen Internatsjahre der Zwillinge bei den Jesuiten, an eine Dreiecksbeziehung mit tragischem Ausgang, an einen autoritären Vater, der sich die Gesetze nach Lust und Laune zurechtbog, und an eine Familiengeschichte, die im Zeichen der Schuld stand.
Als ich Remo im September 1995 kennenlernte, dachte ich jedenfalls nicht, dass ich einmal ein Buch über ihn schreiben würde. Auch neun Jahre später wäre ich nicht auf diesen Gedanken gekommen. Damals wurde er aus dem Gefängnis entlassen, und ich war mir sicher, dass er zu Unrecht verurteilt worden war. Ich weiß noch, wie er mit todernster Miene das Tor durchschritt, in der Hand einen Beutel mit den wenigen Dingen, die er aus der Haft mitnehmen wollte: zwei Päckchen Camel, ein Ölporträt des Heiligen Johannes vom Kreuz, ein Kästchen mit Pinseln, mehrere Blatt Schleifpapier und ein wenig Bleiweiß.
»Gut gehts mir«, sagte er, aber sein Blick und der Klang seiner Stimme verrieten etwas anderes. Damals schrieb ich seine Verbitterung der Tatsache zu, dass weder sein Vater noch sein Bruder erschienen waren, um seine Rückkehr in die Welt, wie er selbst es bezeichnete, zu feiern, weshalb seine Haftentlassung zu einer ziemlich deprimierenden Version des Gleichnisses von der Heimkehr des verlorenen Sohnes geriet. Noch bevor wir zu Ende gegessen hatten, fragte ich ihn, ob er die Therapie fortsetzen wolle, und fügte hinzu, dass das nicht unbedingt mit mir sein müsse.
Dass ich wenige Wochen später, seinen Letzten Willen erfüllend, die Überreste beider Brüder unter dem Feigenbaum beisetzen sollte, wo sie als Kinder immer gespielt hatten, hätte ich mir nicht träumen lassen, und auch nicht, dass mir erst dann bewusst werden sollte, was mein Patient mir jahrelang vergeblich hatte sagen wollen.
Das Buch, das mir vorschwebte, sollte gut recherchiert, jedoch kein trockenes Sachbuch sein. Es würde genügen, den Fall klar und genau darzulegen, die Briefe wiederzugeben, die sich die Brüder Ayala geschrieben hatten, Transkriptionen einiger Passagen der aufgezeichneten Sitzungen sowie mehrere Zeugenaussagen hinzuzufügen, vor allem in Bezug auf den tragischen Mord an Farid Sabag in der Bar Zum letzten Schluck, der den Brüdern zur Last gelegt wurde. Aber all meinen Bemühungen zum Trotz wollte es mir nicht gelingen, die Ereignisse in ihrer Vielschichtigkeit zu Papier zu bringen. Es las sich flach, kalt und hatte nichts von dem Geheimnis, das das Leben der Ayala-Zwillinge stets umgeben hat.
So ging es über zwei Jahre, in denen ich mühsam Absatz an Absatz reihte, bis ich, als ich aufgehört hatte, danach zu suchen, doch noch den Schlüssel fand. Eines verregneten Sonntags saß ich in einem Lokal und blätterte in verschiedenen Büchern. In einem davon stieß ich auf folgende Stelle: »In einer knappen Krankengeschichte gibt es kein Subjekt – dieses wird in der modernen Anamnese nur mit einer oberflächlichen Beschreibung erfasst (»ein trisomischer, weiblicher Albino von einundzwanzig Jahren«), die ebenso auf eine Ratte wie auf einen Menschen zutreffen könnte. Um die Person – den leidenden, kranken und gegen die Krankheit ankämpfenden Menschen – wieder in den Mittelpunkt zu stellen, müssen wir die Krankengeschichte zu einer wirklichen Geschichte ausweiten.«1
Genau das hatte mir gefehlt. Ich las das Buch in einem Rutsch durch, gebannt davon, wie der Autor – ein englischer Neurologe, der in New York lebte – seine Fälle beschreibt. Statt klinische Einzelheiten aneinanderzureihen, richtet er den Blick auf die persönlichen Erfahrungen des Patienten. Dazu zitiert er Autoren wie Borges oder Shakespeare oder die Erzählungen aus Tausendundeiner Nacht. Ich war begeistert. Auf einmal begriff ich, dass die Ayala-Zwillinge für mich bis dahin kaum mehr als eine Krankenakte gewesen waren, die in meinem Gedächtnis vor sich hin staubte. Um ihr Leben erzählen zu können, musste ich mich jedoch ganz auf ihre Welt einlassen, musste versuchen, ihre Obsessionen und Ängste zu begreifen und den Kampf der beiden um eine je eigene Identität nachzuvollziehen. Ich verfügte über ihre Briefe und alle offiziellen Unterlagen, doch wie immer steckte der Teufel im Detail. Was waren ihre Lieblingsgetränke gewesen? Was für ein Kleid trug die Niña Cande in der Nacht, in der sie zum letzten Mal gesehen wurde? Wie sah die Toilette aus, in der die Apostel ihre Treffen abhielten? Erst jetzt wurde mir klar, welch wertvolles Material die Geschichten darstellten, die Remo mir während der Therapiesitzungen erzählt hatte, beispielsweise der Fall der siamesischen Zwillingsschwestern aus dem Iran.2
Zur abschließenden Klärung noch Folgendes: Im Mittelpunkt dieses Buches steht das Leben des einen der Ayala-Zwillinge, beim Schreiben wurde mir jedoch klar, dass ich darin unweigerlich auch über dessen Bruder würde sprechen müssen. Rómulo blieb für mich trotzdem ein Geheimnis. Ich weiß nicht, ob ich ihm auf diesen Seiten gerecht werde. Wer ihn kannte, beschrieb ihn als schlagfertigen jungen Mann, der sich für Sport, Wissenschaft und Technik interessierte. Ein fröhlicher Junge mit großen Plänen. Wer sich dagegen mit Remo unterhielt, merkte schon nach wenigen Sätzen, dass die Auseinandersetzung mit seinem Bruder wie ein schwarzes Loch war, eine düstere Achse, um die sich fast alles drehte, was er in Angriff nahm. Unsere Gespräche liefen stets gleich ab, aufreibend und zermürbend, in den schlimmsten Augenblicken glichen sie eher einer Rauferei auf offener Straße als dem gelassenen Hin und Her einer Schachpartie. Immer wieder versuchte ich, ihm klarzumachen, dass ihn und seinen Zwillingsbruder zwar körperlich einiges verband – beide waren schlank, hatten einen dunklen Teint und schmutzig grün gefleckte Pupillen –, ihre Probleme sich jedoch nicht im Entferntesten mit denen der erwähnten iranischen Schwestern oder der siamesischen Zwillingsbrüder Chang und Eng vergleichen ließen, mit denen er sich geradezu zwanghaft beschäftigte. Er und sein Bruder, sagte ich, seien nicht nur getrennt, also jeder für sich, zur Welt gekommen, auch was ihr Temperament und ihre Interessen angehe, seien sie grundverschieden. Aber er beharrte darauf, dass alle Welt ihn ständig mit seinem Bruder verglich, das spüre er genau.
»Immer?«
»Immer«, klagt er auf dem Mitschnitt, »dauernd geht es darum, wer der Klügere von uns beiden ist, wer der Gute und wer der Böse, oder ob es stimmt, dass, sobald einer von uns krank wird, der andere automatisch die gleichen Symptome aufweist.«
»Und woran könnte das liegen?«
»Keine Ahnung.«
»Denk doch mal an die siamesischen Zwillinge, Remo. Der eine war zurückhaltend und schüchtern und las Shakespeare, der andere dagegen war draufgängerisch, spielsüchtig, ein Alkoholiker – das hast du selbst gesagt.«
»So steht es in den Büchern über sie.«
»Na gut«, erwidere ich, »aber inwiefern war Chang draufgängerisch? Im Verhältnis zu den meisten anderen Menschen oder nur verglichen mit seinem Bruder? Und war Eng vielleicht nicht in Wirklichkeit ein bisschen scheinheilig?«
Mein Patient bleibt stumm.
»Sie hatten keine andere Wahl«, spreche ich weiter, »sie waren zusammengewachsen, du und Rómulo nicht.«
»Die Verbindung ist äußerlich nicht zu sehen, aber es gibt sie. Rómulo ist wie mein Schatten. Kaum sieht mich einer, denkt er sofort auch an ihn.«
»Vielleicht liegt das ja an dir – ist dir schon mal aufgefallen, dass du ständig von Rómulo sprichst? Dauernd redest du über seine Probleme statt über deine.«
»Mein Problem ist eben genau Rómulo.«
Zum letzten Schluck I
Entscheidungsspiel
Torreón, 20. Mai 2001
Als er um 17.03 Uhr das Lokal betrat und ein Bohemia bestellte, wusste er nicht, dass er das Bier nicht mal mehr ganz würde austrinken können. Obwohl an dem Tag kein Alkohol ausgeschenkt werden durfte, waren im Letzten Schluck nur sehr wenige Gäste nüchtern. Vielleicht ließ sich auch deshalb so schwer ermitteln, was in der knappen Stunde geschehen war zwischen dem Moment, in dem Farid Sabag den ersten Schluck trank, und jenem, in dem die Polizei eintraf, um seine Leiche abzutransportieren. Der erste Vertreter der Ordnungskräfte, der den Toten berührte, war der Polizeibeamte Martín Marentes, der damals seit gerade einmal einer Woche im Dienst war. Das Opfer befand sich auf der Toilette. Mit Handschellen an ein Rohr gefesselt, kniete es in urin- und kotverschmutzter Leinenhose auf dem Boden. Obwohl der Mann drei gebrochene Rippen und zahlreiche Blutergüsse am Brustkorb aufwies, wurde als offizielle Todesursache Tod durch Erdrosseln protokolliert – sein Kopf steckte in einer Plastiktüte, die am Hals mit Isolierband umwickelt war. Außerdem hatte der Mörder offenbar im letzten Augenblick beschlossen, die Wirkung des Bandes durch ein von der Decke gerissenes Stück Kabel zu verstärken. Damit das Opfer nicht schreien konnte, hatte man ihm zuvor Werg in den Mund gestopft.
Zunächst einmal galt es, die Identität des Opfers festzustellen – der Mann war allein im Lokal erschienen und trug keinerlei Ausweispapiere bei sich. Und keiner erinnerte sich, dass er seinen Namen erwähnt hätte. Seine Ankunft war allerdings durchaus wahrgenommen worden: »Na klar ist mir der aufgefallen. So wie der gekleidet war, und die weißen Haare dazu – das muss ein Priester sein, hab ich mir gesagt«, erinnerte sich José Luis Mandujano, der Wirt, als ich mich Jahre danach mit ihm unterhielt. Zu der Zeit versuchte ich, das Verbrechen Schritt für Schritt zu rekonstruieren. Hinter der Theke verschanzt, beantwortete Mandujano meine Fragen und hackte dabei mit demselben Picker auf einen Eisklotz ein, den er auch am fraglichen Nachmittag zu diesem Zweck verwendet hatte. »Allerdings passierten an dem Tag am laufenden Band komische Sachen. Dass da ein Pfarrer zur Tür reinkam, war schon nichts Besonderes mehr.«
Wohl wahr – am 20. Mai 2001 herrschte in der gesamten Gegend der Ausnahmezustand, schließlich sollte Santos Laguna, die heimische Fußballmannschaft, zum zweiten Mal in ihrer Geschichte um den Titel spielen. Als der Schiedsrichter die Partie um Viertel vor sechs abpfiff, war der Mann, der später als Farid Sabag identifiziert werden sollte, bereits tot. Als er eine Dreiviertelstunde zuvor die Kneipe betreten hatte, schien in der ganzen Stadt das Leben stillzustehen, auf den leer gefegten Straßen blinkten einsam die Ampeln vor sich hin, während aus allen Häusern die Stimme des Reporters hallte, der Pässe, Torschüsse und Torwartparaden kommentierte.
»Es war wie in einer Geisterstadt. Für die Leute gab es bloß noch dieses Fußballspiel«, beschrieb es Francisco »el Chino« Woo, damals der örtliche Polizeichef, Jahre später. »Aber mir war klar, dass das nur die Ruhe vor dem Sturm war. Ich hatte vier schlaflose Nächte hinter mir und wollte bloß, dass dieses verfluchte Spiel vorbeigeht.« Woo war es auch, der mir damals – ich wollte das Herumstochern in den Spuren jenes bitteren Sonntags schon aufgeben – den Bericht des Gerichtsmediziners besorgte, in dem es unter anderem heißt, bei rechtzeitigem Eingreifen hätte das Opfer gerettet werden können.
»Das war gar nicht so einfach, verstehen Sie. An dem Tag waren wirklich alle im Einsatz, selbst die Polizeihunde«, sagte Woo zur Erklärung auf meine Frage, warum auf den Notruf hin nur ein einziger Polizist am Tatort erschienen war, obwohl in solchen Fällen mindestens zwei Beamte vorgeschrieben waren. Er habe zu diesem Zeitpunkt – das Spiel war da noch nicht zu Ende – mehr als genug damit zu tun gehabt, dafür zu sorgen, dass es nicht zu Ausschreitungen kommt. Die Stimmung in der Stadt war in der Tat äußerst angespannt. Wer etwas von Fußball verstand, sagte dem Team von La Laguna eine Niederlage voraus. Außerdem hatte ein Vorfall im Hinspiel, drei Tage zuvor in Pachuca, die Lage zusätzlich aufgeheizt: In der 85. Minute hatte der Schiedsrichter zu Unrecht einen Elfmeter gegen Santos verhängt, was zur Niederlage der Mannschaft geführt hatte. Spieler wie Fans von Santos fieberten folglich im Rückspiel einer Revanche entgegen.
Aber selbst wenn dem Verein die Aufholjagd gelang und er doch noch den Titel gewann, waren die Aussichten für die Ordnungskräfte alles andere als rosig. Als Santos fünf Jahre zuvor zum ersten Mal den Titel geholt hatte, waren die Feiern vollkommen aus dem Ruder gelaufen. Im Siegestaumel hatten die Fans Straßen blockiert, Geschäfte geplündert und zahllose Unfälle verursacht. So war dieses Mal alles Erdenkliche vorgekehrt worden, um einer Wiederholung solcher Vorfälle vorzubeugen.
Auf Anordnung des Bürgermeisters hatte Polizeichef Chino Woo sechshundertdreißig Beamte auf den Straßen und an strategisch wichtigen Orten der Stadt postiert, weitere zweihundertfünfzig im und um das Stadion. Im Einsatz waren zudem neunzig Funkstreifenwagen der Stadtpolizei, zehn der Schutzpolizei und dreiundzwanzig der Verkehrspolizei sowie dreißig Beamte auf Motorrädern, zwanzig auf Fahrrädern und fünf Angehörige der Hundestaffel. Nach Ansicht des pensionierten Richters und Vaters der Zwillinge Bernardo Ayala führten die übertriebenen Vorsichtsmaßnahmen jedoch nur dazu, die Arbeit der Polizei zu erschweren: »Der Chino hat mal wieder das Kind mit dem Bad ausgeschüttet. Es hat schon seinen Grund, dass manche ihn Captain Neandertal nennen. Damit auch ja niemand gegen irgendwelche Gesetze verstößt, hat er selbst Gesetze gebrochen«, begründete Ayala seinen Vorwurf. »Drei Tage vor dem Spiel hat er seine Leute losgeschickt, sie sollten überall sämtliche Sprühdosen mit Kunstschnee oder grüner oder weißer Farbe einkassieren … Wo gibts denn so was? Dürfen die Leute jetzt nicht mal mehr in Ruhe ihren Geschäften nachgehen? Die verdienen damit schließlich ihren Lebensunterhalt! Feiern ist doch nicht verboten! Er hat den Händlern einfach ihre Ware abgenommen, als wären es Drogen oder Waffen.«
Nach übereinstimmender Aussage der Kneipengäste trafen der Mörder und sein Opfer nur wenige Minuten nacheinander ein. Ein Zeuge, der damals neunzehn Jahre alte Student Pablo García Pescador, gab zu Protokoll: »Als der weiß gekleidete Typ erschien, hatte gerade die Halbzeitpause angefangen. Er hat sich an den Tisch neben meinem gesetzt. Kurz danach ist der junge Mann reingekommen, der in Schwarz. Er hat sich zu ihm gesetzt. Streit schienen sie keinen zu haben, es sah eher aus, als wollten sie ein Geschäft besprechen, wahrscheinlich ging es um das Bild.« Dann wurde die zweite Halbzeit angepfiffen, und García Pescador wandte sich wieder dem Spiel zu. Als Sabag jedoch plötzlich das Ölgemälde vom Tisch fegte, das der andere mitgebracht hatte, blickte García Pescador erneut zu den beiden hinüber.
Was den Streit auslöste, konnte die Polizei bis zuletzt nicht klären. Im Untersuchungsbericht wird jedoch darauf hingewiesen, dass die Auseinandersetzung nicht allzu heftig war, fiel doch, abgesehen von dem in der Tat nicht gerade zimperlichen Umgang des weiß gekleideten Mannes mit dem Ölbild, keinem der Kneipengäste etwas Besonderes auf. Vielleicht hätte sich die Tragödie aufhalten lassen, doch das plötzliche Interesse an Sabags Verhalten wurde vom Jubelgeschrei über den Treffer durch Mariano Trujillo verdrängt, der die Santos-Anhänger erneut hoffen ließ, ihrem Verein könne der zweite Titelgewinn doch noch gelingen. Dieses Tor ist schon deshalb von Belang, weil dadurch mit Sicherheit gesagt werden kann, dass Farid Sabag um 17.13 Uhr zum letzten Mal lebend gesehen wurde.
Nach meinen Unterhaltungen mit allen Zeugen, die ich so lange nach den Geschehnissen noch auftreiben konnte, und gründlicher Durchsicht aller Vernehmungsprotokolle glaube ich, behaupten zu können, dass die Teile dieses Puzzles sehr wohl zusammenpassen, was allerdings, außer dem Mörder, niemandem aufgefallen zu sein scheint. So hat offenbar keiner der Anwesenden mitbekommen, dass der Mörder und sein Opfer irgendwann vom Tisch aufstanden. Auch dass der Täter die Kneipe völlig unbehelligt verlassen konnte, ist erstaunlich, ebenso die Tatsache, dass in einem Lokal voller trinkender Gäste mehr als zwanzig Minuten lang niemand sonst die Toilette aufsuchte. Nachvollziehbar wird all dies jedoch, wenn man bedenkt, dass die Aufmerksamkeit von 17.00 Uhr bis 17.47 Uhr durch das Fußballspiel in Beschlag genommen war, ein Spiel, über dessen Einzelheiten Fachleute wie Fans bis heute erbittert streiten.
Der Student García Pescador entdeckte schließlich die Leiche. Erzählte er zumindest am Telefon, als ich ihn in Barcelona anrief, wo er heute lebt: »Es war schon in der Nachspielzeit, und es stand insgesamt unentschieden, es sah also ganz danach aus, dass es in die Verlängerung gehen würde. Für uns war das gut, den Spielern vom Pachuca merkte man nämlich an, dass sie allmählich schlappmachten. Da bin ich aufgestanden und auf die Toilette gegangen – wie gesagt, ich war mir sicher, dass es eine Verlängerung geben würde. Komischerweise war die Tür abgeschlossen. Ich bin also zum Wirt und hab gesagt, er soll aufschließen.«
Mandujano, der wie gebannt auf den Fernseher starrte, jagte García Pescador zum Teufel: »Draußen stehen jede Menge Bäume, such dir einen aus.«
Eigentlich gab es gar keinen Schlüssel für die Toilette, wie der Untersuchungsbericht vermerkt. Verschließen ließ sich die Tür nur, indem man auf einen kleinen Knopf am Knauf drückte, und genau das hatte der Mörder vor seinem Verschwinden getan. Wer sich mit dieser Art Schlössern auskennt, weiß, dass man sie mit einem Nagel, einem Stück Draht oder einer langen Nadel ziemlich einfach öffnen kann. Da García Pescador nicht lockerließ, ließ Mandujano das Spiel für einen Moment Spiel sein und öffnete die Tür mit seinem Eispicker. Das muss um 17.47 Uhr gewesen sein, denn – das bestätigt der offizielle Spielbericht – genau in diesem Augenblick hörten die Leute in der Kneipe genau wie Tausende Fans in der gesamten Region den Pfiff des Schiedsrichters. Es handelte sich jedoch nicht um den allseits erwarteten Schlusspfiff. Vielmehr hatte der Schiedsrichter soeben einen Elfmeter gegen Santos Laguna verhängt.
Um 17.51 Uhr erreichte Polizeichef Woo dann der Funkspruch, er solle einen Streifenwagen zur Ecke Calle Hidalgo und Calle Donato Guerra schicken – ein anonymer Anrufer habe mitgeteilt, ein Mann sei dort in der Kneipe ermordet worden. Obwohl Woo sich in diesem Augenblick beim Denker-Brunnen befand, also bloß dreihundert Meter vom Tatort entfernt, beschloss er, sich nicht von der Stelle zu rühren, schließlich war ihm da bereits klar, dass ihm die längste Nacht seines Lebens bevorstand. Er saß in seinem Streifenwagen und sah alles kommen: drängelnde Menschenmassen, heulende Polizei- und Krankenwagensirenen, durchdrehende Autofahrer, Unfälle, Überfälle, Schlägereien. Er wusste, dass er und seine Leute in den nächsten Stunden vollkommen überfordert wären. Dass obwohl um ihn herum noch alles ruhig war, schon bald der Lärm von Hupen und Motoren die Straßen erfüllen würde. Er hörte sie bereits, die erhitzten und wütenden Fans, die in Richtung Denker-Brunnen, Bulevar Independencia und Calzada Colón drängten, in grüner Kleidung, natürlich, aber nicht mehr mit Fahnen oder Spraydosen in den Händen, sondern mit Steinen, Stangen und Ketten.
Die Tränen von San Lorenzo I
Die Spur der Niña
Als er abbiegen will, entdeckt Pepe Zamora im Rückspiegel den silbergrauen Ford Ranger – damit fährt sichs bestimmt bequemer als in seinem gebrauchten Datsun. Kurz darauf biegen beide Autos in die Nebenstraße ein, am Himmel ist nicht eine Wolke zu sehen. Ein Plakat erinnert Zamora daran, dass er sich im LAND DER GUTEN FREUNDE UND WEINE befindet. Sein Bauch reagiert mit leisem Stechen, die Hände fangen an zu schwitzen. Er war schon oft hier, aber noch nie, wenn zur Weinernte das San-Lorenzo-Fest gefeiert wird. Immer mit der Ruhe, Pepe, du bist wegen was anderem unterwegs. Oder willst du kneifen? Zeig diesem Camargo, dass du noch nicht zum alten Eisen gehörst. Na gut, einmal hast dus verkackt, aber so schlimm war das auch wieder nicht. Die werden schon sehen, was sie an dir haben.
Die Geschichte mit dieser Niña hat hier in der Gegend voll eingeschlagen. Fast in jeder Familie hat sie etwas Wichtiges vorhergesagt, jemanden geheilt oder vor der Missernte bewahrt. Aber von Beweisen keine Spur. Woher stammte die Niña? Wie war ihr richtiger Name? Was hatte sie vorher gemacht? Niemand weiß Genaueres. Schon seit vier Monaten fragt Zamora überall herum. Ein bisschen was hat er allerdings inzwischen zusammentragen können. Der jungen Frau war scheinbar seit jeher der Tod auf den Fersen. Sie verlor schon früh ihre Eltern und wurde von einer Frau großgezogen, die sie als ihre Patin bezeichnete – auch diese Patin starb offenbar eines gewaltsamen Todes. Offen bleibt, wie und wann genau die Niña starb. Hat man sie wirklich geschlagen und vergewaltigt? Gibt es einen Zusammenhang zwischen ihrem Verschwinden und der Plünderung der Kirche? Zamora hält das für ziemlich wahrscheinlich, allerdings stellt sich dann die Frage, warum man sie in Viesca begraben hat, also fast siebzig Kilometer von dort, wo sie zum letzten Mal gesehen wurde. Welche Rolle spielt der junge Mann, dieser Borrado, wie ihn die Leute nennen? El Borrado, der Verwischte, Verhuschte, Ungreifbare – wirklich mal ein passender Spitzname. Und warum wurde die Leiche zurückgebracht? Den Blick starr auf die Straße gerichtet, tastet Zamora nach dem Tonbandgerät, schaltet es an, und eine Stimme erfüllt das Wageninnere.
»… also ich war damals grad beim Dattelernten. Auf einmal hab ich gesehen, dass ein Auto auf den Feldweg abbiegt und Richtung Salzmine fährt. Solche Autos kriegst du hier fast nie zu sehen, erst recht nicht aufm Feldweg. Lang und glänzend, wie die Kakerlaken, die rauskommen, wenns regnet. Man soll den Leuten ja nicht nachspionieren, ich weiß, aber ich fand das wirklich komisch – was wollen die Leute dort, vor allem, wenn sie nicht von hier sind?«
»Vielleicht waren es Touristen, die sich verfahren hatten.«
»Hab ich auch gedacht, aber dann hab ich gesehen, dass das Auto auf einmal angehalten hat, mitten in der Prärie, gleich bei den Dattelpalmen. Ganz nah bei mir, ich hab gedacht, die haben mich gesehen, und jetzt fragen sie, wos nach Viesca geht. Aber nee, die haben mich nicht gesehen, da hab ich total Glück gehabt, wer weiß, was passiert wär, wenn doch …«
»Wieso?«
»Weil er dabei war.«
»Wer?«
»Der Borrado. Er wollte die Niña mitnehmen. Als er aus dem Auto raus ist, hab ich sein Gesicht gesehen, total ernst, und mit diesen schleimig grünen Augen. Er war mit noch wem unterwegs, genau so ’ne Type wie er. Dem sein Gesicht hab ich nicht gesehen, aber das vom Borrado schon. Sie sind ausgestiegen und haben angefangen zu graben. Das heißt, gegraben hat er, aber gar nicht besonders tief, und der andere hat derweil eine Sporttasche aus dem Auto geholt. Er hat bloß hier ein bisschen gekratzt, und noch ein bisschen da, und schon hat er gefunden, was er gesucht hat. Und was er gesucht hat, war sie, das heißt das, was noch von ihr übrig war.«
»Von wem?«
»Wie von wem? Von der Niña! Sie habens so eilig gehabt, da haben sie das hier verloren.«
Nach diesen Worten hatte der Mann etwas aus einer Plastiktüte geholt und es dem Journalisten gezeigt: ein angesengter weißer Stofffetzen.