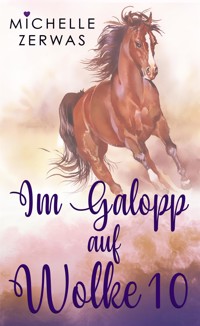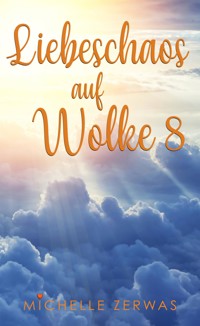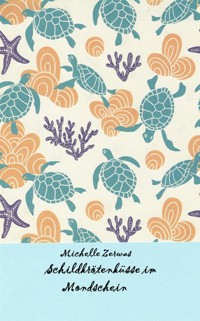4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sophie wird von einem Kindermädchen aufgezogen, da ihre Eltern aus beruflichen Gründen keine Zeit haben. Das behaupten sie immer wieder. Doch in Wahrheit ist Sophie ihren Eltern ziemlich egal. Zwar bekommt sie alles was sie möchte, besucht die besten Schulen, weil ihre Eltern sehr reich sind, aber mit Geld kann man eben die Liebe der Eltern nicht ersetzen. Schon früh wird Sophie von einer Schule zur anderen geschickt, weil sie immer wieder mit ihren Mitschülern oder den Lehrern aneinander gerät. Schließlich lernt sie auf einer dieser Schulen ihre Französischlehrerin Cecile de Maron kennen und verliebt sich in sie. Sophie versucht immer wieder ihrer Lehrerin näher zu kommen. Das Verhältnis der beiden wird mit der Zeit immer enger und freundschaftlicher und eines Tages kann auch Cecile die Gefühle für ihre Schülerin nicht mehr verleugnen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Die verbotene Liebe einer Schülerin
BookRix GmbH & Co. KG81371 München1. Kapitel
Die Bäume, Felder, Wolken und Menschen flogen nur so an mir vorbei. Zeitweise klatschte der Regen gegen die Fensterscheibe. Dann blendete mich grelles Sonnenlicht.
Ich sah Feldarbeiter auf den Feldern. Sie hatten kurze Hosen an und ihre Shirts klebten ihnen am Körper. Kühe grasten auf den Weiden. Sie kauten gelangweilt an einem Büschel Gras.
Die Straße zog sich endlos lang vor uns her. Im Moment war weit und breit kein anderes Auto zu sehen. Wir waren allein! Ich war allein! Wie immer!
Ich saß in der Limousine meines Vaters. Mein Vater saß vorne am Steuer. Auch wenn er nichts sagte, wusste ich, dass er an seine Arbeit dachte. Er war so in Gedanken versunken, dass es mich wunderte, dass er sich bis jetzt noch nicht verfahren hatte. Na ja, er brauchte bloß auf die Ansage des Navis zu achten. Auch meine Mutter war mit im Auto. Sie saß auf dem Beifahrersitz und sah die ganze Zeit stur und beinahe bewegungslos aus dem Fenster. Es wunderte mich, dass sie noch keinen steifen Hals hatte. Auch meine Mutter dachte wohl über ihre Arbeit nach.
Während der ganzen bisherigen Autofahrt, die immerhin schon fünf Stunden dauerte, hatten meine Eltern kein einziges Wort gesprochen. Ich fragte mich, wie man so lange schweigen und über seine Arbeit nachdenken konnte.
Mein Vater war Chef einer Bank mit über hundert Filialen und meine Mutter war Chefin eines großen Mode- und Kosmetikimperiums. Ich dagegen war meinen Eltern nur lästig. Ein nutzloses Anhängsel, das es galt los zu werden.
Meine Mutter war mit zwanzig Jahren schwanger geworden. Zuerst wollte sie die Schwangerschaft verheimlichen und mich abtreiben lassen, aber dann war es durch einen dummen Zufall raus gekommen und da meine Großeltern streng katholisch erzogen worden waren und das auch an meine Mutter weiter gegeben hatten, wurde meine Mutter gezwungen mich zur Welt zu bringen. Von Anfang an bekam ich zu spüren, dass ich nicht erwünscht war.
Kaum war meine Mutter aus dem Krankenhaus entlassen worden, engagierte sie für mich ein Kindermädchen. Mein Kindermädchen hieß Lilly und war kaum älter als meine Mutter. Lilly liebte mich wie eine eigene Tochter. Meine Eltern dagegen hatten nur ihre Arbeit im Kopf. Sie waren so oft auf Geschäftsreise, dass ich die Tage, die sie zu Hause verbrachten, an einer Hand abzählen konnte.
Lilly brachte mir alles bei, was normalerweise Aufgabe der Eltern war. Lilly spielte mit mir, machte das Essen für mich, gab mir die Flasche, später fütterte sie mich und brachte mir auch bei alleine zu essen. Lilly war meine Bezugsperson und so war es kaum verwunderlich, dass ich sie schon bald „Mama“ nannte. Als ich etwas älter war, erklärte Lilly mir, dass sie nicht meine leibliche Mutter ist. Das war ein echter Schock für mich, denn meine leibliche Mutter kannte ich fast nur von Fotos, so selten war sie zu Hause.
Nicht einmal an Weihnachten waren meine Eltern zu Hause und für mich da. Ich erinnere mich noch an ein Weihnachtsfest. Damals war ich gerade mal fünf Jahre alt. Meine Eltern hatten ihre Geschäfte an Heiligabend geschlossen. Sie kamen allerdings nur ganz kurz nach Hause. Meine Mutter strich mir zur Begrüßung kurz über den Kopf. Mein Vater alberte ein wenig mit mir herum. Dann verschwanden sie beide im Schlafzimmer. Ich wollte mit ins Zimmer, aber mir wurde die Tür vor der Nase zugeschlagen. Ich wollte die Tür öffnen, aber sie war von innen verschlossen worden. Ich schrie und hämmerte mit meinen kleinen Fäusten gegen die Tür. Als das nicht half, trat ich so fest gegen die Tür, dass ich mir fast die Zehen dabei brach.
Schließlich kam Lilly. Sie sah schockiert aus, nahm meine Hand und brachte mich weg. Sie ging mit mir ins Wohnzimmer und schmückte den Tannenbaum mit mir. Das lenkte mich ein wenig ab.
Nach einer guten Stunde kamen meine Eltern ins Wohnzimmer. Sie sprachen kurz mit Lilly. Ich verstand nicht, worum es ging. Ich hörte nur etwas von Urlaub und Geschenken. Kurz darauf verließen meine Eltern das Wohnzimmer. Ich wollte ihnen hinterher rennen, aber Lilly hielt mich zurück.
„Bleib hier, wir müssen den Baum doch noch fertig schmücken“, sagte sie.
Ich rannte zur geschlossenen Wohnzimmertür. Es dauerte lange, bis ich sie aufgezogen hatte, denn die Tür war aus Holz und sehr schwer. Ich schlüpfte durch den entstandenen Türspalt und sah gerade noch wie sich die Haustür hinter meinen Eltern schloss. Zuerst versuchte ich auch noch die Haustür zu öffnen, aber ich merkte schnell, dass es mir nicht möglich war. Ich rannte zurück ins Wohnzimmer. Dort befand sich ein riesiges Fenster, das einen Blick in die Einfahrt ermöglichte. Ich sah meine Eltern. Sie luden die gepackten Koffer ins Auto und stiegen ein. Sie sahen kein einziges Mal zum Haus zurück und bemerkten mich nicht, wie ich am Fenster stand und mich nach ihnen sehnte.
Mir stiegen Tränen in die Augen. „MAMA, PAPA!“, rief ich verzweifelt.
Ich hämmerte ans Fenster und hoffte, meine Eltern würden noch mal aus dem Auto aussteigen und zu mir zurückkommen, aber das taten sie nicht. Stattdessen starteten sie den Motor und fuhren davon. Ich blieb weinend zurück.
Lilly kam zu mir. Sie gab mir ein Taschentuch und ein Geschenk. Ich wischte mir die Tränen weg und zog geräuschvoll die Nase hoch. Dann nahm ich das Paket genauer in Augenschein. Es war groß und mit buntem Papier umwickelt. Ein breites blau glitzerndes Band hatte man um den Karton gewickelt und eine große Schleife damit gebunden.
„Was ist da drin?“, fragte ich.
„Mach es doch einfach auf“, sagte Lilly mit sanfter Stimme.
Ich riss das bunte Papier ab und verschönerte den Fußboden damit.
In dem Päckchen befand sich ein großer dunkelbrauner Teddybär. Ich drückte den Teddy an mich, dann warf ich einen letzten traurigen Blick aus dem Fenster und lief zurück zum Tannenbaum.
„Lilly, komm!“, rief ich und griff nach einem selbst gebastelten Stern aus Papier, mit dem ich den Weihnachtsbaum verschönerte.
Wir schmückten den Baum zu Ende. Danach gingen wir in die Küche.
„Was willst du denn heute Abend essen, Sophie?“, fragte Lilly.
„Schokopudding und Pommes…“, rief ich. Wenn es ums Essen ging, unterschied ich mich kaum von anderen Kindern.
„Dann müssen wir noch einkaufen gehen.“
Lilly zog mich warm an und fuhr dann mit mir zum Einkaufszentrum. Dort war natürlich die Hölle los. Jeder wollte noch das ein oder andere besorgen. Lilly und ich kämpften uns durch das Gedränge und spielten zwischen den Regalen Verstecken, was uns viele missbilligende Blicke der anderen Kunden einbrachte.
Als wir schließlich wieder zu Hause waren, durfte ich Lilly beim Kochen helfen. Lilly stellte einen Stuhl vor den Herd, damit ich den Schokoladenpudding rühren konnte, während sie die Pommes in den vorgeheizten Ofen schob.
Als alles fertig war, deckten wir gemeinsam den Tisch. Ich nahm vier Teller aus dem Schrank.
„Sophie, wir brauchen doch nur zwei Teller.“
„Nein, Mama und Papa haben auch Hunger.“ Ich war fest davon überzeugt, dass meine Eltern nur kurz weg gefahren waren.
„Deine Mama und dein Papa kommen heute nicht“, erklärte Lilly.
„Warum?“
„Sie machen eine Reise. Einen Ausflug. Erinnerst du dich, das haben wir beide auch schon gemacht.“
Ich erinnerte mich noch gut daran. Lilly und ich waren im vergangenen Herbst eine Woche auf einem Bauernhof gewesen.
„Wann kommen sie wieder zurück?“, wollte ich wissen.
„Bald, aber nicht heute.“
„Ich will aber, dass Mama und Papa zurückkommen“, schrie ich und fing wieder an zu weinen.
Lilly nahm mich in den Arm und versuchte mich zu trösten. Ich wollte mich aber nicht beruhigen. Immer wieder wurde ich von neuen Schluchzern geschüttelt.
Ich weinte und weinte und weinte, fast eine Stunde lang. Erst dann waren keine Tränen mehr übrig. So kam es mir jedenfalls vor.
Das Essen war in der Zwischenzeit kalt geworden. Lilly wärmte es schnell wieder auf. Um mich nicht wieder zum Weinen zu bringen, hatte Lilly eine Idee. Sie ließ die beiden überflüssigen Teller auf dem Tisch stehen und stellte ein Foto von meinen Eltern auf den jeweiligen Teller.
„So, jetzt sind deine Mama und dein Papa trotzdem irgendwie bei dir“, sagte Lilly.
Ich strahlte. Kinder sind ja manchmal so leicht zufrieden zu stellen.
Wenn ich damals gewusst hätte, dass meine Eltern keinen Gedanken an mich verschwendeten…
Es wurde trotz allem ein schönes Weihnachtsfest. Nach dem Essen zündeten wir Kerzen an und sangen Weihnachtslieder, die uns einfielen. Danach packte ich die Geschenke aus. Es waren fast hundert Pakete mit dem neuesten Spielzeug. Damit wollten meine Eltern ihr Gewissen beruhigen. Ich wusste nicht, womit ich zuerst spielen sollte.
Während ich mit dem Auspacken beschäftigt war, erledigte Lilly den Abwasch.
Den 1. und 2. Weihnachtstag verbrachte ich damit mein neues Spielzeug auszuprobieren. Lilly spielte auch mit. Dabei vergaß ich meine Eltern und meine Traurigkeit.
Am Silvesterabend sah ich mir mit Lilly das Feuerwerk an.
Ich wollte auch Knaller zünden, aber Lilly weigerte sich, weil sie Angst davor hatte, die Knaller anzuzünden. Aber auch so war Silvester ein tolles Ereignis. Mit großen Augen bestaunte ich die bunt glitzernden Funken, die am dunklen Nachthimmel leuchteten.
Meine Eltern kamen erst lange nach Silvester zurück von ihrer Reise. Ihre Ankunft verlief ähnlich wie die Abreise. Meine Mutter beachtete mich nicht und mein Vater redete nur ganz kurz mit mir, behandelte mich jedoch wie eine Fremde und nicht wie seine eigene Tochter. Dann gingen sie ins Schlafzimmer, um ihre Koffer auszupacken. Nur um sich danach sofort wieder in ihre Arbeit zu stürzen und mich zu vergessen.
Bevor meine Eltern das Haus verließen, hielt Lilly sie zurück. „Wie lange soll das eigentlich noch so weiter gehen?“, fragte sie.
„Ich weiß nicht, was Sie meinen“, sagte meine Mutter schnippisch.
„Sophie hat den ganzen Tag geweint, als sie vor einigen Wochen weg gefahren sind. Sie sollten etwas mehr Zeit mit Ihrer Tochter verbringen.“
„Das sollten Sie schon mir überlassen. Ich wüsste nicht, was Sie das angeht.“
„Das geht mich eine ganze Menge an“, verteidigte sich Lilly. „Sophie liegt mir sehr am Herzen und ich kann es nicht ertragen, wenn das Kind leidet.“
„Halten Sie sich aus meinem Leben raus!“, rief meine Mutter. „Sie haben eine Aufgabe, für die sie gut bezahlt werden und wenn Sie die nicht erfüllen, ohne mich als Rabenmutter hinzustellen, dann suche ich mir ein anderes Kindermädchen.“
„Damit würden Sie Sophie das Herz brechen.“
„Das ist dann nicht mehr Ihr Problem.“
Um meine Mutter nicht noch wütender zu machen, ließ Lilly die Sache auf sich beruhen. Sie wollte mich nicht im Stich lassen.
Danach kam Lilly zu mir, um mich so lange abzulenken, bis meine Eltern abgefahren waren.
Von da an sah ich sie wieder nur ganz selten. Meine Eltern stürzten sich in ihre Arbeit und jetteten in der ganzen Welt herum.
Ein gutes halbes Jahr später wurde ich eingeschult. Auch bei meiner Einschulung waren meine Eltern nicht dabei. Einen Tag vor meiner Einschulung fuhr ich mit Lilly ins Einkaufszentrum. Dort suchten wir ein Kleid für mich aus. Lilly wollte mir ein Kleid mit Blumenmuster kaufen, aber ich wusste auch mit sechs Jahren schon ganz genau, was ich wollte. Ich entschied mich für ein dunkelblaues glitzerndes Kleid, das mir ein wenig zu lang war.
„Sophie, das Kleid passt nicht zu einer Einschulung“, meinte Lilly.
Doch ich war mir meiner Sache sicher. Wir fuhren zu einer Schneiderei, um das Kleid ändern zu lassen. Das war soooo langweilig. Ich musste die ganze Zeit still stehen, während eine Frau an meinem Kleid herum fummelte.
„Lilly, wann kann ich denn endlich gehen?“, fragte ich irgendwann jammernd.
„Gleich. Hab noch ein wenig Geduld.“
Die Schneiderin sah uns etwas verwirrt an. Sie fragte sich wahrscheinlich, warum ich Lilly nicht Mama genannt hatte.
Nach zwei Stunden waren wir endlich fertig.
„So, jetzt kannst du mit deiner Schwester wieder nach Hause fahren“, sagte die Schneiderin.
„Ich bin nicht ihre Schwester“, antwortete Lilly lächelnd.
„Dann sind Sie also die Mutter?!“
„Nein, auch nicht. Ich bin das Kindermädchen.“
„Die armen Kinder heutzutage“, sagte die Schneiderin. Dann wandte sie sich an mich. „Ich wünsche dir viel Spaß mit deinem Kleid.“
Ich hörte kaum zu. Ich hatte nur einen Gedanken: „Raus hier.“
Am nächsten Morgen wurde ich früh geweckt. Daran war ich überhaupt nicht gewöhnt. Lilly hatte immer gewartet, bis ich von selbst wach wurde.
Heute stand Lilly schon um 7:00 Uhr an meinem Bett und weckte mich.
„Sophie aufstehen“, sagte Lilly und rüttelte mich sanft an der Schulter.
„Ich bin aber noch müde“, murmelte ich.
„Du musst aber aufstehen. Wir gehen doch gleich in die Schule.“
„Ich will aber noch schlafen.“
Lilly hatte viel Geduld mit mir. Es dauerte fast eine halbe Stunde, bis ich endlich aufstand.
„Jetzt müssen wir uns aber beeilen“, sagte Lilly. Sie nahm mich an der Hand und ging mit mir nach unten in die Küche. Sie bestrich ein Brot für mich und kochte mir einen Tee.
Lilly selbst aß nichts. Heute weiß ich, dass sie vor Aufregung nichts essen konnte.
Nach dem Frühstück ging Lilly auch sofort wieder mit mir nach oben, damit ich mich umziehen konnte.
Ich schlüpfte in mein dunkelblaues glitzerndes Kleid, das wie angegossen passte. Danach bürstete Lilly meine langen braunen Haare und flocht sie zu einem Zopf. Kurz darauf machten wir uns mit dem Auto auf den Weg zur Schule.
Der Schulhof war voller Leute, was mich irgendwie beunruhigte.
„Können wir nicht einfach wieder gehen?“, fragte ich.
Lilly lachte. „Sophie, das geht nicht.“
Wir gingen in die Sporthalle. Dort standen hunderte Stühle, auf denen vereinzelt schon Leute saßen. Auch Lilly und ich setzten uns hin.
Die Halle füllte sich immer mehr und endlich begann die Einschulungsfeier.
Zuerst wurde uns ein abwechslungsreiches Programm geboten. Die älteren Schüler trugen Gedichte vor und sangen Lieder. Der Direktor hielt eine lange Rede, die mich herzlich wenig interessierte. Dann erst begann der spannende Teil. Drei Lehrerinnen betraten die Bühne. Die Erste war noch ziemlich jung, hatte lange schwarze Haare und sah sehr nett aus. Die Zweite war etwas älter, hatte dunkelbraune Haare mit ein paar grauen Strähnen. Sie sah ebenfalls sehr nett aus. Die dritte jedoch hatte graue Haare, die am Hinterkopf zu einem Knoten zusammengefasst waren. Sie sah alt und sehr streng aus. Sowohl Lilly, als auch ich hofften, dass sie nicht meine Klassenlehrerin wurde. Eine weitere halbe Stunde später wurde ich ausgerechnet von der alten grauen Lehrerin aufgerufen. Zitternd ging ich hoch auf die Bühne und gesellte mich zu meinen zukünftigen Mitschülern. Als alle Schüler aufgerufen worden waren, mussten wir uns alle in Zweierreihen aufstellen und unserer neuen Lehrerin in die Klasse folgen. Dort durften wir uns alle einen Platz suchen.
„Ich freue mich euch hier begrüßen zu dürfen“, stellte sich die Lehrerin vor. „Mein Name ist Frau Tonke.“
Anschließend mussten wir uns vorstellen. Zum Schluss sollten wir ein Mandala ausmalen.
Dann wurden wir von unseren Eltern abgeholt.
Zuhause stürzte ich mich sofort auf mein Spielzeug. Lilly ließ mich fürs Erste in Ruhe.
Mein erster richtiger Schultag war voller Überraschungen. Meine Tischnachbarin Sally war sehr nett. Ich verstand mich auf Anhieb mit ihr. Dagegen war Frau Tonke sehr streng. Sie ließ nicht das Geringste durchgehen.
Die Hausaufgaben bereiteten mir große Probleme. Ich hatte nie Lust meine Hausaufgaben zu machen. Lilly musste mich jeden Mittag aufs Neue dazu überreden. Oft war es ein einziger Kampf.
Fast jeden Morgen weigerte ich mich zur Schule zu gehen. Ich wollte den Morgen viel lieber, wie bisher, zusammen mit Lilly verbringen. Doch Lilly lieferte mich jeden Morgen gegen meinen Willen in der Klasse ab. Es dauerte auch nicht lange und ich bekam den ersten Brief mit nach Hause. Dort stand drin, dass ich im Unterricht unaufmerksam war und zu viel schwatzte. Lilly erklärte mir, dass ich besser aufpassen müsste und nicht mehr so viel reden sollte.
Ich sah das nicht ein. Schon am nächsten Morgen quatschte ich weiter.
„Sophie, wenn du jetzt nicht still bist, dann wirst du eine Strafarbeit bekommen“, rief Frau Tonke.
Diese Ansage wirkte. Ich war für eine Weile leise. Doch schon bald nutzte ich die Gelegenheit und fing wieder an mit Sally zu reden. Schneller, als ich gedacht hatte, hatte ich meine Strafarbeit an der Backe. Da ich ja noch nicht schreiben konnte, musste ich zusätzlich ein Bild malen.
Die nächsten vier Jahre verliefen mehr oder weniger gut. Ich bekam sehr oft Strafarbeiten auf und hatte schlechte Noten. Meine Hausaufgaben wollte ich nicht machen, ich weigerte mich weiterhin morgens aufzustehen und mit Frau Tonke kam ich nicht zurecht. Immer wieder gerieten wir aneinander.
In diesen vier Jahren kostete ich Lilly wirklich Nerven, aber sie hielt durch und irgendwann lief es einigermaßen. Während der ganzen vier Jahre sah ich meine Eltern etwa zehn Mal und das nur kurz. An ein Treffen erinnere ich mich noch ganz genau. Meine Mutter wollte unbedingt mein Zeugnis sehen. Damals war ich in der dritten Klasse. Lilly reichte meiner Mutter das Zeugnis. Während meine Mutter die Noten las, verfärbte sich ihr Gesicht leicht rot.
„Die Noten sehen nicht besonders gut aus“, meckerte meine Mutter.
„Wenn Sie wüssten welche Probleme ich mit Sophie habe. Sie will nicht zur Schule. Sie will keine Hausaufgaben machen. Sie hat dauernd Stress mit ihrer Klassenlehrerin.“
„Sie sind nicht streng genug. Wenn das nächste Zeugnis nicht besser ist, werde ich Sie entlassen. Sie werden gut bezahlt, also tun Sie gefälligst auch was dafür.“
„Das kann nicht Ihr Ernst sein. Wenn Sie sich mehr um Ihre Tochter kümmern würden, dann würde sie sich vielleicht ruhiger verhalten“, verteidigte sich Lilly.
„Was hat das damit zu tun?“, fragte meine Mutter. „Sie können Ihre eigene Unfähigkeit nicht mir in die Schuhe schieben. Das ist eine Unverschämtheit.“
„Dann wäre Sophie vielleicht ausgeglichener. Außerdem hat sie mich schon gefragt, ob ihre Eltern sie überhaupt noch lieben.“
„Sophies Vater und ich haben unsere Geschäfte zu führen und da muss man als Kind eben Abstriche machen.“
„Das verstehe ich ja auch, aber Sie könnten sich doch wenigstens einmal pro Woche mit Ihrer Tochter beschäftigen. Ist das denn zu viel verlangt?!“
„Was glauben Sie eigentlich, wofür ich Sie bezahle? Sie sollen sich um Sophie kümmern. Wenn ich genügend Zeit dafür hätte, bräuchte ich Sie nicht.“
„Das tue ich, aber ich kann Sophie nicht ihren Vater und gleichzeitig ihre Mutter ersetzen.“
„Es ist mir egal, wie Sie es machen. Für mich ist das Gespräch hiermit beendet.“
Mit diesen Worten verließ meine Mutter das Haus.
Lilly erklärte mir daraufhin, dass ich auf jeden Fall mein Verhalten ändern musste.
„Hör mal Sophie. Deine Mama ist ziemlich böse. Ich wünsche mir von dir, dass du von nun an in der Schule aufpasst und deine Hausaufgaben ordentlich machst. Sonst darfst du mich nicht mehr sehen. Verstehst du das?“
„Nein“, antwortete ich.
Lilly versuchte es weiter. Sie erklärte mir immer wieder, dass ich bessere Noten schreiben und die Hausaufgaben machen musste. Ansonsten müsste Lilly auch weg, genau wie meine Eltern.
Diese Aussicht war nicht gerade verlockend und da ich nicht blöd war, schwor ich mir diesmal wirklich auf Lilly zu hören. Von Lilly wollte ich keineswegs auch noch getrennt werden.
Zwar machte ich von nun an regelmäßig meine Hausaufgaben, aber mit Frau Tonke geriet ich auch weiterhin immer wieder aneinander. Wir lagen einfach nicht auf einer Wellenlänge. Fast täglich gab es Streit zwischen uns. Lilly verbrachte wegen mir manchen Nachmittag in der Schule. Lilly wollte sogar veranlassen, dass ich in eine neue Klasse kam, aber laut Schulleiter war das angeblich nicht möglich. Der Schulleiter wollte nicht einsehen, dass ich mit Frau Tonke nicht klar kam.
Einige Wochen bevor ich die vierte Klasse beendete, besuchte meine Mutter mich. Ich konnte es kaum glauben.
„Ich möchte einmal kontrollieren wie Sie mit Sophie zurecht kommen“, sagte meine Mutter zu Lilly.
„Sagen Sie doch gleich, dass Sie mir kündigen wollen!“, rief Lilly aufgebracht.
„Nein. Wie kommen Sie denn darauf? Ich stehe nur vor der schwierigen Entscheidung, ob ich Sophie ab dem nächstem Schuljahr vielleicht besser in ein Internat schicke oder erst noch ein Jahr abwarten soll, wie sie sich entwickelt.“
„Ich würde Sophie jetzt noch nicht ins Internat schicken“, beschwor Lilly.
„Sie habe ich aber nicht gefragt“, giftete meine Mutter zurück.
2. Kapitel
Am nächsten Morgen begann meine Mutter mit ihren Beobachtungen. Sie hatte überall ihr Klemmbrett dabei und machte sich Notizen. Ich fand das ziemlich bescheuert, aber nach meiner Meinung fragte keiner.
Als Lilly mich weckte, ging es auch schon los. Lilly weckte mich immer sehr sanft und ließ sich Zeit dabei, auch heute.
Meine Mutter sah Lilly ungeduldig zu und schrieb etwas auf ihren Notizzettel.
„Machen Sie das jeden Morgen so?“, fragte meine Mutter.
„Ja natürlich. Haben Sie etwas dagegen?“
„Ja, das habe ich in der Tat. Sie vertrödeln viel zu viel Zeit damit und Zeit ist Geld.“
Lilly wurde sauer und schrie: „Mischen Sie sich nicht in meine Arbeit ein! Bisher hat immer alles funktioniert, so wie ich es gemacht habe. Sophie ist deshalb noch nie zu spät zur Schule gekommen. Das können Sie auch gerne überprüfen.“
„Was fällt Ihnen ein mich anzuschreien?“, rief meine Mutter.
„Was fällt Ihnen ein mich zu kontrollieren? Bisher haben Sie sich nicht um Sophie gekümmert und jetzt wollen Sie meine Arbeit kritisieren?!“
Ich war inzwischen aufgestanden, hatte mich aus dem Zimmer geschlichen und die beiden Streithähne alleine gelassen.
Beim Frühstück ging es auch schon weiter. Wie immer bestrich Lilly mir ein Toast mit Butter.
„Ich denke Sophie ist in der Lage sich ihr Brot selbst zu schmieren“, meinte meine Mutter.
„Ich mache das jeden Morgen“, erwiderte Lilly.
„Dann lassen Sie es von nun an sein. Sophie ist alt genug, um das alleine zu bewerkstelligen.“
„Wie Sie meinen“, gab Lilly klein bei.
Den ganzen Tag ging es wo weiter. Meine Mutter meckerte und gab haufenweise gute Ratschläge. Sowohl ich, als auch Lilly waren froh, als meine Mutter endlich fertig war mit ihrer Kontrolle.
Es dauerte nicht mehr lange und ich wurde aus der Grundschule entlassen. Ich war total froh, endlich von Frau Tonke weg zu kommen. Für unsere Abschlussfeier studierte die Hälfte der Klasse einen Song ein und die andere Hälfte sollte einen Tanz vorführen. Genau wie bei meiner Einschulung, kamen meine Eltern auch nicht zu meinem Abschluss. Um ehrlich zu sein, ich war noch nicht mal wirklich enttäuscht. So langsam war es mir egal, was meine Eltern machten oder nicht machten. Ich war ihnen gleichgültig und so waren sie mir auch egal.
Meine Sommerferien waren ein richtiges Highlight. Ich machte mit Lilly sechs Wochen Urlaub in Frankreich. Leider rasten die Wochen viel zu schnell an mir vorbei. Man glaubt gar nicht, wie schnell die Tage vergehen, wenn man sie am Strand verbringt und die Seele baumeln lässt.
Ich hatte überhaupt keine Zeit richtig zu Hause anzukommen, denn schon einen Tag später kam ich auf meine neue Schule. Meine Eltern erschienen wieder einmal nicht. Sie müssten arbeiten, sagten sie.
Ich war froh, dass ich wenigstens Lilly hatte.
Von meinen neuen und teilweise altbekannten Mitschülern wurde ich gefragt, ob meine Eltern geschieden seien.
„Nein“, sagte ich. „Meine Eltern müssen arbeiten, aber Lilly, mein Kindermädchen, hat mich begleitet.“
„Du hast noch ein Kindermädchen?“, fragte einer meiner Mitschüler abschätzig. Alle die dieses kurze Gespräch mitbekommen hatten, lachten nun über mich. Kinder können untereinander so grausam sein!
„Was ist so schlimm daran ein Kindermädchen zu haben?“, fragte ich.
„Du bist doch kein Baby mehr.“
Ich ließ das nicht auf mir sitzen und diskutierte es bis zum Ende aus.
Meine neue Lehrerin begrüßte mich freundlich. Frau Sommer sah tausendmal netter aus als Frau Tonke. Ich war mir sicher, dass ich mit ihr gut auskommen würde. Trotzdem wurde das Schuljahr für mich ein einziger Spießrutenlauf. Ich wurde von meinen Mitschülern gehänselt und verspottet und weder Lilly noch meine Lehrerin konnten etwas dagegen unternehmen. Sie alle waren machtlos. Meine Eltern waren mir auch keine Hilfe. Es interessierte sie schlichtweg alles nicht.
„Dann lernt sie endlich sich durchzusetzen“, sagte mein Vater und meine Mutter ergänzte: „Sie soll sich nicht so anstellen, schließlich ist sie sonst auch nicht auf den Mund gefallen.“
Ich wurde mehr und mehr zur Einzelgängerin. Wenn ich mich im Unterricht meldete und eine falsche Antwort gab, wurde ich sofort von meinen Mitschülern ausgelacht. Frau Sommer gab deshalb Strafarbeiten auf und verteilte Klassenbucheinträge. Letztendlich machte sie damit aber alles nur noch schlimmer, denn der Ärger darüber wurde an mir ausgelassen. Es kam so weit, dass ich überhaupt nicht mehr zur Schule gehen wollte. Wenn Lilly mich morgens weckte, klagte ich über Kopfschmerzen und Übelkeit. Oft täuschte ich die Symptome nicht nur vor, sie waren wirklich da. Am Ende des Schuljahres standen über 47 entschuldigte Fehltage auf meinem Zeugnis.
Frau Sommer wollte deshalb mit meinen Eltern sprechen, doch die schoben diese Aufgabe wieder Lilly zu. Ich sollte an dem Gespräch teilnehmen. Zu Anfang wandte sich Frau Sommer an mich. „Sophie, du bist wirklich eine sehr liebe und kluge Schülerin und du bist mir in diesem Jahr sehr ans Herz gewachsen, aber ich denke, es wäre besser, wenn du auf eine andere Schule gehen würdest.“ Zuerst war ich von der Idee nicht begeistert, denn ich hatte mich gerade erst an meine neue Schule gewöhnt. Doch Frau Sommer überzeugte mich schließlich davon diesen Schritt zu machen. Die Sommerferien waren schrecklich. Zuerst wurde ich von meinen Eltern dermaßen runter gemacht. Sie stellten mich als Versagerin hin. Dabei waren sie die größeren Versager. Zwar verdienten sie riesige Mengen Geld und konnten mir ein Luxusleben bieten, aber Zeit hatten sie nie für mich. Ich war für sie ein unnötiger Ballast. Außerdem quälte mich der Gedanke an meine neue Schule. Würde es mir dort ähnlich ergehen? Um mich auf andere Gedanken zu bringen, flog Lilly fünf Wochen mit mir nach Frankreich. Aber auch dort konnte ich mich nur teilweise entspannen. Ich lag den ganzen Tag am Strand und grübelte. An meinem ersten Schultag nach den Ferien konnte ich morgens nichts essen. Mir war so schlecht, dass ich fürchtete mich übergeben zu müssen. Doch ich hatte mir umsonst Sorgen gemacht. Meine neue Klassenlehrerin Frau Zink war genauso nett wie Frau Sommer und von meinen Mitschülern wurde ich sehr freundlich aufgenommen. In der Pause wurde ich sofort mit Fragen gelöchert. Normalerweise hätte ich davon genervt sein müssen, aber das war ganz und gar nicht der Fall. Ich war froh, dass ich endlich mal wahrgenommen wurde. Als ich ihnen erzählte, was ich in meinem letzten Schuljahr erlebt hatte, waren einige entsetzt. „Das wird dir auf dieser Schule ganz sicher nicht passieren“, sagte Mandy. „Hoffentlich“, seufzte ich. „Du brauchst nicht zu hoffen“, ergänzte Jenny. „Bei uns gibt es so etwas nicht, weil die Strafe viel zu groß ist.“ Nun wollte ich es aber genauer wissen. „Was ist das denn für eine Strafe?“ „Jeder der einen anderen hänselt oder gar mobbt muss eine zehnseitige Strafarbeit mit der Hand schreiben und außerdem zwei Wochen lang mit einem potthässlichen Schul-T-Shirt in der Schule rum laufen.“ „Und diese Strafe wirkt so abschreckend?“, fragte ich zweifelnd. „Klar, denn auf dem T-Shirt steht: „Hey du Loser, Mobbing ist uncool!“ „Und das funktioniert?“, fragte ich immer noch skeptisch. „Natürlich, von meiner Schwester weiß ich, dass seit fünf Jahren auf dieser Schule niemand mehr gemobbt wurde und die T-Shirts gibt es seit fünf Jahren.“
Ich wollte Jenny gerne glauben, aber noch war ich skeptisch.
„Na, wie war’s in der Schule?“, fragte Lilly als ich nach Hause kam. „Super, alle sind total nett und ich habe sogar schon Freunde gefunden.“ Lilly sah sehr erleichtert aus. „Das freut mich sehr. Dann hat es sich ja gelohnt die Schule zu wechseln.“
Ich erwiderte nichts darauf. Ob es sich gelohnt hatte oder nicht, musste erst die Zeit zeigen. Das Schuljahr verstrich. Am letzten Schultag verabschiedete ich mich von meinen Freunden. In den Sommerferien konnten wir uns leider nicht sehen, weil wir alle in verschiedenen Ländern Urlaub machten. Meine Eltern mussten mein neu gewonnenes Glück natürlich wieder zerstören. Nach weiteren fünf Wochen in Frankreich, ich konnte mittlerweile schon recht gut Französisch, tauchten meine Eltern zu Hause auf, um mir zu sagen, dass ich von nun an ein Internat besuchen sollte. Das hieß, wieder eine neue Schule, wieder neue Mitschüler, von denen ich nicht wusste, ob sie nett waren und dann natürlich die Trennung von meinen Freunden und von Lilly. Wenn ich meine Eltern bis hierhin nicht gehasst hatte, von da an hasste ich sie. Sie machten mir alles kaputt. Sie zerstörten mein Leben. Warum hatten sie mich nicht einfach in ein Heim gegeben, wenn ich Ihnen sowieso nur lästig war? „Ich hasse euch!“, schrie ich meine Eltern an. Meine Mutter lachte spöttisch. „Irgendwann wirst du uns dankbar sein.“
„Ganz sicher nicht.“ Als meine Eltern mir auch noch Lilly wegnehmen wollten, protestierte ich. „Wer soll sich denn dann in den Sommerferien um mich kümmern?“, fragte ich. „Das werden wir schon regeln“, erwiderte mein Vater. „Außerdem bist du inzwischen zu alt für ein Kindermädchen. Man wird über dich lachen.“ „Das hat euch bis jetzt auch nicht gestört“, erwiderte ich. Meine Eltern setzten sich aber mal wieder durch. Sie wollten mich nach den Sommerferien in ein Internat stecken und Lilly gnadenlos entlassen. Nur die restlichen Sommerferien durfte ich noch zusammen mit Lilly verbringen.
3. Kapitel
Meine Eltern fuhren mich persönlich zum Internat. „Ihr traut mir wohl nicht zu, dass ich alleine mit dem Zug fahren kann?“, sagte ich trotzig. Meine Mutter antwortete wie immer schnippisch: „Oh, wir trauen dir sehr wohl eine Zugfahrt zu, aber wir haben Angst, dass du dich heimlich aus dem Staub machst und irgendwann auf der Straße landest.“Immer noch besser als nach eurer Pfeife zu tanzen, dachte ich. Niemals hätte ich mich getraut diese Worte auszusprechen. Ich hasste meine Eltern. Ich hasste sie abgrundtief. Meine neue Schule lag in einem winzigen Kaff mit gerade einmal hundert Einwohnern. Das Internat war riesig. Die Schüler kamen aus ganz Deutschland.
Bevor wir auf das Schulgelände kamen, mussten wir uns am Tor per Lautsprecheranlage anmelden. Erst dann durften wir die Auffahrt hochfahren. Ich ahnte schreckliches. Der Knast ist wohl locker dagegen, dachte ich. Mein Vater hielt vor dem Eingang. Er lud mein Gepäck aus dem Auto, stieg dann wieder ins Auto ein, rief: „Tschüss“ und fuhr mit meiner Mutter davon. Fassungslos stand ich einige Zeit dort und konnte mich nicht rühren. Ich hatte gedacht, sie würden mich wenigstens hinein begleiten. Na ja, ich war bis jetzt ohne meine Eltern ausgekommen, dann schaffte ich das auch weiterhin. Ich wollte gerade meinen Koffer nehmen, um durch die Tür zu gehen, da wurde die Tür geöffnet. „Guten Tag, du bist bestimmt Sophie Rosengarten“, sagte eine Frau und streckte mir ihre Hand entgegen. „Ja, ich bin Sophie Rosengarten“, antwortete ich und schüttelte der Fremden die Hand. „Ich bin Frau Donarex“, stellte sie sich vor. „Deine Eltern sind sehr beschäftigt, habe ich gehört“, setzte sie hinzu. „Sie haben deshalb schon alles Nötige mit mir am Telefon besprochen.“ Trotzdem sollte ich Frau Donarex ins Büro folgen. „So, dann will ich dir mal etwas über unsere Schule erzählen.“ Nun folgte ein ellenlanger Vortrag über den Gründer der Schule. Ich versuchte aufmerksam zuzuhören, aber meine Gedanken schweiften immer wieder ab. Danach folgten einige Regeln. „Du wirst dir dein Zimmer mit einer Mitschülerin teilen. Sie wird dir auch am Anfang ein wenig helfen, damit du dich hier schnell zurecht findest. Außerdem gibt es hier noch gewisse Freizeitangebote. Ich werde dir mal eine Liste mitgeben. Schau sie dir in Ruhe an und entscheide dich für mindestens zwei Dinge.“ „Und wenn ich nichts davon machen möchte?“ „Das geht nicht. Jeder Schüler muss auch am Nachmittag ein wenig Programm haben. Ihr sollt schließlich nicht bloß eure Zeit hier absitzen.“ Nach diesem Gespräch wurde ich von Frau Donarex zu meinem Zimmer begleitet. Wir mussten drei lange Treppen hoch laufen. Ich musste sogar mein Gepäck selbst schleppen. Nun bereute ich es, dass ich so viel mitgenommen hatte. Als wir das Zimmer erreichten, klopfte Frau Donarex an. „Herein!“, rief jemand von drinnen. Wir traten ein. Im Zimmer standen zwei Betten. Auf dem einen saß ein Mädchen mit langen blonden Haaren, etwa in meinem Alter. Das andere Bett war leer. „Hallo Sally, ich bringe dir deine neue Zimmernachbarin. Ich hoffe, ihr versteht euch gut.“
Sally musterte mich mit einem neugierigen Blick.
„Zeigst du Sophie die Schule?“, fragte Frau Donarex.
„Geht klar“, erwiderte Sally.
Frau Donarex nickte ihr dankbar zu und ließ uns allein. Wir standen uns erst mal schweigend gegenüber, bis ich schließlich sagte: „Hi. Ich bin Sophie.“ Ich streckte ihr meine Hand hin. „Freut mich, dich kennenzulernen“, erwiderte Sally und schüttelte kurz meine Hand. Ich ließ meinen Blick durchs Zimmer wandern. Als erstes fiel mir das riesige Fenster ins Auge. Dadurch kam viel Licht herein und der Raum wirkte hell und freundlich. Ein Tisch mit zwei Stühlen stand auch im Zimmer. Der war sicher für die Hausaufgaben gedacht. Sally hatte fast die gesamten Wände im Zimmer mit Postern voll geklebt. Unter anderem hingen dort Poster von Bushido, den Sugababes und Marquess, aber es waren auch einige Tierposter dabei, hautsächlich Pferde. Ich fühlte mich gleich wohl. „Vielleicht sollten wir mal deinen Koffer auspacken“, schlug Sally vor. „Ich helfe dir gerne dabei, wenn du nichts dagegen hast. „Ja, das sollten wir. Du musst mir aber nicht helfen. Sicher hast du was Besseres vor.“ „Ach was, zu zweit geht’s viel schneller.“ Sally öffnete einen Schrank. Er war noch komplett leer, bis auf einige Sachen, die Sally herausholte. Es handelte sich um Handtücher, einen Bademantel und Bettbezüge. Sally warf die Sachen auf mein Bett. Ich öffnete den ersten Koffer und zusammen legten wir alles ordentlich in den Schrank. „Mit der Ordnung wird es sowieso bald vorbei sein“, sagte Sally lachend. „Du musst mal meinen Schrank in zwei Wochen sehen.“
Ich fiel in ihr Lachen ein. „Ich bin auch nicht gerade für meine Ordnung bekannt“, erwiderte ich.
„Na, das passt ja dann schon mal.“ „Wie lange bist du schon hier im Internat?“, fragte ich.
„Seit einem Jahr. Meinen Eltern ist es schwer gefallen mich gehen zu lassen, aber sie finden ein Internat ist besser, als eine normale Schule.“ „Meinen Eltern geht es mehr darum mich los zu werden“, sagte ich kühl. „Echt? Hast du kein gutes Verhältnis zu deinen Eltern?“ Ich erzählte Sally die ganze Geschichte. „Das ist ja schrecklich“, sagte sie, als ich geendet hatte. „Na ja, meine Eltern sind mir mittlerweile genauso egal, wie ich ihnen egal bin. Ich hasse sie“, ergänzte ich und schob meine Koffer unter mein Bett.
„Das tut mir leid“, sagte Sally. „Es muss schrecklich sein.“
„Man gewöhnt sich dran.“
Ich machte mich daran das Bett zu beziehen, verhedderte mich aber total im Bettbezug. Ohne einen fiesen Kommentar abzulassen, packte Sally mit an und gemeinsam schafften wir es das Bett halbwegs ordentlich aussehen zu lassen. Seufzend ließ ich mich darauf nieder und nahm mir den Zettel vor, den Frau Donarex mir gegeben hatte. Ich las mir die Liste aufmerksam durch. Step-Aerobic, Tanzen, Tennis, Badminton, Bodenturnen, Geräteturnen, Squash, Tischtennis, Volleyball, Reiten, Fechten, Yoga, Judo, Teakwondo, Leichtathletik….
„Ihr habt ja hier ein riesiges Freizeitangebot“, wandte ich mich an Sally, die mit einem Buch in der Hand auf ihrem Bett saß.
„Ach, quälst du dich auch mit dieser Liste rum? Ich würde Tanzen und Reiten nehmen, wenn ich du wäre.“
Mit Tanzen war ich einverstanden. Ich kreuzte es auf der Liste an.
„Reiten ist echt nicht mein Ding“, meinte ich. „Pferde sind mir unheimlich.“
„Dann nimm Volleyball“, schlug Sally vor. „Das ist auch gut, aber ich sage dir eins. Du verpasst echt was beim Reiten.“
„Na, ich weiß nicht. Was soll ich da schon verpassen?“
„Eine ganze Menge, aber letztendlich ist es ja deine Entscheidung.“
„Was machst du denn?“, wollte ich von Sally wissen.
„Ich reite, tanze, spiele Volleyball und mache Yoga.“
Ich war erstaunt. „Ist das nicht ein bisschen viel?“
„Nee, ich meine, was willst du denn sonst in deiner freien Zeit machen? Hier kannst du nicht shoppen gehen, es gibt keine Disco. Einfach nichts. Wenn du was erleben willst, musst du in den nächsten Ort fahren, aber so ohne weiteres kommst du nicht vom Schulgelände. Dazu musst du dir erst eine Erlaubnis bei der Schulleitung holen und dann musst du natürlich Rechenschaft darüber ablegen, was du wann, wie und wo machst.“
„Klingt ja ganz schön hart.“
„Na ja, man gewöhnt sich eben an alles.“
Ich entschied mich nach langem hin und her schließlich für Tanzen und Volleyball.
„Schade, dass du nicht reiten willst. Es gibt im Stall echt tolle Pferde“, versuchte Sally mich zu überreden. Doch ich blieb bei meiner Entscheidung. Reiten war nichts für mich.
Noch vor dem Mittagessen gab ich Frau Donarex den Zettel wieder ab.
Beim Mittagessen lernte ich auch meine anderen Mitschüler kennen. Sie waren genauso nett wie Sally.
Eine Stunde nach dem Mittagessen hatte ich meine erste Tanzstunde.
„Ich hoffe, wir müssen nicht wieder Walzer tanzen“, sagte Sally.
„Wie? Müssen wir das etwa auch machen?“, fragte ich entsetzt und bereute meine Entscheidung sofort. „Ich dachte, wir machen etwas Cooleres.“
„Ja, so ab und zu tanzen wir auch Walzer, aber die meiste Zeit tanzen wir Musikvideos nach.“
Nun war ich ein wenig beruhigt. Ich hatte schon mit dem Schlimmsten gerechnet.
Als wir den Tanzraum betraten waren noch nicht viele Schüler anwesend. Ich sah mich um. Ringsum an den Wänden waren große Spiegel angebracht. Der Boden war mit Parkett ausgelegt und glänzte fast so wie die Spiegel. In einer Ecke des Raumes stand eine riesige Musikanlage.
Wenig später kam unsere Tanzlehrerin. Zuerst hakte sie auf einer Liste ab, wer anwesend war. Als sie damit fertig war, wandte sie sich an mich.
„Wie heißt du?“
„Sophie Rosengarten. Ich bin neu an dieser Schule.“
„Und du hast dich fürs Tanzen entschieden, wie ich sehe? Wie schön. Das freut mich sehr. Herzlich Willkommen in unserer Gruppe.“
„Danke.“
„Hm, Frau Donarex hat mich noch gar nicht darüber informiert, dass du in meiner Gruppe bist.“
„Ich habe den Zettel auch heute erst abgegeben“, erwiderte ich.
„Ach so, na dann werde ich sicher noch Bescheid bekommen.“
„Frau Morgan ist schon irgendwie komisch, oder?“, fragte ich, als ich wieder mit Sally in unserem Zimmer war.
„Na ja, sie ist vielleicht manchmal ein wenig zerstreut, aber ansonsten sehr nett und man lernt viel bei ihr.“
„Muss man eigentlich bei seinen gewählten Sportarten bleiben oder kann man auch wechseln?“, wollte ich wissen.
„Du kannst natürlich jederzeit auch wechseln, aber das machen die meisten nur in den ersten Wochen. Die meisten bleiben ihrem Sport treu, bis sie mit der Schule fertig sind.“
Am nächsten Morgen begann der Unterricht. Ich wurde in jeder Stunde darum gebeten mich kurz vorzustellen. Das war echt nervig und vor allem total unnötig, da mich ja nun alle aus meiner Klasse kannten und ich die Vorstellungsrunde quasi nur noch für den jeweiligen Lehrer machte.
Im Unterricht kam ich gut mit. Manche Sachen hatten wir an meiner alten Schule schon durchgenommen und so arbeitete ich fleißig mit. Zur Freude aller Lehrer.
„Warst du schon immer so gut in der Schule?“, wurde ich beim Mittagessen gefragt.
„Nein, eigentlich nicht. Ich will aber nicht, dass ihr mich für eine Streberin haltet, nur weil ich heute gut mitgearbeitet habe.“
„Keine Angst“, meinte Lucia. „Von mir aus und ich denke, dass ich im Namen aller anderen spreche, kannst du ruhig nur gute Noten schreiben. Allerdings wäre es dann schön, wenn wir bei dir abschreiben könnten, denn wir sind alle ein wenig faul, wenn es um die Hausaufgaben geht.“
„Wenn ich im Unterricht weiter so gut mitkomme, dürft ihr natürlich bei mir abschreiben“, versprach ich. Das brachte mir bei meinen neuen Mitschülern natürlich jede Menge Pluspunkte ein. Doch ich musste schnell feststellen, dass es doch nicht so einfach war, wie ich gedacht hatte. Der Unterricht war immer schwerer zu meistern und dann kamen auch noch zusätzlich zu den Hausaufgaben Tanzen und Volleyball dazu. Ich wusste echt nicht wie Sally das schaffte. Vielleicht musste ich mich auch erst daran gewöhnen.
Sally versuchte immer wieder mich dazu zu überreden mit ihr in den Stall zu kommen, aber ich hatte genug damit zu tun, Schule, Hausaufgaben, Volleyball und Tanzen unter einen Hut zu bringen. Mit Pferden wollte ich nichts zu tun haben, da konnte Sally sagen, was sie wollte.
Ein Jahr lang ging alles gut. Ich war zum ersten Mal richtig glücklich. Ich hatte viele neue Freunde gefunden, ich kam in der Schule gut mit, beim Tanzen hatte ich Fortschritte gemacht, beim Volleyball war ich eine der besten Spielerinnen und mit meinen Lehrern verstand ich mich wunderbar. Doch genau damit sollte es Probleme geben.
Die Sommerferien verbrachte ich in einem Camp. Es war schrecklich. Ich war dort ganz alleine, sprich ohne Freunde. Deshalb war ich froh, als die Ferien endlich vorbei waren.
Als die Schule wieder anfing, gab es eine große Begrüßung. Sally und ich nahmen sofort wieder unser altes Zimmer in Beschlag und unsere übliche Unordnung hielt schneller Einzug, als uns lieb war.
Sally erzählte von ihren Ferienerlebnissen. Sie war kaum zu bremsen. Ich ließ sie einfach reden, auch wenn ich ein wenig neidisch auf sie war, weil sie die Ferien mit ihren Eltern verbracht hatte.
„Wie waren denn deine Ferien so?“, wollte Sally wissen.
„Na ja, irgendwie blöd. Meine Eltern haben mich sechs Wochen lang in ein Camp gesteckt, obwohl ich da nicht hin wollte. Ich war kurz davor von dort abzuhauen, aber ich wusste ja nicht, wo ich sonst hin sollte.“
„Das hört sich ja schlimm an.“
„Das war’s auch. Ich bin jedenfalls froh wieder hier zu sein.“
„Ich glaube, da bist du die Einzige. Diese Schule ist fast so etwas wie ein Gefängnis.“
„Finde ich nicht. Im Gegensatz zu dem Camp oder meinem Zuhause, fühlt sich die Schule für mich an wie Urlaub.“
Sally konnte das nicht verstehen.
In unserer ersten Mathestunde nach den Ferien erlebten wir eine Überraschung. Wir hatten einen neuen Mathelehrer. Auf den ersten Blick sah er sehr nett aus, aber schon bald zeigte er sein wahres Gesicht. Gleich am Anfang der Stunde verteilte er Fragebogen an uns, die ähnlich aufgebaut waren wie ein Lebenslauf. Er bestand darauf, dass wir sie ausfüllten. Er wollte uns besser kennenlernen, sagte er.
Zwar fanden wir das alle ziemlich idiotisch, aber wir füllten die Blätter aus.
„Machen Sie das in allen Klassen so?“, wollte Alina wissen.
„Ich wüsste nicht, was dich das angeht“, wurde sie von Herrn Bleibtreu angeschnauzt.
Um Herrn Bleibtreu zu ärgern, ließen wir uns die ganze Stunde Zeit, um die Fragen zu beantworten.
„Ihr seid echt die langsamste Klasse, die mir je untergekommen ist“, sagte Herr Bleibtreu am Ende der Stunde.
„Gut Ding will nun einmal Weile haben“, antwortete Michael.
„Euch werden die Scherze noch vergehen“, knurrte Herr Bleibtreu. „Wartet nur ab!“ Es klang wie eine Drohung.
Beim Mittagessen war Herr Bleibtreu Gesprächsthema Nummer 1.
„Ich glaube, der kann ziemlich ungemütlich werden“, meinte Alina.
„Ey komm, mit dem werden wir schon fertig. Lehrer sind auch nur Menschen“, erwiderte Michael.
„Wir müssen nur zusammenhalten“, sagte Sally.
Nach dem Mittagessen war auch wieder unser tägliches Sportprogramm angesagt. Zu unserem Entsetzen mussten wir feststellen, dass Herr Bleibtreu auch noch unser neuer Volleyballlehrer war.
„So schnell sieht man sich wieder“, sagte er gut gelaunt.
Herr Bleibtreu war schrecklich als Volleyballlehrer. Er scheuchte uns über eine Stunde lang über den Volleyballplatz, ohne uns eine Minute Pause zu gönnen.
„Also, wenn der das jetzt weiterhin macht, höre ich auf mit Volleyball“, sagte Sally nach der Stunde. Sie war fix und fertig.
Wir anderen stimmten ihr zu. Es war wirklich der Horror gewesen.
Schon am nächsten Morgen ging es mit diesem Horror weiter. Blöderweise hatten wir sogar zwei Mathestunden mit ihm.
Mich rief er zuerst an die Tafel. Er las mir aus einem seiner Bücher eine ellenlange Matheaufgabe vor, die ich an der Tafel rechnen sollte. Ich stand hilflos da und wusste nicht, wie ich auf das richtige Ergebnis kommen sollte.
„Bist du zu doof, oder was?“, schnauzte mich Herr Bleibtreu an. „Jeder Fünftklässler kann diese Aufgabe lösen.“
Ich stand da wie ein begossener Pudel.
„Lass dir von einem deiner Mitschüler helfen!“, schrie Herr Bleibtreu.
Erleichtert drehte ich mich zur Klasse um. Es meldete sich niemand und keiner sah so aus als wüsste er das Ergebnis. Im Gegenteil. Ich las in den Gesichtern meiner Mitschüler allgemeine Ratlosigkeit und, dass sie allesamt hofften und beteten nicht dran genommen zu werden.
„Na wird’s bald, nimm einen dran!“
„Es meldet sich aber niemand“, stotterte ich.
„Na und?! Dann nimm irgendjemanden.“
Ich zögerte. Dann löste Herr Bleibtreu von selbst das Problem. Er nahm Michael dran.
„Ich kann die Aufgabe nicht rechnen“, sagte er.
Einer nach dem anderen wurde dran genommen und musste zugeben, dass er die Aufgabe nicht lösen konnte.
„Ihr seid ein stinkfauler Haufen, alle miteinander. Jeder andere in eurem Alter rechnet diese Aufgabe im Schlaf. Ihr hinkt verdammt weit hinterher. Wenn ihr so weiter macht, werdet ihr es im Leben nicht weit bringen.“
„Dann rechnen Sie uns die Aufgabe doch mal vor“, schlug Alina vor.
„Genau“, stimmte Michael zu. „Gehen Sie mit gutem Beispiel voran.“
„Oh nein, das werde ich nicht tun. In eurem Buch steht die Erklärung dazu. Ich möchte, dass ihr euch das anseht und im Anschluss die Aufgabe allein löst. Eigenständiges Arbeiten nennt man sowas.“
„Wofür gehen wir eigentlich in die Schule, wenn wir uns den Kram sowieso selbst erarbeiten müssen?“, flüsterte Sally mir zu.
Am Ende der Stunde waren wir genauso schlau wie am Anfang der Stunde.
„Hausaufgabe ist die ganze Seite 16!“, rief Herr Bleibtreu nach dem Klingeln.
Michael sah entsetzt aus. „Das sind 36 Aufgaben“, rief er protestierend.
Herr Bleibtreu ging darauf nicht ein und stürmte aus der Klasse.
„Der hat sie doch nicht mehr alle“, rief Sonia empört.