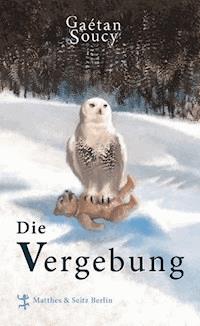
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Die Reise eines gescheiterten Genies in seine Vergangenheit wird zu einem raffinierten Spiel zwischen Wirklichkeit und Illusion. In einer gleißend winterlichen Landschaft spielt sich ein Drama von Ehrgeiz und Versagen ab, von Schuld und Sühne.Nach 20 Jahren kehrt der Musiker Louis Baupaume in ein abgelegenes Dorf im Norden Kanadas zurück, um eine alte Angelegenheit zu bereinigen. Der Weg dorthin erweist sich als beschwerlich, die Landschaft ist im Schnee versunken, das Auto kommt nicht mehr voran, er ist gezwungen, die Reise mit dem Hundeschlitten fortzusetzen. Als er sein Ziel endlich erreicht, erfährt er, dass ein Mädchen aus dem Dorf vermisst wird. Kurze Zeit später wird es tot aufgefunden. Es kommt zu verstörenden Begegnungen, die in Baupaume schmerzhafte Erinnerungen wachrufen. Schließlich steht er der jungen Frau gegenüber, nach deren erlösenden Worten er sich sehnt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 146
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Titelseite
Impressum
Widmung
DIE FALLE
DER SCHÖNHEITSFLECK
DER PLÜSCHBÄR
DAS PRISMA
Gaétan Soucy
DIE VERGEBUNG
Roman
Aus dem kanadischen Französisch von Andreas Jandl und Frank Sievers
Dieses Buch erscheint mit Unterstützung des Conseil des Arts du Canada
friktion 13
Erste Auflage 2008
© MSB Matthes & Seitz Berlin Verlagsgesellschaft mbH
Göhrener Str. 7, 10437 Berlin, [email protected]
Alle Rechte vorbehalten.
Die Originalausgabe erschien 1997 unter dem Titel
»L‘Acquittement« bei Les Éditions du Boréal, Montréal
© by Les Éditions du Boréal
Umschlaggestaltung und Illustration: Falk Nordmann, Berlin
Gestaltung und Satz: Tropen Studios, Leipzig
eISBN: 978-3-88221-910-4
www.matthes-seitz-berlin.de
Für Claire
Aber wenn uns nun das Gedächtnis die Vergangenheit zeigt, wie zeigt es uns, dass es die Vergangenheit ist?
DIE FALLE
Die grundlegende Katastrophe dieser Welt ist der unausweichliche Tod derer, die man liebt. Wer das Leben für unwirklich hielte, müsste nur an die Wirk lichkeit der Trauer erinnert werden.
Louis träumte von sich als kleinem Jungen. Es war Sommer, er stand im Garten auf dem Rasen. Er erwiderte das Winken seines Vaters auf der anderen Straßenseite (der gerade ins Auto stieg). Gefangen in seinem Erwachsenenkörper von vierundvierzig Jahren, stand er abseits an einem Baum und beobachtete das Kind, das er gewesen war. Und noch im Traum fragte er sich, wie so etwas möglich sei. Der Vater wiederholte unablässig seine Handbewegung, als drehten sich diese Sekunden für alle Ewigkeit im Kreis. Von dem kleinen Jungen war nur der Rücken zu sehen. Vielleicht hatte er schon kein Gesicht mehr?
Ein Gefühl des Verschlungenwerdens riss Louis aus dem Schlaf. Er begriff nicht sogleich, wo er sich befand, und bat den Fahrer, seine Worte zu wiederholen.
»Die Straße ist versperrt, Monsieur. Wir kommen nicht mehr weiter.«
»Versperrt?«
Der Wagen war ins Rutschen geraten und in den Schnee eingesunken, der den Straßengraben auf der linken Seite überdeckte. Der Fahrer tobte. Louis, noch entrückt von den Bildern des Julimorgens, hatte Schwierigkeiten, die Lage einzuschätzen. War es, weil er von sei nem Vater geträumt hatte? Ihm schien all dies befremd lich, unverständlich. Sogar das seltsam affektierte Mur ren des Fahrers. Er wirkte wie ein kleiner Junge, der einen Erwachsenen spielt, wie er sich aufregt.
»Und was machen wir jetzt?«
»Was sollen wir schon machen? Wir laufen zurück zum Bahnhof.«
Louis drückte sich tief in den Sitz, mit einem Seufzer des Überdrusses (den er sogleich bereute: Würde der Fahrer etwa glauben, er tadelte ihn wegen irgendetwas?…). In den letzten achtzehn Stunden hatte er nichts anderes getan, als zu reisen, sein Gepäck zu tragen, von einem Wagen in den nächsten zu steigen, doch war er noch immer nicht am Ziel.
»Ist es denn ganz unmöglich? Können wir nicht versuchen, die Reifen freizubekommen?«
Der Fahrer schnaubte in bitterer Ironie. Er erwiderte, dass man dafür mindestens drei Pferde bräuchte.
»Das heißt also, wir werden zu Fuß zurückkehren müs sen«, sagte Louis, als dächte er laut nach.
»Ich fürchte schon.«
Trotz seines Fluchens schien der Fahrer sich nicht über die Maßen zu sorgen. Er war mit blendender Laune auf die Welt gekommen. Zudem löste die zerstreute, bisweilen verängstigte Erscheinung des Reisenden bei ihm ein amüsiertes Erstaunen aus. Doch nicht aus Boshaftigkeit. Er empfand für Louis dieselbe Sympathie, die Kinder für einen Clown empfinden.
Die linke Seite des Wagens war so tief im Schnee versunken, dass die Tür nicht mehr zu öffnen war. Die beiden Männer stiegen also, nicht ganz ohne Mühe, auf der rechten Seite aus. Von der Talsohle an war die Straße unpassierbar. Der Schnee hatte sich darübergebreitet und einen riesigen Pulversee gebildet. Louis band sich den Schal fester um den Hals. Sein Gepäck bestand lediglich aus einem kleinen Koffer, der in Größe und Form an eine Arzttasche erinnerte. Da er möglichst leicht reisen wollte, hatte er im letzten Augenblick auf seinen alten Pelzmantel verzichtet, doch stellte er fest, dass dies vielleicht ein Fehler gewesen war. So trug er nur einen mit Schafsfell gefütterten Wettermantel.
Der Fahrer inspizierte den Wagen (einen Ford aus der unmittelbaren Nachkriegszeit) und Louis betrachtete die Landschaft, die vor ihm lag. Bald würde es dunkeln. Eine Art Leuchten stieg aus dem Schnee. Der Wind hatte in den weißen Dünen präzise, feine Rillen hinterlassen, die wie kunstvoll hineingeschnitzt wirkten. Man konnte sie mit dem Blick über die gesamte Hügellandschaft verfolgen, zart wie die Zeichnung menschlicher Lippen. Da und dort wirbelte ein Lufthauch dicht über dem Boden diamantene Staubwolken auf, die sodann wie Rauch verschwanden. Ein sich dem Anschein nach endlos ausdehnender Wald breitete seine Flügel über beide Seiten des Tals. Die beinahe schmerzhafte Weite der Landschaft dehnte sich in alle Richtungen, blies wie einen Luftballon den Raum auf.
»Danke, es wird schon gehen«, erwiderte er dem Fahrer, der ihm ein Paar Schneeschuhe angeboten hatte. (Tatsächlich hatte er noch nie in seinem Leben welche getragen und fürchtete seine Ungeschicklichkeit.)
Er griff sich sein Gepäck. Er zog vor, es selbst zu tragen, aus ihm eigener Bescheidenheit, und auch, da er es nicht gewohnt war, bedient zu werden. Der Fahrer deutete zum Firmament.
»Na! Sowas!«
Louis hob arglos den Kopf. Der andere kicherte leise in sich hinein und schnallte seine Schneeschuhe unter. Der Reisende erforschte weiter das Himmelsgewölbe. Der Fahrer wurde ungeduldig.
»Heh! War nur Spaß. Da ist nichts.«
»Ich weiß.«
Doch war seine Aufmerksamkeit einmal auf den leeren Himmel gelenkt, war Louis nicht leicht davon zu lösen.
Der Bahnhof lag zwei Kilometer entfernt. Der Reisende ging vorneweg. Er hatte ein schlechtes Gewissen, da er darauf bestanden hatte, das Automobil zu nehmen, und war bereit, die Abschleppkosten zu übernehmen. Er bemühte sich, nicht auf das Geplapper des Fahrers zu hören, den die Widrigkeiten wenig berührten. Bisweilen nur stieß dieser zwei, drei derbe Flüche aus, der Form halber, als erinnere er sich unvermittelt, dass er schlechter Laune war und dies auch zeigen musste. Doch bald schon trällerte er wieder unbekümmert vor sich hin, denn das Leben trägt dafür Sorge, immer wieder Wesen hervorzubringen, deren alleinige Bestimmung es ist, ihm niemals etwas nachzutragen.
Louis ging mit gesenkter Stirn, den Blick auf das Weiß geheftet. Er hörte nichts außer seinem Atem, der den Raum um seinen Kopf erfüllte. Die Erinnerung an den Morgen, an dem er seinen Vater zum letzten Mal gesehen hatte (als Waise altert ein Kind auf einen Schlag um fünfzig Jahre), hatte Louis in einen Zustand versetzt, in dem der Beweis, dass er aus seinem Traum tatsächlich erwacht war, noch auf sich warten ließ. Überzeugt hatte ihn, was gerade geschah, jedenfalls nicht. Vielleicht war er einfach nur aus einem Traum in einen anderen hinübergegangen.
Was er zunächst für einen Stein gehalten hatte, richtete sich, als er näherkam, plötzlich auf, und preschte ihm entgegen, so unvermittelt, dass Louis die Schultern nach hinten warf, wie durch den Rückstoß eines Karabiners. Er sah so etwas zum ersten Mal: Es war ein Stachelschwein. »Ist es wahr, dass man sie, wenn man sich im Wald verirrt hat, roh essen kann?« Jemand hatte ihm erzählt, dass es verboten war, Fallen für Stachelschweine aufzustellen, da diese den Unglücklichen vorbehalten waren, die sich in den Bergen verlaufen hatten; die Haut war angeblich so leicht abzuziehen wie eine Bananenschale. Ob wahr oder nicht, die Geschichte hatte ihn tief beeindruckt, und schon aus diesem Grunde hatte er ihr Glauben geschenkt. In allem, was nicht das Wesentliche berührte, konnte man ihn nach Belieben aufs Glatteis führen. Er war nicht bestrebt, sich darin zu bessern, er maß dem keine Bedeutung bei. Denn er hielt sich für beschlagen genug in Bezug auf Gott, auf das Wirken der Zeit, auf den Tod.
Der Gedanke, ein Tier roh zu verspeisen, beschäftigte ihn über hundert Meter. Bis zu den Waden reichte ihm der Schnee und drang in seine Stiefeletten ein. Er verspürte eine böse Schwere in seinem Oberkörper. Auf dem weißen Blatt erkannte er nur seinen gedrungenen Schatten und den seines Hutes, der wie eine halbe Pause auf einer Notenlinie saß. Der Fahrer folgte ihm, noch immer in demselben Abstand, als gälte es, einen Rangunterschied zu beachten.
Sie erreichten bald die Bahngleise. Am Hang eines Hügels erblickten sie die Lichter des Bahnhofs. Sie schienen heller zu leuchten, je näher man kam. Das lag am Schwinden des Tages, der schon beinah nicht mehr war. Einige Landhäuser schienen so blass, dass sich ihr Licht verlor, wenn der Blick es suchte, wie helle Flecken bei geschlossenen Augen.
»Wie bitte?«
»Ich glaube nicht«, wiederholte der Fahrer schnaufend, »dass Sie es heute abend noch zu den von Crofts schaffen.«
Louis sagte nichts. Er hatte ohnehin nicht vorgesehen, sich noch heute zu den von Crofts zu begeben. Zumindest aber wollte er Saint-Aldor erreichen, wo er in der Herberge ein Zimmer reserviert hatte. Wo würde er sonst übernachten können? Würde er gezwungen sein, die zehn Kilometer vom Bahnhof bis zum Dorf zu Fuß zurückzulegen?
Louis verließ die Gleise und lief auf dem schotterbedeckten Bahndamm weiter: Er spürte die Unebenheiten durch die Schuhsohlen hindurch. Er schlotterte vor Kälte, und zugleich standen ihm dicke Schweißperlen auf der Stirn. Entlang des Bahndamms war ein gutes Dutzend Männer damit beschäftigt, die Gleise freizuschaufeln. Der Fahrer begann mit ihnen zu reden. Louis stapfte weiter.
Der Bahnhofsvorsteher stand auf dem Bahnsteig und ließ sie nicht aus den Augen, bis sie ihn erreicht hatten. Er trug einen Mantel mit Epauletten, wie sie Marineoffiziere tragen, und eine dazugehörige Mütze, die der Damenwelt den Kopf verdrehte. Mit britischem Schnäuzer, sehr blond und sehr fein, der Pfeife im Mund, oder aber Zigaretten, die zu seinem Typ passten (dünn und lang), hatte er sich eine angelsächsische Gelassenheit mitsamt ihren sparsamen, präzisen Bewegungen angeeignet, die gerade der letzte Schrei im Kreise der unteren kanadischen Dienstgrade war.
Ein wackerer Mann im übrigen, in den Dreißigern, von Sittlichkeit und militärischem Ansehen, zu großer Begeiste rung fähig. Er wusste um seinen Mut, ohne ihn zur Schau zu stellen, um seine ganz natürliche Rechtschaffenheit, so wie andere ein feines Gehör haben oder Plattfüße, und trachtete nicht danach, sich dies als Verdienst anrechnen zu lassen. Er akzeptierte stoisch seine Lage, in der ruhigen Gewissheit, dass es ganz undenkbar war, dass seine Stunde nicht eines Tages kommen würde in einer Welt, in der es genügte, seine Pflicht zu erfüllen, in der die Alliierten am Ende doch gesiegt hatten, und dass dieser dienstliche Einsatz in der abgelegensten Provinz nicht ewig würde dauern können.
»Panne?« fragte er, als sie nahe genug waren, um nicht die Stimme heben zu müssen.
Der Fahrer schüttelte den Schnee von seinen Schuhen:
»Ab dem Tal kein Durchkommen mehr.«
Louis hatte seinen Koffer abgestellt und sich mit dem Rücken gegen die Mauer gelehnt. Solange er in Bewegung gewesen war, hatte er nicht gespürt, wie müde er war. Jetzt befand sich sein Körper in einer Art Notzustand. Sein Herz schlug, als liefe es in seiner Brust auf und ab, Sterne blitzten am Rande seiner Augen auf wie winzige Explosionen. Er besah sich sein Spiegelbild in der Fensterscheibe, um das Ausmaß des Schadens festzustellen. Er sah seine geknickte Gestalt, sein feistes Gesicht mit den herabfallenden Wangen – die Hängebacken eines Bernhardiners, hätte Françoise, sie küssend, gesagt; die Augenringe gruben sich so tief in sein Gesicht, dass eine Dreißig-Sous-Münze darin Platz gefunden hätte. Er strich mechanisch eine Strähne seiner zu langen, schwarzen, öligen Haare hinter das Ohr. Seine Lippen waren blau und geschwollen wie die eines Ertrunkenen.
Louis drehte sich um, niedergeschlagen, gar angeekelt von seinem Gesicht.
»Kommen Sie«, sagte der Bahnhofsvorsteher zuvorkommend, »und wärmen Sie sich ein wenig auf! Und du«, wandte er sich an den Fahrer, »geh zu Großmama Beaulieu und hol den Suppenkessel.«
Der Fahrer schnallte sich unverzüglich die Schneeschuhe wieder unter. Er ging in Richtung einer Hütte, die in der Ferne rötlich schimmerte.
Der Bahnhofsvorsteher legte Louis die Hand auf die Schulter und ließ ihm den Vortritt.
Die Wärme, die der Holzofen verbreitete, tat ihm nicht im mindesten wohl. Louis fühlte sich noch bedrückter. Er lockerte seinen Schal.
»Wenn Sie sich setzen mögen, ich habe Tee gekocht.«
Vier Sessel bildeten einen Halbkreis um ein Kaminfeuer. Diese Wärme war nicht so aggressiv wie die des Ofens, und als Louis sich ihr näherte, verspürte er endlich ein Wohlsein. Er setzte sich auf den vorderen Rand des Sessels, um dem sanften Feuer seine steifen Hände entgegenstrecken zu können.
Der Offizier kam mit einer Teekanne zurück und stellte sie auf den Beistelltisch. Er hielt Louis eine Tasse aus Porzellan hin, deren Erlesenheit sich von der bäuerlichen Grobschlächtigkeit der Behausung absetzte.
»Bitte sehr, Monsieur Bapaume. Verzeihen Sie, aber das ist ein seltsamer Name, Bapaume. Sie werden sicher oft ge beten, ihn zu wiederholen. Mir ist er jedoch durchaus geläufig. So heißt ein Ort in der Region Pas-de-Calais, ich war auch schon einmal dort, so wahr ich hier stehe.«
Louis begnügte sich mit einem Nicken. Im allgemeinen, wenn man ihm nicht in aller Form eine Frage stellte, machte er den Mund nicht auf. Er gehörte zu jenen fantasiebegabten und talentreichen Menschen, die von den banalsten Anforderungen des Augenblicks in die Enge getrieben werden, Menschen, die man landläufig schüchtern nennt. Das Gebäude war kaum acht Quadratmeter groß. Im Schatten einer Treppe, die ins Dachgeschoss führte, stapelten sich streng geordnet Register auf einem Tresen, über dem ein schwarzes Brett hing, das mit Rechnungen, Verwaltungszetteln, gewissenhaft zusammengefalteten Landkarten vollgehängt war. Die Wanduhr am Mittelbalken des Hauses zeigte 17:20 Uhr an. Darunter einer jener Kalender, bei denen jeder Tag eine Seite davonträgt: 22. Dezember.
»Oh, vielen Dank«, sagte er, als der Offizier ihm Tee ein schenkte.
Louis war gegen zwei Uhr nachmittags am Bahnhof angekommen. Er hatte seit zwanzig Jahren keinen Fuß mehr in diese Gegend gesetzt, und da ihm jeglicher Orientie rungssinn fehlte, so dass er sich verlief, kaum dass er sich drei Straßenecken von seinem Zuhause entfernte, hatte er auch die Weite des Landes falsch eingeschätzt. Er hatte geglaubt, das Dorf Saint-Aldor schließe gewissermaßen an den Bahnhof an und er könne sich zu Fuß dorthin begeben. Doch die tatsächliche Entfernung und der heftige Schneefall der vergangenen Nacht machten das Unternehmen riskant, und der Offizier hatte abgeraten. Dessen Ehrerbietung ihm gegenüber erstaunte Louis noch immer. Seine mangelnde Ausstrahlung, seine vollendete Mittelmäßigkeit im Umgang, sein in vollem Bewusstsein vernach lässigtes Erscheinungsbild schienen ihm kaum zuträglich, bei jemandem Sympathie zu erwecken, geschweige denn den Respekt eines eleganten jungen Offiziers, der gerade vom Sieg der Alliierten zurückkehrte. Alles in allem zog Louis es vor, wenn man ihn keines besonderen Blickes würdigte, ja, sich gar nicht um ihn bemühte. Er wusste nicht auf Freundlichkeit zu reagieren. Umso weniger, da diese Freundlichkeit ihm zu Herzen ging und in ihm ein solches Gefühl der Dank barkeit entfachte, dass es an Beklemmung grenzte, ihn all seiner Mittel beraubte.
Der Bahnhofsvorsteher nahm seinerseits in einem der Sessel Platz und fragte mit einer demonstrativen Herz lich keit, die sich um Umgangsformen offenbar nicht scherte:
»Und welchem Beruf geht unser Monsieur Bapaume nach?«
»Welchem Beruf?« wiederholte Louis murmelnd und blinzelte mit den Augen, als schien ihm die Frage ungewöhnlich und als verdiente sie, bedacht zu werden. »Ich bin Organist in der Basilika Notre-Dame von Montréal. Hilfsorganist. Und ich … also, ich komponiere auch.«
Das Lächeln des Offiziers entblößte zwei goldene Zähne.
»Ich hätte drauf wetten können … Auf hundert Schritt Entfernung hätte ich allein an Ihrer Haltung erraten können, dass Sie Musiker sind.«
»Ah.«
»Meine Mutter ist Musikerin. Sie hat Geigenunterricht gegeben, früher, als sie noch in Paris lebte.«
»Das ist ja interessant.«
Nach einer derart hölzernen Erwiderung wusste Louis die Unterhaltung nicht wieder in Gang zu bringen. Belanglose Gespräche dieser Art waren ihm seit jeher ein Mar tyrium gewesen. Reden zu müssen, über geläufige Dinge zu plaudern, großer Gott! Für gewöhnlich begriff sein Gegenüber recht bald und beharrte nicht weiter, was Louis eine bittere Erleichterung verschaffte, in die sich ein Gefühl von Versagen und Scham mischte.
Aber der Bahnhofsvorsteher hätte sich mit einem Regenschirm unterhalten können. Die notgedrungene Einsamkeit auf dem Lande, wo das Dorf Saint-Aldor die einzige Spur von Zivilisation war, entfachte in ihm den bren nen den Drang, sein Herz auszuschütten, einem Geistesverwandten anderes mitzuteilen als Befehle. Er behandelte Louis Bapaume sogleich mit dem stillen Einvernehmen des Mannes von Welt, der, von Bauerntölpeln umgeben, auf Seinesgleichen trifft. Wie stets, wenn man sich an ihn wandte, wurde Bapaume von einem Zucken heimgesucht, das die Muskeln seiner Arme, seiner Beine, seines Rückens befiel, in unvorhersehbaren Wellen, wie Wetterleuchten an einem Sommerhimmel. Und da er allzu sehr damit beschäftigt war, diese Nervosität unter einer ruhigen Oberfläche zu verbergen, achtete er kaum darauf, was man ihm erzählte. Der Militär redete über den Fahrer.
»Chouinard ist einer von diesen Einfaltspinseln, die man nur in eine Uniform zu stecken, mit einer Medaille oder Schelle zu verzieren braucht, um sie überglücklich zu machen und sie mit so tiefer Dankbarkeit zu erfüllen, dass sie Ihnen auf Lebenszeit verbunden sind.«
Es lag keine Verachtung in diesen Worten, allenfalls ein Hauch liebevoller Belustigung, so wie man über einen kleinen Jungen spricht.
»Doch jetzt, wo es danach aussieht, dass wir die nächsten Stunden miteinander verbringen werden, will ich mich Ihnen doch vorstellen! (Ich Banause, dass ich es nicht früher tat.) Oberleutnant Hurtubise. Jacques Hurtubise.«
Louis hob leicht das Gesäß vom Sitz.
»Angenehm. Aber ich muss unbedingt noch heute abend in Saint-Aldor sein.«
Und als bedeute die Präzisierung eine zwingende Pflicht für ihn:
»Ich habe ein Zimmer in der Herberge reserviert.«
Der Oberleutnant Hurtubise schnitt eine Grimasse.
»Ich fürchte, das ist unmöglich. Die Straße wird vor morgen Nachmittag nicht geräumt sein. Wenn überhaupt.«
Der Offizier hatte aus seinen Erfahrungen als Führungspersönlichkeit den Schluss gezogen, dass man den Menschen stets direkt ins Gesicht sehen solle, was Louis einschüchterte, der es schlecht vertrug, wenn man den Blick auf ihn heftete. Er betrachtete düster den Boden seiner Tasse.





























