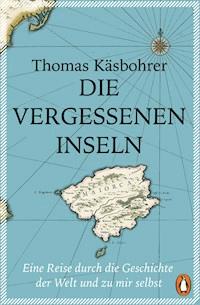
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Von dem Abenteuer, allein auf offener See zu sein
Thomas Käsbohrer fühlt sich dort am wohlsten, wo nur noch Himmel, Wind und Wasser sind. Neun Monate im Jahr verbringt er auf dem Segelschiff und trotzt der Unwirtlichkeit des Meeres. Für »Die vergessenen Inseln« reist er durch das Mittelmeer, steuert große Eilande wie Sizilien an, aber auch fast vergessene wie Palagruža. Auf jeder Insel entdeckt er eine Geschichte, die über den Ort hinausweist und zeigt, warum unsere Welt so wurde, wie sie ist. Käsbohrer erzählt von dem Abenteuer, allein auf offener See zu sein, er bringt uns die Sehnsucht nach Weite nahe, die wir alle in uns tragen, und verdichtet seine Reise zu einer Geschichte der Welt, die so noch nicht erzählt wurde.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 675
Ähnliche
Thomas Käsbohrer
Die vergessenen Inseln
Eine Reise durch die Geschichte der Welt und zu mir selbst
Die Wiedergabe des Zitats von Hilary Mantel erfolgt mit freundlicher Genehmigung des DuMont Buchverlags, Köln.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
PENGUIN und das Penguin Logo sind Markenzeichen
von Penguin Books Limited und werden
hier unter Lizenz benutzt.
Copyright © 2018 Penguin Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlag: Favoritbüro, München
Umschlagmotiv: DEA / G. CIGOLINI / VENERANDA BIBLIOTECA AMBROSIANA / Getty Images
Redaktion: Regina Carstensen, München
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-21820-1V004
www.penguin-verlag.de
Für Consti. Für Alex. Für die, die nach uns kommen.
Inhalt
Teil I
Die Wanderung.
Gegenwart. Und Aufbruch.
Milos. Die Suche nach dem Obsidian.
Levanzo. Gebete der Jäger.
Von Sizilien nach Malta. Die Tugenden eines Seemanns.
Gozo. Tempel der glücklichen Inseln.
Paros. Eine schwangere Frau aus Stein.
Kreta.Knossos. Warum leben wir in der Stadt?
Uluburun. Ein Meer voller Schrecken.
Kreta. Chania und der Sturm der Seevölker.
Sizilien. Totenkammern im Fels.
Malta. Die Zeichen der Purpurhändler.
Olympia. Als Sport noch Kult war.
Teil II
Händler. Eroberer. Heilige.
Capraia. Die Ahnen.
Sizilien. Kamarina. Und das liebe Geld.
Salamis. Sieg der Menschen über die Kentauren.
Gargano. Das vergessene Volk der Vogelmenschen.
Elba. Von Häfen, Eisen und dem guten Leben.
Sizilien. Siracusa. Stalingrad.
Sizilien. Der Wikinger und das versunkene Schiff.
Antikythira. Von Menschen und Maschinen.
Mallorca. Und der Aufstieg Roms.
Patara. Gemiler. Demre. Drei Orte und der Mann in Rot.
Sizilien. Die Villa des Tierhändlers.
Spetses. Der Heilige der kleinen Schiffe.
Teil III
Händler. Kaiser. Diebe.
Geschichten. Die unheimliche Macht.
Venedig. Übers Meer im Winter.
Venedig. Von Lagunen und vom Leben in unsicheren Zeiten.
Monemvasia. Der Fels.
Malta. Allein im Dunkel.
Venedig. Diebe.
Mallorca. Ein maurisches Bad.
Trani. Die Kathedrale am Meer.
Sizilien. Im Kreuzgang von Monreale.
Sizilien. Friedrich und Konstanze. König und Königin.
Rhodos. Das Kreuz mit den Johannitern.
Teil IV
Händler. Mönche. Krieger.
Golf von Tarent. Durch die Nacht.
Kreta. Hallen für die Ewigkeit.
Gramvousa. Der Schrei des Nachtvogels.
Sizilien. In der Kapuzinergruft.
Kreta. Venedigs vorletztes Gefecht.
Venedig. Der Priester mit den roten Haaren.
Vis. Österreichs Meer.
Favignana. Wie der Thunfisch in die Büchse kam.
Teil V
Und wieder: Wanderung.
Ein Knoten fürs Leben.
Landenge von Korinth. Ein Kanal für Aktionäre.
Uliveto. Ein Schlachtschiff für einen Kaiser.
Spinalonga. Krank auf einer Insel.
Skradin. Inseln im Strom.
Chalki. Auswanderung der Schwammtaucher.
Malta. Ein Zettel aus der Vergangenheit.
Symi. Eine deutsche Geschichte.
Skorpios. Eiland für zwei Liebende.
Alimia. Oder: Die Welt vergisst nicht.
Sizilien. Die verlassenen Schiffe von Pozzallo.
Venedig. Im Kaufhaus am Rialto.
Aşırlı Adası. Der Mann, der die Inseln liebt.
Kreta. Sven, Sophie und die Suche nach Glück.
Kythira. Über Anfänge. Und Enden.
Anhang
Glossar nautischer Begriffe
Meine Bücher für die Insel
Es gibt keine Enden. Wenn du es denkst, täuschst du dich. Es sind alles Anfänge. Hier ist einer.
Hilary Mantel
Teil I
Die Wanderung.
Gegenwart.
Und Aufbruch.
Eine harte Bewegung weckt mich. Sie dringt in meinen Schlaf, und einen Augenblick lang wehrt sich alles in mir gegen das Aufwachen. Wieder der harte Ruck. Ich schlage die Augen auf. Draußen, vor den schmalen Fenstern meiner Kajüte, ist alles dunkel. Ich halte die Uhr vor meine Augen. 4:30 Uhr.
Vom Land her fallen Böen in die Bucht. Sie sind es, die Levje an ihrem Anker zerren lassen und die harten Bewegungen meines Schiffes verursachen. Sie hatten, wie der Wetterbericht es angekündigt hatte, pünktlich eingesetzt, morgens um eins. Ich war aufgestanden. Hatte eine Weile zugesehen, wie die Böen das Schiff im grellen Licht der Uferstraße in der Bucht schwingen ließen. Hatte verfolgt, ob der Anker hielt, indem ich zwei Minuten den Tiefenmesser beobachtete. Die Wassertiefe blieb konstant. Schließlich war ich wieder in meine Koje gekrabbelt, war eingeschlafen.
Jetzt sind die Böen immer noch da. Ein wenig hackiger, übellauniger als noch vor einigen Stunden. Das Gleißen eines Blitzes, der meine Kammer im Achterschiff erhellt. »Steh auf! Geh nachsehen!«, mahnt mein Hirn. Schlaftrunken mache ich meine Runde durch das schwankende Schiff. Schließe im Halbschlaf Fenster, die noch offen stehen. Werfe einen Blick nach draußen. Plötzlich fallen dicke Tropfen, erst wenige, dann prasselt Regen aufs Deck. Eigentlich ist alles dicht, nur der Niedergang, die Treppe zum Inneren meines Schiffes, ist noch offen. Sie ist geschützt durch ein Stoffdach, die Sprayhood, auf die jetzt schwer der Regen schlägt.
Warum lebe ich so und nicht wie die meisten Menschen an Land, in einer Stadt? Wann hatten die Menschen beschlossen, es sei vernünftiger, sich mit 3891 anderen einen Quadratkilometer zu teilen? Und immerzu aufzubrechen? Egal ob bei Dunkelheit und Regen? Irgendwohin. Auf der Suche nach – ja, wonach überhaupt? Woher kommt meine Unrast, die mich in eine Bucht am äußersten Ende des italienischen Stiefelabsatzes gebracht hat?
Regen auf dem Meer kann es in sich haben. Er ist nicht zu vergleichen mit dem leisen Niesel, wie er bei uns niedergeht. Stattdessen Tropfen wie Geschosse, die im Nu das Wasser knöcheltief auf den Straßen stehen lassen.
Nach einer Weile lege ich mich wieder in meine Koje. Ich gönne mir noch eine Stunde. Und während ich versuche einzuschlafen und noch dem rauschenden Regen zuhöre, verebbt er. Als hätte jemand mit einer entschlossenen Handbewegung den Wasserhahn abgestellt und mit ihm die Böen. Plötzlich liegt das Schiff regungslos da. Der schwere Regen hat die Wellen platt gedroschen. Ich höre nur noch das Gurgeln strömenden Wassers, das sich an Deck wenige Zentimeter über mir glucksend seinen Weg zurück ins Meer sucht.
Als die Harfentöne aus dem iPad mich wecken, ist es immer noch ruhig. Die harten Windstöße sind einem feinen Singen gewichen. Doch ich ahne, dass weiter draußen viel Wind weht. Vor den Fenstern meiner Kajüte sehe ich ein milchiges Grau. Zeit aufzustehen. Mich fertigzumachen.
Ich koche mir Tee. Schütte Haferflocken mit bitterer Schokolade in eine Schale. Früher, als ich noch einen Verlag mit fünfundzwanzig Mitarbeitern führte, hatte ich oft Magenprobleme. Ich schluckte jeden Tag Pantoprazol. Es war das Einzige, was half. Jetzt gönne ich mir jeden Morgen etwas Haferflocken. Magenschmerzen habe ich keine mehr.
Wir wissen, wo wir hinwollen. Unser Tag ist so vollgestopft mit »Tu dies« – »Kümmere dich um das« – »Erledige jenes«. Jeder Tag ist ein organisatorisches Gesamtkunstwerk, das sich jeder Einzelne schafft. Und das ihn schafft. Haben wir die Dinge noch im Griff? Oder haben die Dinge längst uns im Griff?
Mit der Tasse in der Hand betrachte ich das fahler werdende Licht der Straßenlampen am Ufer, die auf einmal verlöschen. Ich starte den Motor, lausche einen Moment seinem beruhigenden Bullern. Dann setze ich das Großsegel. Und hole im Wasser, das der Nordwind kräuselt, den schweren Anker.
Wieso besitzen wir so viele Dinge? Noch vor 500 Jahren besaß jeder Mensch durchschnittlich nicht mehr als zehn Dinge. Ein Messer. Ein Laken. Drei Kleidungsstücke. Einen alten Hocker. Heute? Jeder Deutsche besitzt im Schnitt 10 000 Dinge. Wir haben so viel, dass wir es nicht mehr mit uns führen könnten, selbst wenn wir Rollen dranschraubten. Waren die Menschen damals unglücklicher als wir? Sind wir glücklicher als sie?
Zwei Stunden später. Ich bin auf See, das Kap verblasst langsam hinter mir. Der Wind hat kontinuierlich zugenommen. Vorsichtig habe ich Großsegel und Genua auf zwei Drittel entrollt. Aber irgendwann schwindet die Vorsicht. Levjes Geschwindigkeit ist mir zu wenig und ich setze Vollzeug. Alles, was ich habe.
Die vier Tonnen meines Schiffes schießen wie ein Pingpong-Ball von rechts nach links, von links nach rechts. Es kann den Kurs nicht mehr sauber halten. Zu viel Segel bei diesem Wind. Reffen ist angesagt.
Reffen: die Segelfläche verkleinern. Man rollt die Segel etwas ein. Das klingt einfach, meist sind es schweißtreibende fünf Minuten mit wütend schlagenden Tauen, knatternden Segeln, schepperndem Rigg, in denen ich zusehen muss, möglichst schnell an den Winschen zu kurbeln, mit denen ich die großen Kräfte in den Segeln bändige. Und den um sich hauenden Schoten, den Leinen an den Segeln, aus dem Weg zu gehen. Blaue Flecken und eine aus dem Gesicht gehauene Brille wären jetzt übel.
Nach dem Reffen segelt Levje mit verkleinerter Segelfläche wieder so munter wie vorher zwischen den Wellenkämmen, surft ein Wellental, das seitlich kommt, entlang. Klettert wiegend auf den Gipfel der unter uns durchlaufenden Welle. Ein nettes Spiel, über dem ich schnell vergesse, dass 25 Knoten eigentlich eine Windgeschwindigkeit sind, bei der man Respekt haben sollte, zumal als Einhandsegler.
25 Knoten. Wieder eine Welle, die gischtend vor uns bricht und mein Schiff kurzerhand aus seinem Kurs spült. Aber der Autopilot, der auf langen Fahrten steuert, schafft es in zwanzig Sekunden, die vier Tonnen wieder einzufangen. Der Autopilot ist mein wichtigstes Utensil. Er übernimmt das Steuern, während ich Segel setze, reffe, unter Deck nach dem Rechten sehe.
Wissen wir, welche Erfahrungen, welche Begegnungen, welche gemeinsamen Geschichten in uns stecken? Uns vielleicht ihren Stempel aufgedrückt haben vor Jahrhunderten, womöglich Jahrtausenden? Könnte ich alles benennen, was wir »unsere Kultur« nennen? Könnte ich erfassen, weshalb einer unserer Vorfahren jenes dachte oder dieses tat, weshalb wir Jahrhunderte, Jahrtausende später in einer bestimmten Situation so und nicht anders denken oder handeln?
Kurz nach 13 Uhr erreiche ich etwa die Mitte des Golfes von Tarent. Der Wind klettert über die Marke von 31 Knoten. Auch ohne den Windmesser vor mir im Cockpit wüsste ich beim Anblick der Wellen, was es geschlagen hat. Sie rollen in langen Reihen steil daher. Mauern aus Wasser, eine nach der anderen, ein tiefer Graben dazwischen. Sie treffen mein Schiff seitlich, brechen unmittelbar neben ihm. Spritzwasser weht eimerweise über mich, wenn ich mich nicht schnell genug hinter die Sprayhood ducke. Es geht jetzt in Böen auf acht Windstärken zu. Sturm.
Ende des Spiels. Schluss mit lustig. Als eine Welle genau an der Bordwand bricht, werde ich erst mit Salzwasser überschüttet, dann fliege ich quer durchs Cockpit. Das geht zweimal so. Ich muss was unternehmen. Reffen? Geht nicht mehr – ich habe Vor- und Großsegel schon maximal verkleinert. Dann die nächste Variante: Ich ändere den Kurs, lasse mein Boot jetzt mehr mit dem Wind laufen. »Abfallen«, sagen Segler. Es wird wieder ruhiger an Deck. Und Levje wird jetzt nicht mehr gar so wild von den Wellen geprügelt.
Mein Schiff und ich – wir kommen langsam an unsere Grenze. Ich versuche, mir übers Handy den neuesten Wetterbericht zu holen. Aber schon seit Stunden empfange ich kein Netz mehr. Ich muss sehen, wie ich allein zurechtkomme, hier draußen.
Was treibt uns, auf Wanderung zu gehen, ins Licht, ans Meer? Welche Sehnsucht bringt Männer und Frauen dazu, ab und an mit einem Zelt in den Bergen zu verschwinden? Und die, die es nicht tun, bevorzugt Kleidung mit dem Emblem einer Bärentatze zu tragen? Was steckt in uns von früheren Leben, von denen wir nicht die leiseste Ahnung haben, während wir uns für dies oder jenes entscheiden?
Woher kommen unsere Sehnsüchte? Woher kommt es, dass wir nicht klug genug sind, ihnen zu folgen, dass es immer hundert gute Gründe gibt, gerade nicht zu tun, was unser Herz uns gebietet? Dass wir jederzeit bereit sind, Gier und Begierden, nicht aber unseren Sehnsüchten freien Lauf zu lassen?
Was ist es, was uns treibt?
Milos.
Die Suche nach dem Obsidian.
Fünf dunkelhäutige Männer. Es war ein einfaches Gefährt, in dem die Männer saßen und ihre schweren Holzpaddel bewegten. Ein Boot, gebaut aus Schilfrohr, das sie Woche um Woche im Sumpf der Flussmündung schnitten. Sie hatten zuerst eine Sichel gefertigt. Die kleinen, scharfkantigen schwarzen Steine, die ihnen der wirre Alte geschenkt hatte, mit Baumharz in gekrümmte Äste eingeklebt. Die Sichel sah aus wie der Kiefer eines urtümlichen Fossils. Mit dieser Sichel hatten sie die langen Halme in der Flussmündung geschnitten, sie nebeneinandergelegt und zu baumstarken, bootslangen Bündeln verschnürt. Dann die Bündel miteinander fest zu einem breiten Floß verbunden, verknotet mit Riemen aus Bast und Astrinde. Und zuletzt hatten sie die dünneren Enden der Schilfbündel ineinandergefügt und so kunstvoll verknüpft, bis die zahllosen Schilfbündel die Form eines Bootskörpers angenommen hatten. Bug und Heck waren wie bei einem Kanu nach oben verjüngt und nach innen geschnürt. Das gab Schutz vor den Wellen, wenn sie steil von vorn kamen oder von hinten. Zweieinhalb Männer lang war das Boot und einen halben Mann breit. Jedes der fünf Paddel war aus hartem Holz herausgekerbt und mit Lumpen und Fellresten voll groben Sands glatter und glatter poliert.
Sie hatten abgelegt, als die Sonne fast am höchsten stand. Zwei Mann vorne, zwei Mann in der Mitte, einer hinten zum Steuern. Der ganze Stamm hatte sich am Lagerplatz versammelt, alle waren auf den Beinen gewesen, um den Männern etwas mit auf den Weg zu geben. Kürbisflaschen mit Wasser. Striemen getrockneten Ziegenfleischs. Gesalzenen Fisch. Ein Amulett aus Muscheln. Eine Figur, aus Knochen geschnitzt, das Abbild der großen Gebärerin. Umarmungen, Stirn an Stirn gepresst Mutter und Sohn, Mann und Frau. Keiner vom Stamm war länger als einen Tag auf dem Meer gewesen. Solange sie denken konnten, waren sie an der Küste entlanggezogen. An dem einen oder anderen Ort waren sie eine Weile geblieben, wo sie Wild nachstellten und Beeren und Gräser sammelten. Sobald sie zu weite Strecken zum Lager zurücklegen mussten, zogen sie weiter.
Stets hatten sie am Meer gelebt, doch merkwürdig von ihm abgewandt. Waren Sammler, Jäger. Fingen wilde Ziegen, die sie hielten. Noch keiner im Dorf war dort gewesen, wo die fünf Männer hinwollten, bis auf den blinden Alten. Wer wusste schon, ob sie es schaffen würden, ob sie sie überhaupt erreichen würden, die Insel mit den schwarzen Steinen, die der Alte aus zahnlosem Mund beschrieben hatte. Und wenn es ihnen gelang? Wenn sie tatsächlich die scharfkantigen schwarzen Steine fanden, die so begehrt waren: Würden sie den Stamm jemals wiedersehen? Würden sie jemals zurückkehren?
Dann waren sie losgefahren, hatten zurückgeblickt zum Lager, bis das Festland hinter ihnen verschwunden war. Am Nachmittag kam der Wind. Die Männer kannten ihn, er wehte den Sommer über und wehte aus der Richtung, in der die Sonne unterging, fast von dort, wo sie niemals schien und wo nachts der eine Stern leuchtete, der sich nie bewegte und um den sich alles andere drehte. Der Wind kam jeden Tag, wenn die Sonne ihren höchsten Punkt überschritten hatte. Er begann zu wehen, wenn im Jahr das Licht härter und härter wurde. Und er verlor seine Kraft, wenn die Hitze des Tages vorüber war, das Licht weicher wurde und milder. Er kam, bevor die Winde in der kalten Zeit von dorther wehten, wo mittags die Sonne stand, und von wo sie Regen, viel Regen mitbrachten. Die Männer hatten auf ihn gewartet, der Wind war der Grund, warum sie erst am Mittag losgerudert waren, denn der Wind blies ihr Schilfgefährt von hinten auf ihr Ziel zu.
Als der Wind zunahm, wurden auch die Wellen höher, die von hinten heranrollten, kurz nacheinander. Das Boot passte sich der Bewegung des Meeres an. Die Männer waren zufrieden, als sie am Abend die Bucht einer Insel erreichten.
Voll Stolz nannten sie das Boot »Die große Schlange«. Sie liebten es. In der Bucht krochen sie über Felsen an Land und schliefen am Strand, das Rauschen der Wellen im Ohr.
Am nächsten Tage brachen sie im Morgenlicht auf. Der Weg zur nächsten Insel war lang, sie wollten den einen Moment nicht verpassen, wenn die Sonne aufging und kurz die nächste, weit entfernte Insel vor ihnen im Dunst als Schemen erleuchtete. Sie wussten nun, in welche Richtung sie ihr Boot rudern mussten, um möglichst auf diese Insel zuzuhalten, damit sie, wenn der vertraute Wind am Nachmittag wiederkehrte, sie am Horizont erkennen und sich vom Wind dorthin wehen lassen konnten.
Aber an diesem Tag wehte der Wind nur schwach. Kaum, dass er die Wellen kräuselte. Er zwang die Männer, die ganze Strecke die Paddel zu bewegen. Die Nacht war längst da, als sie sich am Ufer zum Schlafen niederlegten.
Am kommenden Morgen legten sie sich wieder in die Riemen, bis sie gegen Mittag jede Faser ihrer Rückenmuskeln spürten. Die Sonne peinigte an diesem Tag ihre nackten Oberkörper, das Wasser reflektierte die Sonnenstrahlen rundherum. Gerötete Schultern, Schwielen, offene Stellen an der Hand vom knotigen Holz des Paddels, in denen Salzwasser brannte. Meerwasser, das schmutzig ins Boot leckte und jede Bewegung noch anstrengender machte. Vorwärts, nur vorwärts, immer auf die nächste Insel zu, deren Umriss sie erblickten und der nicht näherkommen wollte.
Als es Abend wurde, sahen sie die große Bucht vor sich. Und Rauch, der sich in der Windstille kräuselte und schließlich wie gemeißelt über der Bucht stand. Rauch von Kochfeuern. Die Kraft kehrte in sie zurück, sosehr die Schultern auch schmerzten. Sie steigerten ihre Anstrengung, obwohl keiner von ihnen das Lager kannte und keiner wusste, wie die Leute dort gesonnen waren. Sie legten ihr Leben in die Hand der großen Gebärerin, die einer von ihnen zusammen mit dem Feuerstein und zwei Steinklingen aufbewahrte.
Als sie näher ans Ufer gelangten, starrten Gruppen von Menschen sie schweigend an. Ein Mann betrachtete reglos die fremden Ankömmlinge und wog dabei seinen Speer. Langsam glitt das Schilfboot auf den Strand zu, knirschend schob sich der Bug auf den Kies. Der Mann mit dem Speer drehte den Kopf nach hinten, sprach drei Worte in eine unbestimmte Richtung. Eine Frau brachte Wasser in einem Holznapf, den sie dem Anführer der Ruderer hinhielt. Er trank gierig. Drei andere Frauen tauchten Holzkellen in einen Bottich, gingen vorsichtig auf die Neuankömmlinge zu. Worte fielen. Anspannung wich. Der Anführer der Ruderer bat um Essen. Die Leute am Ufer brachten das, was sie hatten.
Am nächsten Tag ruderten die fünf Männer weiter. Abschied im Morgenlicht, der Mann mit dem Speer begleitete sie zum Ufer. Großzügig hatte er Wasserflaschen füllen lassen und in Körben aus Weidenrinde getrocknetes Ziegenfleisch, etwas Käse mitgegeben. Und Brotfladen aus grob gemahlenen Körnern, auf heißen Steinen am Feuer gebacken. Dankbar hatten die Ruderer alles angenommen und versprochen wiederzukommen, aber nicht mit leeren Händen, sondern als solche, die zu geben hatten.
Als ob der weite Himmel sie belohnen wollte für ihre Gedanken: Kaum war die Sonne über den höchsten Stand hinaus, kam der Wind und blies das Binsenschiff übers Meer. Die Männer mussten nur noch die Paddel benutzen, um sie in die richtige Richtung zu lenken, den Rest erledigte für sie der Wind. Er brachte sie zur nächsten Insel, gerade als die Dämmerung der Nacht wich und sie die Insel voraus nur noch im allerletzten Schein der Abendröte erkennen konnten. Wieder krochen sie an Land, leise. Sie waren ja Fremde.
Die Nacht über hatte es unvermindert weitergeweht. Das war ungewöhnlich für den Wind, den sie kannten. Sie beratschlagten kurz und beschlossen dann, in der Bucht zu bleiben. Einer von ihnen zog los, um Nahrung zu suchen. Am Nachmittag kehrte er zurück und brachte Wasser mit und gesalzenes Ziegenfleisch von Hirten und Sammlern.
Der Wind wehte unvermindert weiter, die zweite, dritte, vierte und fünfte Nacht ebenso, und steigerte sich am sechsten Tag, um mit voller Stärke zu wehen. Gischtfetzen flogen über den Strand, die Wellen überschlugen sich schon weit vor der Küste.
Dann, noch in der Dunkelheit des folgenden Tags, wachten sie auf. Der Wind hatte sich gelegt. Stille am Strand. Nur das Geräusch sanfter Wellen, die ans Ufer plätscherten. Als wäre es nie anders gewesen. Sie schoben ihr Binsenschiff ins Wasser und ruderten aus der Bucht. In der aufgehenden Sonne sahen sie die nächste Insel am Horizont. Sie waren frisch und ausgeruht und ruderten mit Kraft. Noch im Hellen erreichten sie eine Bucht im Norden der nächsten Insel. Sie war menschenleer, doch voller Seevögel, deren Gelege sie absuchten. Mit einem Feuerstein schlugen sie Feuer und brieten ein Kaninchen, das sie am Vortag gefangen hatten. Es gab reichlich zu essen.
Am nächsten Morgen ruderten sie früh weiter. Wenn es stimmte, was ihnen der blinde Alte erzählt hatte – fünf Inseln hatten sie zu passieren –, dann waren sie jetzt nicht mehr weit entfernt von dem Eiland mit den schwarzen Steinen. Sie ruderten weiter. Schon von der letzten Insel aus hatten sie die nächste am Horizont gesehen.
Die Insel entpuppte sich beim Näherkommen nicht als eine einzige, sondern als ein Paradies voller kleiner Eilande, baumbewachsen, über die zwar der Wind hinwegstrich, wo aber keine Welle mehr aufbrandete. Der Wind wehte jetzt die spärlich bewaldeten Hänge herunter, ihr Binsenschiff glitt durch stilles Wasser – ganz so, wie es der wirre Alte erzählt hatte. Die nächste Insel dort vorne voraus, das musste die Insel der schwarzen Steine sein.
Die Männer legten sich ins Zeug. Sie ruderten um einen riesigen roten Felsen, den eine gewaltige Kraft senkrecht nach oben getrieben hatte, in eine große Bucht. Dort sahen sie den Rauch von Feuern, hörten gedämpfte Stimmen, nahmen den Geruch von gebratenem Fleisch wahr. Im weichen blauen Licht lagen zwei Boote, ähnlich wie ihres aus Binsen hergestellt. Männer lagen an verschiedenen Stellen ums Lagerfeuer herum, brieten, was sie erbeuten hatten, oder kauten auf Getreide herum. Ein Großer mit schwarzem Bart trat auf sie zu und grüßte sie in einer Sprache, die sie kaum verstanden. Ja, schwarze Gesteine. Ja, alle seien hier wegen des schwarzen Gesteins, sie sollten sich nur zu ihnen setzen. Am nächsten Tag würde sie zum Sammeln losziehen.
Die fünf: Sie hatten ihr Ziel erreicht.
Am Anfang war der Stein. Stein, den Menschen in die Hand nahmen, wie sie ihn fanden, und benutzten. Sie begannen ihn dann zu bearbeiten, als Werkzeug zu perfektionieren, vor unvorstellbaren zwei Millionen Jahren zum ersten Mal irgendwo in Afrika. Stein begleitete den Menschen als Werkstoff viel länger als alles andere, länger als Eisen, das es gerade 3000 Jahre gibt, oder Bronze, die wir 6000 Jahre kennen, oder Kunststoff. Eine unvorstellbar lange Zeit: Zwei Millionen Jahre diente Stein dazu, sich immer bessere Ausrüstung zu fertigen. Faustkeile. Äxte. Stein ist heute fast vergessen, wo er uns doch auf Schritt und Tritt umgibt.
Aber nicht jeder Stein ist geschaffen, um aus ihm ein Werkzeug herzustellen. Und nicht jeder Mensch ist fähig, aus einem geeigneten Stein auch geeignetes Werkzeug anzufertigen. Steinzeit, das bedeutet: eine weltweit in der Entwicklung des Menschen fortschreitende Fähigkeit und Fertigkeit, sich Stein zunutze zu machen. Fähigkeiten und Fertigkeiten, die in unserer Welt fast verloren gegangen sind. Oder wüssten Sie, wie aus einem Trumm von einem Stein eine Pfeilspitze oder eine scharfkantige Messerklinge zu fabrizieren sind? Der begehrteste aller Werkstoffe, um solche Gegenstände zu fertigen, war Obsidian.
Der markante rote Felsen markiert auch heute noch die Einfahrt in die Hafenbucht der griechischen Insel Milos in der Ägäis. In der Steinzeit, vor rund 10 000 Jahren, lag der Meeresspiegel um mehr als 100 Meter tiefer als heute. Der Felsen, der damals über hundert Meter höher aus dem Meer aufragte, muss für die Menschen der Steinzeit noch drohender gewirkt haben als heute.
Wann die Insel Milos entstanden ist, kann niemand sagen. Bekannt ist nur, dass die gewaltige Detonation eines Vulkans ihr ihre heutige Form gab. Es war aber nicht nur ein einfacher Vulkanausbruch: Die Spitze des Kegels explodierte, flog in die Luft, detonierte, schleuderte unzählige Tonnen an Lava, Gas, Asche und Gestein in Staubform in die Atmosphäre. Man kann nur mutmaßen, in welchem Ausmaß diese gewaltige Explosion das Klima der Nordhalbkugel auf Jahrhunderte beeinflusste und in den Eiskeller schickte.
Zurück blieb: Dunkelheit. Stille. Eine Kraterwunde, die langsam auskühlte. Und voll Meerwasser lief, als der Spiegel des Mittelmeers anstieg. Gesteine aus dem Erdinneren blieben an der Oberfläche, Gesteine, die die Detonation in einer Hexenküche aus jenseitiger Hitze und aberwitzigem Druck erschaffen hatte. Wie das Vulkanglas Obsidian. Es glänzt tiefschwarz, ist hart und scharfkantig wie Glas. Im Mittelmeer gibt es Obsidian nur dort, wo es Vulkane gab oder Vulkane noch immer aktiv sind: auf Milos oder den Liparischen Inseln nahe Sizilien.
Irgendwann nach der letzten Eiszeit, vor mehr als 12 000 Jahren, als das Klima wärmer wurde, lernten die Menschen nicht nur von dem zu leben, was sie umherziehend fanden, sondern sie erwarben das Know-how, Getreide anzubauen, Vieh zu domestizieren und Werkzeuge für genau diese Zwecke herzustellen. Bereits lange vor dieser neolithischen Revolution mussten Menschen Milos erreicht haben. Sie kamen in einfachen Schilfkanus, wobei die Distanzen zwischen den Inseln wegen des tiefer liegenden Meeresspiegels deutlich geringer waren als heute. Trotzdem muss es für sie ein Wagnis gewesen sein, über das offene Meer zu fahren – ohne Kompass, ohne Karte, ohne Kenntnisse, welches Wetter sie am Nachmittag erwartet. Man kann den Mut, der sie beflügelte, oder den Hunger, der sie trieb, nicht genug nachempfinden. Ob aus Neugier oder Not: Sie waren Entdecker und Sucher. Bei ihren Streifzügen über die Insel stellten sie fest, dass es dort dieses scharfkantige schwarze Gestein gab. Und dass Klingen aus ihm schärfer schnitten, widerstandsfähiger waren als jedes andere Gestein. Obsidian wurde zum begehrten Gut.
Zur neolithischen Revolution gehört, dass die Menschen sich zu spezialisieren begannen. Nicht mehr jeder im umherziehenden Nomadenclan machte alles. Die einen konzentrierten sich auf die Landwirtschaft, andere auf Viehhaltung, Dritte fingen an, Vorratsgefäße oder Werkzeuge herzustellen – das war ein enormer Fortschritt. Überhaupt setzte ein Prozess fortlaufender Verbesserung ein. Und mit ihm die Weitergabe an Wissen. Es bedurfte eines unglaublichen Know-hows und der Erfahrung vieler Generationen an Steinbearbeitern, bis die Menschen um 4000 v. Chr. in der Lage waren, die fein gearbeiteten Pfeilspitzen oder glatt geschliffenen Lanzenspitzen herzustellen, die man heute in archäologischen Museen sehen kann. Produkte wie diese müssen ausgesprochen begehrt gewesen sein – und ihr Rohstoff, der unbehauene Obsidian, immer gefragter. Er ist ein Bestandteil unserer heutigen Wirtschaftsform, bei der es um Angebot und Nachfrage geht. Um Bedarf und Begehren. Um Habenwollen und Handeln. Das große Feilschen, das unser aller Leben weiterhin bestimmt, es begann auch hier. Der Handel entstand. Und mit ihm weitete sich die Seefahrt aus.
Der Obsidian aus Milos verbreitete sich über die Türkei bis nach Süditalien und Sizilien. Klingen aus Obsidian wanderten von Hand zu Hand, und manche gelangten durch die Jahrhunderte sicher auch über die Alpen bis zu uns. Obsidian erreichte seine größte Popularität und Verbreitung, als einige hundert Seemeilen weiter nordöstlich der Insel Milos ein revolutionär neuer Werkstoff entwickelt wurde: Bronze.
Der Meltemi. Vor Jahrtausenden trieb er die Schiffe von Entdeckern, Siedlern und Händlern über die Ägäis, und auch ich reise mit ihm, aber nicht auf einem Binsenboot, sondern auf Levje, meinem Segelboot. Ich musste gegen ihn ansegeln, die Ägäis Richtung Westen durchqueren, um den Peloponnes herum über die Adria, um an der Sohle des italienischen Stiefels entlang bis zu einer Insel zu segeln, auf der ich ein paar Jahre später erneut auf Spuren stoßen sollte, von Menschen, die Zeitgenossen der Obsidian-Sammler gewesen waren. Auf einer kleinen Insel im Westen vor Sizilien.
Levanzo.
Gebete der Jäger.
Die Nacht vor der Insel Levanzo, weit draußen vor der Küste Siziliens, schlief ich schlecht. Einen Hafen, in dem ein Segler anlegen könnte, gibt es auf der drittgrößten der Ägadischen Inseln nicht. Nur zwei, drei Buchten, nicht mehr. Ich ankerte in einer, und in ihr stand die Nacht über Schwell. Schwell: Wellen, die in windstiller Nacht von irgendwoher kommen, Levje seitlich treffen und sie in ein Pendeln versetzen, das sich zu einem rhythmischen Schwanken steigert, das mir jede Ruhe raubt und bei dem an Schlaf nicht zu denken ist.
Noch bevor die Sonne aufging, stand ich auf. Und setzte Tee auf dem Gasherd auf. Er ist so montiert, dass er mit jeder Bootsbewegung frei schwingen kann. Selbst im ärgsten Seegang kann ein Topf mit brodelndem Nudelwasser nicht kippen. Nach Maßstäben der damaligen Zeit war Levje, als man sie 1987 baute, mit ihren 9,40 Metern Länge ein großes Schiff. Heute gilt sie als klein. Ein kleines Boot mag in den Wellen heftiger schaukeln, doch im Geschwanke ist es nicht unbedingt ein Nachteil. Käufer tendieren heute zu größeren Schiffen, sie liegen bei Seegang ruhiger. Was auch lockt, ist der Anblick viel freien Raums unter Deck. Auf See sind solche Entwürfe jedoch fatal. Bei Seegang drei Schritte ohne Halt unter Deck zurückzulegen, führt unweigerlich zu blauen Flecken. Es missachtet die alte Seemannsregel »Eine Hand für das Schiff. Eine Hand für den Mann« gröblich. Auf Levje findet meine Hand jederzeit Halt. Wenn ich aus meiner Koje im Heck krieche und aufstehe, erreiche ich mit ausgestrecktem Arm jederzeit etwas, um nicht gegen den Kartentisch, den Spültisch oder etwas anderes zu knallen.
Mit der warmen Teetasse setze ich mich nun auf die seitliche Salonbank und schaue mich um. Ich liebe mein Schiff. Wer sich auf einem Schiff übers Meer bewegt, gerät in Situationen, in denen es vom simplen Gefährt zum Gefährten wird. Ich sehe den Mastfuß aus stabilem Rohr, an dem meine kleine Petroleumlampe pendelt. Er reicht vom Kiel zur Salondecke und trägt den zwölf Meter hohen Aluminiummast, den sechs Stahlkabel, die Wanten und Stagen heißen, nach allen Seiten halten. Bläst der Wind und fangen Levjes 50 Quadratmeter Segelfläche seine Wucht ein, überträgt der Mast diese Wucht auf Wanten und Stagen und Mastfuß – und diese übersetzen die Wucht in Kraft. Kraft, die das Boot mit seinen vier Tonnen durchs Wasser drückt.
Ihr Rumpf besteht aus in Harz getränkten Glasfasermatten. Ihre Wände messen einen halben Zentimeter. Als das Boot auf einer Werft irgendwo im Sauerland entworfen wurde, war man sich über Haltbarkeit und Verwundbarkeit des Materials nicht im Klaren. Sicherheitshalber gestaltete man Wandstärken stabiler als nötig. Es gibt ein Video über einen legendär gewordenen Test einer Yachtzeitschrift aus den Achtzigerjahren. Tester jagten eine Schwester von Levje, eine baugleiche Dehler 31, in voller Fahrt auf ein treibendes Stahlfass zu. Um zu sehen, ob der Rumpf das aushält. Er hielt. Nur das Stahlfass trug ein paar Beulen davon. Dann steuerte man das Boot in einen querliegenden Baumstamm, um herauszufinden, ob der eineinhalb Tonnen schwere Stahlkiel aus dem Rumpf gerissen wird. Der Kiel zerteilte den Baumstamm einfach. Danach navigierte man das kleine Schiff in ein treibendes Stahlfloß, so, dass die Stahlkante des Floßes wie eine scharfe Axt in die schmale Rumpfkante schlug. Wieder nichts. Weil die Redakteure es nicht glauben konnten, wurden sie waghalsiger. Und derber. Sie bugsierten Levjes Schwester nach langem Anlauf schließlich mit Karacho auf die steinerne Mole von Damp an der Ostsee. Sie machte beim Auftreffen auf die Steinquader nur einen harten Knicks nach vorne. Das war alles. Man sieht im Video die ungläubigen Gesichter der Tester. Kein Loch ist im Schiff zu finden, durch das in Sekunden so viel Wasser einströmen würde, dass es sinkt. Nichts dergleichen. Weil sie es nicht fassen konnten, wiederholten sie das Manöver noch zweimal. Außer Kerben und Schrammen im Rumpf trug das Schiff keine Schäden davon.
Obwohl mein Boot dreißig Jahre alt ist und sein Grundriss noch älter, war es seiner Zeit weit voraus. Konzipiert war es zu keinem Zeitpunkt für einen Einhandsegler. Im Gegenteil. Es hat vorne eine zwei Meter lange Koje, in der zwei Menschen gut die Nächte eines Urlaubstörns verbringen können. Der Salon besitzt zwei lange Sitzbänke mit einem Tisch dazwischen, auf denen wiederum zwei Menschen schlafen könnten. Die lange Saloncouch an Steuerbord ist für mein Leben an Bord der wichtigste Teil. Schreibe ich, sitze ich hier. Wenn ich eine Tasse Tee trinke, auch. Bin ich krank, was auf Reisen manchmal vorkommt, schlafe ich mich auf ihr gesund. Bin ich tagsüber müde, ruhe ich dort. Segle ich nachts durch, lege ich mich dort für zehn, fünfzehn Minuten hin, sobald mich die Müdigkeit übermannt. Danach wecke ich mich selbst auf, stehe rasch auf, bin mit vier Schritten an Deck, um zu schauen, ob nicht die Lichter eines Frachters oder einer Fähre genau auf mein Schiff und mich zuhalten. Ist alles frei, schlafe ich weiter für die nächsten fünfzehn Minuten.
Nach der Steuerbordcouch kommt mein Kartentisch. Alle meine Seekarten für das Mittelmeer befinden sich darin. Aber seitdem ich mit iPhone und iPad navigiere, fahren sie nur noch als Reserve mit. Wo der Kartentisch endet, beginnt meine Devotionalienwand. Das Bild meines verstorbenen Vaters hängt hier. Eine Liste mit Orten, an denen ich in den letzten vier Jahren Levje betankte; sie ist zugleich Liste meiner Sehnsuchtsorte. Burano, Brindisi, Grado, Kalamata, Marmaris, Antalya, Heraklion, Athen, Marina di Ragusa, Palermo, Preko. Hinter der Wand mein Bad: ein kleines Waschbecken. Eine Toilette. Der große Wandschrank, in dem Schwerwettersachen, Seestiefel, Lifebelts und Schwimmwesten hängen.
Auf der Backbordseite schließt sich an die Saloncouch die Küche an. Ein doppeltes Spülbecken. Ein Kühlschrank. Ein dreiflammiger Gasherd mit Backrohr. Dahinter meine Koje mit zwei Meter langer Liegefläche und genügend Breite. Die Designer wollten mit Levje ein Schiff für eine typische Familie der späten Siebzigerjahre schaffen, für Vater, Mutter und drei Kinder.
Wenn ich gelegentlich abends Gäste habe, was nicht oft vorkommt, und wir zu fünft in der Enge des Schiffes um den Salontisch stecken, während draußen der Wind weht, dann ist es urgemütlich. Mancher, der Segeln aus den Siebzigern kennt, bekommt einen wehmütigen Ausdruck. Auf Levje zu mehreren zu sein, ist ein klein wenig Rückkehr zu den Anfängen modernen Fahrtensegelns.
Katrin, meine Frau, liebt die Bugkoje. Sie träumt jede Nacht, doch auf dem Boot noch mehr als zu Hause, weshalb ich die Bugkoje »Cinema Paradiso« getauft habe. Es ist Katrins Höhle, wenn sie mich, sobald sie freihat, ein Stück begleitet. Und sie, die ihr Bett zu Hause über alles liebt, schläft im leichten Schaukeln im »Cinema Paradiso« noch besser als daheim. Ist uns Schlafen im Schutz einer Höhle immer noch näher, als wir glauben?
Am späten Morgen legt sich der Schwell. Ich nehme mein Dinghi, mein kleines Schlauchboot, und rudere hinüber an Land. Levje lasse ich vor Anker allein in der Bucht zurück. Im einzigen und gleichnamigen Ort der Insel Levanzo treffe ich Natale. Er ist einer der knapp 200 Einwohner, die ständig auf der Insel wohnen. Ein Bäcker. Ein Lebensmittelladen. Drei Restaurants. Die Menschen auf dem Eiland leben vom Sommer. Dann kommen die Fähren von Palermo, von Trapani, von Marsala im Viertelstundentakt herüber. Und wie die meisten auf Levanzo lebt auch Natale von den Touristen im Sommer.
Er hat einen sehr seltenen Beruf. Er ist Höhlenführer. Sein Großvater, ein strenger Herr, der in Krawatte und Sakko sonntags auf einem Esel über die Insel ritt, vermietete nach dem Zweiten Weltkrieg Zimmer an Sommerfrischler. Unter ihnen war eine Malerin aus Florenz. Sie kam regelmäßig wieder, hatte sich in die Insel vernarrt. Wanderte über Levanzo, stundenlang, redete mit den Ziegenhirten, die zottelige Herden über die kargen Hänge trieben und sich vor schlechtem Wetter unter einem felsigen Überhang im Westen der Insel bargen. Sie hörte, dass unter dem felsigen Überhang mehr war, dass es weitere Höhlen im Westen gab. Unentdeckte. Und dass in manchen wohl Malereien existieren würden. Eines Tages hatte sie sich aufgemacht, war in eine der Höhlen gekrochen – und hatte nichts weiter als eine Höhle gefunden. Aber eines Tages, zusammen mit Natales Großvater, entdeckte sie die Steinzeitmalereien. Weil die Höhle auf seinem Grund lag, führte der Großvater immer häufiger Reisende dorthin. Und so wurde Natales Familie vor zwei Generationen zu Höhlenbetreibern. Und Höhlenführern.
Auf seinem Ausflugsboot nimmt er mich mit um die Südspitze Levanzos herum, nach Westen. Es ist Juni. Schneefarbene Wolken jagen, wabern über die Hänge. Wolkenfetzen wie zerrissenes Gewebe, das sich über vergessenem Gelände auflöst. Alte Schichten und Falten von Gestein über kargem Gebüsch. Eine unglaubliche Weite, in der das Auge an einzelnen Felsformationen Halt findet. Und immer wieder werden Höhlen sichtbar. Höhlen im Gestein. Höhlen in den Hängen.
Nach kurzer Fahrt erreicht das Boot eine winzige Einbuchtung. Natale steuert es an den winzigen Anleger, der nicht mehr ist als ein Schlitz zwischen den Felsen und kaum Schutz bietet, wenn – wie so oft – der Westwind weht. Vom Anleger führt ein ausgetretener Ziegenpfad den Hang hinauf zur Grotta del Genovese. Unter einem tropfenden Felsüberhang liegt ein kleiner enger Durchgang, kaum einen Meter hoch und einen halben breit. Hier muss auch sie sich durchgezwängt haben, die Malerin aus Florenz, um die Höhlenmalereien zu entdecken.
Ich stehe in einem Raum in der Größe eines repräsentativen Wohnzimmers. Ein Raum, um eine Gruppe Menschen aufzunehmen, um die Unbill regenreicher Jahre und kühler Winter zu überstehen. Konstante feuchtwarme 19 Grad Celsius herrschen im fahlen Innern, klamme Kühle legt sich auf die Haut. Vielleicht ist das der Grund, warum jene Zeichnungen sich so gut erhielten, die Bewohner vor vielen Tausenden Jahren in die Wände ritzten. An die Wände malten.
Natale wirft einen Generator an. Zwei, drei Scheinwerfer springen an. Wände, narbig wie die Haut eines Pottwals, liegen sandfarben vor mir. Ein dünner Kalksteinzapfen hängt von der Decke, an ihm ein Wassertropfen. Wie lange er wohl braucht, bis er schwer genug ist, um zu fallen? Zwei Tage? Eine Woche? Fünf? Wie viel Zeit musste vergehen, bis der kleine Kalksteinzapfen eine Größe von vier Zentimetern hatte? In der Grotta del Genovese wohnt Ewigkeit.
Kann man hier leben? Wie kann man hier überleben? Wie lange könnte ich mich in der feuchten Kühle eines solchen Raumes aufhalten, ohne zu erkranken? Ohne mir im Qualm eines Tag und Nacht genährten Feuers irgendetwas Chronisches zuzuziehen? Eine Nebenhöhlenentzündung etwa, die Archäologen oft bei jüngeren Skeletten entdeckten? Etwas an der Lunge? Chronische Bronchitis? Rheuma? Und was ist mit den Zähnen? Es scheint mir jeden Tag wie ein Wunder, dass die Menschheit überhaupt noch da ist. Vom Leiden unserer Vorfahren wissen wir nichts. Denn aus den zwei Besiedlungsphasen, in denen Menschen die Höhlen bewohnten, haben sich zwar Reste der Besiedlung, aber keine Reste ihrer Bewohner erhalten.
Natale nimmt den Scheinwerfer in die Hand. Als er sich bückt, um ihn von unten gegen die Felswand zu leuchten, sehe ich sie. Feine Striche. Linien, die jemand in den Fels ritzte und die als Schatten Gestalt annehmen: Ein Reh, vielleicht ist es auch ein Pferd, steht auf dürren Beinen in der Felswand. Es hat witternd den Kopf gewendet und blickt nach rechts hinten, als würden geblähte Nüstern in diesem Augenblick Gefahr wittern. Die Ohren sind aufgestellt, und während die Vorderbeine noch fest auf der Erde stehen, sind die Hinterbeine erhoben, setzen zur Flucht an. Eine zarte Zeichnung, ein feines Tattoo, in die schrundige Haut des Pottwals gekerbt.
Ein Stück weiter: zwei Pferde. Ein Muttertier mit Fohlen. Auf der anderen Seite, in einer versteckten Nische: die langen Hörner eines Auerochsen, der seinen Kopf gesenkt hält, bereit zum Angriff. Ein muskulöser Nacken, der den massigen Hals und den Schädel mit den gesenkten Hörnern trägt. Nur eine geritzte Linie. Sie erzählt so viel von Kraft, vom Lebenswillen des Tiers, von seinem unbedingten Willen, dieses Leben zu verteidigen.
Vermutlich ist die Höhle voll von diesen geritzten Zeichnungen. Sie bleiben dem Betrachter merkwürdig verborgen. Man sieht sie nicht. Nur wenn Natale den Lichtkegel von unten über den Stein gleiten lässt, werden sie sichtbar. Wie eine Geheimschrift, eingekerbt in die Wände dieses Felsens, als die Welt eine ganz andere war.
Natale erzählt: »Nachdem mein Großvater und die Malerin die Höhle entdeckt hatten, meinten die Archäologen, dass die Zeichnungen aus zwei unterschiedlichen Zeiten stammen. Und sie fanden heraus, dass zweimal Menschen in der Höhle wohnten – vielleicht nicht nur einen Winter sondern länger. Die ältesten Kunstwerke sind die geritzten Zeichnungen. Die Forscher sagten uns, sie wären vor 14 000 Jahren entstanden.«
Ich denke nach. Das muss etwa um die Zeit gewesen sein, als die ersten Seefahrer Hunderte Kilometer weiter östlich ihren Fuß auf die Insel Milos setzten. Wären sie in der Lage gewesen, ihre kleinen Binsenschiffe nicht nur mit dem Wind treiben zu lassen, sondern sie gezielt nach Westen zu lenken, hätten sie die Menschen in der Höhle treffen können.
Ich höre Natale weiter zu. »Die Leute von der Uni sagten, dass die Welt, jedenfalls die nördlich der Alpen, unter dem Eis lag. Das Eis band große Wassermassen. Erst als es schmolz, stieg der Meeresspiegel, zu Zeiten der Höhlenbewohner lag er deutlich niedriger. Vermutlich mehr als 100 Meter. Unglaublich. Wenn wir vor die Höhle gehen und aufs Mittelmeer hinunterblicken, war dort einmal Land.« Er räuspert sich und betrachtet liebevoll den massigen Schädel des Auerochsen an der Wand. »Levanzo und Favignana, die nächste Insel im Süden, waren damals gar keine Inseln, sondern Berge. Sie standen in einer Ebene, und nach allem, was die Forscher hier ausgruben, war die Ebene ganz anders als unser karges Levanzo heute. Es muss Wald gegeben haben. Man fand Wild, Beeren und allerhand, was herumziehende Jäger und Sammler für ein gutes Leben damals brauchten. Die Tiere, die sie jagten, sind hier an den Wänden abgebildet. Pferde. Wilde Rinder, die Auerochsen, Rehe und das kleine Urpferd.«
Natales Lampe erlischt. Die Linie des massigen Stiers ist augenblicklich verschwunden. Die Wand ist wieder, was sie vorher war: ein Stück Fels im feuchtkalten Dämmer der Höhle. Ich denke weiter nach über das, was die Archäologen Natale mitgeteilt hatten. Aus dieser ersten Phase der Besiedlung stammen die Knochen von Landtieren. Wenn das stimmt, waren die Höhlenbewohner umherziehende Jäger und Sammler. Gruppen von Menschen, die an einem Ort ihr Lager errichteten und von dort aus im Umkreis sammelten und jagten. War die Umgebung »abgeerntet« oder aus sonstigen Gründen unattraktiv geworden, zog die Gruppe weiter. Oder es war anders: Winterlager wechselten mit Sommerlagern. Oder ein Anführer meinte, nun sei es Zeit zu gehen. Leben war laufen, unterwegs sein, umherziehen. Auf der Jagd sein. Auf der Suche nach Nahrung und einem sicheren Unterschlupf sein. Unser Kreislauf, unser Blutdruck, der uns innewohnende Bewegungsdrang erzählt jedem von uns jeden Tag diese unsere Geschichte.
Ich höre Natale, der in einem anderen Teil der Höhle mit Kabel und Scheinwerfer hantiert. Aber ich bin zu sehr in Gedanken. Wenn er recht hat und die Höhle mehr als 100 Meter über dem Meeresspiegel lag, muss der Strand etliche Kilometer vor Levanzo weiter im Westen gewesen sein. Das wäre fast immer noch vor der Haustür. Doch dies scheint die ersten Bewohner der Höhle von Levanzo nicht sonderlich interessiert zu haben. Die Ritzzeichnungen beschwören die Tiere des Waldes, nur sie, und nicht die des Meeres. In der Schicht der frühesten Besiedlung finden sich auch keine Reste von Meerestieren.
»Was denkst du? Wie viele Menschen lebten damals auf Sizilien?«, frage ich Natale, während ich langsam zu ihm hinübergehe.
»Das habe ich die Leute von der Uni auch gefragt. Sie sagten: ›Nur etwa tausend.‹ Heute ist Sizilien die größte Insel des Mittelmeers, mit mehr als vier Millionen Menschen.«
Erneut glimmt ein Scheinwerfer hell auf. Sein Lichtkegel fällt diesmal frontal auf eine Felswand im hinteren Teil der Höhle. Auf dem teppichgroßen Wandstück treten handgroße dunkle Flecken hervor. Als ich genau hinschaue, erkenne ich ein Schwein, dessen Ringelschwanz. Seinen gedrungenen Körper, aus dem zwei Speere ragen. Ermattet steht es da, in einem Moment zwischen Flucht und Verteidigung. Rechts daneben der Umriss eines Fisches, gedrungen, mit flachen, scharfkantigen Finnen und Flossen. Es ist unzweifelhaft das Abbild eines Thunfischs. Rund um die Tiere sind andere Figuren gruppiert, darunter solche, die aussehen wie sanduhrförmige Gefäße, wie Krüge mit einem Stöpsel oben darauf. Dazu eine Gruppe von Körpern, die wie die Silhouetten vierbeiniger Käfer daherkommen.
Während sein Lichtkegel über die Figuren wandert, erzählt Natale: »Diese Höhlenbewohner stellten aus Tierfett, Asche und zerriebener Holzkohle dunkle Farbe her und zeichneten damit Einzelheiten ihrer Welt auf die Wände. Die Tiere, auf die sie Jagd machten, wie Schwein, Hirsch oder Rind. Aber auch Meerestiere wie ein Thunfisch sind sichtbar.«
»Und was sind die Krüge und die vierbeinigen Käfer?«
»Nach heutigem Verständnis sind sie weibliche Idole. Frauengestalten, bei denen die Arme nur angedeutet sind. Die vierbeinigen Wesen hingegen sind Männer, die Beine erdverbunden weit von sich gestreckt. Das Glied mächtig zwischen den Beinen. Die Arme muskulös ausgestellt wie die eines Maorikriegers, der mit bleckender Zunge seinem Gegner vor der Schlacht Furcht einflößen will. Der Kopf, halslos und animalisch, sitzt gedrungen auf dem Körper.«
Natale hält kurz inne und fährt dann fort: »Diese Zeichnungen sind wesentlich jünger. Ihre zweite Phase der Besiedlung erlebte die Höhle zwischen 8000 und 7000 v. Chr. Zwischen den Ritzzeichnungen und den Malereien liegen fünf Jahrtausende. In diesen fünf Jahrtausenden hatte sich die Welt vor dem Höhleneingang entscheidend verändert. Es war wärmer geworden. Die Wasser waren angestiegen. Die fruchtbare Ebene und der wildreiche Wald waren auf einen schmalen Streifen geschrumpft, vielleicht sogar ganz verschwunden.«
Ich unterbreche Natale. »Haben Menschen gesehen, dass das Wasser stieg?«
Er schüttelt den Kopf: »Unwahrscheinlich. Das vollzog sich unmerklich. Das war kein Prozess, den man mit bloßem Auge verfolgen konnte. Etwas anderes an diesen Bildern ist wichtig: der Thunfisch. Mein Großvater erzählte, die Forscher hätten in der Schicht der jüngeren Besiedelung neben Knochenresten von Pferden und Rindern auch Reste von Muschelschalen in der Grotta di Levanzo gefunden. Diese haben ihre Speisekarte erheblich erweitert. Sie haben geerntet, was das Meer hergibt.«
Die Veränderung der Welt hatte also dazu geführt, dass Menschen ihre Lebensweise und ihre Fertigkeiten an die neue Umwelt angepasst hatten. Die neuen Bewohner der Höhle kannten nicht nur die Jagd auf das, was ihnen im Revier über den Weg lief. Sie kannten auch den Thunfisch, der alljährlich im Frühsommer in großen Schwärmen zwischen den Inseln zog. Was bedeutet, dass sie zur Jagd auf diese schnellen Schwimmer gut ausgerüstet gewesen sein mussten. Und bewandert in der Kunst, sichere und schnelle Boote zu bauen.
Ich betrachte wieder das Bild an der Felswand: neunzehn kraftstrotzende Männer- und sechs Frauenidole. Vielleicht sind es kultische Symbole. Vielleicht schwingt aber noch etwas anderes mit. Auch wenn es unwahrscheinlich ist: Mir gefiele der Gedanke, dass in diesem Bild eine Art neolithisches Selfie der damaligen Bewohner der Höhle steckt, bei der ein Maler jedes Mitglied des Stamms, vielleicht auch dessen kraftspendendes Idol auf die Felswand pinnte, auf ihr wie einer Website postete. Und von der Gruppe erzählte, die diese Höhle aufgesucht hatte, um zu überleben. Und sich der gemeinsamen Kraft der Gruppe zu versichern für die Jagd. Damit sie keinen Hunger litten.
Als ich zu Levje zurückrudere, wiegt sie sich friedlich in der warmen Brise, die vom Süden in die Bucht steht. Noch immer habe ich die Porträts jener Menschen vor mir und ihre Zeichnungen. Sie sind wie Botschaften. Botschaften wie diese aus einer anderen Zeit sollte ich noch viele finden. Und gar nicht so weit entfernt. Auf einer Insel in der Nachbarschaft Siziliens, eine Tagesreise von der Südküste weiter im Süden.
Von Sizilien nach Malta.
Die Tugenden eines Seemanns.
Ich bin nicht unbedingt ein mutiger Mensch. Ich meide Grusel- und Horrorfilme und werde wohl auch nie welche sehen. Als Kind ging ich hohen Rutschen und Achterbahnen aus dem Weg, traute mich nicht. Ich halte mich auch heute noch nicht für mutig. Ich weiß nicht, was mich bewegt, immer wieder allein aufs Meer hinauszufahren. Ich weiß nur, wie mich draußen, wenn Land hinter mir zu Schemen verblasst und Land voraus noch nicht erkennbar ist, oft ein Gefühl überrascht: in der Weite alle Angst, die mich an Land beherrscht, zu verlieren, mich vermeintlich sicher zu fühlen im Unwirtlichen, in dem alles Bewegung ist. Und kein Halt nirgends. Mich geborgen zu fühlen dort, wo nur noch Himmel und Wind und Wasser um mich sind.
Ich hatte mir Sorgen gemacht. Ich hatte Levje an der Südküste Siziliens zurückgelassen und war nur gelegentlich dorthin gereist. Der Winter war ungewöhnlich mild und freundlich gewesen, es gab kaum Stürme. Aber im Mai war plötzlich alles anders. Es scheint, als würde schlechtes Wetter in Deutschland keinen Tag später seinen Weg über Alpen, Rhône-Tal und Mistral ins südliche Mittelmeer finden und einen böigen Nordwestwind schicken, der tagelang an der Südküste Siziliens die Palmen der Strandpromenade beugt und Büsche biegt.
Nicht genug damit. Die Wetterberichte blieben nicht stabil, änderten ihre Vorhersagen. Kündigten sie am Tag vorher noch »abflauen« und »14 bis 18 Knoten« an, also ein Lüftchen, das einen langen Wimpel streckt, korrigierte man sich bis zum Morgen des betreffenden Tags regelmäßig auf »17 bis 27 Knoten« – also viel Wind, der eine Überfahrt beschwerlich machen kann. Oft genug zeigte mein kleiner Handwindmesser keine drei Meter über dem Boden auch 30 Knoten, ein Wert, bei dem das große blaue Handbuch in meinem Buchregal sagt: »Schwächere Bäume werden bewegt; fühlbare Hemmung beim Gehen gegen den Wind.«
Meinen Aufbruch von Marina di Ragusa nach Malta verschob ich. Nicht dass mein Schiff diese Wetterbedingungen nicht abkönnte. Nicht dass 50 Seemeilen, etwa zwölf Stunden Überfahrt, nicht allein zu schaffen wären. Levje könnte es wohl ab. Aber vor Kurzem hatte ich das Vorstag bis hinunter zum schweren Stahldraht zerlegt, der den Mast fixiert und in seiner aufrechten Position hält, und gereinigt. 30 Knoten sind jedoch kein Wetter für einen ersten Test nach langem Winter. Ich wäre lieber ein paar Stunden an der Küste entlanggesegelt – für den Fall des Falles.
Aber dann brachte das Wetter eigene Notwendigkeiten ins Spiel: »Dienstag nach Pfingsten unverändert Nordwest 16 bis 26 Knoten. Mittwoch und folgende Tage: zehn Knoten. Aus Süd.« Erst zu viel Wind von der Seite, dann wenig Wind. Und genau von da, wo ich hinwollte. Man kann nicht in die Richtung segeln, aus der der Wind kommt. Ich hatte also die Wahl zwischen »Morgen rausgehen. Und den Starkwind aus der richtigen Richtung nutzen« oder ab Mittwoch »Zehn bis zwölf Stunden mich mühsam unter Motor genau gegen den Wind nach Malta quälen«. Ich entschied mich für Ersteres. Weil der Wind jeden späten Nachmittag deutlich auffrischte, beschloss ich, zeitig am Morgen loszusegeln.
Wie hatten sie das gemacht, die in Binsenbooten losfuhren? Die keinen Wetterbericht hatten, nichts, und einfach hinausfuhren? Sie kannten ihre Umwelt besser als wir. Sie wussten, wann es Zeit war rauszugehen. Sie hatten es unter großen Opfern gelernt. Vielleicht konnten sie in der Natur Dinge ablesen, die wir heute sehen, aber nicht mehr deuten können.
Am nächsten Morgen, um 4:30 Uhr, weckt mich der Harfenton aus dem iPad. Ich war sowieso jede Stunde wach geworden. Gemein wie er war, schlief der Wind am Vorabend nach fulminantem Schlussspurt bei Sonnenuntergang ein. Das weite Hafenbecken von Marina di Ragusa war zum ersten Mal seit Tagen im Abendlicht still wie ein Ententeich. Meine Entscheidung war richtig gewesen. Ich hatte Seestiefel, Schwerwetterklamotten, Rettungsweste und Lifebelt aus dem Schrank geholt und im Salon ausgebreitet. Als ob ich mich beschwören wollte: »Morgen? Nein, verschoben wird nicht! Morgen gehst du raus!«
Ich freute mich zu früh. Kaum lag die gelbe Schwerwetterjacke im Salon, begann der Wind von Neuem durch die Wanten zu fauchen. Er hatte sich nur zwei Stunden Luftholen gegönnt. Um Mitternacht wurde ich wach, das Rigg, der Mast und mit ihm alle Drähte, Wanten und Fallen vibrierten im Wind und mit ihnen das ganze Boot. Und so ging es bis morgens um drei. Ich schlief angespannt, mit offenen Ohren.
Um 4:30 Uhr dann Stille. Ich gehe zum Niedergang, schaue dahin, wo sich im Osten erstes Grau zeigt. Noch ein kurzer Blick in den Wetterbericht: nichts von Windstille. Der verheißt etwas ganz anderes, noch mehr Wind sagt er vorher.
Ich sehe noch zwei weitere Wetterberichte an, aus reinem Aberglauben. Alle haben ihre Prognose verschlechtert. Was mache ich? Warnende innere Stimmen. Wann soll man auf sie hören, wann nicht? Und vor allem: Wie soll man drauf hören? Ich besinne mich auf meine alte Regel: »Geh nachschauen, wenn es draußen vor dem Zelt raschelt. Geh nachschauen, was draußen ist!«
Kurz und liebevoll betrachte ich mein Schiff, dessen Details. Den Mastfuß, die Bändsel, die im Niedergang hängen, die Pinne. Levje hat mich von Triest nach Antalya und von Antalya hierher über Kreta nach Sizilien einhand getragen. Zweimal quer durchs halbe Mittelmeer bin ich allein auf ihr gesegelt. Irgendetwas wird bei dieser ersten Reise nach dem langen Winter ganz sicher nicht funktionieren. Aber mein Schiff wird mich nicht vollkommen hängen lassen, wenn’s heftig wird. Los!
Sonnenaufgang in Marina di Ragusa, 5:53 Uhr. Ich starte den Motor und hole die Vorsegelpersenning herunter. Nebenan steckt Aylin den Kopf aus dem Boot, wie jeden Morgen grüße ich sie auf Türkisch mit einem »Günaydın, guten Morgen, Aylin-Hanim!«, was ihr ein Lächeln entlockt und ein fröhliches »Günaydın, Thomas Bey!« Ihr Mann, Goran, ist auch schon wach, im Holzfällerhemd krabbelt er unter der Persenning ihrer weit gereisten Hallberg-Rassy-Segelyacht hervor. Aylin ruft mir zu, dass das Wetter nur hier an der Küste schlecht sei und vor Malta deutlich besser werde.
Noch einen Schluck Tee. Er ist nicht mehr warm. Zum x-ten Mal nehme ich mir vor, die zu Bruch gegangene Thermoskanne endlich zu ersetzen. Ein kurzer Blick ringsum, die Sonne kriecht in meinem Rücken langsam über die flache Küste. Womit sind sie losgesegelt, die Malta um 5000 v. Chr. besiedelten? Was hatten sie dabei? Ein paar Krüge Wasser? Ein paar Striemen getrockneten Fleisches wie Ötzi, von dem man heute weiß, dass er kurz vor seinem gewaltsamen Ende noch einmal ausgiebig aß, sich sicher fühlte, bevor ihn ein Pfeil in die Schulter traf?
Ich starte den Motor. Beruhigendes Bullern. Nur ein Windhauch aus Nordwest, nicht die angekündigten 14 bis 16 Knoten. Ich warte, bis auch dieser Hauch verebbt ist, um nicht auf Aylins und Gorans Boot getrieben zu werden und vor ihren Augen mein Ablegemanöver zu verpatzen. Dann hole ich die Bugleine ein, löse die Muring, das Tau, an dem ich mein Boot im Hafen festgemacht hatte, ziehe mein Schiff von Hand weiter. Hafenschlunz an den Händen. Grüner Glibber und glasige Entenmuscheln. Das Schiff dreht rückwärts, so wie ich es wollte. Ich lege den Vorwärtsgang ein, lege die Pinne hart steuerbord, und das Boot nimmt langsam Fahrt auf.
Aylin und Goran winken im Morgenlicht. In Marina di Ragusa, wo viele Segler überwintern, wird jeder beim Aufbruch von seinen Nachbarn, mit denen er Seite an Seite die langen Monate verbracht hat, verabschiedet. »Fair winds – Günstige Winde«, rufen sie mir zu. Ich bin gerührt. Aylin und Goran sind gute Nachbarn gewesen, haben den Winter über ein Auge auf Levje gehabt.
Für die nächsten Stunden Richtung Malta – mein Ziel ist die Insel Gozo – muss ich Kurs Südsüdwest, 195 Grad steuern. Auf einmal registriere ich Schwell aus Südwest. Gibt es nun doch nicht den angekündigten Nordwest? Macht nichts. Der Schwell ist aber so unangenehm, dass ich beschließe, das Großsegel zu setzen. Das riesige Segel wirkt wie ein Kiel, sorgt dafür, dass das Boot nicht hin und her schwankt. Hoch damit. Ein leichter Wind aus Nordwest, Levje zieht nun ruhig durch den Schwell.
Zeit für ein zweites Frühstück: etwas San-Daniele-Schinken, etwas Provolone, steinhartes Brot und zwei getrocknete schwarze Oliven. Das Herumstehen hat den Tee nicht wärmer gemacht. Langsam nimmt der Nordwest zu, er ist aber immer noch weit entfernt von jeder schlechten Vorhersage.
Gegen acht kann ich den Motor abstellen. Ich habe die Genua, das große Vorsegel, ausgerollt, wir laufen nun mit etwas mehr als fünf Knoten bei zwölf Knoten Wind dahin. Langsam verschwindet die Küste Siziliens hinter mir im Dunst. Ein italienischer Trawler, der die Last seines Netzes durch den Morgen zieht, quert meinen Kurs. Der Fischer winkt mir aus dem Fenster seines Steuerhauses zu. Alles läuft. Nur die Pinne quietscht bei jeder Bewegung fürchterlich. Der Autopilot, der sie jede Sekunde in die richtige Richtung legt, muss sich unangenehm mühen.
Segel am Horizont weit hinter mir, auf meinem Kurs. Da will noch jemand nach Malta und nutzt das Wetter. Der Wind nimmt zu. Wir sind jetzt schnell unterwegs, 5,8 bis 6,3 Knoten zeigt das iPad als Speed-over-Ground, als Geschwindigkeit über Grund, das ist nicht schlecht. Wenn nur dieses widerwärtige Geräusch von der Pinne nicht wäre. Ich gehe unter Deck, hole die Dose mit Gleitöl, vielleicht ist ja nur das obere Ruderlager vom sandigen Regen in Sizilien voll. Wenn es dort regnet, kommt der Regen meist aus Süd. Und weil die Wüste so nah ist, ist der Regen stets rot vom Wüstenstaub. Jedes Mal ist Levje danach gescheckt wie ein Gepard, überall rote Farbtupfer. Aber je mehr ich mich mit dem Öl mühe, das Quietschen bleibt. Merkwürdig. Es ist zu hören, wenn der Autopilot die Pinne nach Steuerbord drückt, ein melodisches »Kriiieeeek – Kriiiieeek – Kriiiieeek«. Vielleicht ist ja die Ruderwelle verbogen?
Wie es für sie damals wohl war, hier draußen in den Wellen? Sie waren Bewohner der Küsten – das Mittelmeer wurde während der langen neolithischen Revolution zuerst entlang der Küsten besiedelt. Sie kannten das Meer und die Küsten, sie waren – anders als ich – Naturmenschen, zwar ohne GPS, aber dafür mit dreifach geschärften Sinnen. Selbst ich, Kind des 21. Jahrhunderts und die meiste Zeit meines Lebens am Schreibtisch, stelle fest, wie sich meine Sinne geschärft haben, seit ich zum dritten Mal acht, neun Monate eines Jahres auf dem Wasser verbringe. Ich denke fünf Sekunden vorher an den Bootshaken, ehe er aufs Deck knallt. Ich ahne im Straßenverkehr das Reh, zehn Sekunden bevor es die Straße queren wird.
Levje läuft nun richtig schön, hält konstant über sechs Knoten. Das ist Spitze für mein kleines Schiff. Elf Kilometer in der Stunde. Wer übers Meer segelt, tut es mit der Geschwindigkeit eines flotten Joggers. Jeder gute Marathonläufer ist schneller. Aber der Reiz liegt nicht in der Geschwindigkeit, sondern darin, dass der Wind mich und mein Schiff, wenn ich es nur wollte, nicht nur 42,195 Kilometer tragen könnte, sondern 40 000 Kilometer. Einmal um die Welt. Ohne Tankstelle. Dies zu wissen, schafft Weite im Kopf.
Und sie, die Seefahrer vor 7000 Jahren? Mit gutem Wind waren sie genauso schnell. Manchmal wurden sie abgetrieben, kamen zu weit nach Osten, schossen am Ziel vorbei. Sie hatten kein Steuer, nur hölzerne Riemen, mit denen sie sich mit aller Kraft ins Zeug legen konnten.
Die Schaumkronen im Westen haben deutlich zugenommen, aus dem Schwell sind lange Roller geworden. Mein Boot liegt zu schräg, die Segelfläche ist zu groß. Und vor allem: Es hat plötzlich eine ungute Neigung, aus dem Ruder zu laufen. Mein Kurs sieht auf dem Wasser wie besoffen aus, wir fahren Schlangenlinie. Schlangenlinie unter Autopilot ist ja schon okay. Aber dies hier ist eindeutig zu viel. Ich beschließe, die Segelfläche zu verkleinern. Das ist Arbeit. Erst das Großsegel dosiert fallen lassen. Fast gleichzeitig auf dem schwankenden Deck nach vorne turnen, zum Mast. Dort die große Öse im Großsegel in den großen Reffhaken einhängen – wogegen sich jedes Segeltuch mit aller Steifheit wehrt. Wieder nach hinten. Reffleine dichtholen, um damit das Segel erneut waagrecht zu spannen. Dann die Großschot durchsetzen und das Segel nach oben entlang des Masts wieder unter Spannung bringen. Alles funktioniert. Sehr gut. Das Boot segelt eindeutig aufrechter, angenehmer. Der befürchtete Windsprung ist nicht eingetreten. Nur das Quietschen der Pinne ist geblieben. Und die Schlangenlinie.
Kriiieeeek – kriiiieeek – kriiiieeek.
Ich freue mich darüber, wie die Segel stehen, wie die Segel ziehen. Ich gehe nach unten, lasse das Boot für einen Moment allein laufen. Durch meine Koje hindurch krieche ich bis ganz nach hinten ins Achterschiff, wo ich das Dinghi gestaut habe. Dahin, wo der Ruderkoker, das Rohr, in dem das Ruder läuft, von oben nach unten durchs Schiff geht. Ich höre, wie keine 20 Zentimeter neben meinen Kopf das Wasser am Schiff entlanggurgelt, spüre unter mir im Dunkel des engen Winkels fast 200 Meter Wassertiefe. Der Ruderkoker. Ich konzentriere mich ganz auf ihn.
Kriiieeeek – kriiiieeek – kriiiieeek.
Das Geräusch kommt genau von da. Aber nicht vom oberen Ruderlager, sondern von unten. Vom unteren Ruderlager? Ich gehe wieder nach oben. Der Wind hat leicht zugenommen, 18 bis 20 Knoten zeigt der Windmesser nun konstant, Spitze 22 Knoten. Aber weil alles fast Halbwind ist, nimmt Levje es locker. Nur die Schlangenlinie wird extremer.
Nach drei Stunden habe ich etwa ein Drittel geschafft. Ringsum nur Wasser mit Wellen aus Westsüdwest, jedoch kein kurzes Mittelmeer-Adria-Hickhack, bei dem die Wellen im 2,50-Meter-Abstand folgen, sondern weite Roller. Levje nimmt sie wie eine Jolle, wie ein federleichtes Curragh, mit dem die Fischer an der irischen Westküste das Meer befuhren, ein mit Fell bespanntes Etwas aus Holzstäben auf dem Atlantik, das wie ein Korken auf den Wellen liegt.
Die Küstenlinien, die sie vor 7000 Jahren bewohnten: Nach dem Ende der letzten Eiszeit, sie heißt nach dem Fluss, nach dem Tal, in dem ich aufwuchs, die Würmeiszeit, wurde das Klima wärmer. Das Eis zog sich aus unseren Breiten langsam nach Norden zurück. Polkappen tauten, die Meeresspiegel begannen unmerklich anzusteigen. Die Inseln lagen damals viel näher beieinander als heute. Schaue ich in meine Seekarte und wären die Bodenverhältnisse heute die gleichen wie damals: Malta läge von Sizilien nur noch 48 Kilometer entfernt, keine 90. Sie hatten es an diesem Punkt leichter.
Kriiieeeek – kriiiieeek – kriiiieeek.





























