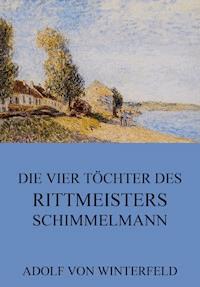
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein komischer Soldatenroman aus der guten alten Zeit. Die Serie "Meisterwerke der Literatur" beinhaltet die Klassiker der deutschen und weltweiten Literatur in einer Sammlung.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 657
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die vier Töchter des Rittmeister Schimmelmann
Adolf von Winterfeld
Inhalt:
Adolf von Winterfeld – Biografie und Bibliografie
Die vier Töchter des Rittmeister Schimmelmann
1. Hasenbalg in der guten alten Zeit
2. Rittmeister Schimmelmann
3. Von Padderow und von Nasewitz
4. Bei Tische
5. Der Floh im Ohr
6. Reaktionen
7. Eine Hofgeschichte
8. Noch ein Josef, aber kein feuriger
9. Wachtparade und Herzensparade
10. Seufzer
11. Irdische Seligkeit
12. Der Floh hat seine Arbeit getan
13. Der Floh bekommt Kinder
14. Vorbereitungen
15. Das Zauberfest bei Rittmeister Schimmelmann
16. Ein Doppelduell
17. Verwicklungen und Lösungen
18. Aller guten Dinge sind drei
19. Schlittenfahrt
20. Die Kugel rollt
21. Othello, der Mohr von Venedig
22. Nummer vier
23. Nachklänge
Die vier Töchter des Rittmeisters Schimmelmann, Adolf von Winterfeld
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849639174
www.jazzybee-verlag.de
Adolf von Winterfeld – Biografie und Bibliografie
Humoristischer Belletrist, wurde am 9. Dezember 1824 zu Alt-Ruppin in der Priegnitz als Sohn eines kgl. Forstmeisters geboren. Diese seine Herkunft aus altem preußischen Adel, unmittelbar von einem Staatsbeamten und zwar des höheren Forstdienstes, in einer kleinen, aber erinnerungsreichen Philister-Kleinstadt, liefert die Hauptmotive für die Gestaltung seines äußeren und inneren Lebens, seiner Carrière und seines Schaffens. Den niederen Unterricht bekam er zu Landsberg a. d. Warthe, trat 1836 in das Kadettenkorps zu Kulm, 1839 in dasjenige zu Berlin und wurde 1843 zum Portepéefähnrich ernannt. Seit 1844 Secondlieutenant beim 2. preußischen Kürassirregiment zu Pasewalk in Pommern, machte er 1848 den ersten Schleswig-Holsteinischen Krieg gegen die Dänen mit, wurde im Herbst 1850 an die Berliner Kriegsakademie versetzt, wo er besonders neuere Sprachen und Literatur studierte, nahm aber nach Beendigung des dreijährigen Kursus 1853 endgültig den Abschied, um künftig sich ausschließlich mit literarischen Studien und eigener Schriftstellerei abzugeben. Er hat seitdem in Berlin seinen regelmäßigen Wohnsitz behalten, aber während der Sommermonate alljährlich größere Reisen und zwar um Land und Leute genau kennen zu lernen unternommen, außer innerhalb Deutschlands besonders nach dem Norden und dem Nordwesten: nach Dänemark und Schweden, den Niederlanden, Belgien, Großbritannien und Frankreich, auch nach Italien; mit besonderer Vorliebe, scheint es, hat er Schweden und England besucht, dass letztere Land stellenweise sogar wie ein Lokalhistoriker durchstreift und englische Volksart und Kultur beinahe mit derselben Hingabe erforscht, die er der schwedischen Literatur zu Teil werden ließ. Auch war es eine Verdeutschung des bis dahin als unübersetzbar geltenden schwedischen Volksdichters Bellman, die ihm 1856 die große goldene Medaille der schwedischen Akademie eintrug, wie die im Auftrage verfasste „Geschichte des ritterlichen Ordens St. Johannis vom Spital zu Jerusalem“ (1859) Ordensverleihungen von vielen deutschen Fürsten, und wohl auch die am 4. Februar 1860 erfolgende Ernennung zum Kammerjunker und die Verleihung der Kammerherrnwürde 1861 wesentlich seiner regen Pflege der Schönwissenschaft zu verdanken sein dürften. Trotz seiner selbstgewünschten Dienstentlassung ist er mit amtlichen und privaten Kreisen der aristokratischen Gesellschaft der preußischen Hauptstadt in ständiger Verbindung geblieben und hat aus diesem Verkehr und der damit Hand in Hand gehenden Beobachtung in gleicher Weise Anlass und Farbe für seine Produktion entlehnt, wie sonst aus seinem aktiven Offiziersleben, aus der Knabenzeit und aus dem Aufenthalte in der Provinz. Im Schlußabschnitt seines Wirkens wollte er nach vergeblichen Ansätzen zu höheren Themen des prosaepischen Faches zu jenen ergiebigen Quellen seiner glücklichsten Periode zurückkehren: da hatte er sich ausgeschrieben, und zudem war das Interesse an seinem souveränen Stoffgebiet bei den maßgeblichen Lesern erlahmt. So war zwar, als W. am 8. November 1888[1] zu Berlin starb, sein Name für die Abnehmer abgelagerten Leihbibliothekenfutters keineswegs erloschen, aber man wähnte eben diesen Mitvertreter einer längst abgetanen Erzählergeneration längst zu seinen Genossen und Gestalten versammelt. – Auch gehörte er zum Prüfungskomitee beim königl. Schauspielhaus.
Diese ganz und gar eigentümliche Richtung, die W. von Anfang an eingeschlagen und mit der eisernen Beharrlichkeit der Selbsterkenntnis verfolgt hat, macht die literarhistorische Bedeutung seiner Schriftstellerei aus und weist ihm in den Annalen der deutschen Literatur, ungeachtet allen verdienten ästhetischen und sonstigen Tadels, einen dauernden Posten zu. Denn er hat eine Gattung, die Militärhumoreske erfunden oder wenigstens – Julius v. Voß war in gewissem Sinne sein Vorläufer – ganz selbständig umgemodelt, dann ihr in der Folge eine Fülle von Sujets abzulocken und den Rang einer, freilich einseitigen Galerie kulturhistorischer Zeitgemälde zu geben gewusst. In den vierziger Jahren unseres Jahrhunderts und bis in die fünfziger Jahre war der preußische Lieutenant noch nicht zur ständigen Zielscheibe des Witzblattspotts geworden, und der Zusammenhang zwischen Volk und Heer, zwischen den feineren Schichten der bürgerlichen Gesellschaft und dem Offizierstande war oft, zumal in kleineren Städten, sogar sehr eng, weil es weder einerseits Hetze und Missgunst, noch andererseits Dünkel, weil es bei beiden Teilen keine Verachtung des andern gab. In diese gerade heute herbeizusehnenden Verhältnisse versetzt uns W. zurück, mit sicherem Stifte zeichnet er uns seine Kameraden in des Königs Rock in Freud und Leid, mit den Äußerungen ihres Tatendurstes, ihrer Begeisterung für das Waffenhandwerk, ihrer fröhlichen Laune, mit ihren Schwächen und Absonderlichkeiten, aber nie am grünen Tische isoliert, nie in die Räume eines „Offizierscasinos“ eingesperrt, sondern unablässig in Konnex, in Kontakt mit dem Zivil, in dessen Handel und Wandel die säbelführenden Herren verflochten werden, ohne eine Kaste im sozialen Alltag einzunehmen oder auch nur zu verlangen. Unwillkürlich wird W. hiernach zum Lobpreiser der „guten alten Zeit“, und er schildert uns deren Vorzüge ohne Schönfärberei in der Tat so treulich und traulich, dass man über die vielen Einseitigkeiten der Menschen von damals, derer in Wirklichkeit und derer bei W., hinwegsieht. Und für diese um ihn herum absterbende Welt, deren allmählichem Erstickungstod er in der Weltstadt Berlin arg betrübt zuschauen muss, bricht er wieder und wieder eine Lanze, eine Überzeugungstreue, die man dem Mitgliede eines meist im Glanze des Lebens sich sonnenden Standes hoch anrechnen sollte.
Es wäre falsch, aus dem Vorstehenden zu schließen, W. sei stehen geblieben; im Gegenteil, in Wahl, Auffassung und Behandlung seiner Vorwürfe zeigt er ein reifendes Verständnis, obzwar es ihm nicht gelungen ist, die Rundheit mehrerer seiner älteren Arbeiten später zu erreichen. Seine Domäne war die rein militärische Offiziersnovellette, gekennzeichnet durch knappen Umriss trotz vollsten Behagens, durch Witz und Laune, durch greifbare Porträtierung und feine Widerspiegelung des ihm so wohl vertrauten milieu. Kaum hat man hier W. als einen Fortsetzer des genannten Julius v. Voß zu betrachten, „der – sagt Gottschall – dass preußische Offiziersleben im Anfange des Jahrhunderts mit so vieler Keckheit geschildert hat“. Doch die Zeiten sind anders geworden; die Offiziere Winterfelds sind nicht mehr die Junker des wackeren Voß. Auch ein Vergleich der literarischen Verwertung des Soldatenhumors durch Friedrich Wilhelm Hackländer ist abzulehnen. Hackländer und W. stehen zeitlich ziemlich neben einander, sich aber nicht im Wege, da ihre Absichten und ihre Mittel zu deren Befriedigung gänzlich verschieden sind, wenn auch manche, wie Richard Weitbrecht, dessen schwäbisches Stammesnaturell freilich dem Winterfelds und seiner alten und jungen brandenburgischen Offiziere wenig Sympathie entgegenbringt, meinen, dass die Äußerungen des Soldatenhumors bei W. „nicht im entferntesten an Hackländer, dessen Gebiet er wirklich ist, hinreichen“. Zugegeben sei, dass W. sonst nur mit vielverwendeten, selbst abgebrauchten Motiven arbeitet, aber dass er mit diesen fast stets und zwar bei jedem unblasierten, noch lachkräftigen Gemüte Erfolg erzielt, beweist sein hervorragendes Talent für humoristische Miniaturerzählung; als Beispiel diene das Genrebildchen „Eine gemischte Ehe“, im 2. Bändchen der „humoristischen Soldatennovellen“, das Heinr. Mahler (Blätt. f. litter. Unterh. 1865, Nr. 5) als ein Kabinettstück, das Kolorit und Zeichnung betrifft, bewillkommnete, obwohl der Hauptpunkt der Handlung schon hundert Mal da war. Auf diesem Felde hat der unermüdlich schreibende W. eine erstaunliche Fruchtbarkeit entfaltet. Dahin gehören: „Garnisongeschichten“ (1856, 3. Aufl. 1861) in Versen abgefasst und die Grundlage seines Rufes, in der letzten, 4. Aufl. illustriert; „Soldaten-Leid, Soldaten-Lust“ (2. Aufl. 1857); „Manöver-Geschichten“ (3. Aufl. 1863); „Der Lieutenant Falstaff“ (1863); „Kadettengeschichten“ (1865); „Die Abenteuer des Lieutenants Puhlmann“ (1865); „Nachhall der Garnisongeschichten“ (1866); „Drollige Soldatengeschichten“ (1875); sodann die drei, die meisten älteren aufnehmenden Sammlungen „Humoristische Soldatennovellen“ (13 Bde., 1860–1877); „Neue Garnisongeschichten“ (11 Bde., 1877–1880); „Neue humoristische Soldatengeschichten“ (6 Bde., 1881–1882); „Schnurren“ (10 Bde., 1875–1884); „Humoresken für Sopha und Eisenbahncoupée“ (10 Bde., 1868–1878). Aber auch in viele der nicht rein soldatisch zugeschnittenen spielen derbe und prägnante Episoden des Kleingarnisonlebens, da namentlich auch Vorgänge im etwas kargen und gleichförmigen Vegetieren alter abgedankter Offiziere, hinein. Figuren, wie die früh verabschiedeten und drum später die ewige Geldklemme nie überwindenden würdigen Herren von Padderow und von Nasewitz, das kernverschiedene Freundespaar – wie W. überhaupt die Kontraste liebt, so namentlich bei Freunden, z. B. in „Die Reisen von Bambus und Comp.“, wo er dies Motiv zu unablässigen Effekten benutzt – fußen zweifellos in Originalen aus der eigenen Aktivität Winterfelds, den die beiden genannten am Abende ihres Lebens einmal selbst als ehemaligen Kameraden und ihren Historiographen herbei phantasieren.
In seinen größeren komischen Romanen hat W. häufig mit viel Geschick drastische anschauliche Stimmungsgemälde aus der Kleinstadtphysiognomie der Zeit von 1820–1860 entworfen; doch passt die Art seiner Schilderung, deren Konturen von vornherein auf einen ganz bestimmten Rahmen zugeschnitten sind, nur auf die preußischen Provinzen Brandenburg und Pommern, allenfalls Sachsen und das nördliche Schlesien. Er wirkt weniger durch sorgfältige Aufnahme von Lokal, Personen und Sachlage, sondern durch den aus seinen Blättern immer von neuem hervorsteigenden altmodischen Duft, die kuriosen Situationen, die drastische Wiedergabe der Eindrücke, der Szenerie, der Charakteristik. Daraus ergibt sich, was an diesen Romanen meist zu tadeln ist: Breite in der Darstellung des dünnen Handlungssubstrats, ans Trivial-Ausgelassene, bisweilen ans Possenhafte streifende Sprache. Die Komposition ist in der Regel recht gelungen, und selbst wo W. in seine Reflexionssucht verfällt, gerät er nicht aus der Entwicklung heraus. Großen Stil, Ideenfülle, höhere Seiten des Humors, etwa feineren Sarkasmus u. dergl., darf man da nicht suchen. W. ist anspruchslos, er will unterhalten, zerstreuen, erheitern, über des Lebens Ernst hinweghelfen, und doch tat er mitunter einen wirklichen kulturgeschichtlichen Griff. Im ganzen sind die älteren Werke von frischem Witz durchzogen, während die späteren einen mannichfach manierierten Stil gesuchter Satire mit den früheren Mitteln aufweisen und dabei doch nicht über die Grenzen von Winterfelds Begabung hinausgelangen. Diese liegt im komisch gehaltenen Konterfei eines Philistergemeinwesens oder auch in der Aneinanderreihung scherzhafter Abenteuer von Pechvögeln und sonderbaren Käuzen. Es seien aus der langen Zahl angeführt: „Die Wohnungssucher“, „Die Reisen von Bambus und Comp.“, „Der stille Winkel“, „Die Ehefabrikanten“, „Modelle“, „Ein gutmüthiger Mephisto“, „Der Winkelschreiber“, „Fanatiker der Ruhe“, „Der Elephant“, „Narren der Liebe“, „Alte Zeit“, „Die Unzertrennlichen“, „Der Fürst von Montenegro“, „Der alte Knast“, „Peter Pinsel“, „Ein Liebling der Furien“, sämtlich drei- oder vierbändig und in dieser Reihenfolge 1864–1879 erschienen. Seitdem ging es mit Winterfelds Schaffenskraft merklich bergab, er wiederholte sich in Erfindung, Fühlung, Ausdruck des Inhalts, und mögen auch noch nach 1880 einzelne Treffer, wie „Hausnarren“ und „Die Reise nach Berlin“, mit unterlaufen, so ist doch z. B. ein Werk wie „Der Waldkater“ trotz eines neuen „Problems“ entsetzlich fad und sein vorletztes, „Das alte Eulenhaus“, nichts als ein Konglomerat von Dingen, die man bei ihm längst gewohnt war, ebenso das letzte, „Der bunte Jakob. Komischer Soldatenroman“ (beide 1889). Immer müssen wir unparteiisch gegenüber den vielen Anfeindern seine Romane dahin Stellung nehmen, dass sie den meisten der jüngeren naturalistischen Schule als Unterhaltungslektüre entschieden vorzuziehen sind: eine geistige Kost sind sie nicht, wollen es aber auch gar nicht. Auch die drei Bände „Lebenskämpfe, Erzählungen“ (1886), wo W. am Schlusse seiner literarischen Laufbahn doch noch einen Ansatz zu höheren Aufgaben machte, zeigen deutlich seine Schranken.
Bezüglich anderweitiger Veröffentlichungen Winterfelds ist auf seine hübsche dramatische Ader hinzuweisen. „Wenn Frauen weinen“ (1859), „Die Touristen“ (1868), „Bäffchens Erben“ (1868), „Nur recht verstehn!“ (1868), „Der Spiegel des Teufels“ (1869), sämtlich kurze Lustspiele „nach dem Französischen“, sind bühnenkundig übertragen, stehen aber hinter seinem selbständigen Lustspiele „Der Winkelschreiber“ (1868), das seit Jahren ein allbeliebtes Repertoirestück des Wiener Hofburgtheaters und nach einer Angabe von 1881 über 70 Bühnen gegangen war, zurück. „Die Memoiren der Frau v. Krilwitz“ (1874) und „Der Hauptmann von Kapernaum“ (1875) sind ebenfalls nette Salonkomödien. „Das Manneken P.. s (d. i. Piß) in Brüssel. Eine Humoreske“ (1. u. 2. Aufl. 1863) bietet größtenteils eine kulturgeschichtliche Plauderei über dieses altvolkstümliche Wahrzeichen der belgischen Hauptstadt, eine Lebensgeschichte des bekannten niedlichen „Brunnenbuberl“, um es vergleichshalber nach einem Pendant des modernen München zu bezeichnen. „Herrn Zappelmann’s heitere Berichte vom Kriegsschauplatz!“ (1870), sind zwei dünne, zum Teil recht amüsante Hefte, die auf dem Titel „von A. Winterfeld“ heißen (sonst fehlt nie die Adelspartikel) und ihm wohl zuzuschreiben sind. „Eine ausgegrabene Reitinstruction“ (3. Aufl. 1883) ist ein hübscher Einfall als anmutiges Gedicht. Besonders in dem Jahrzehnt, da W. seine Muße der Muse widmete, aber noch nicht sein spezielles Feld entdeckt hatte, haben ihn vielfach Übersetzungen beschäftigt: aus dem Schwedischen der Tragödie „Erik XIV.“ von Börjesson (1855), „Der Schwedische Anakreon. Auswahl aus C. M. Bellman’s Poesien. Nebst Sammlungen über Bellman’s Leben und Charakteristik“ (1856), von J. P. Willatzen 1892 in Schatten gestellt, dann 1866 der „Gedichte Königs Karl’s XV. von Schweden“, die ja in demselben Jahre nochmals und 1870 von Gottfried v. Leinburg verdeutscht wurden; ferner hat W. den Spanier Zorrilla, den niederländischen Dichter Hendrik Tollens (1780–1856), den dänischen Johan Herman Wessel, der im 18. Jahrhundert lebte, auch Romane, Novellen, Dramen, Geschichtliches übertragen. Am sichersten beherrschte er wohl das Englische, und wie er Robert Burns’ „Lieder und Balladen“ 1860 in nett nachgefühlter Form herausgab, auch damals ein kleines Repertorium über unser Wissen von Shakespeare „nach fremden und eignen [diese wohl nur betreffs der Autopsie Stratford’s] Forschungen“ lieferte, so hat er auch die höchst interessanten „Blätter aus dem Tagebuche eines Schauspielers, mit Erinnerungen und Klatschereien aus der Garderobe und von der Bühne in England und Amerika. Von Georg Vandenhoff. Aus dem Englischen übersetzt, für das deutsche Publikum bearbeitet und mit Erläuterungen versehen“ (1860), die vier Bände „Unglaubliche Geschichten“ (1879), „nach dem Englischen“ herausgegeben, und wie Zupitza übersichtlich einleuchtend gemacht hat, eines seiner gelungensten Erzeugnisse, den komischen Roman „Der Elephant“ (1870) im Gange der Geschehnisse ganz und gar an Oliver Goldsmiths Lustspiel „The stoops to conquer“ angelehnt. Da letztere Tatsache nicht vermerkt ist, könnte derselbe Fall vielleicht auch anderwärts vorliegen. Endlich hat W. 1859 in einem starken Quartbande die „Geschichte des Ritterlichen Ordens St. Johannis vom Spital zu Jerusalem. Mit besonderer Berücksichtigung der Ballei Brandenburg oder des Herrenmeisterthums Sonnenburg. Mit Illustrationen“ in anerkennenswerter Weise dargestellt, wo er als Ehrenritter die Vergangenheit des Ordens bis zum Jahre 1855 herab, unter Beifügung von allerhand einschlägigen Dokumenten, verfolgt. Freilich haben seitdem Herrlich, „Die Ballei Brandenburg des Johanniterordens“ (2. Aufl. 1891), und v. Finck, „Übersicht der Geschichte des souveränen ritterlichen Ordens St. Johannis vom Spital zu Jerusalem und der Ballei Brandenburg“ (1890), die Sache von neuem behandelt.
Die vier Töchter des Rittmeister Schimmelmann
1.Hasenbalg in der guten alten Zeit
Obgleich Hasenbalg erst im Jahre 1702 funkelnagelneu aufgebaut war, so hatte es in der Zeit, in welcher unsere Geschichte nun bald beginnen wird, doch schon wieder ein altes Gesicht.
Jedes einzelne Gebäude sah aus, als säße es schmerzvoll zusammengesunken und mit trübgeweinten, glasigen Augen auf dem Grabe seines Vorgängers, den es nimmer und nimmer vergessen könne. Während eines so langjährigen Seelenkummers geht natürlich die straffe Haltung des Körpers verloren, und so kam es denn auch, daß sämtliche Häuser von Hasenbalg sich müde eines auf das andere lehnten, wie eine Reihe eingeschlafener Menschen, die ihre Köpfe auf des Nachbars Schulter sinken lassen.
Bloß an dem großen viereckigen Markt trat diese Erscheinung weniger auffallend zutage, als in den langen, leicht gekrümmten Straßen mit den verbindenden Nebengäßchen. Die Häuser hatten hier vielleicht mehr Selbstbewußtsein und setzten einen gerechten Stolz darein, das Herz der Stadt zu bilden und den berühmten Marktplatz zu garnieren, der nicht allein durch Cannabich verewigt worden ist. Außerdem konnten sie sich nicht so ungestört dem träumerischen Brüten überlassen, wie die anderen Gebäude, denn die Rekrutenunteroffiziere der vier Eskadrons mit den dazugehörigen Gefreiten machten hier den ganzen Tag über einen solchen Höllenspektakel, daß Schwermut und Melancholie nicht dagegen aufkommen konnten.
Die Umgegend der Stadt bot auch durchaus keine landschaftlichen Reize. Sonst sieht man doch bei anderen Orten ein Wäldchen, das sich schweigsam ausdehnt, eine stille, blumige Wiese, über die morgens und abends geheimnisvoll die Nebel wallen; einen Hügel, von dem man in die weite Welt schauen kann, einen Bach, der schwatzend durch die Ebene läuft; von dem allen hatte Hasenbalgs Feldmark nichts aufzuweisen; nicht einmal des Kornes bewegte Wogen erblickte man im schönen Halbmond, sondern die weiten Ebenen waren nur mit des Tabaks und der Kartoffel narkotisch duftendem Gewächs bedeckt.
Wenn die Fremden nachher im "Deutschen Hause" ihren aufgeschwitzten Kalbsbraten verzehrten, äußerten sie sich gewaltig unzufrieden über den abscheulichen Geruch, der draußen auf der Gegend lag; die eingeborenen Hasenbalger aber lachten dazu und sagten, das wäre ein großer Segen für die Stadt; denn die ältesten Leute könnten sich nicht entsinnen, daß jemals ein hiesiger Bürger oder eine hiesige Bürgerin den Schnupfen oder eine sonstige Verstopfung gehabt habe, welche Krankheiten allein durch die heilsamen Kommunikationsbeförderungen des Tabaks im Keim erstickt würden.
Was den Charakter der Hasenbalger Bevölkerung anbetrifft, so harmonierte er mit dem Charakter der Gebäude, den morschen Gehäusen ihres kleinen Lebens.
Die Ackerbürger hatten nicht viel zu tun. Wenn im Herbst ihr Feld bestellt war, setzten sie sich in Schlafrock und Pantoffeln ans Fenster und starrten auf die Straße hinaus, und da diese die Phantasie nicht sonderlich anregte, so standen sie von Zeit zu Zeit auf, gingen an das kleine, dunkelbraune Wandspind und gossen sich ein Schnäpschen ein. Davon wurden sie allmählich warm, und wenn sie erst ein halbes Dutzend hinter die Binde gegossen hatten, dann bekamen sie eine rote Nase und wäßrig freundliche Augen. Wenn das aber manch Jährchen so fortgegangen war, kriegten sie das Zittern in den Händen und zuletzt klappten sie den Deckel ihrer Kanne zu, legten sich mit dem Gesicht nach der Wand und verließen diese Welt des Atmens.
Die Materialwarenhändler stehen schon auf einer höheren Stufe der gesellschaftlichen Bildung, einige von ihnen sind sogar ressourcenfähig, obgleich sie ihren Hauptverdienst aus dem Schnaps und der Wichse ziehen, die sie an die Soldaten verkaufen. Wie die kleinen Gastwirte, gehen sie den ganzen Tag in Pantoffeln und stehen bei gutem Wetter gelangweilt und verdrossen in der engen Tür ihres fettigen Ladens, und nur wenn ein Dragoner oder ein Dienstmädchen mit einem Sechser zwischen den zarten Fingern kommt, verzieht sich das Sauregurkengesicht des Krämers zu einer Art von Lächeln und er schlendert mit ladenschwenglicher Artigkeit hinter den Tisch und bedient seine Kunden. Wenn aber die Ressourcestunde schlägt, dann zieht er Stiefel und einen anderen Rock an, knüppert sich ein Paar steife Bäffchen um den Hals und geht mit dem Stolz eines spanischen Granden nach dem gelben Rathaus hinauf, in dessen oberen Räumen das Gesellschaftlokal sich befindet.
Dort mischen sich Offiziere und Bürger auf die glücklichste Art untereinander.
Wer durch seine gesellschaftliche Stellung und unbescholtenen Ruf das Recht erworben hat, diese heiligen Hallen zu betreten, der ist den anderen vollkommen ebenbürtig, ein Mensch den Menschen gegenüber, ein Honoratior den Honoratioren.
Zu diesem freundlichen, gegenseitigen Umgange trug natürlich die Länge des Zusammenlebens in so engem Rahmen nicht unwesentlich bei. Man sah sich täglich auf der Straße, man wohnte miteinander in denselben Häusern, die Offiziere heirateten nicht selten Bürgertöchter, manchmal aus Liebe, manchmal aus Langeweile, manchmal auch aus pekuniären Rücksichten. Denn das Offizierkorps war nicht reich; die meisten hatten nur eine bescheidene Zulage, einzelne sogar nicht einen Groschen. Von Luxus war da gar keine Rede; man trug für gewöhnlich Röcke mit so verblichenen Farben, wie sie heute gar nicht mehr denkbar sind; man wohnte in den allereinfachsten Räumen; bei Tische wurde niemals Wein getrunken, nur bei Gelegenheiten; dann aber ordentlich. Auf der Ressource aßen die Unverheirateten Abendbrot, und das Getränk bestand aus Bier und Grog.
Außerdem gab es eigentlich keine Vergnügungslokale; man müßte denn die kleine Weinstube von Schleckmann dazu rechnen, welche der alte Oberst von Hollprägel nie anders nannte, wie die Giftbude, und dann das Lokal des Konditor Schlichter, an der Ecke vom Markt, wo einzelne verspätete Leutnants und Fähnrichs den sogenannten "Nachtklub" zelebrierten.
Damit hatte aber die Geschichte auch vollständig ein Ende; andere Orte, um Geld auszugeben, gab es neben den laufenden Bedürfnissen nicht.
Trotz dieses einfach veranlagten Lebens hatten doch die meisten Offiziere Schulden; der eine mehr, der andere weniger, erhebliche Summen aber niemand. Gehalt und Zulage reichten aber nur für das Allernotwendigste hin, und wenn von den monatlichen zwanzig Talern die verschiedenen Beträge für Kleider-, Witwen-, Musik- und noch andere Kassen in Abzug gebracht wurden, dann blieb für jeden Tag nur herzlich wenig übrig.
Im Winter war das Leben allerdings ein wenig teurer als im Sommer; da kamen Schauspieler nach Hasenbalg, bei denen man für fünf Silbergroschen den Abend abonnieren konnte, und dann die Bälle; das kostete allerdings auch immer etwas, obgleich es jeder in der Hand hatte, wieviel er dranwenden wollte.
Also ein kleines Leben im engen Rahmen; vom Dienst in die Kneipe, und von der Kneipe wieder in den Dienst; auf dem Markt trampeln fortwährend die Rekruten und in der offenen und geschlossenen Reitbahn geht es den ganzen Tag immer rundum, immer rundum, daß einem ganz dumm und dämlich dabei zumute wird. Und in den Zwischenpausen geht man einmal zu Hause mit heran, holt sich den Schlüssel, bürstet sich vor dem halbblinden Spiegel die Haare, watet über den elastischen Dunghaufen, geht in den Stall zu den schnuppernden Pferden, hebt ihnen die Decken auf, klopft die festen Hinterbacken und macht sich dann sachte wieder auf den Weg zum Dienst oder in die Ressource.
Manchmal besucht auch wohl einer den andern, dann wird eine Pfeife oder eine Zigarre angeboten und die gewöhnliche Unterhaltung geführt, manchmal auch gar keine; sondern wenn der Gast seine Pfeife ausgeraucht hat, stellt er sie in eine Ecke, setzt sich die Mütze auf und sagt: "Na, atje!" – "Na, atje!" wiederholt der andere, "komme nicht zu spät auf die Ressource!" –
Diese Unterhaltung kam namentlich beim "alten Grafen" vor, der nicht viel sprach, aber der einzige Offizier war, der eine Zeitung hielt, an der er den ganzen Vormittag mit der gespanntesten Aufmerksamkeit studierte. Wenn man ihn nachher fragte, was drinstände, wußte er es allerdings nie, oder er wollte es nicht sagen, was auch eine Möglichkeit ist. –
Der Leutnant von Nasewitz wollte zwar gesehen haben, daß der alte Graf oft das Zeitungsblatt verkehrt halte; aber dem konnte man nicht unbedingten Glauben schenken, das war ein arger Spötter, davon konnte der arme Padderow ein Liedchen singen, obgleich er eigentlich sein bester, ja unzertennlicher Freund war. – Herr von Nasewitz meinte es auch durchaues nicht schlecht mit ihm, im Gegenteil, er liebte ihn und konnte nicht ohne ihn leben; aber ebensowenig konnte er es unterlassen, ihn zu necken und ihm oft die schlimmsten Streiche zu spielen; daran fand er nun einmal sein Vergnügen; sowie er den Padderow sah, ging es los, und wenn er ihn nicht sah, dann zerarbeitete er sich den Verstand, um eine neue Marter für seinen Freund zu erfinden. –
Wenn Hasenbalg keine Garnison gehabt hätte, würde es das trostloseste Nest gewesen sein, das je die Sonne beschienen; aber die Dragoner brachten doch etwas Leben und Bewegung hinein. –
2.Rittmeister Schimmelmann
Eine pechschwarze Novembernacht lag noch in träger Ruhe über Hasenbalg, obgleich das Städtchen schon seit geraumer Zeit begonnen hatte, Tag zu machen.
Um fünf Uhr fängt das erste leise Regen an.
Da verläßt der Trompeter nicht sein Grab, wie in der nächtlichen Heerschau, sondern die harte Pritsche auf der Hauptwache, blinzelt mit blöd verschlafenem Auge nach seinem Instrument, hüllt sich in den groben Reitermantel, tritt auf den Markt hinaus und bläst mit noch schlaffen Lippen nach allen Richtungen hin, die morgenheiseren, entsetzlichen Töne der Reveille.
Dann öffnet der Soldat die Stalltür. Da liegen die Pferde auf der weichen Streu und pusten und stöhnen noch im besten Schlaf, daß es dem Dragoner fast leid tut, sie zu wecken.
Jetzt hört er aber im Vorderhause eine Haustür gehen, dann sporenklirrende Tritte und das leise Räuspern des Beritt-Unteroffiziers, und schnell ruckt er die Pferde an den langen Ketten empor, ergreift Striegel und Kartätsche und beginnt mit fanatischem Eifer sein treues Tier zu putzen.
Gleich darauf wird die Stalltür von außen geöffnet, ein kalter Luftstrom dringt in den dünstegeschwängerten laulichen Raum, und der Korporal empfängt die Meldung des Dragoners, ob in der Nacht etwas vorgefallen sei. –
Wenn die Beritt-Unteroffiziere in dieser Weise ihre sieben bis acht Quartiere durchgegangen sind, begeben sie sich zum Morgenrapport beim Herrn Wachtmeister. Das ist ein wichtiger und gestrenger Mann, die rechte Hand des Rittmeisters, oft von größerem Einfluß als die Offiziere.
Er ist noch im Schlafrock, wenn die Korporale eintreten, und empfängt sie im Bewußtsein der ganzen hohen Würde seiner Stellung. Seine Rede ist kurz und gemessen, der Ausdruck in seiner Art gewählt, jede Bewegung zeigt, daß er zum Herrscher geboren.
Wenn der Rapport beendet ist, gehen die Unteroffiziere wieder nach Hause. Die verheirateten finden ein Töpfchen heißen Kaffee vor; die unverheirateten trinken wohl lieber einen handlichen Kümmel, der sie schneller erwärmt. – Es ist draußen noch so finster wie ein Sack. Der rauhe Westwind streicht über die Tabaksfelder und pustet deren narkotisches Aroma den alten wackligen Häusern ins Gesicht, daß sie sich schütteln, als wenn sie niesen wollten, und manchmal kommt auch wirklich ein ängstliches Kreischen und Pruschen zum Vorschein. Das sind aber die losen Dachrinnen und die rostigen Wetterfahnen, mit denen der Wind spielt in seiner tollen Laune.
Allmählich beginnt es auf den Straßen lebendiger zu werden. Die Bäcker und Materialwarenhändler öffnen ihre Türen, gähnende Dienstmädchen mit Federn in den Haaren, einem warmen Tuch über dem Kopf, und die frierenden Hände unter der Schürze, kaufen ihre Frühstückssemmeln ein, und die ersten Dragoner führen nach der bedeckten Reitbahn. Der müde Kerl hängt noch in den Knien, die ganze Figur ist gesackt, der schwere Tritt dröhnend und schurrend zugleich, während das klügere Pferd mit still gesenktem Kopf leicht und behende neben ihm hergeht und vorsichtig die tiefen Löcher in dem schlechten Straßenpflaster meidet. Mehr und mehr Dragoner ziehen nach der Bahn, und wo einmal ein Pferd laut wiehert oder schnauft, da schlagen auf dem Hof die Hunde an und in dem Hühnerstall fliegt's durcheinander.
Dann kommen die Unteroffiziere und Gefreiten, und zuletzt eilt mit emporgeschlagenem Mantelkragen der Leutnant säbelklappernd hinterher, noch ohne Kaffee, weil er die Zeit verschlafen.
Die Uhr schlägt sieben auf den Kirchentürmen.
Lassen wir jetzt die Dragoner immer rundum reiten in der Bahn, den Unteroffizier kommandieren, die Gefreiten korrigieren und den Leutnant im Stehen wieder einschlafen, und begeben wir uns nach einem alten, baufälligen Hause, nicht weit von dem gelben Rathause, mit dem grünen Türmchen drauf.
Die Fenster sind noch alle kohlschwarz, nur hinter den zerbrochenen schmutzigen Scheiben der Soldatenlammer neben dem Stall leuchtet ein trübes, schmutziges Licht, und ab und zu bewegen sich die schattenhaften Formen eines anscheinend menschlichen Wesens durch den kleinen matterhellten Raum.
Dann öffnet sich die Tür und ein Mann tritt auf den Hof heraus. Den oberen Teil seines gedrungenen Körpers bedeckt eine warme Unterjacke, die vorn mit weißen Bändern zugebunden ist, um die kurzen kräftigen Beine bläht sich eine steife, bei jeder Bewegung wie ein Schurzfell knatternde Lederhose, und die strumpflosen, merkwürdig großen Füße stecken in einem Paar noch größeren Holzpantoffeln. Soweit wir, bei der mangelhaften Beleuchtung der Öllaterne, den Kopf des besagten Individuums zu erkennen vermögen, besteht derselbe aus einem dicken, runden Schädel, auf dem die ungekämmten, aschblonden Haare wie auf einem Staubbesen emporstehen; die Stirn ist auffallend niedrig, die Augen auffallend klein, die Backen auffallend blau, Mund und Ohren auffallend groß.
Der Mann trägt in der linken Hand die bewußte fettige Öllaterne und über dem Arm ein Paar Beinkleider, in denen bereits die Stiefel stecken, und einen Uniform-Überrock, während die Rechte einen Korb voll Torf hält.
Nachdem er seine Kammertür sorgsam wieder zugemacht, watet er mit hochgezogenen Beinen über den elastischen Dung, wie ein Storch auf nasser Wiese, klinkt dann eine Tür des Quergebäudes auf, stolpert polternd eine schmale Hintertreppe empor und befindet sich auf einem engen Flur, einer dritten Tür gegenüber.
Das Individuum stellt den Korb auf die Erde, holt erst tief Atem, legt dann die rechte Hand ganz leise und vorsichtig auf den Drücker, tritt behutsam in ein dunkles Zimmer, das von kaltem Torfgeruch durchduftet ist, zieht seinen Korb nach sich, schließt die Tür, wirft einen ängstlichen Blick auf eine helle Stelle in dem jetzt dürftig erleuchteten kahlen Zimmer und holt abermals aus tiefster Seele Atem, als wenn ihm wider Erwarten etwas gelungen wäre.
Nachdem der Mensch noch eine Weile unbeweglich gestanden, trägt er Korb und Laterne nach einem alten, schiefen, schwarzen Ofen, legt dann Beinkleider und Rock auf einen Stuhl, kniet nieder, packt ein Stück Torf nach dem andern in die dunkle Öffnung, zündet die Kienspäne an seiner Öllaterne an und versetzt auch bald das Heizungsmaterial in Brand.
Der Torf glimmt auf, der Ofen beginnt zu bullern.
Das Individuum hockt noch immer vor dem Ofenloch, und scheint sich an der warmen Flamme zu ergötzen, die phantastisch auf seinem dicken Angesichte spielt, als ein plumper, knurrender Ton durch das unheimlich kalte Gemach dringt.
Der Mensch fährt zusammen, als wenn er einen Schmerz empfunden hätte, und sitzt dann mäuschenstill, als wenn er mit dem ganzen Korper horchte, was nun kommen würde.
"Knurr!?" machte jetzt die rauhgekratzte Morgenstimme schon etwas deutlicher.
"Zu Befähl, Herr Rittmeister, eben sieben Uhr geschlagen", stößt der Bursche mit militärischer Genauigkeit heraus, obgleich ihm der Atem stockt vor Angst.
Dann erhob er sich aus seiner knienden Stellung und steckte ein halbes Talglicht an, das auf einer alten invaliden Kommode unter einem alten kurzsichtigen Spiegel stand.
"Knurr!" krächzte jetzt die Stimme wieder, während eine gebrechliche Bettstelle in ihren Grundfesten knackte.
"Zu Befähl, Herr Rittmeister; alles gesund!" stellte sich der Kerl gerade und versuchte die beiden kleinen Finger hinter die nicht mehr vorhandenen roten Biesen seiner steifen, gestickten Hose zu legen.
Dann knackte die Bettstelle noch einmal und aus den lichten Kissen richtete sich mühsam und gliedersteif eine Figur empor, deren pechschwarzer Kopf seltsam mit seiner weißen Umgebung im Widerstreit lag.
Der Bursche stand wie gebannt unter dem stechenden Basiliskenblick der kleinen Augen unter den struppigen Brauen.
"Hat Malwine noch ein dickes Knie?" gurgelte der Gestrenge, nun schon zu menschlichen Worten übergehend.
"Zu Befähl, Herr Rittmeister, nein; ich habe ihr bis Mitternacht Umschläge gemacht."
"Knurr! – Auguste nicht wieder den Schwanz gescheuert?"
"Zu Befähl, Herr Rittmeister, nein!"
"Alle drei gut gefressen?"
"Zu Befähl, Herr Rittmeister, ja!"
"Knurr! - Wetter?"
"Zu Befähl, Herr Rittmeister, räucherig!"
"Gut!"
Der Bursche machte eine so steife, ungeschickte Rechtsumwendung, daß er aussah, als wenn ein hölzerner Soldat ins Schwanken kommt und umzufallen droht; dann stakste er mit seinen großen Holzpantoffeln und ballernden Lederhosen der Flurtür zu.
"Pätel!" knurrte der Machthaber, als jener bereits die Hand nach dem Drücker ausstreckte. Der dicke Bengel bekam einen Schreck und machte jetzt eine so total verunglückte Kehrtwendung, daß er entschieden umgefallen wäre, wenn sein Rücken nicht einen Stützpunkt an der Wand gefunden hätte.
"Um neun Uhr die Käthe satteln... knurr!"
"Zu Befähl, Herr Rittmeister!"
Dann machte er abermals kehrt, verließ das Zimmer und stürzte mit lautem Gepolter die schmale Hintertreppe hinunter.
Der Rittmeister Schimmelmann war der älteste Schwadronschef im Hasenbalger Dragonerregiment, dem man seine sechzig Jahre gut und gerne ansah, obgleich er das volle Haupthaar und den übermäßig starken Schnurr- und Backenbart kohlschwarz gefärbt hatte.
Das von Pockennarben zerfressene Gesicht mit den kleinen stechenden Augen verriet auch noch nicht den angehenden Greis, aber wenn er auf der Straße ging, dann sah er so krumm, so steif und so stackrig aus, als wenn ihm alle Gelenke verrostet wären, und man wunderte sich eigentlich darüber, daß es nicht kreischte und quietschte, wenn er die Beine voreinander setzte, wie es die alten Wetterhähne auf den Dächern taten.
Der Rittmeister Schimmelmann hatte über vierzig Jahre gedient und in dieser langen Frist, trotz der Kriegsjahre, es erst zum Rittmeister erster Klasse gebracht. Das lag damals in den Verhältnissen; es ging einmal nicht schneller; es kam vor, daß man zehn Jahre lang auf einer Stelle stehen blieb, und jetzt nach den Befreiungskämpfen war das Avancement erst recht ins Stocken geraten. Die Premierleutnants hatten alle das fünfundzwanzigjährige Dienstkreuz an dem traurig blauen Bande, das stets an eine verunglückte Hoffnung erinnert.
Der Rittmeister Schimmelmann hatte niemals einen Groschen Zulage gehabt und trotzdem schon als Leutnant eine kleine dicke Frau geheiratet, mit welcher er sechs Kinder zeugte, zwei Söhne, welche bereits Offiziere in der Armee waren, und vier Töchter, die er noch zu Hause auf Lager hatte: Alphonsine, Euphrosine, Melusine und Cölestine.
Wenn er auch wirklich noch zum Major befördert wurde, wie lange konnte es dauern, dann kam der blaue Brief mit dem Abschied hinterher, und dann saß er da mit "seinen fünf Frauenzimmern", wie er sich ausdrückte, und allerhöchstens achthundert Talern Pension. Davor fürchtete sich der Rittmeister Schimmelmann; aber er ließ es sich nicht merken, im Gegenteil, er übertünchte dies Gefühl innerer Schwäche durch eine Grobheit und Bärbeißigkeit, sowohl im Dienst, als im Familien- und gesellschaftlichen Leben, daß er dadurch den meisten Leuten, manchmal sogar dem auch gerade nicht höflichen Obersten von Hollprägel, Sand in die Augen streute oder imponierte.
Seine Frauenzimmer machten ihm also große Sorge und Unruhe; denn obgleich man sie eher hübsch als häßlich nennen konnte, obgleich sie auch für ihre Zeit und Verhältnisse eine ganz leidliche Erziehung genossen hatten, fingen doch die ältesten bereits an, ein bißchen in die Saat zu schießen, und vor allen Dingen hatten sie nicht einen Groschen zu erwarten, kaum eine dürftige Aussteuer zur Hochzeit. - Wer sollte da wohl anbeißen? Nachdem Pätel, der Bursche, die Hintertreppe hinuntergefallen war, streckte der Rittmeister Schimmelmann erst das rechte Bein aus dem Bett und dann das linke.
In militärisch kurzer Zeit war die Toilette beendet und der Rittmeister in voller Uniform, das heißt, in glänzend blankgeputzten Stiefeln mit blinkenden Spornen, einem Paar etwas zu weiter und etwas zu heller Hosen, was eine besondere Eigentümlichkeit seines Anzugs war, und einem engbrüstigen, hochkragigen Oberrock mit zu kurzer Taille, wie die Schwarzwälder Bauern sie tragen. Die aufgeknöpften Epaulettes waren viel zu klein für die Schulterbreite und hingen ein wenig nach vorn, wie ein Paar versengte oder betrübte Amorflügel. Man sah es dem Kostüm des Rittmeisters Schimmelmann deutlich an, daß es nicht in Berlin, bei einem Schneider des Regiments, sondern bei einem billigeren, Halsenbalger Künstler gemacht war, weshalb auch die Farbe der Beinkleider nicht ganz stimmte. Alles war alt, sehr alt; aber durch Schonung erhalten und von einer unübertrefflichen Sauberkeit.
Das triefende Talglicht und der rote Feuerschein des bullernden Ofens warfen jetzt unsichere Lichtreflexe durch das kahle, öde Gemach. Ein wüstes ungemachtes Bett mit zwei alten Rohrstühlen davor, ein kiefernes Kleiderspind mit hängender Schulter, eine lahme Kommode unter einem erblindeten Spiegel, das war das ganze Mobiliar der Schlaf= und gleichzeitigen Wohnstube des Rittmeisters Schimmelmann. In der einen Ecke stand ein Säbel, in einer anderen drei schmucklose Pfeifen mit durchgebissenen Spitzen, und neben dem Talglicht ein Tabakkasten und ein Stippfeuerzeug, wie es in früheren Zeiten Mode war. Die Dinger taugten aber so wenig, daß man zwanzigmal stippen mußte, ehe man ein Holz zum Brennen bekam, und dann roch es im Zimmer dergestalt nach Schwefel, daß man vor Husten die Pfeife nicht anrauchen konnte; unterdes ging aber das Feuer wieder aus und die Geschichte sing von vorne an. - Das war die gute, alte Zeit.
Der alte Schimmelmann mochte seit ungefähr zehn Minuten seine Toilette beendet haben und saß nun krumm und zusammengesunken auf einem der beiden Stühle vor seinem Bett, als ein Säbel auf dem Hofe klirrte und bald darauf bespornte Tritte die Hintertreppe heraufpolterten.
Kaum hatte der Rittmeister diese wohlbekannten Töne vernommen, als es ihn durchzuckte wie ein elektrischer Strahl; dann stand er mit leisem Stöhnen auf, reckte seine Gestalt so hoch empor wie es eben gehen wollte, und stellte sich in die Mitte des Zimmers, die Hände auf dem Rücken, Oberkörper und Kopf vornübergebeugt, den buschigen schwarzen Schnurrbart zu beiden Seiten der Nase in die Höhe gezogen, und die kleinen stechenden Augen fest auf die Flurtüre gerichtet, wie ein Hühnerhund, der vor einem Rebhuhn steht.
Gleich darauf ward besagte Tür von außen mit einem militärischen Ruck aufgerissen und ein Soldat trat ein, der mit dem alten Schimmelmann eine gewisse Ähnlichkeit hatte. Er trug Unteroffiziersabzeichen und Portepee und vorn im Kollet eine mächtige rote Brieftasche.
Nachdem besagtes Individuum die Tür wieder hinter sich zugemacht hatte, nahm es mit der linken Hand den Säbel auf, streckte dann ebenfalls Kopf und Oberkörper vor und blickte seinen Chef ebenso grimmig an, wie sein Chef ihn anblickte.
"Knurr!" machte Schimmelmann.
"Urr!" wiederholte der andere, mit dienstlich bescheidener Weglassung des Anfangsbuchstabens.
"Morgen, Wachtmeister!"
"Guten Morgen, Herr Rittmeister!"
"Knurr!"
"Urr!"
Pause. –
"Neues, Wachtmeister? – Hoffentlich doch nichts passiert?"
"Nein, Herr Rittmeister ... alles gesund ... nur heftiger, kalter Wind draußen!"
"Donnerwetter!!"
"Donnerwe..." echote der andere, mit dienstlich bescheidener Weglassung der beiden Endsilben.
"Jedesmal hat meine Schwadron die Bahn, wenn es des Morgens windig ist ... da werden mir ja alle Pferde kropfig ... ich muß mich wieder beim Herrn Oberst beklagen. – Heiliges Bomben..."
"Element!" setzte der Wachtmeister mit dienstlicher Entrüstung drauf.
Der Chef sah seinen Wachtmeister an, als wenn er ihn beißen wollte, wegen der Freiheit, die er sich herausgenommen, und der Wachtmeister versuchte ungefähr dasselbe Gesicht zu machen, um seinen dienstlichen Eifer zu bezeugen.
"Wer läßt heute die erste Abteilung reiten?" knurrte dann Schimmelmann weiter.
"Leutnant von Padderow, Herr Rittmeister!"
"Mir auch nicht angenehm, daß der zu meiner Schwadron versetzt ist."
"von Padderow kommen jetzt immer sehr pünktlich in den Dienst, Herr Rittmeister."
"Weiß ich... ist mir aber doch unangenehm... wegen..."
Der Wachtmeister erlaubte sich, seine Beistimmung durch ein fein angelegtes Lächeln auszudrücken.
Schimmelmann, der es bemerkte, wurde wütend.
"Herr, der Teufel soll Sie beim Kragen kriegen", schrie er, "und seine dreitausendjährige..."
"Großmutter!" setzte der Wachtmeister gewohnheitsmäßig drauf, gleichviel ob auf ihn selbst geschimpft wurde, oder auf einen andern.
"Wenn Sie nicht im Augenblick den Mund halten, dann soll Ihnen das höllische..."
"Feuer in den Leib fahren!"
"Ruhig!"
"Rrru..."
"Möchte ich mir auch ausbitten... knurr!"
"Urr!"
Der Rittmeister, welcher, neben vielen anderen Eigentümlichkeiten, auch die hatte, gut zu werden, wenn er grob sein wollte, und grob zu werden, wenn er gut sein wollte, besänftigte infolgedessen auch bald seinen Zorn und blickte den Wachtmeister jetzt nur noch mit der gewöhnlich dienstlichen Grimmigkeit an.
"Es ist mir doch unangenehm, daß Herr von Padderow zu meiner Schwadron versetzt ist", begann er dann den alten Ideengang noch einmal; "nicht wegen dessen... was Sie vielleicht gedacht haben, sondern wegen des Leutnants von Nase..."
"witz!" vervollständigte der Wachtmeister den Namen.
"Ja!!" schrie ihn Schimmelmann an, "das mag dem Teufel nicht unangenehm sein... dabei kann der königliche Dienst unmöglich seine Ordnung behalten... wenn die ewigen Neckereien des Herrn von Nasewitz sich wenigstens auf das Privatleben beschränken wollten, dann ginge es noch an... aber er kann es ja auch im Dienst nicht lassen, dem Herrn von Padderow Possen zu spielen... neulich, als in der Reitstunde der Herren Offiziere gesprungen werden sollte, hatte von Nasewitz seinem Freunde die Sattelgurte aufgeschnallt; das Pferd hob sich zum Sprung, Herr von Padderow rutschte mit seinem Sattel herunter und saß ganz verwundert auf der Erde, während der Gaul, ohne seinen Reiter, glücklich und wohlbehalten auf der anderen Seite der Barriere anlangte."
"Hähähähä!" lachte der Wachtmeister Klinke.
"Ja... so lachten alle anderen auch", zürnte der alte Schimmelmann; "und solche Streiche kommen öfter vor; das ist doch wirklich um..."
"Verrückt zu werden!" beendete Klinke den Satz.
Der Rittmeister machte ein wütendes Gesicht, und der Wachtmeister ein fast ebenso wütendes.
"Haben Sie sonst noch etwas zu melden?" schrie ersterer dann seinem Untergebenen zu.
"Nein, Herr Rittmeister!" rief dieser ebenso laut.
"Gut!"
"Gut!"
"Knurr!"
"Urr!"
Damit machte der Wachtmeister kehrt, daß die ganze alte Stube wackelte, ging zur Tür hinaus und klapperte mit seinem Säbel die Hintertreppe hinunter.
Schimmelmann blieb noch eine ganze Weile stehen und blickte, die Hände auf dem Rücken, Kopf und Oberkörper vornübergebeugt, den Schnurrbart emporgezogen, mit grimmigem Gesicht nach der Tür, durch welche sein Klinke verschwunden war; dann stieß er noch einen knurrenden Ton aus und verließ sein Schlafzimmer, um nun mit der Familie den Kaffee einzunehmen.
Nachdem er über einen engen finstern Flur an Küche und Mädchenkammer vorbeigetrampst war, öffnete er eine Tür und stand in einem auf die Straße blickenden Zimmer, in dem es ebenfalls nach Torf roch, das aber doch ein klein wenig behaglicher eingerichtet war, als das vorige.
Dies war das gemeinschaftliche Wohnzimmer. Links davon befand sich die sogenannte "gute Stube", welche eigentlich keinen anderen Zweck hatte, als die besseren Möbel aufzubewahren; und schließlich waren noch zwei kleine Schlafzimmer vorhanden: eins für die Mama, und eins für die vier Töchterlein.
Als der Rittmeister Schimmelmann eintrat, saßen seine fünf Damen bereits um den großen runden Sofatisch, auf welchem, inmitten der sechs Tassen, eine mächtige braune Kaffeekanne stand, welche mit dem Glockenschlage acht vom Mädchen hereingebracht werden mußte.
Die Mutter, eine kleine, dicke, freundlich blickende Frau, hatte sich auf dem schmalen Sofa breit gemacht, und die vier Töchter saßen in einfachen Morgenkleidern auf Stühlen. Es waren lauter hochgewachsene, schlanke Mädchen mit schwarzem Haar und dunklen feurigen Augen, die schon das Interesse eines Mannes in Anspruch nehmen konnten! Die älteste, welche ein weißes Tuch um den Kopf gebunden hatte, befand sich der Mama am nächsten, die drei anderen folgten dem Alter nach, so daß die jüngste neben dem noch leeren Stuhl des Herrn Papa zu sitzen kam.
"Guten Morgen!" knurrte dieser, etwas griesgrämlich, indem er sich langsam auf seinem Platz niederließ.
"Guten Morgen!" wiederholte der weibliche Chor, als wenn eine Abteilung Dragoner den Gruß ihres Vorgesetzten erwidert.
Der Rittmeister Schimmelmann machte ein zufriedeneres Gesicht, dann heftete er die stechenden Blicke auf seine älteste Tochter, die das Tuch um den Kopf gebunden hatte.
"Du hast ja 'ne dicke Trompete, Alphonsine!" brummte er, während die Mutter den Kaffee einschenkte.
"Ich muß mich erkältet haben, Papa", lächelte das Mädchen, ein wenig verlegen; "die linke Backe ist mir angeschwollen, und die Nase auch ein bißchen."
"Ein bißchen?" rührte der Rittmeister in seiner Tasse; "die sieht ja aus wie 'ne Gurke oder ein Kürbis."
"Die arme Alphonsine, nun kann sie heut' nicht singen", sagte die zweite Schwester, Euphrosine, mit einem bedauernden Blick.
"Na, das ist ein wahres Glück", brummte der Papa; "wenn die ihre hohen Töne losläßt, bekomme ich immer Magenschmerzen; hast du nicht auch einen schlimmen Finger, daß du nicht klimpern kannst?"
"Aber, Alter", schüttelte die kleine, freundliche Mama den runden Kopf, "heute bist du ja wieder ganz besonders schlechter Laune; wenn man nicht wüßte, daß du spaßtest..."
"Hat sich 'was zu spaßen... ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht gespaßt", gurgelte der Rittmeister; "ich kann nun einmal diese brotlosen Künste nicht leiden, namentlich die Musik nicht, die der leibhafte Satan erfunden hat... die einzigen nützlichen Musikanten sind die Signaltrompeter; aber wenn sie anfangen, ihre verdammten Stücke zu blasen, dann wird mir so schwindlig, daß ich vom Pferde fallen könnte. - Wie lange wirst du denn nun nicht singen können, Alphonsine?"
"Ja... vier bis fünf Wochen kann es wohl dauern, bis die Geschwulst sich vollständig gelegt hat", sagte das Mädchen.
Der Papa schmunzelte in seinen pechschwarzen, ein klein wenig ins Violette spielenden Schnurrbart.
"Wie kann dir das nur Vergnügen machen, den ganzen Tag zu schreien, als wenn du am Speer stecktest, und dabei mit allen zehn Fingern auf dem verdammten Klimperkasten 'rumzutrommeln?" brummte er dann weiter. "Ein Frauenzimmer muß sich auf solche Künste gar nicht einlassen... die gehört in die Wirtschaft und in die Küche... nach dem Gröhlen fragt der Mann nichts, aber ein gutes Essen will er auf dem Tisch haben..."
"Es sind aber nicht alle Männer wie du, Alter", kopfschüttelte die kleine, freundliche Mama; "manche sehen gerade auf gesellige Talente..."
"Na, hier in Hasenbalg ist mir der Fall noch nicht vorgekommen, daß einer auf Alphonsinens Talente gesehen hätte", grollte der Rittmeister; "wir haben doch das Offizierkorps vom ganzen Regiment und außerdem doch eine ganze Masse unverheiratete Zivilisten; aber hat schon einer angebissen? Prost Mahlzeit!"
Obgleich die älteste Tochter die rauhe Art und Weise des Vaters kannte, so errötete sie doch ein wenig und schlug die Augen nieder.
"Das kommt daher, weil unter den Herren Offizieren gar kein musikalischer Sinn herrscht... überhaupt kein rechtes Verständnis für schöne Künste", plapperte die jüngste Tochter Melusine dazwischen; "die Herren sind viel zu bequem dazu... sie mögen ja nicht einmal tanzen... wenn Ball ist, lassen sie sich Stellvertreter von der Infanterie aus Plettin kommen..."
"Die springen auch weit besser, Jungfer Naseweis", knurrte der Papa.
"Ja, da hast du recht", bemerkte Cölestine, die dritte Tochter; "ehe man mit dem dicken Padderow einmal herumkommt, wird einem Zeit und Weile lang; er trippelt immer um einen herum, tritt bald aufs Kleid und bald auf die Füße und dabei geht es nicht von der Stelle... so ein Infanterist aber, das fliegt wie der Wind."
Bei der Nennung des Namens Padderow hatte der Rittmeister ein Gesicht gemacht, als wenn er seine ganze Familie beißen wollte.
"Und dennoch ist mir der kleine Dicke lieber, als der lange dünne Nasewitz, der gar nicht tanzen kann", sagte Melusine, die jüngste.
Jetzt sprang der alte Schimmelmann auf, als wenn sein Stuhl plötzlich glühend geworden wäre, und machte einige knackschälige Gänge durchs Zimmer, wie ein alter mürrischer Kater, der die Gicht in den Knochen hat.
"Mein Gott, was ist dir denn, Alter?" fragte die freundliche Mama; "der Wachtmeister hat dir gewiß wieder etwas Unangenehmes hinterbracht."
"Das Unangenehme braucht er mir gar nicht erst zu hinterbringen... das weiß ich selber", polterte Schimmelmann; "seitdem der Padderow zu meiner Schwadron versetzt ist, habe ich keine ruhige Stunde mehr... früher hatte ich schon mit dem Nasewitz allein genug zu schaffen; aber seit die beiden zusammengekommen sind, ist es gerade als wenn einen der Teufel holen wollte!"
"Herr von Nasewitz ist mir der angenehmste Offizier im ganzen Regiment", nickte die freundliche Mama mit ihrem runden Kopf.
"Jedenfalls ist er der klügste", sagte Alphonsine ernst.
"Maliziös ist er", fuhr der Rittmeister auf; "was nützt mir alle Klugheit, wenn er sie nicht richtig anwendet... für den Schwadronsdienst hat er gar keine bedeutenden Fähigkeiten... er sieht immer aus, als wenn er sich über alles lustig machte... man weiß nie, wie man mit ihm dran ist, und ob er im Spaß spricht oder im Ernst... für mich ein unangenehmer Mensch!"
"Und dennoch glaube ich, daß er ein gutes Herz und einen vortrefflichen Charakter hat", sagte Alphonsine bestimmt.
"Hauptsächlich neckt er doch nur den Herrn von Padderow" warf die zweite Tochter ein; "und weshalb ist der so komisch?"
"Mag der Teufel komisch sein", brummte der Rittmeister; "mir kommt er eher tragisch vor. - Die Geschichte mit seinen Schulden wird sich nicht mehr lange halten können."
"Sind es denn wirklich so viel, Papa?" fragte Euphrosine, die zweite.
Der alte Schimmelmann machte eine bezeichnende Geste mit der rechten Hand.
"Die Leute laufen mir das Haus ein", sagte er; "ich habe nichts zu tun, wie zu beschwichtigen und zu beschwichtigen ... aber schließlich werde ich es doch dem Kommandeur sagen müssen, und dann ist es mit Freund Padderow zu Ende... dann kann er leicht zum Abschied eingegeben werden." -
"Gott, der arme, kleine Dicke!" bedauerte Melusine, die jüngste.
"Er hat ja doch aber eine reiche Tante, die er beerbt", sagte die Mutter.
"Die lebt aber den Leuten zu lange", knurrte der Rittmeister; "viel Geld hat hier in Hasenbalg keiner übrig... ja, wenn man ihnen einen bestimmten Termin nennen könnte... aber so... mancher glaubt auch gar nicht mehr an die alte Tante..."
"Herr von Padderow müßte eine reiche Partie machen", bemerkte Alphonsine.
"Hab!" fuhr der alte Schimmelmann auf; "ein reiches Mädchen kann sich einen Hübscheren aussuchen ... außerdem hat Padderow eine Abneigung gegen die Ehe... ich glaube, daß er die Hand einer Millionärin ausschlagen würde, selbst wenn er sich dadurch vom Untergang befreien könnte..."
"Aber, das ist ja unbegreiflich, Papa; weshalb ist er denn so?" fragte neugierig die kleine Melusine.
"Ja... bürgen kann ich nicht für die Wahrheit", schmunzelte der Rittmeister; "Nasewitz hat die Geschichte herumgebracht, und ganz aus der Luft gegriffen wird sie nicht sein... er will es von einigen Damen gehört haben, die..."
"Ach, sei doch ruhig, Alter!" rief die kleine Mama mit krauser Stirn.
"Na... mir ist's ja egal", brummte Schimmelmann; "mit einem Wort, er will nicht."
"Aber Papa, ich begreife gar nicht, weshalb er nicht will", wurde die kleine Mesuline ganz ärgerlich; "ich kann mir gar keinen vernünftigen Grund denken, der..."
"Wirst du gleich still sein, dummes Ding!" drohte ihr die Mama mit dem Teelöffel. Das Mädchen machte ein schmollendes Gesichtchen und ärgerte sich.
"Das wäre auch schlimm, wenn du dir den Grund denken könntest", brummte der Rittmeister in Gedanken weiter; "über so etwas müssen junge Mädchen gar nicht..."
Während dieses Satzes hatte die kleine Mama einen ganz roten Kopf bekommen; dann sprang sie von ihrem Sofa auf und zupfte ihren Gemahl am Rockschoß, daß die Nähte knackten.
"Was fällt dir denn ein? Wie kannst du denn so etwas reden?" flüsterte sie ihm zu; "nimm doch deine Gedanken zusammen!"
Der Rittmeister sah sie erst eine ganze Weile an, als wenn er nicht recht wüßte, was sie wollte; dann befühlte er sorgsam die Naht seines langen Rockschoßes, ob sie nicht an irgendeiner Stelle aufgetrennt wäre.
In diesem Moment polterte der schwerfällige Tritt von Pferdehufen über die hölzernen Dielen des Hausflurs und dann klapperten die Eisen auf den Pflastersteinen vor der Tür.
"Väterchen... Pätel ist da mit der Käthe", sagte die Mutter aus dem Fenster blickend.
Eine Minute später schlug von den beiden Kirchtürmen die neunte Morgenstunde.
"Adieu!" knurrte der Rittmeister seine Familie an; dann stackerte er in sein Zimmer zurück, umgürtete seine starken Hüften mit dem Säbel, setzte sich die Mütze auf und stieg die Treppe hinunter.
Als er vor die Haustüre trat, standen seine fünf Frauenzimmer gewohnheitsmäßig an den Fenstern.
Pätel, der Bursche, hatte eine alte, dicke, braune Stute am Zaum, die aber wieder eingeschlafen zu sein schien; denn sie senkte den Hals mit der naßausgekämmten Mähne so tief, daß der ungeschickte Kopf beinahe auf die Pflastersteine reichte.
Als er den Rittmeister kommen sah, trat Pätel auf die andere Seite, um ihm beim Aufsteigen den Bügel zu halten, dann steckte jener mit der größten Anstrengung den steifen Fuß hinein, wickelte sich die Mähne um den linken Daumen, schwang sich stöhnend empor, hob das rechte Bein über die Kruppe und ließ endlich das Gesäß in den Sattel fallen.
In diesem Moment erwachte die dicke Käthe aus ihrem Morgentraum, zuckte zusammen und richtete den Kopf empor.
"Donnerwetter, sie überschlägt sich!" rief Schimmelmann, mit beiden Händen in die Mähne fassend, während der rechte Fuß ängstlich nach dem andern Bügel suchte, "halte sie vorne fest, Pätel!"
Der Bursche stellte sich in gewohntem Gehorsam vor das Pferd und faßte beide Kandarenzügel.
"Sie ist wieder zu mutig... muß sie heute ordentlich abtraben", grunzte der Rittmeister, nachdem er sich zurechtgesetzt... "so, nun laß sie los... es ist immer noch solche aufgeregte Kanaille!"
Dann klopfte er dem alten Gaul mit beiden Waden in die Flanken; aber der alte Gaul stieß bloß einen krächzenden Ton aus und rührte sich nicht.
Schimmelmann kitzelte ihn jetzt mit beiden Sporen, ohne ein besseres Resultat zu erreichen, bis endlich Pätel zurücktrat und dem alten Tier einen kräftigen Klaps auf die linke Hinterbacke verabfolgte.
Die Käthe brachte einen quietschenden Ton zu Gehör, legte die Ohren an und setzte dann steif ein Bein vor das andere, indem sie mit dem dicken Hinterteil schwerfällig hin- und herwackelte.
Der Rittmeister Schimmelmann aber blickte triumphierend um sich, als wenn er eben einen wilden Hengst gebändigt.
3. Von Padderow und von Nasewitz
Ungefähr vierundzwanzig Stunden nach den im vorigen Kapitel erzählten Begebenheiten war es in Hasenbalg üblicherweise wieder Morgen geworden.
Es hatte eben neun Uhr geschlagen und war daher schon ein ganz Teil heller, als gestern, wo der Rittmeister Schimmelmann auf der dicken Käthe nach der verdeckten Bahn ritt.
Lassen wir einmal unsern Blick diese via triumphalis hinunterschweifen. Von dem großen, berühmten Marktplatz ausgehend, kommt also erst zur Linken die gelbe Hauptwache mit dem grünen Türmchen drauf, daneben das alte Gebäude, in dem der Rittmeister Schimmelmann wohnt, und demselben gegenüber eine etwas zurückgebaute Spelunke, an deren Seitenwand ein gebrechliches, verlassenes Nachtwächterhäuschen lehnt. Weshalb das Ding nicht längst fortgeschafft, sondern stehengeblieben ist, gehört zu den vielen Unbegreiflichkeiten dieser rätselvollen Welt.
Dann kommt, wieder in die Straßenlinie einspringend, das Haus des Magazinrendanten, vor welchem ein paar hübsche Bäume stehen, und dann die Hasenbalger Apotheke.
Der Apotheker war ein stiller Mann, der nur selten auf Ressource kam; aber sein Provisor hatte es für desto mehr hinter den Ohren; der hat manche Nacht durchgesungen beim Konditor Schlichter, bis er ausgeschwefelt wurde, oder bis sie ihn heimbringen mußten in seine Wohnung.
Wenn man nun über die Querstraße schreitet, die nach dem Plettiner Tor führt, erblickt man zwei einander gegenüberstehende Häuser, welche unsere Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen.
Das eine, rechter Hand, wo der große knarrende Kessel vor der Tür hängt, ist ein zweistöckiges, langgestrecktes Haus, das in der Mitte höher ist als auf beiden Seiten und das deshalb aussieht, als wenn es traurig die Schultern sinken ließe. Wenn man vor dem geräumigen Torweg vorbeigeht, weht einem der kräftige Hauch vom Düngerhaufen an, und geht man nachher zur Haustür, so strömt ein prickelnder Biergeruch hervor; denn der Eigentümer Branz ist Brauer und hält unten rechts eine Bier- und Frühstücksstube für die niederen Klassen der Hasenbalger Bevölkerung.
Oben, rechts neben dem Kessel, wohnt schon seit einigen Jahren der Leutnant von Padderow, der seinen Wirt immer sehr freundlich grüßt, wenn er ihm im Flur oder auf dem Hof begegnet, namentlich in den letzten Tagen des Monats. Wenn aber der Erste vorbei ist, dann dankt Herr Branz gar nicht mehr so freundlich wie sonst, und es tritt zwischen beiden eine gewisse ängstliche Spannung ein.
Das Haus gegenüber ist mit dem Giebel nach der Straße herausgebaut und hat in der Beletage zwei Fenster Front und unten neben der Haustür nur eins. Der Flur, der hinten nach dem kleinen Hof ging, war dermaßen eng, daß in früheren Zeiten der Dungwagen nicht an der nach oben führenden Treppe vorbeigeschoben werden konnte, sondern immer vor der Haustür stehenbleiben mußte. Das war natürlich sehr unangenehm und erschwerte die Arbeit furchtbar. Denn anstatt den Wagen auf dem Hof vollzuladen, war man genötigt, jede Forke Dünger durch den Hausflur zu tragen, und das kostete gerade fünfmal so viel Zeit, die ungeheuere Schmutzerei gar nicht einmal gerechnet, die jener umständliche Transport auf dem Flur verursachte. Da kam der Besitzer des Hauses, ein Ackerbürger Knelling, auf die sinnreiche Idee, die Treppe so einrichten zu lassen, daß sie wie eine Zugbrücke in die Höhe gewunden werden konnte, wodurch der Dungwagen dann freie Durchfahrt erhielt. Wegen dieser auffallenden Konstruktion bekam das alte schmale Giebelhaus den Spitznamen der "Veste Knelling", der ihm wahrscheinlich noch heutigentages anhaftet.
Die ersten Jahre, die Herr von Padderow beim Regiment war, wohnte er in der Oberetage eines kleinen Hauses, dieselbe Straße weiter hinauf nach der Post zu.
Da fingen aber gar bald seine Schuldenfatalitäten an und nahmen so lawinenartig zu, daß der arme, dicke Leutnant in seinen vier Pfählen aller Ruhe und Behaglichkeit verlustig ging. Namentlich in der Zeit vor dem Ersten war es immer recht schlimm.
Wenn da Herr von Padderow manchmal auf seinem alten harten Sofa saß und philosophischen Gedanken nachhing, hörte er einen ungespornten Tritt die Treppe heraufschleichen und dann einen leisen Knöchel an seine Tür klopfen. Das waren immer schlimme Besucher, die nicht kamen, um sich nach seinem Befinden zu erkundigen.
Oder wenn der Herr von Padderow im Fenster lag und ahnungslos an seiner Zigarre lutschte, fuhr er plötzlich in jähem Schreck zurück und taumelte bis in die Mitte des Zimmers, und im nächsten Augenblick trottete ein schäbiger Jude oder irgendein Handwerker vorbei, mit dem unser Leutnant in Geschäftsverbindungen stand. Und dann die Angst, wenn er abends nach Hause kam und das Licht ansteckte, ob nicht ein Brief auf seinem Tische lag. -
Zuletzt, als er wirklich keine ruhige Stunde mehr in seinem Stübchen hatte, kam ihm die sinnreiche Einrichtung der Treppe beim Ackerbürger Knelling zu Ohren.
Fünf Minuten darauf war er bereits an Ort und Stelle, ließ sich die Maschinerie erklären und nach zehn Minuten weiter hatte er die Oberetage gemietet.
Nun bekam der Herr von Padderow wirklich etwas Erleichterung; denn er konnte sicher und wohlbehalten im Fenster liegen, an seiner ewig verstopften Zigarre lutschen und heiteren Sinnes die Straße rechts herauf und die Straße links hinuntersehen; wenn dann am fernen Horizont eine Physiognomie erschien, die ihm nicht ganz koscher vorkam, dann schloß er schleunigst das Fenster, zog die Treppe auf und war so sicher, wie in Abrahams Schoß.
Wenn er nicht aus dem Fenster sah, war die Treppe stets heraufgezogen, und wenn dann von Nasewitz oder ein anderer harmloser Freund zu ihm wollte, mußten sie von der Straße herauf irgendein bekanntes Signal geben.
So ging die Sache ein paar Jährchen ganz gut, und wenn Herr von Padderow auch viele Straßen gar nicht benutzen konnte, aus Furcht, sich einem darin wohnenden Gläubiger ins Gedächtnis zurückzurufen, so hatte er doch wenigstens in seinem eigenen Hause Ruhe und brauchte nicht bei jedem verdächtigen Geräusch ängstlich die Ohren zu spitzen.
Eines schlimmen Tages aber schrieb ihm der Ackerbürger Knelling einen krähenfüßigen Brief, in welchem er ihm die Wohnung kündigte, unter dem Verwände, daß die Treppenwalze durch zu vieles Herauf- und Herunterlassen dermaßen abgenutzt würde, daß bald eine neue erforderlich sein dürfte. Um diese kostspielige Reparatur wenigstens noch möglichst lange hinauszuschieben, sähe er sich daher genötigt, seinem Mieter die Wohnung zu kündigen.
Dem armen Herrn von Padderow blieb nichts übrig, als gute Miene zum bösen Spiel zu machen und sich mit philosophischer Ruhe ins Unvermeidliche zu fügen.
Am nächsten Ersten zog er zum Brauer Branz hinüber, der ihn immer so freundlich angesehen hatte, und von Nasewitz nahm die Wohnung in der Veste Knelling, um sich täglich an dem Anblick seines Busenfreundes weiden zu können.
So lebten sie nun schon mehrere Jahre einander gegenüber, oft im Frieden, oft im Unfrieden.
Es bestand überhaupt ein merkwürdiges Verhältnis zwischen von Nasewitz und von Padderow. Im Grunde genommen waren sie die besten Freunde von der Welt und hätten gar nicht einer ohne den anderen leben können; aber der lange Nasewitz hatte etwas von Mephistopheles in sich und konnte es durchaus nicht lassen, über alles und jedes spöttische Bemerkungen zu machen, oder seinen Mitmenschen einen kleinen Schabernack zu spielen. Am schlimmsten wurde hiervon aber sein bester Freund Padderow betroffen.Sowie er den sah, ging das Necken los und oft blieb er bis spät in die Nacht hinein auf, um sich etwas auszudenken, womit er seinen Freund ärgern konnte.
Dessenungeachtet mochte ihn von Padderow am liebsten von allen Kameraden; denn er hatte die feste Überzeugung, daß er es doch im Herzen gut mit ihm meine, und deshalb war auch Nasewitz der einzige, gegen den er sich, bis auf einen kitzlichen Punkt, ganz offen und ehrlich aussprach.
Oft kamen sie natürlich so hart aneinander, daß sie sich gegenseitig die Kehlen abschneiden wollten. Ehe diese entsetzliche Katastrophe aber eintrat, vertrugen sie sich immer wieder, denn jeder hatte doch den andern zu lieb, als daß er ihn hätte umbringen können.
Zur Entschuldigung von Nasewitz mußte freilich angeführt werden, daß Padderows ganze Persönlichkeit zur Neckerei und zum Aufziehen herausforderte.
Es war jedenfalls ein ganz komischer Kerl; denn wer ihn einmal gesehen hatte, vergaß ihn in seinem ganzen Leben nicht! -





























