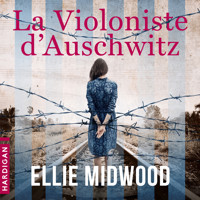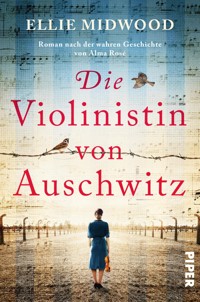
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In der Hölle von Auschwitz schenkte ihre Musik neue Hoffnung Einst begeisterte die Geigerin Alma Rosé weltweit das Publikum, nun empfängt sie die tragische Wirklichkeit von Auschwitz. Als eine Aufseherin sie erkennt, wird Alma zur Leiterin des Mädchenorchesters ernannt. Zunächst weigert sie sich, zur Erbauung der Nazis zu spielen, aber ihre neue Position verschafft ihr auch Macht: Sie kann hungernde Mädchen mit zusätzlichen Rationen versorgen und viele durch die Aufnahme in ihr Orchester vor dem Tod retten. Doch in Auschwitz ist die Luft von Verlust getränkt, Unglück ist die einzige Gewissheit. Kann Almas Musik an einem so hoffnungslosen Ort überleben? »An ihrer Wiege stand Gustav Mahler, an ihrer Bahre Josef Mengele.« Anita Lasker-Wallfisch Ein ergreifender Roman über eine starke Frau nach einer wahren Begebenheit Alma Rosé war eine bekannte österreichische Violinistin. Ihr Vater war Arnold Rosé, er leitete die Wiener Philharmoniker und war erster Konzertmeister der Wiener Hofoper. Der Komponist Gustav Mahler war ihr Onkel, Alma Mahler-Werfel ihre Tante. Alma Rosé selbst hat die Wiener Walzermädeln gegründet. In Auschwitz sollte sie als Leiterin des Mädchenorchesters mit ihrer Musik dem kulturellen Anspruch von Nazigrößen wie Dr. Josef Mengele genügen und Häftlingen auf dem Weg in die Gaskammer beistehen. Weitere Romane über Held:innen des Holocaust bei Piper: - Heather Morris, Der Tätowierer von Auschwitz - Heather Morris, Das Mädchen aus dem Lager – Der lange Weg der Cecilia Klein - Heather Morris, Die Schwestern von Auschwitz - Antonio Iturbe, Die Bibliothekarin von Auschwitz - John Boyne, Als die Welt zerbrach - Nechama Birnbaum, Das Mädchen mit dem roten Zopf
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Die Violinistin von Auschwitz« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
((bei fremdsprachigem Autor))
Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch von Uta Rupprecht
© Ellie Midwood 2020
Titel der englischen Originalausgabe:
»The Violinist of Auschwitz«, Bookouture, London 2020
© Piper Verlag GmbH, München 2023
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Redaktion: Kerstin Kubitz
Covergestaltung: FAVORITBUERO, München, nach einem Entwurf von Sarah Whittaker
Covermotiv: Ildiko Neer / Trevillion Images und Shutterstock.com
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich der Piper Verlag die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Prolog
Auschwitz-Birkenau, 4. April 1944
Kapitel 1
Auschwitz, Juli 1943
Kapitel 2
August 1943
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
September 1943
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
November 1943
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Dezember 1943
Kapitel 23
Kapitel 24
Heiligabend 1943
Kapitel 25
Januar 1944
Kapitel 26
Februar 1944
Kapitel 27
März 1944
Kapitel 28
8. März 1944
Kapitel 29
Epilog
April 1944
Januar 1945
Nachwort
Hinweise zum historischen Hintergrund
Dank
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Für meine Mutter und meine Großmutter, zwei der stärksten Frauen, die ich kenne. Ihr habt mir beigebracht, eine Kämpferin zu sein und über Kämpferinnen zu schreiben. Danke.
Prolog
Auschwitz-Birkenau, 4. April 1944
Heute würde es nach der Vorstellung keine Verbeugung geben. Jedenfalls nicht für sie.
Alma hielt den Blick unverwandt auf den Riss in der Wand vor sich gerichtet, während sie spielerisch eine kleine Glasampulle, gefüllt mit einer klaren Flüssigkeit, zwischen den Fingern hin- und herbewegte. Einen Monat hatte sie gebraucht, um einem der Häftlinge des Arbeitskommandos im »Kanada«, dem Effektenlager, die Ampulle abzuschwatzen. Wochenlang hatte er sie hingehalten, mit gespieltem Bedauern und einer Reihe erfundener Ausreden – er würde ihr ja gern helfen, aber das, worum sie bat, sei nirgendwo aufzutreiben. Das hätten nur die deutschen Ärzte, die hier im Lager nicht, und er wisse nicht, welchen Deutschen er dafür bestechen müsse. Wie sie sich vorstellen könne, pflege er nicht gerade einen freundschaftlichen Umgang mit ihnen – immer in der Hoffnung, sie würde endlich aufgeben. Alma hatte ihm zugehört, genickt und stur erwidert, das sei in Ordnung, sie werde so lange wie nötig darauf warten. Schließlich hatte sie ihn so weit, er gab nach.
»Hier ist die Ware. Das Beste, was hier in der Gegend zu kriegen war. Als Injektion ist es wirksamer, aber wenn Sie wollen, können Sie es auch schlucken. Dann dauert es nur etwas länger.«
»Ich danke Ihnen. Als Bezahlung dafür gebe ich Ihnen meine Geige, nachdem …«
»Dafür will ich nichts haben.« Ein entschiedenes Kopfschütteln, den Blick auf den Boden gerichtet. Der Fußboden war von Tausenden von Häftlingen abgetreten, die meisten von ihnen längst tot und vergessen. »Es ist etwas beigemischt, damit kaum Schmerzen auftreten, ehe …« Er beendete den Satz nicht. Die Hände in den Hosentaschen, sah er sie mit jammervoller Miene an, ein Flehen in den blauen Augen.
Sanft lächelnd, drückte Alma leicht sein Handgelenk, um sich für seine Hilfe zu bedanken.
Schmerzen? Wenn er wüsste, was für Schmerzen sie seit ein paar Wochen ertragen musste, dann hätte er sie nicht so lange und quälend warten lassen. Das da … das würde die Schmerzen nicht hervorrufen, sondern ihnen ein Ende setzen.
Ein ungeduldiges Klopfen an der Tür riss Alma aus ihren Gedanken. Schnell ließ sie die Ampulle in der Tasche ihres schwarzen Kleids verschwinden, dann klatschte sie in die Hände und richtete sich auf. »Ja?«
Zippy, die Mandolinenspielerin, steckte den Kopf herein. Sie war Almas Vertraute, eine gute Freundin, die ihr mittlerweile so nahestand wie eine Schwester. »Oberaufseherin Mandl ist da! Wir können anfangen.«
Alma nickte ihr zu und nahm den Geigenkasten, einen Taktstock und Notenblätter vom Tisch. Als sie das Zimmer verließ, warf sie noch einen letzten prüfenden Blick in den Spiegel.
Die Mitglieder des Mädchenorchesters zählten zu den privilegierten Häftlingen, zur Lagerelite, die Zivilkleidung tragen und ihre Haare behalten durften. Sie waren die Glücklichen, die sich nicht in den Steinbrüchen zu Tode schuften mussten und von den gefürchteten Selektionen verschont blieben, wohlgenährte Schoßhündchen der Nazis, denen im Gegensatz zu den anderen Häftlingen die täglichen Misshandlungen erspart blieben. Wie Zippy sagte: »Das ist doch großartig, warum sollten wir uns darüber beklagen?« Aber es war eine demütigende und würdelose Existenz, wenn einem jeglicher Lebenssinn genommen war. Nicht nur genommen, sondern auf brutalste Weise geraubt, erstickt, verbrannt, als ein Häufchen Asche in einem See versenkt, sodass von einem Menschen nichts mehr blieb außer der Erinnerung.
Die Erinnerung und der Schmerz, die dumpf und unaufhörlich nach und nach ihr Blut vergifteten.
Alma dachte an die Ampulle, die sicher in der Tasche ihres Kleids verwahrt lag, strich sich mit der Hand die dunklen Locken glatt und befestigte ihren weißen Spitzenkragen. Heute Abend gab sie ihre letzte Vorstellung. Und da sollte sie auch entsprechend aussehen.
Kapitel 1
Auschwitz, Juli 1943
Still und heiß war es in Block 10 an diesem diesigen Nachmittag. Gelegentlich machte eine Krankenschwester, selbst ein Häftling, ihre Runde, um nachzusehen, wer in der Zwischenzeit verstorben war. Fast jeden Tag gab es ein paar Tote. Alma zählte sie nicht – sie war mit ihrem eigenen Fieber beschäftigt –, aber im Halbschlaf bekam sie manchmal mit, wenn die Schwestern die Verstorbenen aus den Betten zogen. Einige waren bereits krank gewesen, als man sie in Drancy, dem französischen Durchgangslager, zusammen mit Alma in den Zug gescheucht hatte, andere hatten sich auf der Reise angesteckt. Das war auch kein Wunder, denn sie hatten so dicht aufeinandergesessen wie Sardinen in der Dose, sechzig Menschen in jedem Viehwaggon. Und wieder andere waren erst hier in Auschwitz durch medizinische Versuche zu Tode gekommen.
Langsam ließ Alma ihren Blick durch den Saal wandern. Er war ziemlich groß, und die Betten standen so nahe nebeneinander, dass die Pflegerinnen Mühe hatten, sich dazwischen durchzudrängen. Aber am schlimmsten war der Gestank, ein abstoßendes, durchdringendes Gemisch aus altem Schweiß, verbrauchter Luft, brandigem Fleisch und besudelter Kleidung, das einem den Magen umdrehte.
Im Gegensatz zu den anderen war Almas Gruppe nach der Ankunft nicht in Quarantäne geschickt worden oder sofort in die Gaskammer gewandert. Stattdessen hatte sie das zweifelhafte Glück ereilt, in Block 10 zu landen, dem Block für medizinische Versuche – einem zweistöckigen Ziegelbau, dessen Fenster stets fest geschlossen blieben, um seine teuflischen Geheimnisse vor Neugierigen zu verbergen.
Manchmal hatten die Schwestern Mitleid mit ihnen und öffneten für ein paar herrliche Momente die Fenster, um den Saal durchzulüften. Allerdings schadete dies in den meisten Fällen mehr, als es nützte, denn dabei drangen Schwärme von Fliegen und Mücken herein, stürzten sich hungrig auf die ausgemergelten Körper und verbreiteten weitere Krankheiten. Die Frauen stöhnten, gequält von den Stichen und dem unablässigen Summen. Noch mehr infizierte Wunden, noch mehr Leichen, die von den kahl geschorenen Pflegerinnen abtransportiert werden mussten. Und immer notierte eine davon die Anzahl der Toten in ihren Listen, um diese später ihrem Vorgesetzten, dem SS-Arzt Dr. Clauberg, vorzulegen. Die berüchtigte deutsche Ordnung, durchgesetzt von jüdischen Häftlingen. Schnell begriff Alma die Ironie dieses traurigen Sachverhalts.
An ihrem ersten Tag im Block hatte sie voller Naivität um ein Medikament gegen ihr Fieber gebeten und war ausgelacht worden. Mit so viel Würde, wie sie angesichts der Umstände zusammenkratzen konnte – schließlich hatte man ihr gerade den Kopf geschoren und ihr eine Nummer anstatt des Namens gegeben –, erkundigte sie sich nach den Röntgengeräten, die sie in zwei Räumen im Erdgeschoss erspäht hatte. Aber auch diese Frage wurde von den Pflegehäftlingen ignoriert.
»Kümmere dich um deinen eigenen Kram«, war alles, was sie von der Blockältesten Hellinger hörte, einer blonden Frau mit strengem Gesicht und einem Band zur Kennzeichnung ihres Rangs am linken Oberarm. Es schien so, als hätten die Krankenschwestern, obgleich selbst Gefangene, kein Interesse daran, sich mit den Neuankömmlingen anzufreunden.
»Mir ist schon klar, dass ich hier nicht im Hotel Ritz bin, aber an der Gastfreundlichkeit könnte man trotzdem noch arbeiten«, gab Alma kühl zurück.
Mit verblüfftem Blinzeln blickte die Pflegerin von ihrem Klemmbrett auf. Im ganzen Block war es still geworden, aller Augen waren auf Alma gerichtet. Ihr dämmerte, dass Widerspruch hier wohl nicht häufig vorkam.
»Transport aus Frankreich?« Hellinger musterte Alma eisig. Sie sprach ein vorzügliches Deutsch, aber mit einem starken ungarischen Akzent. »Hätte ich mir denken können. Von dort kommen immer die hochnäsigsten Weiber.«
Alma lächelte. »Ich bin Österreicherin.«
»Noch besser. Die Arroganz des Kaiserreichs. Die SS wird Ihnen den Kopf schon zurechtrücken, Eure Hoheit.«
»Das würde Ihnen wohl gefallen, oder?«
Zu Almas Überraschung zuckte Hellinger nur mit den Schultern. »Mir ist das egal. Als Blockälteste bin ich für Ordnung zuständig und nicht dafür, mir über euch den Kopf zu zerbrechen. Die Hälfte von euch kratzt in ein bis zwei Wochen ohnehin ab, und die andere Hälfte wird im Lauf der nächsten drei Monate durch den Schornstein gejagt, aber auch nur, wenn ihr nach der Prozedur lange genug durchhaltet.«
Die Prozedur.
Alma wusste, dass sich neben ihrem Saal der Raum mit den Frischoperierten befand, doch der Zutritt dort war verboten.
»Dann melde ich mich gleich mal an«, sagte sie aus purem Trotz. Wie ein in die Ecke getriebenes Tier biss sie in nutzloser Selbsttäuschung ein letztes Mal um sich – nicht so sehr, um den Feind zu verletzen, sondern um sich selbst weiszumachen, dass sie keine Angst hatte. »Es spielt ohnehin keine Rolle. Je früher es vorbei ist, umso besser.«
Alma rechnete mit einem Wutausbruch – hier wurden die Insassen schon für die leiseste Provokation geschlagen –, Hellinger blieb jedoch seltsam still. Die Blockälteste schien eine Weile nachzudenken, dann bedeutete sie Alma, ihr zu folgen. Den Blick misstrauisch auf den Rücken der Frau gerichtet, ging Alma durch einen schwach beleuchteten Flur bis zur Tür des anderen Krankensaals, die Hellinger für Alma aufhielt. Als Alma zögernd näher trat, machte die Blockälteste eine spöttische Geste: nach Euch, Eure Hoheit.
In diesem Saal roch die Luft noch ekelhafter. Hellinger blieb am ersten Bett stehen, eine Frau lag darin. Ihr Gesicht war leichenblass und so sehr mit Schweißtropfen übersät, dass es einer Totenmaske aus schmelzendem Wachs glich.
Mit erschreckender Selbstverständlichkeit schlug Hellinger das Nachthemd der Frau nach oben, und Alma wurde übel. Sie brauchte all ihre Kraft, um zu verhindern, dass man ihr sämtliche Gefühle vom Gesicht ablesen konnte. Schwarzer Schorf bedeckte die entzündete rote Haut am Unterleib der Frau, wo die Blasen aufgegangen waren. Unmittelbar über ihrem Schambein befand sich ein langer, grob und mit hässlichen Beulen zusammengenähter Schnitt, aus dem ein übler Geruch aufstieg.
»Unblutige Sterilisation«, erläuterte Hellinger mit der leidenschaftslosen Stimme einer Professorin. »Die Eierstöcke werden einer extrem hohen Dosis Röntgenstrahlung ausgesetzt und dann chirurgisch entfernt, um festzustellen, ob die Prozedur erfolgreich war. Die Strahlung ist so stark, dass sie heftige Verbrennungen hervorruft. Und die Operation selbst wird weitgehend ohne Betäubungsmittel vorgenommen. Wie Sie sehen können, ist in diesem Fall eine massive Infektion aufgetreten, aber das spielt für Dr. Clauberg keine Rolle. Sie versuchen, die richtige Dosis zu finden, um Verbrennungen zu vermeiden, bisher sieht es jedoch hinterher immer noch so aus.« Sie bedeckte den Unterleib der Patientin wieder und warf Alma einen bedeutungsvollen Blick zu.
Eine ganze Weile rührte Alma sich nicht. Als sie endlich ihre Stimme wiedergefunden hatte, fragte sie: »Gibt es da ein bestimmtes System? Ich meine, wie sie die Gefangenen aussuchen.«
»Es sind Deutsche.« Hellinger zeigte zum ersten Mal ein Lächeln, auch wenn es in Almas Augen eher einer Grimasse glich. »Alles ist perfekt durchnummeriert. Bisher sind sie bei der Prozedur mit Nummer 50204 bis 50252 durch.«
Alma sah auf ihren linken Unterarm, auf dem in blauer Tinte ihre eigene Nummer eintätowiert war: 50381.
Hellinger blickte ebenfalls darauf, und ihre Gesichtszüge wurden ein wenig sanfter.
Alma hob den Kopf, in ihren schwarzen Augen stand eine neue Entschlossenheit. »Dürfte ich Sie vielleicht um einen Gefallen bitten?«
Hellinger zuckte mit einer Schulter.
»Ist es möglich, hier irgendwo eine Geige aufzutreiben?«
»Eine Geige?«
Offensichtlich war die Frage nach einem Musikinstrument in Auschwitz ebenso ungewöhnlich wie der Widerspruch gegenüber einer höherrangigen Person.
»Sind Sie Geigerin oder so was?«
»So was. Ich habe acht Monate lang nicht gespielt. So wie ich das sehe, bleibt mir nicht mehr viel Zeit. Wenn es irgendwie möglich ist, würde ich gern noch einmal spielen. Falls der letzte Wunsch einer Todeskandidatin an so einem Ort überhaupt eine Rolle spielt.«
Hellinger versprach ihr, sie werde ihr Möglichstes tun. Sie warf einen verstohlenen Blick auf Almas blasse Hand, als überlegte sie kurz, sie zu ergreifen, drehte sich aber im letzten Moment um und verließ den Krankensaal. Einer Todeskandidatin auch noch Hoffnung zu machen war einfach nur grausam.
Alma stand noch lange vor der reglos daliegenden, todbleichen Frau und beneidete diejenigen, die bereits bei der Ankunft vergast worden waren.
Ein endloser Tag war wie der andere. Auch an diesem Tag wiederholte sich der eingespielte Ablauf, der einen zum Wahnsinn trieb. Schlammbraunes Wasser zum Frühstück, das die Deutschen Kaffee nannten. Die Visite von Dr. Clauberg – »Machen Sie den Mund auf, ich will Ihre Zähne sehen«. In der Ecke eine Französin, die auf Lateinisch betete und sich dabei vor und zurück wiegte, die Hände so fest gefaltet, dass die Knöchel weiß hervortraten.
Zum Mittagessen etwas mehr schlammbraunes Wasser, zu dem die Deutschen Suppe sagten. Wer Glück hatte, fand in seinem Teller ein Stück fauliger Rübe. Sylvia Friedmann, eine jüdische Häftlingskrankenschwester und Dr. Claubergs Erste Assistentin, las von einer Liste die Nummern ab. Die Frau in der Ecke schaukelte heftiger vor und zurück; als die beiden Wachmänner sie aus dem Krankensaal und durch den Korridor zogen, schlug sie laut schreiend um sich. Entsetztes Schweigen griff um sich.
Hellinger sammelte die Laken und die Nachthemden ein, um sie desinfizieren zu lassen. Nackte, kahl geschorene Frauen in Habachtstellung – erneut schritt Dr. Clauberg die Reihen ab, diesmal drückte er ihnen die Brüste fest zusammen. Offenbar hatte jemand eine Schwangere gemeldet. Breit grinsend, rieb Dr. Clauberg vor dem Gesicht der Frau die Finger aneinander: »Milch!« Sie ging gehorsam, diesmal waren keine Wachmänner nötig.
Abendessen. Ein Stück mit Sägemehl gestrecktes Brot und ein Stich Margarine, auf die Handfläche geschmiert. Apathisch leckten die Frauen sie ab. Im Nachbarbett hatte sich ein belgisches Mädchen die Wolldecke über den Kopf gezogen und weinte leise um seine Mutter – ein klägliches, gedämpftes Wimmern, so, als wollte es niemanden mit seiner Trauer belästigen.
Nacht. Tränen über Tränen in sämtlichen Betten um Alma herum, geflüsterte Gebete, die Namen geliebter Menschen stundenlang vor sich hin gesprochen – ein endloses Kaddisch, das sie kaum noch ertragen konnte.
Endlich Stille. Silbernes Mondlicht fiel durch die Fensterläden auf Almas Arme. An ihrer Schulter eine unsichtbare Violine. Wie Schmetterlingsflügel flatterten ihre Finger über das Griffbrett, der Bogen in ihrer Rechten küsste die Saiten der Geige. Draußen brachten die »Sankas«, getarnt als Krankenwagen des Roten Kreuzes, die Toten aus Block 11 nebenan weg. Alma hatte sie kurz durch die Spalten in den Fensterläden gesehen, als sie zum Krematorium fuhren. In ihrem Innern erklangen die Geschichten aus dem Wienerwald von Johann Strauss.
Musik.
Frieden.
Heiterkeit.
Eine Welt, in der ein Ort wie Auschwitz aus moralischen Gründen kein Existenzrecht hatte.
»Alma? Alma Rosé?«
Die junge Pflegerin mit dem frischen, hübschen Gesicht, die Hellinger in den Krankensaal geführt hatte, sprach deutsch mit einem deutlich holländischen Akzent. Alma wurde von einer warmen Welle der Erinnerungen erfasst, an glücklichere Zeiten in den Niederlanden, wo sie von mehreren holländischen Familien vor den Nazis versteckt worden war. Im kriegsgeschüttelten Europa hatten die Jahreszeiten gewechselt, aber ihre Gastgeber hatten ihr weiterhin beigestanden. Sie riskierten ihr Leben, weil sie Alma Zuflucht vor der Gestapo boten, und verlangten nichts dafür – nur ein bisschen von ihrem wunderbaren Geigenspiel. Diesem Wunsch kam Alma nur zu gern nach, denn diesen tapferen, selbstlosen Menschen verdankte sie ihr Leben und ihre Freiheit. Die Gastfreundschaft mit ihrer Musik zu entgelten war das Geringste, was sie tun konnte. Als die Gerüchte über Razzien der Gestapo immer lauter und beunruhigender wurden, brachte man sie in anderen, wechselnden Häusern unter. Doch wo immer sie auch versteckt gewesen war, sie hatte sich immer willkommen und geborgen gefühlt.
Natürlich erkannte Alma die junge Frau, die vor ihr stand, die freundlichen Gesichter der Menschen, die ihr so lange eine sichere Zuflucht geboten hatten, würde sie nie vergessen. Sie hingegen hatte Alma nicht sofort erkannt. Alma hatte seit Wochen – oder waren es bereits Monate? – nicht mehr in den Spiegel geschaut, aber sie konnte sich gut vorstellen, was für einen jämmerlichen Anblick sie bot. Dass sie kaum noch Ähnlichkeit mit der gefeierten Geigerin im eleganten rückenfreien Abendkleid hatte, wusste sie genau.
»Magda, weißt du, wer das ist? Das ist Alma Rosé persönlich!« Die Krankenschwester strahlte die Blockälteste Hellinger voller Begeisterung an. »Sie ist Geigerin und in Österreich sehr berühmt!« Weil sie Almas anhaltendes Schweigen missverstand, erklärte die junge Frau eilig: «Ich bin Ima van Esso, Sie haben in unserem Haus in Amsterdam einmal ein Konzert gegeben. 1942 war das, eine Telemann-Sonate, erinnern Sie sich?«
Natürlich erinnerte sie sich. Trotz aller Verbote der Deutschen war das Haus geheizt gewesen, eine illegale Versammlung von Musikkennern. Elegante, nicht zusammenpassende Stühle standen im Halbkreis, die Frauen trugen Abendkleider, die Männer Gesellschaftsanzug. Aller Augen waren auf sie gerichtet – jene Frau, die die Anwesenden so sehr bewunderten, dass sie das Risiko eingingen, den Zorn der Gestapo auf sich zu ziehen, nur um sie noch einmal spielen zu hören.
»Sie haben mich begleitet. Auf der Flöte«, brachte Alma heraus. Die Erinnerungen taten weh, und es war seltsam, wieder Imas Hand zu halten. Ein freudloses Wiedersehen aus den völlig falschen Gründen. Als sie sich zum letzten Mal getrennt hatten, war Alma noch ein freier Mensch gewesen.
Ima warf ihr ein breites Lächeln zu. »Ja! Wie freundlich, dass Sie sich an mich erinnern. Ich war so eine Dilettantin … sicherlich dachten Sie, dass ich Ihnen in keiner Weise gewachsen war.«
Alma spürte, wie ihre Unterlippe zu zittern begann, und biss fest darauf. »Unsinn. Sie haben ausgezeichnet gespielt.« Sie war stolz, dass ihre Stimme so ruhig war. Der Schmerz, den sie sich selbst zufügte, wirkte Wunder, wie immer.
Magda Hellinger pfiff leise durch die Zähne. »Dann sind Sie eine Berühmtheit? Warum haben Sie das nicht gesagt, als Sie mich um diese verdammte Geige gebeten haben?«
»Muss man berühmt sein, um hier Geige spielen zu dürfen?«, fragte Alma schärfer als beabsichtigt.
»Nicht unbedingt, aber es hilft, wenn jemand versucht, ein Instrument aufzutreiben«, erwiderte Hellinger. »In Auschwitz etwas zu organisieren ist ein Heidenaufwand. Eine Geige für Sie zu bekommen wird mich einiges kosten. Und die Einzige, die etwas von Musik versteht, ist dieses kleine Fräulein hier. Verstehen Sie mich nicht falsch, aber ich musste mich erst bei ihr rückversichern.«
Mit flehendem Blick zupfte Ima an Magdas Ärmel, um ihre Aufmerksamkeit zu erhalten. »Magda, Liebste, bitte besorge ihr eine! Du wirst vor Erstaunen in die Knie gehen, wenn du sie spielen hörst – sie spielt einfach herrlich! Eine echte Virtuosin, glaub mir. Du wirst dich plötzlich fühlen wie bei den Wiener Philharmonikern …«
»Die Wiener Philharmoniker, meine Güte«, knurrte Magda vor sich hin und warf einen Blick zur Tür. »Selbst wenn ich eine an Zippy vorbeischmuggeln kann, wie soll sie denn im Geheimen spielen? Oder schlägst du vor, dass wir hier ein Konzert ansetzen, direkt vor Dr. Claubergs Nase?«
Ima wollte sich noch nicht geschlagen geben. »Dr. Clauberg und die Blockführerin gehen um sechs Uhr nach Hause und kommen erst am nächsten Morgen wieder. Das Lager wird praktisch leer sein. Wir stellen ein paar Mädchen als Türhüterinnen ab, damit sie uns warnen, wenn sich jemand nähert.«
»Und was ist mit Block 11? Denkst du vielleicht, die hören es nicht, wenn sie spielt?«
Ima schwieg einen Moment, dann verzog sie das Gesicht zu einem sanften, traurigen Lächeln. »Die Männer dort sind Todeskandidaten. Glaubst du ernsthaft, sie würden es der SS melden, wenn sie, ehe sie an die Wand gestellt werden, zum letzten Mal schöne Musik hören?«
Sehr zu Almas Verblüffung brachte Magda ihr bereits am nächsten Tag eine Geige. Mit durchtriebener Miene zog die Blockälteste das Instrument aus einem Kopfkissenbezug und hielt es mit sichtlichem Stolz der verdutzten Alma hin.
»Zippy lässt dich grüßen.«
Alma umfasste den Hals der Geige mit einer Gier, die andere Häftlinge allenfalls beim Anblick von Brot zeigten. »Wer ist Zippy?«, fragte sie mehr aus Höflichkeit.
Ihre Aufmerksamkeit war vollständig eingenommen von dem Instrument, an dem noch abgebrochene Strohhalme hingen, vermutlich von dem Ort, an dem es versteckt gewesen war. Langsam und voller Ehrfurcht strich Alma mit den Fingern über den Korpus der Geige. Es war acht Monate her, acht quälend lange Monate, seit sie zuletzt ihre eigene Guadagnini in der Hand gehalten hatte – die treue Begleiterin, die sie in der Obhut ihres Liebhabers in Utrecht zurücklassen musste.
Almas Kehle wurde eng, als sie an Leonards warme Hände auf ihren nassen Wangen dachte, an seine Zusicherung, bestimmt sei sie in kürzester Zeit wieder da, und dann warte ihre Violine auf sie und er auch …
Plötzlich durchfuhr sie eisig der zynische Gedanke, wessen Bett Leonard wohl inzwischen wärmte, genau wie Heini, sein Vorgänger. In den letzten paar Jahren hatte sich Alma an die Untreue der Männer gewöhnt. Nur den Geigen konnte man vertrauen. Ihre Guadagnini war bei ihr gewesen, als ihr erster Ehemann Váša die Scheidung einreichte, und auch, als ihr Geliebter Heini floh und sie, noch vor dem Krieg, ganz allein in London zurückließ. Es hatte ihm nicht gefallen, dass Alma für sie beide das Geld verdiente, und noch weniger, dass er selbst noch einmal neu anfangen musste mit einer Frau, der er noch Wochen zuvor, ehe sie mit Almas Vater im Schlepptau Österreich verließen, ewige Liebe geschworen hatte. Der arme Heinrich, dachte Alma mit einem bösen Lächeln, als er seinen hastigen Rückzug antrat, hatte er nicht einmal den Mut gehabt, ihr in die Augen zu sehen. Sie war aus Österreich geflohen, um ihr Leben zu retten; er floh zurück nach Wien, um sein gewohntes Leben weiterzuleben – ein bequemes Leben ohne unnötige Mühen.
»Wer Zippy ist?« Magda schnaubte und sah sie verschwörerisch an. »Ich weiß es, und du wirst es nicht herausfinden. Jetzt pack die Geige weg und denke nicht einmal daran, sie wieder anzurühren, ehe ich dir persönlich sage, dass es sicher ist. Verstanden?«
»Ja.«
»Du musst sagen: Jawohl, Blockälteste.« Als Alma ihr einen scharfen Blick zuwarf, lächelte Magda unerwartet und schwächte den Befehl ab. »Du musst diese idiotische militärische Antwort nicht geben, wenn wir Mädels unter uns sind. Aber unbedingt in der Anwesenheit der SS-Aufseher oder von Dr. Clauberg und Dr. Wirths. Na ja, bei Dr. Wirths vielleicht nicht, er ist eigentlich ein vernünftiger Mensch und nicht gewalttätig. Ihm ist es zu verdanken, dass wir überhaupt Laken, Nachthemden, Handtücher und sogar Seife in unserem Block haben. Aber die anderen, die sind keineswegs so zuvorkommend. Die SS legt sehr großen Wert auf Disziplin.«
Als hätte sie Magda nicht gehört, lächelte Alma noch immer selig und ließ die Geige nicht aus den Augen.
Magda Hellinger hatte sich bereits zum Gehen gewandt, als sie ein unerwartetes »Danke, Blockälteste« vernahm.
Unwillkürlich musste Magda grinsen. »Es war mir ein Vergnügen, Eure Hoheit.«
An diesem Abend färbte die untergehende Sonne die Wolkenbäuche in zartem Rosa. Seit die Arbeitskommandos von draußen hereinmarschiert waren, lag Stille über dem Lager. Die Wachhunde waren bereits eingesperrt und schliefen in ihren Käfigen. Nur in Block 10 herrschte helle Aufregung. Soweit sie nicht bettlägerig waren, schoben die Frauen ihre Betten zur Seite, um im vorderen Teil des Saals eine Art Bühne zu schaffen. Alma, die Violine bereits in der Hand, trat ungeduldig von einem Fuß auf den anderen. Sie war so nervös, als müsste sie vor einem ausgesuchten Publikum in Wien auftreten und nicht vor dieser jämmerlichen, von Krankheiten gezeichneten Versammlung.
Endlich war alles bereit, tiefes Schweigen senkte sich über Block 10. Alma stellte sich vor ihre Zuhörerinnen, setzte den Bogen auf die Saiten und schloss die Augen. Der erste lang anhaltende, vorsichtige Ton durchdrang die Stille der hereinbrechenden Nacht. Mit einem Mal brach er ab, ein Zögern, doch dann gewann die Melodie plötzlich an Kraft und entfaltete sich in einem Crescendo aus schnellen Läufen. Und in diesem Augenblick erlosch Auschwitz, der Name des Lagers, für seine Opfer. Sie befanden sich nicht länger dort; mit geschlossenen Augen, ein träumerisches Lächeln auf den erschöpften Gesichtern, wiegten sich die Frauen im Rhythmus der Musik, jede von ihnen versunken in ihrer eigenen Welt. Dort hatte Schönheit wieder eine Bedeutung, Liebende hielten einander in den Armen und wirbelten zu einem Wiener Walzer herum, und all ihre Lieben waren trotz allem noch am Leben, denn Musik ist ewig und die Erinnerungen auch.
In der Ecke weinte Ima lautlos und drückte ihr Schwesternkopftuch an den Mund. Magda lehnte an der Wand und rieb sich die Brust, als hätte sie dort Schmerzen, hervorgerufen von der Erinnerung daran, dass es noch etwas gab außerhalb dieser grausamen Welt, wo solche wie sie zu Hunderttausenden abgeschlachtet wurden. Und sie lächelte, denn mit dem Schmerz war in ihr auch die Hoffnung wieder erwacht – vielleicht war nicht alles verloren, wenn solche Schönheit sich sogar durch die Mauern von Auschwitz ihren Weg bahnen konnte.
Unter Almas Fingern vibrierte noch immer die Musik, da öffnete sie die Augen und grinste ihr verblüfftes Publikum verschmitzt an.
»Na, worauf wartet ihr?«, drang ihre Stimme plötzlich durch die ehrfürchtige Stille. »Spiele ich denn für nichts und wieder nichts? Also? Auf, auf und schwingt das Tanzbein! Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr nicht mehr wisst, wie das geht.«
Im ersten Moment sahen sich die Frauen verwirrt an. Schon die Vorstellung erschien ihnen unerhört. Aber dann trat Magda selbst als Erste an eines der Betten, verbeugte sich theatralisch und reichte einer der Frauen die Hand – mit einer Galanterie, die einem Adeligen aus der Kaiserzeit wohlangestanden hätte.
»Madame Mila, würden Sie mir die Ehre erweisen?«
Ohne zu zögern, erhob sich das Mädchen, das Magda als Mila angesprochen hatte, und legte seine schmale Hand in die der ungarischen Blockältesten. Kichernd vor ungläubigem Vergnügen, wirbelten sie barfuß und in ihren langen Nachthemden über die kleine Fläche vor der Behelfsbühne. Bald schloss sich ihnen ein weiteres Paar an, und noch eines. Mit tränenverschleierten Augen sah Alma ihnen zu, zum ersten Mal seit Monaten im Frieden mit sich selbst. Mit der Kraft ihrer Musik hatte sie diesen Frauen ein paar kostbare Momente der Freiheit geschenkt. Jetzt konnte sie glücklich sterben.
Kapitel 2
August 1943
»Eure Hoheit!« Trotz Magdas ironischer Anrede schwang in ihrer Stimme inzwischen ein gerüttelt Maß an Respekt mit.
Und nicht nur das, die Blockälteste hatte es auch irgendwie geschafft, dass Alma von den medizinischen Versuchen ausgenommen wurde. Der Krankenbau sollte seine Geigerin nicht verlieren, die sie alle mit ihrem Spiel das Grauen der Haft vergessen ließ. Alma hatte den starken Verdacht, dass diese Vorzugsbehandlung etwas mit Sylvia Friedmann zu tun hatte, Dr. Claubergs Erster Assistentin, die in letzter Zeit ein fester Gast bei ihren kulturellen Abenden geworden war. Vermutlich war sie es, die zugestimmt hatte, Almas Namen von Dr. Claubergs Liste zu streichen, nachdem Alma für die Krankenschwester ihre ersehnten slowakischen Lieblingslieder gespielt hatte.
»Was hältst du davon, heute Abend vor einem etwas anderen Publikum zu spielen?« Magdas Stimme klang auf angestrengte Weise fröhlich, aber das Unbehagen in ihrer Miene verriet sie. Hinter dem Rücken der Blockältesten traten zwei Neuankömmlinge, dürr wie Saatkrähen, verlegen von einem Fuß auf den anderen. »Diese beiden gehören dem Mädchenorchester an«, fuhr Magda fort. »Du hörst sie jeden Morgen spielen, wenn die Außenkommandos durch die Tore zur Arbeit aufbrechen. ›Arbeit macht frei‹ und solcher Mist. Die SS findet, dass ein Marsch zur Arbeit mit Musik gefeiert werden sollte.« Sie verdrehte die Augen, um anzudeuten, was sie von dem bösartigen Spruch hielt, der auf den Toren des Lagers prangte. »Für diese Aufgabe wurden die Lagerorchester ursprünglich zusammengestellt.«
Alma erwiderte nichts.
»Guten Tag, Frau Rosé.« Die jüngere der beiden Frauen trat vor. Das gestreifte Kleid, das ihr locker über den Körper fiel, betonte noch, wie ausgemergelt sie war. Erstaunlicherweise war ihr Kopf nicht geschoren, Alma sah dunkelbraune Locken, die sorgfältig unter das Kopftuch geschoben waren. »Es ist uns eine große Ehre, Ihre Bekanntschaft zu machen. Wir alle sind leidenschaftliche Bewunderinnen Ihrer Kunst.«
»Ich heiße Hilde, und das ist Karla«, stellte ihre Freundin sie beide vor. Genau wie Karla sprach Hilde Almas Muttersprache, aber mit preußischem Akzent anstatt Almas weichem Wienerisch. Sie trug ebenfalls ein gestreiftes Kleid samt Kopftuch. Offenbar war das eine Art Uniform des Orchesters.
Sofort begannen die beiden zu erzählen, wobei sie einander ständig unterbrachen.
»Zippy hat uns von dem riesigen Erfolg Ihrer Kulturabende berichtet …«
»Sie spielt auch in unserem kleinen Orchester, wissen Sie …«
»Ich spiele Blockflöte und Piccolo …«
»Und ich bin Perkussionistin. Aber ehrlich gesagt, was wir da zusammenspielen, ist eine so grässliche Katzenmusik – die hiesige Gestapo könnte sie gut als Folterinstrument benutzen. Unsere Marschmusik taugt gerade so zum Ausrücken für die Außenkommandos.«
»Sofia, unsere Dirigentin, bemüht sich, so gut es geht, um einen Orchesterklang, aber wir können eben nicht mehr als Affen auf einem Leierkasten.«
»Nun ist heute zufällig der Geburtstag von einem der SS-Aufseher, und wir dachten …«
»Nein.«
Verblüfft über diese kategorische Ablehnung – es war das erste Wort, das Alma über die unerbittlich fest zusammengepressten Lippen kam –, wechselten die beiden Mädchen nervöse Blicke.
Magda neben ihnen stieß lediglich ein leises verächtliches, aber wohlwollendes Schnauben aus. »Ich habe euch doch gesagt, dass sie sich weigern wird. Ihre Hoheit hat noch nicht ganz begriffen, wo sie sich befindet. Wenn sie mal ein paar Tage bei einem Außenkommando mitarbeiten und zum bloßen Vergnügen der SS-Männer Steine von einem Haufen auf den anderen werfen müsste, würde sie bei solchen Gelegenheiten sehr schnell nicht mehr die Nase rümpfen. Wir haben sie schon zu sehr verwöhnt.«
»Für diese nationalsozialistischen Schweinebauern spiele ich nicht«, sagte Alma. Als sie das Entsetzen in den Mienen der beiden Orchestermitglieder angesichts dieser sorglos ausgesprochenen Beleidigung gewahrte, grinste sie düster. »Schweinebauern«, wiederholte sie langsam und mit großem Genuss. »Genau das sind sie. Der Abschaum der Erde, aus ihren Löchern gekrochen, um ganz Europa mit ihrem Dreck zu überziehen. Für die soll ich spielen? Warum soll ich meine Kunst an sie verschwenden? Sie würden gute Musik nicht einmal dann erkennen, wenn man sie kopfüber hineinwerfen würde.«
Bleich und mit weit aufgerissenen Augen schüttelte Karla so heftig den Kopf, dass sich ihre dunkelbraunen Locken lösten und unter dem Kopftuch hervorspitzten. »So etwas dürfen Sie hier niemals laut sagen! Gegen ein Stück Brot meldet Sie jemand der Kapo oder einer Blockführerin der Aufseherinnen, und dann ist es für Sie vorbei.«
»Umso besser. Melden Sie mich doch, wenn Sie wollen. Ist mir völlig egal.« Das war kein bloßes Draufgängertum, in gewisser Weise scherte sie sich wirklich nicht darum, ob die SS-Männer sie wegen ihrer frechen Zunge an die Wand stellten und erschossen.
Magda lachte jetzt laut heraus. Habt ihr so etwas schon mal erlebt? Der Gedanke stand ihr offen ins Gesicht geschrieben. »Hoheit …« Sie trat an Almas Bett. »Sei doch nicht albern. Steh auf.«
Alma rührte sich nicht.
»Na, soll ich dir Beine machen? Wo ist der Unterschied, ob du für uns oder für die Aufseher spielst?«, drängte Magda.
»Für mich ist das ein großer Unterschied.«
»Die Mädchen haben recht, jemand wird melden, dass du dich weigerst zu spielen, und du landest wegen deiner Arroganz im Block nebenan. Dort wird dir die Lagergestapo dann Feuer unter dem Hintern machen.«
»Sollen sie mich doch totschlagen, das ändert nichts an meiner Entscheidung. Sie können mich vielleicht umbringen, aber zum Spielen zwingen können sie mich nicht.«
»Ich habe in meinem Leben ja schon viele Sturköpfe gesehen, aber so was ist mir noch nicht untergekommen.« Magda schüttelte den Kopf. »Ich habe getan, was ich konnte«, sagte sie zu den beiden Frauen vom Orchester, ehe sie sich zum Gehen wandte. »Damit müsst ihr euch jetzt rumschlagen. Ich habe Wichtigeres zu tun.«
Eine Weile sahen sich die drei Musikerinnen schweigend an. Karla war die Erste, die sich räusperte und das Wort ergriff.
»Frau Rosé, ich weiß, dass Sie aus Österreich stammen. In gewisser Weise sind wir Nachbarn, ich komme aus Deutschland. Ihre Familie ist dort ebenfalls wohlbekannt, zumindest in Künstlerkreisen. Was für Philanthropen Ihr Vater und Ihre Onkel immer waren …« Ihre Stimme verklang. Fast verzweifelt wartete sie auf Almas Reaktion.
»Was hat denn meine Familie damit zu tun?« Alma stieß den Atem aus, sie fand das Gespräch ermüdend.
Familie. Für sie hatte dieses Wort seinen ursprünglichen Sinn längst verloren. Als die Nazis nach Wien gekommen waren, hatten sie ihnen alles genommen; nun war der Rosé-Clan über die ganze Welt verteilt. Einige waren geflohen, wie Almas Bruder Alfred und seine Frau. Einige waren geblieben in der Hoffnung, dass dieser kollektive Wahnsinn wieder aufhörte, darunter Almas alter Vater. Aber der Wahnsinn nahm stattdessen noch zu, jeden Tag wurde einer ohnehin schon endlosen Liste ein neues Gesetz gegen die Juden hinzugefügt. Bald durften alte Freunde das Haus der Rosés nicht mehr aufsuchen, und ihr Vater Arnold Rosé, der einst so hochgeschätzte Konzertmeister der Wiener Philharmoniker, war aus dem Orchester geworfen worden und durfte nicht einmal mehr in seiner eigenen Wohnung die Musik deutscher Komponisten spielen. Alma war fast froh darüber, dass ihre Mutter bereits verstorben war und dies alles nicht mehr miterleben musste. Ihr wäre sicherlich das Herz gebrochen angesichts der Unmenschlichkeit und Grausamkeit, mit der Hitlers Braunhemden die Bevölkerung knechteten.
Familie. Am Ende waren sie nur noch zu zweit, Alma und Arnold, ihr geliebter Vater, der sich vor ihren Augen innerhalb weniger Monate von einem gefeierten Musiker in einen alten, gebrochenen Mann verwandelt hatte. Erst als er begriffen hatte, dass es in seiner eigenen Heimat keinen Platz mehr für ihn gab, erlaubte er Alma, ihn fortzubringen, in die Sicherheit von London.
Familie, dachte Alma und fühlte sich plötzlich sehr elend.
Einen Augenblick lang schien Karla nach den richtigen Worten zu suchen. »Wenn schon nicht für Sie selbst – und glauben Sie mir, ich kann Ihre Gefühle sehr gut nachvollziehen –, vielleicht würden Sie es für andere, für uns, in Erwägung ziehen …«
Wieder trat eine unbehagliche Pause ein.
Alma runzelte die Stirn.
Schließlich stieß Karlas Orchesterfreundin einen ungeduldigen Seufzer aus. »Was sie sagen will: Wenn Sie für diese Leute spielen, zusammen mit uns, bekommt das ganze Orchester zusätzliche Essensrationen. Aber wie wir schon sagten, wir spielen nicht besonders gut, und daher bräuchten wir jemanden … mit einer Ausbildung.«
»Ja, mit Ausbildung und Erfahrung …«, fügte Karla hinzu.
»Und mit musikalischem Können …«
»Ja, unbedingt, mit musikalischem Können.«
Hilde fuhr fort: »Wissen Sie, wenn wir gut spielen, geben sie uns mehr Brot und manchmal sogar Wurst dazu. Und Brot und Wurst könnten wir wirklich gut brauchen.«
Almas Miene wurde freundlicher, ein leises Lächeln zeigte sich auf ihren Lippen. »Das ist alles, worum es geht? Das hätten Sie mir von Anfang an sagen sollen. Wohltätigkeitskonzerte habe ich noch nie abgelehnt.«
»Dann werden Sie spielen?« Karla strahlte über das ganze Gesicht, sie klatschte freudig in die Hände.
»Ja, nur …« Mit angeekeltem Grinsen zupfte Alma an ihrem Nachthemd – der üblichen Uniform in Block 10. »Darin kann ich wohl schlecht auftreten, wie Sie sich denken können.«
»Wir besorgen Ihnen umgehend ein Kleid aus dem ›Kanada‹! Heute Abend werden Sie aussehen wie eine Prinzessin.«
»Was ist das ›Kanada‹?«, wollte Alma wissen.
»Das Kanada ist … ach … der Himmel auf Erden.« Karla blickte träumerisch an die Decke. »Ein Ort, wo es einfach alles gibt.«
»Es ist die Effektenkammer von Birkenau und der koscherste Platz im ganzen Lager«, erläuterte Hilde der verwirrten Alma. »In diesen Baracken werden die Kleider und Habseligkeiten der Neuankömmlinge sortiert, desinfiziert und später nach Deutschland gebracht, damit die Arier sie anziehen und benutzen können. Wenn Sie mal etwas ›organisieren‹ wollen, müssen Sie ins Kanada gehen.«
Alma ahnte noch nicht, wie prophetisch diese Sätze waren.
Sie schafften es tatsächlich, ihr innerhalb von weniger als zwei Stunden ein Abendkleid zu besorgen. Es roch noch schwach nach dem Parfüm einer anderen Frau und war ihr eine Nummer zu groß, aber Alma war ihr Aussehen egal. Noch nie zuvor hatte sie sich so zögerlich angekleidet, noch nie zuvor hatte sie so große Abscheu vor ihrem Publikum empfunden. Doch die Mädchen des Orchesters hatten Hunger, und so schob Alma ihre Gefühle beiseite und trat hinter ihnen in die Nacht hinaus.
Im Innern des Blocks, in den sie geführt wurde, wurde die Sperrholzbühne lediglich von ein paar einsamen Glühbirnen erleuchtet. Sogar unter Almas geringem Gewicht knarrte der Boden, als sie, die Violine in der Hand, vor ihr Publikum trat. Eine Guadagnini war die Geige beileibe nicht, aber sie war gut gestimmt und hatte noch alle Saiten, das genügte Alma. »In den Händen eines Künstlers ist jedes Instrument gut genug«, hatte ihr Vater immer gesagt.
Als sie die Geige auf die Schulter legte, fragte sich Alma, wie es ihrem Vater in England wohl erging. Sie hatte ihn nach London in Sicherheit gebracht und war selbst, gegen den Ratschlag aller, nach Holland gereist, wo jüdische Musiker noch Arbeit fanden. Trotz der Bedrohung durch die deutsche Armee, die ihre Klauen in das vom Krieg gebeutelte Europa schlug, hatte Alma unermüdlich gespielt. Ein paar kostbare Monate lang war sie an jedem Veranstaltungsort, der sie buchte, aufgetreten, um ihrem Vater die Einnahmen ihrer kleinen Konzerte zu schicken. Aber dann, wenige Wochen vor ihrer geplanten Rückkehr nach London, marschierten die Deutschen in den Niederlanden ein, und jeglicher Kontakt zwischen Vater und Tochter war auf einmal unmöglich geworden. Als sie nun in Auschwitz ihren Bogen anhob, stellte Alma sich vor, wie ihr Vater in einem ruhigen englischen Dorf irgendwo seinen Tee trank, fernab der Bomben und dieses ganzen »wissenschaftlichen Antisemitismus« – sicher und unbehelligt von all dem Schmutz.
Heute Abend spielte sie für ihn, nicht für diesen bunten Haufen aus eleganten grauen SS-Uniformen und Kapos in Alltagskleidung, sondern nur für ihn. Sie würde so schön spielen, wie sie konnte, um ihn stolz zu machen, und nicht, um diesen elenden Kreaturen, die sie von ganzem Herzen verabscheute, Unterhaltung zu bieten.
Sie spielte an diesem Abend seine sämtlichen Lieblingsstücke, jedes einzelne, aus dem Gedächtnis und laut und herausfordernd. Sogar jüdische Komponisten wagte sie, in ihre Auswahl aufzunehmen. Zum Nachtisch servierte sie ihnen Tschaikowsky, Dezember – Weihnachten aus dem Zyklus Die Jahreszeiten, nur um sie mit der Erinnerung an das Land zu ärgern, gegen das die Deutschen gerade den Krieg verloren. Sie war fast enttäuscht, dass die SS-Männer und die Aufseherinnen die Anspielung nicht begriffen und wie wild applaudierten.
Zum ersten Mal in ihrer gesamten Karriere verbeugte sich Alma nicht vor dem Publikum.
Nach der Vorstellung gab es tatsächlich zusätzliches Brot und eine angeschimmelte Wurst. Alma überließ ihre Ration den anderen Frauen.
Im Büro der Oberaufseherin des Frauenlagers Birkenau roch es leicht nach Flieder. Eine Aufseherin hatte Alma ein paar Tage nach dem Konzert dorthin beordert, und als Alma sich vor dem Schreibtisch von Maria Mandl niederließ, arrangierte eine Gefangene soeben frische Blumen in einer Vase. Mandl sah ihr mit unzufriedener Miene zu, und Alma dachte bei sich, dass die Oberaufseherin die Frau schon längst angeschrien hätte, wenn sie nicht im Raum gewesen wäre. So aber hielt Mandl den Blick nur bedeutungsvoll auf die magere Gestalt gerichtet. Erst nachdem die Insassin das Zimmer verlassen hatte, wandte sie sich Alma zu.
Alma schätzte sie auf etwas über dreißig, ein paar Jahre jünger als sie selbst. Das Alter des Lagerpersonals einzuschätzen war nicht leicht, was auch für die Gefangenen galt. Aber während Hunger, Erschöpfung und Krankheit die Insassen vor der Zeit altern ließen, waren die eigentlich wohlgestalteten Gesichter der Aufseherinnen von harten Falten gezeichnet. Das ständige Schimpfen und Schreien hatte ihre Münder verformt und tiefe Furchen zwischen den sorgfältig gezupften Brauen hinterlassen. So, wie das Leiden die Lagerinsassen dahinwelken ließ, machte der Hass die Aufseherinnen älter, als sie in Wirklichkeit waren. Ausgleichende Gerechtigkeit, fand Alma.
Mandl brach das Schweigen als Erste. »Mein Wachpersonal spricht immer noch über Ihr Konzert«, sagte sie. »Ihr Vater war der Konzertmeister der Wiener Philharmoniker.« Das war keine Frage, sondern eine Feststellung, die einen Hauch von Respekt beinhaltete.
Alma erkannte den vertrauten Tonfall. Auch die Oberaufseherin Mandl war Österreicherin, genau wie sie.
»Ich stamme nicht aus Wien, sondern aus den Bergen«, fuhr Mandl fort und rutschte unbehaglich auf ihrem Stuhl herum.
Aus einer Stadt – oder wohl eher einem Dorf, dessen Namen sie schamhaft verschwieg. Alma grinste. Wie sie gesagt hatte, Schweinebauern waren sie, dieses ganze uniformierte Pack.
»Ich habe Sie und Ihren Vater spielen hören, kurz vor dem Anschluss.«
Natürlich vor dem Anschluss. Nach der Annexion von Österreich hatten die Helfershelfer des Propagandaministeriums jeden einzelnen jüdischen Musiker aus dem Orchester entfernt und durch einen entsprechenden Arier ersetzt, auch wenn dieser sein Instrument nicht im Geringsten beherrschte. Aber das war völlig egal, solange das Blut »rein« war.
Stumm sah Alma die Oberaufseherin an. Es bereitete ihr ein klammheimliches Vergnügen zu sehen, wie dieses Schweigen Mandl zunehmend unruhig machte.
»Was für ein Glück, dass wir Sie bei uns haben dürfen, finden Sie nicht auch?« Bei diesen Worten lächelte Mandl sogar. Es war das Lächeln einer Frau, die diesen Gesichtsausdruck nicht oft einsetzte, unsicher und etwas verrutscht.
Alma runzelte die Stirn. Was sollte das sein? Ein geschmackloser Witz?
»Ich wollte sagen, der Herr Kommandant wäre höchst erfreut, wenn Sie auch für ihn und seine einflussreichen Gäste spielen würden. Ich liebe Musik ebenfalls sehr, das ist uns beiden gemeinsam.«
Das ist so ziemlich das Einzige, was wir gemeinsam haben, hätte Alma gern laut gesagt.
»Sie würden mir einen großen Gefallen tun, wenn Sie aus diesem Haufen von Frauen, den ich jetzt als Orchester ausgebe, etwas Brauchbares machen würden.« Mandl stieß ein kurzes, verlegenes Kichern aus. »Sie haben sie ja spielen hören. Diese sogenannte Musik muss in Ihren Ohren noch viel schrecklicher geklungen haben als in meinen.«
»Es ist schwer, gut zu spielen, wenn man nie genug zu essen bekommt«, gab Alma zurück.
Ein paar Augenblicke lang saß Mandl nur da und zwinkerte nervös, sie schien völlig aus dem Konzept gebracht. Ganz offensichtlich hatte sie sich die ersten Worte der berühmten Geigerin anders vorgestellt.
»Natürlich kann ich ihnen beibringen, wie man in Wien gute Musik spielt, aber unter solchen Bedingungen wie hier kann ich weder leben noch arbeiten«, fuhr Alma mit eisiger Stimme fort. »Ich habe gesehen, wo diese Frauen jetzt untergebracht sind, Oberaufseherin, und bei allem gebotenen Respekt …«, sie konnte nur hoffen, dass sie nicht allzu sarkastisch klang, »die Umstände sind entsetzlich. Wenn Sie wollen, dass ich Ihr Orchester leite, dann brauche ich neue Räume, die ausschließlich meinen Mädchen vorbehalten sind und wo es auch einen eigenen Probenraum gibt sowie eine Aufbewahrungsmöglichkeit für die Instrumente und Zugang zu Duschen, damit wir für die Konzerte gepflegt aussehen können. Und wir brauchen andere Uniformen, nicht diese gestreiften Lappen, die sie jetzt tragen. Außerdem müssen Sie ihnen endlich genug zu essen geben! Regelmäßige, gehaltvolle Mahlzeiten und nicht diese mageren Zusatzportionen, die Sie ihnen jetzt nach jeder Vorstellung zuwerfen wie Hunden einen Knochen! Das ist entwürdigend. Wie soll man gute Musik spielen, wenn man ständig derart gedemütigt wird? Nicht einmal ich könnte noch brauchbar spielen, wenn Sie mich ein paar Wochen lang so behandeln würden.« Mit dem Kopf deutete Alma auf die Blumenvase. »Diesen Flieder würden Sie doch auch nicht ohne Wasser und Sonne lassen und erwarten, dass er Sie dennoch mit seiner Schönheit und dem herrlichen Duft erfreut. Wie also können Sie guten Gewissens von uns erwarten, dass wir Sie und Ihre Kameraden mit unserer Musik erfreuen, wenn Sie uns unser Wasser und unser Sonnenlicht verweigern?«
Den Kopf leicht zur Seite geneigt, wartete Alma auf Mandls Antwort. Es ärgerte sie, dass sie einer Landsmännin solche Selbstverständlichkeiten überhaupt erklären musste.
Ein paar Sekunden lang saß die Oberaufseherin des Frauenlagers wie erstarrt da und wusste nicht, was sie tun sollte. Ihre Autorität war soeben gründlich infrage gestellt worden, und das auch noch von einer Jüdin und Lagerinsassin. Die Häftlinge nannten Mandl nicht umsonst »die Bestie«. Das Frauenlager von Birkenau war ihr Reich, wo sie allein die Befehle gab. Hier war sie nicht nur die rechtmäßige Herrscherin, sondern gottgleich, vom Führer persönlich ernannt, um zu entscheiden, wer leben durfte und wer sterben musste. Zu genau diesem Zweck trug sie eine Pistole in ihrem Holster. Und sie hatte schon für weniger getötet. Dennoch …
… dennoch wagte Mandl es nicht einmal, vor dieser Frau, die ihr da gegenübersaß, die Stimme zu erheben. Sie wusste genau, mit einem einzigen Schrei würde sie ihre überlegene Position augenblicklich einbüßen, so seltsam sich das auch anhören mochte. Schreien und Fluchen waren in ihrem Elternhaus alltäglich gewesen, ausgestoßen in erster Linie von ihrem stets betrunkenen Vater und erwidert mit einer Woge bösartiger Beleidigungen von ihrer Mutter, die auf ihn gemünzt waren: Dieser Nichtsnutz, dieses miese Schwein, soll er doch in dem Rinnstein verrotten, aus dem er hervorgekrochen ist …
Im Hause der Rosé hatte niemand herumgeschrien, darauf hätte Mandl ihren gesamten Besitz verwettet. Bei den Rosés wurde musiziert, man aß mit Silberbesteck von edlem Porzellan und küsste den Damen galant die Hand. Nein, grobes Gebrüll und – schlimmer noch – der Einsatz der Peitsche würden nur die Unterschiede in ihrer Herkunft aufzeigen, und das erschien Mandl unerträglich. In den Augen der anderen würde sie »die Bestie« bleiben. In den Augen von Alma Rosé wollte sie eine zivilisierte Liebhaberin von Kultur und Schönheit sein.
»Das scheint mir ein vernünftiger Vorschlag zu sein«, äußerte sie schließlich in nachdenklichem Ton. »Sie bekommen eine neue Baracke. Und neue Uniformen. Die Duschen müssen Sie sich allerdings vorerst mit den Häftlingen teilen, die im Kanada arbeiten.«
»Das ist völlig in Ordnung, Oberaufseherin. Ich danke Ihnen für Ihre Freundlichkeit und Ihr Verständnis.«
An der Tür schüttelten sie einander die Hand – das erste Mal, dass Mandl einer Gefangenen die Hand hingestreckt hatte. Aber Alma Rosé benahm sich nicht wie eine normale Gefangene, sondern eher wie ein prominenter Gast, der dieses abgelegene Quartier mit seiner Anwesenheit beehrte. Noch lange nachdem die berühmte Geigerin den Raum verlassen hatte, stand Mandl da und starrte ihre Handfläche an, ein dümmliches Lächeln im Gesicht. Sie hatte soeben Alma Rosé persönlich die Hand gegeben.
Kapitel 3
Der Musikblock von Birkenau trug die Nummer 12 und war eine graue Holzbaracke am äußersten Ende des Frauenlagers, etwas abseits und halbwegs geschützt. Hier war das Gras noch nicht von halb verhungerten Häftlingen abgeweidet, und Kiefern spendeten an heißen Nachmittagen angenehmen Schatten. Aber Alma ließ sich nicht so leicht täuschen. Ein frischer Rußfilm färbte das Gras aschgrau, und hinter den Kiefern verbarg sich eine mehr als vier Meter hohe Wand aus Stacheldraht. Das Unheimlichste war allerdings das lang gezogene Gebäude mit dem hoch aufragenden Schornstein, das wie ein böses Raubtier gleich hinter dem Zaun lauerte. Gerade schlummerte es – der Kamin spuckte keinen fettigen, faulig stinkenden Rauch in den strahlend blauen Himmel –, aber Alma wusste genau, was sie da vor sich hatte. Das Krematorium.
»Ihr neuer Block«, verkündete Maria Mandl im fröhlichen Ton einer Empfangsdame in einem österreichischen Hotel. Eine der Aufseherinnen, die Mandl begleiteten, räusperte sich, um darauf hinzuweisen, dass diese Zugeständnisse der Oberaufseherin an die unwürdigen Häftlinge anerkannt werden sollten.
»Wie schön«, murmelte Alma, den Blick noch immer auf den Schornstein gerichtet.
»Die Mädchen wurden gestern erst hergebracht, aber wie Sie hören können, üben sie bereits fleißig.« Mandls Lächeln wurde noch breiter. »Kommen Sie, ich stelle sie Ihnen noch einmal ordentlich vor.«
»Achtung!«, brüllte die zweite Begleiterin und betrat die Baracke.
Unauffällig wischte Alma die freie Hand an ihrem blauen Kleid ab – die neue Uniform des Mädchenorchesters von Birkenau – und folgte Mandl und den Aufseherinnen nach drinnen. Ihre Geige hielt sie fest in der anderen Hand.
Beim Anblick der SS-Helferinnen und der Leiterin des Frauenlagers sprangen die Orchestermitglieder augenblicklich auf, nahmen Haltung an und standen still. Mandl bedeutete ihnen, zu ihren Stühlen zurückzukehren, die in einem Halbkreis um das Dirigentenpult angeordnet waren. Offensichtlich überaus zufrieden mit sich selbst, drehte sie sich zu Alma um.
Unter normalen Umständen hätte Alma das für einen schlechten Witz gehalten, aber ihr wurde klar, dass diese Baracke im Lager Birkenau, das noch überfüllter und stärker mit Ungeziefer verseucht war als das Hauptlager Auschwitz, eine der besseren war. Alma hatte noch nie einen Fuß in die normalen Unterkünfte des Frauenlagers gesetzt, aber schon genug darüber gehört. Magda hatte Neuankömmlingen gern damit gedroht, sie ins Lager Birkenau zu schicken, und nicht nur einmal hatte die eindrückliche Beschreibung der Ungarin ihnen so viel Angst eingejagt, dass sie sich widerstandslos fügten.
»Wenn ihr meine Geduld weiterhin auf die Probe stellt, dann setze ich euch auf die Transferliste. Ihr findet es schlimm hier in Auschwitz? Dann möchte ich mal sehen, wie es euch gefällt, wenn ihr in Birkenau zusammen mit sieben oder acht anderen Frauen eng gedrängt in einem einzigen hölzernen Stockbett schlafen müsst, anstatt wie hier euer eigenes Bett mit Matratze und Kopfkissen zu haben. Und wenn ihr weiter oben keinen Platz mehr findet, dann müsst ihr in der untersten Etage übernachten. Wisst ihr, was das heißt? Ein nasser Ziegelboden. Dort ist es so eng, dass ihr hineinkrabbeln müsst wie in eine Hundehütte. Und wenn ihr das Glück habt, euch zusammen mit sieben anderen Frauen in eine der mittleren Kojen quetschen zu dürfen, dann stellt euch darauf ein, dass euch beim Schlafen menschliche Ausscheidungen aufs Gesicht tropfen – dort haben immer welche Durchfall. Und in der Nacht wird die Tür des Blocks abgesperrt, dann könnt ihr nicht auf die Latrinen gehen, meine Süßen. Jede macht einfach dort, wo sie gerade liegt. Natürlich gibt es auch die Betten ganz oben, die denen, die weiter unten liegen, viel besser vorkommen, aber auch da gibt es Nachteile: Bei Regen tropft es einem durch die Ritzen der Dachbretter nämlich direkt aufs Hirn. Und im Sommer sammelt sich die Hitze dort unter dem Dach, und ihr erstickt noch schneller als in der Gaskammer. In der Nacht knabbern die Ratten an euren zartrosa Knöcheln … Neuankömmlinge mögen sie besonders.«
Inzwischen hatte Alma längst begriffen, dass die Furcht einflößenden Geschichten der Blockältesten Hellinger lediglich dazu dienten, ihre Schützlinge zu disziplinieren. Noch nie hatte sie ihre Drohung, jemanden in die Hölle von Birkenau verlegen zu lassen, wahr gemacht, aber die Schilderungen genügten schon. Nicht einmal Mandls Zusicherung, Almas neue Unterkunft dort sei für das Orchester bestimmt, hatte genügt, um Almas Ängste zu beschwichtigen. Sie war trotzdem in Birkenau. Im Vorraum zur Gaskammer.
Langsam ließ sie den Blick durch die neuen Räumlichkeiten schweifen. Darin standen wie überall in Birkenau die typischen dreistöckigen Kojenbetten, aber es gab Bettzeug, wie Alma erleichtert feststellte. Richtige Bettbezüge und Kopfkissen, in jedem einzelnen Bett. Der Boden war aus Holz und nicht aus Lehm oder Steinen. Es gab zwar keine Zimmerdecken, sondern nur das bloße Dach, aber darunter hingen Glühbirnen an Drähten, ein Luxus, unvorstellbar für die anderen Häftlinge, die ihre Brotration gegen Kerzenstummel eintauschen mussten, um in ihren stallähnlichen Unterkünften wenigstens ein bisschen Licht zu haben. Diese Baracke war immer noch ein jämmerlicher Schuppen, aber wenigstens einer, in dem man halbwegs leben konnte, und das war jetzt alles, was zählte.
Alma schenkte Mandl ein dünnes Lächeln. »Oberaufseherin, ich weiß nicht, wie ich Ihnen für Ihre Großzügigkeit danken soll.« Es kostete sie große Mühe, den Sarkasmus aus ihrer Stimme zu verbannen.
Mandl grinste breit. »Sie müssen sich nicht bei mir bedanken. Im Gegensatz zu dem, was man über mich erzählt, bin ich vernünftigen Argumenten gegenüber durchaus aufgeschlossen. Was Sie angeführt haben, erschien mir überzeugend. Ich habe nur getan, was in diesem Fall richtig war.«
Eine wahre Menschenfreundin mit einer Pferdepeitsche in der Hand, dachte Alma und musste sich erneut ein Lächeln verbeißen.
»Ach ja, und das hier ist Ihr privates Reich.« Mandl stieß die Tür zu einem Raum direkt neben dem Eingang auf.
Es war allenfalls eine Besenkammer, kein Zimmer und schon gar kein »Reich«. Vier weiße Wände, zwischen denen wundersamerweise ein Bett, ein Tisch mit zwei Stühlen und ein winziger Schrank Platz gefunden hatten. Aber wir sind in Birkenau, und in der Not frisst der Teufel Fliegen, dachte Alma düster. Sie musste wirklich dankbar sein, dass sie einen Raum für sich allein hatte, in den sie sich gelegentlich zurückziehen konnte.
Dennoch widersprach das ganze Geschehen ihrem Sinn für Gerechtigkeit. Warum sollte sie dieser Frau für so eine Hundehütte danken, wenn sie doch überhaupt nicht hier wäre ohne ihren wahnsinnigen »Führer« und dessen Behauptung, die Zugehörigkeit zur jüdischen »Rasse« sei ein Verbrechen an der Menschheit und werde mit dem Tode bestraft? Warum sollte sie dankbar sein für ein bisschen Anständigkeit und Menschlichkeit ihr und ihren neuen Kolleginnen gegenüber, wenn doch keine von ihnen hier sein, ja diese ganze Todesfabrik überhaupt nicht existieren sollte?
Halt einfach den Mund, wenn du weißt, was gut für dich ist, Hoheit, vernahm sie viel zu laut Magdas Stimme in ihrem Innern. Du hörst doch täglich die Pistolenschüsse an der Mauer. Und weißt, wie diejenigen enden, die Widerstand leisten.
»Ich danke Ihnen, Oberaufseherin«, stieß Alma mit zusammengebissenen Zähnen hervor. »Das weiß ich sehr zu schätzen.«
In diesem Moment entdeckte sie einen fremden Schal, der über einer Stuhllehne hing.
»Sieht so aus, als wohnt da schon jemand«, sagte sie und deutete auf den Schal.
»Jetzt nicht mehr.« Umstandslos zog Mandl den Schal von der Lehne und warf ihn hinaus auf den Flur.
Wie mit einem eiskalten Wasserschwall wurde Alma klar, dass sie soeben miterlebt hatte, wie schnell einer Gefangenen die Privilegien wieder entzogen werden konnten.