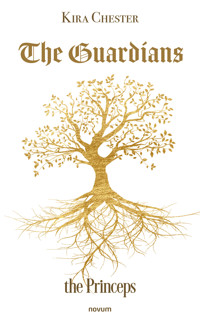17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
"Und immer, wenn das Gleichgewicht zu kippen drohte, schickten die Götter ihre Wächter." Die Welt wurde in drei Teile geteilt: In die der Elementare und Blutmagier, die der Götter und die jener, die sich gegen die Magie entschieden. Genau diese Welt ist es, die von Bahal und seinen Wächtern beschützt werden muss. Denn es sind magische Wesen in der Welt der Sterblichen, von denen sie nichts erfahren dürfen. Der Polizist Robert ist von seinem Leben frustriert, und davon, in einer neuen Abteilung festzusitzen, die sich mit Dingen befasst, an die er selbst nicht glauben will. Als aber ein mysteriöser Fall seine Aufmerksamkeit erregt, kehrt sein Spürsinn zurück.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 559
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2024 novum publishing
ISBN Printausgabe: 978-3-99130-553-8
ISBN e-book: 978-3-99130-554-5
Lektorat: Theresia Riegler
Umschlagfotos: Scenery1, Olivier Le Moal | Dreamstime.com
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
www.novumverlag.com
Prolog
Unsere Welt ist wunderschön, voller Wunder und Magie, aber sie ist auch dunkel und gefährlich. Damit sie nicht zerbricht benötigt sie Balance. Die Waage muss ausgeglichen sein, dass ist das eine Gesetz was für jeden von uns gilt, auch für uns Götter. Doch Balance erreicht man nicht allein. Deshalb existiert das Flüstern. Eine leise Stimme die wir in unseren Träumen und Zweifeln hören. Sie will uns verführen die Balance zu stören damit die Waage zu kippen beginnt. Das Gleichgewicht und das Flüstern sind der Ursprung allen Lebens. Aus diesem flüchtigen Funken des Seins wurden wir geboren: die ersten Götter.
Als unsere Welt noch jung war, teilten wir Götter sie mit den alten Wesen, die genau wie wir aus dem ersten Funken geboren wurden. Gemeinsam herrschten wir über all ihre Wunder, in Harmonie und Einigkeit. Wir Götter schufen ein eigenes Volk, geboren aus unserer Magie. Wir teilten all unser Wissen und all unsere Magie mit unserer Schöpfung, und sie beteten für uns. Als die Zeit gekommen war, erschufen wir eine magische Barriere, um einen kleinen Teil der Welt zu unserer Heimat zu machen, diese Barriere nannten wir den Schleier. So wachten wir eine ganze Ewigkeit über unser Volk. Jedoch brachte die Trennung von uns Göttern und unserer Magie einige sonderbare Änderungen mit sich. Ohne unseren Einfluss, legte sich eine Kraft namens Zeit über die Welt. Ihre Wellen flossen nun durch alles Leben und machten es sterblich. Mit der Sterblichkeit kamen Krankheit, Alter und Verlust über das einst so mächtige Volk. Aus Angst flehten die Gläubigen, sie knieten und bettelten um unsere Rückkehr. Doch ihr Klagen drang nicht zu uns, denn die Zeit unserer Herrschaft war um, wir fielen in einen tiefen Schlaf.
Ein neues Zeitalter brach an, Misstrauen und Verzweiflung legten sich über die Herzen der Gläubigen und das Flüstern wurde immer lauter. Es drang in die Träume der Sterblichen ein und setzte sich in ihre Köpfe. Unsere Stimmen und unsere Namen, waren nun nichts mehr als eine blasse Erinnerung.
Neue Götter schritten nun durch die Welt hinter dem Schleier, sie lebten in einer Halle aus Gold, von dort aus beobachteten sie die Welt, die wir ihnen hinterlassen hatten. Die neuen Götter aber waren nicht wie wir, sie teilten nicht, sie wollten herrschen, also entbrannte Streit zwischen ihnen. Wie Spielfiguren schoben sie die Gläubigen über ihre Schlachtfelder, damit sie in ihrem Namen starben. Auf dass das im Glauben vergossene Blut ihre Macht stärken möge. Und die Gläubigen bluteten und sie starben als Opfer für ihre gierigen Götter.
Viele Zeitalter zogen über das Land, noch immer gab es keinen Sieger in der goldenen Halle hinter demSchleier. Das einst so große, starke Volk, das wir alten Götter zurückgelassen hatten, war nicht mehr. Wo das Blut die Erde tränkte, war niemand übrig, der glauben konnte. Ohne den Glauben jedoch ist ein Gott nicht mehr als sein Volk, schwach und verletzlich. Die verbliebenen Herrscher wandten sich von ihren Göttern ab. Aus Priestern wurden Könige und als solche beanspruchten sie das Land für sich. Als die Zeit gekommen war, versammelten sich die großen Heere unter dem Namen ihrer Könige, um etwas zu verhandeln, was die Götter ihnen nie vergönnt hatten: Frieden. So standen sich die ersten drei Könige gegenüber, jeder von ihnen mit einem eigenen Volk, und stritten über die rechtmäßige Herrschaft über alles Leben. Der Erste, dessen Magie es vermochte, die Elemente selbst zu bändigen, erhob Anspruch auf die Schöpfung. Denn die Magie seines Volkes durchfloss die Berge, die Meere und die Luft. Der Zweite, dessen Magie mit dem Blut durch seine Adern floss, beanspruchten die Herrschaft über alles Leben für sich. Denn in allem Leben floss Blut und die Magie des Blutes gehörte seinem Volk. Der Dritte jedoch mahnte, dass die Magie, egal welche, nur den Göttern gehören sollte, denn sie hatte das Volk und alles Leben verdorben. In seinen Augen sollten alle Völker der Magie entsagen, denn nur so könne es Frieden geben, frei von dem Flüstern und den Göttern. Ein letztes Mal riefen die Könige ihre Götter an und baten um Rat. Doch keine Antwort drang durch den Schleier, kein Zeichen war zu sehen, die Götter blieben stumm. So entschlossen sich die Herrscher, das Reich endgültig aufzuteilen. Der Norden und der Osten gehörten nun den Elementaren. Sie herrschten über die Magie und alle Wesen, die aus ihrer reinen Form entstanden. Der Süden und Westenfiel unter die Herrschaft des Blutes. Sie herrschten über ein großes Volk und über ihre Diener aus Fleisch und Knochen. Diejenigen, die der Magie entsagen wollten, erkannten, dass diese Welt keinen Platz für sie hatte. Das Volk des dritten Königs schloss sich zusammen für einen letzten Akt der Magie, um sich endgültig von den Göttern zu lösen. Mit ihrer gemeinsamen Energie erschufen sie eine Barriere, dicker noch als der Schleier selbst, sodass das Flüstern sie nicht mehr erreichen konnte. Ohne ihre Magie wurde das Volk in ein Zeitalter des Vergessens geführt. Keine Geschichten der alten Zeit wurden mehr erzählt, keine Lieder über die Magie und ihre Schönheit wurden gesungen. Bis schließlich niemand mehr übrig war, der sich an die alte Welt erinnerte. Nun gehörte die Welt hinter der Barriere nicht mehr dem Flüstern, diese Welt hatte nun neue Götter: diese Welt gehört den Menschen.
Kapitel 1
Angewidert blickte Pain auf die Stadt zu seinen Füßen. Wie sehr er die Menschen verachtete. Ihre schwächlichen Körper, geboren ohne jegliche Begabung, zum Sterben verdammt. Wie eine Herde ohne eigenen Verstand folgten die Menschen allen, von denen sie sich ein besseres Leben versprachen. Was ihnen an Magie fehlte, versuchten sie mit Metall und Elektrizität zu ersetzen. Ihre Häuser reichten in den Himmel, dicht an dicht, wie in einem Wald gab es kaum ein Durchkommen durch die überfüllten Gassen. In den dunklen Ecken und Winkeln standen zwielichtige Gestalten und warteten auf Beute. Ein amüsiertes Lächeln huschte über Pains Gesicht, die Vorstellung, dass sich diese schwächlichen Sterblichen wohl als Raubtiere verstanden, er konnte nicht verstehen, wie man überhaupt etwas so Zerbrechliches wie einen Menschen fürchten konnte. Ohne Reißzähne oder Krallen hatten sie nichts, um ihren Mangel an Macht und Begabung auszugleichen. Ohne Flügel konnten sie nicht fliegen, keine Schuppen schützten ihre weiche Haut. Sie waren einfach nur ein Haufen gebrechlicher Knochen, umhüllt von weichem Gewebe, verpackt in Sterblichkeit, was für eine Irrung der Natur. Pain richtete den Blick nach oben. Ob es wohl schon Nacht ist, fragte er sich. Sein Zeitgefühl war verdammt durcheinander, seit er auf dieser Seite der Barriere festsaß. Nicht nur, weil die Zeit hier offensichtlich anders floss, als er es gewohnt war. Ihm fiel es einfach schwer, die Zeit am Himmel abzulesen. Am Tag war das Blau verdeckt von dichtem, grauem Rauch, der aus den Schornsteinen emporstieg wie aus einem Schmiedeofen und die Nacht war verdeckt von den Lichtern der Stadt. Es bestand keine Möglichkeit, dem Stand der Sonne oder dem der Sterne zu folgen. Welch Ironie, dass ihre Häuser in den Himmel reichen, obwohl von ihren Dächern aus der Himmel gar nicht zu sehen ist, stellte Pain amüsiert fest. Allerdings, so leer wie die Straßen im Moment waren, war es wohlNacht, versuchte er seine Beobachtungen einzuordnen. Nur die Sonderbarsten und Abartigsten ihrer Rasse trieben sich zu solcher Stunde in der Stadt herum. Beobachtet von Wachen, die mehr ein Teil des Drecks waren als wirklich eine Hilfe, zumindest soweit er es beurteilen konnte. Pain verfolgte ein donnerndes Geräusch durch die Straßen. Es kam von den Wachen, die sich auf Gefährten aus Metall durch die Straßen bewegten. Die Gefährte waren so laut und schwer, dass er die Wachen schon von Weitem gut ausmachen konnte. Selbst hier oben konnte er die Vibrationen unter seinen Füßen spüren. Welchen Vorteil das haben sollte, wusste Pain nicht, er selbst würde ein starkes Pferd bevorzugen. Und statt sich wie echte Männer in einem Duell mit Schwert oder Degen gegenüberzustehen, hatten die Menschen Waffen aus Metall bei sich, die mit einem ohrenbetäubenden Knall Kugeln verschossen. Er verzog angewidert die Miene, Metall in Wunden war nicht zu empfehlen. Wie wenn die Spitze eines Dolches oder ein Pfeil in der Wunde steckte, sie heilte einfach nicht richtig. Die Vorstellung, mit den Händen im eigenen Fleisch nach der Kugel suchen zu müssen, gefiel ihm gar nicht. Pain hatte beobachtet, dass die Kugeln sich tief ins Fleisch fraßen, sie aus der Wunde zu holen würde eine echte Sauerei geben. Achtsamkeit war geboten, denn die Wachen schienen recht schießwütig zu sein, so schreckhaft und so leicht zu töten. Amüsiert dachte Pain über die Wache nach, die er letzte Nacht ausgeschaltet hatte. Den zerbrechlichen Körper des Mannes unter seinen Schlägen brechen zu spüren, hatte ihm eine gewisse Befriedigung verschafft. Bedauerlich, dass er den Menschen nicht töten durfte. Der Sterbliche hatte im Weg gestanden, was er ignoriert hätte, aber dann hatte der Mann sich umgedreht und angefangen, mit seiner metallenen Waffe herumzufuchteln. Der Mensch hatte ihn bedroht, oder er hatte es zumindest versucht, Pain lächelte angesichts der süßen Erinnerung. Gezittert hatte der Mensch, wie ein Rekrut vor seinem Offizier, erbärmlich. Dennoch, er ließ sich nicht bedrohen, von niemandem, vor allem nicht von einem Sterblichen. Wenn man nachgab, stand man schwach dar und niemand würde ihn jemals als schwach bezeichnen. Langsam strich Pain mit den Fingerspitzen über den Zaun vor ihm. Das Metall fühlte sich glatt und fest unter seinen Fingern an. Alle Dächer in der Gegend waren so eingefriedet. Als wollten sie hier oben Tiere halten, seltsam, wunderte er sich, während seine Finger weiter der Rundung des Metalls folgten. Angestrengt stieß er die Luft aus seinen Lungen und klammerte sich mit den Händen an den Zaun, so fest das seine Hände zu schmerzen begannen. Seit Stunden war er hier und hatte noch immer keine Beute ausgemacht. Seinem räuberischen Wesen gefiel das gar nicht. Langsam stieg eine gewisse Nervosität in ihm auf. Er konnte es deutlich hören, sein Lied, der klang seiner Magie, war schnell und unruhig. Alle Muskeln in seinem Körper fühlten sich angespannt an, doch noch war die Jagd nicht beendet. Manchmal musste man eben etwas länger auf Beute warten. Ein wenig Spannung machte die Jagd nur noch schöner. Pain versuchte, seine Schultern und den Nacken wieder etwas zu lockern. Gelangweilt beobachtete er die Stadt zu seinen Füßen und hoffte auf ein bisschen Ablenkung. Um weiter nach unten sehen zu können, lehnte er seinen Oberkörper gegen den Zaun. In einer Seitenstraße standen Dirnen und warteten auf Kundschaft. Sie waren krank oder high von Rauschmitteln oder Alkohol, manchmal sogar alles zur gleichen Zeit, das konnte er riechen. Wie die Dirnen in unseren Tavernen. Pain erinnerte sich an Abende in ihrer Heimat, in denen er Ähnliches gesehen hatte. Bezahlen ließen sich die Dirnen mit grünen Papierstücken, denen die Menschen einen hohen Wert beimaßen, zumindest schien es so. Menschen liebten dieses Papier wie ein Drache seinen Schatz. Nicht einmal Goldmünzen tauschen sie in dieser rückständigen Welt, bemerkte er und unterdrückte den Ekel, den er immer noch empfand. Einmal, als er mit seinen Schwestern und Brüdern in einer Taverne gewesen war, hatte sich eine sterbliche Frau massiv an ihn ran gemacht. Sie hatte dunkles Haar gehabt, braun oder schwarz vielleicht, so genau erinnerte er sich nicht an ihr Aussehen. Ihren Geruch jedoch hatte er noch immer in der Nase. Sie hatte nach billigem Parfüm und Alkohol gerochen. Zunächst hatte sie immer wieder zu ihm herübergeschaut, dann war sie immer näher gekommen. Als sie schließlich fast auf seinem Schoß gesessen hatte, war er mit ihr nach draußen gegangen, hinter die Taverne. Keinen Überlebensinstinkt hatten die Menschen, keine Einsicht für Situationen, denen man besser aus dem Weg ging. In ihrer Heimat würde niemand es wagen, sich ihm unaufgefordert zu nähern. Alle fürchteten ihn, zurecht, war er doch für seine Grausamkeit und seinen Mangel an Mitgefühl bekannt. Diese Menschenfrau jedoch schien ernsthaft mit ihm Sex haben zu wollen. Zugegeben, es weckte Neugierde in ihm. Neugierde, wann ihr Körper an seiner Kraft oder seiner Magie zerbrechen würde, wann ihre Instinkte erwachen und sie warnen würden, wann sie sich wehren würde. Er hatte die Frau hochgehoben und sie mit festem Griff gegen die kalte Mauer der Taverne gedrückt. Sie schluckte erschrocken, versuchte aber noch zu lächeln. Sie sagte etwas zu ihm, ihre Stimme klang sanft und obwohl er kaum ein Wort verstand, erkannte er die Lust in ihrer Stimme. Als würde ein Reh einen Wolf zum Essen einladen und fragen, ob es Wein mitbringen solle. Pain war nicht stolz darauf, aber solch ein Mangel an Instinkten hatte sogar ihn kurz zögern lassen. Mit Freude erinnerte er sich daran, wie ihr die Farbe aus dem Gesicht wich, als er seine Augen rot aufleuchten ließ. Als ihre Instinkte endlich ansprangen, begann sie sich zu wehren, endlich benahm sie sich wie Beute. Mit Genuss erinnerte er sich an ihre Schreie und das Gezappel unter seinen Händen, welch eine süße Melodie in seinen Ohren. Besonders wehrhaft war die Frau dennoch nicht, auch nicht, als er seine Fänge tief in ihrem Fleisch vergrub. Es war schwer gewesen, ihre Haut zu durchbohren, ein Zeichen dafür, wie sehr ihn die Sterbliche langweilte. In Erregung waren seine Fänge sehr viel länger und schärfer. Das Blut der Frau hatte nach abgestandenem, korkigem Wein geschmeckt, es war widerlich. Allein die Erinnerung an den Geschmack treib ihm die Galle hoch. Zu ihrem Glück tauchte einer seiner Brüder auf, Keith hatte den Tumult gehört und beendete das Spiel. Pain war es gleichgültig gewesen, seine Neugierde war befriedigt, also hatte er sie ziehen lassen. Allerdings, wenn er sich jetzt daran erinnerte, fingen seine Fänge an zu pochen. Zu gerne würde er heute Nacht noch jemandem die Kehle aufreißen.
Lautes Geschrei hallte durch die Straßen und zog Pains Aufmerksamkeit auf sich. Eine Gruppe Männer, glatzköpfig und tätowiert, jagten einen Mann in feinen Kleidern durch die Straße. Die Gruppe folgte ihm bedrohlich, forderte Geld. Der gut Gekleidete weigerte sich, seinen Besitz aufzugeben. Es wurde geschrien, gekämpft, geflucht, dann zog einer der Glatzköpfe ein Messer und klärte den Besitzanspruch für sich. Blut floss aus dem Körper des Unterlegenen und bildete eine Lache auf dem Boden. Die Jäger hatten bekommen, was sie wollten und zogen ab, ließen ihre Beute zum Sterben zurück, so wie es nur die grausamsten Kreaturen taten. Ein Raubtier fraß seine Beute, ein König hing seine Opfer auf oder tötete sie öffentlich, um seinen Anspruch auf Herrschaft zu untermauern. Ein Krieger von Ehre tötete seinen Kontrahenten, um ihm einen würdigen Tod zu gönnen, wie ihn jeder Krieger verdiente, egal für wen oder für was er kämpfte. Das sterbende Fleisch jedoch den Tieren zu überlassen, war grausam. Die Menschen aber waren eine grausame Rasse. Sie behandelten einander schlecht, zerstörten ihre Welt und auch sich selbst mit einer Hingabe, die sogar ihn ein wenig beeindruckte. Obwohl es Pain verwunderte, dass Menschen wie dieser dort unten bereit waren, ihr Leben für ein wenig Besitz zu opfern. Was für eine Verschwendung seines Blutes, als Opfer für die Götter hätte es sicher noch getaugt, dachte er.Einen Sterblichen an die Götter zu opfern hatte zwar nicht mehr Gewicht als eine Ziege oder ein Schaf zu opfern, aber als kleine Geste des guten Willens konnte man sie dennoch in Betracht ziehen,befand Pain, während er dem Menschen bei dem zusah, was seines Gleichen am besten konnte: sterben. Woran die Menschen wohl glaubten, er hatte nie mit einem gesprochen, hatte es auch nicht vor. Er stellte sich aber vor, wie die Menschen ihr Metall und all das Mechanische in ihrer Welt anbeteten. Weshalb sonst sollten sie sich mit all dem umgeben? Manche von ihnen hatten sogar Teile ihres Körpers durch Metall ersetzt. Warum sollte man so etwas tun, wenn nicht für eine Gottheit? Ein Gefühl der Vertrautheit unterbrach seine Gedanken. Als Pain sich dem Gefühl zuwandte, blickte er in die leuchtend gelben Augen seiner Schwester Ria. Lautlos und elegant waren ihre Schritte, als sie zu ihm an den Rand des Daches kam. Ihre Augen richteten sich nach unten, um einen Blick auf das zu erhaschen, was Pain dort beobachtete. Angewidert verzog sie die Lippen, er wusste, dass sie dachte, was auch ihm zuvor durch den Kopf ging.
»Was für eine Verschwendung«, sagte sie und richtete ihren Blick wieder auf ihn. Anscheinend war ihre Jagd bisher ebenso erfolglos wie seine, sonst wäre sie nicht hier. Um sich einen Überblick zu verschaffen, lief Ria die Seiten des Daches ab und begutachtete die Straßen unter ihnen. Pain beobachtete sie dabei aufmerksam. Seine Schwester trug denselben schwarzen Lederharnisch wie er auch. Magische Runen waren in das schwarze Leder geprägt, es war eine Warnung und ein Zeichen ihres Standes. Benutzten sie ihre Magie, leuchteten die sonst verborgenen Zeichen golden auf. Das Gold floss durch die geprägten Runen und machte den rituellen Text auf dem Leder lesbar, er erzählte von dem Schwur, den sie alle geleistet hatten und von ihrer untrennbaren Verbindung zueinander. Dadurch waren sie alle den Respekt gewohnt, den ihr Stand mit sich brachte, dass die Sterblichen diese unmissverständliche Warnung aber nicht verstehen konnten, war frustrierend. Wobei sie die Harnische nicht zwingend brauchten, ihre Beute erkannte sie auch ohne all die Symbolik, denn sie konnten einander spüren. Geschmeidig stieg Ria auf den metallenen Zaun und während sie Pain beim Grübeln zusah, balancierte sie darauf hin und her.
»Nicht dass du runterfällst«, mahnte Pain, als er bemerkte, womit seine Schwester sich die Zeit vertrieb. Ria zog die Augenbrauen zusammen und blickte über die Schulter auf die Straße, die gut dreißig Meter unter ihr lag.
»Das soll wohl ein Witz sein.« Ihre Stimme klang ruhig, aber streng wie immer. Pain nickte nur, sicher, warum sollte Ria sich auch vor der Höhe fürchten. Noch nie hatte er seine Schwester vor etwas zurückschrecken sehen. Abgesehen davon landete sie sowieso immer auf ihren Füßen. Ria war schneller und geschickter als alle Krieger, die er kannte. Seine Schwester war eine Jägerin, keine Beute, wären sie noch in ihrer Heimat, würde Ria dort sicher ein eigenes Heer führen oder Rekruten zum Weinen bringen. Pain betrachtete seine Schwester. So ruhig, wie sie dastand, täuschte es über ihr kriegerisches Wesen hinweg. Ebenso wie ihr schlanker, zierlicher Körper, obwohl Ria durchaus muskulös war. Die gelben Augen, immer wachsam auf die Umgebung gerichtet, wie man es von einem Raubtier wie ihr erwarten würde.
Ein unangenehmes Kribbeln breitete sich unter Pains Haut aus, langsam kroch es seinen Arm hinunter. Um das Gefühl zu unterdrücken, rieb er sich die Hände, mit wenig Erfolg, das Kribbeln wurde stärker. Die Tätowierung, die seinen rechten Oberarm bedeckte, begann sich zu winden. Die schwarzen Linien krochen seinen Arm hinunter. Bald würden sie die Hand erreichen und sich um seine Finger schwingen. Unaufhaltsam wanderte seine Unruhe ihrem Höhepunkt entgegen.
»Nervös?«, frage Ria und deute auf seinen Arm. Kurz davor die Beherrschung zu verlieren, dachte Pain. Es fehlte ihm definitiv an Auslastung, eine gute Jagd, ein guter Kampf oder Sex. Etwas, was seinen Geist und seinen Körper forderte. »Hungrig«, antwortete er knapp, was der Wahrheit entsprach, es dürstet ihm nach Blut und Tod. Pain betrachtete seinen rechten Arm, er verlor langsam die Kontrolle über sich. Dank dieser reizenden Strafe der Götter konnte das auch jeder sehen. Die Tätowierung war eine Warnung an alle, sich von ihm fernzuhalten. Je mehr er die Kontrolle über sich verlor, desto weiter breiteten sich die Linien aus, bis sie im schlimmsten Fall die ganze rechte Hälfte seines Körpers bedeckten. Maßlos übertrieben und völlig unangebracht, doch leider konnte man sich dem Willen der Götter nicht entziehen, meistens jedenfalls. Ria sprang vom Zaun und kam mit eleganten Schritten auf ihn zu. Ihre langen Haare schwangen dabei wie der Schweif einer Raubkatze, sie waren schwarz und immer zu einem Zopf geflochten, der ihr mittlerweile bis zu den Knöcheln reichte. Ihre Haare waren eingewickelt in Bandagen, sodass jeder aus ihrem Volk sofort wusste, womit er es zu tun hatte. Denn es war das Zeichen eines Tempels, der mitten in der Wüste lag und die besten Assassinen ihrer Welt ausbildete. Der Mann, dessen Stärke sie irgendwann anerkennen würde, würde einen rituellen Dolch nehmen,ihr den Zopf abscheiden und ihn anschließend bei sich tragen. Bis dahin durfte kein Mann sie mit offenen Haaren sehen, so sagte es die Tradition. Wobei Pain sich fragte, welcher Mann es freiwillig mit ihr aufnehmen würde. Er hatte schon gesehen, wie Ria es mit Kriegern aufnahm, die doppelt so groß und mindesten dreimal so schwer waren wie sie.
»Sicher, dass alles in Ordnung ist?«, hakte seine Schwester nach. Der sanfte Ton ihrer Stimme widerte ihn an, es klang nach Mitleid.
»Ich brauche nur eine gute Jagd«, gab Pain knapp zurück. Um das Thema nicht vertiefen zu müssen, wandte er sich wieder seinen Beobachtungen zu. Sein Blick schweifte erneut über die Stadt, all das Grau und Schwarz stand in starkem Kontrast zu den hellen, bunten Lichtern überall. Jeder Laden versuchte, noch heller und bunter zu sein als der neben ihm, wie Vögel, die um die Aufmerksamkeit eines Weibchens buhlten. Obwohl zu dieser Zeit nur wenige Menschen unterwegs waren, war es so laut, dass ihm die Ohren klingelten. All ihre Maschinen und Gefährte dröhnten und donnerten, selbst ihre Lichter schnurrten und knisterten.
»Denkst du, er kommt heute Abend?«, unterbrach Ria seine Gedanken. Seine Schwester hatte sich neben ihm mit dem Rücken an den Zaun gelehnt.
»Ich weiß es nicht.« Seine Stimme klang betrübter, als er es wollte. Möglicherweise war es sogar Sorge, die in seiner Stimme mitklang, wenn man bedachte, was sein Bruder in letzter Zeit durchgemacht hatte. Wobei, eigentlich sollte es ihm egal sein, war es ihm egal, es interessiere ihn nicht. Pain biss die Zähne aufeinander, lieber würde er noch einmal das Blut eines Menschen kosten, als über seinen Bruder nachzudenken. Ria musterte ihn mit ihren gelben durchdringenden Augen, aber sie sagte nichts. Geschmeidig drehte sie ihren Körper und wandte ihren Blick zurück auf die Straße unter ihnen. Sie wusste um sein gespaltenes Verhältnis zu diesem Thema. Pain war dankbar, dass sie es dabei beließ. Gemeinsam beobachteten sie, wie das Blut des Menschen über die Straße ran und im Boden versickerte. »Das Gleichgewicht muss bewahrt werden«, hatte man ihm gesagt, er schüttelte innerlich den Kopf, so ein Schwachsinn. Als ob es das Gleichgewicht stören würde, wenn eine so niedere Rasse dahingerafft würde. Das mit dem Aussterben schienen die Menschen ohnehin ganz gut selbst hinzubekommen. Erneut hallte ein lauter Schrei durch die Nacht. Pain lächelte in der Hoffnung, die Schreie würden bedeuten, was er sich erhoffte. Dann würde diese Nacht doch nicht so ereignislos zu Ende gehen wie befürchtet. Er schloss die Augen und versuchte, sich auf die Energie in der Luft zu konzentrieren. Im Geiste versuchte er die Energien der Menschen von denen der Stadt zu trennen, um etwas anderes zu finden. Etwas, das nicht in diese Welt gehörte. Schließlich fand Pain, was er suchte, schwach, dunkel, kaum wahrzunehmen, doch er hatte es gefunden.
»Na endlich.« Seine Stimme war fast heiser vor Anspannung. Er konzentrierte sich intensiv auf die Energie, versuchte ihr zu folgen. Auch Ria hatte die Fährte aufgenommen, sie hatte ihren Dolch gezogen und setzte zum Sprung vom Dach an. Pain dematerialisierte sich und tauchte neben seiner Schwester wieder auf, mit seinem Element springen zu können war eine seltene, aber durchaus nützliche Fähigkeit. Die Zeit wurde knapp, wenn sie die Schreie gehört hatten, dann sicher auch jemand anderes. Bald würde es hier von Wachen wimmeln, die nach dem Rechten sehen wollten. Pain und Ria stiegen über die Leiche auf der Straße und über das Blut am Boden. Gemeinsam folgten sie der Energie durch dunkle und verwinkelte Gassen, vorbei an all dem stinkenden Müll, der sich dort stapelte, und den zwielichtigen Gestalten, die dort ihrer Arbeit nachgingen. Pain hatte aufgegeben, sich darüber zu wundern, wie verschwenderisch die Menschen doch mit ihren so kurzen Leben umgingen. Wie leicht ihr Verstand von Rauschmitteln verwirrt wurde und wie sorglos sie ihren Körper zerstörten. Selbst wenn ihr Verstand und ihr Körper von all dem Schmutz zerfressen waren, kamen sie nicht zur Vernunft, ganz im Gegenteil. Es schien, dass je mehr sie zerfielen, desto mehr wollten sie Rausch, Völlerei, Sex und Gewalt, manchmal alles an einem Abend. Und diese verrottenden Sterblichen sollten für das Gleichgewicht relevant sein, wohl kaum. Doch es stand ihm nicht zu, einen direkten Befehl zu missachten. Nicht, dass er es nicht versucht hatte, aber bedauerlicherweise waren sie zu stark miteinander verbunden. In einer Sackgasse fanden sie schließlich ihr Ziel, es war so dunkel, dass man nichts erkennen konnte, aber man konnte ihn schmatzen hören und das Kratzen von Zähnen und Krallen an den Knochen. Ein Diener, niedere Kreaturen ohne eigenen Verstand, hatte sich eine der Dirnen geschnappt und beschlossen, sie zu fressen. Normalerweise würden die Diener von ihren Herren gefüttert oder würden durch Wälder streifen und Wild erlegen, doch hier in der Welt der Menschen waren die Sterblichen wohl die einfachste Beute. Ein lautes Jaulen durchschnitt die Luft. Ria hatte dem Diener ihren Dolch zwischen die Rippen geschlagen und dem leisen Pfeifen nach zu urteilen dabei die Lunge durchstoßen. Pain erleuchtete die Gasse, indem er eine kleine, aber sehr helle Sphäre aus Licht über seiner Hand schweben ließ. Das Licht gab den Blick auf das ganze Elend frei. Der Frau war nicht mehr zu helfen. Die Kreatur hatte ihren den Brustkorb zertrümmert und ihre Eingeweide überall verteilt. Anschließend hatte der Diener, ihr das Fleisch von den Knochen genagt. Auch der Diener atmete nicht mehr, schwarzes Blut floss aus seinem Körper. Wieder hatte er keine Beute gemacht, um seine Triebe zu beruhigen. Enttäuschung machte sich in ihm breit und mit ihr kam die Anspannung zurück. Dieser kurze Moment der Jagd konnte sein Verlangen zu Töten nicht befriedigen. Das rote Blut der Menschen und das schwarze ihrer Feinde zusammen im Staub versickern zu sehen, war ein groteskes, aber auch amüsantes Schauspiel. Ein bildlicher Ausdruck seiner Empfindungen und eine eindrucksvolle Demonstration, dass beide auf derselben Stufe der Evolution gefangen waren, fand Pain. In seinen Augen waren die Sterblichen ebenso entbehrlich wie die Diener. Während er an der Seite stand und das Szenario beobachtete, wischte Ria das Blut von ihrem Dolch an der Kleidung der Frau ab. Eine kluge Entscheidung, besser man hielt sich vom Blut der Diener fern, und von ihrem Speichel. Beides enthielt ein starkes Gift, das alles Sterbliche qualvoll verenden ließ. Ein grausamer Tod, der bedauerlicherweise viel zu schnell eintritt, so blieb keine Zeit, um die Qualen und die Schreie zu genießen. Für Ria wäre das Gift zwar nicht zwingend tödlich, aber es würde sie auf jeden Fall sehr krank machen. Eine Erfahrung, die manche von ihnen bereits gemacht hatten, kein schöner Anblick, wie Pain sich erinnerte. Gut, dass einer seiner Brüder immer ein Fläschchen Gegengift zu Hause hatte, trotz allem war Vorsicht geboten. Als seine Schwester sich zu dem Kadaver hinunterbeugen wollte, schritt er ein. »Ich mach das«, sagte er und ließ die Sphäre über seiner Hand in die Mitte der Gasse schweben. Pain kniete sich neben die Kreatur, um sie zu untersuchen. Das Ding war klein, gerade mal einen Meter groß, nicht ausgewachsen, kein gutes Zeichen, sie schienen sich in dieser Welt mittlerweile zu vermehren. Etwas dünn, nicht gut gefüttert oder schlecht in der Jagd, was die Beute erklären würde, die es gemacht hatte. Keine Anzeichen eines Herren, weder ein Brandzeichen noch eine Tätowierung, keine Narben, kein Amulett. Wieder ein Reinfall, aber immerhin, einer weniger, obwohl das Jagen von Dienern nicht gerade befriedigend war, es fehlte an Herausforderungen. »Enttäuschend, es ist zu ruhig heute Nacht«, sagte Pain mit einem gelangweilten Ausdruck im Gesicht.
Ria nickte, nur ein einziger Diener war wirklich keine gute Beute. Sie gaben einfach keine ernsthaften Gegner ab, auch wenn sie den Menschen das Leben sichtlich verkürzten. Beide hätten lieber einen Gegner gefunden, der ihr Blut in Wallungen brachte und ihren Körpern und ihrer Magie alles abverlange. Aber sei es drum, heute Nacht würden sie sicher nicht noch mehr Diener finden, die Gegend war für heute Nacht gesichert. Pain empfand Wehmut angesichts der beendeten Jagd, jetzt müsste er bis morgen Nacht warten, in der Hoffnung auf bessere Beute. Ria verließ die Gasse zuerst, das Aufräumen überließ seine Schwester ihm, wie immer. An der nächsten Kreuzung würde er sie einholen. Pain ließ sein Licht heller und heißer werden, schließlich setzte er damit die Gasse in Brand. Damit sollten eigentlich alle Spuren vernichtet sein. Die Sterblichen durften nichts über ihre Existenz erfahren, das würde nur zu noch mehr Problemen führen. Nun allerdings wurde es Zeit, sich mit den anderen zu treffen. Nach der Jagd wollten sich seine Schwestern und Brüdern in einer schäbigen Taverne in der Nähe treffen. Dort stellte man keine lästigen Fragen und die Menschen waren zu betrunken oder zu high um sich an irgendetwas zu erinnern. Der Treffpunkt war nur wenige Straßen entfernt, also schlenderten Ria und er langsam die Straße hinunter.
»Besser?«, fragte sie und deutete auf seine Hand. Die Linien hatten sich wieder bis auf seinen Oberarm zurückgezogen.
»Etwas.« Pain versuchte, sich zu konzentrieren, seine Instinkte waren noch immer hellwach. Nur durch Konzentration konnte er seinen Geist zur Ruhe auffordern. Angesichts des erfolglosen Abends fiel es ihm zusehends schwerer, konzentriert zu bleiben. Hoffentlich würde eine große Menge an Alkohol dazu beitragen, Ruhe zu finden. In der Taverne warteten Jeanne und Arya schon auf Gesellschaft. Arya winkte Pain und Ria freudig an den Tisch. Wie immer war sie aufgedreht, eine echte Frohnatur, die Pain versuchte nur gelegentlich ertragen zu müssen. So wie Ria waren auch diese beiden Frauen seine Schwestern, zumindest ihrer Gefühle zueinander wegen und wegen ihres gemeinsamen Schicksals. Nicht einmal diese Welt kann Aryas Laune trüben, stellte Pain fest und war fast froh darüber. Ihre laute, quirlige Art lenkte ihn von sich selbst ab, zumindest kurzzeitig. Typisch Windelementar, dachte er, aber das war nicht fair. Irgendwie waren sie ja alle das Klischee ihrer Magie oder Rasse, außerdem waren Windelemente genau wie Feuer- oder Wasserelemente sehr wankelmütig. Oft brauchte es nicht viel von einer sanften Brise bis zu einem wütenden Sturm. Angesichts dieser Tatsache war Aryas glückliches Wesen und ihr nie enden wollender Optimismus wohl weit weg von einem Klischee. Ganz im Gegensatz zu Jeanne, ihr kaltes Wesen und der Pragmatismus, nach dem sie lebte, war sehr typisch für Eiselementare. Jeanne war kalt, unnahbar und unheimlich sexy. Pain kannte keinen Mann, der nicht vor den Göttern geschworen hätte, Jeanne sei die schönste Frau, die er je erblickt habe. Wobei sie wohl jeden aufdringlichen Bewerber in eine Statue aus Eis verwandeln würde. Er setzte sich neben Jeanne, sie roch nach kaltem Winter, das gefiel ihm. Ihre langen weißen Haare hatte sie heute Nacht hochgesteckt. Der Anblick der fast weißen Haut ihres Nackens war verlockend. Pain stellte sich vor, wie es wäre, seine Fänge in ihrer makellosen Haut zu versenken. Wie eine dünne Spur aus Blut ihr Schlüsselbein hinablaufen würde. Er biss die Zähne aufeinander, bis sein Kiefer zu schmerzen anfing. Statt seinem Impuls zu folgen, lehnte er sich zu Jeanne und gab ihr einen Kuss auf den Nacken. Sie lächelte kurz, dann wurde ihr Blick wieder strenger. Jeanne wandte sich wieder ihren Schwestern zu, doch ihre schlanken Finger strichen fast schon beiläufig über seinen rechten Arm. Pain zog den Arm weg, Streicheleinheiten brauchte er jetzt nicht, was er brauchte, war weit weg von jeder Etikette und auch von jeder Vernunft. Noch heute Nacht würde er irgendwas in Stücke reißen.
»Es war ruhig heute Nacht«, hörte er Ria mit ihren Schwestern reden, »zu ruhig.«
»Ach komm, sei doch froh, dass du nicht jeden Abend etwas töten musst«, meinte Arya und lächelte ihre Schwester an, als erhoffte sie sich wirklich Bestätigung. Dabei wusste Arya genau, wie sehr Ria sich ohne eine gute Jagd langweilte.
»Wo sind die anderen?«, frage Pain in die Runde. Irgendwie musste er den Kopf freibekommen und wenn er dafür mit einem seiner Brüder einen Streit provozieren musste.
»Jagen noch«, Jeanne griff nach ihrem Glas und nippte daran.
»Und der Rest?«, hackte er nach, obwohl er die Antwort schon kannte.
Jeanne zuckte mit den Achseln. »Ich weiß nicht, vielleicht bleiben sie bei ihm zu Hause, wer weiß, was er wieder vorhat.« Jeanne wandte sich wieder Ria zu.
»Er sah aus, als hätte er was vor, sah entschlossen aus, als wir los sind«, ergänzte Arya und nahm einen Schluck aus ihrem Glas.
Na klasse, dachte Pain, wobei es ihn ja freuen sollte, immerhin hatte er keine Lust, ihm zu begegnen. Andererseits hatte Pain ihn nicht mehr gesehen, seit er sich vor Tagen in sein Zimmer eingeschlossen hatte. Aussichtslos, auf die anderen zu warten, beschloss Pain. Er würde sich also heute Abend mit seinen Schwestern begnügen müssen. Nicht, dass er generell ein Problem damit hatte, aber er konnte sich wirklich unterhaltsamere Gespräche vorstellen. Um seinen Schwestern nicht beim Tratschen zuhören zu müssen, versuchte Pain sich auf die Geräusche in der Taverne zu konzentrieren. Inständig hoffte er, der Lärm würde ihn von seinen inneren Dämonen ablenken. Die Menschen um ihn herum waren ausgelassen, sie tanzten und tranken, sie waren mit sich selbst beschäftigt. Laute Musik dröhnte durch die Taverne und vernebelte allen den Kopf, insofern es nicht schon die Drogen und der Alkohol taten. Genau deshalb trafen er und seine Geschwister sich in solchen Tavernen, in feineren Gesellschaften würden sie zu sehr auffallen. Wegen ihrer Haarfarbe oder der Augen, vielleicht sogar wegen ihrer Ausstrahlung. In den niederen Gesellschaftsschichten jedoch waren alle Menschen bunt. Sie hatten bunte Haare, ausgefallene Kleider. Manche von ihnen trugen Leder, wie es normalerweise nur Krieger taten. Keiner dieser Sterblichen ahnte, dass er lediglich Beute war. Ab und an kam eine der Bardamen an den Tisch und brachte neue Getränke. Sie war so leicht bekleidet, dass ihre Oberweite bei jedem Vorbeugen aus dem Oberteil zu rutschen drohte. Auf dem Rückweg zur Bar wurde die Frau von jedem zweiten Mann betatscht, an dem sie vorbeilief. Schade, dass diese Sterblichen so etwas nicht bei Ria versuchten, dachte Pain. Gerne hätte er dabei zugesehen, wie sie dem Mann erst den Arm brechen und sich dann den restlichen Knochen in seinem Körper widmen würde. Er hatte die schmerzerfüllten Schreie und das Gewimmer schon in den Ohren, eine fast sinnliche Vorstellung. Trahy hätte das alles sicher gefallen. Pain rief sich die Erinnerung an seinen Bruder ins Gedächtnis. Sein Bruder Trahy hatte solche Ansammlungen von Sterblichen immer unterhaltsam gefunden. Gewissen körperlichen Erfahrungen mit ihnen war er ebenfalls nie abgeneigt gewesen. Pain konnte sich noch gut an ihr erstes Treffen erinnern, damals waren sie noch Kinder gewesen. Man hatte Trahy in ihrem Haus aufgenommen, weil alle seine Lehrer an seinem rebellischen Wesen gescheitert waren. Pain war ihm in der Küche begegnet, als sie beide versuchten, etwas Süßes zu stibitzen. Trahy war der Einzige, den Pain je als Freund bezeichnen würde. Ein Seufzen huschte über seine Lippen.
»Ich vermisse Trahy«, sagte er etwas zu laut. Weichheit stand ihm nicht zu Gesicht. Im Augenblick war er mehr von sich angewidert als von den Sterblichen um ihn herum. Seine Schwestern nickten nur, die Stimmung am Tisch trübte sich erstaunlich schnell ein. Es war schon ein paar Monate her, dass sie ihren Bruder verloren hatten, aber der Schmerz war immer noch sehr präsent. Trahy war der Lauteste von ihnen gewesen, dieser Abend wäre mit ihm so viel interessanter geworden. Die Welt der Menschen war Trahy immer wie ein großer Spielplatz vorgekommen. Das Loch, das er hinterließ, war groß genug, um sie alle mit hinunterzuziehen. Doch all das Grübeln und Trauern brachte ihren Bruder nicht zurück in ihre Mitte. Das Einzige, was sie tun konnten, war ihre Gläser zu heben und auf ihren Bruder zu trinken, so wie es Sitte war. Langsam entspannten sich alle wieder und lauschten der lauten Musik. Pain beobachten die Sterblichen in ihrem Treiben, während seine Schwestern sich wieder in ihre Gespräche vertieften. Bedauerlicherweise langweilte ihn das Beobachten der Menschen schneller als erwartet. Pain fühlte, wie seine Fänge länger wurden, bereit sich in Fleisch und Muskeln zu vergraben. Jeder Muskel in seinem Körper war angespannt. Angestrengt versuchte er, die Anspannung weg zu atmen. Normalerweise versuchte er erst gar nicht, sich zu kontrollieren, aber nach drei Nächten ohne erfolgreiche Jagd war die Spannung in ihm kaum zu ertragen. Auf keinen Fall wollte er sich auf seine Schwestern stürzen, schon gar nicht vor all den Menschen. Wobei ein Kampf mit Ria durchaus unterhaltsam war. Pain hoffte, sich langsam wieder zu beruhigen, wie schon zuvor an diesem Abend. Prüfend sah er sich seine rechte Hand an. Die Linien seiner Tätowierung schlangen sich um seine Finger. Sein Handrücken war fast komplett in schwarz gehüllt. So wie auch seine Gedanken immer dunkler wurden, die Magie waberte in ihm, sein Lied wurde immer lauter und unruhiger. Mit einer etwas zu kräftigen Bewegung stieß er sein Glas von sich weg.
Arya fing es mit einer kleinen Windböe auf, bevor es den Boden erreichte. Sanft setzte sie das Glas auf dem Tisch ab. »Alles in Ordnung?«, fragte sie besorgt.
»Nein«, fluchte Pain und stand auf. »Ich muss los.« Seine Stimme klang gepresst und angespannt. Für den Augenblick war er jedoch froh, dass statt eines Knurrens noch Worte aus seiner Kehle kamen. Hastig drängte er sich durch die Sterblichen nach draußen. Als er außer Sicht war, dematerialisierte er sich und sprang hinter das Gebäude. Pain lehnte sich an die Wand, versuchte ihre harte, raue Oberfläche im Rücken zu spüren, doch das Leder seines Harnischs war zu dick. Verdammt noch mal, sein Herz raste so schnell, dass er kaum noch Atmen konnte. Seine Haut war feucht vom Schweiß, eine Beklemmung breitete sich in seiner Brust aus, brachte seine Hände zum Zittern. Völlig außer sich schloss er die Augen und versuchte, die Welt um sich herum auszublenden. Bis eine sanfte Berührung ihn aus seiner Rage riss. Zierliche Hände strichen ihm über den Arm und folgten seinen Muskeln bis zur Brust. Dort ruhten sie, verbreiteten einen kurzen Hauch von Ruhe in seinem Herzen. Jeanne war ihm nachgelaufen, ihr Duft war unverwechselbar, wie ein sanfter Wintermorgen, kalt, aber angenehm. Er öffnete die Augen und sah sie an, das einzige Wesen, das er liebte, jedenfalls soweit er dazu im Stande war. Wie gut für sie beide, dass sie keine liebevolle, kuschelige Vereinigung erwartete. Jeanne kannte ihn zu gut und wusste, dass ein ruhiges Familienleben nicht auf seinem Plan stand.
»Du musst dich beruhigen«, sagte sie sanft.
Du musst, wiederholte er in Gedanken, das klang nach einem Befehl, ein tiefes, dunkles Knurren drang aus seiner Kehle. Pain stemmte sich gegen ihre Hände, drückte sie an die gegenüberliegende Wand.
Ruhig, aber aufmerksam betrachtete Jeanne ihn, ihre Blicke folgten seiner mittlerweile fast schwarzen Hand bis zu seinen Augen. Besorgnis legte sich über ihr hübsches Gesicht. »Pain?« Sie rief seinen Namen wie eine Frage.
Er packte ihre Hände und hielt sie über ihrem Kopf fest. Völlig in Rage hatte er keine Lust mehr zu warten, wenn er schon keine Beute fand, würde er sich wenigstens an ihr abreagieren. Hungrig ruhte sein Blick auf ihrem Hals, so schlank und so perfekt. Ihr Blut wäre süß und sinnlich, kein Vergleich mit der abartigen Brühe, die durch die Venen der Sterblichen floss. Die Erinnerung an den Geschmack ihres Blutes weckte ein dunkles Verlangen in ihm. Pain konnte es tief in sich fühlen, das uralte Blut in seinen Adern, das Erbe seiner Abstammung, das ihn zu einem Monster machte. Das Knurren aus seiner Kehle verwandelte sich in ein dunkles Grollen. Jeanne redete mit ihm, doch ihre Stimme drang kaum noch zu ihm durch. Was auch immer er heute Nacht mit ihr tun würde, er würde es bereuen, doch er konnte nicht anders. Jeanne versuchte, sich aus seinem Griff zu lösen, doch das Gezappel verstärkte seine Raserei noch mehr. Bedrohlich beugte Pain sich zu ihr, sie würde nur ihm gehören. Als seine Fänge ihren Hals streiften, schoss ein scharfer Schmerz durch seine Hände, Jeanne hatte sie eingefroren. Doch er war nur kurz beeindruckt, angeheizt von der wehrhaften Beute ließ er seine Hände aufleuchten. Das Licht war warm und verwandele das Eis ohne jede Mühe in Wasser. Laut Knurrend wollte er Jeanne packen um die Jagd zu beenden.
»Stopp.« Ihre Stimme durchdrang seinen Geist, hallte durch den Nebel seiner Wut. Er hielt inne, als hätten ihre Worte ihn an den Boden gefesselt. Ihre Hand ruhte auf seinem Herzen, sie hatte die Jagd für ihn beendet. »Stopp«, wiederholte sie, ihre weiß-blaue Augen fixierten ihn, versuchten, zu ihm durchzudringen. Er war ein Monster, ein grausamer Jäger, ohne jede Reue, gebunden an die Frau, die er liebte. So wie alle Kinder des alten Blutes, seines Blutes. Es war eine tiefe Bindung, stärker als sein Zorn und all der Hass in ihm. Eine Verbindung ihrer Seelen, die er nicht brechen konnte, selbst in diesem Zustand nicht. Jeanne war wohl die Einzige, die es vermochte, das Monster in ihm in Schach zu halten. Pain hasste es, dass sie solche Macht über ihn hatte, doch heute war er froh darüber. Ein hohles, blechernes Geräusch hallte durch die Nacht. Jemand war gegen eine weggeworfene Dose gestolpert. Pain hob seinen Blick, die angsterfüllten Augen, in die er sah, verrieten ihm alles, was er wissen musste. Heute musste er nicht mehr jagen, die Beute hatte den Weg allein zu ihm gefunden. Es wurde Zeit, seine Fänge endlich in Fleisch zu versenken. Endlich hatte die Jagd begonnen.
Kapitel 2
Auch nach etlichen Zeitaltern stritten die Blutmagier und die Elementare unerbittlich über die Herrschaft des Landes. Nur eine Macht konnte über sie alle herrschen, dieser Glaube war ihre einzige Gemeinsamkeit. So schufen die Blutmagier Sklaven aus Fleisch und Knochen und ließen sie für sich kämpfen. In einer nie enden wollenden Welle rollten sie über das Land und verzehrten alles Leben. In Furcht und im Angesicht ihrer Auslöschung riefen die Elementare ihre Götter an. Sie flehten und bettelten und schließlich fanden sie Gehör.
In ihrem Eifer zu herrschen hatten die Blutmagier das Gleichgewicht ins Wanken gebracht. Um die Balance wieder herzustellen, schufen die Götter eine neue Macht: die Wächter. Sie sollten dem Gleichgewicht dienen und es beschützen. Immer wieder standen sich die Blutmagier und die Elementare auf dem Schlachtfeld gegenüber. Unerbittlich kämpften sie über viele Zeitalter hinweg. Und immer, wenn das Gleichgewicht zu einer der beiden Seiten zu kippen drohte, schickten die Götter ihre Wächter. Es war ein Kreislauf, der nie enden wollte.
In einem Zeitalter jedoch gab es zwei Könige, die mächtiger waren als alle, die vor ihnen herrschten. Ihre Heere waren so groß, wie die Geschichte selbst es bisher nie gesehen hatte und auch nie mehr danach. Denn beide Könige waren bereit, ihr gesamtes Volk zu opfern, um siegreich aus dem Krieg hervorzugehen. Unter dem wachsamen Auge der Götter, trafen die beiden Heere in einer letzten blutigen Schlacht aufeinander, auf dass nach diesem Tag nur noch ein Volk existieren würde. Dieses Mal jedoch, als die Götter ihre Wächter riefen, war es anders. Statt das Gleichgewicht zu wahren, zerstörten die Wächter die Welt, töteten jeden Krieger, jeden General, jede Frau und jedes Kind. Niemand wusste, wie die Wächter letztlich gebannt wurden, doch man würde sich immer an den Schrecken jener Tage erinnern. Denn die Wächter hatten die Erde in Blut getränkt, hatten alles Leben verzehrt und die Welt in Stücke gerissen.
Letztlich waren es die Elementare, die aus der Asche jener Tage emporstiegen. Sie verbannten die verbliebenen Blutmagier auf eine Insel jenseits des Dunklen Meeres. Fortan wurde ihre Existenz geleugnet, sie wurden vergessen, ebenso wie ihre Magie.
Die Wächter waren seither nicht mehr gesehen worden. Doch in den Schatten der Zeit flüsterten die Stimmen von ihrer Rückkehr, sollte das Gleichgewicht erneut gestört werden.
Es tat gut an etwas anderes zu denken und Bahal erinnerte sich gern an die alten Geschichten, die man ihm als Kind erzählt hatte. Geschichten über Götter, Krieger und große Schlachten, Erzählungen, die er als Kind immer gern gehört hatte, denn sie waren eine nette Abwechslung zu seinem streng getakteten Alltag. Die alten Geschichten erzählen uns, dass das Gute stets über das Böse siegen wird, erinnerte Bahal sich weiter an die Worte, die man ihn stets lehrte. Aber es war eine geschönte Wahrheit, die nur einen Teil der Geschichte erzählte, nämlich die über gute Elementare und böse Blutmagier. Die Elementare hatten den Krieg gewonnen, wenn auch nur durch das Chaos, das die Wächter verursacht hatten, doch das wurde in den Geschichten gern verschwiegen. Die Blutmagier, einst ein starkes, großes Volk, hatten durch ihre Gier nach Macht am Ende alles verloren. Eine Wahrheit, die er selbst lange glaubte, denn als Kind war es das Einzige, was man ihn lehrte. Seit der Vertreibung beschimpfte man die Blutmagier als Dämonen, eine Beleidigung, die mit den Zeitaltern von ihnen selbst angenommen wurde. Heute verwendete man den Ausdruck Blutmagier nicht mehr, denn sie selbst nannten sich jetzt Dämonen. Bahal erinnerte sich, dass jemanden als Dämonen zu beschimpfen ironischerweise für einen Adeligen deutlich beleidigender war als für einen Dämon selbst. Die eigentliche Wahrheit war, es gab keine gute Seite und auch keine Schlechte, das nennt man Balance, Gleichgewicht. Und obwohl das Gleichgewicht die stärkste Kraft aller Welten war, lernte er als Kind nichts darüber. Man könnte annehmen, dass es jetzt, wo die Elementare allein über das Land herrschten, friedlicher wäre, von Frieden konnte aber keine Rede sein. Denn statt der Blutmagier hassten die Elementare jetzt einander und alles, was anders war. Natürlich war »anders« eine vage Definition, die sich je nach Region stark unterschied. Heute war sein Volk besessen von der Reinheit des Blutes, jede Anomalie war ein Skandal unermesslichen Ausmaßes, jedenfalls unter den Adligen. Deshalb versuchte man krampfhaft, nur Verbindungen mit der eigenen Familie einzugehen. Nicht auszudenken, ein Außenstehender würde unreines Blut in die Linie bringen. Die Ironie war nur, dass die Elementare die Blutmagier mehr brauchten, als ihnen lieb war. Mit jeder Generation ohne das alte Blut wurden sie schwächer und sterblicher. Kein Wunder also, dass man in feinen Gesellschaften seine Magie nicht mehr zur Schau stellte. Stattdessen duellierte man sich lieber mit Schwert oder Degen, was weniger blamabel war als seine Magie nicht im Griff zu haben. Das Seltsame war nur, die Reinheit des Blutes entsprach eigentlich dem Glauben der Blutmagier, warum die Elementare diesen Aspekt übernommen hatten, war Bahal ein Rätsel. Aber in diesem Punkt unterschied sich das Verhalten seines Volkes gar nicht so sehr von dem der Menschen. In den Monaten, die vergangen waren, seit sie durch die Barriere in diese Welt gekommen waren, hatte er bei den Menschen sehr Ähnliches beobachtet. Auch die Sterblichen taten sich schwer, Andersartigkeit zu akzeptieren, sie zwängten sich gern in selbst auferlegte Normen, die sie strikt einzuhalten gedachten. Bahal dachte über seine Gefährten nach, die ihm gefolgt waren. Sie alle waren Schwestern und Brüder, ihrer Gefühle zueinander wegen und wegen ihres gemeinsamen Versprechens, das Gleichgewicht zu wahren. Er wusste, wie schwer es ihnen in dieser Welt fiel, zwischen all dem Metall, dem Lärm und all der sonderbaren Dinge, die Menschen anscheinend zum Leben benötigten. Natürlich war ihm bewusst, dass gerade Pain diese Welt mehr verachtete als alle anderen, sogar mehr als ihn. Doch Bahal wusste auch, dass die Menschen zunehmend skeptischer ihnen gegenüber wurden. Zu oft hatten die Wachen der Menschen sie misstrauisch beäugt, irgendwann würde es richtig Ärger geben. Allerdings, wer konnte es den Sterblichen verdenken, sie alle mussten wahrlich ein seltsamer Anblick für ihre Augen sein. Ihr Aussehen unterschied sich deutlich von dem der Menschen, sie kannten die Regeln dieser Gesellschaft nicht und sprachen die Sprache kaum, es wurde Zeit, sich etwas Unterstützung zu holen. Schwere Schritte waren auf dem Flur zu hören. Sie erinnerten ihn daran, dass er nicht allein im Haus war.
»Alles in Ordnung?« Die besorgte Stimme seines Bruders drang durch die verschlossene Tür. Ascan war wie immer viel zu besorgt um seine Gesundheit, da verwunderte es schon fast, dass er heute erst fünfmal nach ihm gesehen hatte.
»Ja«, log Bahal, während er versuchte, jegliche Emotion aus seiner Stimme fernzuhalten. Obwohl die Antwort knapp und gelogen war, entfernten sich die Schritte nach einem leisen Fluchen wieder von ihm. Sein Bruder würde wiederkommen, schneller als es ihm lieb war, soviel stand fest. Doch fürs Erste war er dankbar, dass Ascan nicht zu ihm ins Zimmer geplatzt kam, sondern ihm seine Ruhe ließ. Bahal breitete die Arme aus und strich mit den Händen über das Bett. Es war mit einem weichen Stoff bezogen, der sich glatt und kalt anfühlte. Auch die Luft im Zimmer war kühl, durch das gekippte Fenster drang der Lärm der Stadt. Seine Blicke wanderten durch sein Zimmer, bis auf das Licht weniger Kerzen, war es dunkel. Noch immer stieg ein dünner Rauchfaden von der Schale auf, in der er die Kräuter verbrannt hatte, der Geruch erfüllte den ganzen Raum. Er schloss die Augen und inhalierte den Rauch. Mit geschlossenen Lidern war auch das Licht der Kerzen vor seinen Augen verschwunden und er empfand einen kurzen Moment Frieden in der Dunkelheit. Bis die Stimmen wieder durch seinen Geist drangen und sich in seinem Kopf ausbreiteten. Leise, aber fordernd, kamen sie immer näher, wurde bedrohlich lauter: Komm zu uns,wir sind hier. Bahal öffnete die Augen wieder, in dem Versuch, sich seiner selbst bewusst zu werden. Dieses Gewimmer, Geflüster und Geschreie tat er sich jetzt schon eine gefühlte Ewigkeit an, doch daran gewöhnen würde er sich wohl nie. Die Stimmen quälten seinen Geist unentwegt, und obwohl sie in dieser Welt leiser waren, ließen sie ihn nie in Frieden. Vor einer Weile hatte er beschlossen, das Gemurmel zu ignorieren, was ihm jedoch zusehends schwerer viel. Sein Kopf hämmerte, jeder Gedanke, den er fasste, war schwer und träge. Vorsichtig rieb Bahal sich die Schläfen, in der Hoffnung, die langsamen, kreisenden Bewegungen würden den Schmerz verdrängen. Doch es half nichts, also streckte er sich zu der kleinen Lampe auf seinem Nachttisch, er wollte die Dunkelheit in seinem Zimmer vertreiben und hoffte, dass dies auch die Stimmen zum Schweigen bringen würde. Genervt schaltete er das Licht an und bereute es noch im gleichen Augenblick, zischend sog er die Luft ein und hielt sich die Hände vor die Augen, um sie vor dem Licht zu schützen. Die Menschen und ihr verfluchtes, künstliches Licht, es fühlte sich an, als hätte ihm jemand einen Pfeil durch den Kopf geschossen. Es dauerte eine Weile, bis seine Augen sich an das Licht gewöhnt hatten. Nicht dass er Licht generell verabscheute, aber das künstliche Licht der Menschen fühlte sich so anders an. Es war schwer in Worte zu fassen, doch etwas daran störte ihn. Die Energie, die davon ausging, war unnatürlich, sie schwang nicht mit ihrer Umgebung. Es war wie sich Musik anzuhören, bei der regelmäßig die Noten verrutschten, noch immer ein schönes Lied, aber dennoch falsch. Blinzelnd versuchte Bahal seine Umgebung wahrzunehmen, weder die Kopfschmerzen noch das laute Geschrei der Stimmen waren dabei sonderlich hilfreich. Kontrolle, Kontrolle, wiederholte er im Rhythmus seiner Atmung. Wieder und wieder erinnerte er sich an das Mantra, bis die Stimmen langsam leiser wurden und sein Geist allmählich Ruhe fand. Dankbar, dass langsam wieder Ruhe in seinem Körper herrschte, versuchte er vom Bett aufzustehen, seine Beine fühlten sich schwer und steif an. Langsam ging Bahal durch das Zimmer, um das Gefühl für seinen eigenen Körper wiederzufinden. Vor dem Fenster blieb er stehen und zog vorsichtig den Vorhang zur Seite, der das Licht der Stadt aus dem Zimmer fernhielt. Die Stadt der Menschen war so groß wie die, in der er aufgewachsen war, dennoch kam sie ihm viel größer vor. Das erste Mal, als er diesen Ort gesehen hatte, fühlte er sich wie in einem dichten Wald. Die Häuser waren alle so riesig, dass sie den Himmel zu berühren schienen. Das Haus, in dem sie lebten, war aber kleiner, es lag an einem alten Pier am Rand der Stadt. Es war dunkel, kalt und kam am ehesten einer Arbeiterunterkunft nahe. Sie hatten dem Menschen, der es verkaufte, mit Goldmünzen entlohnt. Bahal erinnerte sich, wie überschwänglich glücklich der Mensch über die Bezahlung gewesen war. Und obwohl er seine Freude über die paar Münzen nicht nachvollziehen konnte, war er dennoch zufrieden, dass seine Familie nun eine sichere Zuflucht hatte. Ab und an hatte er sich die Zeit genommen, die Menschen zu beobachten, ihn beeindruckte, wie sie mit ihrer Sterblichkeit umgingen, denn es schien sie nicht sonderlich zu belasten. Die Natur mochten Menschen aber nicht sonderlich, zumindest schien es so, denn in der Stadt gab es nur einen einzigen Platz, an dem Pflanzen und Bäume wuchsen. Dennoch war ihre Welt nicht grau oder trist, im Gegenteil, die vielen Lichter verwandelten die Stadt in einen bunten, wundersamen Ort, so vollkommen anders als er es gewohnt war. Bei den Gedanken an seine Heimat wurde Bahal ganz wehmütig, er erinnerte sich an die Wälder und Gärten, den Duft der frischen Luft, die über die Berge ins Tal kam. An all die kleinen Häuser, welche die Straße säumten, die in Kreisen zum Zentrum der Stadt führten. Wunderschön und friedlich, jedenfalls, bis eine Gruppe von Dämonen die Hauptstadt angegriffen und in ein Trümmerfeld verwandelt hatte. Einige ihrer Feinde waren durch einen Riss in der Barriere in die Welt der Menschen geflohen, doch ihre Anwesenheit hier war falsch. Das war auch der Grund, warum er und seine Geschwister in diese Welt gekommen waren. Ihre Feinde brachte das Gleichgewicht ins Wanken, eine Gefahr für beide Welten. Ihre Aufgabe war es, sie zu finden und sie zu jagen, bis das Gleichgewicht wieder in Balance war. Erst dann würden sie nach Hause zurückkehren. Doch ohne den Angriff auf die Hauptstadt hätte er nie die Möglichkeit gehabt, diese Seite der Barriere zu sehen. Ein Grund mehr, mit diesem Geschenk sorgfältig umzugehen.
Wieder näherten sich schwere Schritte der Tür. »Es geht mir gut«, rief Bahal, noch bevor sein Bruder klopfen konnte. Doch war dem wirklich so, ganz sicher war er sich nicht. Seit drei Tagen betete er nun fast ununterbrochen zu den Göttern, vergebens. Er hatte Kräuter verbrannt, die alten Riten abgehalten, Gebete gesprochen, alte und neue, ohne Erfolg. Drei Tage kniend auf dem Boden, in tiefe Meditation versunken, das hinterließ definitiv seine Spuren. Sein Lied klang schwer, fast traurig. Das Lied, der einzigartige Klang ihrer Magie, zeigte wie es um sie stand, in seinem Fall war es ein eindeutiges, geh ins Bett. Sein Körper fühlte sich schwer an, als würde die Last der Welt ihn mit sich ziehen. Die Gelenke und Knochen schmerzten, ebenso wie alle Muskeln und die Haut an seinem Körper. Aber dass man ihm nicht antwortete, wunderte ihn wenig, auch wenn es ihn ärgerte, sein Verhältnis zu den Göttern war eben schwierig. Dennoch hatte Bahal gehofft, wenigstens die alten Riten würden als Friedensangebot angenommen, doch leider herrschte jenseits des Schleiers eisernes Schweigen. Schleier, Götter, knurrten die Stimmen. Seit er zu beten begonnen hatte, war es schlimmer geworden, als versuchten die Stimmen ihn davon abzuhalten. Bahal rieb sich die Augen, das Gebrabbel in seinem Kopf wurde wieder lauter, es war hartnäckig, wollte ihn verführen zu folgen, doch er würde den Stimmen nicht nachgeben, niemals. Kontrolle, rief er sich ins Gedächtnis zurück, Kontrolle. Bahal drängte die Stimmen zurück, bis ihre Lautstärke erträglich wurde. Doch er versuchte ja nicht aus Spaß und Langeweile, mit den Göttern zu sprechen, er wollte etwas, und da man ihn nicht einmal anhören wollte, wurde es wohl Zeit für Plan B. Fest entschlossen, sein Vorhaben in die Tat umzusetzen, verließ Bahal das Zimmer. Sein Weg führte ihn den Flur hinunter, in die Badestube. Ascan hatte den Raum mit Kerzen beleuchtet, um künstliches Licht zu vermeiden. Aufmerksam und fürsorglich wie immer, stellte Bahal fest. Der Duft von Kräutern lag in der Luft und die Wanne war zur Hälfte mit Eis gefüllt. Prüfend setzte er sich auf den Rand der Wanne, nahm ein Stück Eis heraus und drehte es in der Hand hin und her. In der Nähe ihres Hauses gab es einen Menschen, der ihre Goldmünzen in Papier umtauschte. Wie sie beobachtet hatten, tauschten die Menschen ihre Waren gegen dieses Papier ein, es war also gut, welches zu haben. Vor einigen Tagen, bei einem Spaziergang, fiel Bahal ein Händler auf, der Eis in Beuteln verkaufte. Praktisch, so blieb es ihm erspart Jeanne um Hilfe zu bitten, auch wenn er keine Ahnung hatte, was die Menschen mit diesem Eis anstellten, denn um Nahrung darauf zu lagern waren die kleinen Blöcke viel zu winzig. In Gedanken sah Bahal dem Eis in seiner Hand beim Schmelzen zu und stellte sich die Kälte vor, von der er umgeben sein würde. Ein wenig unruhig angesichts dessen, was er zu tun gedachte, begann er durch das Zimmer zu tigern. Am Fenster blieb er stehen und betrachtete andächtig den Himmel, kaum ein Sonnenstrahl drang am Tag durch den dicken, grauen Rauch. Nachts konnte man weder die Sterne noch den Mond sehen, sodass es kaum einen erkennbaren Unterschied zwischen Tag und Nacht gab. Er hoffte, dass diese Tatsache weniger Einfluss auf sie alle hatte, als er befürchtete. Denn sie waren Elementare, ihre Gesundheit war von ihrer Umgebung abhängig. Kein Schatten kann im Licht existieren, hatte sein Lehrer immer philosophiert, und kein Licht kann existieren in der Dunkelheit. Wie gesagt, sehr philosophisch, aber es war wohl etwas Wahres daran. Selten hatte er sich so erschöpft gefühlt wie im Moment, gut möglich, dass es an der Welt lag, in der sie jetzt lebten.
»Muss das wirklich sein?« Ascans Stimme klang streng und besorgt, als er das Zimmer betrat.
»Ich muss mit ihm reden«, sagte Bahal ruhig aber bestimmt, während er sich seinem Bruder zuwandte. Dieser stand in der Tür, nur mit seiner Hose bekleidet, wie eigentlich meistens. Imposant wie immer beanspruchte er den gesamten Türrahmen für sich. Ascan war der muskulöseste von ihnen und der größte, mit seinen zwei Metern überragte er fast jeden Krieger und jeden Menschen um einiges. Sein Schultern waren breit, der Körper stark und sein Geist unbeugsam und das, obwohl er, mit seinen knapp tausend Jahren, noch nicht ausgewachsen war. Möglich, dass er irgendwann an seinen Großvater heranreichen würde. Bahal erinnerte sich, einmal ein Porträt von ihm gesehen zu haben, das Bildnis eines Mannes mit dunklem Haar und dunklen Augen, ein Gigant, dem Bild nach zu urteilen.
»Trotzdem bin ich dagegen«, stellte Ascan entschlossen fest. Nervös strich Bahal sich durch das ungewohnt kurze, schwarze Haar, das er abgeschnitten hatte, um unter den Sterblichen weniger aufzufallen. Ascan starrte ihn noch immer voller Besorgnis an, was Bahal aber nicht verwunderte, denn eigentlich sah sein Bruder ihn immer so an. Er war eben der Inbegriff eines besorgten großen Bruders, gepaart mit absoluter Paranoia. Bedauerlicherweise war Ascan sehr gut in dieser Rolle, er ließ ihn keine einzige Sekunde aus den Augen, niemals. Das war anstrengend für sie beide, dennoch war es notwendig, wenn auch nur um die Traditionen zu achten. Ascan war sein Beschützer, ein Titel mit großer Ehre, er würde alles tun, um ihn zu beschützen, sogar für ihn sterben. Seinesgleichen stand für Stärke, Weisheit und bedingungslose Treue und so wie alle Abkömmlinge aus Ascans Linie, füllte auch er diese Aufgabe mit aller Leidenschaft aus. Man konnte es an seinem Körper sehen, obwohl ihm die rituellen Tätowierungen fehlten. Sein Körper war übersät von tiefen Narben, die aussahen, als hätte man ihm Säure über die Haut geschüttet. Wunden, die sich tief ins Fleisch gefressen hatten, sie zogen sich über die Arme und Schultern, die Rippen, den Rücken und die Oberschenkel.
»Wäre es dir lieber, ich würde mich bedecken?« Ascans Stimme hatte ihre Liebe und Weichheit wieder gefunden. Seine braunen Augen ruhten sanft und fürsorglich auf ihm. »Es ist nicht deine Schuld«, ergänzte er sanft und väterlich.