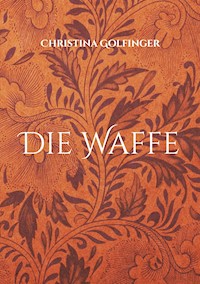
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Als Pam nach London fährt, will sie nur ein paar Tage Erholung haben. Von ihrer Arbeit beim deutschen Geheimdienst. Und ihrer Ehe, die genau daran scheitert. Doch anstatt Ruhe zu bekommen, wird sie in einen Terroranschlag im Herzen Londons verwickelt. Der Terroranschlag ist erst der Beginn einer globalen Verschwörung. Und Pam ist unfreiwillig ein zentraler Teil des Ganzen. Angegriffen und verurteilt von den Medien - von der anderen Seite gefeiert als Heldin. Das Schicksal der Welt liegt in ihren Händen. Der Preis - Ihr Leben. Wird sie ihn bezahlen?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 465
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Waffe…
…in meinem Kopf
…an meinem Kopf
…für meinen Kopf
Christina Golfinger
Inhalt
Teil 1: Die Waffe in meinem Kopf
Prolog: Perfekt
Kapitel: Ankunft
Kapitel: Tube
Kapitel: Check In
Kapitel: The Times
Kapitel: Lissy
Kapitel: Daglin
Kapitel: The World’s End
Kapitel: Zwischen den Zeilen
Kapitel: Der Anhänger
Kapitel: Stille
Kapitel: Anspannungen
Kapitel: Das Opfer
Kapitel: Reinheit
Kapitel: Schuss
Kapitel: Einführung
Kapitel: In deinen Augen
Kapitel: Der Abschied
Kapitel: Gerettet
Kapitel: Die Waffe in meinem Kopf
Kapitel: Gründe zu töten
Epilog: Imperfekt
Teil 2: Die Waffe an meinem Kopf
Prolog: Die Erkenntnis
Kapitel: Die Ankunft
Kapitel: Die Kippe kannst du küssen
Kapitel: Heimfahrt
Kapitel: Heimat
Kapitel: Wiedersehen
Kapitel: Schlaflos
Kapitel: Frühstück
Kapitel: Vorstellung
Kapitel: Ausbilderin
Kapitel: Sehnsucht
Kapitel: Die Rose
Kapitel: Seltsame Kontakte
Kapitel: Wilhelm Tell
Kapitel: Verarbeitung
Kapitel: Erwachen
Kapitel: Verlassen
Kapitel: Es ist noch nicht zu spät
Kapitel: Der Morgen danach
Kapitel: Die Waffe an meinem Kopf
Kapitel: Die Annahme
Kapitel: Konfrontation
Kapitel: Der Abschied
Epilog: Die Einsicht
Teil 3: Die Waffe für meinen Kopf
Prolog: Wahre Treue
Kapitel: Ankunft
Dublin
Brüssel
Kapitel: Beschützerin
Dublin
Brüssel
Kapitel: Alte Bekannte
Dublin
Brüssel
Kapitel: Die Nacht ist die schlimmste Tageszeit
Dublin
Brüssel
Kapitel: Der Beginn
Dublin
Brüssel
Kapitel: Der Plan
Dublin
Brüssel
Kapitel: Die Spannungen
Dublin
Brüssel
Kapitel: Der Auslöser
Friedrichshafen
Brüssel
Kapitel: Der Zündung
Friedrichshafen
Brüssel
Kapitel: Die Freunde
Friedrichshafen
Brüssel
Kapitel: Die Stufen
Friedrichshafen
Brüssel
Kapitel: Die Verluste
Friedrichshafen
Brüssel
Kapitel: Das Opfer
Friedrichshafen
Brüssel
Epilog: Wahre Loyalität
Teil 1: Die Waffe in meinem Kopf
Prolog: Perfekt
Schon eine ganze Weile lang sahen sie ihr zu. Es stand außer Frage, dass Theodors Erwählte wirklich hübsch war. Intelligenz und Begabung zeichneten sie ebenfalls aus. Sie war eine begnadete Schützin.
Dennoch war da etwas, das Edgar störte. Zu diesem Zeitpunkt vermocht er noch nicht zu sagen, was es genau war. Er war sich nur sicher, dass da etwas war.
Sie war deutlich jünger als die meisten anderen, die sie erwählt hatten. Doch das Alter spielte bei ihrem Unterfangen kaum eine Rolle. Primär ging es um die persönliche Eignung eines jeden Kandidaten.
„Und du bist dir wirklich sicher, dass sie die Richtige ist?“, erkundigte sich Edgar bei seinem Freund und langjährigem Partner. Dieser nickte nur geistesabwesend. Immer, wenn sie in ihrer Nähe waren, schien er in eine Art Rausch zu verfallen. Und dann war es schwierig bis nahezu unmöglich, mit ihm noch eine normale Konversation zu betreiben, oder auch nur die Antwort auf eine simple Frage zu erhalten.
„Ja. Sie ist alles, was wir brauchen. Alles, was uns noch fehlt. Sie ist perfekt“, hörte Edgar seinen Freund vor sich hinmurmeln. Er war in einem Bann. Und genau das war es, was ihn so misstrauisch ihr gegenüber stimme: Theodor war ein überaus pragmatischer, vernünftiger und intelligenter Mann. Wie konnte er nur so schwach werden bei einer einzigen, einfachen, unbedeutenden Frau?
Edgar beobachtete, wie sie eine Waffenstörung hatte. Sie hielt die Waffe ordnungsgemäß nach oben auf das Ziel gerichtet, so dass niemand in Gefahr gebracht wurde, sollte die Pistole doch noch feuern. Sie rief nach dem Aufsichtspersonal. Der Mann war sofort zur Stelle, als hätte er nur darauf gewartet. Und er half ihr. Wie es seine Pflicht war.
Auf einmal sah er in ihre Augen, was ihm schlaflose Nächte bereitete, seitdem er das erste Mal von ihr gehört hatte. Sie verhielt sich korrekt. Doch zur gleichen Zeit war sie begierig darauf zu lernen. Nicht, um sich zu entwickeln, sondern um unabhängig von anderen agieren zu können. Sie war ein Freigeist.
„Sie ist perfekt“, murmelte Theodor erneut. Das war zu viel für Edgar. Er wollte nicht wahrhaben, wovon sein Freund so sehr überzeugt war. Er teilte seine Auffassung nicht.
„Dir ist schon klar, dass sie ihren Gehorsam nur vortäuscht? Es geht ihr nur um ihr eigenes Interesse. Und wir brauchen Soldaten, Theodor. Soldaten, die an unsere Sache glauben. Die uns trotz und gerade wegen ihrer Intelligenz willenlos folgen“, wandte er ein. Zum ersten Mal sah ihn Theodor an. Sein Blick war eindringlich. Obwohl ihn Edgar schon all die Jahre kannte, vermochte er nicht zu sagen, was jetzt in seinem Kopf vor sich ging.
„Glaubst du wirklich, sie wird bedingungslos unsere Befehle ausführen? Sie niemals infrage stellen?“, hackte er weiter nach. Theodor seufzte. Vermutlich über das Unbehagen seines Freundes.
Edgar konnte einfach nicht das Gefühl verlieren, dass diese Frau 30 Jahre harte Arbeit mit einem Schlag zunichtemachen würde.
„Hast du geprüft, was das System über sie sagt?“, wollte Theodor in einem neutralen und distanzierten Tonfall wissen. Edgar schluckte. Natürlich. Das System.
„Doch. Lucy hält sie für geeignet“, gab Edgar kleinlaut zu. Er hatte es selbst überprüft. Wie bei jedem einzelnen Kandidaten.
Sie hatten jahrelang an diesem System gearbeitet. Das System berechnete ziemlich genau, welche Menschen in Deutschland ihren Anforderungen entsprachen. Und sie war sogar recht weit oben in der Liste gewesen.
Seine Zweifel waren unbegründet, denn Lucy – das System – irrte sich nie.
1. Kapitel: Ankunft
Tief atmete ich die Luft des Flughafens ein.
Ich konnte es kaum glauben. Ich hatte es geschafft. Ich war tatsächlich hier. In London.
Ich hatte gerade das Check-Out hinter mir. Nun musste ich mich nur noch orientieren und die richtige Richtung zur U-Bahn finden, um in die Stadtmitte zu gelangen und zu meinem Hotel zu fahren.
In der Regel fand ich immer Ausreden, um solche Unterfangen doch noch abzubrechen. Spontane Pläne waren nicht meine Stärke. Ich benötigte ein System und Ordnung, um mit meinem Leben klarkommen zu können. Doch dieses Mal hatte ich es durchgezogen. Meine Freude ließ sich nicht in Worte fassen.
Ich war hier.
Dämlich grinste ich vor mich her. Ich wollte gar nicht wissen, wie das von der Seite aussah. Aber das war mir egal. Generell hatte ich lange genug auf die Meinung von anderen geachtet. Jetzt war ich endlich an der Reihe.
„Tamara?“, hörte ich auf einmal eine vertraute Stimme rufen. Verwirrt warf ich einen Blick hinter mich. Ich kannte zwar die Stimme, hasste es aber, wenn mich jemand bei meinem richtigen Namen rief. Das erlaubten sich nur zwei Menschen in meinem Leben. Und beide Menschen bedeuteten mir enorm viel. Bei beiden duldete ich es nur dem anderen zuliebe.
Ich sah mich suchend um. Als ich ahnte, wer es sein musste, stieg Freude in mir auf.
Ich erblickte ihn: meinen Cousin Daniel.
Er kam grinsend auf mich zu. Man. Ich hatte ihn seit gut neun Jahren nicht mehr gesehen. Seit seiner Hochzeit eben. Ich musste zugeben, dass ihm das Eheleben stand. Er war nicht einmal mehr ansatzweise so schlank wie früher. Das war gut. Und er hatte sich einen kleinen Schnauzer zugelegt. Damit sah er aus wie ein Teddybär. Süß.
Daniel war der Sohn von meiner Tante Elisabeth, väterlicherseits. Sie bevorzugte es aber, Lissy genannt zu werden, seitdem sie von Moskau nach London gezogen waren. Und ich bevorzugte es, wenn man mich Pam nannte. Nicht, weil es cooler klang, sondern weil ich meinen richtigen Namen hasste.
Meine Tante war ein Fall für sich. Sie hatte Geld. Viel Geld. Ihr Mann handelte mit Aktien und das erfolgreich. Keiner wusste so genau, wie er es schaffte, immer nur Gewinne zu erzielen. Wenn es Verluste gab, dann nur marginal. In jedem Fall waren sie in Moskau eine sehr einflussreiche Familie gewesen. Wieso sie schließlich nach London gezogen waren, war für die meisten unserer Familie – mich miteingeschlossen – ein Rätsel. Bei Daniel war es etwas verständlicher: Er hatte ein Internat in England besucht und war danach in London geblieben. Er hatte eine Direktion für seinen Vater geleitet.
Daniel hatte eine jüngere Schwester: Kiara. Er war sieben Jahre älter als ich und fünf Jahre älter als Kiara. Er trat eindeutig in die Fußstapfen seines Vaters. Kiara war…ein verzogenes, reiches Gör. Wir hatten uns nie sonderlich gut verstanden. Ich war auch nicht scharf darauf, sie wiederzusehen. Aber feiern konnte man mit ihr gut. Das musste man ihr lassen.
Wieso hatten sie eigentlich ihre Tochter Kiara genannt? Ein Inder und eine Russin, die sich an einer Uni kennenlernten, heirateten und nannten ihre Tochter Kiara. Natürlich. Was denn sonst? Vielleicht war ich auch einfach neidisch auf dem Namen. Er gefiel mir.
Meinen letzten Stand nach hatte sie ja Schauspielkunst studieren wollen. Ich hatte noch nicht einmal gewusst, dass es diesen Studiengang überhaupt gab.
Daniel erreichte mich und streckte seine Arme nach mir aus. Ich warf mich hinein – genau wie früher, als ich noch ein Kind gewesen war – und genoss die Wärme seiner Nähe. Sein Duft hatte sich nicht verändert. Er war mein Lieblingsverwandter. Ich war wirklich froh, ihn zu sehen, auch wenn sein plötzliches Auftauchen keine Zuversicht in mir weckte. Das konnte nämlich nur bedeuten, dass mein Vater mich verraten hatte und meine Tante mich abfangen wollte, ehe ich in mein Hotel fuhr.
„Woher wusstest du, dass und vor allem, wann ich hier erscheinen werde?“, verlangte ich von meinem Cousin zu wissen, und er blickte mich enorm leidend an.
„Du hast es deinem Vater erzählt. Und wie du sicherlich weißt, telefoniert er regelmäßig mit seiner Schwester.“ Er stöhnte. Es tat mir wirklich leid für ihn, dass er wieder einmal zwischen den Fronten stand.
Ich hatte meinen Eltern erzählt, dass ich vorhatte, nach London zu fliegen und ihnen auch grob gesagt, in welcher Woche. Diese Informationen waren für Lissy wohl ausreichend gewesen. Ich hätte es wissen müssen. Immer wieder unterschätzte ich ihre Mittel und Wege an Informationen gelangen.
Mein Blick fiel auf einen blonden Mann, Mitte 30, hinter Daniel. Er war kräftig gebaut, aber nicht arg viel größer als ich – also höchstens 1 Meter 65. Daniel brauchte nichts weiter zu sagen. Ich war mir sicher, dass er das Opfer war. Das lag unter anderen an seinem leicht dämlichen Grinsen. Vermutlich sollte es ein Lächeln darstellen. Es war ihm nicht sonderlich gut gelungen. Er schien Angst vor mir zu haben. Und das war auch gut so.
Für Daniel blieb es natürlich nicht unbemerkt, dass ich ihn gesehen hatte. Daniel trat ein wenig zur Seite, sodass ich meinen künftigen Bodyguard, der auch seinen Job bald verlieren würde, besser begutachten konnte. Ich hatte das bereits getan und es reichte mir vollkommen. Ich war nicht zufrieden. Nicht zufrieden, Daniel.
„Pam, das ist mein Freund Ken“, stellte er ihn mir vor. War ja klar. Auf einmal konnte er mich Pam nennen. Das ging nur dann, wenn es ihm in den Kram passte und er mich gnädig stimmen wollte.
„Dein Freund also“, wiederholte ich nur etwas ungläubig und sarkastisch. Daniel sah genervt nach oben, zum Himmel, den man im Gebäude nicht erblicken konnte. Schon immer war er einer der wenigen Menschen gewesen, die meinen Sarkasmus verstanden hatten. War ich sarkastisch, nahmen mich die meisten Menschen ernst. War ich ernst, hielten mich die anderen für sarkastisch. Ich hatte kein leichtes Leben, wenn es um Verständigung ging.
„Und dein Freund arbeitet nicht zufällig für deine Mutter?“ Ich blieb bei meinem Sarkasmus. Der dieses Mal auch einen Funken Ernst enthielt.
„Doch. Das tut er“, antwortete Daniel und seine Stimme klang wie die eines trotzigen Kindes. Ich sah mir Ken noch einmal genauer an. Ja. Ich konnte mir sehr gut vorstellen, dass meine Tante ich für sich arbeiten ließ. Selbstverständlich waren ihr Qualitäten wichtig. Aber das Äußere war für sie ebenfalls maßgeblich. Er sah aus wie ein Ken, wenn auch die Haarfarbe und Körpergröße nicht so ganz übereinstimmte.
„Aber er ist auch mein Freund“, stellte Daniel noch einmal klar. Nun klang seine Stimme fast schon drohend. Er war sauer. Auf Lissy und auf mich gleichermaßen, so wie ich ihn kannte. Eventuell wäre es politisch korrekt von mir, mich doch ein wenig bei ihm einzuschleimen. Er war mein stärkster Verbündeter gegenüber meiner paranoiden Tante.
„Ich kürze das Ganze jetzt etwas ab, weil weder du noch ich was dafür können: Meine Mutter bietet dir die Wahl an, nachdem ich einiges an Zeit investiert habe, mit ihr darüber zu verhandeln. Und glaub mir, das war nicht leicht, weil sie sehr verletzt war, dass du ihr noch nicht einmal erzählt hast, dass du nach London kommst.“ Er setzte eine Kunstpause ein. Vielleicht musste er auch einfach nur Luft holen. Er sprach normalerweise nicht so viele Sätze hintereinander. Und auch nicht so schnell. Außerdem raubte ihm die Wut den Atem, wenn er im Moment wütend war, wovon ich ausging.
„Option eins: Du kannst bei Lissy wohnen. In diesem Fall entfällt der Bodyguard. Aber du weißt selber, was das für dich heißt.“ Ja, das wusste ich nur zu gut. Rechtfertigungen bis zum Abwinken, jedes Mal, wenn ich das Haus verließ. Kreuzverhöre, wenn ich später als zehn zurückkam. Bei Lissy zu leben bedeutete für mich, dass ich nicht mehr 26, sondern höchstens 14 war.
„Option zwei: Du bleibst im Hotel. In diesem Fall bleibt Ken.“ Ich konnte deutlich heraushören, dass es Daniel ganz und gar nicht gefiel, Ken als Bodyguard zu bezeichnen. Viel eher war, dass er die Wahrheit sagte, und die beiden tatsächlich Freunde waren.
„Aber das bedeutet auch, dass er dir wie ein Schatten folgt. Er wird immer für dich da sein, auch wenn du es nicht weißt oder willst. Und für Missverständnisse übernehme ich keine Haftung.“ Er spielte auf eine Situation in Moskau an, die sich vor etwa zehn Jahren zugetragen hatte. Damals, als ich meine Tante besucht hatte, hatte ich mich in Moskau mit einem Typen an einem Museum verabredet, den ich in einem Onlinegame kennengelernt hatte. Das Lustige war, dass er der Sohn eines Freundes meines Vaters war, wie ich beiläufig erfahren hatte. Also sollte man annehmen, dass all das kein Problem darstellen sollte. Doch der Bodyguard hatte mein Treffen etwas falsch verstanden und es für sexuelle Belästigung gehalten, als wir einander zur Begrüßung umarmten. Die Resultate waren ein gebrochenen Arm und einige Prellungen. Aber nicht für den Jungen. Er betrieb Kampfsport.
„In diesem Fall werde ich dir wie ein Schatten folgen“, meldete sich plötzlich Ken zu Wort. Sowohl Daniel als auch ich sahen ihn überrascht an. Selbst seine Stimme klang nach einem typischen Ken: Hell und klar.
„Ehrlich gesagt, finde ich beide Optionen scheiße“, meinte ich. Daniel nickte, als hätte er nichts anderes erwartet. Gut. Sie war wirklich kalkulierbar gewesen.
„Dir ist schon klar, dass das bereits die verhandelte Variante ist?“, fragte er mich provokativ. Ich seufzte nur genervt. Er tat es mir nach, wobei klar war, dass er mich damit nur imitierte, weil er genervt war und nicht damit anders umzugehen wusste.
Er hatte wirklich einen undankbaren Job. Er war schon immer der Einzige gewesen, der es irgendwie geschafft hatte, zwischen mir und Lissy zu vermitteln. Zwar waren weder Lissy noch ich damit zufrieden, doch wir konnten uns damit arrangieren. Der direkte Kontakt führte nur zu unglaublichem Streit und vollkommen sinnlosen Diskussionen. Daniel setzte sich für mich ein. Ich war aber kein kleines Kind und auch kein pubertierender Teenager mehr. Vielleicht war es an der Zeit, mich für seinen Einsatz erkenntlich zu zeigen.
Ich sah Ken an und konnte nicht anders, als es leicht säuerlich zu tun.
„In Ordnung. Ich wähle Option zwei.“ Und mir fiel sofort ein, wie ich mich erkenntlich zeigen konnte für Daniels Engagement.
„Wann soll ich zum Essen vorbeikommen?“, fragte ich ihn daher. Daniels Augen leuchteten auf. Das schien die richtige Frage zu sein.
„Danke, dass du fragst. Lissy wird sich sicherlich darüber freuen.“ Daran zweifelte ich nicht. Wenigstens ein bisschen mehr Kontrolle, als sie verhandelt hatte, würde sie dadurch erhalten. „Am besten du bringst es gleich hinter dich. Heute Abend. 7 Uhr.“ Ich stimmte zu und dann umarmte er mich plötzlich. Ich zuckte, doch er hielt mich fest. Ich hielt meine Hand unter Kontrolle, mich nicht aus Versehen zu wehren. Er war keine Bedrohung.
„Ken ist wirklich mein Freund. Also sei bitte nicht zu gemein zu ihm“, wies er mich noch einmal scharf an. Oh, je. Das war alles? Für diese kleine Bitte so ein Theater?
„Ich muss jetzt leider los. Aber ich vertraue dir hiermit Ken an. Äh. Dich, Ken ihr, meinte ich.“ Daniel redete wirr. Ich grinste. Wir umarmten uns ein letztes Mal zum Abschied. Dann ging Daniel einfach. Ich sah ihm noch kurz nach, ehe ich mich dem stummen Ken zuwandte, welcher noch immer das dämliche Grinsen in seinem Gesicht trug. Ich sah ihm direkt in die Augen. Ich wollte irgendetwas Knalliges sagen.
Mir fiel nichts ein.
Ken sagte auch nichts. Er starrte nur dumm. Ich zuckte mit den Schultern, wandte mich von ihm ab und lief los. Sogar in die richtige Richtung. Immer, wenn ich einen coolen Abgang hinlegen wollte, lief ich in die falsche Richtung los.
„Wo willst du hin?“, wollte Ken von mir wissen, nachdem er mich eingeholt hatte. Er erinnerte mich an ein Kind, dem aufgetragen wurde, mit mir zu spielen, obwohl es das gar nicht wollte. Und ich musste mitspielen gegen meinen Willen, wenn ich keinen Ärger bekommen sollte.
„Zur Tube“, sagte ich leichthin. Ich hielt seine Frage für überflüssig und dämlich. Wie sollte ich sonst in die Stadt gelangen? Ken lachte. Ich blieb stehen. Das verwirrte mich jetzt.
„Was ist?“
„Es ist erstaunlich, wie gut Dani dich kennt. Er hat mir prophezeit, dass du die Tube nehmen wirst. Ich habe ihm nicht geglaubt und mich die ganze Zeit geärgert, dass wir nur mit einem Auto hergekommen sind.“ Jetzt starrte ich ihn an. Was?
„Ihr habt über mich geredet?“, fragte ich tonlos.
„Sicher. Er hat mich vor dir gewarnt.“ Und dass er Tipps erhalten hatte, schwang deutlich mit. Dann schnaubte ich, drehte mich um und ging. Ihn ließ ich einfach stehen. Dann sollte er doch Schatten spielen, wenn er konnte!
2. Kapitel: Tube
Während ich lief, dachte ich an all die Bodyguards, die vor ihm gewesen waren. All diese armen Männer, die wegen mir ihren Job verloren hatten. Da war zum Beispiel Einer gewesen, den ich mit 19 in einer Disco abgefüllt hatte. Das war einer der wenigen Abende gewesen, an denen ich mich auch mit Kiara verstanden hatte. Sie hatte meine Aktion voll und ganz unterstützt. Und mal ehrlich: der Typ war ekelhaft gewesen und stand auf Frischfleisch.
Ich lief zum Schalter und kaufte mir eine Oyster-Card. Diese Karte erleichterte das Leben in London enorm. Man lud sie an einem Schalter mit Geld auf. Und dann konnte man verbilligt mit ihr herumfahren. Das Guthaben wurde einem vor und nach jeder Fahrt angezeigt. Theoretisch war es also idiotensicher.
Nach dem Erwerb begab ich mich zum eigentlichen Eingang zur Tube, zum Drehkreuz. Aus dem Augenwinkel nahm ich noch wahr, dass Ken sich ebenfalls eine Karte kaufte. Seltsam. Ich hatte angenommen, dass er eine Jahreskarte hätte oder die Oyster-Card besaß. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie man in London ohne überleben konnte.
Das Gleis war schnell erreicht. Die Tube kam auch sogleich. Ich stieg ein. Ken war nicht mehr zu sehen. Ich hatte erwartet, dass er mehr draufhatte. Das war zu einfach gewesen. Aber auch war ich überzeugt davon gewesen, dass hier deutlich mehr los war. Es waren sogar noch einige Sitzplätze frei. Ich stellte mich hin. Ich hatte keine Lust zu sitzen.
Die meisten um mich herum waren Männer um die 40. Sie sahen aus wie aus einer Schablone gedruckt: Anzug, Hemd, Krawatte, manche mit Brille, alle etwa gleich groß, ähnlicher gelackter Haarschnitt und eine Zeitung, in die sie vertieft waren.
Ich sah sie mir an. Aber wirklich begeistert war ich nicht von meiner Umgebung. Den gleichen Mist hatte ich schon zu Hause, um mich herumgehabt.
„Hallo“, ertönte es auf einmal neben mir. Ich konnte mich gerade noch zurückhalten, nicht zusammenzuzucken. Ich gab nicht gerne zu, dass ich mich erschrocken hatte.
„Tut mir leid. Ich wollte dich nicht erschrecken“, entschuldigte er sich und sah dabei zerknirscht zu Boden.
„Ah, ja. Wenn nicht das, warum hast du dich dann von hinten an mich herangeschlichen?“, fragte ich leicht säuerlich. Ken blickte mich mit Rehaugen an. Ich wurde aus diesem Mann einfach nicht schlau.
„Du bist mir bloß aufgefallen, weil, na ja“, er zeigte um sich herum, „du irgendwie nicht ins Bild passt. Und da habe ich mich gefragt, was dich hierher verschlagen hat.“ Ich sah ihn schräg an. Er verhielt sich so, als würde er mich nicht kennen. Was war der Grund?
„Ich will ein paar Tage ausspannen. Die letzten paar Monate waren für mich sehr anstrengend“, antwortete ich wahrheitsgemäß, wobei das noch eine Untertreibung war. Das einzig Stabile war mein Job gewesen. Alles andere war… Sagen wir mal einfach: kompliziert.
Gespieltes Entsetzten war in seinem Gesicht zu erkennen.
„Du willst ein paar Tage ausspannen und kommst dafür nach London? Sorry, aber für das gleiche Geld hättest du einen schönen Strandurlaub machen können. Oder Ski fahren gehen. Je nachdem, was für ein Typ du bist“, wandte er ein und er hatte recht. Ich hatte mir durchaus überlegt, so einen Urlaub zu machen.
„Ja, das stimmt. Aber ich wollte unter Menschen sein. Eins mit der Menge werden. Einfach abtauchen. Ich wollte so berieselt werden mit Eindrücken, Wahrnehmung und Werbung, dass ich mich selber nicht mehr spüre. Und dafür ist weder der Strand noch die Berge geeignet.
Außerdem: Ich mag kein Ski. Wenn, dann Snowboard.“ Nach meiner etwas längeren Antwort fiel mir der Groschen. Ich hatte es an der Art, in der ich auf ihn reagiert hatte, bemerkt.
Ken hatte mich tatsächlich so angesprochen, als wären wir vollkommene Fremde. Er hatte mich damit gelockert. Und damit unsere Begegnung auf ein vollkommen neues Niveau gebracht. Er wollte sich eine Chance bei mir verdienen. Mir zeigen, dass er keine Marionette von Lissy war. Allein schon die Idee und den Versuch musste ich ihm hoch anrechnen. Das oder Daniel hatte ihm wirklich gute Tipps gegeben. Auch die Anwendung dieser war nicht zu verachten.
Innerlich seufzte ich.
Er hatte gewonnen.
Und vermutlich hatte Daniel ihn genau aus dem Grund gewählt. Er kannte mich, obwohl wir nur selten zusammen Zeit miteinander verbracht hatten. Aber wenn, dann sehr intensiv.
Und es war offensichtlich, dass er Ken kannte. Eigentlich nahm ich es den beiden gar nicht so übel, dass sie über mich geredet hatten. Im Gegenteil. Ich konnte es ihm nicht verdenken.
„Ich war noch nie Snowboarden. Wie ist es?“ Ken spielte mit mir ein Spiel. Und ich wollte mitspielen.
„Es ist das absolute Gefühl von Freiheit. Zumindest, nachdem man die ersten paar Muskelkater der Hölle durchgestanden hat.“ Ken lachte. Ich rang mir mein erstes Lächeln ihm gegenüber ab.
„Wie heißt du eigentlich?“, fragte er mich. Das fiel ihm aber früh ein. Obwohl… Nein. Es war richtig so rum. Anders hätte ich ihn nicht wahrgenommen. Oder es mit Absicht falsch aufgefasst.
„Tamara. Aber alle nennen mich Pam.“ Hoffentlich musste ich meine Antwort nicht bereuen.
„Und was ist dir lieber?“
Mit dieser Frage hatte ich nicht gerechnet. Das hatte mich noch nie jemand gefragt. Und ich hatte darüber nur bedingt nachgedacht. Ich wollte nicht Tamara genannt werden. Aber den Namen Pam hatte ich mir auch nicht selber gegeben. Das war die Idee eines guten Freundes gewesen.
„Pam. Außer in Ernstfällen. Dann Tamara. Das ist ein wenig wie ein Warnruf für mich.“ Ken nickte mir zu.
„Und du bist?“, spielte ich nun meinen Part. Er zwinkerte mir dankbar zu. „Ken.“ Er hielt mir seine Hand hin. Unüblich, aber durchaus sympathisch. Ich nahm sie und schüttelte sie.
„Wo musst du raus?“
Kaum, dass er die Frage gestellt hatte, ertönte auch die Stimme, die meine Haltestelle verkündete. Die Fahrt war schneller vergangen, als ich gedacht hatte. Der Warnhinweis ertönte: „Please mind the gap“. Ich grinste. Ich liebte diesen Spruch.
„Jetzt gleich. Und du?“ – „Ich auch.“
Die Tube hielt an und ich stieg aus. Etwas abseits blieb ich stehen und sog die Luft ein. Wieso liebte ich so etwas bloß so gern? Gesund war das sicherlich nicht.
Ich wurde blass.
Verdammt.
Nein.
Ich hatte meinen Koffer in der Tube vergessen. Mein gesamtes Hab und Gut war darin.
Und mein Geld. Mein Ausweis. Mein Reisepass.
„Hast du nichts vergessen?“, fragte Ken neben mir. Na super. Jetzt ritt er noch auf meiner Dummheit herum.
Ich wollte gerade ihn empört anschnauzen, als ich meinen Koffer neben ihm stehen sah. Ich atmete erleichtert auf.
„Danke“, keuchte ich. Meine Selbstbeherrschung war flöten gegangen. Ich hatte mich wirklich erschrocken. Schon wieder.
„Und das ist alles? Mehr bekommt der Retter in der Not nicht?“, neckte er mich. Inzwischen hatte ich mich wieder entspannt.
Und hatte eine Eingebung.
Ich trat an ihn heran und bewegte mein Gesicht auf sein Gesicht zu. Ken erstarrte. Erst jetzt sah ich, dass er einen Ring am Finger trug. Scheiße. Egal. Ich würde jetzt keinen Rückzieher machen. Aber es abmindern.
Ich gab ihm einen Kuss auf den Mundwinkel. Obwohl Ken eingefroren war, sah ich ihm an, dass er es genossen hatte.
„Schon besser“, meinte er etwas zu verträumt.
„Darf ich dich ein Stück begleiten?“, fragte er daraufhin. Das war ja wohl das Mindeste nachdem eben. Das Spiel begann mir Spaß zu machen.
„Klar. Ich kann doch meinen Helden nichts abschlagen“, neckte ich ihn. Wobei das eher schon ein Flirten war. Nicht unbedingt typisch für mich. Aber ich genoss es.
„Erzähl mal. Wo kommst du her? Ken ist nicht unbedingt ein üblicher Name für einen Engländer“, erkundigte ich mich. Das interessierte mich wirklich.
Kens Lächeln verrutschte. Ups. Das war wohl kein günstiges Thema gewesen.
„Das liegt daran, dass ich eigentlich aus Frankreich komme.“ Ich sah ihn schräg an. „Das macht es nicht unbedingt besser.“ Er lachte. Etwas verspannt.
„Gut. Dann die lange Fassung. Ich wurde in Deutschland geboren. Aber meine Eltern haben sich getrennt. Ich habe danach nie wieder was von ihm gehört. Meine Mutter hat auf einer Geschäftsreise kennengelernt. Wir sind nach Frankreich gezogen.“ Seine Erklärungen waren auch keine wirkliche Erklärung. Das schien auch er zu realisieren.
„Und wie bist du in England gelandet?“ Wenn er schon begonnen hatte zu erzählen, dann sollte er auch weiterreden.
Er seufzte. Dann sprach er weiter.
„In der Nachbarschaft war ein Au-pair-Mädchen zu Besuch. Wir haben uns getroffen. Wir hatten Spaß. Sie ist schwanger geworden. Ich bin mit ihr nach London gezogen.“
Seine Formulierungen deuteten nicht auf Liebe und Glück hin. Damit war auch klar, warum er nicht darüber reden wollte. Beziehungsweise, warum es ihm unangenehm war.
Und ich hatte die Erklärung für den Finger bekommen.
„Cool. Habt ihr mehrere Kinder?“ Ich konnte jetzt keinen Rückzieher machen. Konnte ich schon, aber wollte ich nicht. Ich war leider ein sehr, sehr neugieriger Mensch. Mir fiel auf, dass meine Frage etwas dumm war. Er hatte doch gesagt, dass sie schwanger geworden sei.
„Drei Mädchen.“ Er lächelte mich an.
„Und wie sieht es mit dir aus? Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand wie du solo sein könnte.“ Ich verdrehte meine Augen. Das war ein bisschen zu dick aufgetragen. Er zuckte entschuldigend mit den Schultern. Offensichtlich war er zu der gleichen Ansicht gekommen wie ich.
„Ja. Ich bin verheiratet. Aber Kinder haben wir keine“, antwortete ich. Mir war das Thema unangenehm. Auch wenn ich es so locker daher sagte.
Das Hotel war nicht weit entfernt von der Station. Ich hatte das mit Absicht so gewählt.
„Du wohnst in diesem Hotel?“, fragte Ken fassungslos. Er war ein verdammt guter Schauspieler.
„Ja. Wieso?“ – „Weil ich auch hier ein Zimmer habe!“ – „Kann ja nicht sein! Ich dachte, du wohnst in London?“ Kurz musste er überlegen, was er als Nächstes sagen sollte. Ich grinste innerlich.
„Das schon. Aber mein Arbeitgeber hat mich dazu verdonnert“, sagte er schließlich. Das war eine neutrale Antwort. Ich beschloss ihn nicht weiter zu quälen. Außerdem gefiel mir seine Wortwahl.
„Dann lass uns mal einchecken“, sagte ich daher und hoffte auf einmal, dass ich mein Zimmer schon beziehen konnte. Eine Welle der Müdigkeit hatte mich ergriffen. Es war nicht weiter verwunderlich, denn ich war schon seit ein Uhr morgens auf den Beinen. Der Flieger ging um kurz nach acht. Aber leider nicht aus meiner Heimatstadt. Ich wohnte in Friedrichshafen. Der Flieger ging von Stuttgart aus. Das waren etwas mehr als zwei Stunden Autofahrt. Und ich sollte zwei Stunden vorm Abflug am Flughafen sein. Und dann war da noch die Zeit, die man für Zwischenfälle mit einkalkulierte…
Und jetzt hatten wir bereits zwei Uhr nachmittags. Ich war seit über zwölf Stunden auf den Beinen! „Dann lass uns mal reingehen“, stimmte mir Ken zu. Sein Arm zuckte kurz, doch er legte ihn nicht um mich, wie ich bei dieser Geste erwartet hatte. Vermutlich hatte sich der Anstand bei ihm gemeldet.
3. Kapitel: Check In
Wir betraten die Lobby. Sie war schön groß und geräumig. Auch war sie in ein gelbliches Licht getaucht, dass den Raum gemütlicher erschienen ließ. Ich lief auf die Rezeption zu, die sich rechts von mir befand. Links neben dem Eingang konnte ich eine hoteleigene Bar erkennen. Ich beschloss, dass ich sie im Laufe meines Aufenthaltes unbedingt aufsuchen musste.
Ich trat an die Rezeption heran, dicht gefolgt von Ken. Die Frau sah sofort zu mir auf und lächelte mich an. Ken registrierte sie ebenfalls. Und es fiel ihr nicht leicht, sich auf mich zu konzentrieren. Doch sie tat es.
„Guten Tag. Mein Name ist Pam Miller. Ich habe ein Zimmer reserviert“, teilte ich der Frau höflich mit. Sie lächelte mich an.
„Alles klar. Ich sehe kurz nach Miss Miller.“ Es war süß, dass sie mich Miss nannte. Nach englischem Sprachgebrauch war das nicht ganz richtig. Aber sie konnte es nicht wissen. Es drückte eher aus, dass sie hoffte, dass Ken und ich nicht zusammengehörten. Wir erweckten nicht unbedingt den Eindruck.
Sie glitt mit ihrem Stuhl nach hinten zu einem Regal hinter ihr. Sie griff nach einem Stapel Papier und rutschte zu mir wieder vor. Dann begann sie darin etwas zu suchen.
„Wenn Sie schon dabei sind: Ich habe hier auch ein Zimmer reserviert. Ken Merîon“, meinte auf einmal Ken. Sie zuckte leicht. Schnell fing sie sich wieder und lächelte ihn an.
„Vielen Dank. Das spart mir in der Tat Arbeit“, lobte sie ihn. Ken strahlte. Er hatte wirklich eine einnehmende Art. Ich musste aufpassen, dass ich auf diesen Kern nicht hereinfiel. Er war durchtrieben. Und er war wusste mit seinem Charme umzugehen. Obwohl ich so etwas recht schnell erkannte, war ich nicht unbedingt immun dagegen, wie meine jüngste Vergangenheit gezeigt hatte.
Die Frau suchte weiter. Sie zog einen ersten Zettel heraus. Dann einen Zweiten. Sie füllte auf beide etwas aus. Erst nachdem sie diese Tätigkeit beendet hatte, wandte sie sich wieder uns zu.
„Ich habe hier Ihre Unterlagen. Aber leider sind die Zimmer noch nicht fertig. Sie können zwar einchecken, aber den Schlüssel erhalten sie frühestens um 17 Uhr“, teilte sie uns mit und sah uns dabei an, als würde es ihr wirklich leidtun. Ich wollte ihr das mal so glauben, auch wenn ich wusste, dass das nur zum guten Ton gehörte. Der Wille reichte mir. Ich kannte auch ganz andere Arten.
„Aber Sie können Ihre Koffer unten bei uns abstellen. Dann können Sie die Zeit in der Stadt verbringen“, tröstete sie uns. „Klingt gut“, meinte ich nur gleichgültig. Sie erklärte uns, wie wir zu dem Raum gelangen konnten. Ken hörte ihr aufmerksam zu. Ich nur mit halbem Ohr. Wir liefen los.
Um zu dem Koffer-Ablageraum zu gelangen, mussten wir ein Stockwerk tiefer. Ich ging zum Aufzug. Ken folgte mir.
„Ernsthaft? Für die paar Stufen nehmen wir den Aufzug? Es ist nur ein Stockwerk“, wandte er ein. Prinzipiell hatte er recht. Unter anderen Umständen würde ich das auch genauso sehen wie er. Aber heute war ich faul.
„Ich bin seit über 12 Stunden auf den Beinen. Ich kann es mir erlauben, ein wenig faul zu sein.“ Ken zuckte nur mit den Schultern und drückte auf den Knopf vom Aufzug, da ich das vergessen hatte.
Der Aufzug kam recht schnell. Wir stiegen ein und fuhren runter. Obwohl die Fahrt nur wenige Sekunden dauerte, erschien sie mir ewig. Meine Augen begannen zuzufallen. Oh, man. So etwas hatte ich ja schon nicht mehr gehabt. Meine Ausbildung hatte mir das gründlich ausgetrieben. Und weil ich kilometerweis davon entfernt war, ließ ich es auch zu.
Der Raum befand sich direkt neben dem Aufzug. Das war gut durchdacht. Die Kofferabgabe nahm ich eher durch einen Tunnel war. Ich kam erst wieder richtig zu mir, als wir wieder vor dem Hotel draußen an der Luft standen.
„Geht es dir wieder besser?“, fragte mich Ken draußen. Ich nickte. „War es so schlimm?“, erkundigte ich mich, da ich manchmal Schwierigkeiten hatte, mein eigenes Verhalten einzuschätzen. Gerade in solchen Situationen.
„Wenn ich dich als Zombie bezeichnen würde, würde ich dir noch ein Kompliment machen. Ist es die Müdigkeit?“ Ich nickte. Ken lächelte mich mitfühlend an. Er konnte nicht ahnen, wie sehr ich es hasste, so angesehen zu werden. Genau aus diesem Grund zeigte ich meine wahren Gefühle nur selten vor anderen.
„Weißt du, was du jetzt brauchst?“ Ich schüttelte meinen Kopf. Mehr, weil es mich weckte, als dass ich keine Kraft hatte. „Einen Kaffee. Und ich weiß auch schon, wo wir einen Guten herbekommen können!“ Ich musste grinsen. Der Kerl riss sich echt einen Arsch für mich auf.
„Dann bring mich hin, bevor ich aufgrund von Koffeinmangel zusammenklappe!“, forderte ich ihn auf und hackte mich bei ihm ein. Er sah mich kurz und seltsam an. Er schien diese Geste nicht einordnen zu können.
Während wir liefen und uns über die Stadt unterhielten, spürte ich ein heftiges Verlangen in mir aufsteigen. Nein. Es war nicht das Verlangen nach Ken.
Es war das Verlangen nach einer Zigarette.
Mit meiner freien Hand griff ich meine Handtasche. Ich hatte gar nicht mitbekommen, wie ich sie aus meinem Koffer geholt und mitgenommen hatte. Manchmal – eher öfters – funktionierte ich so tadellos wie eine Maschine. Ich war gedrillt darauf.
Ich zauberte meine Schachtel American Spirit hervor. Ken sah mir beim Herausholen etwas belustigt zu.
„Du weißt, dass es leichter wäre, wenn du mich einfach kurz loslässt?“, neckte er mich belustigt. Er hatte recht. Schon wieder. Das geschah eindeutig zu oft an diesem Tag. Des Weiteren war mir diese Feststellung unangenehm. Sie implizierte, dass ich an ihm klammerte. Und das wollte ich keinesfalls tun. Theoretisch hatte ich ihn als Feind betrachten wollen.
Aber ich passte mich den neuen Umständen an. Das war schon immer eine meiner Stärken gewesen.
Ich ließ ihn los und holte nun auch das Feuerzeug heraus. Ich öffnete die Schachtel und hielt sie ihm hin. Ich hatte keine Ahnung, ob er rauchte. Seine äußere Erscheinung ließ keinerlei Rückschlüsse zu. Es war mehr eine Geste der Höflichkeit.
Er zog sich Eine raus. Yes! Ich freute mich darüber. Es war immer deutlich angenehmer als Raucher mit einem Raucher Zeit zu verbringen, als mit einem Nicht-Raucher. Oder schlimmer noch: Einem scheinheiligen Objekt, das vorgab, strickt dagegen zu sein und allen anderen seine eigene, ignorante Meinung aufzwang. Ich hasste solche Menschen.
Ich zündete erst Ken, dann mir die Kippe an. Ich zog gleich richtig. Rauch füllte meine Lungen. Und es tat mir so unglaublich gut. Außerdem war es ausgezeichnet, dass es so kühl war. Das weckte mich zusammen mit der Zigarette. Und ich freute mich schon wirklich auf den Kaffee. Der würde mich endgültig ins Reich der Lebenden zurückholen.
An einer Straßenecke hielt Ken an. Ich sah ihn fragend an. Er deutete auf den Laden hinter sich.
Aber es war kein Laden, wie ich angenommen hatte, sondern ein kleines Café.
„Dieses Café ist echt gut“, stellte Ken fest. Noch einmal sah ich es mir an. Es war an einer Straßenecke mitten im Nirgendwo Londons. Ich hätte das alleine niemals entdeckt. Dank Ken hatte ich ohnehin meine Orientierung schon lange verloren, wofür mich mein Ausbilder sicherlich tadeln würde. Aber er war nicht hier. Zum Glück. Das Café selber sah eigentlich nicht sonderlich vielversprechend aus. Eher schäbig und herabgekommen. Aber was wusste ich schon? Die meisten Kneipen in Deutschland, die solch eine äußere Erscheinung hatten, waren die besten.
Wir drückten die Zigaretten im Aschenbecher daneben aus und traten ein. Ken ging zielgerichtet auf die Theke zu, während ich stehen blieb und mich ein wenig umsah.
Es war wirklich schön hier.
4. Kapitel: The Times
„Möchtest du was Bestimmtes?“ – „Egal. Hauptsache Koffein.“
„Zwei Amarena Latte“, hörte ich ihn bestellen. Amarena Latte? Was sollte das denn sein? Das klang nicht nach einem Getränk, das ich normal trinken würde. Oder auch nur anfassen. Aber ich würde es trinken. Sei es auch nur dafür, ihm eine Freude zu bereiten.
Eigentlich sah der Laden ziemlich gemütlich aus. Das dunkle goldbraune Holz erweckte einen heimischen Eindruck. Es strahlte Wärme und Liebe aus. Ich wandte mich wieder Ken zu.
Und während ich das tat, erblickte ich einen Zeitungsständer direkt neben der Bedientheke.
Ich wusste selber, dass meine Augen aufleuchten. Lag vielleicht auch daran, dass ich mich selber im Spiegel hinter der Theke sehen konnte. Ken sah mich bereits fragend an. Ein wenig fühlte ich mich wie ein Kind in seiner Nähe.
Ich griff mir eine original Times aus dem Regal. Dann legte ich sie auf die Theke.
„Die will ich haben“, teilte ich Ken wie ein Kleinkind mit. Er lächelte mich schwach an.
„Und die Times“, fügte er an. Ich lächelte zufrieden. Im gleichen Moment wurde mir klar, dass ich gerade Ken dazu gezwungen hatte, mir eine Zeitung zu kaufen. Da war was schiefgelaufen.
Er nahm die Getränke und ich die Times. Wir liefen nach hinten und setzten uns an einen abgelegenen Tisch. Er war außerhalb des Sichtfeldes für die normalen Gäste. Ich ignorierte diese Tatsache. Kaum, dass wir uns hingesetzt hatten, nahm ich die Times und begann darin zu lesen.
Das klang jetzt vielleicht etwas abgedreht, aber ich hatte mir schon immer mal eine original Times in London kaufen wollen. Es durfte keine nach Hause gelieferte sein. Ich wollte sie definitiv in London kaufen. Ich wusste, dass dieser Wunsch keinen Sinn ergab. Es war die gleiche Zeitung, die auch an manchen Kiosken in Deutschland vorzufinden war oder die man über das Internet bestellen konnte. Dennoch war es für mich etwas anderes. Das hier war irgendwie… echter.
Ich las verschiedene Beiträge über die Stadt. Ein paar wenige über Landwirtschaft. Vielleicht war Lesen etwas hochgegriffen. Ich überflog sie viel eher. Ich war auf der Suche nach irgendeinem besonderen Artikel. Und ich war mir mehr als sicher, dass diese Zeitung mindestens Einen enthalten musste.
Für Ken hatte ich keine Konzentration mehr. Aber das war nicht weiter schlimm. Er war ja schließlich nur mein Bodyguard, selbst wenn er das Ganze in eine Richtung gelenkt und ich hatte mich darauf eingelassen. Er hatte mir die Times gekauft, so wie ich es gewollt hatte.
Und dann fand ich ihn: den interessanten Artikel, nach dem ich gesucht hatte. Von dem ich gewusst hatte, dass es ihn gibt, ohne ihn vorher gesehen oder von ihm gehört zu haben.
Dieser Artikel handelte von Deutschland und seiner aktuellen Politik. Vor fast über einem Jahrzehnt hatte Deutschland einen Haufen Flüchtlinge in unser Land gelassen. Diese Handlung war damals wie heute hart umstritten, denn sie hatte unser ohnehin schon brüchiges Land ohne jegliches Nationalgefühl noch tiefer zerrüttet.
Der Autor des Textes vermutet, dass Deutschland das nur getan hatte, um sich von einer alten Schuld loszukaufen. Einer Schuld, die sie sich während des Zweiten Weltkrieges aufgeladen hatten.
Damit meinte er im Konkreten die Verfolgung und Ausrottung der Juden. Es war wie ein Statement, dass wir uns verändert hatten. Dass wir gut und sozial waren. Dabei sollte man meinen, dass nach fast 100 Jahren das Thema langsam mal gegessen sein sollte. Es war ein rein politisches Instrument. Die einfachste Möglichkeit, Deutschland klein zu halten und unsere Regierung ließt sich auf diesen Quatsch willenlos ein. Sie hielten Deutschland klein. Als die Deutsche Mark, Deutschlands einstige Währung, zu stark wurde, führten sie die Europäische Zentralbank ein. Die Bildung wurde amerikanisiert, nur nicht sonderlich gut. Und wenn ein Deutscher die Nationalhymne sang, außerhalb der Fußball-Saison, so war er ein Nazi. Die amerikanischen Schüler taten das Tag aus Tag ein vor Schulbeginn. Und das war in Ordnung so.
Alles in allem, so wand er ein, klang dieses Vorhaben moralisch richtig. Auch räumte er ein, dass es nicht leicht sein musste, diese Altlast mit jedem Tag weiter vor sich hintragen zu müssen und aus diesem Grund eingeschränkt zu werden. Vor allem, da die jetzigen Generationen ja gar nichts dafür konnten.
Doch sein Einwand ließ nicht lange auf sich warten. Wenn Deutschland sich endlich offiziell von dieser alten Schuld reingewaschen hatte, so konnte sie sich frei entfalten. Unabhängig davon, was die bereits in sich zerfallende EU dazu sagen würde. Vor allem befürchtete er die militärische Entwicklung, denn Deutschland habe schon immer nach Höherem gestrebt. Ich übersetzte das mit: Er hielt Deutschland für größenwahnsinnig. Order aber: Er fürchtete die Macht, die sich Deutschland neu erarbeiten konnte. Und ich konnte nicht leugnen, dass einiges darauf deutete, dass wir in den letzten Jahren darauf hingearbeitet hatten. Ich wusste nicht, wie sehr es im Ausland bekannt war, dass wir in den letzten Jahren über ordentlich aufgerüstet hatten – in der Grauzone der EU. Die offizielle Ausrede dafür waren die Flüchtlinge, die mehr oder weniger freiwillig in das Land gelassen wurden. Eine unschlagbare Logik.
Das Militär wurde aufgerüstet. Militärgeschichte war wieder ein Bestandteil des deutschen Unterrichtes. Die Polizei wurde stärker bewaffnet. Sicherheitsvorkehrungen für öffentliche Einrichtungen wurden erhöht. Selbst die Richtlinien für Sportschützen wurden deutlich gelockert, was in unserem Land an ein Wunder grenzte und nicht zu den anderen Maßnahmen, zumindest von der Theorie her passte. Schließlich wurden diese gerne vor der Öffentlichkeit für terroristische Anschläge bestraft.
Ich meine, was war das für eine Logik? Diverse Menschen erlangen illegale Waffen, um damit Unheil anzurichten. Manche brauchten noch nicht einmal welche, sondern begnügten sich damit, einen LKW zu klauen und damit in eine Menschenmenge zu fahren. Und mir war klar, dass das keine Flüchtlinge oder Terroristen gewesen waren, sondern deutsche Staatsbürger. Zumindest in einigen der Fälle.
Und welche Maßnahmen wurden ergriffen?
Strenge Richtlinien für den Erwerb von Waffen für Sportschützen. Es war ja nicht schon genug, dass sie ein Jahr lang in einem Verein sein mussten, von dessen Zustimmung es am Ende abhing, ob man eine Waffe erwerben durfte oder nicht. Sie mussten eine theoretische und eine praktische Prüfung ablegen, in der sichergestellt wurde, dass sie wussten, wie man mit einer Waffe umgeht und dass sie nicht außerhalb des Schießgeländes verwendet werden durfte. Ein polizeiliches Führungszeugnis, inzwischen ein erweitertes, wurde angefragt. In manchen Fällen hatte man sogar einen Psychologen vorher aufsuchen müssen, um seine Zurechnungsfähigkeit bestätigen zu lassen. Unabhängig von der polizeilichen Akte. Wieso bestrafte man so stark geprüfte, nachweislich vorbildliche Bürger für Anschläge, mit denen sie nichts zu tun hatten?
Aber das war noch nicht das Ende vom Lied. An dieser Stelle hatte man erst die WBK erhalten. Und mit dieser qualifizierte man sich für den Erwerb von Schusswaffen. Aber auch nicht für jede. Nur für diejenige, die man zuvor schon eine bestimmte Anzahl an Malen im Verein und für die man Ringe geschossen hatte. Dann ging die Bürokratie los, die nicht gerade billig oder einfach war. Jede Waffe wurde registriert. Nur zur Waffe passende Munition durfte erworben werden.
Zum Glück hatte ich diese Zeit nicht miterlebt. Ältere Freunde von mir hatten mir davon berichtet. In jedem Fall war das jetzt egal. Deutschland und seine Gesetze waren sowieso ein eigenes Thema. Vielleicht sollte ich mal ein Buch darüber schreiben: „Deutschlands sinnvollsten Gesetzte. Der schnellste Weg zum Selbstmord.“
Der Artikel endete damit, dass alles darauf hindeutete, dass Deutschland wieder eine Weltmacht sein wollte.
Ich sah fassungslos zu Ken auf. Er nahm nur recht unbeeindruckt einen Schluck von seinem Kaffee, oder was auch immer das für ein Gesöff sein sollte.
Ich konnte es kaum glauben, was ich da gelesen hatte. So sahen die Briten uns? Kein Wunder, dass sie die EU verlassen hatten, kaum dass sie eine offizielle Gelegenheit dazu gehabt hatten. Was hatten sie zu befürchten? Es bedarf sie nicht länger direkt, wenn Deutschland die Europäische Union an die Wand fuhr.
Konnte es sein, dass die Briten Recht hatten? Ich hatte es noch nie aus diesem Blickwinkel betrachtet: Ich hatte unsere arschkriechende Regierung so viel Schneid nicht zugetraut, obwohl ich für sie arbeitete. Andererseits würde selbst das in das Bild passen.
„Dein Kaffee wird langsam kalt“, riss mich Ken aus meinen Gedanken. Ich benötigte einen Moment, ehe ich mich wieder im Hier und Jetzt befand.
Ich nahm einen Schluck von dem inzwischen lauwarmen Getränk.
Erneut blickte ich Ken überrascht an. Dieses Mal aus einem anderen Grund.
„Das schmeckt gut. Und normalerweise trinke ich so etwas nicht, weil es mir nicht schmeckt“, stellte ich fest. Ken sah mich schief an.
„Das hättest du mir ruhig sagen können, ehe ich bestellt hatte“, meinte er etwas gekränkt. Einerseits konnte ich ihn verstehen. Andererseits war es mir einfach nur egal.
Ich sagte nichts dazu. Irgendwie fand ich es besser, das auszuschweigen. Wir tranken fertig und verließen gemeinsam das Café. Wir liefen zusammen zur U-Bahn, wobei ich mich wieder komplett von ihm führen ließ. Erneut nahmen wir die Tube. Ich atmete tief durch. Ich liebte den Geruch der U-Bahn einfach zu sehr. Das war in Moskau nicht anders gewesen.
In der Stadt angekommen, führte mich Ken ein wenig umher. Er zeigte mir all die Sehenswürdigkeiten, von denen er der Meinung war, dass ich sie unbedingt sehen musste. Ich hörte ihm nur mit halbem Ohr zu. Ich war überfordert mit den ganzen Eindrücken, die mich in der Stadt trafen. Überall waren Menschen. Überall waren Stände. Restaurants. Bars. Alles. Seine Rede langweilte mich im Vergleich dazu.
Ich sah zum Eingang des Museums, von dem mir Ken gerade etwas erzählte. Und da entdeckte ich sie. Meine Augen weiteten sich aufgeregt. Ich packte Kens Arm und klammerte mich daran fest.
„Oh, mein Gott!“, hauchte ich und klammerte mich an ihm fest. Ich nahm nur beiläufig wahr, dass er etwas genervt aufseufzte.
„Was hast du jetzt wieder gesehen, was dich so sehr erregt?“, fragte er. Er klang belustigt, nicht gereizt. Ich ignorierte das. Ich war damit beschäftigt, mich zu freuen.
„Da!“, brachte ich nur raus und deutete auf die beiden Männer, etwas abseits des Museums.
Ken folgte meinem Blick. Dann sah er mich mit hochgezogenen Augenbrauen an.
„Stehst du auf Männer in Uniform?“, wollte er nun deutlich belustigt wissen. Ich schüttelte meinen Kopf. Dann atmete ich tief durch.
„Nein. Es geht um die Waffen. Die sehen aus wie MPs. Glaubst du das sind welche?“ Ken schüttelte ein wenig seinen Arm. Oh. Ich hielt ihn ja noch fest. Wahrscheinlich ein wenig zu fest. Ich lockerte meinen Griff ein wenig. Dann löste ich ihn ganz und hackte mich stattdessen bei ihm ein.
„Das merk ich mir. Um dich ins Bett zu bekommen, brauche ich also nur eine Schusswaffe“, neckte er mich. „Am besten Halbautomatische oder Automatische. Und Pistolen habe ich lieber als Gewehre. In der Regel. Außer sie sind selten für mein Auge“, erwiderte ich sarkastisch und ernst zugleich.
„Kann schon sein. Ich kenne mich da nicht sonderlich gut aus“, antwortete er mir noch auf meine Frage, auf die ich keine Antwort erwartet hatte.
Unvermittelt löste er sich wieder von mir. Stattdessen nahm er meine Hand in die seine, lächelte mich an und zwinkerte mir zu. Seine Hand fühlte sich warm an im Vergleich zu dem kalten Wind um mich herum.
„Vertrau mir. Du wirst dich freuen. Spiel einfach mit“, forderte er mich auf. Ich sah ihn kurz fragend an. Dann zwang ich mir zur Entspannung und lächelte. So echt und unverkrampft ich konnte.
Er lief los. Ich folgte ihm schweigend. Mein Herz war nahezu stehen geblieben.
Wir erreichten die beiden Spezialeinheiten, die mich so fasziniert hatten. Ich zwang mich, nicht zu schlucken.
„Hallo. Meine Freundin Pam ist aus Deutschland. Sie möchte gerne ein Bild mit euch beiden machen. Ist das in Ordnung?“, fragte er die beiden Männer. Überraschung war ihnen ins Gesicht geschrieben.
Ich meine, man musste mich auch verstehen. Ich war einfach nur ein Tourist. Und hier gab es genug Attraktionen.
Die beiden Männer wechselten einen Blick. Sie schienen sich nicht sicher zu sein, ob sie sich darauf einlassen sollten. Wahrscheinlich wogen sie ab, ob von mir und Ken ein Risiko ausging. Also wirklich. Mir stand doch ins Gesicht geschrieben, dass ich die Unschuld in Person war.
Die Unschuld in Person, die total auf Waffen stand. Aber das war ein Thema für sich.
„Du bist Pam?“, wollte der Linke wissen. Erst jetzt betrachtete ich die beiden Männer ein wenig genauer. Sie beide waren etwa gleich groß – nur minimal größer als ich. Und meine Körpergröße betrug lediglich ein Meter sechzig. Der Mann, der mich angesprochen hatte, war recht stämmig und hatte einen kleinen, vorstehenden Bauch. Die wenigen Haare, die an der Seite unter seiner Mütze heraustraten, waren dünn und grau. Er trug einen Vollbart, der bestenfalls grau war. Seine braunen Augen strahlten Zuneigung und Wärme aus. Vermutlich hatte er eine Familie, die ihn genau dieses Gefühl Tag für Tag schenkte. Er sah nicht aus, als hätte er jemals einen wirklich schlimmen Einsatz gehabt.
Anders stand es mit dem Rechten der beiden. Er war schmal, aber kräftig. Selbst durch die Uniform hindurch konnte man seine Muskeln deutlich erkennen. Sein Gesicht war braun gebräunt, doch die Haut darunter war mal blass gewesen und genauso schmal wie der Rest seines Körpers. Genauso wie seine Augen. Aber am auffallendsten war die Narbe, die sich quer über seine rechte Wange zog.
„Ja. Ich bin Pam“, beantwortete ich die Frage.
Sie sahen mich kurz an. Dann wieder einander. Sie nickten einander zu. Dann sahen sie wieder zu mir. Dann zu Ken. „In Ordnung“, war schließlich ihre Antwort.
Ich lief etwas unsicher auf die beiden zu. Sie rückten bei Seite, sodass ich mich zwischen sie stellen konnte. Ken schoss ein Bild mit seinem Smartphone. Und ich begann zu strahlen.
Als die beiden für das Bild ihre Arme um mich legten, schien für einen Augenblick die Welt um mich herum stehen zu bleiben. Als hätte ich die Liebe meines Lebens erblickt. Ich wusste, dass dem nicht so war. Doch ich genoss es in vollen Zügen, denn es war ein wirklich schönes Gefühl.
Paralysiert verließ ich die beiden wieder. Dabei bedankte ich mich immer und immer wieder. Der ältere Mann lachte mich ein wenig aus. Es machte mir nichts aus.
Wir traten bei Seite.
Noch einmal sah ich zu ihnen herüber. Der Jüngere sah just in dem Moment zu mir. Unsere Blicke trafen sich. Die Zeit blieb stehen. Ein Blitz traf mich in meinem Inneren.
Ich sah wieder weg.
Was war das denn gewesen?
Ken reichte mir wieder mein Handy und ich nahm es geistesabwesend.
„Wir sollten uns langsam auf den Weg zu Lissy machen. Sie wartet mit dem Abendessen wahrscheinlich schon“, teilte mir Ken die weiteren Pläne mit. Ich nickte nur kurz angebunden, sah noch einmal zu der Spezialeinheit und dann wieder zu Ken.
„Und wahrscheinlich ist das Essen schon seit heute Morgen fertig. Aber sobald wir kommen, wird sie sagen, dass es gerade erst fertig geworden ist.“ Ken lachte auf.
„Da hast du recht. Es gibt da nur noch eine Kleinigkeit.“ Er schien sich unwohl zu fühlen. Und das erregte meine Aufmerksamkeit.
„Was ist?“, hackte ich nach. Er sah bei Seite.
„Wir müssen noch mein Auto holen. Lissy wird alles andere als begeistert sein, wenn wir mit der U-Bahn angefahren kommen.“ Seine Aussage weckte Erinnerungen in mir. Erinnerungen an meinen Ausflug mit meinen Eltern. Damals hatte sie noch dort gewohnt. Der Chauffeur, der uns aufgezwungen wurde, hatte uns in die Stadt gefahren. Dort hatten wir die Metro genutzt. Als sie das erfahren hatte, ist sie ausgeflippt und bestand darauf, dass wir uns herumkutschieren ließen – ob wir wollten oder nicht. Und das unter Androhung einer fristlosen Kündigung. Bei meiner Tante einen Job zu verlieren bedeutete, keinen Job mehr in der Stadt zu bekommen.
„Ja. Ok. Aber wieso sollte das ein Problem sein?“ Ich konnte ihn nicht so ganz folgen. Er zuckte nur mit seinen Schultern.
„Ist egal. Na, dann wollen wir doch mal zur U-Bahn laufen.“ Er begann ein Thema und wollte im Grunde gar nicht darüber reden. Ich hasste solch ein Verhalten. Und eigentlich kannte ich so etwas nur von Frauen.
Schweigend liefen wir zur U-Bahn und nahmen die nächste Tube in Richtung seines Hauses. Ich war überrascht darüber, wie weit außerhalb der Stadt er wohnte. Klar. Es gehörte noch zu London. Aber dennoch war es ein komplett anderer Bezirk als die Stadtmitte.
Wir liefen zu seinem Haus. Vor der Garage hinter einer Hecke blieben wir stehen.
„Warte hier bitte kurz. Ich hole nur schnell das Auto“, wies er mich an. Ich sah ihn nur seltsam an. Seine Frau wusste schon, als was er arbeitete und vor allem für wen, oder? Er erweckte voll und ganz den Eindruck, dass er mich nicht in Sichtweite der Fenster haben wollte.
Ken lief zur Garage, öffnete sie und trat ein. Kurz darauf hörte ich, wie ein Motor ansprang. Er fuhr in einem schwarzen Audi heraus. Von mir hielt er kurz an und ich stieg ein. Wir fuhren los.
Auf zu Lissy!
Während der Fahrt unterhielten wir uns noch ein wenig über seinen Job. Er war verhältnismäßig lange bei Lissy eingestellt. Das war nie sein Traumjob gewesen. Er hatte während seines Studiums Kiara kennengelernt und sich mit ihr ein wenig angefreundet. Ich hinterfragte das nicht. Durch Kiara hatte er Daniel kennengelernt. Und er ist zu seinem besten Freund geworden. Er hatte ihm auch die Stelle verschafft.
Er redete über alles Mögliche. Nur nicht über seine Frau und seine Kinder. Oder die Aktion von gerade eben. Ich interpretiere sein Verhalten wie folgt: Es lief bescheiden in seiner Beziehung. Den Eindruck hatte ich bereits bei seiner ersten dürftigen Erzählung von ihr gehabt. Da war ich mir aber nicht sicher gewesen, ob es eine schlechte Anmache gewesen war.
5. Kapitel: Lissy
Wir erreichten das Haus von Lissy. Die Autofahrt war recht schweigsam verlaufen. Jeder war in seine eigenen Gedanken versunken gewesen. Und das, obwohl ich im Grunde wusste, dass es mich nichts anging. Ob er wohl über das Gleiche nachdachte?
Ken stieg als Erster aus. Ich war im Augenblick der Ankunft von meinem Handy abgelenkt worden, auf das ich natürlich auch sofort blickte. Ich meine, das war ein guter Vorwand, um keinen blöden Spruch reißen zu müssen, um das Schweigen zu durchbrechen. Ich war nicht gut darin, die Stimmung zu lockern. Mit mir konnte man gut schweigen.
Ich starrte auf mein Handy. Noch war der Display schwarz – ich hatte es noch nicht entsperrt. Ich überlegte. Ich spürte meine Augen zucken. Nein. Ich war im Urlaub. Meinem Mann und meinen Eltern hatte ich direkt nach der Ankunft geschrieben. Und sie hatten mir beide geantwortet. Immer wieder sagte ich mir: Es war nicht wichtig. Es konnte warten. Ich atmete tief durch. Ich hasste es, wie sich die Gesellschaft entwickelt hatte. Nur weil man ein Handy hatte, erwarteten die meisten, dass man es auch permanent bei sich trug und ständig drauf starrte. Selbst ein simples „Hallo“ wurde als Notfall und als überaus wichtig klassifiziert. Nein. Nein. Nein. Ich wollte mich dieser Mode nicht beugen. Stattdessen öffnete ich das Nachrichtenprogramm und deaktivierte die Benachrichtigungen. Jetzt würde ich die App immer willentlich starten müssen, um zu sehen, ob mir jemand geschrieben hatte.
Ken öffnete die Beifahrertür und sah mich an. Ich packte mein Handy weg. Ich bereute es nicht.
„Wollen wir dann mal?“, fragte er mich. Seine Stimme klang gereizt. Offensichtlich hatte er zuvor an nichts Positives gedacht. Es war seltsam. Der Mann, den ich in der Tube kennengelernt hatte, war mir deutlich sympathischer als dieser hier.
Ich stieg aus und er knallte die Tür hinter mir zu. Ich zuckte kurz zusammen, riss mich aber dann wieder am Riemen. Ich fühlte mich nervös. Wie vor einer Klausur oder einem Vorstellungsgespräch. Ich schüttelte meinen Kopf. Innerlich natürlich. Das war doch unsinnig. Es war nur Lissy.





























