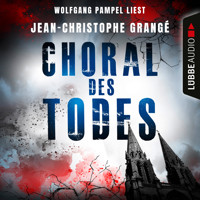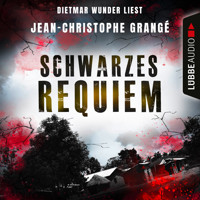7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Atemberaubende Spannung von Frankreichs Thriller-Autor Nr. 1
- Sprache: Deutsch
Nichts scheint, wie es ist.
Die Jagd nach einem Serienkiller führt Hauptkommissar Olivier Passan in einen der größten sozialen Brennpunkte von Paris: das Wohnviertel Le-Clos-Saint-Lazare. Doch Passan kommt zu spät. Er findet nur noch die grausam entstellte Leiche einer jungen Afrikanerin, die im neunten Monat schwanger war. Sie ist bereits das vierte Opfer des "Geburtenhelfers" - einem sadistischen Serien-Killer, der es auf schwangere Frauen abgesehen hat.
Auch privat durchlebt Passan eine schwere Zeit. Die Ehe mit seiner japanischen Frau Naoko ist gescheitert. Nachdem er aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen ist, geschehen dort bedrohliche Dinge. Passan vermutet zunächst einen Racheakt des Killers. Doch dann stellt sich heraus, dass die Anschläge mit der geheimnisvollen Vergangenheit Naokos zu tun haben ...
Atemberaubende Spannung mit hohem Gruselfaktor von Frankreichs Thriller-Autor Nr. 1. Jean-Christophe Grangé führt uns in eine Welt, in der Grausamkeit und dunkle Gesetze herrschen. Weitere spannende Meisterwerke des Thriller-Genies bei beTHRILLED:
Der Flug der Störche
Der steinerne Kreis
Das Imperium der Wölfe
Das schwarze Blut
Das Herz der Hölle
Choral des Todes
Der Ursprung des Bösen
Purpurne Rache
Schwarzes Requiem
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 571
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Dein beTHRILLED-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Die Jagd nach einem Serienkiller führt Hauptkommissar Olivier Passan in einen der größten sozialen Brennpunkte von Paris: das Wohnviertel Le-Clos-Saint-Lazare. Doch Passan kommt zu spät. Er findet nur noch die grausam entstellte Leiche einer jungen Afrikanerin, die im neunten Monat schwanger war. Sie ist bereits das vierte Opfer des »Geburtenhelfers« – einem sadistischen Serien-Killer, der es auf schwangere Frauen abgesehen hat.
Auch privat durchlebt Passan eine schwere Zeit. Die Ehe mit seiner japanischen Frau Naoko ist gescheitert. Nachdem er aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen ist, geschehen dort bedrohliche Dinge. Passan vermutet zunächst einen Racheakt des Killers. Doch dann stellt sich heraus, dass die Anschläge mit der geheimnisvollen Vergangenheit Naokos zu tun haben …
JEAN-CHRISTOPHE GRANGÉ
DIE WAHRHEITDES
BLUTES
Aus dem Französischen vonUlrike Werner-Richter
TEIL 1:
FURCHT
1
Es regnete. Seit Menschengedenken hatte es keinen derart miesen Juni gegeben. Schon wochenlang zeigte sich das Wetter immer gleich: grau, feucht und kalt. Vor allem die Nächte waren schlimm. Hauptkommissar Olivier Passan ließ den Verschluss seines Px4 Storm SD nach vorn schnellen und legte die Waffe entsichert auf seinen Schoß. Mit der Linken griff er wieder nach dem Lenkrad, rechts tippte er auf seinem iPhone herum. Auf dem Touchscreen baute sich die Navi-App auf und beleuchtete sein Gesicht gespenstisch von unten.
»Scheiße, wo sind wir hier überhaupt?«, knurrte Fifi. »Hast du eine Ahnung, wo wir hier rumgurken?«
Passan gab keine Antwort. Langsam und mit ausgeschalteten Scheinwerfern fuhren sie weiter. Im strömenden Regen konnte man kaum die Hand vor Augen sehen. Die Umgebung erinnerte an ein kreisförmiges Labyrinth, fast wie bei Borges. Gekrümmte, mit Ziegeln und rötlichem Putz verkleidete Mauern öffneten sich zu Eingängen, Gassen und Umwegen, schienen jedoch jeden Eindringling wieder nach außen zu katapultieren, als wollten sie ein geheimnisvolles Zentrum schützen.
Bei diesem Labyrinth jedoch handelte es sich um ein Wohnviertel namens Le Clos-Saint-Lazare, einen typischen sozialen Brennpunkt in einer der Pariser Vorstädte.
»Wir dürften überhaupt nicht hier sein«, murmelte Fifi. »Wenn das unsere Kollegen wüssten …«
»Schnauze!«
Passan hatte Fifi gebeten, dunkle Klamotten anzuziehen, um möglichst wenig Aufmerksamkeit zu erregen. Und was machte dieser Spinner? Er war in einem Hawaiihemd und knallroten Shorts angerückt. Passan verkniff sich die Frage, womit Fifi sich vor der Arbeit zugedröhnt hatte. Wodka? Speed? Koks? Wahrscheinlich alle drei.
Mit einer Hand am Lenkrad tastete Passan auf der Rückbank herum und griff nach einer kugelsicheren Weste, wie er auch selbst eine trug.
»Zieh das an.«
»Brauche ich nicht.«
»Zieh das Ding an! Mit deinem Hemd siehst du aus wie eine Tunte bei der Gay Pride.«
Philippe Delluc, der von allen nur Fifi genannt wurde, fügte sich widerstrebend. Passan beobachtete ihn von der Seite. Wasserstoffblonde Mähne, Aknenarben und gepiercte Lippen. Der offene Hemdkragen gestattete einen Blick auf das Maul eines wilden Drachen, der Fifis linken Arm und Schulter zu zerfleischen schien. Nach mittlerweile drei Jahren gemeinsamer Arbeit fragte sich Passan noch immer, wie der Junge die achtzehnmonatige Ausbildung an der Polizeischule, die Motivationsinterviews und die medizinischen Untersuchungen überstanden hatte.
Aber das Resultat war immerhin ein Bulle, der mit einer Pistole ein Ziel aus mehr als fünfzig Metern Entfernung treffen konnte, und zwar sowohl mit der rechten als auch mit der linken Hand. Auch nach mehreren durchgemachten Nächten zeigte er keine Ausfallerscheinungen. Mit kaum dreißig Jahren hatte der junge Kommissar schon mindestens fünf Schießereien überstanden, ohne einen Rückzieher zu machen. Fifi war mit Abstand der beste Teamkollege, den Passan je gehabt hatte.
»Wie war noch mal die Adresse?«
Fifi riss das Post-it ab, das am Armaturenbrett klebte.
»134, Rue Sadi-Carnot.«
Laut Navi mussten sie sich ganz in der Nähe befinden, lasen aber ständig andere Namen auf den Straßenschildern: Rue Nelson Mandela, Square Molière, Avenue Pablo Picasso. Alle paar Meter holperte der Wagen über Straßenschwellen, was Passan allmählich unendlich nervte.
Im Vorfeld hatte er sich die Zeit genommen, einen Plan von Le-Clos-Saint-Lazare auszudrucken, einem der größten Wohnviertel im Departement Seine-Saint-Denis, wo fast zehntausend Menschen in Sozialwohnungen hausen. Der Hingucker des Viertels sind kreisbogenförmig gebaute Wohnblöcke, die sich in Schlangenlinien zwischen ein paar mickrigen Bäumen hindurchwinden. Um die Häuserschlange herum türmen sich fast feierlich ein paar rechteckige Klötze, die wie Wächter auf ihrem Posten zu stehen scheinen.
»Scheiße«, presste Fifi zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor.
Hundert Meter vor ihnen droschen ein paar Schwarze auf einen am Boden liegenden Mann ein. Passan bremste ab, nahm den Gang heraus und ließ den Wagen auf die Gruppe zurollen. Die Schlägerei war in vollem Gange. Das Opfer versuchte verzweifelt, sein Gesicht zu schützen.
Prügel hagelten aus allen Richtungen auf den Mann ein. Einer der Angreifer mit abgeschnittenen Jeans und einer Kangol-Kappe auf dem Kopf trat ihm so heftig in den Mund, dass dem Opfer ein paar Zähne ausfielen.
»Ja, immer schön an meinen Schuhen lecken, Judenarsch. Immer schön lecken.« Der Schwarze presste ihm die Turnschuhe noch fester zwischen das geschundene Zahnfleisch. »LECKEN, ARSCHLOCH!«
Fifi griff nach seiner CZ 85 und öffnete die Tür. Passan hielt ihn zurück.
»Halt dich da raus. Du vermasselst noch alles.«
Plötzlich wurde es laut. Das Opfer war mit einem Satz aufgesprungen, die Treppe hinaufgerannt und in einem der Häuser verschwunden. Die Schwarzen lachten laut, verfolgten ihn aber nicht.
Passan legte den ersten Gang ein und fuhr an ihnen vorbei. Fifi schloss leise die Tür. Sie holperten über die nächste Schwelle. Der Subaru machte kaum mehr Lärm als ein U-Boot auf Tauchstation. Wieder warf Passan einen Blick auf sein iPhone.
»Rue Sadi-Carnot«, murmelte er. »Da drüben muss es sein.«
»Wo siehst du denn da eine Straße?«
Hinter einem Bauzaun fast verborgen zweigte rechts eine Gasse ab. Im gesamten Viertel wurde wie wild gebaut. Auf einem Reklameschild stand in großen Lettern »Raubtiergehege« – ganz ohne Ironie, als Werbung für einen berühmten Tierpark. Am Ende der Gasse erkannte Passan zwischen halbfertigen Mauern und einer Menge Baumaterial einige viereckige, unpersönliche Bauten, die in einer Vorstadt wie dieser ebenso gut eine Schule als auch eine Lagerhalle sein konnten.
»128 … 130 … 132 …«, zählte er halblaut. »Das ist es. Ganz sicher.«
Die Blicke der beiden Polizisten richteten sich auf einen der Betonkästen. Passan zog den Zündschlüssel ab und schaltete das iPhone aus. Man sah nichts als große schwarze Pfützen, in die Regentropfen prasselten.
»Und jetzt?«, fragte Fifi.
»Wir gehen rein.«
»Bist du ganz sicher, dass du dich nicht irrst?«
»Ich bin überhaupt nicht sicher. Aber wir gehen da jetzt rein. Basta.«
Plötzlich hörten sie eine Frau schreien. Hastig blickten die Polizisten sich um. Woher war der Schrei gekommen? Drei halbwüchsige Kerle rannten die Straße entlang. Sie zerrten ein junges Mädchen mit sich, das sich verzweifelt schluchzend nach Leibeskräften wehrte. Einer der Jungs trieb sie mit heftigen Tritten vorwärts, ein anderer drosch ihr seine flache Hand in den Nacken. Offenbar wollten sie zu den Bauwagen.
Wieder öffnete Fifi die Wagentür. Sofort packte Passan ihn am Arm.
»Lass sie laufen. Deswegen sind wir nicht hier, kapiert?«
Sein Kollege warf ihm einen wütenden Blick zu.
»Wegen so etwas bin ich aber Bulle geworden, okay?«
Passan zögerte. Die Frau schrie schrill auf.
»Scheiße …« Er gab nach.
Mit vorgehaltener Waffe stiegen sie aus, schlichen hinter geparkten Autos bis zu der Gruppe und warfen sich ohne Vorwarnung auf die drei Übeltäter. Passan versetzte dem ersten einen solchen Schlag, dass er auf einem Haufen Sand in sich zusammensank. Fifi riss den zweiten von den Beinen, drehte ihn sofort auf den Bauch und fingerte nach seinen Handschellen. Der dritte Jugendliche suchte fluchend das Weite.
Das zitternde Mädchen verschwand fast gleichzeitig. Die beiden Polizisten blickten sich an. Das war ja schnell gegangen! Plötzlich gab es weder ein Opfer noch einen Angriff – einfach gar nichts mehr. Der Kerl am Boden nahm das kurze Zögern sofort wahr, schlug Fifis Hand mit der Pistole zur Seite und sprang auf die Füße.
Ein Schuss löste sich. Die Handschellen flogen in hohem Bogen klirrend davon. Der Übeltäter verschmolz im Handumdrehen mit der Nacht.
»So ein Mist«, schimpfte Passan.
Aus dem Augenwinkel sah er, wie die Tür des Lagerhauses leise geöffnet wurde. Sofort erkannte er den kahlen Schädel, die gedrungene Figur und die blauen Chirurgenhandschuhe. Wie oft hatte er diesen Augenblick herbeigesehnt! In seiner Fantasie lief immer alles sauber und glatt.
Er zog seine 45er und brüllte:
»Stehen bleiben!«
Der Mann erstarrte. Auf seinem regennassen Schädel spiegelte sich das durch die halb geöffnete Tür flackernde Licht. Drinnen brannte es. Sie kamen zu spät. Plötzlich klickte es in Passans Gehirn. Er fuhr herum und sah gerade noch den dritten Vergewaltiger, der in Richtung der bogenförmigen Gebäude floh.
Fifi legte an, den Finger bereits am Abzug. Passan drückte seinen Arm nach unten.
»Sag mal, spinnst du?«
Nun rannte auch der Kahlkopf davon. Natürlich in die entgegengesetzte Richtung. Sein schwarzer Regenmantel flatterte hinter ihm her. Ein wahres Fiasko! Passan sah, dass Fifi die Waffe wieder hochgenommen hatte und abwechselnd auf die beiden Flüchtenden zielte.
»Lass den Spinner laufen«, schrie er. »Schnapp dir Guillard!«
Sein junger Kollege stürmte in Richtung Baustelle, Passan lief zum Lagerhaus, verstaute die Beretta im Holster, schaltete sein Handy wieder ein, streifte im Laufen Handschuhe über und ließ die Schiebetür aufgleiten.
Er wusste, was ihn erwartete.
Aber es war noch viel schlimmer.
In einer mit Motoren, Ketten, Werkzeug und Ersatzteilen vollgestopften Halle von etwa hundert Quadratmetern hing in fast ein Meter fünfzig Höhe eine junge Frau an einem Großtank. Ihre weit auseinandergespreizten Arme und Beine waren mit Gurten gefesselt. Man sah ihr die nordafrikanische Abstammung an. Sie trug einen Jogginganzug von Adidas. Hose und Slip waren bis zu den Knöcheln heruntergelassen, das T-Shirt war hochgestreift.
Ihr Bauch war vom Brustbein bis zum Schamhügel aufgeschnitten, und die Därme hingen bis zum Boden hinunter. Vor ihr verkohlte ein Fetus in einer lodernden Lache. Die übliche Vorgehensweise. Sekunden vergingen. Sie kamen Passan wie Ewigkeiten vor. Er war unfähig, sich zu bewegen. Der Körper des Babys krümmte sich in der Glut. Erstickender Qualm stieg auf. Das Kind schien Passan mit glühenden Feueraugen zu beobachten.
Endlich brachte er es fertig, sich loszureißen. Zwischen Reifen und Antriebswellen hindurch stürzte er auf das Feuer zu, riss einen Läufer vom Boden und bedeckte den winzigen Körper. Er musste mehrfach zuschlagen, ehe das Feuer endlich erlosch. In einer Ecke entdeckte er eine Leiter, stellte sie auf und stieg zu der gefesselten Frau hinauf. Er wusste, dass sie tot war, tastete aber zur Bestätigung nach ihrem Puls.
Sein iPhone meldete sich. Er wühlte so heftig in seiner Tasche, dass er beinahe von der Leiter gefallen wäre.
Die atemlose Stimme von Fifi meldete sich.
»Was treibst du?«
»Hast du ihn?«
»Von wegen. Er ist auf und davon.«
»Und wo bist du jetzt?«
»Keine Ahnung.«
»Ich komme.«
Passan sprang von der Leiter und rannte mit der Waffe im Anschlag zur Tür. Draußen musste er sich zwischen Betonmischern, Hohlblocksteinen, Gipssäcken und Moniereisen durchquetschen. Es war stockfinster. Er konnte kaum etwas erkennen.
Nach wenigen Metern fiel er der Länge nach hin. Hastig rappelte er sich auf und untersuchte das Hindernis, das ihn zu Fall gebracht hatte. Es war Fifi. Er lag auf dem Boden. Sein Fuß war unter einer abgerutschten Palette Rigipsplatten eingeklemmt.
»Ich bin hingefallen, Passan. Ich bin gefallen.«
Passan hätte nicht sagen können, ob der junge Mann lachte oder weinte. Er bückte sich, um seinem Kollegen zu helfen, doch dieser wehrte ab.
»Vergiss es! Such lieber das Arschloch!«
»Wo ist er?«
»Da. Die Mauer!«
Passan drehte sich um und machte in einigem Abstand eine schemenhaft sichtbare Brandmauer aus, die sich offenbar über mehrere Hundert Meter erstreckte. Jenseits der Mauer schimmerte ein diffuses Licht: die Nationalstraße. Mit der Beretta in der Hand rannte er los. Er fand einen Erdhaufen, von dem aus er auf die Mauer klettern konnte, und ließ sich auf die andere Seite fallen. Hier war nur noch ödes Brachland. In der Ferne fuhren Autos. Im Scheinwerferlicht entdeckte Passan die Umrisse von Patrick Guillard, der sich, immer wieder strauchelnd, den steilen Hang hinauf auf die breite Straße zubewegte.
Passan stürmte los. Die Kevlarweste brachte ihn ins Schwitzen. Seine Füße blieben so tief im Matsch stecken, dass er manchmal Mühe hatte, sie freizubekommen.
Aber er holte auf.
Guillard erreichte den höchsten Punkt des Abhangs. Gleich dahinter lag die Nationalstraße. Passan legte noch einmal einen Zahn zu. Als sein Gegner gerade über die Leitplanke klettern wollte, erwischte er ihn am Bein und zerrte ihn ein Stück den Hang hinunter. Guillard versuchte, sich an Grasbüscheln festzuhalten. Passan packte ihn am Kragen, drehte ihn um und ließ seinen Schädel mehrmals heftig auf einen Steinbrocken prallen.
»Widerliches Arschloch!«
Guillard wehrte sich. Der Polizist prügelte mit dem Lauf seiner Waffe auf ihn ein. Er spürte, wie das Blut seines Widersachers seine Finger, seine Augen und sein Nervenkostüm überschwemmte. Jedes Mal, wenn auf der Straße unmittelbar oberhalb der beiden kämpfenden Männer ein Auto vorbeifuhr, bebte der Boden.
Plötzlich hielt Passan inne. Mit hervortretenden Augen richtete er sich auf, steckte die Waffe ein und zerrte den schlaffen Körper Guillards den Hang hinauf an den Rand der Fahrbahn.
Scheinwerfer blendeten auf. Ein Sattelschlepper näherte sich mit hoher Geschwindigkeit.
Mit einem Fußtritt beförderte Passan den zusammengeschlagenen Mann auf die Asphaltpiste und setzte ihm einen Fuß auf die Brust. Der Sattelschlepper kam unerbittlich näher.
Passan schloss die Augen.
Er war das Gesetz.
Er war die Gerechtigkeit.
Er war das Schwert und der Richterspruch.
Eine Sekunde, ehe die Reifen Guillards Schädel zermalmt hätten, schrak Passan zusammen, riss den Mann hoch, katapultierte sich mit ihm über die Leitplanke und rutschte den Abhang hinunter. Der Sattelschlepper brauste mit aufgeblendeten Scheinwerfern und wild hupend nur wenige Meter an ihren verschlungenen Körpern vorbei.
2
»Das gibt Ärger. Ich schwöre dir, das gibt einen Riesenärger!«
Passan blickte den Kommissar an, ohne ihn einer Antwort zu würdigen. Sein Gegenüber war klein, gedrungen und trug eine Jeansweste, unter der sich seine Sig Sauer deutlich abzeichnete. Auf dem Ärmel seiner Jacke war das Logo seiner Einheit aufgenäht.
Ein Hubschrauber überflog das Gebiet und tastete die nassen Dächer der Häuser mit einem starken Scheinwerfer ab. Passan kannte sich gut genug in den Pariser Vorstädten aus, um zu wissen, wonach die Polizei suchte. Man fahndete nach Gruppen meist jugendlicher Taugenichtse, die sich irgendwo versteckten, um aus der Deckung mit Flaschen, Zündkerzen und Schottersteinen anzugreifen. Bereitschaftspolizisten waren in den Kellern ausgeschwärmt und sahen sich nach mit Steinen gefüllten Einkaufswagen um.
Olivier Passan rieb sich das Gesicht und trat ein paar Schritte beiseite. Nur fort von der Menge. Er konnte das verrückte, fast kriegerisch anmutende Gehabe nicht leiden. Gerade erst war er dabei, sich von seinem eigenen Ausraster zu erholen. Das blendende Licht des Sattelschleppers. Der Kopf des Mörders auf dem Asphalt. Die unbändige Mordlust, die er gespürt hatte und die er sich als Ausübung des Gesetzes schöngeredet hatte.
Er wandte sich zu Tom Pouce um.
»Es war ein Notfall«, rechtfertigte er sich schließlich.
»Und da treibst du dich einfach so in unserem Einsatzgebiet herum, ohne jemanden zu informieren?«
»Wir haben den Hinweis erst in letzter Minute bekommen.«
»Schon mal was von Artikel 59 gehört?«
»Es musste schnell gehen, verdammt noch mal! Und vor allem möglichst diskret.«
Pouce lachte kalt auf.
»Was die Diskretion angeht, da bekommst du sicher noch einiges zu hören.«
Um sie herum flackerte Blaulicht. Polizisten in Uniformen und weißen Kombis wuselten herum, zogen Absperrbänder und untersuchten den Tatort. Neugierige Kinder in viel zu großen T-Shirts und Kapuzenjacken drängten sich vor den gelben Bändern.
»Bist du wenigstens sicher, dass es sich um den Geburtshelfer handelt?«
Oliver zeigte auf die Tür des Lagerhauses.
»Genügt dir das da drüben etwa nicht?«
Die Leiche wurde weggebracht. Zwei Angestellte eines Bestattungsunternehmens schoben die Bahre zum Wagen. Das Opfer steckte in einem Plastiksack. Ein dritter Mann folgte mit einer Kühlbox, auf der ein rotes Kreuz prangte. Sie enthielt den verkohlten Fetus. Pouce rückte seine Armbinde zurecht.
»Ihr Idioten habt das ganze Viertel in Gefahr gebracht.«
»Aber die Gefahr ging von deinem Viertel aus.«
»Soll jetzt etwa ich schuld dran sein?«
Plötzlich erkannte Passan, wie erschöpft sein Gegenüber war. Seine Wut und die Verachtung fielen in sich zusammen. Pouce ging einfach nur auf dem Zahnfleisch – verbraucht von langen Jahren nutzloser Stadtguerilla-Arbeit. Verlegen wandte Passan sich wieder der stakkatoartig beleuchteten Umgebung zu. Familien standen an den Fenstern, Nutten drängten sich um das Sicherheitsband, Kinder im Schlafanzug tobten auf den Treppen der bogenförmigen Wohnhäuser. Mit Helmen und Gummigeschossen bewaffnete Ordnungskräfte waren angerückt und jederzeit bereit, in die Menge zu schießen.
Einige besonders ausgebildete schwarze und nordafrikanische Polizisten bemühten sich, die Umstehenden zu beschwichtigen. Passan musste an die Fährtenleser im Wilden Westen Amerikas denken – Indianer, die den Weißen den Weg in eine geheimnisvolle, feindlich gesinnte Welt bereiteten. Diese Ethno-Polizisten waren ebenfalls eine Art Kundschafter.
Auf dem Rückweg zu seinem Wagen ließ er noch einmal die Ereignisse Revue passieren, die ihn fast an die Pforte zur Hölle gebracht hatten. Am Vorabend war die achtundzwanzigjährige Leila Moujawad vermisst gemeldet worden. Die junge Frau war im neunten Monat schwanger. Gleichzeitig erhielt Passan die Information, dass es in der vom Hauptverdächtigen Patrick Guillard geleiteten Holding eine Offshore-Gesellschaft gab, die wiederum eine Werkstatt im Pariser Vorort Stains in der Rue Sadi-Carnot 134 besaß. Es war eine Lagerhalle, die in keinem von Guillards Büchern vermerkt war und sich nicht einmal drei Kilometer entfernt vom Fundort der ersten drei Leichen befand.
Passan hatte sofort Fifi angerufen und sich mit ihm auf den Weg gemacht. Aber sie waren zu spät gekommen. Nur Minuten zuvor hatten Leila und ihr ungeborenes Kind sterben müssen. Aber Passan hatte im Laufe seines Berufslebens zu viel gesehen, um sich über die Ungerechtigkeiten des Daseins noch aufzuregen.
Plötzlich zerriss ein Schrei den allgemeinen Tumult. Ein junger Mann stieß die Bereitschaftspolizisten beiseite und stürzte sich auf den Leichenwagen. Passan kannte ihn. Es war Mohamed Moujawad, dreißig Jahre alt, der Ehemann von Leila. Er hatte ihn erst am Vorabend auf der Wache in Saint-Denis vernommen.
Für diese Nacht war es weiß Gott genug. Der Staatsanwalt würde sicher gleich kommen und einen neuen Beamten einschalten, der sich dann mit Ivo Calvini herumschlagen durfte – dem Untersuchungsrichter, der mit der Mordserie betraut war. In jedem Fall würde Passan selbst sicher nicht an den Ermittlungen beteiligt. Zumindest nicht sofort. Er würde zunächst für seine Fehler geradestehen müssen. Illegale Verfolgung, verzögerte Ankunft am Tatort, Nichteinhaltung des Urteils, das ihm bei Strafe verbot, sich Guillard auf weniger als zweihundert Meter zu nähern, und Ausübung von Gewalt gegenüber einem Verdächtigen, der noch keines Verbrechens überführt war. Die Anwälte des Schweins würden ihn in der Luft zerreißen.
»Verschwinden wir?«
Fifi saß im Subaru und rauchte eine Zigarette. Seine behaarten Beine – eines hatten die Sanitäter sorgfältig verbunden – hingen aus der geöffneten Tür.
»Eine Sekunde noch.«
Passan kehrte noch einmal in die Lagerhalle zurück. So schnell würde er vermutlich keine Gelegenheit mehr erhalten, sich noch einmal genauer umzusehen. Techniker von der Spurensicherung machten sich überall zu schaffen. Das Blitzlicht des Fotografen zuckte auf. Kontrastpulver, Pinzetten und verschließbare Plastiktüten wanderten von Hand zu Hand. Schon tausend Mal hatte Passan diese Vorgänge beobachtet.
Vor dem Tank entdeckte er Isabelle Zacchary, die die Arbeit der Spurensicherung koordinierte. Er hatte sie selbst zum Tatort gerufen. Sie beugte sich in ihrer weißen Kombi über den schwärzlichen Fleck, den die Eingeweide der Toten hinterlassen hatten.
»Hast du schon was gefunden?«
»Führst du die Ermittlungen?«
»Natürlich nicht, das weißt du doch.«
»Also, ich weiß nicht, ob …«
»Ich will ja nur deinen ersten Eindruck hören.«
Zacchary zerrte an ihrer Kapuze, die sie zu stören schien. Ihre Maske mit den seitlichen Filtern hing ihr um den Hals. Sie sah aus wie ein Wesen von einem anderen Stern. Sobald sie sich bewegte, knisterte ihr Anzug. Sie hatte ihre Brille aufgesetzt, was ihr normalerweise ein distanziert erotisches Aussehen verlieh. An diesem Abend allerdings nicht.
»Leider kann ich dir im Augenblick noch gar nichts sagen. Wir müssen alles im Labor untersuchen lassen.«
Passan sah sich um. Der blutüberströmte Tank, die herunterhängenden Fesseln, die blutverkrusteten chirurgischen Instrumente auf dem Tresen. Immer noch roch es nach versengtem Fleisch.
Mit einem Mal kamen ihm Zweifel.
»Habt ihr seine Fingerabdrücke gefunden?«
»Überall. Aber es ist schließlich seine Werkstatt.«
Man müsste Abdrücke auf dem Opfer finden. Oder auf den Klingen, mit denen die junge Frau verstümmelt wurde. Auch der Benzinkanister kam infrage, mit dessen Inhalt das Baby verbrannt wurde. Vielleicht gab es Hautfetzen unter den Fingernägeln des Opfers. Sie brauchten irgendwelches organisches Material, das den Garagenbesitzer mit seiner Beute in Verbindung brachte.
»Schick mir einfach die Befunde per Mail.«
»Das darf ich nicht.«
»Das ist mein Fall, kapiert?«
Zacchary nickte. Passan wusste, dass sie es tun würde. Acht Jahre Zusammenarbeit, ein oder zwei durchgeflirtete Nächte und eine sexuelle Anziehungskraft, die nie ganz erloschen war, mussten schließlich zu etwas gut sein.
Als er wieder ging, fühlte er sich alles andere als erleichtert. Draußen war es ebenso scheußlich wie drinnen. Es regnete wieder stärker. An der Absperrkette der Bereitschaftspolizei wurde übel gerempelt. Diese Sache würde sicher nicht gut ausgehen. Das einzig Gute war, dass wie durch ein Wunder die Medien noch nicht aufgetaucht waren und man weit und breit weder einen Fotografen noch eine Kamera sah.
Als Passan um seinen Wagen herumging und eben einsteigen wollte, sah er, wie eine Trage vor einem wartenden Krankenwagen abgesetzt wurde. Patrick Guillard lag unter einer silbern glänzenden Überlebensdecke und trug eine Halskrause und eine Sauerstoffmaske. Die Plastikhülle über seinem Gesicht verzerrte seine Züge und zeigte sein wahres Gesicht – die Fratze eines kahlen weißen Monsters.
Vorsichtig schoben die Sanitäter die Trage in den Krankenwagen. Das Blaulicht spiegelte sich in der silbrigen Decke. Passan hatte den Eindruck, der Schinder krieche aus einem mit türkisfarbenen Pailletten besetzten Kokon.
Ihre Blicke kreuzten sich.
Und das, was Passan in Guillards Augen entdeckte, machte ihm klar, dass er diesen Krieg noch lange nicht gewonnen hatte.
Vielleicht noch nicht einmal diese Schlacht.
3
Eine Stunde später stand Olivier Passan unter der Dusche in seinen neuen Büroräumen und schloss genüsslich die Augen. Das Wasser schien eine gewisse Macht zu besitzen: Es entfernte nicht nur Schweiß und Schmutz, sondern auch den Geruch verbrannten Fleisches, die Erinnerung an gemarterte Körper und die Gräuel von Tod und Zerstörung, die ihn immer noch verfolgten. Er neigte den Kopf unter dem kühlen, fast kalten Duschstrahl, der auf sein Haar prasselte und seine Haut so intensiv massierte, dass sie ganz rot wurde.
Als er sich abtrocknete, fühlte er sich neu belebt. Die Räumlichkeiten der nagelneuen Direktion der Kriminalpolizei in der Rue Trois-Fontanot in Nanterre taten ein Übriges dazu. Im Gegensatz zu dem altmodischen, düsteren Labyrinth am Quai des Orfèvres war hier alles Hightech, weitläufig und nüchtern. Einige Einheiten waren bis zum Beginn der Erweiterungsarbeiten in der Zentrale nach Nanterre ausgelagert worden. Allerdings gab es inzwischen Gerüchte, dass alle in Bälde wieder zurückbeordert würden, weil es für die Umbaumaßnahmen an Geld fehle.
Passan betrachtete sich im Spiegel über dem Waschbecken. Mit seinem ausgemergelten Gesicht, dem eckigen Kinn und dem Bürstenhaarschnitt sah er eher wie ein Soldat als wie ein Polizist aus. Seine Züge waren fein und regelmäßig, die Brust wirkte dank vieler im Sportstudio verbrachter Stunden muskulös und wie in Stein gehauen. Passan ging nicht aus Gesundheitsbewusstsein oder Eitelkeit zum Sport, sondern um sich zu beweisen, dass er seinen Willen unter Kontrolle hatte.
Er kehrte zu den Umkleidekabinen zurück, zog die schmutzigen Kleider wieder an und nahm den Aufzug in die zweite Etage. Hier wie überall im Gebäude beherrschten Stahlkonstruktionen, Glaswände und grauer Teppichboden das Interieur. Passan gefiel diese kühle, etwas monotone Ausstattung.
Fifi, ebenfalls frisch geduscht und gekämmt, machte sich an der Kaffeemaschine zu schaffen.
»Funktioniert sie nicht?«
Der Punker versetzte dem Gerät einen heftigen Tritt.
»Jetzt schon.«
Er griff nach dem dampfenden Kaffeebecher, reichte ihn seinem Chef und gab den nächsten auf die gleiche Weise in Auftrag. Unter dem nassen Haarwust sahen seine Aknenarben noch wüster aus.
Schweigend genossen sie ihren Kaffee. Mit einem einzigen Blick hatten sie sich darauf verständigt, nicht über das eben Erlebte zu sprechen. Bloß kein Druck! Und so schwiegen sie sich an. Abgesehen von ihrer Arbeit gab es für sie nur ein gemeinsames Thema: die Probleme in ihrem Privatleben.
Schließlich war es Fifi, der den ersten Schritt wagte.
»Wie läuft es mit Naoko?«
»Wir lassen uns scheiden. Beschlossene Sache.«
»Und eure Bude? Verkauft ihr die?«
»Auf gar keinen Fall. Zumindest nicht jetzt. Wir behalten sie.«
Fifi wiegte zweifelnd den Kopf. Er wusste, dass die Konjunktur des Immobilienmarkts nichts mit Passans Entschluss zu tun hatte.
»Und wer von euch wohnt dann dort?«, wollte er wissen.
»Beide. Abwechselnd.«
»Wie soll das denn funktionieren?«
Passan zerknüllte seinen Plastikbecher und warf ihn in den Mülleimer.
»Na ja, jeder wohnt eine Woche im Haus.«
»Und die Kinder?«
»Die bleiben, wo sie sind. Sie brauchen nicht einmal die Schule zu wechseln. Wir haben uns überlegt, dass es für die beiden so das Beste ist.«
Fifi schwieg. Er schien an der Lösung zu zweifeln.
»Heutzutage wird so etwas oft gemacht«, fügte Passan hinzu, als wolle er sich selbst überzeugen. »Es ist eine gängige Lösung.«
Fifi entledigte sich ebenfalls seines Bechers.
»Ich halte das für eine ziemlich blöde Idee. Es wird noch so weit kommen, dass die beiden euch in ihrem Haus empfangen. Ihr werdet so etwas wie Touristen unter eurem eigenen Dach sein.«
Passan zuckte zusammen. Seit Wochen schon dachte er über diese Entscheidung nach und versuchte sich einzureden, dass sie für alle Beteiligten die beste Lösung war. Mögliche Einwände ließ er einfach außen vor.
»Entweder so, oder ich wohne einfach weiter in meinem Keller.«
Seit einem halben Jahr hauste er im Untergeschoss der Villa. Die Kellerfenster gingen auf den Garten hinaus, und er versteckte sich dort wie in einem Bunker.
»Und dann?«, fragte Fifi. »Willst du etwa deine Weiber mit nach Hause nehmen? Damit Naoko ihre Höschen im Bett findet? Wird sie in dem Bett dann überhaupt noch schlafen wollen?«
»Wir fangen heute Abend mit dem abwechselnden Wohnen an«, sagte Passan, um die Diskussion abzukürzen. »Naoko übernimmt diese Woche. Und ich verziehe mich in das Appartement, das ich in Puteaux gemietet habe.«
Der Punker schüttelte skeptisch den Kopf.
»Und was ist mit dir und Aurélie?«, konterte Passan.
Fifi lachte und drückte erneut auf den Kaffeeknopf.
»Vorgestern ist sie beim Vögeln glatt eingeschlafen.«
Er griff nach dem Becher und pustete auf die heiße Brühe.
»Das ist doch sicher ein gutes Zeichen, oder?«
Beide mussten lachen. Alles war besser, als sich an die Spur des Entsetzens zu erinnern, die der Geburtshelfer hinter sich gelassen hatte.
4
Zerstreut lauschte Passan den Nachrichten im Radio. Er war auf dem Weg nach Suresnes, wo er die letzten Stunden vor seinem Umzug nach Puteaux verbringen würde. Er wusste noch nicht genau, ob er schlafen, Umzugskisten packen oder seinen Bericht schreiben würde. Was die Schlagzeilen anging, war dieser Montag, der 20. Juni 2011, nicht unbedingt bemerkenswert. Es gab eine einzige Nachricht, die Passans Aufmerksamkeit erregte: Ein geschiedener Mann war in den Hungerstreik getreten, um gegen den von seiner Ehefrau geforderten Unterhalt zu protestieren. Bei dieser Vorstellung musste er unwillkürlich lächeln.
Mit Naoko würde es diese Art Problem gar nicht erst geben. Sie hatten sich auf einen gemeinsamen Anwalt, gemeinsames Sorgerecht und keine Abfindung geeinigt. Naoko verdiente deutlich mehr als er. Es gab nur einen Besitz, der aufgeteilt werden musste. Die Villa.
Passan fädelte sich auf dem Quai de Dion-Bouton in Richtung der Brücke von Suresnes ein. Zwar war ihm kalt, aber er weigerte sich, die Heizung einzuschalten. Immerhin war es Juni, zum Teufel! Das Wetter ging ihm auf die Nerven – diese nicht enden wollende, graue und feuchte Kühle, die so gar nichts mit einem schönen Frühsommer zu tun hatte und seinem Rücken zu schaffen machte!
Von Nanterre aus hätte er den Mont-Valérien auch über Stadtstraßen erreichen können, aber er brauchte jetzt Weite. Himmel und Fluss unter der aufgehenden Sonne. In Wirklichkeit allerdings sah er nicht viel davon. Ein Stück weiter unten zu seiner Linken lag die Seine, die Bäume rechts verbargen die Stadt, und der Himmel über ihm war grau und nass wie ein voller Schwamm. Er hätte sich überall und nirgends befinden können.
Plötzlich kehrte die Erinnerung daran zurück, wie er den Fuß auf Guillards Brust gepresst hatte und bereit gewesen war, seinen Kopf von einem Sattelschlepper zermalmen zu lassen. Eines Tages würde man vielleicht die Tür einer Gefängniszelle schließen, und er befände sich nicht auf der richtigen Seite. Seine Scheidung war einer der letzten Vorgänge, die ihm noch eine normale Existenz vorgaukelten – und dabei ging es um eine Trennung.
Er ordnete sich rechts ein, fuhr den Boulevard Henri-Seller entlang und bog in die Avenue Charles-de-Gaulle in Richtung des Mont-Valérien ab. Je höher er kam, desto vertrauter wurde die Umgebung. Häuser, die sich an den Hang schmiegten. Mit Efeu bewachsene Mauern. Cafés, die allmählich öffneten.
Passan hielt vor einer Bäckerei, die bereits hell erleuchtet war, und kaufte Croissants, ein Baguette und zwei Chupa Chups. Wieder überkam ihn ein Gefühl von Unwirklichkeit. Welchen Zusammenhang gab es zwischen den harmlosen Abläufen hier und dem Albtraum von Stains? Konnte er sich einfach so mit einem Fingerschnipsen wieder in die normale Welt einfügen?
Er stieg wieder in sein Auto. Es ging weiter bergauf. Die Kuppe des Mont-Valérien erinnerte mit ihren weiten Rasenflächen an einen Golfplatz. Hier herrschte die Atmosphäre eines Hochplateaus. Symmetrische Linien, keine Erhebungen. Es gab ein Klärwerk samt einer sauberen, gepflegten Kanalisation, das Stadion Jean-Moulin mit seinen schnurgeraden Aschenbahnen, den amerikanischen Soldatenfriedhof mit endlosen Reihen weißer Kreuze.
Obwohl es nur sehr langsam hell wurde, war der Blick auf Paris beeindruckend. Es war vor allem die Entfernung, die Passan beruhigte. Nach und nach erloschen die Straßenlaternen. Die Ansammlung von Häusern und Wohntürmen, die dort unten verschwommen aus dem Regendunst ragten, dienten als Kulisse für das tragische Schauspiel eines primitiven Krieges. Ein Tal der Gewalt. Hier oben auf der Höhe fühlte Passan sich unverwundbar. Er war in seinem Refugium angekommen. In seiner Einsiedelei.
Vor dem Tor in der Rue Cluseret verlangsamte er die Fahrt und betätigte die Fernbedienung. Die Einfahrt in das Grundstück war immer wieder berauschend. Zunächst sah man nichts als einen weißen Klotz auf grünem Grund. Gemessen am Grundstücksdurchschnitt des Viertels hatte Passans Garten mit fast zweitausend Quadratmetern Rasen geradezu riesenhafte Ausmaße. Die Pflege war aufwendig, lohnte sich aber.
Ganz bewusst hatte er so gut wie nichts gepflanzt, sondern lediglich links im Schatten einiger Pinien einen kleinen Zen-Garten angelegt. Er lenkte den Wagen nach rechts und zog den Schlüssel. Die Villa besaß keine Garage, und er hatte die Stimmigkeit der Architektur nicht beeinträchtigen wollen. Das Gebäude stammte aus den 1920er-Jahren, war im Bauhausstil gehalten und hatte die Form eines Parallelepipeds mit Flachdach. Der Dachstuhl bestand aus Stahl. Pfeiler aus Eisenbeton stützten eine offene Galerie. Viele Fenster reihten sich aneinander. Das ganze Haus wirkte nüchtern, solide und funktional. Passan lächelte stolz.
Mit den Croissants in der Hand schloss er die Eingangstür auf und betrat den Windfang. Als er die Jacken von Shinji und Hiroki an der Garderobe hängen sah, ließ er in jede Tasche einen Chupa Chup gleiten. Eine kleine Überraschung von Papa. Ehe er das Wohnzimmer betrat, zog er die Schuhe aus.
Die Villa war vor allen Dingen ein Schnäppchen gewesen. Nach dem Tod von Jean-Paul Queyrau, dem letzten Nachkommen einer Familie von Kunsthändlern, wurde die Villa im März 2005 versteigert. Passan war einer der Ersten gewesen, die davon erfuhren, und zwar aus einem recht einfachen Grund: Er hatte als Kriminalbeamter nach dem Tod Queyraus ermittelt. Der hoch verschuldete Mann hatte seinem Leben mit einer Kugel ein Ende gesetzt.
Während seines Einsatzes hatte Passan sich in die Villa verliebt. Jedes einzelne Zimmer hatte er begutachtet, ohne sich an der Baufälligkeit des Ganzen zu stören. Der Erbe war in seinen letzten Jahren zum Penner geworden, der mehr schlecht als recht in seinen eigenen vier Wänden hauste. Passan hatte sich vorgestellt, was er aus diesen Räumen machen könnte.
Es war Naoko, die den Kauf schließlich ermöglicht hatte. Sie arbeitete damals seit einem Jahr bei einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen, besaß Ersparnisse aus ihrer Zeit als Model, und ihre Eltern, die in Tokio Grundbesitz hatten, gaben den Rest dazu. Obwohl sie zum Erwerb der Villa deutlich mehr beigesteuert hatte als Passan, gehörte das Gebäude laut Notarvertrag ihnen beiden jeweils zur Hälfte. Im Gegenzug hatte Passan sich bereit erklärt, den größten Teil der anfallenden Arbeiten zu übernehmen.
Und daran hatte er sich gehalten. Für ihn war es eine Arbeit, die sozusagen die Fundamente seines Heims sicherte. Das Haus sollte Naokos und seine Liebe vor Angriffen von außen und vor Verschleiß und Eintönigkeit schützen. Leider hatte die Methode nicht funktioniert. Zwar hatte die Villa standgehalten, es aber nicht geschafft, Naoko und ihn zu behüten.
Passan ging in die Küche. Plötzlich wurde er so heftig angerempelt, dass er beinahe gestrauchelt wäre. Es war Diego, der ihn überschwänglich begrüßte. Diego, ein riesenhafter, grauer Pyrenäenberghund, hätte sich auf einer Weide bei einer Schafherde sicher wohler gefühlt. Als Naoko plante, einen Hund anzuschaffen, hatte Passan zunächst widersprochen. Ein Familienhund – das kam ihm so unendlich spießig vor. Aber inzwischen war Diego das Einzige in diesem Haus, worüber immer Einigkeit herrschte.
»Leise, Diego«, flüsterte Passan. »Du weckst noch alle auf.«
Er legte die Croissants in ein Brotkörbchen und das Baguette deutlich sichtbar auf den Tisch. Dann breitete er die karierten Sets aus und holte die Schüsseln der Kinder mit ihren in japanischer Schrift kalligrafierten Vornamen und die Tasse aus dem Schrank, aus der Naoko morgens ihren Tee mit Milch trank. Konfitüre, Frühstücksflocken, Orangensaft. Die einsame Beschäftigung stimmte ihn nicht traurig, denn er frühstückte schon lange nicht mehr mit Naoko und den Kindern.
Als er die Küche verlassen wollte, streifte sein Blick unwillkürlich die an der Wand aufgehängten Fotos. Er schaltete das Licht ein. Ein Bild zeigte Naoko und ihn vor acht Jahren auf der Terrasse des Tempels Kiyomizu-dera oberhalb von Kyoto. Er selbst wirkte steif und lächelte gekünstelt, während Naoko mit der Professionalität eines Models ihre Schokoladenseite zur Schau stellte. Trotz der Pose war in diesem Foto das Glück zu spüren, das sie einte – die Achtung voreinander und der Stolz, zusammenzugehören.
Das nächste Bild war ein Familienfoto aus dem Jahr 2009, aufgenommen in Shibuya, einem der angesagten Viertel Tokios. Passan hatte den damals vierjährigen Hiroki auf dem Arm. Der Kleine trug eine Mütze in der Form des Waldgeistes Totoro, einer bekannten, von Miyazaki gestalteten Comic-Figur aus einem Animationsfilm. Auf Naokos Arm saß der sechsjährige Shinji, der mit seinen kleinen Fingern das v-förmige Siegeszeichen zeigte. Alle vier lachten, aber man spürte das Unbehagen und die Verkrampfung der Erwachsenen. Ermüdungserscheinungen und Frust waren so etwas wie Metastasen verrinnender Zeit.
Links von diesem Bild hing eines aus dem Jahr 2002. Es zeigte einen Strand in Okinawa, wo sie auf Hochzeitsreise gewesen waren. Passan hatte die Einzelheiten der Reise vergessen, aber noch immer sah er Naoko vor sich, wie sie am Flughafen aufgeregt ihre Karte zückte, auf der sie Flugmeilen eintragen lassen konnte. Naoko war ganz wild auf Ermäßigungskarten und geradezu süchtig nach Clubverkäufen. Bis heute erinnerte sich Passan daran, wie er sich damals geschworen hatte, für immer dieses naive Mädchen zu beschützen, das glaubte, sich gegen alle Eventualitäten absichern zu können.
Hatte er sein Versprechen gehalten?
Er knipste das Licht wieder aus, durchquerte das Wohnzimmer und stieg die Betontreppe hinunter.
Es war an der Zeit, in sein Souterrain zurückzukehren – in die unterirdischen Privatgemächer, die einer Ratte wie ihm gebührten.
5
Der Flur bestand aus weiß getünchten Ziegelsteinen. Links befanden sich ein Kellerraum und eine Waschküche mit Waschmaschine und Trockner. Rechts gab es eine Abstellkammer, in die er Wasser gelegt hatte, um ein eigenes Bad zu bekommen. Am Ende des Flurs befand sich der Raum, den er sich als Schlaf- und Arbeitszimmer eingerichtet hatte.
In der Waschküche entkleidete er sich, stopfte die schmutzigen Klamotten in die Waschmaschine und schaltete sie ein. Schon seit Monaten lebte er völlig autonom, aß am Schreibtisch aus der Bento-Box und schlief allein.
Nackt stand er vor der Waschmaschine und betrachtete seine blutbeschmierten Kleider, die im schaumigen Wasser herumgewirbelt wurden. Ein Gerät zum Zermalmen von Albträumen, fuhr es ihm durch den Sinn.
Aus einem Korb nahm er ein T-Shirt und eine Unterhose, die beide nach Weichspüler dufteten, zog sie an und ging weiter in sein Zimmer, einen zwanzig Quadratmeter großen, mit Kellerfenstern ausgestatteten Raum mit Betonwänden. Auf der einen Seite stand ein Feldbett, auf der anderen, unter den Fenstern, hatte Passan ein Brett über zwei Böcke gelegt. Außerdem gab es noch eine Werkbank, an der er seine Waffen zerlegte und daran herumbastelte. In gewisser Weise entsprach der Bunker seinem Charakter besser als die weitläufigen Räume oben im Haus. Hier konnte er sich verkriechen.
An den Wänden hatte Passan die Konterfeis seiner Idole aufgehängt. Da fanden sich Bilder des Schriftstellers Yukio Mishima, der 1970 im Alter von fünfundvierzig Jahren Harakiri begangen hatte, des Komponisten Rentaro Taki, der 1903 mit vierundzwanzig Jahren an Tuberkulose gestorben war, und des Regisseurs Akira Kurosawa, der neben Rashomon – Das Lustwäldchen noch viele weitere Meisterwerke gedreht hatte und nach dem Flop seines ersten Farbfilms Dodes’kaden – Menschen im Abseits 1971 einen Selbstmordversuch nur knapp überlebte. Nicht gerade eine sehr fröhliche Truppe.
Passan schaltete seinen mit Lautsprechern ausgestatteten iPod ein, minimierte die Lautstärke und lauschte der Ekloge für Koto und Orchester von Akira Ifukube, einem unglaublichen Werk, das in Frankreich vermutlich nur er allein manchmal hörte. Passan liebte japanische sinfonische Kompositionen des 20. Jahrhunderts, die im Westen überhaupt nicht und selbst in Japan nur wenig bekannt waren.
Zeit für einen Tee. In Tokio hatte Passan ein Gerät gekauft, das Wasser ständig auf einer Temperatur von neunzig Grad hielt. Er füllte seinen Teebecher und gab fünf Gramm Hojicha – gerösteten grünen Tee – hinzu. Während er die exakt dreißig Sekunden abwartete, die der Tee ziehen musste, zündete er ein Räucherstäbchen an und schwenkte es. Nie im Leben hätte er auf die glühende Spitze geblasen, denn für Buddhisten gilt der Mund als unrein.
Mit der Tasse in der Hand legte sich Passan auf sein Bett und schloss die Augen. Der Klang des Koto, einer Art horizontaler Harfe, war ein hartes, gleichzeitig melancholisches und bitteres Vibrato. Passan hatte den Eindruck, dass jeder Ton seine Nerven direkt berührte. Zwar sorgte die Musik für einen dicken Kloß in seiner Kehle, doch gleichzeitig spürte er tief in seiner Brust eine beruhigende Kraft. Ihm war, als würde sein Geist federleicht und als könne sein Herz plötzlich wieder aufatmen.
Japan.
Mit der Entdeckung des Landes hatte Passan auch sich selbst entdeckt. Schon die erste Reise hatte sogleich Ordnung in seine Existenz gebracht.
Passan war 1968 in Katmandu auf die Welt gekommen. Seine dem Chillum zugetanen Eltern hatten ihn im Rausch eines Trips zu Füßen eines Buddhas empfangen. Da sein Erzeuger zu viel Blut verkauft hatte, um sich Opium zu beschaffen, starb er ein Jahr später. Wenige Monate darauf verschwand seine Mutter, ohne eine Adresse zu hinterlassen. Die französische Botschaft in Nepal veranlasste seine Rückführung nach Frankreich und brachte ihn bei der Fürsorge unter.
Fünfzehn Jahre lang war er als Waisenkind in Heimen und bei Pflegefamilien aufgewachsen, hatte gütige Menschen und Ekelpakete kennengelernt und war sowohl guten als auch schlechten Einflüssen ausgesetzt. Die Schule hatte er abgebrochen. Er war auf die schiefe Bahn geraten, hatte Autos geklaut, Papiere gefälscht und Schutzgeld erpresst. Wie durch ein Wunder hatte er ohne größere Probleme mit der Polizei überlebt.
Mit zwanzig war er dann plötzlich aufgewacht. Er hatte die Vorstädte im Westen von Paris verlassen, mit seinem ergaunerten Geld ein Dienstbotenzimmer im 5. Arrondissement in der Rue Descartes gemietet und sich an der Sorbonne gleich um die Ecke für Jura eingeschrieben.
Drei Jahre lang hatte er sich auf seinen sieben Quadratmetern eingeschlossen, gebüffelt, von Hamburgern ernährt und seine Lektionen mit lauter Stimme und zur Decke gewandtem Gesicht auswendig gelernt. Außerdem hatte er sein Interesse an Kunst, Philosophie und klassischer Musik entdeckt. Diese Zeit wirkte wie eine Entziehungskur, und sein Geld ging dabei komplett drauf. Der Not gehorchend zog er in ein Studentenwohnheim um, wurde aber nie mehr rückfällig.
Nach dem Examen entschied er sich für die Polizeischule, weil er sich auf diese Weise Zügel anlegen konnte, ohne ganz auf den Kitzel der früheren Umgebung verzichten zu müssen – die Nacht, das Adrenalin und die gesellschaftlichen Randzonen.
Einer seiner Ersatzväter, ein Rentner, der früher bei Chausson in Gennevilliers gearbeitet hatte, sagte ihm einmal: »Ein Bulle ist eigentlich ein Gauner, der seinen Beruf verfehlt hat.« Wie wahr!
Passan hatte beschlossen, sein Scheitern in einen Erfolg umzuwandeln. Für seine Berufswahl gab es noch einen anderen Grund: Als Kriminalbeamter hatte er die Möglichkeit, seinem Land zu dienen, dem er etwas zu schulden glaubte. Immerhin hatte der französische Staat ihn gerettet, ernährt und aufgezogen.
Er absolvierte die achtzehnmonatige Ausbildung ohne Zwischenfälle und bekam in jedem Fach die Bestnote. Als es darum ging, sich für die weitere Laufbahn zu entscheiden, wählte er weder einen strategischen Posten im Innenministerium, noch eine vielversprechende Stelle in einer angesehenen Einheit, sondern bewarb sich um einen der im Ausland angebotenen Plätze als Verbindungsoffizier, Ausbilder oder im Nachrichtendienst. Passan, der bislang noch nie im Ausland gewesen war, nahm die Stelle an, die ihn am weitesten wegführte: die eines Assistenten des Verbindungsoffiziers in Tokio.
Mit der Landung in Narita veränderte sich sein Leben von Grund auf.
Japan wurde zur Wahlheimat seiner Erwartungen, seiner Wünsche und seiner Hoffnungen. Jeder Wesenszug der ihm völlig neuartigen Welt rief in ihm eine weitere, bis dahin oft unbewusste Neugier hervor.
Die Kultur erfüllte ihn mit ungeahntem Nachhall. Er fühlte sich zum Japaner geschaffen.
Von Anfang an idealisierte er das Land und vermischte Fiktion mit Realität. Er genoss die außerordentliche Höflichkeit, die Sauberkeit der Straßen, der öffentlichen Anlagen und der Toiletten ebenso wie die raffinierten Speisen. Auch die strengen protokollarischen Regeln waren ihm nicht unangenehm. Neben solchen Alltäglichkeiten lenkte er sein Augenmerk auf längst verschwundene Traditionen wie den Ehrenkodex der Samurai, eine gewisse Faszination für den Freitod und die Schönheit der Frauen in der Ukiyo-e-Malerei.
Alles andere blendete er aus. Den übertriebenen Materialismus, die Technikbesessenheit, die Abstumpfung eines Volkes, das zehn Stunden täglich arbeitete, und ein Gemeinwesen, in dem das Individuum keine Rolle spielte, wollte er nicht wahrhaben. Ebenso verschloss er sich der Ästhetik der Mangas, jener Leidenschaft für große, schwarze Augen, weil ihm selbst nur die Mandelaugen gefielen. Auch den allgemeinen Run auf technische Spielereien, die Pachinko-Hallen, die Sitcoms und die Videospiele, nahm er nicht wahr.
Was Passan vor allem leugnete, war die Dekadenz des Inselstaats. Seit seiner ersten Reise hatte sich die Lage ständig verschlechtert. Auch in Japan machte sich die Wirtschaftskrise bemerkbar. Das Land war chronisch verschuldet, und es gab kaum mehr Arbeitsplätze für Jugendliche. Passan jedoch suchte nach wie vor in den Straßen nach Figuren wie Toshiro Mifune, dem Schwert tragenden Lieblingsschauspieler Kurosawas, und übersah dabei die femininen Androgynen, die Manga-Freaks und die kleinen Angestellten, die in der U-Bahn schliefen. Ganze Generationen hatten nicht etwa die Kraft ihrer Vorfahren geerbt, sondern litten unter einer erdrückenden allgemeinen Müdigkeit. Japan war zu einer Gesellschaft geworden, die sich – infiziert von westlicher Dekadenz – entspannte.
Über die Jahre hinweg bewahrte sich Passan trotz seiner Ehe mit einer äußerst modernen Japanerin diesen Traum eines zeitlosen Japan, aus dem er Ruhe und Gleichgewicht schöpfte. Seltsamerweise hatte er sich nie mit japanischer Kampfkunst beschäftigt, sondern hielt sich lieber an die Verteidigungstechniken, die er auf der Polizeischule gelernt hatte. Auch die Methoden der Zen-Meditation hatte er nie begriffen, sondern sich lediglich eine Welt aus Disziplin und Ästhetik geschaffen, die ihm half, seinen Beruf auszuhalten. Für ihn war Japan eine Art gelobtes Land, wo er sich niederlassen wollte, wenn alle Stricke reißen sollten. Und wenn er nach einer Nacht wie der in Stains Ruhe finden wollte, gab es wenigstens noch die Ekloge von Ifukube und den melancholischen Blick Rentaro Takis.
Bei diesem Gedanken öffnete Passan die Augen und suchte neben seinem Bett nach der Haiku-Sammlung. Beim Durchblättern stieß er auf die Worte, die er jetzt brauchte.
Im Mondschein
Verlass ich mein Boot,
Um in den Himmel einzutauchen.
Auf der Suche nach einem weiteren Gedicht blätterte er noch eine Seite um, doch im nächsten Augenblick war er eingeschlafen.
6
Ungekämmt, zerknittert und noch nicht ganz wach stand Naoko auf der Schwelle zu Passans Räuberhöhle und beobachtete ihren Mann. Was sie sah, war ein Wrack. Allerdings nicht etwa in seiner Eigenschaft als Mann und schon gar nicht als Polizist – Passan war für sie der beste Polizist der Welt –, sondern das Wrack eines Ehemannes. Auf diesem Gebiet hatte er kläglich versagt. Sie konnte ihm deshalb nicht einmal böse sein, denn sie hatte ebenfalls einen Punkt erreicht, von dem aus es kein Zurück mehr gab.
Immer wieder fragte sie sich, wie es überhaupt so weit hatte kommen können. Das ehemals strahlende Licht war erloschen. Ihre Liebe war verblichen wie Sonnenbräune im Winter, ohne dass sie es bemerkt hatten. Aber woher kam dieser dumpfe Hass, diese irritierende Gleichgültigkeit? Möglicherweise lag es an der Sexualität. Oder besser gesagt: an deren Mangel.
Junge Mädchen in Tokio flüsterten sich gern eine magische Zahl zu. Es gab eine berühmte Umfrage, laut der die Franzosen ausnahmslos mindestens drei- bis viermal in der Woche miteinander schliefen. Eine derartige Frequenz rief bei Japanerinnen, die sich mit der matten Libido ihrer Männer abfinden mussten, neidvolle Begeisterung hervor. Sie hielten Frankreich für ein Eldorado der Romantik und ein erotisches Paradies.
Vor ihrer Übersiedlung nach Paris wusste Naoko noch nicht, wie eitel die Franzosen sein können. Inzwischen aber kannte sie sie nur allzu gut und konnte sich deutlich vorstellen, wie sie sich mit anzüglichem Schmunzeln ihrer imaginären Eroberungen rühmten.
Es war jetzt mindestens zwei Jahre her, dass Passan sie das letzte Mal berührt hatte. So lange war zwischen ihnen nichts mehr geschehen. Mattigkeit wurde zu Gereiztheit, dann zu Hass und schließlich zu einer Art asexueller Distanz, wie sie häufig zwischen Eheleuten vorkommt.
Ihre Freunde hatten dem Niedergang ungläubig zugeschaut. Olive und Naoko, das Traumpaar, die perfekte Liebesgeschichte, eine Verbindung über Grenzen hinweg. Sie galten als beispielhaft, erweckten manchmal den Neid der anderen, gaben aber auch Anlass zu Hoffnung. Doch dann hatten sich unerbittlich die ersten Makel gezeigt. Die Stimmen wurden lauter, man machte sich Vorwürfe, man war abwesend. Und schließlich mussten sie zugeben, dass es nicht mehr ging und dass sie über eine Scheidung nachdachten.
In ihrem Umfeld schob man den Schiffbruch auf die kulturellen Unterschiede. Dabei stimmte eigentlich das genaue Gegenteil: Die Unterschiede waren nicht groß genug gewesen, um sie vor der Langeweile zu bewahren.
Naoko hatte die Entwicklung der Katastrophe verfolgt wie eine Wissenschaftlerin. Über jede Etappe und jedes Detail hatte sie Buch geführt. Als sie sich kennenlernten, hatte sich Passan ihr zugewandt wie eine Sonnenblume der Sonne. Damals war sie sein Herzblut und sein Lebenslicht gewesen. Ihr Stolz kannte keine Grenzen, ihre Zufriedenheit ließ sie aufblühen. Später jedoch begann er, seinen Bedarf anders zu decken. Vielleicht auch nur in sich selbst. Er hatte zu seinem, wie er sich ausdrückte, Grundkonzept zurückgefunden – seiner Polizeiarbeit, seinem Patriotismus und später seinen Kindern. Aber auch, und das wusste Naoko, zu seinen Lastern, der Nacht und der Gewalt. In dieser schwarz-weißen Welt, die nur aus Siegern und Besiegten, aus Verbündeten und Feinden bestand, war kein Platz für sie.
Sie hatte geglaubt, nicht mehr tiefer sinken zu können. Aber sie täuschte sich. Im Lauf der Zeit wurde sie für ihren Ehemann zum Hindernis, zum Hemmnis für seine Freiheit. Was aber hätte er mit seiner Freiheit gemacht? War er nicht schon längst frei? Hätte sie ihn mit diesem Problem konfrontiert, hätte er vermutlich keine Antwort gewusst. Er selbst stellte sich solche Fragen nicht. Er lehnte es sogar ab, das Scheitern ihrer Beziehung zuzugeben, indem er sich weiterhin auf seinen Job und seine Arbeiten im Haus konzentrierte und seine Sorge um die Kinder fast etwas Zwanghaftes bekam. Er tat es mit zusammengebissenen Zähnen, ohne die Notrufe ihres Körpers wahrzunehmen. Ihr gegenüber gab er sich gereizt und manchmal sogar feindlich.
Im Gegenzug war auch sie unnahbar geworden, denn Liebe ernährt sich aus den Gefühlen des anderen. Ohne Übung vertrocknet das Herz. Man verlernt die Fähigkeit des Teilens, und irgendwann schützt man sich, indem man sich in die Einsamkeit zurückzieht.
Lautlos glitt Naoko in Passans Zimmer. Sie hatte ihn immer auf japanische Art bei seinem Familiennamen genannt. Sie zog die Vorhänge auf, schaltete die Musik aus und räumte das Buch fort. Ihren Ehemann beachtete sie dabei nicht – sie handelte lediglich als Hausfrau.
Als sie wieder nach oben ging und die Küche betrat, erblickte sie die Croissants im Brotkörbchen und den gedeckten Tisch. Unwillkürlich musste sie lächeln. Der Mörderjäger, der selbst schon getötet hatte, war manchmal auch ein Schutzengel.
Sie machte sich einen Kaffee und betrachtete zerstreut die Fotos an der Wand. Wie oft schon hatte sie sie gesehen? Heute nahm sie sie nicht einmal wahr. Vor ihren Augen zeichnete sich etwas ganz anderes ab.
Ihr einsames Schicksal. Ihre heimliche Suche.
Denn Naoko war immer allein gewesen.
7
Naoko Akutagawa war im Zeichen des Hasen geboren und hatte die ganz normale Hölle aller japanischen Kinder durchgestanden. Eine extrem strenge Erziehung: Schläge mit dem Gürtel, eisige Duschen sowie Schlaf- und Nahrungsentzug. Der reinste Horror.
Ihr Vater war Jahrgang 1944 und hatte die gleiche Behandlung erfahren. In Europa hätten manche warnend darauf hingewiesen, dass Gewalt sich fortsetzt und dass ein Kind, das geschlagen wird, später selbst oft seinen Nachwuchs verprügelt. In Japan hingegen ging man schlicht davon aus, dass eine Ohrfeige manchmal Wunder wirkt. Naokos Vater, ein berühmter Geschichtsprofessor in Tokio, war das lebende Beispiel für diese These.
Zum Albtraum des häuslichen Lebens kam derjenige der Schule. Man erwartete von Naoko nicht nur, dass sie Jahrgangsbeste im Gymnasium war; sie musste sich auch gleichzeitig auf die Aufnahme in die Universität vorbereiten – zwei Dinge, die nichts miteinander zu tun hatten. Neben dem täglichen Lernen für die Schule belegte Naoko Abend-, Wochenend- und Ferienkurse. Jedes Vierteljahr erfolgte die landesweite Einstufung. Dann erfuhr sie, dass sie auf Platz 3220 der Liste stand und somit für bestimmte Universitäten gar nicht erst infrage kam, was nicht gerade einen Motivationsschub bedeutete.
Aber Naoko ließ sich nicht entmutigen. Sie arbeitete wie ein Pferd, ohne sich je einen Tag Ferien oder auch nur eine Stunde Freizeit zu gönnen. Immerhin hatte sie sich obendrein auch noch mit Kampfkunst, Kalligrafie, klassischem Tanz und häuslichen Arbeiten in der Schule zu beschäftigen. Außerdem musste sie Kanji lernen, die alten, aus China stammenden Schriftzeichen, die mehrere Bedeutungen besitzen und jeweils unterschiedlich ausgesprochen werden.
Naoko perfektionierte sich mit eiserner Selbstdisziplin – sowohl geistig als auch körperlich.
Gleichzeitig – und das ist eines der Paradoxa Japans – wurde Naoko von ihrer Mutter geradezu verhätschelt. Bis zum Alter von acht Jahren schlief sie mit ihr zusammen. Noch mit fünfzehn weigerte sie sich, eine Nacht außerhalb des Elternhauses zu verbringen, und mit achtzehn hätte sie keine Entscheidung ohne die Zustimmung von mama-san getroffen.
Nach dem Abschluss in einem protestantischen Privatgymnasium in Yokohama schrieb sich Naoko an einer guten Universität in der gleichen Stadt ein. Sie war so viele Jahre täglich von Tokio nach Yokohama gefahren, dass es ihr vorkam, als hätte sie diese Reise längst im Blut – ein genetischer Fingerabdruck, den ihre Kinder eines Tages erben würden und in dem die Namen der Bahnhöfe die Chromosomen ersetzten.
Ihr Notendurchschnitt reichte nicht für ein Medizinstudium, aber Naoko war eigensinnig genug, um Jura abzulehnen – eine Fachrichtung, die ihr Vater befürwortet hätte. Stattdessen entschied sie sich für eine mehrgleisige Ausbildung: Ökonomie, Sprachen und Kunstgeschichte.
Im Jahr 1995 nahm ihr Leben eine ungeahnte Wende. Ein Fotograf sprach sie in der U-Bahn an und wollte Testfotos von ihr machen. Naoko konnte es kaum fassen. Sie war zwanzig Jahre alt, aber noch nie hatte jemand ihre Schönheit erwähnt. Japanische Eltern wären nicht im Traum auf die Idee gekommen, ihrem Kind Komplimente wegen seines Aussehens zu machen. Naoko war wirklich schön. Und nach dem ersten Shooting bekam sie es jeden Tag aufs Neue bestätigt. Bereits bei den ersten Castings verbuchte sie Erfolge und verdiente plötzlich Summen, die ihr unermesslich vorkamen. Trotzdem sagte sie ihren Eltern nichts, sondern widmete sich weiter ihrem Studium. Das Geld legte sie heimlich beiseite. Mit dem Ersparten wollte sie eines Tages dem strengen Vater entkommen. Fliehen, und zwar für immer.
Schnell begriff sie, dass ihre Karriereaussichten als Model im Ausland besser waren, denn ihr Äußeres entsprach nicht den japanischen Kriterien. Den Japanern gefielen Eurasierinnen ohne Lidfalte – Mädchen, die zwar aus dem Land der aufgehenden Sonne stammten, aber einen kleinen Hauch Exotik versprühten.
Mit dreiundzwanzig hatte Naoko ihre Abschlüsse in der Tasche und brach auf – zunächst nach Amerika, dann nach Europa. Sie arbeitete in Deutschland, Italien und Frankreich, wo man ihr perfektes Äußeres zu schätzen wusste. Mit ihrem glatten schwarzen Haar, den hohen Wangenknochen und der kurzen, ganz leicht gebogenen Nase stellte sie genau die Art Japanerin dar, von der Europäer träumten.
Was ihre Augen anging, so erklärte ein Mailänder Fotograf eines Tages, sie seien wie mit einem weichen Pinselschwung gemalt und trotzdem grausam und hart wie ein Messer.
Zwar verstand sie nicht ganz, was er damit meinte, aber es war ihr auch egal. Die Aufträge häuften sich, und der Rubel rollte. Aus rein beruflichen Gründen ließ sie sich schließlich in Paris nieder und verwirklichte dabei einen Lebenstraum – allerdings nicht ihren eigenen, sondern den ihrer Mutter. Oka-san war ihr Leben lang ausgesprochen frankophil gewesen, sah sich am liebsten Filme der Nouvelle Vague an, hörte Adamo und las Flaubert und Balzac. Naoko hatte als Kind ihre Hausaufgaben zu den Klängen von Adamos »Tombe la neige« gemacht, mindestens zwanzigmal Die Verachtung von Jean-Luc Godard mit ihrer Mutter ansehen müssen und konnte Apollinaires »Le Pont Mirabeau« Wort für Wort auswendig rezitieren.
Der Kontrast zwischen dem von ihrer Mutter idealisierten Paris und der feindseligen Stadt, in der sie nun lebte, war erschreckend. Sie erkannte nichts wieder, verirrte sich in schmutzigen Straßen und wurde von Taxifahrern abgezockt. Vor allen Dingen aber schockierte sie die Arroganz der Franzosen. Sie machten sich offen über ihren Akzent lustig, halfen ihr nie und fielen ihr laut und unbeherrscht ins Wort – vor allem wenn sie gegen etwas waren. Und Franzosen sind immer gegen irgendetwas.
Im Krankenhaus Sainte-Anne gibt es eine Abteilung, die sich auf Paris shokogun – das Paris-Syndrom – spezialisiert hat. Jedes Jahr fühlen sich etwa hundert Japaner derart enttäuscht von der Stadt, dass sie eine Depression oder eine Paranoia entwickeln. Sie werden in die Klinik eingeliefert, behandelt und nach Hause zurückgebracht. So weit kam es bei Naoko allerdings nie. Dank ihres Vaters hatte sie früh gelernt, mit Widrigkeiten fertigzuwerden, und außerdem lebte sie nicht aus romantischen Gründen in Paris.
Nach zwei Jahren, als ihr Französisch akzeptabel geworden war, hängte sie den ungeliebten Job als Model an den Nagel und widmete sich ihrer eigentlichen Berufung: den Zahlen, denen ihre Liebe gehörte. Zunächst arbeitete sie als Buchprüferin für japanische oder deutsche Firmen, um schließlich in eine große Gesellschaft namens ASSECO einzutreten. Damit war ihre Zukunft endlich gesichert.
Die einzige Schwierigkeit war und blieb der Sex. Naoko lehnte es ab, durch den Einsatz ihres Körpers zum Erfolg zu gelangen. Dieses Vorgehen kannte sie bereits zur Genüge aus der Modebranche, doch in der eher sachlich geprägten Umgebung von Buchprüfungen und Steuerexpertisen war es noch viel schlimmer. Mit ihrer hellen Gesichtshaut und den tintenschwarzen Haaren stellte sie ein Traumbild dar. Trotz ihrer Qualifikationen für den Job forderte ihr Arbeitgeber mehr von ihr. Manchmal lehnte sie rundweg ab, manchmal gab sie vor, auf ihn einzugehen, ohne allerdings nachzugeben. Die Spielchen erschöpften sie, und das Resultat ließ nicht lange auf sich warten. Als ihr Chef begriff, dass er nicht bekommen würde, was er von ihr wollte, kündigte er ihr.
Die ständige Anmache erstreckte sich auch auf andere Lebensbereiche. Eines Tages wurde ihr die Handtasche gestohlen, was in Japan so gut wie nie vorkommt. Naoko erstattete Anzeige. Zwar wurde ihre Gucci nie gefunden, aber anschließend hatte sie die größten Schwierigkeiten, den mit der Aufklärung betrauten Beamten wieder loszuwerden.
Alles änderte sich jedoch, als sie Passan kennenlernte.
Es war eine Liebe auf den ersten Blick, bei der wirklich alles stimmte. Schuld an dieser positiven Wende war Naokos drei Jahre älterer Bruder, der bereits in Paris lebte, als sie ankam. Shigeru, der mit fünfzehn Alkoholiker und mit siebzehn heroinabhängig gewesen war, hatte schon früh von einer Musikerkarriere in Europa geträumt. Nach einigen wilden Jahren in London landete er schließlich in Paris. Danach hörte seine Familie monatelang nichts mehr von ihm. 1997 tauchte er plötzlich clean, fröhlich und mit zehn Kilo mehr auf den Rippen wieder aus der Versenkung auf, sprach akzentfrei Französisch und arbeitete am Institut für orientalische Sprachen in Paris.
Naoko und Shigeru standen sich nie sehr nah. Ihre einzige Gemeinsamkeit waren die schlechten Erinnerungen an ihr Elternhaus. Niemand legt Wert auf den Kontakt mit Menschen, die wissen, wie man mit heruntergelassener Hose bei einer Tracht Prügel aussieht, oder die miterlebt haben, wie man schluchzend und bibbernd an einem Winterabend vor die Haustür verbannt wurde. Trotzdem meldete sich Naoko nach ihrer Ankunft in Paris bei ihrem Bruder. Er half ihr bei der Wohnungssuche, und manchmal gingen sie zusammen essen. Von Zeit zu Zeit holte Naoko ihren Bruder nach dessen Kursen in der Rue de Lille im 7. Arrondissement ab.
Bei einer dieser Gelegenheiten traf sie Passan. Der japanbegeisterte Kriminalbeamte war zweiunddreißig und nahm regelmäßig an Shigerus Sprachkursen teil. An einem 4. November gingen sie zum ersten Mal miteinander aus, und vom ersten Augenblick an war Naoko klar, dass der etwas ungehobelte Polizist genau der Mann war, nach dem sie immer gesucht hatte. Er tendierte weder zur Pseudoromantik der Franzosen, noch glich er den Muskelprotzen, die im Tokioter Viertel Shibuya ihr Unwesen trieben.
Durch die Bekanntschaft mit Passan lernte Naoko viel über sich selbst. Merkwürdigerweise gefiel ihr Passans Begeisterung für das traditionelle Japan. Sie selbst interessierte sich schon lange nicht mehr für die alten Geschichten von Samurai und ihrer Lebensphilosophie Bushidō, obwohl sie im Grunde bedauerte, dass diese Kultur mit dem wirtschaftlichen Aufschwung des Landes und der daraus resultierenden Blutleere seiner Bewohner versunken war.
Mit einem Mal jedoch fand sie alle diese Tugenden in einem robusten Franzosen wieder – einem Athleten mit tiefer Stimme und einem schlecht geschnittenen Anzug, dessen Nähte bei jedem Lachen zu platzen drohten. Auf seine Weise war Passan selbst ein Samurai. Ein Mann, der seinem Staat so treu ergeben war wie die historischen Krieger ihrem Shogun. Seine Worte und sein Wesen enthüllten ihr eine Geradlinigkeit und eine moralische Integrität, die sofort ihr Vertrauen weckten.
Wie lang war das alles her!