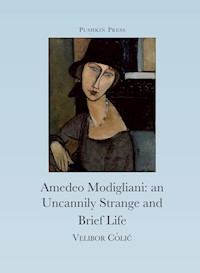16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tempo
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ohne Geld und ohne Freunde findet sich der Erzähler als Deserteur der bosnischen Armee in Rennes wieder. Er spricht drei Worte Französisch: Jean, Paul und Sartre und hat bereits drei Romane veröffentlicht – in einem Land, das es nicht mehr gibt. In Frankreich muss er einen Sprachkurs für Analphabeten besuchen. Zwischen afrikanischen Familien und russischen Exsoldaten lernt er die wichtigsten Überlebensstrategien, vor allem aber kämpft er darum, nicht als namenloser Flüchtling unter vielen zu verschwinden, sondern Schriftsteller zu bleiben. Er wird weiter schreiben, und zwar auf Französisch. Poetisch, tieftraurig und voller Witz erzählt Čolić von der existentiellen Erfahrung, sich seiner Heimat beraubt zu sehen und in der fremden Sprache eine neue Heimat zu finden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 176
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Velibor Čolić
Die Welt ist ein großer Flipper
Roman
Aus dem Französischen von Claudia Steinitz
TEMPO
Armut, Exil, aber Freiheit. Schlechte Wohnung, schlechtes Bett, schlechtes Essen.
Was macht es, wenn der Körper beengt ist, wenn nur der Geist die Weite hat!
Victor Hugo
Alles Unglück der Menschen kommt von der Hoffnung.
Albert Camus
1
Ich bin achtundzwanzig, ich komme in Rennes an, und mein einziges Gepäck sind drei Wörter Französisch – Jean, Paul und Sartre. Außerdem habe ich mein Soldatenheft, fünfzig Deutsche Mark, einen Kugelschreiber und eine große, abgewetzte Sporttasche, olivgrün, Made in Jugoslawien. Ihr Inhalt ist mager: ein Manuskript, ein paar Socken, ein unförmiges Seifenstück (sieht aus wie ein toter Frosch), ein Foto von Emily Dickinson, anderthalb Hemden (für mich ist ein kurzärmeliges nur ein halbes Hemd), ein Rosenkranz, zwei Postkarten von Zagreb (unbeschrieben) und eine Zahnbürste. Es ist Spätsommer, 1992, aber ich bin angezogen wie für eine Polarexpedition: zwei Jacken aus einer anderen Ära, ein langer Schal, an den Füßen meine ausgetretenen, tausendmal von Regen und Wind angefressenen Wildlederstiefel. Ich bin ein Leichtkavallerist, ein Reisender, das Gesicht versiegelt von metaphysischer Kälte, jenem höchsten Grad der Einsamkeit, der Erschöpfung und der Trauer. Ohne Gefühl, ohne Angst oder Scham.
Vor dem Bahnhof von Rennes stelle ich meine Tasche ab und betrachte lange mein neues Land.
Ich brabble eine Klage, dumm und kindisch, da ich doch weiß, dass die Wörter nichts auslöschen können, dass meine Sprache nichts mehr bedeutet, dass ich fern bin und dass dieses fern meine Heimat und mein Schicksal geworden ist. Ich habe das Gefühl, in einer Wasserwelt versunken zu sein, wo jede Regung, jede Bewegung und jedes Wort in beängstigender Stille erstickt. Wie ein Traum, aus dem man nicht erwacht, ein seltsames Ballett zweier Welten, die sich nicht berühren. Ich nehme meine Tasche und gehe hinaus auf die Straße. Ich gehe langsam, wie ein Sonntagsspaziergänger. Schließlich habe ich es nicht eilig. Unter weniger tragischen Umständen könnte ich mich frei fühlen, wie ein Vagabund. Nur dass ich hier einfach nach einem Park und einer Bank suche, um mich auszuruhen und endlich über meine erste Nacht in Rennes nachzudenken. Der schmale Parkweg unter meinen Füßen ist weiß, ich habe das Gefühl, auf Federn zu laufen. An diesem herrlichen Sommernachmittag ist der Weg gesäumt von den hübschen weißen Blumen, die man wegen ihrer Schönheit Queen Anns Spitzen nennt. Kaum habe ich mich hingesetzt, spüre ich, dass ein stahlschwerer Regen im Anzug ist. Kaum Wolken, der Himmel ist immer noch blau und gewöhnlich, der Wind schüchtern, aber ich spüre, dass der liebe Gott in seinem Topf eine kalte Dusche braut, um mich in dieser Stadt willkommen zu heißen. Der Parc des Tanneurs ist ruhig. Vor meinen Füßen zeichnen die langen Schatten der Bäume erstaunliche Arabesken, wie ein ganz zart bewegtes Gemälde, das sich gemächlich an meinen Augen vorbeischiebt. Für einen kurzen Moment versuche ich, ihnen eine logische Form zu geben. Ich suche den Allmächtigen da, wo er sein muss – in der Natur, als wäre auch der bärtige Alte entzückt von diesem Augenblick majestätischer Ruhe. Ich denke natürlich an den Tod. Aber wenig, so wenig wie möglich. Um nicht so große Angst davor zu haben, lerne ich schon seit Wochen, mit einer ganz einfachen, ganz unphilosophischen Vorstellung zu leben: Plötzlich hört alles auf, ist alles schwarz. Ist die Erinnerung aufgehoben. Ich stelle mir dieses Nichts als sanften Ort irgendwo zwischen dem Himmel und den Platanenblättern vor, die zart in der leichten Brise zittern. Ich rauche, und in dem Moment, der den ersten Regentropfen folgt, wird alles klar. Ich spüre die Parkbank nicht mehr, noch weniger die Wut oder die Traurigkeit. Die Tropfen fallen und machen Lärm wie eine marschierende Armee. Als zögen sie mühsam die Seelen der Gestorbenen hinter sich her. Sie zeichnen nasse Rosen auf den Asphalt und bilden viele kleine Pfützen, die aussehen wie Spiegel. Dann beginnt der Regen, mit leeren Konservendosen und Plastiktüten zu spielen. Er hat etwas Laszives, wie die Augen trunkener, von Schlaflosigkeit gepeinigter Frauen. Ich spüre die Angst nicht mehr, aber auch keinen Mut. Unter einen Baum geflüchtet, lausche ich dem Regen. Ernüchtert.
Ich bin Soldat. Ich kann den Geruch einer menschlichen Leiche von jedem anderen unterscheiden, ich weiß, dass die schlimmste Wunde die Bauchwunde ist und dass jeder Tote das ruhige und wächserne Gesicht des Fortgehens hat. In den Gräben trage ich keinen Helm. Ich zittere die ganze Zeit, ich übergebe mich heimlich, ich schreibe Nachrufe auf mein Land und trage eine bosnische Fahne auf meinem Ärmel. Meine Kameraden sagen: »Das ist ein guter Kroate, siehst du: Er ist für Bosnien.« Ich bin Soldat. Abends bin ich betrunken und singe mit meinen Kameraden unsere schönen traurigen Balladen, und ich träume, etwas anderes zu werden, egal was – eine Ameise, ein Baum, ein Vogel, eine Schlange. Ich träume, dass ich kein Mensch mehr bin. Vergeblich. Ich bin ein Soldat. Ich habe meine Kalaschnikow, meinen unnützen Körper, ein Buch von Emily Dickinson und ein sorgfältig in Großbuchstaben abgeschriebenes Gebet des heiligen Augustinus in meinem Kriegstagebuch.
Ich habe Angst. Ich mache meine acht Stunden im Graben mit einer unerträglichen, kalten Flamme im Bauch. Ich schieße auf einen unsichtbaren Feind, danach übergebe ich mich heimlich und träume mich fort von hier, egal wohin. Je verzweifelter meine Situation ist, desto zärtlicher werden meine Träume. Ich träume von Seide, die Frauenkörper umschmeichelt, ich träume vom Himmel und vom Meer, vom salzigen Morgen in Dubrovnik und vom Schnee, dem weißen Flaum meiner Kindheit, der ohne Ausnahme jedes Jahr zwischen zwei Weihnachten, dem katholischen und dem orthodoxen, großzügig unsere Hügel ziert. Ich träume von Zügen und vom Regen, von Küssen und von den hübschesten Mädchen meiner Schule.
Ich sehe mich einfach als Stein oder Baum in dieser Welt und dieser Zeit ohne Ende. Ich mache mich zum König der Ameisen und der Fliegen, ich bin der Kommandeur der Wolken: Jedes Mal, bevor ich in den Graben gehe, nehme ich ihnen die Parade ab und befehle ihnen, sofort unseren Himmel zu verlassen, um woanders ein ruhigeres und vernünftigeres Blau zu finden. Ich bin die perfekte Zielscheibe. Immer wieder sind mein Kopf, meine Beine oder mein Oberkörper für die serbischen Sniper sichtbar. Ich weiß nicht, warum niemand auf mich schießt. Wahrscheinlich ist es zu einfach. Ich bin keine begehrte Trophäe, mein Leben ist weniger wert als eine auf dem Schwarzmarkt gekaufte Gewehrkugel.
Ich weiß, dass ich für niemanden irgendetwas darstelle. Ich bin nicht mal mehr ein menschliches Wesen. Ich bin nur ein Schatten zwischen den Schatten.
Nach einer langen Reise durch das schlafende Europa komme ich nach Frankreich. Ich durchquere Kroatien, Slowenien, Österreich und das wiedervereinigte Deutschland. Ich durchquere das skandalöse Schweigen und die Gleichgültigkeit der Welt, die Sternennacht und den Morgentau, die kleinen Landstraßen und die langen Nebenstraßen der von Hitze aufgeweichten Autobahnen. Ich wirbele die Asche des Eisernen Vorhangs auf, immer noch deutlich an der Kleiderordnung und der Architektur zu erkennen. Ich weine hinter einer Tankstelle in Österreich, ich schluchze vor einer Backsteinmauer, unter einem Neonlicht, zu einer Melodie, die mir leise moonlight shadow, moonlight shadow zuflüstert, banal und hartnäckig, als wollte sie mich ein weiteres Mal daran erinnern, dass ich am Ende meines ersten Lebens angelangt bin. So, wie meine zweite Existenz beginnt, als Exilant, erwartet mich eine lange Zeit geheimer Emotionen. Eine harte, kalte, erwachsene Zeit.
Im Westen nichts Neues, sage ich mir, eine Grenze, dann eine andere. Polizei und Zoll, Zoll und Polizei.
Ich sitze auf der Parkbank in Rennes. Es regnet warmes Weihwasser auf die Stadt. Mir wird allmählich bewusst, dass ich der Flüchtling bin. Der Mann ohne Papiere und ohne Gesicht, ohne Gegenwart und ohne Zukunft. Der Mann mit schwerem Schritt und gebeugtem Körper, die Blume des Bösen, so flüchtig wie Blütenpollen und ebenso verstreut. Ich habe keinen Namen, bin nicht mehr groß oder klein, bin nicht mehr Sohn oder Bruder. Ich bin ein vom Vergessen durchnässter Hund in einer langen Nacht ohne Morgen, eine winzige Narbe im Gesicht der Welt.
Ich bin der Flüchtling.
Jetzt und morgen.
Hier oder anderswo.
Im Regen oder in der Sonne, im Sommer wie im Winter.
Vor den Männern und den Frauen.
Vor den Weisen und den Irren, den Bäumen und dem Gras.
In der Stadt wie auf dem Land.
Ich bin der Flüchtling.
Auf Erden wie im Himmel.
2
Vom ersten Tag meines Exils an bin ich überzeugt, Krebs zu haben: Kehlkopf- oder Lungenkrebs, Hirntumor oder eine besonders bösartige Krabbe in meinen Eingeweiden. Ich bin kein richtiger Hypochonder, ich glaube nur felsenfest, dass ich die Krankheiten meiner drei Lieblingskünstler des Tages habe. Am Morgen bin ich Modigliani und huste meine Tuberkulose heraus, am Nachmittag habe ich einen Lungenkrebs namens Raymond Carver und abends bin ich Alkoholiker, also Hemingway. Und so geht es weiter. Am nächsten Tag bin ich blind wie Borges, epileptisch wie Dostojewski und ständig betrunken wie Fitzgerald. Ich habe eine große Auswahl, die Literaturgeschichte gleicht einem Medizinlexikon.
Mein Manuskript ist ein echtes Manuskript, mit der Hand geschrieben. Auf engen Zeilen, um Platz zu sparen, liste ich meine Beobachtungen, meine Gedanken und meine Flüche auf. Ich bin zugleich Kriegsgegner und Friedensgegner, Humanist und Nihilist, Surrealist und Konformist, der Hemingway des Balkans und wahrscheinlich der größte jugoslawische Dichter unserer Zeit. Da ist nur ein Detail: Meine Texte sind viel schlechter als ich. Meine Weltanschauung ist universell, mein Schreiben nur eine endlose Aufzählung von Dingen und Menschen, die ich nie mehr sehen werde.
Oft besuchen mich in meinen Träumen eine Stadt und eine Frau, dann eine andere Sonne. Die Stadt in meinen Träumen ist eine eigenartige Mischung aus meinem Geburtsstädtchen, Sarajevo und Dubrovnik. Die Frau ist eine große Blonde, lasziv und sanft, ihr langes Haar schimmert orange. Die Sonne ist ein blasser, gequälter Stern, wie bei Lorca der Mond, Beschützer der Zigeuner, Diebe und Vagabunden.
Mein Problem ist das Aufwachen. Das Aufwachen ist immer niederschmetternd. Ich möchte in der Geografie des Südens bleiben, ich begehre die schöne Skandinavierin, ich will durch die vertrauten und beruhigenden Straßen meiner Jugend spazieren. Aber sobald ich die Grenze zwischen beiden Welten überschritten habe, finde ich mich im geschlossenen Universum meines dunklen und kalten Zimmers wieder. Ich bin traurig, ich bin wütend. Ich träume davon, mich in einen Bär im Winterschlaf, eine in Illusionen balsamierte Mumie zu verwandeln. Ich sehne mich danach, einer der Sieben Schläfer von Ephesus zu werden, versunken in dreihundertjährigem Schlaf. Ich möchte für immer der Bewohner meiner eigenen Träume bleiben, ein anderes, flüchtiges und leichtes Leben leben, ein Märchendasein ohne Schmerz. Und vor allem ohne Exil.
Die neue Welt um mich herum ist eckig und gefährlich. Ich erlebe sie wie einen großen Flipper. Ständig stoße ich mich, überall: an den Schienbeinen, den Hüften, den Schultern und meinem armen Kopf. Ständig steht ein Stuhl, eine Tischecke oder eine zu niedrige Tür in meinem Weg, und ich stoße mich daran. Ich pralle mit voller Wucht dagegen, ich blute. Ich habe das Gefühl, diese Folge kleiner Schmerzen bestätige mir, dass ich immer noch lebendig bin. Ich bin schlecht angepasst. Mein Frankreich besteht aus einem beschränkten Raum voll unheilvoller Dinge. Ich bin ein Elefant in einer Porzellanwelt, in der sich viele höfliche und geschmeidige Menschen mit bemerkenswerter Leichtigkeit zwischen den Fallen bewegen.
Unglaublich, seufze ich, wie sie es schaffen, auf so wenig Raum so viele Dinge unterzubringen. Noch besser als wir in Bosnien. Wir haben nur versucht, drei große Länder in einem kleinen zu errichten.
Zwei Wochen lang bin ich praktizierender Katholik. Ich treibe mich in der Cathédrale Saint-Pierre rum und gebe mein letztes Geld für Kerzen aus. Jeden Tag entzünde ich eine für die heilige Rita, die Schutzpatronin für aussichtslose Anliegen, für Miles Davis, den Fürsten der Engel, und für Christophorus, der die Reisenden schützt. Für Franz von Assisi, der mit den Vögeln sprach, Antonius von Padua, an den man sich wendet, um wiederzufinden, was man verloren hat, und manchmal für unsere teuren Toten. Aber ich höre bald damit auf. Wie viele Arme bin ich ein starker Raucher. Ich fange an, mir von dem Kerzengeld Zigaretten zu kaufen.
Und wenn ich nun anstelle einer Kerze eine Zigarette anzünde?, überlege ich. Meine Heiligen würden es sicher verstehen. Es ist schließlich Krieg.
Die Sonntagsmessen sind enttäuschend. Die Anbetung des Altars und die Lesung der Psalme, die Predigt des Priesters – das ist alles zu kompliziert, zu verschlüsselt. Ich kenne kein einziges Gebet. Ehrlich gesagt, kann ich den Anfang vom Vaterunser und vom Ave Maria, aber das reicht nicht, um von der Himmlischen Macht richtig verstanden zu werden. Umgeben von einigen ehrbaren Damen sitze ich hinten in der Kirche und warte auf ein Zeichen oder Wunder. Ich habe es wohl zu eilig, unser Schöpfer arbeitet für die Ewigkeit, und mein Schicksal ist vergänglich.
Der Priester in der Cathédrale Saint-Pierre ist Vietnamese. Ein ewig junger, rundlicher, weicher Mann, ein Michelin-Männchen des Evangeliums, das mit weicher, sanfter, fast weiblicher Stimme spricht. Er ist das genaue Gegenteil der langen Gesichter der Apostel und der Askese Christi. Ich stelle mir seine gepflegten Hände, seinen glatten Eunuchenkörper und den Schweiß vor, der über seinen Rücken rinnt, während er hinter dem Altar die heiligen Formeln murmelt. Um ihn herum sehe ich Blut und Gold, eine barocke Atmosphäre, die mich an die Gemälde der flämischen Meister erinnert. Ich suche das wahre Wort Gottes, der Priester hat offenbar anderes zu tun.
Gott fischt die Seelen mit der Angel, der Teufel mit dem Netz.
An einem Montagmorgen setze ich mich auf eine Bank und rauche eine Zigarette. Ich ziehe meinen Rosenkranz aus der Jackentasche. Der kleine Jesus sieht besorgt und müde aus, er beobachtet mich aus seinen winzigen Augen. Ich habe den Eindruck, dass seine Wunden wieder bluten.
»Bist du immer noch da, am Kreuz? Bist du nicht abgehauen? Zweitausend Jahre, das ist lang.«
»Timor mortis conturbat me …«, antwortet er.
»Du bist lustig«, sage ich.
»Nein«, seufzt Jesus, »ich bin nicht lustig. Ich bin der Sohn Gottes …«
Ich lege meinen Rosenkranz vorsichtig, als wäre er wirklich aus kostbarem, zerbrechlichem Material, auf die Bank. Dann stehe ich auf und durchquere wieder einmal ohne klares Ziel die Stadt.
3
Das frisch renovierte Asylbewerberheim in Rennes erinnert mich an mein Gymnasium. Eine große Glastür, endlose Flure, nur dass es hier anstelle der Klassenzimmer Schlafräume für Flüchtlinge gibt. In der Eingangshalle hängt eine Weltkarte mit kleinen Fähnchen aus den Ländern der Bewohner. Im Spätsommer 1992 trifft sich das ganze Elend der Welt in Rennes. Irak und Bosnien, Somalia und Äthiopien, mehrere Länder des ehemaligen Ostblocks. Dazu ein paar professionelle Vagabunden, Männer, die seit langem, vielleicht schon immer, zwischen den verschiedenen Behörden und Grenzen, zwischen der richtigen Welt und der Unterwelt der Bürger zweiter Klasse verlorengegangen sind, ohne Papiere, ohne Gesicht und ohne Hoffnung.
Ich werde von einer Frau mit einer riesigen Brille empfangen. Sie spricht leise und sieht mir in die Augen. Das ist eine Premiere für mich. Seit meiner Ankunft in Frankreich sprechen alle (auch die Gutwilligen) sehr laut und in kurzen Sätzen mit mir, etwa so: »Du … Essen … ja … mjam, mjam, mmmm, ist gut, ja?«, oder: »Du, warten, hier! Hier, warten!«
Hier ist es anders. Die Frau erklärt mir ganz ruhig – und wie durch ein Wunder verstehe ich alles –, wie das Heim funktioniert. Ich verstehe, dass ich ein Einzelzimmer für Ledige bekomme, dass ich Badezimmer und Küche mit den anderen teile und dass ich Recht auf einen Französischkurs für erwachsene Analphabeten habe, der dreimal pro Woche stattfindet.
Ich bin etwas beleidigt:
»Aber ich habe Abitur und ein abgeschlossenes Studium, ich bin Schriftsteller, Romanautor …«
»Völlig unwichtig, mein Junge«, antwortet die Frau. »Hier beginnt für dich ein neues Leben.«
Mein Zimmer gleicht einer Mönchszelle: ein Metallbett, ein kleiner Tisch, ein Stuhl und ein Fenster mit Blick auf den Parkplatz eines Supermarkts. Ich bin erschöpft, ich bin wütend, auf mich, auf den Krieg, auf die ganze Welt. Ich gehöre ganz offensichtlich nicht hierher. Ich fühle mich den anderen Flüchtlingen im Heim überlegen. Ich habe Edgar Allan Poe und Kafka gelesen, ich kenne den Unterschied zwischen Realismus und Surrealismus. Ich habe bereits einen Literaturpreis erhalten, einen sehr bedeutenden, in Jugoslawien. Ich höre Jazz, Miles, Mingus und Coltrane, und um mich herum sind nur arme Bauern, Hirten und Notleidende aus der Dritten Welt. Momentan sitze ich in der Klemme, zugegeben, aber ich habe so viel beizutragen, so viel zu erzählen, dass ich meine neuen Lebensumstände als erniedrigend empfinde. Ich stelle meine Tasche ab und mache auf dem Absatz kehrt.
Mit fünfzig Mark in der Tasche gehe ich in Richtung Stadtzentrum. Unterwegs bete ich zu John Fante und Julio Cortázar, zum großen Baudelaire und zum unsterblichen Apollinaire; ich flehe zum Bart von Hemingway und zu Balzacs Bauch, zur Unerträglichen Leichtigkeit des Seins von Kundera und zu Sábatos Abaddon, sie mögen mir zu Hilfe kommen. Ich balle vergeblich die Fäuste, ich fluche. Ich kann meinen wachsenden Frust nicht kanalisieren. Ich habe nur meinen dummen, unnützen Stolz, die Nicht-Annahme meines Schicksals, kalten Zorn. Ich bin verkrampft, verängstigt von meinem neuen Leben ohne Morgen.
Gegen zwei Uhr morgens werde ich aus der Bar geworfen, ich erinnere mich vage, dass ich brülle: »Dazu haben Sie kein Recht, ich bin Jacques Dutronc«, trotz meines Widerstands ist der Rausschmeißer unerbittlich. Ergebnis meines Ausflugs ins Stadtzentrum: Ich bin immer noch Flüchtling und wütend, aber jetzt bin ich voll wie eine Haubitze, und meine fünfzig Mark sind weg. Meine Rückkehr ins Heim ist lang und mühsam. Irgendwie suche ich mir meinen Weg durch den dichten Nebel der Nacht und des Biers. In der ersten halben Stunde singe ich jugoslawische Lieder, dann verlaufe ich mich in einem Vorort, und als ich endlich das Schild Foyer Guy Houist Rennes sehe, bin ich sehr müde.
Unter dem finsteren Blick des Nachtwächters gehe ich in mein Zimmer, ziehe die Schuhe aus und falle sofort in einen tiefen, traumlosen Schlaf.
Nach einer Woche habe ich zwei neue Freunde. Zwei russische Ex-Soldaten, die über die Berliner Mauer gesprungen und durch Belgien und die Niederlande nach Frankreich gelangt und in diesem Heim gelandet sind. Alexander Terohin ist groß und stämmig, blond wie der Sommer, sein Gesicht schon vom Alkohol zerstört. Er spaziert mit nacktem Oberkörper durch die Flure, muskulös und glänzend wie ein slawischer Gott. Auf seiner hellen Haut sind ein paar blaue Flecken zu sehen – eine zitternde, unsichere Hand hat ihm den Namen einer Stadt und den eines Mädchens eintätowiert: Samara und Tamara, das reimt sich wie der Anfang eines Gedichts von Sergej Jessenin. Weiter unten, auf seinem Unterarm, gibt es einen Kommunistenstern und eine sehr schlecht gezeichnete Sirene, der Künstler der russischen Marine wurde wohl von hohen Ostseewellen bei der Arbeit gestört. Sein Freund Wolodja Kudaschow ist sein Sancho Pansa. Er ist klein, gedrungen, ziemlich fett und erinnert mich an eine wohlgenährte Ratte. Er hat ungesunde Schweinsäuglein und lange gelbe Zähne, die aus seinem Mund ragen. Nach jedem Glas klatscht er sich auf den Bauch und rühmt sich seiner sexuellen Eroberungen in Berlin.
»Nicht alle deutschen Frauen sind Nutten«, erzählt er, »manche machen es auch umsonst.«
Wir verständigen uns in einer Mischung aus Russisch, Serbokroatisch und einfachen Sätzen auf Deutsch. Ich bin froh, dass ich zu einer Bande gehöre, auch wenn ich mich nie an den Prügeleien mit den Schwarzen und den Arabern beteilige, die meine neuen Freunde regelmäßig vom Zaun brechen.
»Wir sind hier in Europa«, wiederholt Alexander ständig. »Die sollen gefälligst zu ihren Scheißstämmen zurückgehen.«
Manchmal verbringen wir eine ruhige, angenehme Nacht. Wir sitzen auf dem Parkplatz hinter unserem Heim und trinken, singen und vergleichen unsere schönen Länder mit diesem eigenartigen Frankreich.
»Frankreich ist wirklich ein komisches Land«, schwafelt Alexander los. »Hier ist Weißbrot billiger als Schwarzbrot.«
»Außerdem essen sie den Salat vor dem Fleisch«, sagt Wolodja, »nicht dazu, wie wir.«
»Ja, ja«, bestätige ich mit ernster Miene, »die Franzosen und ihre tausend Sorten Stinkekäse … Bei uns gibt es zwei Sorten Käse – gesalzen und halbgesalzen – und ansonsten sieh zu, Kamerad.«
Dann stoßen wir an und trinken aus der Flasche, auf slawische Art.
Meine russischen Freunde und ich folgen immer demselben Ritual. Zwei Sixpacks vom billigsten Bier, dazu mixen die Russen ihren fighting cocktail (eine Flasche billige Limonade mit Alkohol aus der Apotheke, 75 Prozent), und ich nehme eine Flasche vin de pays, am liebsten roten, um meine Integration zu beschleunigen. Dann pflegt jeder seinen Rausch. Die Russen brüllen im Flur rum, ich weine, den Kopf im Kissen versteckt, in meinem Zimmer.
»Wenn du noch einmal sagst, dass du Dichter bist, schlage ich dir die Fresse ein!«, warnt mich Alexander regelmäßig.
»Ich bin Dichter«, entgegne ich.
Und er verpasst mir einen freundschaftlichen, aber festen Schlag ins Gesicht. Und wieder stoßen wir an, trinken und singen aus voller Kehle Kalinka, Kalinka maja …
Ich lasse das Blut laufen und auf mein Hemd tropfen. Mein Blut, mein Gesicht und mein Körper, das ist alles nicht mehr wichtig. Nur ein kleiner Preis dafür, dass ich den endlosen Nächten der Einsamkeit in meinem Heimzimmer entfliehe. Ich lasse mein Blut laufen, na und? Betäubt vom Alkohol und der schrecklichen metaphysischen Kälte in mir, erfahre ich, dass alles hier auf Erden etwas kostet. Verglichen mit den zerbrochenen Schicksalen eines Schalamows oder Pasternaks ist eine blutende Nase nichts!