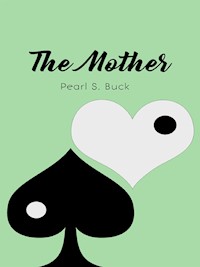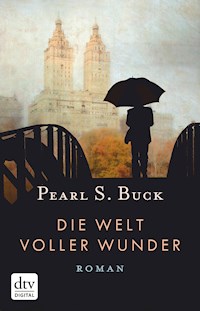
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der lang verschollene letzte Roman der Nobelpreisträgerin Dass Rann Colfax etwas Besonderes ist, merken seine Eltern schon kurz nach seiner Geburt: Er ist hochbegabt – und wächst deshalb ohne Freunde auf. Sein Vater beschließt, mit Rann um die Welt zu reisen, damit er neue Eindrücke gewinnt und seinen Horizont erweitern kann. Doch noch bevor die Reise stattfindet, stirbt der Vater ‒ und Rann muss sich allein aufmachen in die weite Welt, wo er die Unwägbarkeiten des Lebens kennenlernt und schließlich auch die Liebe.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 457
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
PEARL S. BUCK
DIE WELT VOLLER WUNDER
Roman
Aus dem amerikanischen Englisch von Britta Mümmler
Das Leben ist das Wunder, von dem wir alle durchdrungen sind …
TEIL I
Er lag schlafend da im stillen Wasser. Doch das soll nicht heißen, dass seine Welt stets unbewegt war. Es gab Zeiten, in denen er Bewegung wahrnahm, heftige Bewegung sogar. Dann wiegte ihn die warme Flüssigkeit, von der er ganz und gar umschlossen war, hin und her, ja wirbelte ihn manches Mal sogar regelrecht herum, sodass er instinktiv die Arme ausbreitete, mit den Händen zu rudern begann und die Beine spreizte wie ein hüpfender Frosch. Nicht dass er schon irgendetwas von Fröschen gewusst hätte – dafür war es noch zu früh. So wie es überhaupt zu früh war für jegliche Art von Wissen. Instinkt war das Einzige, was er besaß. Und so lag er die meiste Zeit einfach reglos da und bewegte sich nur, wenn er auf unerwartete Bewegungen in der Außenwelt reagierte.
Diese Reaktionen, notwendige Reaktionen, um sich selbst zu schützen, wie sein Instinkt ihm sagte, bereiteten ihm mit der Zeit immer mehr Vergnügen. Nun wartete er nicht mehr länger auf Anregungen von außen, sondern begann, sich aus eigenem Antrieb zu bewegen. Er ruderte mit den Armen und strampelte mit den Beinen, er drehte sich, anfangs noch ganz zufällig, dann aber zunehmend absichtlich und mit dem Gefühl, etwas vollbracht zu haben. Er konnte sich in seinem eigenen warmen Ozean vollkommen frei bewegen, erst als er größer wurde, begann er plötzlich Grenzen wahrzunehmen. Nun stieß er hin und wieder mit der Hand oder dem Fuß an eine Wand, die zwar weich war, ihm aber Grenzen aufzeigte, über die er sich nicht hinausbewegen konnte. Vor und zurück, auf und ab, um sich selbst herum, aber nicht über die Wand hinaus – sie begrenzte seine Welt.
Instinkt war es auch, der ihn dazu antrieb, sich heftiger zu bewegen. Er wurde mit jedem Tag größer und stärker, und in demselben Maße wurde sein eigener Ozean allmählich immer kleiner. Schon bald würde er zu groß sein für seine kleine Welt. Das spürte er, ohne sich dessen bewusst zu sein. Mit der Zeit drangen immer häufiger schwache, weit entfernte Geräusche zu ihm heran. Bis dahin hatte Stille ihn umgeben, doch nun hallten in den zwei kleinen Gebilden, die an beiden Seiten seines Kopfes gewachsen waren, Echos wider. Diese Gebilde schienen einen bestimmten Zweck zu haben, den er jedoch nicht verstand, ja nicht verstehen konnte, weil er noch nicht denken konnte, und denken konnte er noch nicht, weil er noch nichts wusste. Doch er konnte fühlen. Er nahm die Dinge mit seinen Sinnen wahr. Manchmal öffnete er den Mund, um ein Geräusch zu machen, auch wenn er nicht wusste, was ein Geräusch überhaupt war, ja nicht einmal, dass er eines machen wollte. Er konnte nichts wissen – noch nicht. Er wusste ja nicht einmal, dass er nichts wusste. Instinkt war das Einzige, was er besaß, und diesem war er vollkommen ausgeliefert.
Und so war es auch sein Instinkt, der ihn spüren ließ, dass er zu groß wurde für das, worin er lebte, was auch immer es sein mochte. Ihm war unbehaglich zumute, und dieses Unbehagen trieb ihn mit einem Mal zur Rebellion. Seine Welt wurde zu klein für ihn, er wollte sich daraus befreien, und dieser Instinkt äußerte sich in einer stetig wachsenden Ungeduld. Eines Tages schließlich stieß er mit rudernden Armen und strampelnden Beinen derart heftig gegen die Wand, dass sie brach – und da strömte das stille Wasser jäh davon, verließ ihn, ja ließ ihn hilflos zurück. Noch in demselben Augenblick aber, oder auch kurz danach – denn er konnte ja immer noch nichts verstehen, weil er nichts wusste –, spürte er enorme Kräfte auf sich einwirken, die ihn mit dem Kopf voran durch einen unpassierbar eng erscheinenden Gang hindurchtrieben, so eng, dass er dort niemals irgendwie vorangekommen wäre, wenn er nicht gänzlich von feuchtem Schleim umhüllt gewesen wäre. Krampfartige Erschütterungen seiner Welt zwangen ihn Zentimeter um Zentimeter kopfüber voran in der Dunkelheit. Nicht dass er etwas von der Dunkelheit gewusst hätte, denn er konnte ja noch nichts wissen. Doch er fühlte sich von Kräften getrieben, die ihn voranstießen, voran und immer weiter voran. Oder wurde er einfach nur ausgestoßen, weil er zu groß geworden war für seine Welt? Wer konnte das wissen!
So setzte er seine Reise fort und zwängte sich durch den Gang hindurch, indem er seine Wände unerbittlich weitete. Eine andere, dickliche Flüssigkeit quoll hervor und trug ihn, immer noch kopfüber, weiter voran auf seinem Weg, bis er plötzlich – und wirklich mit einer solchen Plötzlichkeit, als würde er ausgespien – hinausschoss in die Unendlichkeit. Dort wurde er gepackt, am Kopf gepackt, sehr behutsam natürlich, und in luftige Höhen gehoben – wovon, das wusste er nicht, denn er konnte ja noch nichts wissen –, und dann baumelte er mit einem Mal wiederum kopfüber an den Füßen. All das geschah so rasch, dass er nicht einmal darauf reagieren konnte, und unmittelbar danach spürte er an einer seiner Fußsohlen auch schon ein Stechen, eine ganz neue Empfindung. Und nun wusste er plötzlich etwas. Er wusste, was Schmerz war. Mit den Armen rudernd schlug er um sich, denn wie er mit Schmerz umgehen sollte, das wusste er noch nicht. Er wollte zurückkehren, in das stille, warme Wasser, in dem er stets so unversehrt dagelegen hatte, wusste aber nicht, wie er das anstellen sollte. Weiter wollte er jedenfalls nicht mehr. Er fühlte sich atemlos, hilflos und vollkommen ungeborgen, doch er wusste nicht, was er tun sollte.
Und während er noch zögerte, ängstlich, ohne zu wissen, was Angst war, und nur instinktiv wahrnehmend, dass er in Gefahr schwebte, ohne zu wissen, was Gefahr war, spürte er wieder diesen plötzlichen stechenden Schmerz an seinem Fuß. Irgendetwas ergriff ihn bei seinen Fußgelenken, irgendwer versetzte ihm einen Schreck, er wusste nicht was, er wusste nicht wer, doch nun wusste er, was Schmerz war. Und da kam ihm mit einem Mal sein Instinkt zu Hilfe. Er konnte nicht zurück, aber so verharren konnte er auch nicht. Also musste er weiter voran. Er musste dem Schmerz entkommen, indem er weiter voranging. Er wusste zwar nicht wie, doch er wusste, dass er weiter musste. Und nun wollte er auch weiter, und angesichts dieses Willens leitete ihn sein Instinkt. Er riss den Mund auf und stieß ein Geräusch aus, einen Protestschrei gegen den Schmerz, und dieser Protest zeitigte Erfolg. Auf einmal waren seine Lungen von der Flüssigkeit, die er nun nicht mehr brauchte, befreit, und er atmete zum ersten Mal Luft ein. Er wusste natürlich nicht, dass es Luft war, aber er spürte, wie etwas den Raum des Wassers einnahm. Doch es war flüchtig. Irgendetwas in seinem Inneren trieb es beständig hinein und hinaus, und während sich dies vollzog, begann er plötzlich zu schreien. Er wusste nicht, was Schreien war, doch nun hörte er zum ersten Mal seine eigene Stimme, auch wenn er nicht wusste, dass dies seine Stimme war oder was eine Stimme überhaupt war. Doch das Schreien gefiel ihm ganz instinktiv, und das Hören ebenso.
Dann wurde er aufgerichtet, jemand hielt seinen Kopf, und kurz darauf wurde er auf etwas Warmes und Weiches gebettet. Er spürte, wie sein Körper mit Öl eingerieben wurde, auch wenn er noch nicht wusste, was Öl war, und danach wurde er gewaschen. Er konnte ja all das, was mit ihm geschah, nur hinnehmen, weil er nicht wusste, was all das war. Aber der Schmerz war verschwunden, und ihm war behaglich zumute und warm, auch wenn er, ohne sich darüber bewusst zu sein, sehr müde war. Und so schloss er die Augen und schlief ein, ohne auch nur zu ahnen, was Schlaf war. Instinkt war immer noch das Einzige, was er besaß, und das reichte bislang auch vollkommen aus.
Er war wieder vom Schlafen erwacht. Doch den Unterschied zwischen Schlaf und Wachsein kannte er ja noch gar nicht. Er lag nicht mehr in seinem eigenen kleinen Ozean da, aber er fühlte sich dennoch warm und geborgen. Und er nahm Bewegung wahr, wenn auch nicht seine eigene. Anstatt durch Flüssigkeit glitt er nun durch Luft hindurch, und er atmete regelmäßig, auch wenn er nicht wusste, dass er es tat. Sein Instinkt trieb ihn zum Atmen an. Und es war auch sein Instinkt, der ihn antrieb, in der Luft genauso mit den Armen zu rudern und mit den Beinen zu strampeln, wie er es einst in seinem Ozean getan hatte. Dann spürte er plötzlich, so wie ihm jetzt alles ganz plötzlich widerfuhr, wie er mit etwas in Berührung kam, das weder weich noch hart war, aber warm. Und er spürte, wie er an dieses Warme gedrückt wurde und wie sein Mund an etwas ebenso Warmes stieß. Und weil er immer noch nichts wusste, setzte nun sein Instinkt wieder ein. Er öffnete den Mund und spürte, wie etwas kleines warmes Weiches sanft in diesen hineingeschoben wurde. Eine süßliche Flüssigkeit benetzte seine Zunge, und mit einem Mal ergriff seinen ganzen Körper eine instinktive Freude, und er spürte ein völlig neues, unerwartetes Bedürfnis. Er begann zu saugen, er begann zu schlucken, und dann saugte und schluckte er in einem fort und gab sich diesem neuen Gefühl vollkommen hin. So etwas hatte er noch nie erlebt, eine solch allumfassende Freude an seinem eigenen Dasein. Genauso intensiv, wie er zuvor den Schmerz empfunden hatte, empfand er nun die Freude. Schmerz und Freude waren das Erste, was er im Leben kennenlernte – auch wenn er natürlich noch nicht wusste, was es damit auf sich hatte. Doch nun kannte er den Unterschied zwischen beidem und wusste, dass er den Schmerz hasste und die Freude liebte. Und das war jetzt schon etwas mehr als nur reiner Instinkt, obwohl der Instinkt immer noch großen Anteil daran hatte. Das Gefühl der Freude und das Gefühl des Schmerzes erkannte er ganz instinktiv. Wenn er Schmerz empfand, riss er den Mund auf und begann laut, ja sogar wütend zu schreien. Und er lernte, dass der Ursache seines Schmerzes Einhalt geboten wurde, sobald er das tat, und so erlangte er Wissen.
Was er noch nicht wusste, war, dass sich nach einer Phase der Freude sein Mund zu einem weiten Gähnen öffnete. Und manchmal gab er auch ein anderes Geräusch von sich: ein vergnügtes Glucksen. Das konnte beim Anblick bestimmter Menschen geschehen, vor allem dann, wenn diese selbst Geräusche von sich gaben und seine Wangen oder sein Kinn berührten. Mit der Zeit lernte er, dass sie mit solchen Lauten und Berührungen auf seine Freude reagierten, und auch dies wurde ihm zu Wissen. Alles, was er durch seine Bedürfnisse oder sein Verlangen tun oder auslösen konnte, wurde zu Wissen, und dieses Wissen nutzte er instinktiv. Sein Instinkt verhalf ihm auch zum Wissen um andere. Anfangs war er sich nur seiner selbst bewusst, seiner eigenen Freude, seines eigenen Schmerzes. Allmählich aber begann er, gewisse Menschen mit seiner Freude oder seinem Schmerz in Verbindung zu bringen. Der erste solche Mensch war seine Mutter. Anfangs erkannte er sie nur instinktiv und durch das Gefühl der Freude. Ihre Brüste nährten ihn, und das war seine größte Freude. Saugte er an diesen, blickte er ihr ins Gesicht, bis dessen Züge schließlich ein Teil seiner Freude wurden. Und so war sie auch die Erste, die er instinktiv anlächelte, als er lernte, seine Freude mit einem Lächeln zum Ausdruck zu bringen.
Umso mehr erschrak er, ja fürchtete sich regelrecht, als er eines Tages entdecken musste, dass dieser andere Mensch, der ihm sonst so viel Freude bereitete, ihm auch Schmerz zufügen konnte. Seine Kiefer fühlten sich wund und fiebrig an, und so presste er an diesem Tag, nachdem sein Hunger gestillt war, seine Kiefer instinktiv auf das, was er da im Mund hatte. Zu seiner großen Überraschung stieß sie einen Schrei aus, der dem seinen, wenn er Schmerz empfand, nicht unähnlich war – und in genau diesem Augenblick empfand er wieder Schmerz. An der Wange, einem Teil seiner selbst, dessen er sich bisher gar nicht wirklich bewusst gewesen war. Wiederum vom Instinkt getrieben brach er unmittelbar in lautes Weinen aus, und er spürte etwas Feuchtes in seinem Gesicht, etwas wie Wasser. Das waren seine ersten Tränen, und sie wurden ausgelöst von einer neuen Art von Schmerz: von einem Schmerz, der nicht allein von seiner Wange herrührte, die immer noch brannte, sondern von einer Wunde tief in seinem Inneren, die er nicht benennen konnte. Es war ein innerer Schmerz, der sich da in seiner Brust ausbreitete – und mit einem Mal fühlte er sich ganz allein und verloren. Die warme weiche Gestalt, die ihn Tag und Nacht umsorgte, ihn an ihren Brüsten nährte und von der er vollkommen abhängig war, hatte ihm Schmerz zugefügt! Er hatte ihr ganz und gar vertraut, und nun konnte er ihr nicht mehr vertrauen, weil sie ihm Schmerz zugefügt hatte. Er fühlte sich isoliert von allem, wie ein Wesen, das nirgendwo mehr dazugehört und deshalb verloren ist. Natürlich nahm sie ihn, während er untröstlich immer weiter weinte, in die Arme und wiegte ihn besänftigend hin und her, doch er konnte einfach nicht aufhören zu weinen. Sie schob ihm eine Brustwarze in den aufgerissenen Mund und bot ihm erneut Nahrung an, die warme süße Nahrung, die er sonst stets so begierig annahm. Doch er drehte den Kopf weg und verweigerte sie. Er schrie und schrie, bis er den inneren Schmerz schließlich nicht mehr spürte, und dann schlief er ein.
Er erwachte auf der rechten Seite liegend in seinem Kinderbett. Er drehte sich auf den Rücken und dann auf die linke Seite. Und mit einer Lust, die ihm neu war, verlangte ihn nun danach, sich wieder auf die rechte Seite zu drehen, und da sein Verlangen immer noch nicht gestillt war, weiter auf den Bauch. Nun jedoch war sein Gesicht auf die Matratze gepresst, und so verlangte ihn danach, seinen Kopf zu heben. Mit einem Mal sah alles ganz neu und anders aus, so als hätte er es noch nie zuvor gesehen. Er schien wie von einer Höhe herabzuschauen. Und außerdem konnte er seinen Kopf auch zur Seite herumdrehen, ja sogar zu beiden Seiten. Unablässig folgte eine Überraschung auf die andere. Dann hörte er plötzlich einen lauten Schrei und spürte, wie die Gestalt ihn hochhob, jene Gestalt, die solchen Schmerz zufügen konnte, dass er sich in den Schlaf geweint hatte. Doch es war ein freudiges Gefühl, das er nun empfand, eine neue Art von Freude, die nichts mit Nahrung zu tun hatte. Hatte er zuvor inneren Schmerz empfunden, so erfüllte ihn nun innere Freunde. Er gehörte wieder zu ihr, fühlte sich wieder von ihr angenommen und umsorgt. Immer wieder stieß sie kleine Laute aus, und er spürte, wie ihre Lippen ein ums andere Mal seine Wangen und seinen Hals berührten. Und als sie dann laut etwas rief, kam auch der andere Mensch herbeigeeilt und betrachtete ihn aufmerksam. Sein eigener Blick wanderte von dem einen zum anderen, er fühlte sich beiden zugehörig. Wieder war es sein Instinkt, der all dies bewirkte. Denn er wusste ja noch nichts über die beiden oder darüber, warum genau er sich als Teil von ihnen fühlte. Aber es war ein freudiges Gefühl. Instinktiv öffnete er den Mund und gab mit noch unsicheren Lippen ein neues Geräusch von sich, einen Laut, und da hörte er die beiden vor Überraschung Freudenschreie ausstoßen.
Danach hatte er das Gefühl, sich beinahe täglich zu verändern. Es verlangte ihn danach, all das zu tun, was nicht möglich zu sein schien. Wenn er in seinem Kinderbett dalag, wurde es ihm zu einer Selbstverständlichkeit, sich auf den Bauch zu drehen und den Kopf zu heben. Dann stemmte er sich mit beiden Armen hoch, und seine Welt wurde größer. Nun konnte er schon aus seinem Kinderbett hinaussehen. Und ein paar Tage später – wie viele Tage später genau wusste er nicht, weil er noch immer von seinem Instinkt getrieben wurde – entdeckte er, dass er seinen Körper auch auf die Knie hieven konnte. Und so, auf Hände und Knie aufgestützt, wiegte er sich nun vor und zurück, eine Bewegung, die er im ganzen Körper spürte und ein ums andre Mal vollführte, weil es ihm so großen Spaß machte. Danach vergingen die Tage in rasender Geschwindigkeit. Immer schneller entwickelte sich aus seinem instinktiven Tun heraus Wissen. Mittlerweile war es ihm schon zur Gewohnheit geworden, sich auf Hände und Knie zu stützen. Er wusste nun, wie man es machte, doch das reichte ihm längst nicht mehr. Und so trieb sein Instinkt ihn an, sich vorwärtszubewegen, eine Hand vor die andere zu setzen, ein Knie vor das andere, und wenn er an die Grenzen seines Kinderbettes oder des Laufstalles stieß, in den die Gestalt ihn tagsüber setzte – weil er noch nicht weiter durfte –, ergriff er die Holzstäbe des Gitters und zog sich daran hoch.
Nun hatte er Höhe erreicht. Und von dieser Höhe aus sah alles, die ganze Welt, gleich vollkommen anders aus. Er war nicht mehr länger dem Boden verhaftet, er war oben, hoch oben, über der Welt, und dabei lachte er laut vor Freude.
Wenn er sein Gesicht an das Gitter drückte und zwischen den Holzstäben hindurchlugte, sah er die Gestalten, zu denen er gehörte, allein oder auch gemeinsam, wie sie hierhin und dorthin liefen. Er wurde immer noch vom Instinkt getrieben, doch es kam auch schon Wissen dazu, das ihm inzwischen auf verschiedene Arten zugänglich war. Er betrachtete alles um sich herum genau, und dort, wo er anfangs nur gesehen hatte, ohne zu verstehen, entstand nun Wissen, und er sah, dass auch anderes – Löffel, Teller, Becher – als die Brüste eine Nahrungsquelle waren. Er lernte, sich Wissen anzueignen, und verbrachte nun mehr Zeit mit Lernen als mit instinktivem Reagieren. Er war umgeben von lauter Dingen, und über jedes einzelne dieser Dinge konnte man etwas wissen: wie es sich in den eigenen Händen anfühlte oder – wenn es zu groß war, um es selbst festzuhalten – wie es sich anfühlte, es zu berühren. Es gefiel ihm, Dinge anzufassen oder festzuhalten. Und es gefiel ihm auch, zu schmecken, was ja im Grunde letztlich nur ein Anfassen mit der Zunge war. Als er diese Art der Wissensaneignung entdeckte, begann er alles in den Mund zu stecken oder, wenn es zu groß war, mit den Lippen und der Zunge zu erkunden. Und auf diese Weise lernte er, was der Geschmack war. Alles hatte sowohl einen Geschmack als auch eine Oberfläche zum Anfassen. Er lernte und lernte, und sein Wissen wuchs stetig, denn es war ein Instinkt, lernen zu wollen und sich so Wissen anzueignen.
Er gab sich der Beschäftigung des Lernens vollkommen hin, und im Laufe dieser Beschäftigung wurde es notwendig, sich zu bewegen. Er hatte bereits herausgefunden, dass seine Knie nachfolgten, wenn er eine Hand vor die andere setzte, immer eine vor die andere. Und so wurde der enge Laufstall langsam zu klein für ihn. Er spürte das Verlangen, diesen zu verlassen, in den Raum jenseits davon zu gelangen, und um seinen Willen durchzusetzen, weinte und schrie er so lange, bis er herausgehoben und außerhalb der Holzstäbe hingesetzt wurde. Dann begann er auf Händen und Knien seine Erkundungstour. Wenn er einen Stuhl oder ein Tischbein erreichte, trieb sein Kletterinstinkt ihn an, sich daran hochzuziehen. Anfangs wusste er nicht, was nun zu tun war. Er stand auf beiden Beinen da und hielt sich mit den Händen fest, doch was als Nächstes kam, wusste er nicht. Er konnte natürlich sehen, was die beiden Gestalten taten, aber er wusste nicht, wie sie es machten. Und außerdem bestand die Gefahr hinzufallen. Einmal hatte er schon versucht, mit den Händen loszulassen, und war prompt derart plötzlich auf den Boden geplumpst, dass er von dem Bedürfnis zu weinen überwältigt worden war und die Gestalt herbeigeeilt kam und ihn tröstend in die Arme nahm. Er wusste noch nicht, dass nichts für immer so blieb, wie es war. Alles begann damit, nicht zu wissen. Er musste erst lernen, dass er es einfach noch einmal versuchen konnte, und das wiederum begann mit dem vom Instinkt getriebenen Verlangen danach, es noch einmal versuchen zu wollen.
Die Gestalten halfen ihm nun. Sie hielten ihn an den Händen fest, zogen ihn hoch und stellten ihn auf die Beine. Und als sie ihn schließlich vorsichtig zu sich heranzogen, entdeckte er, dass ein Bein instinktiv dem anderen folgte und er sich bewegte. Er konnte sich bewegen! Nie wieder würde er sich damit zufriedengeben, dass man ihn auf einen Raum beschränkte. Er war ein freier Mensch, ganz genauso wie die beiden anderen auch. Natürlich, ab und zu fiel er noch hin, und manchmal tat es sogar weh, doch er lernte, sich allein wieder auf die Beine zu stellen und von vorn zu beginnen.
Das war eine ganz neue Art von Freude! Er verspürte weder den Wunsch noch das Verlangen, irgendetwas anderes zu tun, irgendein anderes Ziel zu verfolgen, als sich einfach nur auf den Beinen zu halten und sich zu bewegen. Natürlich verführten ihn oft irgendwelche Dinge dazu, doch stehen zu bleiben und sie zu betrachten, zu fühlen, anzufassen und zu schmecken, und auf all diese verschiedenen Arten zu lernen, was für ein Ding genau es war und welchen Nutzen es hatte. Doch kaum hatte er es herausgefunden, trieb sein Instinkt ihn auch schon weiter zu Neuem. Und allmählich lernte er auch, das Gleichgewicht zu halten, sodass er nicht mehr hinfiel, oder zumindest nicht mehr so oft.
Auch sein Bedürfnis, Laute von sich zu geben, hatte sich in der Zwischenzeit weiterentwickelt. Seine Stimme hatte er schon entdeckt, kurz nachdem er seinen eigenen Ozean verlassen hatte, als er instinktiv vor Schmerz zu schreien begann. Der Schmerz hatte ihn gelehrt, Protestschreie auszustoßen, genauso wie ihn bald darauf die Freude das Lachen gelehrt hatte. Diese beiden Lautäußerungen benutzte er inzwischen jeden Tag, sogar recht häufig. Doch die Stimme konnte auch noch andere Laute hervorbringen. Die beiden Gestalten benutzten ihre Stimmen unablässig, manchmal um zu lachen, vor allem aber um noch eine andere Art von Lauten von sich zu geben. Für ihn zum Beispiel benutzten sie einen ganz bestimmten Laut. Und dies wurde der erste spezifische Laut, den er lernte, die erste Konstante, das erste Wort – sein Name: Randolph, oder kurz Rannie. Dieses Wort wurde meist zusammen mit anderen benutzt, die ihrerseits wiederum mit Schmerz oder Freude verbunden waren. Es waren zwei kurze Wörter: »ja« und »nein«. »Nein, Rannie«, »Ja, Rannie« – das konnte Schmerz bedeuten oder auch Freude. Wörter konnte man allerdings nicht mittels Instinkt lernen, sondern nur durch Erfahrung. Anfangs hatte er ihnen weiter keine Beachtung geschenkt. Ein »nein« bedeutete ihm gar nichts. Doch schon bald fand er heraus, dass es Schmerz zur Folge hatte, wenn er diesem Wort keine Beachtung schenkte, einen plötzlichen Klaps auf die Hand oder auf den Hintern zum Beispiel. So lernte er innezuhalten, sobald er das Wort »nein« hörte, vor allem dann, wenn kurz darauf noch ein »Rannie« folgte, mit dem er gemeint war. Dann lernte er, dass es für alles ein ganz bestimmtes Wort gab. Er lernte »Mama«, er lernte »Papa« – damit waren die beiden Gestalten gemeint, zu denen er gehörte und die zu ihm gehörten. Sie waren es auch, die »nein« und »ja« zu ihm sagten, und sie sagten auch »komm«. So lernte er auch, wann er selbst »nein« und »ja« benutzen konnte. Eines Tages sagten die beiden zu ihm: »Komm, Rannie, komm, komm.« Doch in diesem Augenblick wollte er nun einmal gerade nicht kommen, weil er beschäftigt war, und so benutzte er instinktiv das Wort, das er am besten kannte.
»Nein«, sagte er. »Nein – nein – nein.«
Da wurde er prompt von dem Großen hochgenommen.
»Ja – ja – ja – «, sagte der Große.
Und dieses sonst stets mit Freude verbundene Wort wurde zu seiner Überraschung diesmal von einem heftigen Klaps auf seinen Hintern begleitet. Er begann sofort zu weinen. Es fiel ihm leicht, in Tränen auszubrechen, wann immer er wollte. Manchmal half es, manchmal nicht. Diesmal half es nicht.
»Nein, nicht weinen«, sagte der Große.
Er blickte ihm ins Gesicht und beschloss, mit dem Weinen wieder aufzuhören. Und das war Lernen durch Wissen. Man sagte nicht »nein«, wenn ein Großer »komm« oder »ja« gesagt hatte.
Sein wahres Interesse richtete sich jedoch nicht auf solch beiläufige Wissenshäppchen. Seine Hauptbeschäftigung, die er sich ganz allein ausgesucht hatte, war das Erkunden. Er war besessen von dem Verlangen, alles zu erkunden, jede Schachtel zu öffnen und auszuprobieren, ob er sie wieder schließen konnte, wenn er herausgefunden hatte, was sich – oder ob sich etwas – darin befand, alle Türen zu öffnen, wieder und wieder die Treppenstufen hinauf- und hinunterzukrabbeln, Töpfe und Pfannen, Dosen und Schachteln aus den Küchenschränken zu räumen, Bücher aus den Regalen zu holen, Schubladen herauszuziehen, Gläser aufzuschrauben und Flaschen zu öffnen. Und hatte er etwas Neues schließlich vollständig erkundet, sah er keinen Grund dafür, alles wieder so anzuordnen, wie es gewesen war. Er hatte gelernt, was er wissen wollte, und damit hatte sich die Sache für ihn erledigt. Es machte ihm Spaß, Schubladen auszuräumen und Toilettenpapier abzuwickeln. Es gefiel ihm, im Wasser zu planschen und die Wasserhähne im Badezimmer immer wieder auf- und zuzudrehen. Er sah keinen Grund dafür, warum seine Mutter so entrüstet aufschrie. Doch wenn sie sagte: »Nein – nein, Rannie«, ließ er von dem, was immer er gerade tat, ab und setzte seine Tätigkeiten anderswo fort.
An seinem ersten Geburtstag, den er natürlich noch nicht begreifen konnte, konzentrierte sich sein Interesse ganz auf die eine Kerze auf dem Kuchen; und nachdem er gelernt hatte, wie man sie ausblies, verlangte er jedes Mal, dass sie erneut angezündet wurde, damit er herausfinden konnte, was dieses Licht war. Als der Große die Kerze schließlich ein letztes Mal für ihn angezündet hatte – »Nicht noch einmal, Rannie – nein, nein, nein« –, beschloss er, auf andere Weise herauszufinden, was es damit auf sich hatte. Er hielt einen Zeigefinger in die Flamme – und zog ihn augenblicklich wieder zurück. Er erschrak viel zu sehr, als dass er hätte weinen können. Stattdessen betrachtete er seinen Zeigefinger und blickte fragend seine Mutter an.
»Heiß«, sagte sie.
»Heiß«, wiederholte er. Und dann begann er, weil er nun wusste, dass »heiß« auch »Schmerz« bedeutete, zu weinen.
In diesem Augenblick nahm seine Mutter einen Eiswürfel aus ihrem Limonadeglas und hielt ihn an seinen Zeigefinger, an dem sich mittlerweile eine Blase gebildet hatte.
»Kalt«, sagte sie.
»Kalt«, wiederholte er.
Nun wusste er, was »heiß« und »kalt« bedeutete. Es war schon schwierig, dieses Lernen, aber aufregend. Und als er später seine Eiscreme aß, tat er sein neues Wissen sogleich kund.
»Kalt«, sagte er.
Er verstand nicht, warum die beiden anderen lachten und in die Hände klatschten.
»Kalt«, bestätigten sie. Er hatte sie glücklich gemacht; er wusste zwar nicht wie, doch er war zufrieden mit sich selbst und lachte ebenfalls.
Von der Zeit wusste er noch nichts, doch seines eigenen Körpers und seiner Bedürfnisse war er sich bewusst, und auf diese Weise lernte er schließlich auch, was Zeit war. Irgendetwas in seinem Bauch, eine Leere, die fast wehtat, wenn auch nicht richtig, bereitete ihm immer wieder ein Unbehagen, das nur durch Nahrung zu besänftigen war. Und dieses Bedürfnis teilte den Tag in Zeiten ein. Wenn es dunkel wurde, überkam ihn Schläfrigkeit, die Augen fielen ihm zu, und die Gestalt, die seine Mutter war, steckte ihn in warmes Wasser und in warme weiche Kleidung. Er trank Milch und aß, bis er sich wieder wohlfühlte, und später im Bett spielte er noch mit einem Plüschtier, wobei ihm aber meist schon die Augen zufielen. Um diese Zeit war das Zimmer dunkel, doch wenn er die Augen wieder aufschlug, war es hell. Dann stellte er sich sogleich auf die Beine und rief nach seiner Mutter, die übers ganze Gesicht strahlend hereingeeilt kam und ihn aus dem Bett heraushob. Und sobald er wieder gewaschen und gefüttert war, machte er sich erneut an sein Tagewerk, das immer noch darin bestand, alles ein ums andere Mal zu erkunden und bei allem Neuen innezuhalten oder, wenn er allein war, auch das zu erkunden, zu dem seine Mutter stets »nein – nein« sagte, wenn sie im Zimmer war. Denn er selbst kannte in seinem Wissensdrang keine Grenzen. Er musste einfach alles wissen.
Eines Tages lernte er ein neues Wesen kennen. Der Große brachte es mit. Es war klein und weich, hatte vier Beine und gab Laute von sich, die er noch nie gehört hatte.
»Wau – wau!«, machte das neue Wesen.
»Hund«, erklärte der Große.
Doch er hatte Angst vor »Hund«, wich zurück und steckte seine Hände hinter den Rücken.
»Wau – wau – wau«, machte der Hund.
»Schau mal, Rannies Hund«, sagte der Große, nahm Rannies Hand in die seine und streichelte den Hund.
»Hund«, sagte Rannie, und dann hatte er keine Angst mehr. Denn da gab es etwas Neues zu lernen. Auch der Hund musste erkundet werden, und er musste gleich einmal an diesem Schwanz da ziehen. Warum hatte der Hund überhaupt einen Schwanz?
»Nein – nein«, sagte seine Mutter. »Das tut dem Hund doch weh.«
»Tut weh?«, wiederholte Rannie verdutzt.
Daraufhin zog sie Rannie einmal kräftig am Ohrläppchen. »Tut weh, nein – nein«, wiederholte sie. »Schau mal, so macht man das – «
Mit sanften Bewegungen strich sie dem Hund über das Fell, und nachdem Rannie eine Weile zugeschaut hatte, machte er es ihr nach. Und da leckte der Hund ihm plötzlich die Hand. Er wich zurück.
»Hund – nein, nein«, rief er.
Seine Mutter lachte. »Er mag dich – er ist ein lieber Hund«, sagte sie.
Tag für Tag lernte er neue Wörter. Er wusste nicht, dass es ungewöhnlich war, so früh schon Wörter zu lernen. Er freute sich einfach nur darüber, dass seine Eltern so oft lachten und in die Hände klatschten.
Zu der Zeit, als er seinen zweiten Geburtstag erreichte, konnte er sogar schon zählen. Er wusste, dass das eine auf das andere folgte und dieses wiederum auf ein weiteres und noch ein weiteres und jedes eine eigene Bezeichnung hatte. Diese Bezeichnungen hatte er eines Tages zufällig mithilfe von Holzklötzen gelernt, als er aus einer Kiste voller Holzklötze einen herausnahm und diesen auf den Fußboden legte.
»Eins«, sagte seine Mutter.
Er nahm einen weiteren heraus und legte ihn neben den ersten. »Zwei«, sagte seine Mutter.
Und so machte er immer weiter, bis sie »zehn« gesagt hatte. Dann zählte er zurück bis zur Eins und wiederholte die Bezeichnungen dabei selbst. Seine Mutter starrte ihn zunächst nur an, dann aber nahm sie ihn freudestrahlend in die Arme. Und als sein Vater nach Einbruch der Dunkelheit nach Hause kam, holte sie die Kiste mit den Holzklötzen noch einmal hervor.
»Sag es, Rannie«, forderte sie ihn auf.
Er konnte sich gut an die Bezeichnungen erinnern, und die beiden sahen einander ernst und überrascht an.
»Kann er etwa schon – «
»Es sieht so aus – «
Noch einmal sagte er die Bezeichnungen lachend und sehr schnell nacheinander auf. »Eins – zwei – drei – vier – fünf – sechs – sieben – acht – neun – zehn!«
Jetzt lachten seine Eltern nicht, sondern sahen einander nur an. Und plötzlich holte sein Vater einige kleine runde Gegenstände aus seiner Hosentasche.
»Pennys«, sagte er.
»Pennys«, wiederholte Rannie. Er wiederholte alles, was sie zu ihm sagten, und konnte sich hinterher immer daran erinnern, welches Wort zu welchem Gegenstand gehörte.
Sein Vater kniete sich vor Rannie hin und legte einen Penny auf den Teppich.
»Ein Penny«, sagte er sehr deutlich.
Rannie hörte zu, ohne es zu wiederholen. Es war ja nicht zu übersehen, dass es sich um einen Penny handelte. Sein Vater legte einen weiteren Penny dazu und sah Rannie an.
»Zwei«, sagte Rannie.
Und so ging das Spiel weiter, bis es bei zehn Pennys schließlich endete. Sie sahen einander an, das heißt, seine Eltern sahen einander an.
»Er versteht es tatsächlich – er versteht, was Zahlen sind«, sagte sein Vater erstaunt.
»Ich hab’s dir doch gesagt«, erwiderte seine Mutter.
Danach musste natürlich alles gezählt werden. Äpfel in einer Schale, Bücher in den Regalen, Teller im Küchenschrank. Aber was kam nach der Zehn? Er forderte dieses Wissen von seiner Mutter ein.
»Zehn – zehn – zehn«, wiederholte er ungeduldig. Was kam nach der Zehn?
»Elf – zwölf – dreizehn – «, zählte seine Mutter für ihn weiter.
Er begriff es sofort. Man konnte weiter und immer weiter zählen. Es gab kein Ende. Er zählte alles, machte sich auch an das Unzählbare und bekam so eine Vorstellung davon, was das Unendliche ist. Zum Beispiel die Bäume in den Wäldern, in die sie zum Picknick fuhren – es war sinnlos, sie alle einzeln zählen zu wollen. Das begriff er, nachdem er das Prinzip des Zählens verstanden hatte – es war einfach nur immer mehr desselben.
Geld unterschied sich natürlich von den Bäumen im Wald oder von den Gänseblümchen auf einer Wiese. Als er drei Jahre alt war, hatte er verstanden, dass man im Austausch für etwas, das man haben wollte, Geld geben musste. Er begleitete seine Mutter manchmal in den Lebensmittelladen am Ende der Straße und sah, wie sie im Tausch gegen kleine Metallstücke oder Papierscheine Brot und Milch, Fleisch und Gemüse bekam.
»Was ist das alles?«, fragte er, als sie nach dem ersten gemeinsamen Einkauf wieder zu Hause waren. Er hatte ihr Portemonnaie mit dem Wechselgeld gefunden, es aufgemacht und die verschiedenen Münzen darin in einer Reihe auf dem Küchentisch ausgelegt.
Seine Mutter nannte ihm die Bezeichnung jeder einzelnen Münze, und er wiederholte sie alle für sich. Wenn er etwas erst einmal gelernt hatte, dann vergaß er es nicht mehr. Er stellte unentwegt Fragen und erinnerte sich immer an die Antworten. Doch es war mehr als nur Erinnern. Er verstand das Prinzip. Geld war einfach nur Geld und sonst nichts, solange man es nicht im Austausch für etwas gab, das man gern haben wollte. Das war der eigentliche Wert des Geldes, seine eigentliche Bedeutung.
Seine Mutter hatte ihn ganz seltsam angesehen an dem Tag, als er die Bezeichnungen der Münzen fehlerfrei wiederholt hatte.
»Du vergisst nie etwas, oder, Rannie?«, hatte sie gefragt.
»Nein«, hatte er erwidert. »Es ist doch wichtig, alles zu wissen, deshalb darf ich es nicht vergessen.«
Sie sah ihn jetzt oft seltsam an, so als hätte sie Angst vor ihm.
»Warum guckst du mich denn so streng an, Mama?«, fragte er einmal.
»Ich weiß selbst nicht so genau«, sagte sie aufrichtig. »Ich glaube, es liegt daran, dass ich noch nie so einen kleinen Jungen wie dich gesehen habe.«
Er dachte darüber nach, ohne es jedoch richtig verstehen zu können. Irgendwie fühlte er sich plötzlich so allein. Aber ihm blieb keine Zeit, weiter darüber nachzudenken, denn er wollte lesen lernen.
»Bücher«, sagte er zu seinem Vater eines Tages. »Warum gibt es Bücher?«
Sein Vater las ständig Bücher. Er war Professor an einem College, und am Abend las er Bücher und schrieb Wörter auf Papier.
»Aus Büchern kann man alles Mögliche lernen«, sagte sein Vater.
Es war ein verschneiter Tag, ein Samstag, an dem sein Vater zu Hause Bücher las.
»Ich will auch lesen«, erklärte er seinem Vater.
»Das wirst du lernen, wenn du in die Schule kommst«, antwortete sein Vater.
»Ich will es jetzt lernen«, sagte er. »Ich will alle Bücher auf der ganzen Welt lesen.«
Sein Vater lachte und ließ das Buch sinken, das er gerade las. »Na gut«, erwiderte er. »Hol mir ein Blatt Papier und einen Stift. Dann zeige ich dir, wie man beginnt, das Lesen zu lernen.«
Er rannte in die Küche, wo seine Mutter das Abendessen kochte.
»Stift und Papier«, forderte er forsch. »Ich lerne jetzt lesen.«
Seine Mutter legte den großen Kochlöffel, mit dem sie etwas in einem Topf auf dem Herd umrührte, zur Seite und ging ins Arbeitszimmer seines Vaters hinüber, wo dieser las.
»Du willst doch wohl diesem Kleinkind nicht das Lesen beibringen!«, rief sie.
»Er ist kein Kleinkind mehr«, gab sein Vater zurück. »Und wenn du mich fragst, war er auch nie eins. Er möchte lesen lernen. Natürlich werde ich es ihm beibringen.«
»Ich halte nichts davon, Kindern etwas aufzuzwingen«, sagte seine Mutter.
»Ich zwinge ihm doch nichts auf – er zwingt vielmehr mir etwas auf«, erwiderte sein Vater lachend. »Also, Rannie – gib mir das Blatt Papier und den Stift.«
Rannie vergaß seine Mutter, und sie ging und überließ die beiden sich selbst. Sein Vater malte eine Reihe von Zeichen auf das Papier.
»Dies sind die Bausteine, mit denen die Wörter gebildet werden – es gibt sechsundzwanzig davon. Und man nennt sie Buchstaben.«
»Alle Wörter?«, fragte er. »Alle Wörter in all den vielen Büchern?«
»Alle Wörter in allen Büchern – in unserer Sprache jedenfalls«, erwiderte sein Vater. »Und jeder Baustein hat eine eigene Bezeichnung und einen eigenen Klang. Ich nenne dir erst einmal die Bezeichnungen.«
Woraufhin sein Vater ihm wiederholt langsam und deutlich die Bezeichnungen der Buchstaben vorsagte. Und nach drei solchen Wiederholungen kannte er die Bezeichnungen jedes einzelnen Buchstabens. Sein Vater überprüfte es, indem er ihm die Buchstaben unsortiert aufschrieb. Aber er kannte sie alle.
»Gut«, sagte sein Vater mit einem überraschten Ausdruck im Gesicht. »Sehr gut. Jetzt dazu, wie man sie ausspricht. Jeder Buchstabe hat einen Klang.«
Eine Stunde lang hörte Rannie sehr aufmerksam zu, wie jeder Buchstabe klang, bis er schließlich freudig ausrief: »Jetzt kann ich lesen! Ich kann lesen, weil ich das alles weiß und verstehe.«
»Nicht so schnell«, sagte sein Vater zu ihm. »Buchstaben können außerdem noch unterschiedlich klingen, je nachdem, wie sie mit anderen Buchstaben zusammengesetzt sind. Aber für heute hast du genug gelernt.«
»Doch, ich kann jetzt lesen, weil ich weiß, wie Lesen geht«, beharrte er. »Ich weiß es, und deshalb kann ich es auch.«
»Na gut«, sagte sein Vater. »Dann probiere es aus. Du kannst mich immer fragen kommen.«
Und damit wandte er sich wieder seiner eigenen Lektüre zu.
Nach diesem verschneiten Samstag, als er drei Jahre alt war, verbrachte Rannie den Großteil seiner Zeit damit, allein das Lesen zu lernen. Anfangs musste er seiner Mutter noch viele Fragen stellen und rannte oft quer durchs Haus auf der Suche nach ihr, die immer irgendwo Betten machte, Fußböden fegte oder all die Dinge erledigte, die sie von morgens bis abends beschäftigten.
»Was ist das hier für ein Wort?«, fragte er dann.
Seine Mutter war stets geduldig. Was immer sie gerade tat, sie hielt inne und sah dorthin, wohin sein kleiner Zeigefinger zeigte.
»Das lange Wort da? Oh, Rannie, das wirst du ganz lange noch nicht benutzen – ›intellektuell‹.«
»Was heißt das?«
»Es heißt, dass man gern sein Gehirn benutzt.«
»Was ist das … Gehirn?«
»Das ist deine Denkmaschine – das, was du hier drin hast.«
Sanft tippte sie ihm mit ihrem rechten Zeigefinger, der in einem goldenen Fingerhut steckte, an den Kopf. Sie nähte gerade an eines der Hemden seines Vaters einen Knopf an.
»Ich habe da ein Gehirn drin?«, fragte er.
»Das hast du allerdings – sogar eins, das mir manchmal schon fast Angst macht.«
»Warum macht es dir Angst?«
»Oh, weil … weil du immer noch ein kleiner Junge bist, der noch keine vier Jahre alt ist.«
»Wie sieht mein Gehirn aus, Mama?«
»So wie das von allen anderen vermutlich – es ist eine runzlige graue Masse.«
»Aber warum macht es dir dann Angst?«
»Was du immer für Fragen stellst – « Sie hielt inne.
»Aber ich muss doch fragen, Mama. Wenn ich nicht frage, dann verstehe ich es nicht.«
»Du könntest im Wörterbuch nachsehen.«
»Wo ist das denn, Mama?«
Sie legte ihre Näharbeit schließlich aus der Hand und ging mit ihm in die Bibliothek zu einem großen Buch, das aufgeschlagen auf einem kleinen Tisch dalag, und zeigte ihm, wie man darin nach Wörtern suchte.
»›Intellektuell‹, zum Beispiel – das Wort beginnt mit einem i, nicht wahr, und hier sind all die Wörter mit i. Aber du musst auch darauf achten, welches der nächste Buchstabe ist – ia, ib, ic –, bis du zu in kommst …«
Völlig versunken und fasziniert hörte er zu und sah sich alles genau an. Dann war dieses große Buch also die Quelle aller Wörter! Hier war der Zugangsschlüssel, und er verstand das Prinzip!
»Jetzt werde ich dich nie wieder etwas fragen müssen, Mama. Jetzt kann ich alles ganz allein lernen.«
Rannie lebte in einer Kleinstadt, in der viele Menschen wohnten, die sehr viel älter waren als er. Es war eine Studentenstadt, und sein Vater unterrichtete jeden Tag außer Samstag und Sonntag am College. Am Sonntagvormittag ging Rannie mit seinen Eltern in die Kirche. Anfangs, als er noch klein war – denn mittlerweile hielt er sich nicht mehr für klein, schließlich wurde er in einer Woche vier Jahre alt –, wurde er zum Kindergottesdienst im Untergeschoss der Kirche gebracht. Aber das war nicht lange gut gegangen. Bald schon hatte er alle Bilderbücher angesehen, alle Puzzles zusammengesetzt und alle anderen Kinder dadurch, dass er so viel älter wirkte als sie, gehörig eingeschüchtert. Er war recht groß für sein Alter, hielt all die anderen für Kleinkinder und empfand es als Demütigung, mit ihnen zusammengesteckt zu werden. Ihr Geplapper war einfach albern, und nach zwei weiteren Sonntagen bat er seine Eltern darum, oben in der Kirche bei den Erwachsenen sitzen zu dürfen.
Sein Vater blickte zweifelnd drein und sah seine Mutter fragend an. »Glaubst du, er kann schon so lange still sitzen?«
»Ich sitze ganz still, versprochen«, warf er schnell ein.
»Probieren wir es aus. Unten gefällt es ihm ja nun mal nicht«, sagte seine Mutter.
Auch oben in der Kirche gefiel es ihm nicht so richtig, doch er dachte an das, was er seinen Eltern versprochen hatte, und hielt sich daran. In seinem Kopf allerdings arbeitete es unablässig. Sein Gehirn schaltete nicht einen Augenblick lang ab. Er dachte über die Wörter des Pastors nach, wobei er sich manchmal, anstatt ihren Zusammenhang zu beachten, mehr auf ihren Klang, ihre Schreibweise und ihre wörtliche Bedeutung konzentrierte. Sein unermüdliches Gedächtnis bewahrte jedes einzelne Wort, das ihm neu war, und wenn er nach Hause kam, schlug er die Wörter in seinem ständigen Begleiter, dem Wörterbuch, nach. Immer wieder einmal kam es vor, dass er dort keine Erklärung fand, und dann war er gezwungen, sich doch an seine Mutter zu wenden, denn es war ihm ganz und gar unerträglich, etwas nicht zu wissen.
»Mama, was bedeutet ›Jungfrau‹?«
Seine Mutter sah überrascht von der Schüssel auf dem Küchentisch auf, in der sie einen Teig anrührte. Sie zögerte. »Nun, das bedeutet wohl so viel wie ›nicht verheiratet‹, nehme ich an.«
»Aber Mama, Maria war verheiratet. Sie war mit Joseph verheiratet. Das hat der Pastor gesagt.«
»Oh, das – das versteht vermutlich niemand so richtig. Jesus wurde durch eine unbefleckte Empfängnis geboren, wie man sagt.«
Und wieder hatte er zwei neue Wörter gelernt. Weil das Wörterbuch sie so weit voneinander entfernt aufführte, versuchte er, sie selbst zusammenzusetzen. Doch das ergab keinen Sinn. Also schrieb er sie in Großbuchstaben ab, was bislang seine einzige Art des Schreibens war, und ging dann zurück in die Küche zu seiner Mutter. Sie war fertig mit Teigrühren, wusch bereits die Schüssel und den Löffel ab, und ein köstlicher Duft frischgebackenen Kuchens zog durch den Raum. Er zeigte ihr die aufgeschriebenen Wörter und beschwerte sich.
»Mama, ich verstehe es immer noch nicht.«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich kann es dir auch nicht erklären, mein Kind. Ich verstehe es selbst nicht so richtig.«
»Wie kann ich es denn dann herausfinden, Mama?«
»Frag deinen Vater heute Abend, wenn er nach Hause kommt, mein Sohn.«
Er faltete das Stückchen Papier und steckte es in seine Hosentasche. Doch noch ehe er seinen Vater fragen konnte, hörte er, wenn auch zufällig, ein Gespräch seiner Eltern mit an. Das Küchenfenster stand offen, als er draußen im Garten mit seinem Hund spielte oder vielmehr versuchte, ihm ein Kunststück beizubringen. Fast alle seine Spiele mit dem Tier hatten damit zu tun, ihm ein Kunststück beizubringen und herauszufinden, was Brick, sein Hund, lernen konnte und was nicht. Er lachte gerade über Bricks eifrige Bemühungen, auf den Hinterbeinen zu laufen, als er die aufbegehrende Stimme seiner Mutter durchs Küchenfenster hörte.
»George, einige Dinge wirst du Rannie erklären müssen. Das kann ich nicht tun.«
»Welche Dinge meinst du denn, Sue?«
»Nun, heute zum Beispiel, da hat er mich gefragt, was ›Jungfrau‹ bedeutet und was eine ›unbefleckte Empfängnis‹ ist. Solche Dinge!«
Er hörte seinen Vater lachen. »Na, was eine ›unbefleckte Empfängnis‹ ist, kann ich ihm ganz bestimmt auch nicht erklären!«
»Es wird dir wohl nichts anderes übrig bleiben. Du weißt, dass er nie etwas vergisst. Und er ist fest entschlossen, es herauszufinden.«
Auf diese Weise erinnert, überließ er seinen Hund sich selbst und lief aus dem Garten ins Haus, um seinem Vater diese Frage zu stellen. Sein Vater war bereits nach oben gegangen, wo er sich einen Pullover und eine bequeme Hose anzog. Der Frühling stand vor der Tür, und der Garten war schon umgegraben worden und zum Anpflanzen bereit.
»›Jungfrau‹?«, wiederholte sein Vater. Er hängte zunächst seinen Arbeitsanzug in den Kleiderschrank und sah dann aus dem Fenster.
»Siehst du den Garten dort unten?«, fragte er.
Rannie kam an seine Seite gerannt. »Mr Bates hat ihn heute Vormittag umgegraben.«
»Jetzt müssen wir Samen einpflanzen«, sagte sein Vater. »Denn …«
Er setzte sich hin und zog Rannie zwischen seine Knie, die Hände auf den Schultern des Jungen. »… denn solange wir in dieser umgegrabenen Erde keine Samen einpflanzen, haben wir keinen richtigen Garten. Stimmt’s?«
Rannie nickte, den Blick auf das gut aussehende Gesicht seines Vaters gerichtet.
»Das da draußen«, fuhr sein Vater fort, »ist nämlich noch jungfräuliches Ackerland – jungfräuliche Erde. Ganz allein kann sie all die Dinge, die wir haben wollen, nicht wachsen lassen. Alles fängt mit einem Samen an – Obst und Gemüse, Bäume und Unkraut – ja, sogar die Menschen.«
»Die Menschen auch?«, fragte Rannie erstaunt. »War ich ein Samen?«
»Nein«, erwiderte sein Vater. »Aber ein Samen war dein Ursprung. Ich habe diesen Samen gepflanzt. Deshalb bin ich dein Vater.«
»Was für einen Samen denn?«, fragte er erstaunt.
»Meine Art Samen«, sagte sein Vater schlicht.
»Aber … aber … wo hast du ihn denn gepflanzt?«
Fragen drängten ihm auf die Lippen. Er konnte sie gar nicht schnell genug stellen.
»In deiner Mutter«, sagte sein Vater. »Bis dahin war sie eine Jungfrau.«
»Eine unbefleckte Empfängnis?«
»Hm, ich glaube schon.«
»Empfängnis …«
Sein Vater unterbrach ihn. »… kommt vom lateinischen Wort ›conceptio‹ und bedeutet so viel wie ›Vorstellung‹ – eine abstrakte Vorstellung –, also etwas, das zuerst nur ein Gedanke ist. Und dann wird es zu mehr, eben zu einer Konzeption – und dann zu einer – «
»Ich war eine Konzeption?«
»In gewisser Weise – ja. Ich sah deine Mutter, habe mich in sie verliebt und wollte sie zu meiner Ehefrau und deiner Mutter machen. Das war meine Vorstellung, meine Konzeption. Und als du deinen Anfang nahmst, war es eine ›conceptio‹, eine Empfängnis.«
»Als Jesus – «
Wieder unterbrach sein Vater ihn. »Oh, wir wissen, dass er aus Liebe geboren wurde. Das ist der Grund, weshalb wir es die ›unbefleckte Empfängnis‹ nennen. Es war aber nicht Joseph, der den Samen gepflanzt hat. Er war schon etwas zu alt, um einen Samen zu pflanzen. Aber Maria war jung – noch eine Jungfrau vielleicht. Und jemand, der sie sehr liebte, hat den Samen gepflanzt. Das wissen wir – jemand, der etwas höchst Außergewöhnliches war, denn sonst wäre nicht ein so außergewöhnliches Kind geboren worden.«
»Wo hat er ihn denn gepflanzt? Wo hast du – «
»Ah, da kommt schon die nächste Frage! Der Samen wird im Körper der Frau, der Mutter, gepflanzt. Dort gibt es eine Art Garten, einen kleinen geschützten Ort, wohin der Samen fällt – und wo er zu wachsen beginnt. Diesen Ort nennt man Gebärmutter, und dort wachsen die Kinder heran.«
»Habe ich auch so was?«
»Nein, du bist ein Samenpflanzer, so wie ich.«
»Wie macht man – «
»Das Werkzeug dafür ist der Penis, und es gibt einen Gang zur Gebärmutter, der Vagina heißt. Schlag die beiden Wörter im Wörterbuch nach.«
»Kann ich auch schon einen Samen pflanzen?«
»Nein. Dazu musst du erst erwachsen werden. Du musst ein Mann sein.«
»Kannst du es machen, wann immer du willst?«
»Ja – aber ich möchte es nur dann machen, wenn deine Mutter dazu bereit ist. Sie ist es schließlich, die den Samen in sich heranwachsen lassen muss, sich darum kümmern muss und so weiter. Ein Garten muss vorbereitet werden, wie du ja dort draußen siehst.«
»Kann Brisk Hundesamen pflanzen?«
»Das kann er.«
»Und kriegen wir dann Welpen? Ich möchte gerne Welpen haben.«
»Dazu müssen wir uns einen Mutterhund suchen.«
»Wie erkennen wir den denn?«
»Nun, daran dass er, anders als Brisk, keinen Penis hat. Ein Penis ist ein Pflanzwerkzeug, wie du nun ja weißt.«
»Hat Mama – «
»Nein. Ich habe dir doch gesagt, dass du es im Wörterbuch nachschlagen sollst. Und jetzt komm mit hinaus und hilf mir die Erde im Garten locker aufzuhacken. Das ist jetzt erst mal deine Aufgabe.«
Dennoch hörte Rannie keinen Augenblick lang auf, über den Samen nachzudenken. Alles auf der Welt, alles, was lebte, fing mit einem Samen an! Aber woher kam dieser Samen? »Am Anfang«, intonierte der Pastor eines Sonntagvormittags in der Kirche, »am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort.«
»Ist Gott dasselbe wie der Samen?«, fragte er später auf dem Weg nach Hause seinen Vater.
»Nein«, erwiderte sein Vater. »Und frag mich jetzt bitte nicht, was Gott ist, denn das weiß ich auch nicht. Ich bezweifle, dass überhaupt irgendjemand es weiß, auch wenn jeder Mensch von einiger Intelligenz sich diese Frage wohl stellt, jeder auf seine eigene Weise. Es scheint so, als sollte es – oder als müsste es sogar – einen Anfang geben, doch dann wiederum … vielleicht gibt es einfach keinen. Vielleicht leben wir in der Ewigkeit.«
»Worüber du immer redest!«, warf seine Mutter ein. »Das kann der Junge doch noch gar nicht verstehen.«
»Er versteht es«, erwiderte sein Vater.
Der Junge sah vom einen zum anderen der beiden, die seine Eltern waren, und liebte seinen Vater noch umso mehr.
»Ich verstehe es wirklich«, sagte er.
Als Rannie sechs Jahre alt war, wurde er eingeschult. Es war ein frischer Herbstmorgen, und an diesem Morgen sollte ein neues Leben für ihn beginnen. Seine Mutter hatte ihm in der Woche zuvor einen Stoffanzug gekauft, einen blauen, und sein Vater hatte ihn zum Friseur gebracht, wo ihm die Haare geschnitten wurden.
»Bin ich hübsch?«, fragte er seine Mutter, als er in der Tür stand.
Sie lachte. »Was für ein komischer kleiner Kerl du doch bist!«
»Warum sagst du denn, dass ich komisch bin?«, fragte er erstaunt und fast ein wenig verletzt.
»Weil du solche Fragen stellst«, erwiderte sie.
»Genau genommen bist du sogar sehr hübsch«, schaltete sein Vater sich ein, »und dafür solltest du dankbar sein. Denn gutes Aussehen ist auch für einen Mann von Vorteil, wie ich in meinem Leben festgestellt habe.«
Jetzt lachte seine Mutter sogar noch lauter. »Oh, Eitelkeit – Eitelkeit, dein Name ist Mann!«
»Was ist Eitelkeit …?«, begann er, doch seine Mutter versetzte ihm einen liebevollen Knuff.
»Stell all deine Fragen einfach in der Schule«, riet sie ihm.
Auf dem Weg zur Schule, die in dieser beschaulichen Studentenstadt nur einen halben Kilometer entfernt war, sodass er den Weg gut zu Fuß bewältigen konnte, dachte er über die große Bedeutung dieses Tages nach.
Jetzt werde ich endlich alles, alles lernen, dachte er. Sie werden mir beibringen, wie man Maschinen baut, und mir erzählen, woher der Samen kommt, und mir erklären, was Gott ist.
Die friedliche Morgenstunde erfüllte ihn mit Zuversicht und Freude. Die Schule war der Ort, wo er alles lernen konnte. Er würde eine Lehrerin haben, und all seine Fragen würden jetzt beantwortet werden. Als er schließlich den Schulhof erreichte, spielten dort Kinder, Jungen und Mädchen seines Alters. Manche hatten ihre Mütter dabei, weil es ihr erster Tag in der Schule war. Und auch seine Mutter hatte gesagt: »Vielleicht sollte ich an diesem ersten Schultag besser doch mit dir gehen, Rannie.«
»Warum denn?«, hatte er gefragt.
Sein Vater hatte nur gelacht. »Genau, warum eigentlich! Er hat recht – er ist doch schon recht selbstständig.«
Auf dem Schulhof blieb er bei den anderen Kindern gar nicht erst stehen. Einige von ihnen kannte er zwar, aber es waren keine Spielkameraden von ihm. Kinder langweilten ihn rasch, wenn sie zu ihm nach Hause in den Garten zum Spielen kamen, und er las ohnehin lieber ein Buch, als Spiele mit ihnen zu spielen. Seine Mutter protestierte hin und wieder dagegen.
»Rannie, du solltest aber mit anderen Kindern spielen.«
»Warum denn?«, fragte er dann.
»Weil es Spaß machen würde«, sagte sie.
»Ich habe allein Spaß«, erwiderte er. »Außerdem macht das, was ihnen Spaß macht, mir keinen Spaß.«
Deshalb ging er jetzt direkt in das Schulgebäude hinein und fragte einen Mann, wo das Zimmer der ersten Klasse sei. Der Mann betrachtete ihn aufmerksam, er war grauhaarig – sein Gesicht aber wirkte noch jung.
»Du bist doch Professor Colfax’ Sohn, nicht wahr?«
»Ja, Sir«, sagte Rannie.
»Ich habe schon von dir gehört. Ich war früher einmal ein Klassenkamerad deines Vaters – lange vor deiner Geburt. Ich bin Jonathan Parker, dein Schuldirektor. Dann komm mal mit. Ich werde dich vorstellen.«
Er legte Rannie eine Hand auf die Schulter und führte den Jungen einen Korridor entlang und um eine Ecke herum und blieb schließlich vor der ersten Tür rechts stehen.
»Da sind wir. Das hier ist dein Klassenzimmer. Und das ist deine Lehrerin, Martha Downes – Miss Downes. Sie ist eine gute Lehrerin. Miss Downes, das ist Randolph Colfax – oder kurz Rannie.«
»Guten Tag, Miss Downes«, sagte Rannie.
Er blickte in ein faltiges Gesicht mit Brille, das zwar freundlich dreinsah, aber nicht lächelte.
»Ich habe dich schon erwartet, Rannie«, sagte sie. Sie gaben einander die Hand.
»Dein Platz ist dort am Fenster. Jackie Blaine sitzt an der einen Seite neben dir und Ruthie Greene an der anderen. Kennst du die beiden?«
»Noch nicht«, sagte Rannie.
In diesem Augenblick erklang die Schulglocke, und all die anderen Schüler kamen die Korridore entlanggerannt. Die meisten Erstklässler hatten ihre Mütter dabei, und einige der Mädchen weinten, als ihre Mütter schließlich gingen. Ruthie war eine von ihnen. Er beugte sich zu ihr hinüber.
»Wein doch nicht«, sagte er zu ihr. »Es wird dir Spaß machen, Dinge zu lernen.«
»Ich will nichts lernen«, schluchzte sie. »Ich will nach Hause.«
»Ich bringe dich nach der Schule auch nach Hause«, versprach er ihr. »Wenn du nicht mit dem Bus gefahren bist.«
Sie wischte sich die Augen mit einem Zipfel ihres rot karierten Baumwollrocks ab. »Wir sind nicht mit dem Bus gefahren. Ich bin mit meiner Mutter zu Fuß gekommen.«
»Dann bringe ich dich zurück«, versprach er noch einmal.
Im Ganzen jedoch war der Tag eine Enttäuschung. Er lernte nichts Neues, da er schon lesen konnte. Er las seine erste Lesefibel durch, während Miss Downes vorne an der Tafel die Buchstaben und deren Klang erklärte. Die halbe Stunde, in der sie mit Buntstiften malen durften, gefiel ihm, denn er entwarf gerade eine Maschine mit Schaufelradantrieb, die er in den Damm einbauen wollte, den er zurzeit in dem kleinen Bach aufschüttete, der durch das einen halben Hektar große Grundstück hinter dem Haus seiner Eltern floss.
»Was ist das denn?«, fragte Miss Downes und betrachtete seine Zeichnung prüfend durch die untere Glashälfte ihrer Brille.
»Das ist ein Wasserrad«, erwiderte er. »Ich bin aber noch nicht fertig damit.«
»Was für einen Zweck soll es denn erfüllen?«, fragte die Lehrerin.
»Es soll die Fische im Teich an der oberen Bachseite halten. Sehen Sie, wenn sie hinunterschwimmen, hält diese Schaufel hier sie auf.«
»Und was, wenn sie hinaufschwimmen?«, fragte sie.
»Dann hilft die Schaufel ihnen hindurch – und zwar so.«
Sie betrachtete ihn eine Weile mit durchdringendem, aber freundlichem Blick, und schließlich sagte sie zu ihm: »Mein Junge, du gehörst nicht hierher.«
»Wohin gehöre ich denn?«, fragte er.
»Das weiß ich auch nicht«, erwiderte Miss Downes beinahe traurig. »Und ich bezweifle, dass irgendjemand das jemals wissen wird.«