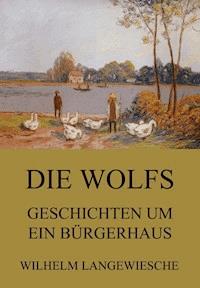
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der Autor erzählt in zwei Bänden die Chronik der Familie Wolf von der Zeit Napoelons bis zur Errichtung des letzten Kaiserreichs.
Das E-Book Die Wolfs - Geschichten um ein Bürgerhaus wird angeboten von Jazzybee Verlag und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 661
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Die Wolfs - Geschichten um ein Bürgerhaus
Wilhelm Langewiesche
Inhalt:
Die Familie Langewiesche
Die Wolfs - Geschichten um ein Bürgerhaus
Erstes Buch: Im Schatten Napoleons
Zweites Buch: Vor Bismarcks Aufgang
Wolfs Geschichten um ein Bürgerhaus, Wilhelm Langewiesche
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
Loschberg 9
86450 Altenmünster
ISBN: 9783849630218
www.jazzybee-verlag.de
Die Familie Langewiesche
Die Familie Langewiesche führt ihren Stammsitz auf den 1343 zum ersten mal urkundlich erwähnten »Schultenhof zu Möllenkotten« in der Grafschaft Mark zurück. Die Buchhändler aus dieser Familie beginnen indessen erst mit dem am 4. Dezember 1807 geborenen Wilhelm Langewiesche, der nach einer gründlichen wissenschaftlichen Ausbildung seine Lehrzeit in der altberühmten Buchhandlung von G. D. Baedeker in Essen bestand und dann bei Enslin in Berlin als Gehilfe arbeitete. Schon mit 23 Jahren machte er sich selbständig und begründete am 16. September 1831 ein eigenes Geschäft in Iserlohn. Vier Jahre später siedelte Langewiesche nach Barmen über, wo er in der Mittelstraße eine Buchhandlung eröffnete.
Neben dem Betriebe des Sortimentsgeschäfts, für das die Räumlichkeiten wiederholt zu eng wurden, beschäftigte er sich auch mit Verlag. Er gab gern jungen Schriftstellern Gelegenheit, ihre Erstlingswerke zu veröffentlichen, und auch mancher bekannte Name befindet sich unter den Verfassern seiner Verlagswerke, z.B. Ferd. Freiligrath, Levin Schücking, Prof. K. Rosenkranz, Dr. Rud. Stier, Prof. Lange, Missionsinspektor Dr. Fabri, Dr. E. Kleinpaul, Prof. Neumann u. a. Mit vielen Dichtern und Schriftstellern stand er in regem persönlichen Verkehr. Namentlich den aufstrebenden Talenten im Wuppertale ging er stets gern mit Rat und Tat zur Seite. Autoren wie F. W. Hackländer, Reinh. Neuhaus, Emil Rittershaus, Carmen Sylva und nicht zum wenigsten Ferd. Freiligrath, suchten und fanden bei Langewiesche, dem klar und besonnen urteilenden Manne, Anregung und Förderung. Auch er selbst war literarisch tätig, besonders, nachdem er im Jahre 1866 das Sortimentsgeschäft seinem ältesten Sohne übergeben hatte. So veröffentlichte er Gedichte, in denen sich sein tiefreligiöses Empfinden bekundete, unter dem Titel: »Vorhofklänge eines Wahrheitssuchers«, eine Studie über das heilige Abendmahl und verschiedene andere Schriften. In hervorragendem Maße wandte er sein Interesse der Umgestaltung einer in seinem Verlage erschienenen, ursprünglich von Dr. Kleinpaul verfassten »Poetik« zu. Mit unermüdlichem Eifer hat er in den folgenden Auflagen das kleine Schriftchen zu einem ausführlichen, dreibändigen Werke über deutsche Dichtkunst ausgearbeitet, das sich noch heute eines großen Ansehens in der literarischen Welt erfreut.
Das Iserlohner Geschäft gab Langewiesche 1838 an Georg Müller ab, der dasselbe unter eigenem Namen weiterführte. 1858 nahm er seinen erstgeborenen Sohn Wilhelm Robert Langewiesche als Teilhaber seines Barmer Geschäftes auf. 1869 erwarb das Sortiment Otto Glaser, von welchem es 1883 an Adolf Graeper kam.
Die Verlagsabteilung des alten Langewiescheschen Stammgeschäftes, welche 1867 noch den Debit der Verlagsartikel von J. F. Steinhaus in Barmen übernommen hatte, siedelte 1872 nach Leipzig über. Als der Begründer des Geschäftes im Alter nach Godesberg zog, übernahm der Sohn, der seit 1869 die von Theodor Hahn in Rheydt erkaufte, 1845 gegründete Buchhandlung besaß, die Firma, verkaufte aber, ein Jahr nach dem Tode des Vaters, 1885, den Verlag an M. Heinsius in Bremen. Seit 1903 ist das Rheydter Geschäft, welches nach des Vaters Tode der älteste Sohn Wilhelm Langewiesche übernommen hatte, im Besitze von Karl Weber. Wilhelm Langewiesche ist Verfasser von vielen feinsinnigen Gedichten, die z. T. gesammelt sind in: Morgentau; Planegg;... und wollen des Sommers warten; er ist ferner Verfasser des anonym erschienenen Buches »Frauentrost« Gedanken für Männer, Mädchen und Frauen. – Er gründete 1906 unter der Firma W. Langewiesche-Brandt einen Verlag für schöne Literatur und Jugendkunst. Unter dem Sammeltitel »Bücher der Rose« erschienen und fanden eine außerordentlich weite Verbreitung: »Die Ernte aus 8 Jahrhunderten der Lyrik«; »Alles um Liebe«; »Göthes Jugendbriefe«; »Vom tätigen Leben«; Goethes Mannesbriefe« u. a.
Der zweite Sohn des Rheydter Langewiesche, Karl Robert Langewiesche, begründete 1902 in Düsseldorf jenen eigenartigen Verlag, der heute überall sich größter Wertschätzung erfreut. Von der prächtigen Sammlung »Lebende Worte und Werke« sind bis jetzt 6 Bände erschienen. Weiter ist zu nennen die Sammlung »Der Brunnen«, eine Sammlung ernster Bücher, ferner das Hausbuch deutscher Art »Die Freude«, die Blätter deutscher Zukunft »Das Suchen der Zeit« u.a.m.
Im Jahre 1864 erwarb Wilhelm Langewiesche die im Besitze von W. Rackhorst befindliche W. Hasselsche Sortimentsbuchhandlung in Elberfeld und erteilte gleichzeitig Adolf Langewiesche Prokura. 1873 zweigte letzterer den inzwischen in seinen Besitz übergegangenen Verlag ab, verkaufte das Sortiment an Albert Mosel und verlegte die Verlagsbuchhandlung unter eigener Firma unter gleichzeitiger Gründung eines Sortimentsgeschäftes und einer Lokalzeitung nach Godesberg. Mosel hat das Elberfelder Sortiment 1876 an Theodor Thieme verkauft.
Der dritte Sohn Ludwig des Wilh. Langewiesche senior gründete in den 70. Jahren des verflossenen Jahrhunderts in Barmen eine Buchdruckerei, welche seit seinem Tode in erweiterter Form von seinen Söhnen weitergeführt wird.
Hans Langewiesche, dritter Sohn des Adolf Langewiesche in Godesberg, erwarb am 1. Juli 1900 die 1877 gegründete E. Rustsche Buchhandlung in Eberswalde, seit 1895 im Besitze von J. Courtois. Letzterer hatte das Geschäft von Erich Heller
Die Wolfs - Geschichten um ein Bürgerhaus
Erstes Buch: Im Schatten Napoleons
Alles Kornes innerste Natur meinet Weizen Alles Metall meinet Gold Alle Geburt meinet den Menschen
Ein Maurermeister, der noch in keine Fachschule gegangen war, hatte um Achtzehnhundert das Haus den Wünschen des Bauherrn gemäß erbaut und dabei, vielleicht so unbewußt wie ungewürdigt, ein feines Gefühl für Formen, Raum und Maße bekundet. Das Wohnhaus lag, ein wenig zurück, an der Hauptstraße, und wenn es zwischen den Nachbarhäusern, aus denen es in engster Verbindung hervorwuchs, wie ein König unter Hirten wirkte, so war das weder unbeabsichtigt, noch ungerechtfertigt. Denn in jenen wohnten Kleinbürger und in ihm wollte J. P. Wolf, der großmächtige Maire des Städtchens, hausen, den nach unverhofft frühem Aufstieg zu solcher Würde, obschon sie seiner Länge keine Elle zugesetzt hatte, niemand mehr "et Wölfche" nannte. Wußte man doch, daß zwischen ihm und dem Ersten Konsul nur noch der Präfekt stand. Ja, er war wirklich ein kleiner König und er sollte es sein, er sollte den Gemeinderat möglichst selten anhören. Daß ihm sein Amt nichts einbrachte, brauchte J. P Wolf nicht zu beunruhigen, für den in allen Dörfchen der fruchtbaren niederrheinischen Ebene ringsum auf hunderten von Stühlen die Weberschiffchen tagaus tagein unermüdlich hin- und herliefen. Es war aber um die Zeit, da das von alters her in dieser Gegend heimische Leinen, durch die bis an den Rhein vorgerückten französischen Zollgrenzen der westfälischen und schlesischen Konkurrenz glücklich enthoben, mit zwei neuen Todfeinden den Kampf aufnehmen mußte: Die Baumwolle, aus Holland durch den Seewind über die nahe Grenze geblasen, aus dem Wuppertale durch die niedrigeren Arbeitslöhne magnetisch angezogen, und die Seide, von Krefeld aus energisch vorgeschoben, suchten ihm arbeitwillige Hände abspenstig zu machen. Mit Weitblick und Erfolg hatte der Maire, nachdem er in jungen Jahren behend und doch gründlich in der Welt sich umgetan, auch wohl ein Weniges über die Stränge geschlagen, seine Tatkraft nun auch vor die Baumwolle gespannt, ohne der leinenen Überlieferung seiner Väter untreu zu werden. Sichtbarlich ruhte ein Segen auf seiner Unternehmung. Der glänzte als überlegene Heiterkeit auf dem glattrasierten, roten und rundlichen Antlitz des Dreißigjährigen, knisterte festlich in der gestickten Weste und der seidenen Halsbinde, die, durch eine goldene Nadel verbunden und gebändigt, ruhevoll vor dem hochragenden Samtkragen des dunkelblauen Rockes wogte, und umgab ihn mit einer Wolke von Sauberkeit und Wohlwollen – "Gnade bei Gott und den Menschen" wie sein Schwiegervater, der Pastor Pieper, meinte. Wie sollte er nun solchen Segen nicht auch durch die Behäbigkeit der neuen Behausung zum Ausdruck bringen, die sich aufsammelnden Schätze nicht würdig zu bewahren trachten? Nicht nur vor Rost und Mottenfraß, sondern auch vor Räubern, von denen noch immer einzelne Banden den niederrheinischen Bürger bedrohten.
Schwervergittert waren darum die Fenster des Kellergewölbes, die in Höhe der nachbarlichen Erdgeschoßfenster saßen und hinter denen in verdunkelter Kühle die vielen guten Weine lagerten, die besonderen Pfleglinge des Hausherrn. Die sollte ihm der "Schafsheinrich" nicht austrinken, wenn er wiederkäme! Denn auf die Nachtwächter war ja kein Verlaß! Das eine Mal, als "dat Studentche", Damian Hessel, den die Holländer, Gott sei's gedankt, jetzt auf die Galeere geschickt hatten, ihnen zurief, sie sollten mitkommen und Soldaten werden, da waren sie ausgerissen, und das andere Mal hatte "dat Generalche", das, Gott sei's geklagt, immer noch dem Arm der Gerechtigkeit sich zu entziehen wußte, sie geknebelt vor die Tür der einstigen Pastoratsscheune legen lassen, die jetzt als Schulhaus diente, wo dann am Morgen die frühesten der Buben den sonst so gefürchteten Hütern der Obstbäume Bedauern und Befreiung nicht versagten. Nein, auf die war kein Verlaß! – Und eine richtige Spitzbubenfalle, wie sie vor einem Vierteljahrhundert der misogyne Sonderling, der alte Graf Kessenich draußen auf Haus Duynburg sich eingerichtet hatte, ließ sich in das neue Haus doch nicht wohl einbauen. Der hatte neben dem Einfahrtstor, das täglich, sobald es anfing zu dunkeln, geschlossen und verrammelt ward, ein hochsitzendes Fensterchen geflissentlich unvergittert gelassen, darunter auf der Hofseite der tiefe Ziehbrunnen sich befand. Und jeden Morgen, den Gott werden ließ, mußte sein Diener und einziger Hausgenosse, der greise Ephraim, nachsehen, ob etwa ein Dieb im Brunnen läge. Was aber nie der Fall war, denn die Tücke des Fensters war so wenig Geheimnis geblieben wie die Armut des alten Herrn, dem die verpachteten Äcker nicht einmal Pferd und Wagen zu halten erlaubten.
Daß die beiden hohen und breiten Steintreppen, die der Maire von rechts und links zur schweren Haustür emporführen und vor dieser eine balkonartige Plattform bilden ließ, späteren Bürgermeistern ein Stein täglichen Anstoßes werden sollten, das freilich konnte er nicht voraussehen, und wenn er's gekonnt hätte, würde er sie doch angelegt haben. Einmal, weil Jan Bosbeck, der Schändliche, den Gott strafe, dieser Jan Bosbeck, dessen Bande nach vollbrachtem räuberischen Überfall in geschlossener Ordnung unter dem Gesang der Marseillaise abzuziehen pflegte, jetzt wenigstens den gefürchteten Rennbaum nicht gegen die Haustür sausen lassen konnte, sintemal ihm der Platz zu wuchtigem Anlauf gefehlt hatte. Dann aber auch, weil der Maire erkannte, daß er von keiner Stelle aus so stattlich zu einer wohlgesinnten Bürgerschaft werde reden können, wie von der Plattform dieser Treppe, die ganze Wirkung des Hauses hinter sich. Und nicht nur er, sondern – wer weiß – vielleicht auch der eine oder andre hohe Gast seines Hauses. Napoleon freilich, als er an dem heißen Nachmittag des 11. September 1804 mit seinen Mamelucken und großem Gefolge das Städtchen durchflog, dachte nicht daran, seinen achtspännigen Reisewagen an dieser Treppe oder sonst wo halten zu lassen. Aber 1810 hat Ladoucette, der Präfekt des Roer-Departements, von ihr aus zu den Bürgern gesprochen, die unter Freudentränen einander umarmend sich selig priesen, Untertanen des großen Friedenskaisers zu sein, den ein protestantischer Pfarrer in der Eifel soeben als "die Liebe und das Vergnügen des Menschengeschlechtes" gefeiert hatte ... Zu denselben Bürgern, die mit ebenso ehrlicher Begeisterung einige dreißig Jahre später den vierten Friedlich Wilhelm von Preußen an derselben Stelle stehen sahen und dem gänzlich unkriegerischen Herrn durch ein kräftiges "Heil dir im Siegerkranz" huldigten. Diesen hohen Tag seiner Stadt und seines Hauses freilich, wie so manchen späteren, sollte der Maire leider unter seiner Sandsteinplatte draußen auf dem Friedhof verschlafen.
In bedauerlicher Ermangelung eines Familienwappens ließ I. P. Wolf über der Haustür aus Stein gemeißelt die römische saugende Wölfin anbringen, was dem überaus züchtigen Sinn seiner Hausfrau Maria Magdalena, der Tochter des Pfarrhauses schräg gegenüber am Marktplatz, peinlich genug war, von ihrem Vater, dem Pastor Pieper, aber durchaus gutgeheißen ward, weil er die Antike schätze und weder an der menschenfreundlichen Wölfin, noch an seinem Schwiegersohn den mit Recht gefürchteten Schafspelz wahrzunehmen vermöge.
Den durch solches Bildnis hervorgerufenen Eindruck klassischer Strenge verstärkte der breite, niedrige Giebel, der, durch zwei Stockwerke von der Haustür getrennt, und getragen von zwei glatten, flachen, die Wand aufs schönste gliedernden Pilastern, aus dem schwarzen Schieferdach herauswuchs. Inmitten dieses Giebels saß ein kreisrundes Fensterchen, aus dem, so oft in beruhigender Ferne die französischen Waffen gesiegt hatten, die Trikolore wehte, aus dem aber seit 1815 alljährlich an Königs-Geburtstag eine mächtige schwarz-weiße Stange herausschaute, die Trägerin einer gleichfalls schwarz-weißen Fahne von so ungeheurer Länge, daß, wer auf der Treppenplattform stand, ihren Saum beinahe greifen konnte. Von der Rückseite des Hauses gingen zwei wesentlich niedrigere Seitenflügel aus, zwischen denen ein gepflasterter Hof lag, und die an ihren Enden im rechten Winkel sich verbanden, ein großes, schmiedeeisernes Tor überbauend. In diesen Seitenflügeln befanden sich außer Pferdestall, Gärtner- und Kutscherwohnung das Kontor, die Wiegekammer und zahlreiche Lagerräume für die Erzeugnisse der Hausweber, die ringsum im Lande für I. P. Wolf arbeiteten.
So war das Haus beschaffen, das um Achtzehnhundert erstand und das, als es den Wohnansprüchen der Nachkommen längst nicht mehr genügte und die Industrie die Einwohnerzahl des Städtchens verzwölffacht, die Zahl der städtischen Beamten aber unter der preußischen Regierung sich verdreißigfacht hatte, um Neunzehnhundert durch die Brüder Elias und Abraham Schlesinger aus Köln erworben und durch einen Umbau von verblüffender Kühnheit in ein Warenhaus "großen Stiles", wie sie sagten, verwandelt ward.
Wer zu des Maire Zeiten den Hof durch das schmiedeeiserne Tor verließ, sah sich auf der Bachstraße, die, die Hauptstraße in immer gleichem Abstand begleitend, nur an dieser Seite mit Häusern bestanden war. An ihrer anderen Seite floß ein Bach, der sich keines eigenen Namens erfreute, sondern kurzweg "die Bach" genannt ward. Jenseits des Baches dehnten die Gärten sich aus, mit denen die Stadt hier in die weite und fruchtbare Ebene überging. Die war leicht gewellt und mit ihren zerstreuten, unter Obstbäumen halbversteckten Dörfchen, ihren vielgewundenen hellen Wegen, einzelnen Baumgruppen und mancherlei unregelmäßigen Streifen niedrigen Buschwerks heiter, fast lustig anzusehen, denn die Verkoppelungsideen einer weisen Königlich Preußischen Staatsregierung schliefen noch im Dunkel fast eines Jahrhunderts.
Auch dem schmiedeeisernen Tor des Wolfschen Hofes gegenüber setzte, stattlicher als die andern, eine Brücke über den Bach. Die führte zu dem großen alten Garten, der der Familie schon vor der Erbauung des neuen Hauses jahrzehntelang gehört hatte. Der Eintretende mußte zunächst die große runde Gruppe alter Bäume und Sträucher umgehen, die den Einblick in den Garten von der Bachstraße aus verhinderte, wie denn auch die Grenzen ringsum durch alte Bäume und dichtes Gesträuch geschlossen waren. Die Mitte des Gartens war baumlos, und gegliedert durch einen in seine Tiefe führenden Hauptweg, der von vielen Nebenwegen rechtwinkelig geschnitten oder in mäßigen Abständen begleitet ward. Buchs faßte die Wege ein und nicht Kies, sondern feiner, roter Sand bedeckte sie, der nicht geharkt, sondern gewalzt und gefegt werden mußte, denn der Maire wünschte bequem und unhörbar zu gehen. Auf den Beeten gediehen Obst, Gemüse und Blumen, und der Stolz auf deren besondere Fülle, Güte und Schönheit war in der Wolfschen Familie erblich. Im letzten Teil des Gartens aber hörten Beete und Querwege auf, hier durchschnitt der Hauptweg eine große Rasenfläche, um dann zwischen zwei Zedern, die die weiche niederrheinische Luft zu wahren Prachtstücken hatte gedeihen lassen, vor der Tür eines weißen Gartenhäuschens mit bescheidenen Andeutungen von Rokoko zu enden. Das Häuschen enthielt einen größeren Raum, dessen Einrichtung, wenn auch nicht mehr prächtig, so doch noch ganz wohnlich anmutete, obwohl der Name "Gartensaal" trotz der großartigen chinesischen Tapete nicht ganz zu passen schien, und zwei kleine Nebenzimmer. Aus den tief hinuntergehenden Fenstern des Gartensaals hatte man an den Zedern vorbei hübsche Blicke in den Garten. Überraschend schön aber war die Aussicht über das weite Land von einem der Nebenzimmer aus, in dem ein paar Stufen zu einem behaglichen Fensterplatz emporführten. Besonders zur Zeit der Flachsblüte. Dann war der kleine Raum von Licht und lauter Bläue erfüllt. Denn unter dem zartblauen Himmel dehnte sich hier im Flimmern der Sommerluft der wunderblaue Teppich eines schier endlosen Flachsfeldes aus.
Das Gartenhaus hatte seine Geschichte, die nicht immer Pastor Piepers Beifall gefunden haben würde, am wenigsten die Blätter, die sein Schwiegersohn, der Maire, im letzten Jahr seines Junggesellenlebens beschrieben hatte.
Nicht lange nach dem Tode seines Vaters war nämlich dem "Wölfche" eines Tages in Köln ein schönes großes Fräulein über den Weg gelaufen, das von einem französischen Offizier aus Bayern entführt, in Wesel verlassen worden und nun auf der Heimreise sein wollte. Das hatte er ohne sonderliche Mühe zu einem kleinen Umweg und heimlichen Sommerfrischlern verleitet und vorläufig hier einquartiert, die Verfolgung solch werten Gastes der Kutschersfrau anvertrauend. Die sah sich dadurch täglich in nicht geringer Verlegenheit, denn wie richtig sie auch die Gesamtlage beurteilte – was hinter der niedrigen Stirn ihres dunkelhaarigen Schützlings vorging, mochte es nun wenig oder viel sein, das blieb ihr völlig verborgen. Denn sie verstand von dem, was jene ihr erzählte, nicht viel mehr als von den Liedchen, die das fremde Mädchen zuweilen mit dunkler und ein wenig belegter Stimme sang, wobei sich der einfachen Schönheit des länglichen Antlitzes der Ausdruck einer unschuldigen und unbewußten Schelmerei verband:
Wann i erst außi schau, wos Lüfterl is schö blau, sich i die Stadt, die schö, mit die zwoa Kirchturm steh.
Nach Verlauf einiger Wochen, als I.P.Wolf schon erwog, wie er sich des fremden Fräuleins auf eine gute Manier wieder entledigen könne, fand er bei seinem abendlichen Besuch das Gartenhäuschen leer. Der hübsche Vogel war entflogen. Doch sieh da: Am Spiegel stak ein Brief, darin Mamsell Kathi in großen, unsichern Schriftzügen ihm kundtat, sie sei der geraden und wohlgepflegten Wege seines Gartens überdrüssig und wolle hinfort lieber wieder auf den unterhaltsameren ihres früheren Lebens wandeln.– "Laß fahren dahin, laß fahren!" tröstete sich der Maire, der seinen Schiller kannte.
Im folgenden Sommer aber las Pastors Lenchen, die blonde und ein wenig kurzsichtige Frau Maria Magdalena, als I. P. Wolfs vielbeneidete junge Gattin im Gartensaal ihren Freundinnen St. Pierres Paul und Virginie vor, denn sie war eine schöne Seele und hatte das Lehrhafte.
Es war sozusagen noch während des Bauens, daß I. P. Wolf mit seiner Frau Maria Magdalena das neue Haus bezog. Aber gegen einen nächtlichen Angriff Jan Bosbecks erschien es hinreichend gesichert, und daß bei Tage noch allerlei Handwerker in ihm ihr Wesen hatten, hinderte die junge Frau nicht, in der Nacht vom 14. auf den 15. September 1800 den sehnlichsten Wunsch ihres Mannes zu erfüllen so gut sie konnte. Das Kindlein, durch dessen Erscheinen das neue Haus erst die rechte Weihe erhielt, war, was erste Kinder immer sein sollen: ein kräftiger Stammhalter, der noch im selben Herbst von seinem Großvater, dem Pastor Pieper, auf den Namen seines längst verstorbenen andern Großvaters Friedrich Wilhelm getauft ward. Der liebe Junge gehe mit dem Jahrhundert, hatte der Pastor ausgeführt, aber er solle nicht mit ihm vergehen, sondern zum mindesten in Söhnen und Enkeln noch die folgenden Jahrhunderte bereichern. Das Kindlein brüllte hierzu, aber Frau Maria Magdalena bewahrte die väterlichen Worte in ihrem Herzen. Sie zog sich frühzeitig zurück und im Dämmerlicht der winzigen Flamme, deren Docht auf dem Öl des Nachtlichtchens schwamm und deren Schein an der weißen Zimmerdecke sich sacht bewegte, lauschte sie behaglich mal auf die sich nähernden und wieder entfernenden Hufschläge eines verspäteten Pferdes (wobei es sie vergnügte, deren Klang und Rhythmus mit der Zunge nachzuahmen) mal auf die Atemzüge des kleinen Schläfers an ihrer Seite, mal auf die Lieder, die gedämpft zu ihr drangen. Denn ihr Gatte, der Maire, saß noch lange, die Rheinweinflasche in bequemer Nähe, an seinem schönen Erardschen Piano und sang mit den letzten Gästen ein Lied nach dem andern, aber keines so oft wie das, was er vor allem liebte:
Freut euch des Lebens, weil noch das Lämpchen glüht! Pflücket die Rose, eh sie verblüht!
Nach zwei Jahren genas die junge Frau eines zweiten Kindes. Wieder war es ein Knabe, ein winziges, zartes Kerlchen, das die roten Haare und den großen häßlichen Mund, der in späteren Jahren ein allzu entwickeltes Gebiß nicht verbergen konnte, von seinem Großvater Wolf geerbt hatte. Er ward von seinem Großvater Pieper auf den Namen seines noch Mädchenkleider tragenden Oheims, des jüngsten Bruders seiner Mutter, Johannes und – nicht ohne einiges Sträuben des geistlichen Herrn – auf den des großen Napoleon getauft und ließ sich in seinem Schlummer nicht stören, als kurz nach Mitternacht die Sturmglocke das Tauffest beendete. Es hieß, ein Teil der "Neußer Bande", unter "Schlaumännches" persönlicher Führung sei im Anzug. Noch war's diesmal nur blinder Lärm. Der alte Bote Schrey, der mit seinem Planwägelchen soeben von Düsseldorf zurückgekehrt war und in einer Fuhrmannskneipe verdächtige Kerle von dem Anschlag reden gehört haben wollte, mußte sich getäuscht haben. Er wurde ohnehin alt und war immer seltener ganz nüchtern. Und der Maire, der lange nicht einschlafen konnte, erwog, ob ihm nicht die Konzession zu entziehen sei.
Auch in den benachbarten, zu Preußen gehörigen Landschaften stand eine hohe Obrigkeit dem Räuberbandenwesen ebenso rat- und hilflos gegenüber wie der Maire. Zwar verkündete der Minister Schulenburg am 7. Juli 1802, daß die preußische Regierung von der russischen die Erlaubnis erwirkt habe, die gefährlichsten Bösewichte, für die preußische Ketten und Kerker als zu schwach sich erwiesen, in die entferntesten sibirischen Bergwerke abzuschieben. Aber was half es, daß man alsbald achtundfünfzig nach und nach eingefangene Mitglieder rheinischer Banden diese weite und beschwerliche Reise antreten ließ? Das niedere Volk, seit Jahrhunderten der Willkür fürstlicher Landesväter preisgegeben, infolge der langen, bösen Kriegszeiten verwildert, auf tausendfache Weise Not leidend und ohne alle Möglichkeit, sich emporzuarbeiten, ergänzte den Bestand jeder dezimierten Räuberbande rasch und reichlich, darin auch fremde Landstreicher und fahnenflüchtige Soldaten zahlreich genug ihr Glück versuchten. Und wie am Niederrhein, so gedieh das Unwesen auch auf Hunsrück und Eifel, an Mosel, Main und Nahe, wo der "Schinderhannes", dessen Persönlichkeit und Taten die Phantasie des Volkes ins Heroische steigerte, als eine Art "Gottesgeißel" sich umtrieb. Wie dieser seinen "Beruf" auffaßte, indem er die Reichen und Mächtigen schädigte, den Armen und Unterdrückten aber sich hilfreich erwies, darüber mußte I. P. Wolf, wenn er abends den Maire ausgezogen hatte und seiner Frau aus dem Kölner "Beobachter" vorlas, wohl selber oft herzlich lachen. Am meisten Vergnügen hatte ihm bereitet, was das Blatt von einer Begegnung des Räuberhauptmanns mit der berühmten schönen Tänzerin Cäcilie Vestris zu erzählen gewußt hatte. Die sei, von Paris nach Mainz unterwegs, für dessen Theater sie der dortige Präfekt verpflichtet habe, in Kirn an der Nahe abgestiegen. Das habe Schinderhannes erfahren und mit seinen Gesellen am andern Tag ihr aufgelauert. Er habe ihren Kutscher nach Kirn zurückgeschickt, einem seiner Räuber die Zügel übergeben, sich selber aber ganz manierlich zu der Schönen und ihrer Kammerfrau in den Wagen gesetzt und ihr versichert, sie brauche nichts zu fürchten, er wolle dem Präfekten nur einen Tort antun, indem er ihn ein wenig auf sie warten lasse und selber der Annehmlichkeit ihrer Gesellschaft vor jenem genieße. Sie solle ihm nur vertrauen und fröhlich sein, es werde ihr kein Haar gekrümmt werden und allzu lange werde er sie auch nicht aufhalten. – Indessen sei der Wagen in scharfem Trabe immer weiter und weiter gerasselt und habe endlich vor einer entlegenen und verwitterten Ruine gehalten, darin ein paar ganz wohnlich eingerichtete Gemächer und eine schön gedeckte Tafel die Räuber und ihre Gäste erwartet, auch ein hübsches Räubermädchen die Honneurs gemacht habe. Die schöne Cäcilie Vestris aber sei immer mehr aufgetaut und ganz vergnügt geworden. Endlich habe sie gar auf Bitten des Schinderhannes eine Probe ihrer Kunst gegeben, wofür der ihr eine nach seiner Versicherung "ehrlich erworbene" goldene Kette aufgenötigt. Nach wenigen Tagen habe Schinderhannes die beiden Frauen wieder durch den Wald fahren und ihrem aus Kirn zurückbeorderten Kutscher überantworten lassen, und seien sie dann auch ohne weiteren Schrecken und Abenteuer beim Präfekten in Mainz angelangt.
Aber der Maire empfand doch eine tiefe bürgerliche Befriedigung, als die Zeitung eines Abends behaglich und erbaulich berichtete, wie man diesem Erzbösewicht in Mainz den Prozeß gemacht, daß bei den letzten Verhandlungen die Eintrittskarte zum Gerichtssaal vierundzwanzig Franken gekostet, und wie man ihn und neunzehn seiner Spießgesellen am 21. Oktober 1803 vor vierzigtausend von nah und fern herbeigeströmten Zuschauern mittels der Guillotine vom Leben zum Tode befördert habe. Und seine Ahnung, daß nun den rheinischen Banden allen bald das letzte Stündlein schlagen werde, betrog den Maire nicht.
Pastor Pieper, ein kleiner, sehr beweglicher Herr von entschiedener pastoralem Aussehen, als er es Wort haben wollte, war durch seine Frau zu Vermögen gekommen. Das gestattete ihm ein Vergnügen, woran weder die Gattin noch sonst jemand im Städtchen ein sonderliches Gefallen fand: Er reiste gern. Sein leichter Reisewagen war schon in fast aller deutschen Herren Ländern auf guten und schlechten Wegen dahingerollt. Meist waren es freilich nur kurze Entfernungen, die mit ihm zurückgelegt wurden, wenn es galt, einer Konferenz oder Synode beizuwohnen. Aber einmal in jedem Jahr nahm der Pastor seine sechs Wochen Urlaub, und dann ging's in die weite Welt hinaus. Die kleinen Verdrießlichkeiten des Reisens, als da waren: Wege, die den Wagen beschädigten oder gar umwarfen, mürrische oder allzusehr auf ihren Vorteil erpichte Wirte und Posthalter, schläfrige oder allzu temperamentvolle Kutscher und Pferde, umständliche Vorschriften und zeitraubende Formalitäten, die ebenso zahlreich waren wie die deutschen Landeshoheiten – das alles ward gern in Kauf genommen, und durch viele neue Eindrücke erfrischt und bereichert kehrte Pieper von jeder Reise befriedigt heim.
Im Sommer 1805 entschloß sich I. P. Wolf, der Maire, auch einmal Urlaub zu nehmen und den Schwiegervater auf solcher Fahrt zu begleiten, deren Ziel diesmal Hamburg sein sollte. Dort lebte als Schiffsmakler und kleiner Reeder ein Bruder des Pastors. Den wollte man besuchen und sehen, ob sich etwa ein Wasserreis'chen anschließen lasse. Unterwegs hielten sich die Reisenden ein paar Tage in Helmstedt auf, denn der Pastor Pieper, dessen Frau einer dortigen Professorenfamilie entstammte, hatte zu seiner Zeit etliche Semester auf dieser kleinen braunschweigischen Universität studiert, und nun machte es ihm Freude, den Schwiegersohn die alten Wege dort zu führen und mit ihm in der dämmerigen Stephanskirche den Grabstein des Mannes aufzusuchen, in dem er seinerseits den Schwiegervater verehrte, freilich ohne ihn noch gekannt zu haben. Die Berufung auf den toten Professor erschloß den beiden Reisenden in Helmstedt das Haus eines lebenden, eines Sonderlings, dessen Ruhm den der kleinen Universität überflügelt hatte und überdauern sollte. Es war der fünfundsiebzigjährige Professor Gottfried Christoph Beireis, der die fremden Besucher freundlich empfing, auch, gut gelaunt, alsbald ihre Bitte erfüllte und ihnen seine weltberühmten Merkwürdigkeiten zeigte. Da war die automatische Ente aus seinen Metallfäden, die, aufgezogen, sich genau wie eine lebende betrug: watschelte, schnatterte, vorgehaltene Gerstenkörner aus der Hand fraß und – verdaute. Da waren die Lieberkühnschen Präparate, die dem bloßen Auge wie rote Fleckchen von der Größe eines Stecknadelkopfes erschienen, wenn man sie aber durchs Mikroskop betrachtete, sich als unendlich zart aus Wachs gebildete, in allen Einzelheiten klar erkennbare Organe des menschlichen Körpers darstellten. Und mit Stolz erzählte der Alte, wie er diese Wunderwerke menschlicher Geschicklichkeit in Berlin dem Fürsten Orlow, der sie aus dem Lieberkühnschen Nachlaß für die Zarin kaufen sollte vor der Nase weggeschnappt hätte. Allerdings hätte er vierzehntausend Taler dafür bezahlen müssen. Jener nun wäre ihm alsbald nachgereist und hätte ihm schließlich unter Fluchen und Drohen die Hälfte mehr geboten. Da aber hätte er, Beireis, gesagt: "Fürst, wenn Gott selbst vom Himmel stiege, vor mich träte und spräche: Beireis, siehe ich will dir geben ganz Deutschland, Europa, Asia, Amerika, die ganze Welt und alles, was darinnen ist – gib mir das Kästchen mit den Präparaten! – so spräche ich dennoch: das kann ich nicht!" – Aber die größte Merkwürdigkeit war doch das blasse dürre Männlein selber in seiner weißen Ziegenhaarperücke, die hinten einen Knoten und an den Seiten zwischen Ohr und Auge kunstvolle Locken hatte. Eine weiße, dünne und schmale Halsbinde wurde im Nacken durch eine große silberne Schnalle gehalten und der Rock mit Aufschlägen und langen Schößen war, wie die tiefausgeschnittene Weste und die kurzen Beinkleider, von blauem Tuch. Hochklappige Schuhe und lange schwarze Strümpfe vollendeten die Gewandung des Sonderlings, der bald gravitätisch schreitend, bald leichtfüßig tänzelnd, sie durch das Museum führte, das seine Junggesellenwohnung bildete. Dabei redete er in einemfort mehr noch als von seinen Schätzen von sich selber, den Verdiensten um die Wissenschaft, die er als Jurist und Theologe, als Chemiker und Sprachforscher sich erworben, von den wunderbaren Kuren, die er als Arzt gemacht, von seinen mannigfachen Reisen in fernen Ländern und von seinen Beziehungen zu den Großen der Erde. Bitter klagte er über die Unvernunft der Menschen, die er in ganze, dreiviertel, halbe und viertel Köpfe einteilte, nicht ohne anzudeuten, daß zu der ersten dieser Klassen außer ihm nur Archimedes, Christus, Newton und allenfalls Friedrich der Große zähle. Beireis schien Gefallen an seinen artig zuhörenden Gästen zu finden, denn als diese, von dem Gesehenen und Gehörten überwältigt, unter geziemenden Dankesbezeigungen und gegenseitigen Bücklingen sich zu verabschieden begannen, schloß er plötzlich die schon geöffnete Haustür wieder, und bedeutete den überraschten Herren mit geheimnisvollem Flüstern, ihm zu folgen. Nun führte er sie in seine Bibliothek, zog einen Teil des Bücherregals heraus, der sich wie eine Tür bewegte, und entnahm dem Geheimfach eine Flasche und drei Gläser; jetzt wollten sie noch miteinander von seinem Lebenselixier trinken. Das schmeckte freilich den beiden Herren vom Niederrhein scharf und abscheulich, indessen Beireis sein Gläschen mit Behagen ausschlürfte. Dann trat er wieder an den Wandschrank und holte einen derben Stein heraus, der an einigen Stellen ein wenig glitzerte: das sei sein höchster Schatz, erklärte er strahlend, das sei der größte Diamant der Erde und alle Potentaten Europas zusammen wären nicht annähernd reich genug, ihn nach seinem Wert zu bezahlen. – Während der Pastor diesen Diamanten, der so unscheinbar aussah, mit Ehrfurcht in der Hand wog, dachte er in seinem Herzen, jetzt sei der Augenblick günstig, und ganz unvermittelt fragte er den Alten, ob es denn wahr sei, daß er Gold machen könne. – Und alsbald begann auf dem Greisengesicht ein seltsames Mienenspiel, wie wenn alle die Falten und Runzeln durcheinander huschten. Dann aber war es ein unheimlich starrer Ausdruck, mit dem jener erwiderte: ja, wahr sei das freilich, aber darüber spreche er nicht, denn dies Geheimnis tauge nicht für die dem Mammonsgeist verfallende Menschheit und er werde es mit ins Grab nehmen. – Als der Pastor und sein Schwiegersohn abends in ihrem Gasthof die Einzelheiten dieses denkwürdigen Besuches durchsprachen, um sie alsdann in ihr Reisetagebuch einzutragen, wußten sie nicht recht, ob sie Beireis für einen Schelmen und Narren, oder für ein Genie und großen Gelehrten halten sollten. Schließlich kamen sie überein, daß er wohl eine Mischung aller menschlichen Möglichkeiten und Widersprüche darstelle.
Etliche Tage später hielt das pastorale Wägelchen nach mancherlei Paßumständlichkeiten glücklich vor dem Hause des Schiffsmaklers Pieper auf dem Holländischen Brook zu Hamburg, und die beiden Reisenden begannen, den Eindrücken der lauten und lebhaften Hafenstadt sich hinzugeben, deren Schiffe alle Meere durchfuhren, die aber daheim jeglicher Erziehung zum Weltbürgertum um so entschiedeneren Widerstand entgegensetzte. Die vielen französischen Emigranten zwar, die der Sturm der Revolution hierher geweht, hatte man gastlich genug aufgenommen, und beim Doppelkonzert im Rainvilleschen Garten am Sonntagnachmittag begann die eine Kapelle mit der Marseillaise, die andere mit God save the King. Aber gegen das nachbarliche Ausland wurden allabendlich die Tore sorgsam geschlossen und die Wälle von einer Bürgerwache besetzt, deren Soldaten weder nach Gestalt und Haltung, noch nach Montur und Bewaffnung den Beifall eines preußischen Generals gefunden hätten. Das jede Nacht eintreffende berlinische Postfelleisen mußte mittels eines sinnreichen Flaschenzuges über Tor und Wall hinweg durch die Luft seinen Weg nehmen, und wer nicht in Hamburg geboren war, der blieb zeitlebens ein "Butenminsch".
Alsbald nach dem ersten Abendbrot lobten die Gäste die vorzügliche Mischung, womit der Reeder sie ihre Pfeifen hatte stopfen heißen. Das sei freilich etwas anderes als sie's daheim bekommen könnten, meinte der Maire, und der Pastor fragte, ob es denn wahr sei, daß hier in Hamburg auch die Frauen dem Tabakgenuß sich hingäben, und daß man immer mehr dazu überginge, das edle Kraut ohne Pfeife zu rauchen. – Jawohl, das sei so, in den niederen Ständen rauche freilich alles, auch Frauen und junge Burschen, aber unter den Gebildeten gelte der Tabak doch noch für ein ausschließliches Vorrecht des erwachsenen Mannes. Und was die sogenannten Zigarren betreffe, so erziele sein Freund, der Bürgerkapitän Hans Hinrich Schlottmann am Rademachergang, der seit Anno achtundachtzig als erster in Hamburg, und somit wohl auch als erster in ganz Deutschland, diese Dinger fabrikmäßig herstelle, von Jahr zu Jahr einen größeren Umsatz. Und das, obwohl die Zigarren keineswegs billig seien, sintemal die ordinärste Sorte doch immerhin fünfzehn Pfennig das Dutzend koste, und obwohl mit der Zeit auch ein paar Konkurrenten sich aufgetan.
Noch mehr als in Hamburg werde übrigens wohl im benachbarten Altona geraucht, so daß der dortige Polizeimeister, ein Herr von Aspern,sich schon veranlaßt gesehen, dagegen einzuschreiten und zum mindesten alles öffentliche Tabakrauchen unter Androhung einer Geldstrafe und sofortiger Konfiskation der Pfeife strengstens zu verbieten.
Da nun habe vor wenigen Wochen eine Geschichte sich zugetragen, die zeige, daß ein einfacher Hamburger Bürger allein gegen die Übergriffe einer ausländischen Macht sich zu helfen wisse. Das sei aber solchergestalt zugegangen:
Herr Kaspar Knoop fährt eines Samstagnachmittags im offenen Wagen aus Hamburg durch Altona seinem Landsitz zu, allwo er die Sonntage zu verleben pflegt. Ohne des Polizeiverbots zu gedenken, raucht er behaglich seine schöne Meerschaumpfeife. In solcher angenehmen Beschäftigung sieht er plötzlich durch Polizeidiener sich gestört, die, ihren Müßiggang unterbrechend, seinen Wagen halten lassen und unwirsch zwei Taler Strafe und die Pfeife heischen. Sie lassen sich auf nichts ein, so daß Herr Kapsar Knoop ihnen schließlich gehorsamen muß.
Aber er fährt sofort bei Herrn von Aspern vor und gibt dem Allgewaltigen gute Worte genug, um seine Lieblingspfeife wiederzukriegen. Doch der bleibt harthörig: er dürfe das Recht nicht biegen. – Am Montag nach der Hamburger Börse gehen die Altonaer Kaufleute wie immer zum Maria-Magdalenen-Kirchhof, wo nach alter Gewohnheit ihre Equipagen auf sie zu warten pflegen. Aber diesmal ist der Platz leer, nicht ein Wagen zu sehen. Indessen jene noch stehen und sich den Kopf zerbrechen, was ihren Kutschern denn nur eingefallen sein könne, fährt einer von diesen gemächlich heran. Da erfahren sie dann, daß Herr Kaspar Knoop, dem der Fuhrwerskverkehr auf den Hamburger Straßen und Plätzen unterstellt ist, ein strenges Verbot erlassen hat, wonach sie nicht mehr wie bisher auf dem Maria-Magdalenen-Kirchhof ihre Herren erwarten dürfen, sondern während der ganzen Börsenzeit unablässig in den Straßen umherfahren müssen. Am Dienstag aber erhält Herr Kaspar Knopp seine geliebte Meerschaumpfeife zurück, denn den Vorstellungen der vereinigten Altonaer Kaufmannschaft hat Herr von Aspern nicht zu widerstehen vermocht ...
Kaum hatte der Reeder diese Erzählung beendet, als ein Höllenlärm von der Straße her seine Gäste aufschreckte: das seien die Nachtwächter, beruhigte er sie, die mit großen Schnarren etwaige Spitzbuben verscheuchen und, um ja nicht überhört zu werden, auch noch ihre eisenbeschlagenen Stöcke über das Pflaster fahren lassen müßten. Auch hätten sie mit diesen Stöcken nachzuprüfen, ob etwa die eine oder andere Haustür nicht ordentlich verschlossen oder vielleicht sogar nur angelehnt sei ... Und später wimmerte die ganze Nacht alle Viertelstunden das Glockenspiel auf einem nahen Stadtturm – mit den nicht immer richtigen und nicht immer vollzähligen Tönen der verschiedensten Bußlieder der bürgerlichen Frömmigkeit sänftiglich aufzuhelfen.
Wenn nun auch mancher Hamburger jahraus jahrein mit der ganzen Welt Geschäfte machte, ohne selber jemals eine Nacht außerhalb des Bereichs dieser frommen Klänge verbracht zu haben, so gab doch, besonders seit sie am zweiten Abend in einer Gondel über den weiten Alsterspiegel geglitten waren, jeder Tag dem Wunsche des Pastors und seines Schwiegersohnes neue Nahrung, eine bescheidene Seefahrt zu riskieren.
Eines Mittags konnte der Schiffsmakler die Gastfreunde dann auch durch die Mitteilung erfreuen, daß er einen zuverlässigen Schiffer ausfindig gemacht habe, der sie nach Helgoland mitnehmen und nach etwa vierzehn Tagen von dort wieder abholen wolle. Er kenne den Mann seit langem und habe sich sein Schiff angesehen, das einen tüchtigen und saubern Eindruck mache. So rate er, die gute Gelegenheit zu benutzen, sie würden daheim viel zu erzählen haben und er bedauere nur, daß seine Geschäfte ihm nicht erlaubten, die Partie mitzumachen, wie er denn bisher noch nie dazu gekommen sei, jenes seltsame Felseneiland aufzusuchen. Die beiden Landratten griffen erfreut zu und gestanden einander erst viel später, daß jeder alsbald heimlich einen Brief an die Frau geschrieben, der so etwas wie ein letzter Wille gewesen sei, und daß sie ein höchst ungemütliches Herzklopfen verspürt hatten, als sie das Schiff bestiegen. Es war schon dunkel geworden, als sie die Ufer aus den Augen verloren und an den lebhafteren Bewegungen des Schiffes merkten, daß sie sich der offenen See näherten. Und alsbald fühlten sie sich gleichzeitig mit solcher Heftigkeit von der Seekrankheit befallen, daß sie, einander mit sterbenstraurigen Augen hilflos anblickend, heimlich aber herzlich den Leichtsinn verwünschten, der sie in diese abscheuliche Lage gebracht hatte. Obwohl an Schlaf nicht zu denken war, wurden sie doch erst nach geraumer Zeit inne, daß ein widriger Wind sich aufgemacht hatte, der den Schiffer zwang, viele Stunden lang hin und her zu kreuzen. – In der Dämmerung des zweiten Abends erst kam Helgoland in Sicht und ward dann auch bald erreicht, eine hohe schwarze Masse, darauf, von dunkeln Gestalten geschürt und behütet, ein mächtiges Feuer flammte, sprühte und qualmte, fernen Schiffen die Wege zu weisen. – Die beiden Reisenden, denen der feste Boden unter den Füßen alsbald Gesundheit und Unternehmungslust zurückgab, stiegen, von einem Fischer geleitet, der sich als zu den Ratsmännern der Insel gehörig vorstellte, übrigens aber wortkarg und schwer verständlich blieb, die hohe Treppe zum Oberland hinauf und fanden in dem einzigen Gasthäuschen leidliche Unterkunft. Als Männer von guter Erziehung machten sie gleich am ersten Tage den Honoratioren ihren Besuch: dem dänischen Landvogt, dem sie als Ausländer ohnehin ihre Pässe vorzulegen hatten, den beiden Pastoren, dem Apotheker, den der Maire einen botanischen Beireis nannte, weil er bei der Vorführung seiner Blumenzucht versicherte, seine Sonnenblumen wendeten jede Nacht ihre Köpfe dem Leuchtfeuer zu, und im vorigen Sommer hätte er eine Levkoie zu solcher Höhe und Umfang gebracht, daß er mittags mit seiner Frau in ihrem Schatten den Kaffee habe trinken können. Endlich dem Kommandanten Major Ziska. Der führte hier mit seiner aus vierundzwanzig Invaliden bestehenden Inselwache das beschaulichste Stilleben, das aber keineswegs ohne Haltung war: bei jedem Ausgang mußte, in geziemendem Abstand und nie erteilter Befehle stets gewärtig, eine Ordonnanz ihn begleiten und vor dem Hause, in dem der Gestrenge etwa an Tee oder Souper teilnahm, ohne Rücksicht auf Zeit und Witterung Posten stehen. Der Major nahm den Besuch der beiden mit verbindlichen Worten entgegen, wobei freilich sein Raubvogelgesicht sie aus kleinen wasserblauen Augen anschaute, wie wenn er in ihrer Seele lesen wollte, ob sie auch wirklich so harmlos wären, wie sie aussähen. – Übrigens war seine militärische Laufbahn zu jener Zeit ihrem letzten Ende schon recht nahe. Als nämlich zwei Jahre später, 1807, die Engländer den Dänen die Flotte wegnahmen und der Major ahnte, daß seinem Felseneiland bald das gleiche Schicksal widerfahren werde, da bildete er auf eigene Faust die jungen Insulaner militärisch aus, entschlossen, bis aufs äußerste Widerstand zu leisten. Doch der Heldentod blieb ihm versagt ... Zwar ließ er, als die Engländer ihn zur Übergabe aufforderten, seine Truppe aufmarschieren und hielt ihr eine gewaltige Ansprache: Als er aber am Schluß fragte, ob sie denn nun auch alle wie rechte Männer sich wehren und die Insel bis zum letzten Hauch verteidigen wollten, da öffneten sich die lebensfrischen Lippen der Flachsköpfe zögernd, aber mit einstimmiger Entschiedenheit zu einem überzeugten: "Nee!" Worauf dann freilich nur übrig blieb, zu kapitulieren. So ward Helgoland englisch.
Die beiden Reisenden vom Niederrhein, die in ihren Tagen die einzigen Fremden auf der Insel waren, denn an ein Seebad dachte noch niemand, unterbreiteten jeden Morgen, während sie sich rasieren ließen, der jungen Barbierin ihren Tagesplan, die sie immer freundlich und munter beriet, auch nicht unterließ, dem Maire Ort und Stunde zu verraten, da die jungen Burschen und Mädchen täglich ihren Spaß miteinander trieben. Sie warnte ihn aber: wenn er etwa mittun und auch "körteln" wolle, so solle er doch von den "Deerens" die in Ruhe lassen, die einen silbernen Schmuck auf der Brust trügen, denn die waren "Bruut", und soviel Freiheit den andern gegenüber auch gern erlaubt sei, so wenig ratsam sei es, mit Bräuten zu scherzen, "denn die jungen Keerls mögt dat nich hebben". So körtelte der Maire dann in den Grenzen, die ihm die Barbierin, der Gedanke an sein blondes Lenchen daheim und die Augen des pastoralen Schwiegervaters zogen, und obwohl diese Grenzen nicht allzu weit waren, fand er die Sache doch ganz pläsierlich.
Standen die Bräute so hoch in Ehren, so war das Los der Witwen um so betrüblicher: sie durften sich nicht wieder verheiraten, auch wenn sie noch so jung waren. Aber auch das Leben der verheirateten Frauen war hart genug. Alle Arbeit lag auf ihnen, indessen die Männer, sofern sie nicht als Fischer oder Lotsen gerade auf See waren, sich einen guten Tag machten. Allerdings waren sie nur scheinbar ganz müßig, wenn sie, die Hände in den Hosentaschen, stundenlang auf dem Oberland umherlungerten. Denn ihre scharfen Augen suchten immerfort den Horizont ab. Und sobald einer von ihnen "wat in Kieker" hatte, schlenderte er nachlässig und wie zufällig an die Treppe, um sie dann plötzlich in wilden, mächtigen Sätzen hinabzuspringen, auf daß er als erster sein Boot und das noch ferne Schiff erreiche, das vielleicht einen Lotsen brauchte. – Von der Gefährlichkeit dieses Berufes sollten die beiden Landratten alsbald einen Eindruck bekommen. Am Sonntagnachmittag hatte Pastor Pieper seinen Helgoländer Amtsbruder noch gefragt, warum er denn nach der Predigt so umständlich gesagt hätte: "Ferner bitten wir Gott für einen christlichen Lotsen, der am 20. in ein Schiff getreten, und für einen christlichen Lotsen, der am 20. in ein Schiff getreten, und für einen christlichen Lotsen, der am 20. in ein Schiff getreten", statt diese drei christlichen Lotsen summarisch dem Schutze Gottes zu empfehlen. – Tja, das müsse so sein, hatte ihm jener auseinandergesetzt: die Insulaner hätten solche Lotsenfürbitten ganz abschaffen wollen, weil sie für jede zwölf Schillinge an den Pastor zahlen müßten. Aus demselben Grunde hätten aber die Geistlichen an der guten alten Sitte festhalten zu müssen geglaubt, und die oberste Behörde hätte ihnen recht gegeben. Da wäre dann die Folge gewesen, daß die zur Zahlung der Schillinge Verurteilten nun darauf beständen, daß dann auch jede einzelne Fürbitte für sich ausgesprochen werden müsse ... Am Sonntagabend setzte ein böser Sturm ein, und am Dienstag verbreitete sich das Gerücht, daß eine Jolle umgeschlagen und zwei Männer ertrunken wären. Da machten sich mehrere Boote auf, die Leichen zu suchen. – Am nächsten Sonntag nach der Predigt wurden die beiden Särge im Mittelgang der Kirche niedergesetzt. Nahe bei jedem nahmen die Leidtragenden Platz, und die beiden jungen Witwen mußten der Sitte gemäß während der ganzen Trauerrede das verschleierte Haupt an den Sarg gelehnt halten. Auf dem Friedhof aber, wo die Entfernung zwischen den beiden offnen Gräbern kaum zwanzig Schritt betrug, redeten beide Geistliche gleichzeitig, an Seelenschmerz und Lungenkraft einander überbietend, denn jede Partei hatte ihren Pastor bezahlt und wußte und wollte, was ihr zukam.
Wie manches artige Erlebnis und seltsame Beobachtung das Reisetagebuch auch festzuhalten hatte, nie hat größere Begeisterung die pastorale Feder geführt, als am Abend des Tages, an dem die beiden auf der Rückreise in Hamburg den französischen Luftschiffer François Blanchard hatten aufsteigen sehen. Es sei ihm wie eine richtige Himmelfahrt vorgekommen, versichert der ehrliche Rationalist, und nie habe er einen Menschen mehr beneidet, als diesen Luftschiffer, der, alles Irdische zurücklassend, in der seligen Blaue verschwunden sei. Und das Heiligegeistfeld, von wo aus Blanchard aufgefahren, trage nun seinen Namen in einem neuen Sinn, denn es sei eine heilige und rein geistige, von keinerlei materiellen Absichten gespeiste Sehnsucht des Menschen, aller Erdenschwere ledig, so in dem Unendlichen sich zu verlieren ... An die Hunderttausend seien nicht nur aus den Schwesterstädten Hamburg und Altona, sondern auch aus ganz Holstein, Mecklenburg und Hannover auf diesem Felde zusammengeströmt, wehmütig beneidet von den Hunderttausenden, die sie hatten zu Hause lassen müssen. – Die Füllung des Ballons sei innerhalb der Sternschanze geschehen und der Eintritt in diese mit zwei Reichstalern wahrlich nicht zu teuer bezahlt gewesen. Nach schier endlosem Warten drei Kanonenschüsse und dann habe der Ballon, zuerst langsam, bald aber immer rascher, sich erhoben. Der Luftschiffer, ein behender kleiner Mann in weißer Matrosenkleidung, seidener Schärpe und rundem Hütchen, habe mit zwei Fahnen, die er statt der Ruder in Händen gehalten, den unendlichen Jubel erwidert, unter oder vielmehr über dem der Ballon kerzengerade in die völlig windstille Höhe gestiegen sei, zuletzt nur noch als Pünktlein erkennbar. Da plötzlich sei in raschem aber sanftem Gleiten ein Schaf vom Himmel her auf der Wiese gelandet, das jener mittels eines Fallschirmes der Erde zurückgegeben habe. Das Tierlein nun, anscheinend durch solche Luftreise nicht im geringsten alteriert, habe unverzüglich zu grasen begonnen, indessen die Menschen einander fast totgedrückt hätten, um seiner ansichtig zu werden, das doch genau so ausgesehen wie jedes andere Schaf.
I. P. Wolf, der Maire der kleinen niederrheinischen Stadt im französischen Roerdepartement, die mit ihrer nächsten Umgebung bis vor gut zehn Jahren noch eine jülichsche Unterherrschaft gebildet hatte, sah im Jahre 1806 sowohl das Erbe Friedrichs des Großen, wie das der alten Kaiser zusammenbrechen. Er bedauerte das, denn sein Vater war gut fritzisch gesinnt gewesen und sein eigenes Weltbürgertum war von durchaus deutscher Färbung, aber es erschütterte ihn nicht. Und wie gut er als Maire auch zwischen den Wünschen der Regierung: das Französische zu fördern und das Deutsche zu unterdrücken, seinen Unterschied zu machen wußte – er fühlte sich doch als Sohn einer neuen Zeit, die ihr Heil vom Erben der französischen Revolution, dem großen Napoleon erwartete. Dazu kam, daß die noch im gleichen Jahr verfügte Absperrung des europäischen Festlandes gegen englische Waren gerade dem Roerdepartement bedeutende Vorteile brachte. Zahlreich siedelten sich hier innerhalb der französischen Zollgrenzen Fabrikanten und Kaufleute von jenseits des Rheins, besonders aus dem Bergischen an, nachdem es ihnen nicht gelungen war, den Kaiser zur Annexion ihrer Heimat zu bewegen, und mancher von ihnen wählte das Städtchen, dem I. P. Wolf als Maire Vorstand. Der gedachte solchen Zuwachs zwei Lieblingswünschen zugute kommen zu lassen, die sich auf die Verbesserung des Schulwesens und auf die Hebung der Geselligkeit richteten.
Bei jedem Besuch im nahen Krefeld – und solcher Besuche machte der Maire viele, um sich in den Dingen der dortigen Fabrikanten auf dem Laufenden zu halten – mahnte die Inschrift, die nun schon an die fünfzig Jahre am dortigen Schulhaus stehen mochte und deren Richtigkeit ihm jährlich mehr einleuchtete:
Bebauet wie ihr wollt ein wildes Krähenfeld, führt schöne Häuser auf, erweitert Mauern, Toren, ja legt Fabriken an und häufet Geld auf Geld – ist keine Schule da, so bleibt es wie zuvoren.
Dann mußte er immer wieder an die ehemalige Pastoratsscheune daheim denken und an den nicht weniger unzulänglichen alten Paulussen, der, für seine schulmeisterlichen Bemühungen von den Eltern seiner Opfer teils durch mittäglichen "Wandeltisch", teils durch "Schlafung, Waschen und Schuhschmieren" entlohnt, im Winter in ihr sein Wesen hatte. Denn in der schönen Jahreszeit zog er vor, als wandernder Scherenschleifer ein reichlicheres Brot sich zu erwerben. – Durch solchen Schulbetrieb nun mochte freilich die Zahl der Analphabeten nicht wesentlich kleiner werden. Aber der Präfekt in Aachen war nicht imstande oder nicht gewillt, die schulreformatorischen Absichten des Maire zu fördern. Und wenn es diesem schließlich auch gelang, den irrlichtelierenden Scherenschleifer durch einen seßhaften Schneider philosophischer Neigungen zu ersetzen, so waren doch dessen pädagogische Gaben leider gleichfalls allzu bescheiden. Pastor Pieper, der zuweilen einmal einer Schulstunde beiwohnte, wußte davon ergötzlich genug zu erzählen. – Zwar die gesunde Philosophie des bakelschwingenden Schneiders mußte er anerkennen, der etwa seinen Schülern versicherte, das Schwein trage seinen Namen mit Recht, weil es in der Tat ein äußerst schmutziges Tier sei, aber er meinte doch, daß jener noch nicht hinter das Geheimnis der neuen Rechenmethode gekommen sei, sintemal er im Unterricht die Frage aufgeworfen habe, "wenn dreiGänse siebenundzwanzig Silbergroschen kosten, was kostet dann ein Kalb?"
Mehr Erfolg hatten die Bemühungen des Maire um die Hebung der Geselligkeit. Es gelang ihm, die Honoratioren zu einem Verein zusammenzuschließen, der den Zweck haben sollte, "unter gleichzeitiger Pflege der geistigen Interessen die Vergnügungen der Geselligkeit in angenehmer Unterhaltung gemeinschaftlich zu genießen", und den man kurzweg "Die Gesellschaft" nennen wollte. Der Maire selber übernahm gerne den Vorsitz. Sein Schwiegervater Pastor Pieper, der alte Doktor Kükes mit dem Rohrstock (an dessen durchlöchertem goldnen Knopf zu riechen, gut gegen Miasmen war, sintemal er allerlei heilsame Kräuter barg) und der fast neunzigjährige kleine Herr Henricus ten Bompel wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Der Wirt vom "Jülicher Hof" am Markt baute einen Gesellschaftsraum an, zu dem nur Mitglieder Zutritt hatten. Ein Billard ward aufgestellt, man subskribierte auf Brockhausens Konversationslexikon, das soeben in Bündchen bescheidenen Umfangs zu erscheinen begann und rasch das am meisten gelesene Buch in Deutschland ward, und hielt sich die Cottasche Allgemeine Zeitung, den Freimütigen und das Journal de l'Empire. Und jeden Abend von sechs Uhr an genoß die Gesellschaft, oder doch ein Teil von ihr, in angenehmer Unterhaltung der Pflege geistiger Interessen und der Vergnügen der Geselligkeit, wobei die Betrachtung der städtischen und häuslichen Angelegenheiten hinter der Würdigung der politischen und kriegerischen Ereignisse der Zeit natürlich durchaus nicht zurückblieb. Aber beides stand im Zeichen der Freude über den Fortschritt. Denn daß noch nicht zehn Jahre vergangen waren, seit des Heiligen Römischen Reiches Kammergericht zu Wetzlar zwei mecklenburgische Städte bestraft hatte, weil sie in einer Klage gegen die überhebliche Ritterschaft das Wort "Menschenrechte" gebraucht hatten, das wollte allen fast unglaublich erscheinen. Und die von Görres verfaßte Todesanzeige, die Pastor Pieper eines Abends vorlas, löste keine Trauer in den Herzen der Hörer aus: "Am 30. Dezember 1797, am Tage der Übergabe von Mainz, nachmittags um drei Uhr starb zu Regensburg im blühenden Alter von neunhundertfünfundfünfzig Jahren, fünf Monaten, achtundzwanzig Tagen sanft und selig an einer gänzlichen Entkräftung und hinzugekommenem Schlagfluß, bei völligem Bewußtsein und mit allen heiligen Sakramenten versehen, das Heilige Römische Reich, schwerfälligen Andenkens."
Pastor Pieper, der vor kurzem sein fünfundzwanzigjähriges Amtsjubiläum gefeiert, hatte gezögert, die Ehrenmitgliedschaft der Gesellschaft anzunehmen. Wenn er sie annahm stand für ihn fest, daß er auch Gebrauch von ihr machen und wenigstens zweimal in der Woche sein Schöppchen Mosel dort trinken würde. Daß ihm dies von den pietistisch gesinnten seiner Gemeindeglieder alle oder fast alle verdenken würden, wußte er. Er wußte und bedachte auch, daß Christus gesagt hatte: "Wer aber ärgert dieser Geringsten einen, die an mich glauben, dem wäre besser, daß ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er ersäufet würde im Meer, da es am tiefsten ist." Würde er einen ärgern, oder gar alle? Nein! Sie würden sich an ihm ärgern, und das mochten sie mit sich selber abmachen. Er wußte, daß er nicht in die Gesellschaft gehen würde, um Wein zu trinken. Und gehörten die Herren dort nicht ebensogut zu seiner Gemeinde? Würden sie sich nicht mit mehr Recht an ihm ärgern, wenn er es ablehnte, in ihrem Kreise zu verkehren? Mußte er nicht vielmehr die Gelegenheit ergreifen, dem einen oder andern, der vielleicht nur selten in die Kirche ging, näherzukommen, und konnte er nicht möglicherweise das geistige Niveau der Geselligkeit glücklich beeinflussen? So entschloß er sich denn, die Ehrenmitgliedschaft anzunehmen, und der Erfolg gab ihm recht. Sein Rationalismus, der den pietistischen kleinen Leuten so wenig zu geben hatte, hielt von den Herren der Gesellschaft doch manchen wenigstens an der Peripherie des Christentums fest, und da Pastor Pieper nicht nur Theologe, sondern zugleich auch ein in den Dingen der Welt wohlunterrichteter und interessierter Herr war, freute man sich, so oft er im Jülicher Hof erschien. Und er seinerseits, indem er sich zuerst an dem Gespräch etwa über den neuen Webstuhl, den der Franzose Jacquard erfunden hatte, mit Interesse und Verständnis beteiligte, wußte oft die Unterhaltung ganz zwanglos auch auf geistige, ja manchmal sogar auf geistliche Fragen hinüberzuleiten. Auch brachte er zuweilen ein Buch mit, etwa Herders "Cid" oder Arndts "Geist der Zeit" und las Stellen daraus vor, wodurch sich dann der eine oder andere angeregt fühlte, daheim weiterzulesen. Dabei ward Pastor Pieper, auch innerlich nicht, weder ungeduldig noch überheblich, wenn er merkte, daß es den meisten doch wichtiger blieb, welche Erfahrungen die Engländer mit der Dampfmaschine machten, wovon nun schon mehrere Tausend drüben in Betrieb sein sollten, oder wie sich in London diese merkwürdigen Straßenlaternen bewährten, in denen Luft brannte, was mancher geradezu für Teufelsspuk zu halten geneigt war. Wie denn auch zwanzig Jahre später noch, als das Heilige Köln sich anschickte, dem Beispiel Londons zu folgen, die Geistlichkeit aus theologischen Erwägungen Widerspruch erhob: Gott sei es, der die Nacht dunkel gemacht habe, darum dürfe der Mensch sie nicht erhellen. – Und der gute Ton schrieb denen, die sich's leisten konnten, noch lange vor, auch durch die gaserhellten Straßen nach guter alter Sitte das eigene Laternchen sich vorantragen zu lassen.
Ein Gebiet nun gab es, auf dem aller Interesse sich vereinte, das waren die großen kriegerischen Ereignisse der Zeit, die in beruhigender Ferne sich abspielten. Hier nun schied ein anderes die Geister, das war die Stellung für oder gegen den Franzosenkaiser, die der einzelne einnahm. Während der Pastor, besonders seitdem er Fichtes Reden gelesen, die Befreiung der Deutschen zuversichtlich voraussagte, hielt sein Schwiegersohn, der Maire, selbst noch nach der Katastrophe in Rußland daran fest, daß der endliche Sieg doch Napoleon gehören werde. Nicht daß I. P. Wolf dies gewünscht hätte, er rechnete damit als mit etwas Selbstverständlichem und er war keineswegs der einzige, der unbeirrbar an den Dämon des Kaisers glaubte. Ja, noch nach der Völkerschlacht bei Leipzig nahm I. P. Wolf, wie die meisten Herren der Gesellschaft, durchaus für bare Münze, was das in Aachen erscheinende staatliche " Journal de la Roer" immer wieder von militärischen Erfolgen des Kaisers zu melden wußte, den übrigens alle mehr als Friedensfürsten, denn als Kriegshelden zu verehren gewohnt waren. Der Pastor aber hielt sich den Rheinischen Merkur, den Joseph Görres, einer der Hüter und Schürer des Feuers, das die Fremdherrschaft verzehrte, in Coblenz herausgab, und immer wieder las er in der Gesellschaft daraus vor und freute sich, so oft er merkte, daß ein Funke zündete. Und allenthalben in Deutschland stärkten die Besten sich an diesem Merkur, der den Staatsmännern Berater und der öffentlichen Meinung Gewissen sein wollte. Bis er wenige Jahre nach Beseitigung der Fremdherrschaft verboten ward, weil er ein "teutsches Blatt" bleiben und nicht zu einer "K. preuß. privil. Zeitung" degradiert werden wollte.
Indessen wurden in den pietistischen Versammlungen der Kleinbürger die Zeitereignisse nach der Offenbarung Johannis und Napoleon als der Antichrist gedeutet. Und der Komet von 1811 gab auch den Kindern der Welt ernste Gedanken ins Herz. – Aber die Winzer am Rhein ließen alle diese Dinge auf sich beruhen und klimperten vergnüglich mit ihren rasch sich mehrenden Silbertalern, denn ein Wein wie der Gilfer war lange nicht dagewesen.
Mit Pfarrhaus und Kirche gute Nachbarschaft haltend, stand mitten auf dem Markt der Blumenpott. So nannte man augenfälliger Ähnlichkeit halber ein fast mannshohes, kreisrundes und stark verwittertes Backsteingemäuer, daraus ein schöner alter Kastanienbaum aufragte. Der "Verkehr", zu jenen Zeiten noch Diener, noch nicht Tyrann der Menschen, ärgerte sich an solchem "Hindernis" keineswegs. Im Gegenteil, er sah sich dadurch gefördert, denn das junge Volk vereinte mit Vorliebe am Blumenpott sich zu Spiel und Kletterkunst, und die Erwachsenen, wenn sie den Markt überquerend einander begegneten, traten nicht ungern in den Schatten der Kastanie, um ein wenig zu schwatzen. In jedem Herbst aber bedauerten kleine und große Leute einmütig, daß man bei solchen Anlässen sich nicht ein Paar Nüsse abschlagen könne. – Von dem alten Gemäuer nahm man an, daß es die Reste eines durch die Spanier zerstörten Wachtturms darstelle, dessen Trümmer, soweit sie nicht in seinem Innern zwischen den Wurzeln der Kastanie begraben lagen, von den verständigen Vorvätern wohl zum Bau ihrer Häuser mitverwendet sein mochten.
In der Dämmerung eines nebeligen Spätnachmittages zu Anfang Oktober des Jahres 1812 gewahrte der Pastor Pieper, als er von einer Beerdigung heimschreitend auf den Marktplatz einbog, am Blumenpott ein Trüpplein Männer, daraus zwei auffallend hochgewachsene emporragten. Da so ansehnliche Leibeslänge des Landes zwischen Niederrhein und Maas nicht der Brauch ist, mutmaßte Pieper alsbald, daß es sich um durchwandernde Fremdlinge handle, die etwa eine politische Neuigkeit oder ein absonderliches Reiseerlebnis zum besten zu geben sich gedrungen suhlen mochten. Es schien lediglich der längere der beiden Langen zu sein, der redete, und zu dem an die zwanzig oder fünfundzwanzig Leutchen gereckten Halses hinaufblickten; auch schien jener abwechselnd der deutschen und der französischen Sprache sich zu bedienen, denn vorhin hatte er seine Hörer "Bürger" angeredet und jetzt nannte er sie › citoyens‹, das eine wie das andere Wort mit erhobener Stimme und einer werfenden Bewegung der Rechten ihnen zuschleudernd. Als der Pastor, der unwillkürlich seine Schritte verlangsamt und etwas näher als seines Zieles wegen nötig gewesen wäre, auf den Blumenpott zugelenkt hatte, endlich, zwischen sich und dem lauschenden Häuflein geziemenden Abstand wahrend, gar stehen geblieben war, da merkte er zunächst mit Staunen, daß er sich getäuscht hatte: Der dort redete, war keineswegs ein Riese, eher hätte man ihn einen Zwerg nennen können, denn er stand nicht vor, sondern in dem alten Gemäuer, es als Kanzel benutzend. Aber der Bebrillte daneben, der, den Ellenbogen auf die Brüstung solcher Kanzel gestützt, schwarz gewandet in derben Stiefeln vor der Mauer stand, der war nun in der Tat von ganz außergewöhnlicher Länge, denn sein kräftiges und ruhiges, wenn auch anscheinend etwas erheitertes Antlitz befand sich in gleicher Höhe mit dem blassen und leidenschaftlich erregten des Redners, der soeben wieder sein " citoyens" auf die Hörer herabschmetterte. Und der dann fortfuhr, in beweglichen, übrigens ausschließlich deutschen Worten und mit einer Stimme von landfremder Rauheit den Heiligen Vater zu beklagen und dem Kaiser Napoleon, dem Verruchten, zu fluchen, der, allem göttlichen und menschlichen Recht hohnsprechend, jenen in Frankreich gefangen halte, und dem für so unerhörten Frevel die Fülle der zeitlichen und ewigen Strafen sicher sei. Noch zwar sitze der Bluthund, verblendet als Sieger sich fühlend, in Moskau, aber schon habe in seinem Rücken die Heilige Mutter Gottes das himmlische Heer aufgestellt, ihm die Heimkehr zu verleiden. Und aus dem sibirischen Bergwerk, wohin die Russen den Elenden schleppen würden, und wo der Teufel schon auf ihn warte, gebe es nur einen Ausgang und der führe schnurstracks in die benachbarte Hölle. – Nachdem das Männlein alsbald mit der Bitte, durch Anrufung der Heiligen und fromme Gelübde die Wiederbesetzung des verwaisten Stuhles Sankt Petri und das Hereinbrechen des Strafgerichtes zu beschleunigen, seinen Sermon beendet hatte, ließ es sich ganz gemächlich durch den Langen von der Kanzel herunterheben. – Der Volkshaufe löste sich auf und war rasch von Nebel und Dämmerung verschlungen. Pieper aber schritt seinem Pfarrhaus zu, im Herzen bedenkend, auf wie vielen und krausen Wegen die deutsche Seele wandle, um in Haß oder Liebe, Furcht oder Hoffnung mit diesem einen Franzosen sich auseinanderzusetzen. Er freute sich des gesunden Empfindens dieses gutkathotischen Mannes, der dem Bonaparte so gar keine "heilsgeschichtliche Bedeutung" beizulegen schien und der gewiß weder am 15. August zwischen der Geburt des Korsen und der Himmelfahrt der Maria die vorgeschriebenen Beziehungen konstruierte, noch am 10. Dezember den "Tag des heiligen Napoleon" in besonderer Andacht feierte. Und der Pastor gestand sich, daß ihn persönlich solche Philippika des Hasses doch ungleich erfreulicher berühre als die vom großherzoglich bergischen Staatsrat zu Düsseldorf unlängst dem Kaiser zu Füßen gelegte Bitte um sein Bildnis, mit ihrer überschwenglich liebevollen Begründung: "Wenn wir uns schwach fühlen, werden wir unsere Augen zu Euer Majestät erheben, und diese Züge werden uns erleuchten, uns das Wissen und die Weisheit geben, die uns fehlt." – Im Grunde aber, meinte Pieper, habe doch Friedrich Stapß, der siebzehnjährige Pastorensohn aus Naumburg (den gerade jetzt vor drei Jahren Napoleon zu Schönbrunn hatte erschießen lassen, weil jener ihn hatte totstechen wollen) in seiner Unschuld den natürlichsten Weg gewählt – nur daß er ihn leider nicht bis zum glücklichen Ende zurückgelegt habe. Freilich wäre es ein Mord gewesen, ein politischer zwar, aber immerhin ein Mord, ein feiger Meuchelmord ... Nun, gerade "feige" hätte man die Tat wohl nicht nennen dürfen ... Aber Mord bleibt Mord, bleibt ein nach der christlich-bürgerlichen Moral zu verdammendes Verbrechen. Gewiß! Nur, daß Klio ihre eigene Moral hat, die zuerst nach dem Motiv und dann nach dem Erfolg – vielleicht auch umgekehrt, aber jedenfalls dann nicht weiter – fragt. Ihr Griffel hätte den Namen dieses "Verbrechers" in die Ehrentafel der Helden seines Volles eingegraben...
Während solcher Meditation hatte der Pastor ein Gefühl, wie wenn ihm jemand folge. Richtig. An seiner Haustür sah er sich eingeholt. Es war der Lange, der, indessen der Zwerg ein paar Schritte zurückblieb, als studiosum theologiae





























