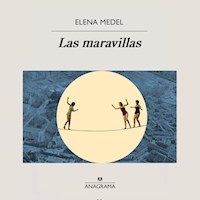12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Noch nie sind sie sich begegnet: María und Alicia, Großmutter und Enkelin. Die Ältere kommt Ende der Sechziger einer Schande wegen nach Madrid, arbeitet als Kindermädchen, als Hausangestellte, der komplette Lohn fortan bestimmt für die zurückgelassene, fast unbekannte Tochter. Die Jüngere flieht Jahrzehnte später in die Stadt, von einer Tragödie um ihre Herkunft und den Schlaf gebracht. María und Alicia, beide führen sie ein Frauenleben, beiden fehlt das Geld. Und damit die Zuversicht und das Vertrauen. In sich selbst, ihre Männer, dieses Land, in dem sich alles verändert zu haben scheint, bis auf das eigene Elend. Und plötzlich fordert jede auf ihre Weise die hergebrachte Ordnung heraus.
Elena Medel schreibt die jüngere Geschichte Spaniens aus Sicht der vergessenen Hälfte. Die Wunder ist ein eleganter feministischer Bildungsroman über die herrschenden Kräfte, über das Geld, das Begehren, die Mutterliebe, und wie sie als Waffen seit jeher gegen die Frauen verwendet werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Titel
elena medel
die wunder
Roman
Aus dem Spanischen von Susanne Lange
Suhrkamp Verlag
Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.
Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.
Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel Las maravillas bei Anagrama, Barcelona.Die Übersetzung dieses Buches wurde unterstützt von der Acción Cultural Española, AC/E.
eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2022
Der vorliegende Text folgt der deutschen Erstausgabe, 2022.
Deutsche Erstausgabe© der deutschen Ausgabe Suhrkamp Verlag AG, Berlin, 2022© Elena Medel Navarro, 2020Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzungdes Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Umschlaggestaltung : Anzinger und Rasp, München
Umschlagfotos: Jan Reiser; Cyndi Hoelzle/EyeEm/Getty Images
eISBN 978-3-518-77397-0
www.suhrkamp.de
Motto
Clearly money has something to do with life.
Philip Larkin
Übersicht
Cover
Titel
Impressum
Inhalt
Informationen zum Buch
Inhalt
Cover
Titel
Impressum
Motto
Inhalt
Der Tag. Madrid, 2018
Das Haus. Córdoba, 1969
Das Königreich. Córdoba, 1998
Die Mässigkeit. Madrid, 1975
Der Gehängte. Córdoba, 1999
Das Gefecht. Madrid, 1982
Der Traum. Madrid, 2008
Der Überfluss. Madrid, 1984
Die Schönheit. Madrid, 2015
Die Freude. Madrid, 1998
Die Nacht. Madrid, 2018
Informationen zum Buch
Der Tag
Madrid, 2018
Sie gräbt in ihren Taschen und findet nichts. Die in der Hose leer, auch die im Mantel: nicht mal ein zerknülltes, feuchtes Taschentuch. Im Portemonnaie gerade noch ein Euro zwanzig. Alicia braucht das Geld erst nach dem Schichtwechsel, aber es ist ein ungutes Gefühl, fast blank zu sein. Ich arbeite im Bahnhof, in einem der Läden für Snacks und Süßigkeiten, dem bei den Toiletten. So stellt sie sich gewöhnlich vor. In Atocha muss sie an allen Geldautomaten Gebühren bezahlen, also steigt sie eine U-Bahn-Station vorher aus, zieht sich in der Filiale ihrer Bank zwanzig Euro und ist etwas ruhiger. Alicia, den einsamen Schein in der Tasche, blickt zur Glorieta hinüber, fast leer, kaum Autos, kaum Fußgänger. Hell wird es erst in ein paar Minuten. Wenn sie die Wahl hat, nimmt Alicia immer die Nachmittagsschicht, dann muss sie den Wecker nicht stellen, ist bis zum späten Abend im Laden und geht direkt nach Hause. In diesen Wochen, bei weitem die meisten, beschwert sich Nando; sie schiebt die Bitten ihrer Kollegin vor: Die hat zwei Kinder, und die Frühschicht passt ihr besser. So bleiben ihr die Morgenstunden, und sie erspart sich die Abende in der Bar mit seinen Freunden – durch die Macht der Gewohnheit auch die ihren –, die billigen Tapas, die Babys inmitten schmutziger Servietten. Alicia hatte gedacht, die anderen Frauen würden, nachdem sie Mutter geworden waren, die Tradition begraben, aber sie bleiben, bis die Kinder ins Bett müssen, und schlafen die tief genug, kommen sie manchmal sogar zurück. Nando ist enttäuscht, dass sie sich dem Ritual entziehen will. Tu wenigstens das für mich, verlangt er. »Das« meint manchmal, ihre Abende in der Bar unten zu vergeuden, manchmal, ihn auf der jährlichen Radrallye zu begleiten. Er tritt in die Pedale, sie fährt mit den anderen Frauen im Auto nebenher, und Alicia denkt, dass der Ausdruck »Ehebande« niemals sprechender gewesen ist: An diesen Wochenenden jucken ihr die Handgelenke, als wären sie gefesselt. Nachts in der Pension – raue Laken – beißt Nando sich auf die Lippen und hält ihr den Mund zu, damit kein Laut sie verrät, und fragt anschließend, warum sie diese Ausflüge meide, wenn sie ihr doch so guttun.
So geht es Tag auf Nacht auf Tag auf Nacht auf Tag, der eine wie die andere, ohne einen einzigen Morgen, an dem Alicia krankgemacht hätte und bummeln gegangen wäre, ohne eine einzige Nacht, in der sich in ihrem Kopf nicht der gleiche Albtraum abgespielt hätte. Ihre Chefs – sie hatte schon einige, junge Männer, früher etwas älter als sie, inzwischen sind sie ein paar Jahre jünger und stecken das Hemd in die Hose – wundern sich, wie lange sie schon auf derselben Stelle ausharrt; einige fragen, ob es sie nicht langweile, für Reiseproviant zu kassieren, und sie antwortet, es mache ihr Spaß – das wissen sie zu schätzen: Diese Freude der Schokoriegelverkäuferin beruhigt sie, sag mal, Patricia war dein Name, stimmt’s –, das sei ihr genug. Einer wollte wissen, ob Alicia keine Träume habe: Wenn du wüsstest, und sie dachte an den taumelnden Mann, an den leblosen, rotierenden Leib, während der damalige Chef in ihrem Kopf Luxusappartments im Zentrum vermutete, Monate an Stränden mit durchsichtigem Wasser.
Ob Früh- oder Spätschicht, ihre Gewohnheiten bleiben gleich: Wenn sie vormittags arbeitet, holt sie nachmittags Nando ab oder wartet auf seinen Anruf, und sie treffen sich unten in der Bar, umgeben von den plärrenden Kindern anderer; wenn sie nachmittags arbeitet, hat sie mehr von ihrer Zeit. Manchmal schminkt sie sich morgens ein wenig – sie weiß nie so recht, was sie betonen soll: Mit den Jahren hat sich Fett an Hüften und Schenkeln gesammelt, es bleiben die Mausaugen, die sie von ihrer Mutter geerbt hat und diese von ihrem Vater, ein Jammer, meint Onkel Chico –, sie geht in Viertel, in die Nando niemals einen Fuß setzen würde, zeigt sich allzu interessiert, wenn sie in einer Bar Kaffee trinkt, in der die Köchin noch nicht mit der Arbeit begonnen hat, oder vor der Theke einer Fleischerei, die bald schließen wird. Wenn Nando nicht fort war, hielt sie sich anfangs zurück, aus Angst, entdeckt zu werden, aber dann geschah es doch: Sie füllte gerade Formulare für die Sozialversicherung aus, und ein Typ im Wartesaal wollte ihr unbedingt den Roman erzählen, den er gerade las. Alicia schämt sich langsam ihres Körpers, sie ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen.
Die Glorieta de Atocha fast leer, kaum Autos, kaum Fußgänger. Hell wird es erst in ein paar Minuten. An der Cuesta de Moyano sind die Bücherstände noch verrammelt, ein paar violette Tupfer – die Frauen macht sie in der Ferne aus –, die beim Karussell Transparente stapeln. Sie hat im Fernsehen etwas über den heutigen Tag gehört, aber gleich ist sie wieder abgelenkt, die Ampel springt auf Grün, sie geht zum Bahnhof hinüber, denkt an Dinge, die ihr wichtiger sind.
María schläft gut, tief und fest. Als sie in den Ruhestand gegangen ist, hat sie den Wecker in eine Plastiktüte gesteckt und bei der Bürgerinitiative ins Tauschregal gestellt, vielleicht braucht ihn jemand. Seit Jahren schon hatte sie ihn nicht mehr benutzt – sie hat ihn wie alle Welt durch den Handyalarm ersetzt –, aber sie hielt es für eine symbolische Geste, wie gemacht für die Geschichte einer anderen: Jetzt, da ich ihn nicht mehr brauche, dachte sie, soll er jemandem von Nutzen sein, der früh aufstehen muss, soll er eine andere Geschichte begleiten, in der jemand vor Tagesanbruch das Haus verlässt. Fast immer wacht sie von allein auf. Sie stört das trübe Licht, das durch die Jalousien sickert, die rauschende Dusche des Nachbarn. Seit Monaten schon bereiten sie diesen Tag vor. Gestern Abend hat eine Freundin María eine WhatsApp geschickt: »kannnich glaubn, ds so weit is«. Bei Versammlungen und Kreistreffen relativiert María die Begeisterung der jungen Frauen: Mein ganzes Leben lang, all die siebzig Jahre, die ich bald erreiche, habe ich gelebt, um heute aufzuwachen, mich mit euch zu vereinen, mit euch zu marschieren. Bei der Bürgerinitiative hört sie: Jede, die will, soll in den Arbeitsstreik treten, soll in den Konsumstreik treten, soll in den Hausarbeits- und Sorgestreik treten. Jede soll sich aussuchen, was ihr passt, alle sind uns nützlich, wir verteilen hier keine Diplome für Feministinnen. Mein Mann wird sich umsehen, wenn heute nichts auf den Tisch kommt. Mach ihm doch ein Lunchpaket, eine Suppe, die soll er sich warm machen. Nicht mal das kann er? Nächste Woche Mikrowellenlehrgang, Grundbegriffe. Ich geh zur Arbeit, an dem Tag gibt’s Lohn, da kann ich nicht fehlen, aber nachmittags stoße ich bei Atocha zu euch. Und um sich selbst darf man sich sorgen? Bevor ich komme, will ich in die Badewanne, bis ich zur Rosine verschrumpelt bin. Na klar, heute sorgst du für dich selbst und sorgst für die Frauen.
Gestern Nachmittag hatten sie sich bei der Bürgerinitiative getroffen. Die einen bereiteten Sandwichs für die vor, die am nächsten Tag auf der Straße die Frauen informieren würden, die aus dem Supermarkt kamen oder doch zur Arbeit gingen; die anderen würden nicht etwa Streikposten stehen, sondern in aller Frühe ins Büro der Initiative kommen und berichten, was in all den anderen Städten geschah, auch in ihrer. Darf man beim Streiken Radio hören? Darf man im Internet surfen? Sie wickelten eine Backform aus der Alufolie und verteilten Kuchen. Sie hatten Empanadas gebacken, die jungen Frauen Hummus und Guacamole gemacht; eine der Veteraninnen tauchte den Löffel in die Tonschüssel wie in einen Eintopf oder eine Suppe. So isst man doch keinen Hummus, die Mädchen lachten. Das war ihr zu modern, sie dachte an ihre Mutter, die den Krieg miterlebt hatte und Lebensmittel niemals so verschwendet hätte: Wo kommt ihr denn her, aus dem Nildelta oder aus Carabanchel, hier in Carabanchel gehören die Kichererbsen in den Eintopf. Während sie das Toastbrot mit Chorizo und Salami belegten, es in Dreiecke schnitten, in Plastikfolie wickelten und im Kühlschrank verwahrten, um es am nächsten Tag zu verteilen, zählte María die Streiks und Demonstrationen auf, an denen sie nicht teilgenommen hatte: die in den Siebzigern unter Suárez, vor und nach den Wahlen, die des Nein zur NATO, die von 85 gegen die Rentenreform, der Generalstreik von 88, die beiden in den Neunzigern, die Demos gegen den Irakkrieg, die von 2010, die beiden von 2012 – die eine gegen Rajoy, die andere europäisch –, der »Zug der Freiheit« für das Recht auf Abtreibung. Bei den grünen Wellen warst du dabei, erinnert sich eine der Jüngeren, eine Studentin, bei den Demonstrationen der Marea Verde bist du mitgegangen, und María erzählt, bei einer habe sie eine Journalistin gefragt, ob sie für ihre Enkelin demonstriere, und auf die Tochter einer Freundin gedeutet, sie wusste nicht, was sagen, und hatte bejaht, für ihre Enkelin und die Freundinnen ihrer Enkelin, und die Mädchen aus der Jugendgruppe der Initiative hatten in die Kamera gewinkt, als wären sie ihr Fleisch und Blut. María war vertraut mit diesen Vor- und Nachnamen, die zu ihrer Biografie gehörten – Felipe, Boyer, Aznar – und die niemals etwas von einer Frau erfahren würden, die Ende der Sechziger aus einem nie zu Ende gebauten Viertel einer Stadt im Süden nach Carabanchel gezogen war. Eine Ministerin unter Zapatero hatte den Frauen der Bürgerinitiative einen Preis verliehen, doch sie war nicht dabei gewesen. Die Verleihung hatte vormittags stattgefunden, und sie hatte sich nicht freinehmen können.
Nando bittet, gib mir wenigstens das, Alicia. »Das« meint nicht mehr die Ehe, auf die Alicia dann doch eingegangen ist, weil sie ihr diese triste Wohnung in einem tristen Viertel sicherte, und meint auch nicht die Kinder. Nando hat sich – fast – damit abgefunden, dass sie nie geboren werden. »Das« manifestiert sich bei ihrem Mann gelegentlich als Wochenende mit dem Radsportverein, schöne Landschaften in nicht optimaler Gesellschaft, oder als zusätzliche Strandtage mit seiner Mutter, der gegenüber Alicia den gesunden Brauch des Schweigens pflegt; »das« manifestiert sich als Samstagabend bei einem befreundeten Paar und als Abendessen in einem Restaurant im Viertel. Alicia hat sich auf »das hier« eingelassen – auf »das hier«, nicht auf »das«: auf Nando, mit Nando zu leben, ihn zu heiraten, ihr Leben dem seinen anzupassen –, und die Weigerung, Kinder zu bekommen, zwingt sie zu einem täglichen Nachgeben: Wer etwas haben will, muss etwas bieten; wer etwas verweigert, muss dafür entschädigen. Alicia hat noch Zeit: Und wenn sie ja sagt, einverstanden, wenn sie Glück haben und es sofort klappt, wenn sie in einem Jahr ein Beistellbettchen anbauen, damit sie das Schreien gleich hören? Wie mühsam wäre es für Alicia, die zusätzlichen Kilo wieder loszuwerden? Würden ihre Chefs honorieren, dass sie jahrelang erklärt hatte, der Hamburger sei nicht im Angebot enthalten, oder sie durch eine zehn Jahre Jüngere ersetzen, der es ebenso egal ist wie ihr, für einen Hungerlohn zu arbeiten? Die Milchtröpfchen, die den BH nässen, der schlaffe Bauch. Sie würde sich eine andere Strategie ausdenken müssen, die Angel auszuwerfen, denn Alicia lässt sich schon jetzt auf allzu alte oder durchgeknallte Männer ein, wenn ihr nichts Besseres über den Weg läuft, und sie befürchtet, dass nicht einmal die ihren Mutterkörper hinnehmen würden. Der Mutterkörper ist für keinen Mann ein Glücksfall. Ihren Mutterkörper, kann sich Alicia den vorstellen? Wie wird Nando reagieren, wenn ihre Brüste noch mehr hängen, wenn sie Streifen an den Schenkeln bekommt? Nando wird sie nicht mehr mit dem Vornamen anreden, wird sie – sogar vor anderen – »Mama« nennen, als hätte Alicia gleich doppelt entbunden. Vorher hätte er sich den Sex verboten, aus Angst, mit seinem Ungestüm das Genie seines Sprosses zunichtezumachen – ein Vorteil für Alicia: die Verwandlung von der Ehefrau zur Mutter würde sie vor der Lust ihres Mannes schützen –, er hätte ihr Tee gegen die Übelkeit der ersten Monate gekauft, Beißringe und Stillkleider. Sie denkt an ein Baby – nennen wir es Alicita –, das es nicht gibt, also vergnügt sie sich mit der Vorstellung von Alicita, von dem, was Alicita mit sich bringt – ob sie ihre Mausaugen bekommt oder Nandos Augen? –, und sie googelt: mitwachsendes Umstandskleid, Umstandsshirt, die Brüste in einem dieser scheußlichen BHs. Mit etwas Glück verguckt sich Nando während ihrer Schwangerschaft in eines der Mädchen, die im Lager arbeiten, in der Verwaltung – er erwähnt mehrere, sympathisch und hoch qualifiziert: sie hat ihre Namen vergessen –, und lässt sie eine Zeitlang in Ruhe, ein paar Monate, den Rest ihres Lebens. Was wird sie unterdessen mit Alicita machen, falls Alicita existieren sollte, wenn Nando sich amüsiert? Als Erstes fällt ihr ein, sie für ihre Eskapaden in der Stadt zu benutzen: Ein Mann tritt zu ihnen, unter dem Vorwand, ihr beim Zusammenfalten des Kinderwagens zu helfen, eine süße Grimasse führt zu einem Gespräch auf dem U-Bahnsteig. Wie alt ist die Kleine – Alicita in rosa Spitzen, zwei kleine Perlen an den Ohrläppchen, fast von Geburt an –, und sie wird begeistert antworten, irgendeine Geschichte erfinden, da Alicita keinerlei Regung zeigt, nichts hört, ihr Leben aus wenig mehr besteht als aus Weinen, Trinken, Scheißen und Gewickeltwerden. Alicita in einer Wohnung in Palomeras oder Las Tablas neben einem Schirmständer geparkt, während ihre Mutter es mit einem Unbekannten treibt, der sie um ihre Telefonnummer bittet, damit sie sich wiedersehen, und wochenlang Fotos von seinem Schwanz an einen Mathematiklehrer in Cartagena schickt, dessen Nummer in drei, vier Ziffern mit Alicias übereinstimmt. Sie hält ihr Lachen nicht zurück, auch wenn die Kunden sie hören können. Und wenn Alicita von diesen Treffen ein Bild, ein Klang im Kopf bleibt? In den Träumen ihrer Tochter für den Rest ihres Lebens ein Frauenkörper auf dem eines Mannes, ein Männerkörper auf dem einer Frau, Rauputzwände einer Wohnung mit dreißig Jahre alten Möbeln, jemand soll unten liegen, jemand soll oben liegen, und dann plötzlich, unmittelbar vor dem Erwachen, entdeckt Alicita ihr eigenes Gesicht in dem der Frau, die neben einem Körper liegt, von dem sie nichts weiß und den die schwitzende Frau verachtet, endlich glücklich für einen Augenblick.
Und früher auf den Versammlungen, gab es da viele Frauen, María? Das hatte unschuldig eine der ganz Jungen gefragt, fast noch ein Teenager, von den Fingerspitzen bis zum Handgelenk Spuren von Schmierfett. María musste immer wieder an diese Hände denken, so jung und schon verunstaltet, denn in ihnen deutete sich jemand an, der sie mehr würde benutzen müssen als den Kopf. Sie bewunderte, wie sich das Mädchen – die Tochter der Tochter einer Freundin, sagte sich María mit seltsamem Stolz – trotz ihrer Jugend artikulierte, die kategorische Art, in der sie ihre Gedanken zum Ausdruck brachte, ihr Verständnis für Andersdenkende, und zugleich beruhigte sie diese Zwischenbemerkung, bei der sie wieder zu ihrem Alter zurückfand: Ich kann einfach nicht glauben, dass die Männer dich nicht haben reden lassen. Ich war immer mit den Männern der Bürgerinitiative zusammen, erklärte María. Einer von ihnen wurde mein Freund, fünf, sechs Jahre nachdem ich nach Madrid gekommen war. Ich habe ihn immer zu den Treffen begleitet, bei denen es um Verbesserungen fürs Viertel ging. Damals gab es hier viele heikle Ecken, mehr als heute, vor aller Augen haben sie sich Drogen gespritzt, vor meiner Haustür, haben nicht nur Taschen weggerissen, die brauchten mehr, und es gab noch die Baracken und dahinter das Gefängnis. Wir hatten das Gefühl, südlich des Flusses existiert niemand: niemand, das waren natürlich wir Frauen. Ich habe angefangen, mir Gedanken über das zu machen, was bei den Treffen geredet wurde, habe Namen von Schriftstellern notiert, die die Männer dort erwähnten, auch andere, mit denen ich weniger Kontakt hatte, im Lokal der Bürgerinitiative oder in den Bars, wo wir etwas trinken gegangen sind. Ich bin von einem Schriftsteller zum nächsten gesprungen, und deren Gedanken habe ich dann diesem Mann erzählt, meinem Freund, Pedro hieß er, und bin sie mit ihm durchgegangen. Der hat sie dann bei der nächsten Versammlung den anderen vorgestellt: So ein schlauer Kerl, der ist ja ein halber Professor, alle haben ihn bewundert. Ich bin stumm geblieben, denn alles, was ich mit meiner Stimme hätte sagen können, klang in seiner besser. Ich habe mich aber mit anderen Frauen zum Kaffee getroffen, mit deiner Großmutter und anderen Freundinnen, mal im Wohnzimmer der einen, mal bei der anderen, mal bei mir, und da haben wir über Themen gesprochen, die uns näher waren und die Männer wenig interessierten: Scheidung, Abtreibung, Gewalt, nicht nur die mit Fäusten, sondern die mit Worten. Deine Mutter hat mir Bücher empfohlen, aus ihrem Studium, und ich habe weitergelesen und gemerkt, je mehr ich auf eigene Faust denke, desto unbehaglicher fühlt sich Pedro. Deine Mutter und ich, wir haben miteinander geredet, haben geredet, wie wir es seit eh und je tun, und schließlich gefragt, ob wir eine Frauengruppe der Initiative gründen dürfen. Sie dachten wohl, wir würden Rezepte austauschen oder Kleidung, die uns nicht mehr passt. Wir haben uns mit deiner Mutter und ein paar ihrer Studienfreundinnen hier getroffen und sind ihnen allmählich auf die Nerven gegangen. Die Stadtverwaltung hatte uns einen Raum überlassen und ihn wieder einkassiert, als wir uns über die mangelnde Parkbeleuchtung beschwerten; wir haben Geld zusammengekratzt und selbst etwas gemietet. Ich habe mich damals halb totgearbeitet, als Putzfrau in Büros, bei Nuevos Ministerios, habe auf dem Rückweg in der U-Bahn ein Sandwich gegessen oder rasch irgendwo einen Imbiss im Stehen; und abends habe ich mich manchmal noch kurz mit Pedro getroffen, aber ich glaube, nie bin ich so zufrieden gewesen. Nicht einmal jetzt, da ich nicht mehr in aller Frühe aufstehen muss, den Tag mit euch in der Bürgerinitiative verbringe und sehe, dass immer mehr Frauen helfen. Damals hatte ich zum ersten Mal im Leben das Gefühl, dass mir jemand zuhört und respektiert, was ich sage. Nicht, weil er mit mir ins Bett wollte, nicht, weil er abgeschaltet hätte und meine Stimme nur ein fernes, unverständliches Rauschen für ihn gewesen wäre, sondern weil mich jemand verstanden hat und einverstanden war und dachte, dass es sich lohnt, mir zuzuhören, weil ich eben sage, was ich sage. Doch der Moment kam, in dem all das, die Gedanken, sie aussprechen und tun, wovon ich sprach, die Bürgerinitiative, viel wichtiger für mich war als alles, was Pedro mit mir vorhatte. Er wollte, dass wir zusammenzogen, und mir wurde klar, dass das nichts mit Liebe zu tun hatte. Ich war nicht María, eine Person, sondern etwas, ein Ding, als dessen Eigentümer er sich fühlen konnte: seine Wohnung, sein Wagen, seine Frau. Diese Narbe – sie deutet auf ihr Kinn, eine glänzende Schramme auf der weißen Haut – kommt daher, dass ich einmal überstürzt aus dem Bus gestiegen, gestolpert und hingefallen bin, und ihn hat es nicht mal gejuckt. Danach haben wir es gerade noch ein Jahr zusammen ausgehalten. Also nein: Nie habe ich damals Frauen wie uns getroffen, das wollte ich sagen. Was meinst du, María? Arme Frauen. Selbst fürs Protestieren braucht man Geld.
Das Haus
Córdoba, 1969
Das Baby riecht nach Zigarette. Als María Carmen auf den Arm nimmt, fällt ihr als Erstes auf, dass sie ganz anders riecht als andere Babys. Bei Onkel und Tante riecht die Tochter der Nachbarin manchmal nach Zwiebel, sosehr ihre Mutter es mit Kölnisch Wasser zu überdecken versucht; der kleine Junge zu Hause – in dem Haus, in dem sie arbeitet, verbessert sich María; es ist nicht ihr Zuhause, sie hat keins – ist ein paar Monate vor ihrer Tochter zur Welt gekommen und hat einen süßen Geruch. María kann es schwer erklären – was ist ein »süßer Geruch«? –, denn sie hat noch nie etwas Ähnliches gerochen, doch sie erkennt den Geruch in Läden wieder, in Cafés. Die Nachbarstochter spielt nachmittags mit den Töpfen, und der kleine Junge lebt zwischen Bettchen und Tragetasche im Wohnzimmer. Carmen kommt auf ihre Weise in der Wohnung herum, ist im Schlafzimmer oder auf dem Arm der Großmutter am Esstisch. María denkt, dass der Zigarettengeruch mit ihrer Familie zu tun hat. In der Küche raucht ihre Mutter, ihr Vater raucht auf Schritt und Tritt, und vermutlich raucht inzwischen auch ihr Bruder Chico im Schlafzimmer und glaubt, dass es niemand merkt. Carmen riecht nach Zigarette; vielleicht denkt María, dass ihre Tochter nach einer Zweizimmerwohnung riecht, oder vielleicht denkt sie nur, wie seltsam es ist, dort zu schlafen, mit ihr.
Vor ein paar Wochen ist Carmen ein Jahr alt geworden, und María kehrt zum ersten Mal seit ihrem Fortgang nach Hause zurück. Sie hat im Bus die Worte geprobt, mit denen sie Madrids breite Straßen beschreiben will, und was sie besser auslässt, damit sie keine Gegenden erwähnt, die ihr Onkel und Tante streng verboten haben. Sie versuchte, mit der Frau auf dem Nebensitz ins Gespräch zu kommen, redete über das Wetter und die Unterschiede zwischen den beiden Städten – die breiten Straßen, die Gegenden, die man besser meidet –, aber als Antwort erhielt María nur einsilbiges Gestammel und Gemeinplätze. Sie hatte Angst vor dieser untätigen Zeit, musste sie irgendwie füllen. Mal nickte sie ein, mal sah sie zu, wie sich die Farbe der Landschaft veränderte: Das spröde Gelb der Erde wurde greller, je mehr sie nach Süden kamen. Während ihre Tochter Mittagsschlaf hält, wollte María ausruhen, doch nun liegt sie mit offenen Augen neben ihr, den Blick starr auf ihre Atmung gerichtet. Sie sucht Ähnlichkeiten zwischen sich und Carmen. Die zarten Hände hatte sie noch in Erinnerung, aber nicht Marías plumpes Kinn, das ihr Komplexe bereitet. Carmens Haar – dunkel, wie das ihres Vaters – ist kaum gewachsen, und die wenigen Strähnen sind so fein, dass María ihr lieber nicht den Kopf streichelt, damit sie nicht brechen. Sie ist kleiner, als María erwartet hatte – viel kleiner als der Junge zu Hause –, und ihr Bauch ist immer noch geschwollen. Die blendend weiße Haut kommt wohl aus der Familie ihrer Mutter, María kann sie sich mühelos vorstellen, etwas jünger als sie jetzt, mit durchscheinenden Adern an Armen und Brust. Carmen wünscht sie mehr Glück.
In der Erinnerung passt Carmen noch bequem in ihre Arme, heute stützt sie ihre Tochter auf die Hüfte, die bloßen Arme reichen nicht mehr. Wie komisch, wird María viele Jahre später denken, dass sich das Gedächtnis seine eigene Fiktion schafft: Was sich uns nicht eingeprägt hat, weil wir es für bedeutungslos hielten oder etwas anderes erwartet hatten, wird durch das ersetzt, von dem wir uns gewünscht hätten, dass es geschieht. Tagsüber kocht, putzt, bügelt und gehorcht sie, doch abends widmet sie sich dem Erinnern. Vor dem Einschlafen skizziert sie im Kopf ihr Elternhaus: Beim Eintreten eine kleine Diele, wo die Mäntel hängen, links das Schlafzimmer ihrer Eltern – das Kopfteil des Betts aus Holz, die Jalousien fast immer heruntergelassen –, rechts das Zimmer, das sie mit ihren Geschwistern Soledad und Chico geteilt hat – früher auch mit den älteren –, hinten die Küche mit dem großen Tisch, anschließend Hof und Toilette: anfangs ein Loch im Boden, der schwere Eimer in der Ecke, randvoll mit Wasser, denk dran, leere ihn vollständig und fülle ihn für den Nächsten. Ihr früheres Bett hat man auseinandergenommen, an seiner Stelle steht jetzt das Bettchen der Kleinen: früher das ihrer Neffen, fast schon Halbwüchsige, das ihres kleinen Bruders. Die Augen bereits geschlossen, erlaubt sie sich, einiges rückgängig zu machen: Nimm nicht diesen Bus, erwidere nicht den Gruß dieses Mannes, geh nicht in dieses Haus.
María vermisst auch einige Fotos, die sie nicht mit nach Madrid genommen hat. So hätte sie vielleicht die Gesichter, die ihr entgleiten, festhalten können. In den Koffer hatte sie nur ein altes Foto von sich gesteckt, mit ihrer Schwester und ihrem Vater im Hof des Hauses, und manchmal versucht sie, die Spuren zu identifizieren, die sich auf dem Schwarz-Weiß der Mauer abzeichnen. Ein paar Monate nach ihrer Ankunft in Madrid hatte ihre Mutter ihr einen Brief geschickt, den sie Chico diktiert hatte. Sie musste lächeln über die Schönschrift der ersten Zeilen, die im zweiten Absatz nachlässiger wurde, ungelenk im Briefschluss. Ihre Mutter hatte ein Foto beigelegt. Darauf posierte einer der Neffen vor einer Geburtstagstorte, Chico hatte Carmen auf dem Schoß, stützte zärtlich ihren Kopf und schmierte ihr Baisercreme auf die Nase. María stellte es auf den Nachttisch. Dafür hatte man es vermutlich geschickt. Doch sie wollte damit die Tante warnen: Sie sollte sich nicht von der Folgsamkeit täuschen lassen, mit der sie in aller Frühe aufstand und später, wenn sie von der Arbeit kam, das Abendessen zubereitete und das Bad putzte. Dieses Foto erzählte die Wahrheit.
Als die Kleine aufwacht, sieht sich María Carmens Augen an: zwei schwarze Stecknadelköpfe. Das Baby streckt sich, und María reagiert darauf: Sie setzt sich auf den Bettrand, reckt den Hals, blickt ins Bettchen. Sie hat sich an die Spielchen mit dem kleinen Jungen zu Hause gewöhnt, an die Späßchen, die sie mit der Nachbarstochter macht, doch Carmen, ihr Kind, kommt ihr fremd vor. Carmen bewegt sich, als wollte sie sich aufrichten. Sie strampelt, zuerst ganz leicht, dann entschieden, weil nichts geschieht; sie bewegt die Arme, sucht Marías Blick. Die steht schließlich auf, tritt zum Bett, nimmt ihre Tochter auf den Arm – der Geruch nach Zigarette – und drückt sie an sich. Das Mädchen reagiert nicht auf die Liebkosung. Zwar strampelt es nicht mehr, doch das rechte Ärmchen streckt sich. María denkt, dass Carmen vielleicht auf einen ramponierten Teddy in der Zimmerecke zeigt. Wie stolz ist María in dem Moment. Es bewegt sie, dass Carmen schon so verständig ist, auf ihre Erinnerungen zurückgreifen kann und María darin findet, dass sie schon so weit ist, ihr ihre Spielsachen zu zeigen. Ist das so? Ist das so, oder sind das Marías eigene Vorstellungen? Mit Carmen auf dem Arm holt María den Teddy und gibt ihn ihr, aber das Mädchen stößt ihn mit einer Handbewegung weg: keine Tränen, kein Schreien, obwohl die Gebärden des Babys immer deutlicher werden. María nimmt das linke Händchen und legt es an ihre Brust; sie nennt sich »Mama«, wiederholt »Mama«, obwohl sie weiß, dass Carmen sie nicht von einer Fremden unterscheidet. Carmen streckt immer noch den rechten Arm, deutet auf etwas, das María nicht errät:
»Was willst du, Carmen?«
Carmen versteht Marías Worte so wenig wie María Carmens Gebärden, das liegt auf der Hand. Soll sie jemanden holen, um Hilfe bitten? Chico kommt erst abends von der Arbeit. María vermutet, dass ihr Vater im Bett liegt, ihre Mutter in der Küche sitzt, Soledad ihr gegenüber am Tisch näht. Was braucht ihre Tochter? Das Baby streckt den Arm aus, deutet hinunter auf eine breite Schublade. Man hat ihr erklärt, dass die unterste Schublade Carmen gehört, die beiden folgenden Chico, die anderen beiden Soledad; in der obersten sind noch Sachen von María. Damals hatte sie darin etwas Wäsche aufbewahrt, ein Heft, ein breites Plastikarmband, das sie auf der Straße gefunden und ab und an getragen hatte; das Armband hatte sie weggeworfen, den Rest in den Koffer gepackt. Doch das Baby, das Baby jetzt: Es deutet auf die Schublade, auf der ihre Mutter – Marías Mutter, Carmens Großmutter – ihr am Morgen die Windeln gewechselt hat.
María erkennt ihren Irrtum: Carmen verlangt weder Zärtlichkeit noch Beachtung, sondern Routine. Carmen verlangt, dass sie jemand nach dem Mittagsschlaf auf den Arm nimmt, aus dem Bettchen holt und auf die improvisierte Wickelunterlage legt. Wer, ist ihr egal: die Mutter ihrer Mutter, der Bruder ihrer Mutter, die Schwester ihrer Mutter, die eigene Mutter. Heute übernimmt das María, aber wenn sie wieder in Madrid ist, wird sich jemand anderes darum kümmern, und Carmen wird es ebenso stumm mit sich geschehen lassen. Carmen hat keine Angst vor Fremden. Sie ist es gewohnt, abends im Arm einer der Nachbarinnen zu liegen, die sich vor dem Haus versammeln; sie hat auch keine Anst vor der unbekannten Frau, die ständig »Mama« wiederholt, sie an sich drückt und ihr ein Stofftier hinhält. Auf dem Handtuch hört Carmen zu strampeln auf, sie hebt die Beine ein wenig – wie jeden Tag, jedes Mal –, murrt, weil María einen Schritt ausgelassen hat. Als María das Mädchen für sauber hält und es geschafft hat, sie zu wickeln, legt sie Carmen wieder ins Bettchen und streckt sich auf dem Bett des Bruders aus. Bevor sie die Augen schließt, hat sie das Gefühl, dass Carmen – der Babykörper längs zu ihrem Erwachsenenkörper, beide im Begriff, den Schlaf zu suchen – sie beobachtet.
Vor dem Haus erst drei, vier Frauen, dann mehr, acht oder neun. Ihre Stimmen vermischen sich, die Tonlagen sind nicht zu unterscheiden, dieselben Wörter aus unterschiedlichen Mündern. Die Nachbarinnen versammeln sich jeden Abend auf dem Gehweg; mit Stühlen, die jede von zu Hause mitbringt, pilgern sie hierher, essen manchmal ein paar Happen zu Abend, falls der Ehemann spät nach Hause kommt. Der Brauch war in den Anfangsjahren des Viertels entstanden, als María ein kleines Mädchen gewesen war, die großen Brüder noch im Haus und die kleinen Geschwister gerade erst auf der Welt. Damals begegneten sie der Nacht mit Kerzen, denn es gab noch keine Straßenbeleuchtung, und die Stühle standen auf der bloßen Erde. Chico erinnert sich nur, dass er mit der Mutter immer zum Brunnen gegangen ist. Jetzt sieht es im Viertel anders aus, obwohl aus den Straßen bei Regen weiterhin Morast wird. Man hat versprochen, das in Ordnung zu bringen, verrät ihr Chico, das habe er vor ein paar Wochen in der Bar gehört. María hat nicht das Gefühl, dass sich im letzten Jahr viel verändert hätte, sosehr Chico auch behauptet, sie werde vieles nicht wiedererkennen, wenn sie einen kleinen Rundgang mit ihm machte.
»Ich reiche nicht über die Theke.«
»Das glaube ich nicht.«
María entschlüpft ein Lachen, als Chico das sagt. Da er so klein sei, hätten ihn die Kunden an den ersten Tagen gar nicht bemerkt. Ihr Bruder übertreibt. In Chicos Worten klingt die Wirklichkeit immer ernster oder glücklicher, je nachdem, und María amüsiert es, wie er von Soledads Schweigen erzählt, von Carmen oder dem Klatsch der Nachbarinnen.
»An den ersten Tagen hat nur mein Kopf hervorgesehen. Ein Kinderkopf, der eine Flasche auf die Theke stellt. Dann habe ich mir einen Steg aus Limonadenkisten gebastelt, und jetzt sieht man den ganzen Oberkörper.«
Chico hat seinen Vornamen an den Spitznamen verloren. Er selbst stellt sich als Chico vor, so hatte sein Vater ihn von Geburt an genannt: das kleinste Kind, ein blondes Baby, mehr Knochen als Fleisch, mit großen, hellen Augen – wie die von María –, das einfach nicht wachsen will. Mit sechs schätzte man ihn auf gerade mal vier; jetzt, mit dreizehn, auf gerade mal elf. María hatte immer gedacht, dass Chico als Einziger von ihnen dem Viertel entkommen würde. Er ging gern zur Schule, hatte Freude an den Zahlen. Sie war enttäuscht, als sie erfuhr, dass er die Schule aufgab, um in der Bar des älteren Bruders zu helfen. Das denkt sie, während sie versucht, die Worte ihres Bruders vom Stimmengewirr der Frauen zu unterscheiden, fünf, sechs, sieben, ihr Schwatzen dringt durchs Fenster. Ist sie hier? Sie ist hier. Im Schlafzimmer, mit der Kleinen und dem Bruder. Sie ist gekommen? Also ich könnte das nicht. Ich hätte nicht gehen und sie hierlassen können, wie ein Stück Plunder, das man vergisst. Ich hätte das gar nicht erst tun können. Was tun? Sprich leiser, die Mutter hört dich. Und die da hört dich auch. Was? Sie ist gekommen? Da lob ich mir Soledad, immer schön still und brav. Und den Kleinen. Ich hab’s der Mutter gesagt, die wollte nicht auf mich hören. Seid still, der Kleine, der ist noch ein Kind.
»Hör nicht auf sie«, tröstet sie Chico und bestätigt Marías Verdacht: ein rascher Zug an der Zigarette, noch einer und noch einer, vor Carmens Bettchen, die jetzt im Arm ihrer Mutter liegt.
»Seit wann rauchst du?«
»Seit ich in der Bar bin. Sie haben mich ständig ausgelacht. Für manche war ich ein Mädchen, sie haben mich ›Chica‹ genannt. Ich mag keine Zigaretten, aber so wirke ich älter. Findest du nicht auch?«
»Ist die Kleine sehr anstrengend?«
»Ich bin den ganzen Tag nicht da. Ich liefere Soledads fertige Arbeit ab, zur gleichen Zeit wie immer, und wenn ich aus dem Zentrum zurückkomme, bringe ich ihr die neue mit und gehe weiter zur Bar. Toñi und ich sind zwar allein, aber besser so. Nach dem Mittagessen haben wir unsere Ruhe, höchstens trinkt mal einer einen Kaffee, dann kommen die Männer mit Karten und Domino, ein paar Abendessen und nach Hause. Da schläft die Kleine fast immer. Süß ist sie nicht gerade, aber ganz schön schlau. Manchmal spreche ich mit ihr, und sie hört zu, als würde sie mich verstehen. Jedenfalls ist sie lieber bei mir als bei Soledad.«
Beide schweigen, falls die Schwester sie hören kann. Soledad ist weniger eine Brücke als eine Lücke zwischen ihnen. Sie wurde nach María und vor Chico geboren, und für beide kommt sie wie aus einer anderen Welt, hat nichts mit ihnen gemein. Sie sitzt in der Küche, näht, hört die ganze Zeit Radio, hält kaum zum Mittagessen inne, ruht nur kurz aus. Manchmal unterbricht sie ihre Arbeit vorzeitig, macht ein paar Klatschspiele mit Carmen, will sich liebevoll geben, aber schnell wird es ihr langweilig. Chico drückt die Zigarette aus und hält María die Arme entgegen, damit sie ihm Carmen reicht.
»Sie sind weggezogen, María.«
»Davon will ich nichts wissen.«
»Gut. Jedenfalls sind sie weg. Du könntest jetzt wiederkommen.« Chico verstummt, falls María etwas erwidern will, aber seine Schwester schweigt. »Wie ist Madrid? Ich würde gern mal hin. Vielleicht im Urlaub.«