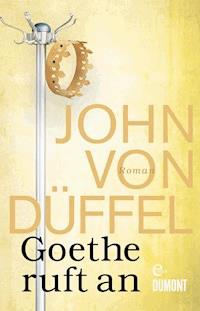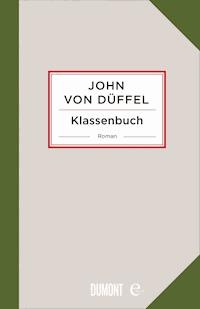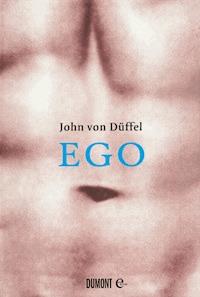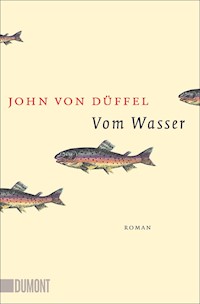10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DUMONT Buchverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
März 2020: Ein protestantischer Pfarrer in der Uckermark, der dem Tod ins Auge blickt. Eine Anästhesistin der Charité, die mit einem Rabbi zusammen in Quarantäne gerät. Ein Kunststudent, der heillos in seine Professorin verliebt ist und in eine Welt der Betäubung abdriftet. Und Selma, die Enkelin, Tochter und Schwester der Genannten, die diese Familie irgendwie zusammenhalten soll – keine leichte Aufgabe in Zeiten von Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln, in denen Distanz zur Tugend wird und Nähe zum Problem. Die vier auseinandergerissenen Familienmitglieder sind weniger durch Ähnlichkeit miteinander verbunden als durch eine gemeinsame Leerstelle: Holger, Pfarrerssohn, Ex-Mann und Vater der Protagonisten befindet sich nach einem Suizidversuch in einer Klinik und ist nunmehr so gut wie unerreichbar. Für jede der Figuren bedeutet er eine Lücke, einen Phantomschmerz der anderen Art. Doch Holger ist nicht der einzige Abwesende, der im Leben der Familienmitglieder viel präsenter ist, als sie es wahrhaben wollen. Die Verschwundenen – Lebende wie Tote – und die Wut- und Schuldgeschichten, die zu ihnen führen, kommen immer mehr zum Vorschein in dieser extremen, brennglasartigen Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 459
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Erzählen vom veränderten Leben
März 2020: Ein protestantischer Pfarrer in der Uckermark, der dem Tod ins Auge blickt. Eine Anästhesistin der Charité, die mit einem Rabbi zusammen in Quarantäne gerät. Ein Kunststudent, der heillos in seine Professorin verliebt ist und in eine Welt der Betäubung abdriftet. Und Selma, die Enkelin, Tochter und Schwester der Genannten, die diese Familie irgendwie zusammenhalten soll – keine leichte Aufgabe in Zeiten von Kontaktbeschränkungen und Abstandsregeln, in denen Distanz zur Tugend wird und Nähe zum Problem.
Die vier auseinandergerissenen Familienmitglieder sind weniger durch Ähnlichkeit miteinander verbunden als durch eine gemeinsame Leerstelle: Holger, Pfarrerssohn, Ex-Mann und Vater der Protagonisten befindet sich nach einem Suizidversuch in einer Klinik und ist nunmehr so gut wie unerreichbar. Für jede der Figuren bedeutet er eine Lücke, einen Phantomschmerz der anderen Art. Doch Holger ist nicht der einzige Abwesende, der im Leben der Familienmitglieder viel präsenter ist, als sie es wahrhaben wollen. Die Verschwundenen – Lebende wie Tote – und die Wut- und Schuldgeschichten, die zu ihnen führen, kommen immer mehr zum Vorschein in dieser extremen, brennglasartigen Zeit.
© Birte Filmer
John von Düffel wurde 1966 in Göttingen geboren, er arbeitet als Dramaturg am Deutschen Theater Berlin und ist Professor für Szenisches Schreiben an der Berliner Universität der Künste. Seit 1998 veröffentlicht er Romane und Erzählungsbände bei DuMont, unter anderem ›Vom Wasser‹ (1998), ›Houwelandt‹ (2004), ›Wassererzählungen‹ (2014), ›Klassenbuch‹ (2017), ›Der brennende See‹ (2020) und zuletzt ›Wasser und andere Welten‹ (Neuausgabe 2021).
Seine Werke wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem aspekte-Literaturpreis und dem Nicolas-Born-Preis.
John von Düffel
DIE WÜTENDENUND DIE SCHULDIGEN
Roman
Von John von Düffel sind bei DuMont außerdem erschienen:
Vom Wasser
Zeit des Verschwindens
Ego
Houwelandt
Hotel Angst
Beste Jahre
Wovon ich schreibe
Goethe ruft an
Wassererzählungen
KL – Gespräch über die Unsterblichkeit
Klassenbuch
Der brennende See
Wasser und andere Welten
eBook 2021
© 2021 DuMont Buchverlag, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Lübbeke Naumann Thoben, Köln
Umschlagabbildung: © plainpicture/Yann Grancher
Satz: Fagott, Ffm
eBook-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck
ISBN eBook 978-3-8321-7108-7
www.dumont-buchverlag.de
Für
Katja und Greta
Dank
Petra Anwar
TEIL I
SELMA
… versuchte wegzuhören. Schon zum dritten Mal telefonierte Kathi Kuhn während der Fahrt, um mittels Ferndiagnose die Medikamentierung und Dosierung für ihre Patienten einzustellen. Die kryptischen Mengenangaben und Abkürzungen lösten in Selmas Gehirn Entschlüsselungsreflexe aus, die sie diskret unterdrückte. Doch sie konnte nicht ausblenden, dass hauptsächlich von Fentanyl die Rede war. Fentanyl, so viel verstand sie, bekamen die Todgeweihten.
Der Verkehr auf den Landstraßen war epidemisch dünn, so als wäre mitten in der Woche Sonntag. Selma krallte sich trotzdem in den Sitz, als Kathi für ein Überholmanöver auf die Gegenfahrbahn wechselte und an zwei Lkws vorbeizog, beide von derselben Spedition. Danach kam nichts mehr. Die Landschaft links und rechts erblühte auf unwirkliche Weise unter einer hoch stehenden Märzsonne: Triebe, Knospen und Blätter, Andeutungen von Baumkronen vor blauem Himmel. Irgendwo am Ende der großflächigen Felder glitzerte in einer Senke ein See oder eine Luftspiegelung. Der Frühling war erstaunlich weit, fühlte sich aber nicht an wie ein Anfang.
Einen Moment lang malte sich Selma ihren Unfalltod aus, in Kathi Kuhns schwarzem Mercedes-Kombi an irgendeinem Baum der Allee. Auf einer fernen Hügelkuppe zog ein Traktor eine Staubfahne über einen grauen Acker.
Kathi drängte auf ein Ende des Telefonats mit dem Pfleger, der sämtliche Anweisungen offenbar noch einmal wiederholte. Ihr mechanisches Nicken wurde begleitet von einem kurzen, schnappenden Ja. Ja. Ja. Selma verkrampfte auf ihrem Beifahrersitz unter dem Stress der anderen. Schon beim Einsteigen hatte sie kein gutes Gefühl gehabt, jetzt bekam sie ein schlechtes Gewissen, weil diese Ärztin Wichtigeres zu tun hatte, als mit ihr aufs Land zu fahren. Dr.Kathi Kuhn war, wie Selmas Mutter jedem sagte, eine Institution. Die beiden hatten Anfang der Neunziger zusammen Medizin studiert und waren seitdem beste Freundinnen. Doch während ihre Mutter den stillen, unscheinbaren Weg in die Anästhesie gewählt hatte, war KK zu einer Vorreiterin der Palliativmedizin geworden, ein Beispiel dafür, dass Mediziner nicht nur Leben, sondern auch Tode retten konnten. Die Friedhöfe von Kreuzberg waren voll von Verstorbenen, deren Leiden sie gelindert hatte. Und die Angehörigen dankten es ihr noch Jahre und Jahrzehnte später, teils mit Umarmungen auf offener Straße.
Vielleicht hatte sie das Wort Fentanyl ein paarmal zu oft gehört, doch Selma wurde auf einmal bewusst, wie sehr es beim Leben und Sterben um Betäubung ging – im richtigen Maß, an der richtigen Stelle, zur richtigen Zeit. Der Unterschied zwischen einem sanften Tod und der wundersamen Todesähnlichkeit der Narkose, zwischen Entschlafen und Einschlafen erschien ihr gar nicht mehr so groß und die Freundschaft zwischen einer Palliativmedizinerin und einer Anästhesistin fast zwangsläufig.
»Wo bleiben die Funklöcher? Heute ist mein freier Tag!« Kathi zupfte den Stöpsel aus ihrem Ohr und schickte ein halbseitiges Grinsen in Selmas Richtung. Dann machte sie sich am Autoradio zu schaffen und suchte einen Sender, der ein bisschen Musik zur Entspannung spielte. »Es gibt in meinem Beruf keinen günstigen Zeitpunkt, um wegzufahren«, erklärte sie weiter angesichts der Arbeit, die sie in Berlin zurückließ. »Gestorben wird immer, und für jeden ist es das erste Mal.«
Zu wissen, dass KK ihrem Alltag kaum entfliehen konnte, machte die Sache nicht leichter. Am Ende dieser Fahrt wartete Richard und damit ein weiterer Patient, der ihren Rat und Beistand brauchte. Selma konnte nicht ermessen, wie gut sich Kathi und ihr Großvater kannten. Als Freundin der Familie hatte sie ein, zwei Feste auf dem Land mitgefeiert. Doch das windschiefe Pfarrhaus mit seinem wilden Garten war für sie kein Kindheitsort und Richards eigenbrötlerischer Haushalt vermutlich nur eine muffige Altmännerwirtschaft. Weder das schöne Wetter noch die Frühlingslandschaft konnten darüber hinwegtäuschen, dass sie nicht ins Blaue fuhren. Auf dem Rücksitz, neben dem schwarzledernen Arztkoffer, lag Richards Krankenakte. Von den Fällen am Telefon unterschied sich ihr Großvater nur durch die vielen Umstände, die ein Besuch bei ihm machte.
»Danke, dass du ihn dir ansiehst«, sagte Selma ein bisschen zu leise. »Danke – auch von Mama –, dass du mit ihm redest, in deiner freien Zeit. Es wird sicher nicht einfach …«
»Für deine Mutter tue ich alles.«
Ein alter Bonnie-Tyler-Hit heulte auf und brachte die Boxen zum Scheppern. Kathi zögerte einen Moment, dann schaltete sie das Radio wieder aus. Ohne hinzusehen, ertastete sie auf der Mittelkonsole die Schachtel Zigaretten samt Feuerzeug und zündete sich eine an, die fünfte, registrierte Selma, obwohl sie sich vorgenommen hatte, nicht mitzuzählen. Sie sah ein, dass dieses Auto eine Art Raucherbereich auf Rädern darstellte. Bei ihren todkranken Patienten musste KK auf ihre Nikotindosis verzichten. Die Fahrten zwischen den Hausbesuchen waren ihre einzige Pause.
Selma sollte und wollte noch ausrichten, dass für ihre Mutter wie für das gesamte Klinikpersonal höchste Bereitschaft galt; sobald die Lage es zuließ, würde sie nachkommen. Doch entweder wusste Kathi das schon, oder es verstand sich von selbst. Genauso fraglos, wie sie sich die Zigarette angesteckt hatte, betätigte sie den Fensterheber und blies den Rauch zur Seite, während der Fahrtwind im Fensterspalt knatterte wie ein frisch gewaschenes Laken beim Straffziehen. Selma fühlte sich nicht stark genug, um gegen den Lärm anzureden, was KK nicht zu stören schien. Nach den hektischen Telefonaten genoss sie es sichtlich zu schweigen.
»Zieht’s?«, erkundigte sie sich erst, nachdem sie aufgeraucht und die Kippe in den übervollen Aschenbecher gestopft hatte.
Es zog, doch die Frühlingsluft war auf seidige Weise kühl und angenehm, weshalb Selma nichts sagte. Sie schüttelte nur den Kopf und langte mit einem Arm hinter sich nach ihrer Strickjacke.
»Vergiss die Prognose.« Mit ihrer rauen, durchdringenden Stimme übertönte Kathi den Fahrtwind mühelos. »In fast fünfundzwanzig Berufsjahren habe ich noch nie erlebt, dass eine Prognose gestimmt hat, und ich rede nicht nur von Stunden oder Tagen, sondern von Wochen, manchmal Monaten.«
Selma brauchte einen Augenblick, um zu verstehen, dass damit die Einschätzung des behandelnden Arztes gemeint war. Offenbar sah es so aus, als wollte sie sich nicht ihre Strickjacke, sondern die Krankenakte vom Rücksitz angeln. Verlegen zog sie den Arm zurück und schaute auf ihre Knie.
»Ich dachte, was da drinsteht, unterliegt der ärztlichen Schweigepflicht«, sagte sie laut.
»Es gehört ins Reich der Spekulation.«
Von einer Prognose hatte ihre Mutter nichts erzählt, doch offenbar existierte ein Todesurteil, und die Frist war kurz. KK neigte nicht zu Nettigkeiten. Wenn sie jemanden aufmuntern wollte, musste es einen Grund dafür geben. Womöglich handelte es sich um eine niedrige einstellige Zahl, weniger als eine Woche.
Das Fenster war auf einmal zu.
»Mama kommt nach, sobald sie kann«, verkündete Selma nun doch; die Nachricht erschien ihr plötzlich bedeutungsvoll. »In der Klinik stehen gerade alle stramm und warten auf die erste Welle. Doch sie meint, es sei gerade so wenig Arbeit wie nie.« Offenbar war es ihrer Mutter weniger darum gegangen, Kathi Unterstützung zu versprechen, sie wollte vor allem Richard noch einmal sehen. Von dem Gespräch mit seinem Arzt hatte sie nur erzählt, er sei offiziell »austherapiert« – eine Formulierung, über die Selma lange nachgedacht hatte. Jetzt war ihr klar, was das hieß: Niemand konnte ihrem Großvater mehr helfen – niemand außer Kathi Kuhn.
Sie fuhren durch ein Straßendorf, dessen Ortseingangs- und Ortsausgangsschild am selben Pfahl hätte hängen können. Auf dem schmalen Bürgersteig unter den niedrigen Traufen ließ sich keine Menschenseele blicken. Die Fenster waren verhangen, viele Rollläden heruntergelassen. Hinter einer Gaststätte mit vernagelter Eingangstür folgte die nächste Allee, auf der nichts fuhr, nicht mal ein Lkw. Das steile Sonnenlicht brach sich zwischen Ästen in dem Staub, der von den Äckern herüberwehte wie feiner Nebel.
»Kennt deine Generation eigentlich noch Bonnie Tyler?«, kam Kathi auf das Radio zurück.
»Meine Generation vielleicht nicht, aber ich.« Selmas Mutter hörte die alten Sachen manchmal beim Kochen und hatte diese Vorliebe offensichtlich mit KK gemeinsam. In der Ablage unter dem Autoradio stapelten sich einige Best-of-CDs.
»Sie war mein großes Vorbild. Ich wollte immer singen wie sie.«
Selma verkniff sich die Frage, ob Bonnie Tyler noch lebte.
»Nein, wirklich. Ich hätte nie so viel geraucht und längst aufgehört, wenn ich nicht insgeheim noch hoffen würde, irgendwann einmal so eine Stimme zu kriegen wie sie. Aber Rauchen allein genügt leider nicht. Man müsste auch ein bisschen musikalisch sein.« Kathi schob ein schüchternes Lachen hinterher, das wie zum Beweis in einen rasselnden Raucherhusten überging.
»Wenn du gerne Bonnie Tyler hören möchtest, kein Problem.«
»Das Problem ist: Wenn ich Bonnie Tyler höre, muss ich mitsingen und deine Mutter, wenn sie neben mir sitzt, auch …«
Schwer zu sagen, ob das eine Aufforderung sein sollte. Doch bevor Selma sich herausreden konnte, klingelte erneut das Handy, und KK friemelte sich den Stöpsel zurück ins Ohr. Wieder ging es um Milliliter und Grammzahlen. Bonnie Tyler sang nicht.
Möglichst unauffällig drehte sich Selma zur Rückbank und versuchte, an die Krankenakte heranzukommen. Falls ihr Großvater nur noch wenige Tage zu leben hatte, war es ihr gutes Recht, die Zahl zu kennen. Doch sie reichte mit den Fingerspitzen nur bis zur äußersten Ecke des Arztkoffers, ließ den Arm wieder sinken und blickte auf die Straße vor sich. Im Grunde wusste sie, dass Richard nicht mehr auf der Welt sein würde, wenn sie diesen Weg wieder zurückfuhr. Damit wusste sie genug.
Kathi redete indessen weiter über Fentanyl in verschiedenen Verabreichungsformen und Dosierungen. Vermutlich war ihr Koffer voll von dem Zeug und ein Teil davon für Richard. Insofern ging es bei der Frist weniger um die Anzahl der Tage bis zu seinem Tod. Die Rechnung, die Selma aufmachte, war eine andere: Wie viele von den Stunden, die ihrem Großvater blieben, würden wirklich ihm gehören, nicht dem Schmerz und seiner Betäubung?
RICHARD
… wurde wieder von diesem Geräusch wach, das irgendwo aus dem Haus kam, aus der Küche wahrscheinlich, ein Küchengeräusch wie Topfauskratzen, ein Löffel, der umrührt oder Rührei schlägt, oder kein Löffel, sondern ein Schneebesen, Handmixer oder Mörser. Jedes Mal, wenn er das Geräusch erfasst zu haben glaubte, verschob sich sein Rhythmus, veränderte und verformte es sich, wurde zu einer klappernden Lüftung, dem Flappen einer Gardine, dem Kühlschrank, der klirrte, und dann zum Boiler, mit dem etwas nicht stimmte. Er musste unbedingt den Boiler abstellen, nahm er sich vor, bis das Geräusch wieder seine Gestalt wechselte und weiterwanderte. Aber es war in der Küche, wenigstens das wusste er. In der Küche oder in seinem Kopf.
Richard schlug die Augen auf. Licht fiel ins Fenster, zu grell und zu steil für einen Sonnenaufgang. Es war Mittag. Er hatte Mittagsschlaf gemacht und war aus der Zeit gefallen in tagferne Zonen, traumwärts. Jetzt hielt er die Augen offen. Er wollte dem Sog nicht nachgeben und zurücktauchen, sondern sich festklammern an irgendetwas. Da hörte er es ganz deutlich. Das Geräusch ging aus der Tür. Er hatte die Hintertür zum Garten nicht richtig zugemacht, er kannte das Quietschen der Scharniere, ihre ewige Klage und das Schaben, Holz auf Stein, wenn das schief hängende Türblatt über die Fliesen schleifte und sich an immer derselben Stelle verkeilte, er hörte das alles. Dann war das Geräusch weg. Die Stille schwappte wieder über ihm zusammen. Es dauerte einen Moment, dann umgab sie ihn ganz.
Er sah nach der Uhr auf dem Fensterbrett, konnte aber vor Helligkeit nichts erkennen, nur die Umrisse des alten Reiseweckers, der nie mitgereist war, sondern schon so lange hier stand, dass sein Ticken ein Teil der Stille geworden war. Richard hörte ihn kaum noch. Sein Amtsvorgänger hatte ihn seinerzeit zurückgelassen, bei seiner Flucht in den Westen, obwohl der Wecker damals sicher neu gewesen war, vielleicht sogar das Allerneueste. Stattdessen hatte er das Kreuz mitgenommen, das schon über dem Fußende des Bettes gehangen haben musste, als sein Vorvorgänger noch in dieser schmalen Kammer schlief. Gleich bei seinem Einzug ins Pfarrhaus war Richard die Leerstelle aufgefallen, auf die man vom Kopfkissen aus starrte, auf die er vorm Einschlafen und beim Aufwachen starren sollte, all die Jahre bis jetzt. Sie war das einzig Auffällige an den schmucklos kahlen Wänden, ein kalkweißes Nichts, umgrenzt von schmutzig grauen Staubrändern, die einen Rahmen bildeten um das verschwundene Kreuz.
Richard erinnerte sich, wie er anfangs noch nach einem Ersatz gesucht hatte im Schuppen des Pfarrhauses, auf dem Speicher und in der Sakristei. Doch kein Kreuz passte, und mit der Zeit gewöhnte er sich an sein Fehlen. Es wurde für ihn ein stärkeres Zeichen, als es jedes andere Kreuz hätte sein können hier in der Diaspora, wo das Land selbst eine Leerstelle war.
Sein Vorgänger hatte die Lücke, die er hinterließ, vermutlich kaum bemerkt. Doch Richard war es gelungen, sie jedes Frühjahr beim Großreinemachen vor Staubwedeln und Wischlappen zu bewahren. Der Kontrast war vermutlich nicht mehr so gestochen scharf wie am ersten Tag, sondern mit ihm ergraut. Doch dieses Kreuz ohne Kreuz hatte Jahrzehnte überstanden und würde womöglich noch einmal so lange halten. Das Einzige, was Richard Sorgen machte, war der Gedanke, dass er es nicht würde mitnehmen können, wenn er ging.
Aufstehen!, befahl er sich kurz und knapp, obwohl es schon lange keine einzelne Bewegung mehr war, sondern eine komplizierte Abfolge von Anstrengungen und Etappenzielen. Langsam kam er, sich aufstützend, mit dem Oberkörper hoch, dann drehte er die Hüften, setzte die Füße auf und ruckelte sich in den Stand. Zwei Schritte waren es bis zur Schwelle der Schlafkammer, dem kleinsten Zimmer des Hauses, in das er sich mehr und mehr zurückgezogen hatte, weil es wie eine Mönchszelle war und nichts Überflüssiges enthielt. Es passte zu seiner Welt, die immer kleiner wurde. Sogar das Pfarrhaus wurde ihm zu groß. Richard durchquerte Wohnzimmer und Flur, ohne innezuhalten. Gehen ging gut, wenn er einmal in Gang war. An der Tür zur Küche überlegte er kurz, ob er den Kopf hineinstecken und nachsehen sollte. Doch er folgte der Spur des Geräuschs weiter durch die Hintertür nach draußen in den unverwüstlichen Frühling. Hinter dem Pfarrhaus und seitlich ein Stück weit den Kirchhügel hinauf wuchs ausufernd wild und zum Ärger der Nachbarn sein Garten ohne Gärtner. Die Männer vom Grünflächenamt, die neulich oder vielleicht schon vor Jahren zum Mähen und Beschneiden gekommen waren, hatte er mit den Worten vertrieben: »Hier gärtnert Gott.« Er glaubte das selbst nicht, aber es hatte seine Wirkung nicht verfehlt.
Das Geräusch war nirgends. Auch der Garten wiegte sich in Stille.
Am Staketenzaun zur Straße blieb Richard stehen und verschnaufte einen Moment, die Fäuste um die verwitterten Zaunspitzen geballt, deren flechtenartiger Bewuchs in seinen Handflächen krümelte. Aus Gewohnheit ließ er den Blick ein Stück hügelan schweifen, seinen alten Dienstweg zur Kirche hinauf. Ihn wunderte, dass schon wieder Sonntag zu sein schien, einst der wichtigste Tag der Woche, dessen Ruhe etwas Bedrückendes hatte, seit er nicht mehr predigte. Einen Nachfolger für ihn gab es nicht. Das Häuflein der Gläubigen, das sich früher auf den Bänken vor der Kanzel zusammengefunden hatte, wurde nach seinem letzten Gottesdienst an die nächstgrößere Gemeinde verwiesen und die Kirche stillgelegt, abgesehen von kurzen Gastpredigten an Weihnachten, Ostern und Pfingsten, die wie Wahlkampfauftritte wirkten und größtenteils aus heruntergebeteten Phrasen bestanden. Seither fühlte sich jeder Sonntag wie eine Niederlage an. Vier Häuser weiter bellte Schultemichels Rauhaardackel. Ein Fahrrad zuckelte klappernd übers Kopfsteinpflaster und fuhr in die Bodenlosigkeit der Stille davon. Richard grüßte auf Verdacht, sah aber nicht hin. Er stellte fest, dass er noch seinen Schlafanzug anhatte.
Erst auf dem Rückweg zu seinem Platz auf der Steinterrasse seitlich der Hintertür entdeckte er das Opfer. Mit offenen Augen, glanzlos und erloschen, lag die Maus auf der Steinplatte, die ihm als Tisch diente, wie auf einem Altar – eine hiesige Brandmaus mit braunem Fell und einem zierlichen schwarzen Streifen auf dem Rücken. Äußerlich schien sie erstaunlich unversehrt; das Fell war nicht zerzaust. Einen Kampf hatte es anscheinend nicht gegeben. Anstatt mit ihrer Beute zu spielen, musste die Katze – es konnte nur eine Katze gewesen sein – gezielt zugebissen haben.
Richard beugte sich über den kleinen Kadaver. Der Nacken war hinter den Öhrchen unnatürlich geknickt; der Kopf mit der spitzen Schnauze und den flimmernden Schnurrhaaren neigte sich in einem unguten Winkel. Aus einem fleischigen Riss im Fell sickerte Blut, das frisch aussah, sehr rot, sehr flüssig. Lange konnte das Tier noch nicht tot sein. Wenn er sich richtig erinnerte, war die kniehohe Steinplatte vor seinem Gang zum Gartenzaun leer gewesen. Normalerweise vergewisserte er sich, dass von seinem zweiten Frühstück nichts stehen geblieben war; eine tote Maus hätte er bemerkt. Doch gerade bei Dingen, die er immer tat, war es hinterher schwer zu beurteilen, ob er sie wirklich getan hatte. Richard setzte sich, kniff die Augen zusammen und faltete die Hände. Die Art, wie die Maus dalag, so ruhig und friedlich, erinnerte an eine Aufbahrung.
»Amen«, sagte er leise und lehnte sich mit dem Hinterkopf gegen die Steinmauer. Die alten Findlinge waren vollgesogen mit Sonne und strahlten eine Wärme ab wie sonst nur im Sommer. In dieser windgeschützten Ecke der Steinterrasse genoss es Richard, selbst Stein zu werden und seine Knochen durchglühen zu lassen wie etwas Fossiles, das noch einmal Leben in sich spürt. Zwischen den Augenlidern blinzelte er in die Weite, den Schwung des Kirchhügels hinauf und wieder hinab, die eng stehenden Erlen am Seeufer entlang bis zu den breiten Ackerrücken der angrenzenden LPG-Ländereien. Über die geometrisch gezogenen Furchen zog der kolossale Schatten einer einzelnen Wolke, deren Ränder sich immer wieder verschoben, ineinanderquollen und zergingen. Einen Moment lang sah er dem Schatten beim Wandern zu, dann ließ er die verschränkten Hände auf die Oberschenkel fallen.
Es wurde Zeit, die Toten zu begraben.
Der Kater saß wie eine Statue auf der Schwelle der Hintertür und sah ihn aus grünen, schmal geschlitzten Augen an. Richard wusste sofort, dass es ein Kater war und keine Katze, obwohl das Tier auf den ersten Blick alles andere als kräftig wirkte. Sein schwarzes Fell war räudig und verklebt, mit kahlen Stellen an den Schenkeln. Doch seine ganze Haltung hatte etwas Herausforderndes, so als würde er darüber wachen, dass Richard ihn richtig verstand: Was da auf dem Stein lag, war keine Jagdtrophäe und auch kein Beutegeschenk, sondern eine Botschaft.
»Was soll das?«, murmelte Richard und wedelte mit der Hand, als könnte er ihn wie eine Fliege verscheuchen. »Hier ist kein Platz für dich. Na los, verzieh dich dahin, wo du hingehörst!«
Doch der Kater zeigte sich unbeeindruckt. Seine völlige Reglosigkeit ließ keinen Zweifel daran, dass er gekommen war, um zu bleiben. Er trug kein Halsband und auch keine Marke vor der weiß gelatzten Brust. Allerdings befand sich schräg über seiner Schnauze ein milchweißer Felltupfer wie ein Sahneklecks, anhand dessen man ihn unter Hunderten von Hofkatzen erkennen konnte. Sicher nannte ihn irgendwer »Flecki« oder »Schlecki« oder »Krümel«. In dieser Gegend war man bei Tiernamen nicht übertrieben erfinderisch.
Richard rückte ein kleines Stück näher, stützte die Ellbogen auf die Knie und beugte sich vor, um seinen Worten Nachdruck zu verleihen. »Du bist doch nicht einfach vom Himmel gefallen, hm? Irgendwo kommt jeder von uns her, und wenn du da nicht wieder auftauchst, wird sich jemand große Sorgen um dich machen«, hörte er sich weiterreden und ärgerte sich über sich selbst, weil er, anstatt Befehle zu geben, um Verständnis bat. Auch deshalb wollte er keine Haustiere und hatte nie welche gehabt, sehr zum Leidwesen seines Sohnes und seiner Enkelkinder, die früher ständig mit entlaufenen oder zu verschenkenden Kleintieren angekommen waren. Er hatte sie jedes Mal wieder weggeschickt mit der Begründung, dass es ihm im Gegensatz zu seinen katholischen Kollegen zwar erlaubt sei, eine Familie zu haben; dafür lebe er im Haustier-Zölibat.
»Es geht einfach nicht«, beteuerte er, als würden die Kinder noch einmal vor ihm stehen und betteln. Selbst wenn es sich um einen Streuner handeln sollte, ohne Zuhause, ohne Namen, selbst in diesem sehr unwahrscheinlichen Fall war die Schlussfolgerung, zu der er kam, dasselbe Kopfschütteln wie eh und je.
Richard musste an den Tierarzt denken, der sich immer wieder über die Bauern beklagte, die zu geizig waren, ihre Katzen sterilisieren zu lassen, und stattdessen die »Asphaltkastration« bevorzugten. Was das bedeutete, hatte Richard zur Genüge erlebt, als er kurz nach der Wende hierhergezogen war. Die real existierenden Katzen der DDR waren an Trabis und Wartburgs gewöhnt und wurden von der schnellen Ausbreitung PS-starker Gebrauchtwagen aus dem Westen überrascht. Ihre Kadaver säumten damals die Landstraßen der Uckermark wie Maulwurfshügel. Er merkte, dass er noch immer den Kopf schüttelte, und ließ es sein.
Demonstrativ ignorierte er die Totenwache vor seiner Tür und hielt nach der Wolke Ausschau, die schon über das Dorf hinweggezogen sein musste. Der Acker lag im weißen Licht, der Himmel war blau und leer. Er würde noch ein Weilchen hier sitzen, beschloss Richard, als Fossil zwischen Steinen und sich aufheizen, bevor er wieder ins Haus ging – über die Schwelle, die dann hoffentlich unbewacht sein würde.
Als er die Augen wieder aufmachte, schwirrten Fliegen in immer engeren Kreisen über dem kleinen Mäusekadaver, ließen sich nah an der Wunde nieder oder landeten direkt auf dem offenen Fleisch, verjagten und jagten einander um die blicklosen Augen, deren glasiges Schwarz sich allmählich milchig färbte. Das Blut auf dem Stein, das eben noch rot geleuchtet hatte, war schon geronnen.
»Hau jetzt endlich ab!«, sagte Richard, ohne den Kater eines Blickes zu würdigen. Die Sterbekatze kam ihm wieder in den Sinn. Seit Jahren hatte er nicht mehr an sie gedacht, doch die Erinnerung und das damit verbundene Gefühl waren so deutlich, als hätte er von ihr geträumt. Begegnet war er diesem Tier im Seehausener Pflege- und Seniorenheim, wo er eine Zeit lang seelsorgerisch viel zu tun gehabt hatte. Damals wurde er nicht nur ungewöhnlich oft dorthin gerufen, um Sterbenden in ihrer letzten Stunde beizustehen, sondern auch – im Hinblick auf den Todeszeitpunkt – selten zu früh oder zu spät. Als er die Heimleiterin auf ihre »hellseherischen Fähigkeiten« ansprach, erfuhr er von der Katze. Eine verstorbene Heimbewohnerin hatte sie ihrer Station hinterlassen, und bald stellte sich heraus, dass sie eine Art sechsten Sinn für den Tod besaß. Wann immer jemand im Begriff war zu gehen, setzte sich die Katze auf die Schwelle seines Zimmers oder wanderte vor der Tür auf und ab. Die Pflegerinnen und Pfleger, denen das aufgefallen war, machten zunächst einen großen Bogen um sie. Die schwarze Katze galt als Unglücksbringer und Todesbotin. Irgendwer nannte sie scherzhaft »das Omen«, ein Spitzname, der sich herumsprach. Doch mit der Zeit stellte man sich darauf ein wie auf die Wettervorhersage. Wenn das Omen wieder umging oder Platz nahm, griff man kurzerhand zum Telefon und informierte die Angehörigen, den Arzt und den Pfarrer.
In der Hosentasche seines Pyjamas fand Richard ein knittriges Taschentuch, deckte die Maus damit zu und wartete einen Moment, bis sich die Fliegen verzogen hatten. Dann wickelte er den kleinen Körper ein und steckte die Enden sorgfältig fest. Das Ganze war sehr leicht, so als wäre der Tod ein Gewichtsverlust. Auf dem Stein blieb ein rostbrauner Fleck von der Größe eines Buchenblatts.
Es roch nach Heu mitten im Frühling, als er das Päckchen durch den Pfarrgarten trug und sich nach einem geeigneten Platz für ein Grab umsah. Trotz der steil stehenden Sonne spürte er eine altbekannte Kühle in den Knochen, wie immer vor einer Beerdigung. Durch das hohe Gras war der Boden etwas weniger trocken, aber genauso verhärtet wie überall. Richard entschied sich für die äußerste Ecke hinter der Tischtennisplatte, die bedeckt war mit Laub von mehr als einem Herbst. Dabei hatte er mal das ganze Dorf herausgefordert, als es Beschwerden gab, weil im Pfarrgarten Tischtennis gespielt und laut geflucht wurde. Am Ende fluchten die Dorfbewohner, er besiegte sie alle ohne Satzverlust. Mit Gottes Hilfe.
Das Netz, ein paar Bälle und die Tischtennisschläger lagen noch in der muffigen Kiste für das Zubehör. Er nahm wie aus Gewohnheit seine alte Kelle, suchte sich am Fuß der Schlehdornhecke eine sandige Stelle und grub abwechselnd mit dem Griff, der Schlagfläche und den Händen. Das Loch, in das er das Bündel legte, war tief und breit genug für seine Faust. Als er es wieder zuschüttete und die staubige Erde ringsum zusammenkratzte, kam kein Grabhügel zustande, es blieb eine Kuhle. Richard betete kein zweites Mal. Als er sich erhob, war der Kater verschwunden.
Aus irgendeinem Grund war er darüber eher enttäuscht als erleichtert.
Trotzig fegte er mit dem Schläger das Laub von der Tischtennisplatte, klappte eine Tischhälfte hoch und spielte Pingpong gegen sich selbst. Der Belag hatte unter der Feuchtigkeit gelitten, war stellenweise aufgequollen und übersät von Blasen, die den Rückgaben mitunter einen überraschenden Schnitt verliehen. Zwar stand er ziemlich hüftsteif an der Platte und sein Stellungsspiel hatte den Namen Beinarbeit nicht verdient, doch nach ein paar Ballwechseln kam eine Gewandtheit in sein Handgelenk zurück, an die sich sein Körper schneller und besser erinnerte als er selbst. Schade, dachte er, dass ihm der Kater jetzt nicht zusah.
Das Omen war ihm nach dem Gespräch mit der Heimleiterin nur ein einziges Mal über den Weg gelaufen. Er hatte die halbe Nacht einer fast hundertjährigen Dame die Hand gehalten und verließ gerade das Zimmer, als er das Tier den Flur hinabschleichen sah. Anscheinend hatten sie beide auf den Moment gewartet, in dem die altersschwache Sterbende endlich losließ. Nach allem, was er im Voraus gehört hatte, war er einigermaßen verblüfft, dass es sich um eine ganz normale schwarze Katze handelte, die eher müde als dämonisch wirkte und zurück ins Schwesternzimmer tappte, wo ihr Platz war, seit sie mehr oder weniger zum Personal gehörte. Während sie schwerfällig eine Pfote vor die andere setzte, schlackerte ihr tief hängendes, ausgefranstes Bauchfell. Zwei Tage später war sie tot, wie ihm der Tierarzt berichtete, der von den Pflegerinnen geholt worden war, weil die Sterbekatze nicht mehr in ihr Körbchen wollte, sondern nur noch davorsaß. Es war der letzte Tod, den sie hatte kommen sehen. Medizinisch konnte man nichts mehr für sie tun. Gesäuge und Gebärmutter waren total verkrebst. Der Tierarzt, der ebenfalls von ihrer prophetischen Gabe gehört hatte, schwankte zwischen zwei Theorien: Entweder hatte die Katze ihr besonderes Gespür für den Tod dem Krebs zu verdanken, der sie für die Leiden anderer empfänglich machte, oder sie verdankte ihrer Empfänglichkeit für die Leiden anderer den Krebs. Er neigte zu letzterer Ansicht.
Es dauerte einen Moment, bis Richard registrierte, dass das Telefon im Haus klingelte.
Er schmetterte eine missglückte Rückhand neben die Platte und fluchte, weil er dabei zum Haus hinübergesehen hatte und den Ball nicht wiederfand. Das Telefonklingeln setzte kurz aus und begann von Neuem. Am anderen Ende vermutete er Maria, die keine Ruhe geben würde, bis er sich meldete. Insofern ging er besser gleich an den Apparat, damit sie nicht die Nachbarn alarmierte oder womöglich selbst ins Auto stieg, um nach dem Rechten zu sehen. Eine Ärztin zur Schwiegertochter zu haben, war ohne Zweifel ein Segen, sonst hätte er wahrscheinlich mit dem Tierarzt vorliebnehmen müssen. Doch in Momenten wie diesem haderte er mit jeder Unterbrechung seiner Einsamkeit. Er war am liebsten mit dem Schmerz allein.
Als er das Haus betrat, verstummte das Klingeln ein zweites Mal und fing nicht wieder an. Richard bemerkte erst jetzt, dass er den Schläger noch in der Hand hielt, wie um jemanden damit abzuwehren oder niederzuschlagen. Eine Tischtenniskelle war keine ernst zu nehmende Waffe, doch er hatte die Faust fest um den Griff geballt und schob die Küchentür jetzt einen Spalt auf. Sie quietschte, er lauschte, schaute hinein. Nichts. Kein Kratzen, kein Scharren, keine Bewegung. Es war so still, dass Richard sein Herz schlagen hören konnte. Aber das Geräusch war trotzdem wieder da.
JAKOB
… verspürte schon beim ersten Klingel-Jingle das Bedürfnis, sich eine Unterhose anzuziehen, zögerte aber mit Blick auf seine Kunstprofessorin, der es sicher nicht recht war, wenn er plötzlich vom Sockel stieg. Als Modell hatte er gewisse Pflichten und eine künstlerische Mitverantwortung. Insofern schickte er eine Geste der Entschuldigung voraus, die allerdings ins Leere ging. Frau Professor Strauss-Kutschera verschwand gerade bis zur Spitze ihres verwegen hochgesteckten schwarzen Haars hinter der Leinwand wie für ein äußerst anspruchsvolles Detail. Also merkte sich Jakob die Position und huschte durch das weitläufige Atelier zu seinem Rucksack, um sein Handy hervorzukramen. Zum ersten Mal in dieser Sitzung fühlte er sich nackt – nackt und schuldig, weil er es nicht stumm geschaltet hatte, und noch schuldiger, weil er ranging. Aber es war seine Mutter, die anrief und nicht aufhören würde anzurufen. Sie hinterließ keine Nachrichten oder schrieb SMS, sondern bestand darauf, »seine Stimme zu hören«, was vor allem hieß, dass er ihre Stimme zu hören bekam.
»Ja«, sagte er, »hallo.«
Er wollte das Gespräch möglichst kurz halten, als Zeichen seines guten Willens oder schlechten Gewissens. Vor allem aber sollten weder seine Professorin noch seine Mutter mitbekommen, dass sie im Moment zwei Seiten desselben Dilemmas waren.
»Gerade ist ungünstig«, merkte er an.
Einhändig fischte er seine Boxershorts aus dem Klamottenhaufen. Dann streckte er seinen rechten Fuß in die Luft und versuchte hüpfend, ihn mit dem Gummizug einzufangen wie mit einem Lasso. Das schlug fehl.
»Ich bin noch in der Uni …« Beim nächsten Versuch verhedderte sich das Gummi zwischen seinen Zehen und brachte ihn aus dem Gleichgewicht. »Bist du noch in der Charité?«
Damit hatte er hoffentlich nicht zu viel verraten. Wie fast alles an Professor Strauss-Kutschera war ihm ein Rätsel, was diese wunderbar reife Frau von ihm wusste und wie viel sie von ihm wissen wollte. Dass seine Mutter Ärztin war, Anästhesistin, hatte er ihr nicht verschwiegen, zumal es in seinen Studienunterlagen stand. Aber hatte er die Charité erwähnt? Und waren die Gerüchte über seine Trennung von Ilvy aus der Bildhauerei auch Strauss-Kutschera zu Ohren gekommen? Gerüchte, die leider größtenteils stimmten und darauf hinausliefen, dass er wieder bei seiner Mutter einzog.
Das melancholisch-verlebte oder verlebt-melancholische Gesicht der Kutschera, das die Antwort auf all seine Fragen enthielt, tat ihm nicht den Gefallen, hinter der Staffelei wieder aufzutauchen – oder es tat ihm den Gefallen, untergetaucht zu bleiben. Jakob konzentrierte sich auf seine Boxershorts und die üblichen Telefonfloskeln, um nicht zu verraten, mit wem er sprach. Er wollte in den Augen seiner – dieser! – Professorin auf keinen Fall der junge Mann sein, der nackt oder halb nackt mit seiner Mutter telefonierte.
Irgendwie wurde er das Gefühl nicht los, dass dieses Detail in dem Bild, das er abgab, über seine Zukunft entschied.
Natürlich war er aus Sicht von Strauss-Kutschera zunächst nur ein Student unter vielen. Doch als Spezialistin für Akt- und Porträtmalerei zeigte sie für gewisse Aspekte seines Lebens ein besonderes Interesse. Es fing an mit seinem Vornamen und der Art, wie sie ihn aussprach, neckisch und zugleich gelangweilt, mit einer Portion Wiener Schmäh, hinter dessen Vokaldehnungen sich eine mehr oder weniger heimliche Botschaft verbarg. Statt »Jakob« sagte sie zu ihm: »Jaaa, kooom.« Wer das nicht heraushörte, konnte sich in den Vorlesungen und Seminaren davon überzeugen, wie ihr Blick ihn jedes Mal suchte und fand, wobei sie meist seine rechte Gesichtshälfte fixierte, besonders den Leberfleck an seiner Schläfe, der ziemlich präzise die Form von Südamerika im Miniaturmaßstab hatte. Diese kleine Pigmentstörung schien Prof.Strauss-Kutschera künstlerisch oder kartografisch sehr zu beschäftigen. Ja, manchmal, wenn sie ihren fragenden Blick durch die Reihen des Hörsaals schweifen ließ, sah es so aus, als suchte sie unter den Anwesenden nicht ihn, sondern vor allem den Fleck. Hinzu kam das Wechselspiel des Meldens und Drannehmens, das Gewähren und Entziehen von Aufmerksamkeit nicht nur in den Seminaren, sondern vor allem in dem heiklen Moment der Auswahl, wer beim Aktzeichnen Modell stehen würde, wofür er immer den Finger hob und immer genommen wurde. Im Unterschied zu den anderen Modellen, die kamen und gingen, war er der Klassiker unter den Freiwilligen und besaß mittlerweile Musen-Status, weshalb er – wie heute – oft über das offizielle Sitzungsende hinaus für sie posieren durfte. Und das war noch das geringste Privileg. Von Mal zu Mal ging es weiter zwischen seiner Professorin und ihm, mit halb versteckten, halb öffentlichen Gunstbezeugungen. Die Frage war nur, wie weit es gehen würde.
Wie weit würde sie gehen?
In seinen Träumen nannte er sie Milena. Der Name an sich war Musik.
Was die Musik störte, war seine Mutter und der Gedanke, dass Milena – über deren genaues Alter sich die Uni, ihre Galeristen und das Internet ausschwiegen – vermutlich alt genug war, um seine Mutter zu sein, ein Gedanke, der ihm ins Herz stach. Sicher gab es zwischen ihr und ihm einen beträchtlichen Unterschied an Lebenserfahrung, Macht, Geld und Ansehen. Doch dieses Mehr an Welt und Wichtigkeit, das sie ihm voraushatte, war kein Hindernis, sondern Teil des Faszinosums dieser Frau und verschmolz mit ihren übrigen Reizen. Im Gegensatz zu Ilvy, der Bildhauerin, die studentische Hilfskraft war, konnte Milena Strauss-Kutschera alles sein: Lehrerin und Geliebte, Bezwingerin und Trophäe, Himmel und Hölle. In ihrer Reife erschien sie ihm universal und für jede erdenkliche Rolle in jedem erdenklichen Traum wie geschaffen – mit Ausnahme der Mutterrolle, weshalb er sich größte Mühe gab, in ihrer Gegenwart jede Anspielung oder Bezugnahme auf Alter, Familie und Fortpflanzung zu unterlassen. Für Nackttelefonate mit seiner leibhaftigen Mutter galt das besonders.
Seine Boxershorts fielen ihm nun schon zum dritten Mal vor die Füße, wobei die Hosenbeine jetzt zwei knöchelhohe Krater bildeten, in die er einsteigen konnte. Mit einem Schulterblick zur Staffelei, hinter der Milenas schwarze Haarspitzen weiter wippten, kehrte er ihr seine Rückseite zu, ohne sich deshalb weniger nackt und schutzlos zu fühlen, vor allem als er sich bückte. Schnell drehte er seinen Hintern und sich ins Profil, ging in die Hocke und zog die Unterhose dann mit einer Hand hoch, weil er aus anatomisch rätselhaften Gründen nicht imstande war, sein Handy zwischen Ohr und Achsel einzuklemmen.
Vielleicht sollte er Milena einfach gestehen, dass er sie liebte. Bei der Gelegenheit konnte er gleich hinzufügen, dass er ihretwegen mit Ilvy Schluss gemacht hatte – beziehungsweise Ilvy mit ihm.
Seine Mutter senkte die Stimme. Wahrscheinlich hatte sie gemerkt, dass er nur mit halbem Ohr zuhörte, und wollte ihn dazu bringen, besser aufzupassen, indem sie leiser sprach. Doch sie war wirklich schwer zu verstehen, was nicht an ihm lag, sondern an dem Gesang, der immer lauter wurde. Jakob brauchte einen Moment, bis er merkte, dass die Stimme nicht aus dem Telefon kam, sondern von irgendwo hinter der Leinwand.
Es war Milena. Sie sang.
Jakob ließ den Hörer ein Stück sinken. Er hatte Prof.Strauss-Kutschera beim Aktmalen vor sich hin murmeln und manchmal auch summen hören, aber singen noch nie. Es war kein Lied, das er kannte, nicht einmal eine Melodie, es waren einfach nur Laute, Töne, ihre Stimme, frei schwebend und losgelöst … Wie bezaubert stand er da, eine Hand am Bund seiner Boxershorts, lauschte verzückt und fasste es nicht. Sang sie für ihn oder nur so vor sich hin? War es ein Zeichen ihrer Vertrautheit und Nähe, oder hatte sie schlicht vergessen, dass es ihn gab?
Er hätte jetzt gern ihr Gesicht gesehen.
»Tut mir leid«, flüsterte er, den Hörer dicht vor Mund und Nase, »es geht gerade wirklich nicht.« Wie zum Beweis schnaubte er seiner Mutter aus kurzer Distanz telefonisch ins Ohr und versuchte, mit seinen Atemgeräuschen den Gesang im Hintergrund zu übertönen. Milenas Stimme durfte den Raum nicht verlassen, jedenfalls nicht in Richtung seiner Mutter, weil sie nackt war im musikalischen Sinn.
Milena sang nackt über dem Bild seines Körpers.
Er hätte alles dafür gegeben, jetzt ihr Gesicht sehen zu können.
»Ich muss Schluss machen«, sagte er laut und deutlich in der Hoffnung, Milena hinter der Leinwand hervorzulocken. Doch sie kam nicht zum Vorschein, auch nicht, als er tief Luft holte, um hinzuzufügen, er würde später noch mal anrufen, damit es nicht so herzlos klang. Dummerweise hatte seine Mutter gerade genau dasselbe gesagt und aufgelegt. Jakob kam sich vor wie ein Idiot.
Wenn er darüber nachdachte, gab es unterm Strich schlechte Nachrichten. Mit seinem Großvater ging es zu Ende, das war nicht überraschend. Von Richards Krebserkrankung hatte er gewusst, aber erfolgreich verdrängt, dass sie zum Tod führen würde. Neu war, dass seine Mutter nicht wie geplant zu ihm aufs Land fahren konnte, weil das gesamte Ärzteteam, in dem sie arbeitete, nach zwei positiven Tests in Quarantäne musste. Das machte nicht nur ihr einen Strich durch die Rechnung, sondern auch ihm. Er hatte sich nach der Trennung von Ilvy damit getröstet, dass seine Mutter, wenn er wieder zu ihr zog, kaum zu Hause sein würde. Unter den strengen Quarantäneregeln für das Klinikpersonal lief es jetzt auf das genaue Gegenteil hinaus. Und sollte sie tatsächlich keinen Kontakt haben dürfen, zu niemandem, wurde es noch komplizierter …
Jakob hatte ein Problem, und die einzige Person, die er um Rat fragen konnte, hatte das Gespräch soeben beendet.
Professor Strauss-Kutschera schien ihn schon eine Weile anzusehen. Ihr Blick ruhte auf ihm. Ihr Gesicht, das sich hinter der Leinwand hervorgeschoben hatte wie ein zweites Bild, wirkte fremd und unverwandt. Es waren dieselben Züge, die er immer wieder zu zeichnen versucht hatte, ohne sie je zu treffen: die hängenden Lider mit ihrer nächtlichen Schwere und etwas blasierten Müdigkeit; die Spur von Herablassung um die Mundwinkel, die er nicht länger persönlich nahm, sondern als ihr wienerisches Erbe begriff und somit als Haltung zur Welt; der sinnliche Fleischbogen unter dem Kinn und die leicht beleidigte Fülle ihrer Wangen, die viel wussten von Lust und Langeweile, Schwelgen und Erschlaffung, Hingabe und Überdruss. All das hatte er so oft mit dem Gedächtnis fotografiert, so oft erinnert und geträumt, herbeigesehnt und wiedergesehen, doch noch nie so still. Nie so als Stillleben.
Sie hatte aufgehört zu singen, als wäre sie es nicht gewesen. Ihr Gesicht besaß die Gabe der Auslöschung. Es konnte jedes Lächeln, jedes bisschen Wärme oder Sympathie von einem Moment auf den anderen verschwinden lassen wie eine optische Täuschung. So auch jetzt. Die Entfernung zwischen ihr und ihm war größer als der Raum.
»Entschuldigung. Ich wollte nur …« Verlegen fuchtelte er mit seinem Handy herum, ohne zu wissen, wohin damit. Von den Wänden und Glasflächen des Ateliers hallte seine Stimme wider, eine halbe Oktave zu hoch und irgendwie kläglich. Er machte gerade keinen vorteilhaften Eindruck, das war ihm bewusst.
Was würde eine Muse an seiner Stelle tun?
»Ich wollte fragen, ob es fertig ist.« Eine Muse hätte das nie gefragt. »Sofern ein Bild überhaupt fertig sein kann, im Sinne von ›abgeschlossen‹ oder ›vollendet‹. Im Grunde ist ja alles in der Kunst unfertig, irgendwie …«
Die Professorin legte den Pinsel weg, machte aber keine Miene, seinen Gedanken weiterzudenken oder zu beenden. Ihre Teilnahmslosigkeit war total. Jakob schlug die Augen nieder. Die Sonne fiel in steilen Bahnen durch die Oberlichter und zeichnete die Rahmenkonstruktion als Schattengitter auf das Parkett. Er versuchte, nicht auf die Linien zu treten, während er zu seinem Rucksack ging.
»Ich muss los. Der Anruf – entschuldigen Sie die Störung – war ein Notruf von meiner Schlafgelegenheit.« Seine Mutter verschwieg er, ohne sich etwas davon zu versprechen. »Quarantäne, häusliche Isolation. Keiner darf raus aus der Wohnung, keiner rein, zu unser aller Sicherheit. Die Frage ist nur, wo bleibe ich?« Er wartete ihre Antwort nicht ab, sondern zog schnell seine Jeans hoch und drehte sich dabei einmal mehr ins Profil. Auch mit Hose wollte er ihr nicht seine Rückansicht bieten.
»Willst du es sehen?«
Vor Überraschung vergaß er fast den Reißverschluss, als er sich umwandte.
»Ich dachte, du magst vielleicht einen Blick darauf werfen. Schließlich ist es auch dein Bild.«
»Ja, aber …«
»Jaaa-kooom«, sagte sie. Sein Name und die Einladung waren eins.
Jakob übertrat sämtliche Schattenlinien auf dem Weg zur Staffelei, damit sie es sich nicht noch anders überlegte. Die Gefahr bestand. Als Künstlerin hatte Strauss-Kutschera den Ruf, ausgesprochen skrupulös zu sein in der Frage, was sie von sich zeigte und was nicht. Manchmal fielen sogar schon gehängte Bilder kurz vor Ausstellungsbeginn ihrer Selbstzensur zum Opfer. Bei der »documenta« hatte sie vor Jahren den von ihr gestalteten Raum mit einem Extraschloss gesichert und den Schlüssel zur Eröffnung weggeworfen, nicht mal das Reinigungspersonal erhielt Zutritt. An der Uni war es im Prinzip nicht anders. Studierende, die ihr beim Malen über die Schulter gucken wollten, flogen aus dem Atelier. Die Leinwand in der Schaffensphase war tabu, und jeder voreilige Blick glich einem Säureanschlag auf das noch ungeschützte Bild.
Es zeigte ein fotorealistisches Porträt seines Penis in Öl.
Einen Augenblick verharrte Jakob in einer Mischung aus Ratlosigkeit und Entsetzen. Strauss-Kutschera hatte sein Geschlechtsteil gut getroffen. Wobei er natürlich nur die Draufsicht kannte, eine Art Vogelperspektive. Die Künstlerin hingegen hatte die volle Frontalansicht auf Augenhöhe gewählt. Was er auf diese Weise über sich beziehungsweise seinen Körper lernte, war gleichermaßen bedrohlich und schmeichelhaft. Dank der teils dramatischen Hell-Dunkel-Kontraste und modellierenden Abschattungen wirkte das Genitalgemälde in seiner Tiefenschärfe verblüffend plastisch und dreidimensional.
Dieser Hyperrealismus der Hautkappen, -lappen und Rillenwulste im Maßstab eins zu eins wurde konterkariert durch eine künstliche Farbgebung mit poppigen Verfremdungseffekten. Sie erinnerte boshaft an Lebensmittelfotografie und den Antinaturalismus der Fleischwarendarstellung in den kolorierten Reklamebeilagen der Kettendiscounter. Das Aderwerk des Penisschafts umfasste ein Spektrum vom saftigen Blutrot der Arterien bis hin zu knolligen, knotigen Schwellungen in Venenblau, Violett und Dunkellila. Die ölig glänzenden Hautpartien vom Skrotum aufwärts changierten zwischen hühnerhautartiger Blässe und einem warmen Leberbraun, das sich zur Spitze hin in ein surreal flaumiges Rosa verjüngte. Darunter lugte, zart knospend, seine Eichel hervor, fleischfarben und gleichzeitig puderig wie ein mit Zucker bestäubtes Erdbeerbonbon.
»Ist das Pink?«, erkundigte sich Jakob vorsichtig mit Blick auf den quietschig kitschigen Farbakzent am Eichelschlitz.
»Es ist noch nicht fertig«, sagte Strauss-Kutschera knapp und schwieg sofort wieder, die Lippen zusammengekniffen, die Kiefer mahlend, in harten Verhandlungen mit sich selbst. Sie war ihr eigenes Kunsttribunal, ihr schlimmster Kritiker, das schärfste Auge von allen. Neben ihr fühlte sich Jakob als Betrachter zwar geduldet, aber unmaßgeblich.
»Hat was unglaublich Haptisches«, lobte er mit der gebotenen Zurückhaltung, »das Bild, meine ich, ein sehr beeindruckendes Maß an Gegenständlichkeit, jetzt schon, in diesem Stadium des Entstehungsprozesses …« Das war ein ehrliches Kompliment, auch wenn es ihn hauptsächlich drängte zu reden, weil er die Telefonstimme seiner Mutter noch im Ohr hatte. »Aber vielleicht geht es auch gar nicht ums Körperliche – ich meine immer noch das Bild –, sondern nur um die Farbe als direkte Antwort auf Jeff«, überlegte er laut, da sie nichts dazu sagte, »also Jeff Koons …«
Jetzt schwiegen sie beide.
Die Peinlichkeit stieg weiter an und stabilisierte sich dann auf hohem Niveau.
Bei näherer Betrachtung – Jakob beugte sich ein Stück vor und studierte den Hintergrund, um irgendetwas zu tun – erschloss sich ihm das diffus schwarze Schamhaar-Gewimmel. Er hatte es zuerst als Kulisse abgetan, als Rahmenkontrast für den grell hervorspringenden Penisprospekt. Doch dieser scheinbar hingehuschte Schattenschurz stand seinem Genital an Detailversessenheit und Ausarbeitungswut in nichts nach. Eine buschige Wildnis erhob sich aus der Tiefe, schraubte sich in irren Spiralwindungen aus dem Dickicht empor wie ein Wald oder Dschungel, der in seinem Gestrüpp zu ersticken drohte, nach Luft rang oder nach Licht, um sich dann wieder zu legen, glatthaarig wie ein gelecktes Katzenfell bis auf einzelne kritzelige Ausreißer gegen den Strich.
Es war kein Hintergrund, sondern eine eigene Welt mit ihren eigenen Gestalten und Gewalten, das wurde ihm klar, eine Gegenwelt. Es war Südamerika.
Seltsamerweise erkannte er die Form als Letztes. Dabei waren es genau die Umrisse des Kontinents, den er auf der Stirn trug. Die Faszination von Strauss-Kutschera für den Leberfleck an seiner Schläfe bekam auf einmal einen Sinn. Ihr Gemälde setzte den Fleck mit dem Land seiner Scham gleich oder seine Stirn mit seiner Eichel.
»Woran denkst du?«, fragte sie. Ihre Stimme klang ganz sanft.
Jakob wusste nicht, was er sagen sollte. Sollte er etwas sagen?
Er sah sie an, sie sah ihn an. Ihre Lippen bewegten sich ein weiteres Mal, ganz unglaubliche Lippen, nicht blühend, nicht welk, sondern beides.
»Naaa, kooom, Jaaa-kooob«, sagte sie so melodiös, als würde sie zum Trost für ihn singen, »was ist das Erste, das dir durch den Kopf geht?«
»Regenwald.« Er räusperte sich und wiederholte dann mit noch immer belegter Stimme: »Der tropische Regenwald, das Amazonasbecken. Ich weiß nur nicht, ob es das Erste ist.«
»Und was ist wirklich das Erste?« Ihr Blick ruhte auf ihm mit einem Gewicht, das durch keinen Lidschlag aufgehoben wurde.
»Ich dachte, offen gestanden, ich könnte vielleicht bei Ihnen übernachten, meine Schlafgelegenheit ist ja im Moment Sperrbezirk …« Er klang fast heiser, aber sich noch mal zu räuspern, kam nicht infrage. »Ich meine natürlich nicht bei Ihnen zu Hause, sondern hier im Atelier auf der Couch.«
Ihr Blick veränderte sich, rückte aber nicht von ihm ab.
»Hast du es mal untersuchen lassen?«, fragte sie, statt zu antworten.
Verwirrt sah er zwischen ihr und dem Bild hin und her. Hatte er etwas übersehen, etwas Medizinisches, eine Geschlechtskrankheit? War das der Grund für die Farbwahl?
»Nicht das – das!« Wieder fixierte sie den Fleck auf seiner Stirn, aus nächster Nähe diesmal. Dabei streifte ihr Kinn mit dem Fleischbogen leicht seine Schulter. Es war ihre erste Berührung.
»Sie meinen, ob ich deswegen mal beim Arzt war …?« Er fasste sich an die Schläfe und rieb dann seine Fingerspitzen, so als würde der Leberfleck abfärben. »Das liegt in der Familie, keine Sorge.«
»Für ein Muttermal ist es ziemlich groß.« Sie lächelte gedankenverloren, ihr Kinn lächelte mit.
»Es ist kein Muttermal«, erwiderte er, »nur eine Pigmentstörung.«
MARIA
… machte die Tür hinter sich zu, nahm den Mundschutz ab und war allein. Endlich, dachte sie, doch es fühlte sich eher endgültig an. Dass es sich dabei um zwei verschiedene Dinge handelte, war ihr klar. Maria steckte das Telefon weg, wich ihrem Garderobenspiegel aus und verstaute den leeren Einkaufsbeutel in einer Schublade. Nach Maßgabe des Infektionsschutzes war sie als Klinikmitarbeiterin dazu verpflichtet, sich im Quarantänefall unverzüglich und unter Vermeidung weiterer Kontakte nach Hause zu begeben. Daran hatte sie sich gehalten. Sie war nicht mal für einen spontanen Hamsterkauf in den Späti an der Ecke eingebogen, obwohl Kaffee ganz oben auf ihrer Einkaufsliste stand, das einzige Lebensmittel, auf das sie nicht verzichten konnte, weder morgens noch mittags noch abends. Doch wer auch immer stattdessen für sie einkaufen gehen würde, eins stand fest: Jakob war es nicht.
Bei dem Gedanken an das Telefonat mit ihm überkam sie eine Welle von Wut und schlechtem Gewissen. Es war das letzte in einer Reihe unerfreulicher Telefonate gewesen, die alle um ein und dieselbe Frage gekreist waren: »Wie soll das gehen?« Die Quarantäne machte Maria Striche durch so viele Rechnungen, dass sie kaum gewusst hatte, wen sie zuerst anrufen sollte. Nur dass Jakob der Letzte sein würde, wusste sie sofort. Sie musste sich warmgeredet haben, um ihrem Sohn zu erklären, dass er nicht wie versprochen wieder bei ihr einziehen konnte – eine Verabredung, der sie von vornherein mit gemischten Gefühlen entgegengesehen hatte, obwohl oder gerade weil sie seine Mutter war.
»Und weil oder obwohl er mich immer wieder dazu macht!«, murmelte sie vor sich hin, als sie die Vorratsschränke aufriss, um sich zu vergewissern, dass sie genügend Reis, Nudeln und Mehl im Haus hatte.
Die Antwort auf die Wie-soll-das-gehen-Frage nach Jakobs Einquartierung unter Quarantänebedingungen war schlicht: »Es geht nicht.« Vierzehn Tage zu zweit auf sechzig Quadratmetern – die Vorstellung war für sie genauso albtraumhaft wie für ihn. Es erschien ihr wie die brennglasartige Vergrößerung ihrer schlimmsten Befürchtungen im Hinblick auf das Zusammenleben mit ihrem Sohn: die eingespielten Rollen, die alten Muster und Abhängigkeiten. Alles deutete darauf hin, dass er nicht gelernt hatte, alleine zu leben, während ihr nach seinem und Selmas Auszug nichts leichter gefallen war als das – eine Leichtigkeit, die bedroht schien. Immer mehr bestätigte sich ihre Ur-Sorge, dass Jakob nie, niemals erwachsen werden und für immer ihr Sohn bleiben würde und sie, im Umkehrschluss, für immer seine Mutter.
Und dann hatte er nicht einmal fünf Minuten Zeit für ein vernünftiges Telefonat! Im Nachhinein ärgerte sie sich, dass sie nicht sofort aufgelegt hatte. Als wäre es ihr Problem. Als hätte sie ihn nicht nur bei sich wohnen lassen, um zu verhindern, dass er unter Brücken schlief. Als würde sie zu den Müttern gehören, die es kaum erwarten konnten, ihre Söhne nach dem erstbesten Beziehungsfiasko wieder unter ihre Fittiche zu nehmen.
»Obwohl oder weil er mich immer wieder dazu macht«, wiederholte sie und warf die Schranktüren zu. Am meisten ärgerte es sie, dass sie sich so ärgerte, während Jakob vermutlich mit seinen Gedanken längst woanders war. So wie sie ihn kannte, nahm er seinen Rausschmiss genauso hin wie dieses missratene Telefonat. Sollte sie ihn jemals darauf ansprechen, würde er sie nur mit großen Augen angucken und fragen: »Was hast du denn?« Immer ließ er es so aussehen, als sei sie diejenige, die etwas von ihm wollte. Und darin trafen sich ihre Wut und ihr schlechtes Gewissen: in dem Verdacht, dass es auf irgendeiner der vielen Ebenen ihrer verkorksten Beziehung womöglich stimmte und ihre Abhängigkeit die größere war. Jakob nahm sich von ihr, was er brauchte, nahm es hin wie alles andere, sie aber wollte etwas von ihm, das nur er ihr geben konnte und das sie im Leben vielleicht nie bekommen würde. Eine Art Freispruch.
Maria öffnete die Wohnzimmerfenster und Flügeltüren und trat hinaus auf den kleinen Balkon, der vollgestellt war mit Blumentöpfen, verkümmertem Staudengemüse und welken Sträußen in Vasen. Sie hatte die kleine Freiluftfläche nie für sich genutzt, weil man dort saß wie auf dem Präsentierteller. Jetzt wurde ihr klar, dass diese anderthalb Quartmeter das einzige Stück Außenwelt waren, zu dem sie noch Zugang hatte.
Endgültig, dachte sie, nicht endlich.
Sie räumte die Töpfe und Vasen beiseite und trat ans Geländer. Unter dem abblätternden Anstrich kam eine Farbe zum Vorschein, die sie nicht kannte, irgendein rostiges Rotorange. Die Farbsplitter rieselten in die Tiefe und verschwanden aus ihrem Blickfeld, bevor sie auf dem Pflaster landeten. Die Straße war eine andere Welt, die wenigen Passanten eine andere Spezies, die Sonne schien wie immer. Maria überlegte, ob sie einen Regenschirm an dem Gestänge festklemmen sollte, um im Schatten sitzen zu können. Es war vielleicht der beste Platz für einen letzten Kaffee zur Feier dieser über sie verhängten Einsamkeit.
Leider hatte sie den letzten Kaffee schon getrunken. Die Reste, die sie noch zusammenkratzen konnte, reichten nicht einmal für eine halbe Tasse, und das Vorratsglas mit dem Löslichen, das sie in der zweiten Regalreihe fand, stammte noch aus Zeiten des Mauerfalls. Die Kaffeekrümel von einst waren zu einer festen schwarzen Masse verklebt, die nach Chemie und Lakritze roch. Maria schraubte den Deckel wieder zu.
Aber sie ließ den Kopf nicht hängen, sondern schrieb weiter an ihrer Einkaufsliste und ging die angestaubten Konservenbüchsen mit Linsen-, Bohnen-, Erbsensuppe durch. Die auf den Etiketten abgebildeten Speckwürfel und Würstchen hatten sich über die Jahre in einer Weise verfärbt, die nichts Gutes verhieß, auch wenn die Haltbarkeitsdaten teilweise in eine Zukunft reichten, von der niemand wusste, ob es sie gab. Maria stufte die Konserven als eiserne Ration ein und notierte vor allem frisches Gemüse und Obst. Erst bei der Frage, wer die ganzen Besorgungen für sie erledigen sollte, kam sie aus dem Konzept. Selma und Kathi waren auf dem Weg zu Richard. Ihre Arbeitskolleginnen durften so wie sie nicht aus dem Haus. Und in ihrem sonstigen Bekanntenkreis kam eigentlich nur eine Person in Betracht: Ilvy, ausgerechnet.
Maria seufzte.
Das Verhältnis zwischen ihr und ihrer Beinahe-Schwiegertochter war unkompliziert, geradezu solidarisch, schließlich hatten sie beide, jede auf ihre Weise, dasselbe Problem – Jakob – und einen sehr ähnlichen Sinn für Humor. Es verging kaum eine Woche, in der sie nicht zusammen Kaffee tranken. Ilvy gehörte zur Familie, und die Familie, einschließlich Selma, stand auf ihrer Seite. Dass sie Jakob vor die Tür setzte, war eine viel diskutierte Option. Doch niemand hätte gedacht, dass sie es je tun würde. Der Schock darüber blieb nicht auf Jakob begrenzt. Ohne die näheren Umstände zu kennen, hoffte Maria, es würde ein heilsamer Schock sein: keine unwiderrufliche Trennung, sondern eine erzieherische Maßnahme, um Jakob zu mehr Selbstständigkeit zu animieren – wogegen allerdings sprach, dass er sich prompt bei seiner Mutter einquartierte. Dass daraus jetzt nichts wurde, war vielleicht sogar eine glückliche Fügung, gab ihr aber noch lange nicht das Recht, zum Telefon zu greifen und Ilvy zu bitten, für sie einkaufen zu gehen, fand Maria.
Mit einem Seufzer erinnerte sie sich an den Ausspruch von Schwester Ivana, als die ganze Abteilung in häusliche Isolation geschickt wurde: »Wenn ich könnte, würde ich mich jetzt ins künstliche Koma versetzen und erst in vierzehn Tagen wieder wecken lassen.« Ivana hatte drei Kinder im Grund- und Vorschulalter, insofern war das eine verständliche Reaktion auf ihr ganz persönliches Wie-soll-das-gehen-Problem. Doch das Bedürfnis, die Zeit bis zum Ende des Ausnahmezustands in Vollnarkose zu verbringen, verspürte Maria nicht minder.
Sie hatte das Plätschern schon von Weitem gehört, aber erst als sie auf die Badezimmertür zuging, um ihre Klopapier-Bestände zu inspizieren, kam ihr der Gedanke, es könnte sich um ein Geräusch aus ihrer Wohnung handeln, eine defekte Toilettenspülung oder ein undichter Wasserhahn. Dass das Wasser die Wände herunterlief und sich über die Fliesen ergoss, hätte sie sich nicht träumen lassen. Aber so war es. Einen Moment stand sie da und starrte auf die Rinnsale an der Kachelwand und die sich ausbreitenden Wasserlachen am Boden. Ihr erster Gedanke war, ob es gegen die Quarantänevorschriften verstieß, wenn sie jetzt einen Handwerker rief. Doch wie sich zeigte, war dieser immer größer werdende Wasserschaden kein Fall für den Klempner, das verrieten die schaumumkränzten, leicht erzitternden Pfützen sowie die leisen Rüttelgeräusche von oben. Über ihr in der Penthouse-Wohnung, die angeblich einem Schweden gehörte und von häufig wechselnden Gästen frequentiert wurde, lief die Waschmaschine.