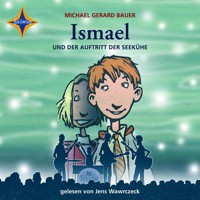Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Michael Gerard Bauer, Autor der „Nennt mich nicht Ismael“-Trilogie, erzählt die ebenso ungewöhnliche wie zarte Liebesgeschichte zwischen Ms. Wrong Girl und Mr. Right Guy Wer sind wir? Und wie wollen wir von anderen wahrgenommen werden? Mit seinem besten Freund Tolly besucht Sebastian den Tag der offenen Tür an der Uni. Dort begegnet er Frida. Frida ist schräg, frech und äußerst schlagfertig. Scheinbar mühelos schwindelt sie die abenteuerlichsten Geschichten zusammen. Doch so unterhaltsam das auch zunächst ist, wenn es um ihre Person geht, verstrickt sich Frida immer wieder in Ungereimtheiten. Sebastian fällt es zunehmend schwer, Wahres von Erfundenem zu unterscheiden. Trotzdem ist er beeindruckt von Frida, vielleicht sogar mehr als das. Wer ist sie wirklich? Und wie nah kann er ihr an einem einzigen Tag kommen? Aber vor allem: Was ist er bereit, dafür von sich preiszugeben?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 268
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über das Buch
Wer sind wir? Und wie wollen wir von anderen wahrgenommen werden? Mit seinem besten Freund Tolly besucht Sebastian den Tag der offenen Tür an der Uni. Dort begegnet er Frida. Frida ist schräg, frech und äußerst schlagfertig. Scheinbar mühelos schwindelt sie die abenteuerlichsten Geschichten zusammen. Doch so unterhaltsam das auch zunächst ist, wenn es um ihre Person geht, verstrickt sich Frida immer wieder in Ungereimtheiten. Sebastian fällt es zunehmend schwer, Wahres von Erfundenem zu unterscheiden. Trotzdem ist er beeindruckt von Frida, vielleicht sogar mehr als das. Wer ist sie wirklich? Und wie nah kann er ihr an einem einzigen Tag kommen? Aber vor allem: Was ist er bereit, dafür von sich preiszugeben?
Michael Gerard Bauer
Dinge, die so nicht bleiben können
Aus dem Englischen von Ute Mihr
Carl Hanser Verlag
Für die Dudeisten und Träumer
1.
Sesam öffnet sich nicht
Ich fixiere die gläserne Automatiktür und zwinge sie, sich zu öffnen.
Aber sie öffnet sich nicht.
Enttäuschend, aber nicht überraschend.
Ich werfe einen Blick auf die Uhr an der Wand zu meiner Rechten. Wie schon so oft. Die rot leuchtenden Zahlen verkünden 10:40 Uhr.
Noch fünf Minuten. Noch fünf Minuten, und dann war’s das. Irgendwo muss man die Grenze ziehen, und ich ziehe sie in fünf Minuten. Das habe ich mir natürlich auch schon um 10:30 Uhr gesagt und um 10:35 Uhr. Aber diesmal meine ich es ernst. Echt jetzt. Entweder kommt sie um 10:45 Uhr durch diese Tür, oder ich bin weg. Du kannst mich beim Wort nehmen. Um 10:45 Uhr ist Schluss, ich weg.
Noch einmal lasse ich den Blick durch das leere Kinofoyer mit seinem blau-gold gesprenkelten Teppich schweifen, als ein inzwischen vertrautes Mantra in meinem Kopf wieder lauter wird.
Komm durch diese Tür. Los. Komm durch diese Tür. Wir haben noch Zeit. Der Film hat noch nicht begonnen. Bestimmt kommt jede Menge Werbung. Das ist immer so. Außerdem noch die ganzen Trailer. Und stand in dem Prospekt nicht, dass zuerst ein Kurzfilm in Schwarz-Weiß gezeigt wird? Also los. Es ist noch nicht zu spät. Komm durch diese Tür. Mach schon. Lass dieses eine Mal ein Wunder für mich geschehen. Du hast es in der Hand. Das weißt du. Du musst nur durch diese Tür kommen.
Niemand kommt durch die Tür.
Frustrierend, aber nicht überraschend.
Also gut, wenn das hier so läuft, dann habe ich keine Wahl: Ich muss die unfassbaren Kräfte meines positiven Denkens aktivieren. Ich bin verzweifelt. Alles ist einen Versuch wert.
In den nächsten zwanzig Sekunden wird sie durch diese Tür kommen. Sie wird kommen. Sie wird in den nächsten zwanzig Sekunden durch diese blöde Tür kommen.
Ich hefte meinen Blick auf die geschlossene Tür und beginne stumm, von zwanzig herunterzuzählen. Je niedriger die Zahl, desto langsamer zähle ich. Als ich bei drei bin, wäre jeder Gletscher schneller als ich. Von drei schleppe ich mich ganz langsam in Richtung eins. Dann quetsche ich noch einige wenige wertvolle Tropfen Zeit aus, bevor ich den letzten, niederschmetternden Schritt zur Null vollende. Natürlich buchstabiere ich die Zahl.
N ………………….. U …………………………………………………… LL.
Niemand kommt durch die Tür.
Ultrakacke, aber nicht überraschend.
Nach außen hin reagiere ich nicht. Aber innerlich falle ich auf die Knie und stoße einen markerschütternden Schrei gen Himmel aus, während ich von oben gefilmt werde.
Einen Countdown runterzählen? Willst du mich verarschen? Das ist aus mir geworden? Wie alt bin ich? Sechzehn oder sechs? Wem mache ich hier überhaupt was vor? Ich meine, wann ist mir zuletzt so etwas Unglaubliches, wie ich es mir jetzt hier erhoffe, tatsächlich passiert?
MÖÖÖÖP! Könnte es sein, dass die Antwort lautet … noch nie?
Genau!
Warum stehe ich also immer noch wie ein Vollidiot mit der Kinokarte in der Hand hier herum, starre auf die Scheißtür, die sich nicht öffnet, auch wenn die Zukunft der Welt davon abhinge, und erwarte, dass sich mein beschissenes Leben entwickelt wie eine kitschig romantische »Stinknormaler Typ bändelt mit supersüßem Mädel an«-Liebeskomödie mit Wohlfühlfaktor.
Warum? Also, ich persönlich gebe meiner Mutter die Schuld. Sie hat, als ich klein war, dauernd romantische Kitschfilme geguckt. Heute natürlich nicht mehr. Vermutlich glaubt sie inzwischen einfach nicht mehr an Happy Ends. Aber mein Punkt ist, dass ich mit ihr zusammen viele solcher Filme gesehen habe. Und das sorgte dafür, dass ich, na ja, ein gutes Gefühl hatte. Sogar Tatsächlich … Liebe gefiel mir. Nein, wenn ich darüber nachdenke, gefiel er mir sogar sehr. Da hast du’s, ich gebe es zu. Ich bin ein Vollidiot und ein Verräter meiner durchdrehenden Hormone.
Aber auch wenn ich ein Vollidiot bin, könnte mein echtes Leben nicht trotzdem ablaufen wie diese Schmonzetten? Natürlich nicht immer, aber wenigstens manchmal. Jetzt zum Beispiel. Könnte ich den romantischen Kitsch-Augenblick meines echten Lebens nicht genau hier und jetzt haben? Schau dich um. Die Voraussetzungen sind optimal. Geradezu perfekt.
Der hoffnungslos verliebte, stinknormale Typ (ich) steht allein in einem menschenleeren Kinofoyer, den Blick auf eine automatische Tür geheftet, und hofft und betet dafür, dass sie sich öffnet. Unterdessen verrinnt die Zeit, die Spannung steigt, und es sieht so aus, als würde unser stinknormaler Typ gleich aufgeben. Damit es zum Kitsch-Overload kommt, muss nur das supersüße Mädchen seiner Träume ihren großen Auftritt haben.
Also dann. Legen wir los!
Licht. Kamera. Ruhe am Set.
Und ACTION!
Aber … nichts passiert. Peinliche Stille.
Ich schaue wieder auf die Uhr. 10:43 Uhr. Großartig. Noch zwei Minuten bis zu meiner letzten, meiner allerletzten Grenze. Mein supersüßes Traummädchen hat nur noch hundertzwanzig Sekunden Zeit, hier aufzutauchen, damit meine persönliche romantische Liebeskomödienfantasie atemberaubende Wirklichkeit wird.
Aber könnte das passieren? Könnte das wirklich passieren?
Na ja, ich denke schon. Weißt du, was mich ein kleines bisschen optimistischer machen würde? Na, eigentlich sind es zwei Dinge.
Wenn ich herausgefunden hätte, wie das supersüße Mädchen heißt,
und
wenn ich es tatsächlich geschafft hätte, sie zu fragen, ob sie mit mir ins Kino geht.
2.
Das perfekte weibliche Wesen
Ja, offensichtlich mache ich mir etwas vor. Das ist die einzige plausible Erklärung.
Aber (und das ist die entscheidende Frage): Handelt es sich wirklich um eine totale, komplette und absolute Selbsttäuschung? Oder gibt es einen schmalen Silberstreifen Hoffnung am Horizont, dass das Szenario »Stinknormaler Typ schleppt supersüßes Mädchen ab« Wirklichkeit werden könnte?
Hier hilft nur eines: Alles, was an diesem Vormittag passiert ist, noch einmal genau durchgehen und nach Anzeichen für den trügerischen Silberstreifen abchecken. Dann schauen wir mal. Zuletzt bei Aus dem Leben eines stinknormalen Typen …:
Es ist Tag der offenen Tür an der Landesuniversität, und wie unzählige andere Elft- und Zwölftklässler sind auch unser stinknormaler Typ (ja, da bin ich wieder) und sein bester Freund Tolly in den Frühlingsferien hierhergekommen, um herauszufinden, wie ihre zukünftigen Kurse und Karrieren aussehen könnten.
Schon bald nach ihrer Ankunft trennten sich der stinknormale Typ und sein Freund. Während sich sein bestens vorbereiteter und informierter Kollege zu drei verschiedenen Vorträgen aufmacht, die bei den Naturwissenschaftlern und Medizinern angeboten werden, streift unser stinknormaler Typ durch die herumschlendernden Gruppen von Schülern, Eltern und freiwilligen Helfern im Hauptgebäude und macht sich dann mit der halbherzigen Absicht, betriebs- und wirtschaftswissenschaftliche Präsentationen anzuschauen und eine Vorlesung über Stadtplanung zu hören, auf den Weg zum Gebäude der Wirtschaftswissenschaftler.
Frag ihn bloß nicht, warum er das tut. Er hatte eigentlich nie den brennenden Ehrgeiz, eine Stadt zu planen. Tatsächlich ist es eine Weile her, seit er überhaupt einen brennenden Ehrgeiz verspürte, irgendetwas zu tun. Aber seine Eltern freuen sich über seinen Plan, und er schätzt, dass es immer Städte geben wird. Das ist doch immerhin was, oder?
Nachdem sich unser stinknormaler Typ ungefähr eine Stunde lang eine nicht besonders anregende Präsentation angeschaut hat, betritt er den Hörsaal, wo die Vorlesung über Stadtplanung stattfinden soll. Er sucht sich einen Platz und vertreibt sich die Zeit damit, die vielen Dutzend Broschüren zu lesen, die ihm begeisterte Helfer auf dem Weg in die Hand gedrückt haben. Der Hörsaal ist ziemlich voll, aber zu seiner Rechten ist immer noch ein Platz frei beziehungsweise war frei, bis sich jemand an einer Reihe von vorstehenden Knien vorbeigedrückt hat und fragt: »Sitzt hier jemand?«
Der stinknormale Typ schaut auf. Und sieht ein Mädchen. Sie hat hellbraune, mittellange Haare, die ihr direkt oberhalb ihrer blauen, mandelförmigen Augen als Pony in die Stirn fallen. Sie trägt weiße Shorts und einen blauen Pullover mit den Worten NEW YORK auf der Vorderseite. Um Zeit zu sparen, lasst uns einfach sagen, dass sie perfekt ist. Denn das ist sie. Sie ist ein PWW. Ein perfektes weibliches Wesen.
Der stinknormale Typ lässt sie wissen, dass der Platz frei ist. Er bemüht sich an dieser Stelle, richtige Wörter hervorzubringen, schafft es aber nicht, mit seinem Mund mehr als ein paar grunzende, murmelnde Geräusche zu fabrizieren und seinen Kopf auf und ab zu bewegen wie ein geistesgestörter Wackeldackel. Er erwartet natürlich nicht, noch mehr mit seiner Banknachbarin zu kommunizieren, denn sie ist, wie ich bereits ausgeführt habe, ein perfektes weibliches Wesen, und zwischen perfekten weiblichen Wesen und stinknormalen Typen findet keine ausgedehnte Kommunikation statt. Das gehört zu den großen universellen Wahrheiten. Ein bisschen wie die Schwerkraft und das Gesetz von der Erhaltung der Energie.
Sie setzt sich. Der stinknormale Typ stellt sicher, dass er das PWW neben sich nicht anstarrt, aber er spürt natürlich das Prickeln ihrer elektrisierenden Gegenwart. Aus dem Augenwinkel sieht er, wie sie einen Notizblock und einen Kuli herauszieht und etwas oben auf die Seite schreibt. Eine Sekunde später hört er sie seufzen, und dann sagt sie etwas zu ihm. Zu ihm! Zu einem stinknormalen Typen!
»’tschuldigung, aber du kannst mir nicht zufällig einen Kuli leihen? Meiner hat gerade den Geist aufgegeben.«
Er kann sein Glück nicht fassen. Danke, Herr der Kulis, sagt er zu sich selbst.
Laut sagt er: »Klar. Kein Problem.« Er greift in seinen Rucksack und zieht ein prall gefülltes Mäppchen heraus. Nachdem er den Reißverschluss geöffnet hat, hält er es ihr hin wie die Opfergabe für eine Göttin. Ziemlich genau das ist es schließlich auch.
»Such dir einen aus.«
Sie kichert in sich hinein. Perfekt.
»Wow. Bist du sicher, dass du auch genügend mitgebracht hast?«
Der stinknormale Typ erkennt sofort, wie albern und idiotisch er ihr vorkommen muss. Wer besitzt im digitalen Zeitalter eine Sammlung von verschiedenen Stiften? Wer hat überhaupt noch ein Mäppchen? Und vor allem eines, das noch aus Grundschulzeiten stammt? Natürlich will er seine Verlegenheit durch einen Scherz oder eine witzige Bemerkung überspielen, aber das würde ja bedeuten, dass er sich einen Scherz oder eine witzige Bemerkung einfallen lassen müsste, was unter dem Druck, sich in nächster Nähe zu einem PWW zu befinden, völlig unmöglich ist.
Also kichert er stattdessen selbst. Idiotisch.
Sie sucht sich einen Kuli aus, und daraufhin entspinnt sich folgender tiefschürfender Dialog:
»Danke. Ich geb ihn dir gleich nach der Vorlesung zurück.«
»Schon okay, behalt ihn.«
»Nein, alles gut. Du bekommst ihn zurück.«
»Eigentlich brauche ich ihn nicht. Ich hab genügend.«
»Bist du sicher? Scheint ein guter Stift zu sein.«
»Nö. Ist einfach nur ein Kuli. Ich hab haufenweise andere. Und du brauchst ja auch noch für den Rest des Tages einen.«
»Ich kann mir bestimmt irgendwo einen kaufen.«
»Nicht nötig. Es ist okay. Kein Problem. Behalt ihn.«
»Na ja, wenn du sicher bist …«
»Bin ich. Echt.«
»Okay. Danke. Aber wenn du’s dir anders überlegst …«
»Tu ich nicht. Es ist okay. Er gehört dir.«
»Danke.«
Und das war’s.
Die Wahrheit ist: Der stinknormale Typ hätte ihr einen ganzen Schreibwarenladen angeboten, wenn er einen dabeigehabt hätte. Er schaut ihr zu, wie sie die Seite oben mit dem Datum versieht. Sie hat eine saubere, gleichmäßige, runde Schrift. Ein perfektes weibliches Wesen schreibt mit einem seiner Kulis. Was für ein Leben!
Der stinknormale Typ widmet sich wieder der Durchsicht seiner Broschüren. Sie machen Werbung für verschiedene universitäre Clubs und Organisationen, aber nur die Broschüre vom Uni-Kino, »The Hub«, erregt seine Aufmerksamkeit. Es laufen ein paar aktuelle Mainstream-Filme, aber am Tag der offenen Tür zeigt der Uni-Filmclub auch Klassiker und kurze Stummfilme. Unter den Klassikern sind Die Faust im Nacken mit Marlon Brando und Casablanca mit Humphrey Bogart und Ingrid Bergman.
Das springt dem stinknormalen Typ gleich ins Auge, denn der Vater seines Freundes Tolly ist ein großer Cineast, der schon mehrfach behauptet hatte, besser als Casablanca könne ein Film gar nicht sein. Und nicht nur das. Als der Vater seines Freundes herausfand, dass keiner von ihnen von Die Faust im Nacken auch nur gehört hatte, bekam er fast einen Herzinfarkt. »Was? Ihr kennt Die Faust im Nacken nicht? Na, dann habt ihr nicht gelebt, Jungs! Die Taxiszene? Steiger und Brando? Die beste Szene der ganzen Filmgeschichte. ›Du verstehst nicht! Ich hätte Klasse haben können! Ich hätte um den Titel kämpfen können!‹«
Der stinknormale Typ mag Tollys Vater wirklich sehr (einer der Gründe, warum er in diesem Schuljahr den Kurs »Film und Fernsehen« belegt hat), aber für seine geistige Zurechnungsfähigkeit kann er sich nicht wirklich verbürgen. Jedenfalls befindet er sich immer noch in seiner kleinen Welt und denkt über all das nach, als …
»Ohhhh, läuft das heute?«
Das PWW schaut herüber und zeigt auf die Casablanca-Anzeige. Ihr Finger berührt die Broschüre, die er in der Hand hält. Also berührt sie indirekt ihn. Und sie spricht mit ihm. Schon wieder. Ein PWW spricht mit einem stinknormalen Typ, obwohl sie eigentlich gar nicht unbedingt muss. Sie sucht keinen Platz. Sie braucht keinen Kuli. Sie redet einfach davon, dass sie einen Film sehen will. Sie redet mit ihm. Das gab es noch nie. Genau diese Szene würde sich der stinknormale Typ eigens auf den Leib schreiben, wenn er die Hauptrolle in seiner eigenen romantischen Wohlfühlkomödie spielen könnte!
»Casablanca? Ja, heute Vormittag. Ähhh … um halb elf«, sagt er zu ihr.
»Den wollte ich schon immer mal anschauen«, antwortet sie. »Ich habe Ausschnitte gesehen, aber nie den ganzen Film. Und nie auf einer großen Leinwand. Das wäre fantastisch.«
»Ja, soll gut sein. Kostet auch nur ’nen Fünfer. Lohnt sich, hinzugehen.«
»Hmmmm. Stimmt.«
Und hier endet das Gespräch, denn während unser stinknormaler Typ wertvolle Zeit mit dem verzweifelten Versuch verschwendet, ein paar halbwegs intelligente Wörter in einer gewissen logischen Reihenfolge aus seinem Mund zu befördern, tritt eine Dozentin für Stadtplanung an das Rednerpult. Und in der nächsten halben Stunde müssen alle, einschließlich des PWW, den Worten lauschen, die aus ihrem Mund kommen. Und als die Vorlesung zu Ende ist, wird das perfekte weibliche Wesen sofort von ein paar fast ebenso perfekten, lange nicht gesehenen, schwer vermissten Freundinnen entdeckt und belagert und in einer Blase aufgeregten Geplappers fortgeschleppt.
Ende der Rückblende.
Das war’s. Daran knüpfe ich meine Hoffnung. Nicht viel. Oder, um Tollys Vater zu zitieren: »ein Fliegenschiss von einem Nichts«. Was bin ich für ein Idiot? Warum habe ich nichts gesagt, als sie erwähnte, dass sie sich gerne Casablanca anschauen würde? Nur etwas Einfaches und Harmloses wie: »Also, ich geh wahrscheinlich rein, vielleicht sehen wir uns dann dort.« Das hätte schon gereicht. Mehr als gereicht. Das wäre supercool gewesen. Wer weiß, was sie entgegnet hätte? Und selbst wenn sie nichts gesagt hätte, wäre die Grundlage für einen Silberstreifen Hoffnung gelegt worden.
In der romantischen Vollversion meiner Fantasie ist die Unterhaltung etwa so abgelaufen: Kaum hatte das PWW erwähnt, dass sie gern Casablanca sehen würde, hätte ich sie charmant und selbstsicher angelächelt und gesagt: »Von allen Hörsälen in allen Universitäten dieser Welt bist du ausgerechnet in meinen gekommen.« Und das wäre es gewesen. Game over. Zwei Karten, bitte. Schau mir in die Augen, Kleines!
Aber leider klingt mein echtes Leben immer viel mehr nach einer sehr schlecht geschriebenen ersten Fassung als nach einer geschliffenen finalen Bearbeitung, und deshalb blieben die wenigen klassischen Casablanca-Zitate, die ich dank Tollys Vater im Kopf habe, auch sicher dort verwahrt.
Zeit für einen weiteren Uhren-Check.
10:46 Uhr.
Mist.
Was bist du nur für ein Vollidiot, erinnere ich mich im Stillen selbst, obwohl wenig Gefahr besteht, dass ich es jemals vergesse.
Ich betrachte die Karte in meiner Hand. Einlass für eine Person. Jap, das ist richtig. Einlass für einen Vollidioten zum Club der traurigen Vollidioten. Ich will die Karte gerade zerreißen und im Papierkorb neben mir entsorgen, als eine Bewegung und ein leises Geräusch mich davon abhalten.
Ich hebe den Kopf.
Auf der anderen Seite des Foyers öffnet sich das »Sesam öffnet sich nicht«.
Und ein Mädchen kommt herein.
3.
Die halbe Eiskönigin
Allerdings nicht das Mädchen.
Nicht das Mädchen, auf das ich gewartet habe. Auf das ich gehofft hatte.
Nicht das PWW.
Richtig gehört. Von allen Kinos in allen Universitäten dieser Welt kommt sie nicht in meines.
Viel Weiß. Das ist mein erster Eindruck von dem neuen Mädchen. Dem falschen Mädchen. Sie erinnert mich ein bisschen an die Hauptfigur in Die Eiskönigin, denn ihre Haare sind weißblond und fallen ihr in einem Fransenschnitt fast bis zu den Schultern. Außerdem trägt sie weiße, bis über die Knöchel geschnürte Sandalen und ein weißes Trägertop, das locker über einen langen, weißen Rock hängt. Aus meinem Blickwinkel von der Seite nehme ich nur ein blasses Profil und einen gleichermaßen blassen, dünnen Arm wahr.
Wie hieß sie noch mal, die Figur aus Die Eiskönigin? Irgendwas mit E, oder? Eva? Ellie? Evelyn? Irgend so was.
Egal.
Das Eiskönigin-Mädchen ist vor einer lebensgroßen schwarz-weißen Pappfigur von Humphrey Bogart stehen geblieben. Er trägt einen weißen Smoking und steht eine Zigarette rauchend neben einem Klavier. Das Eiskönigin-Mädchen passt sehr gut zu dem Farbschema. Ich beobachte, wie sie Bogie kurz mustert und dann eine Geldbörse aus ihrer Baumwolltasche zieht. Die Tasche ist mit fröhlich und traurig dreinschauenden Theatermasken bedruckt. Ich werfe einen letzten sinnlosen Blick auf die Uhr an der Wand und dann auf die Karte in meiner Hand, um mich ein weiteres Mal daran zu erinnern, was für ein Vollidiot ich bin. Als das Eiskönigin-Mädchen auf den Kartenschalter zugeht, setze ich mich in Bewegung, um sie abzufangen.
»Kaufst du eine Karte für Casablanca?«
Sie bleibt stehen und dreht sich zu mir. Sie ist einen halben Kopf kleiner als ich. Und wie ich jetzt sehe, ist sie nur eine halbe Eiskönigin. Wenigstens vom Hals an. Denn die Haare auf der rechten Seite ihres Kopfes sind dunkel und von der Schläfe an kurz geschoren. Das Ohr auf dieser Seite ist unter Unmengen metallener Piercings fast verborgen. Sie streicht sich die langen Haare hinter ihr anderes Ohr und hält sie dort fest. Graugrüne Augen schielen unter dichten dunklen Augenbrauen zu mir herauf.
»Sorry«, sagt sie und schüttelt den Kopf ein wenig. »Was?«
»Willst du dir Casablanca anschauen? Falls ja, kannst du nämlich meine Karte haben.«
Ich hebe die Karte hoch, und sie betrachtet sie eine Sekunde lang. Dann schaut sie mich an.
»Deine Karte? Warum nimmst du sie nicht?«
Weil ich ein Vollidiot bin, der einen Augenblick lang tatsächlich dachte, er könnte die Hauptrolle in einer herzerwärmenden Liebeskomödie spielen, aber dann rasch bemerkte, dass er leider doch in seinem normalen, schäbigen und überhaupt nicht romantischen Leben feststeckt.
Aber das sind vielleicht ein bisschen zu viele, persönliche Informationen, deshalb behalte ich sie für mich.
»Äh, ich habe gerade … beschlossen … also … dass ich was anderes mache.«
»Wirklich? Was?«
»Wie bitte?«
»Du hast gesagt, du hättest beschlossen, etwas anderes zu tun. Und was hast du beschlossen lieber zu tun, als Casablanca anzuschauen, obwohl du schon hierhergekommen bist und eine Karte gekauft hast?«
Ihre Stimme ist heiser und rau, als ob sie an den Rändern ausgefranst wäre. Der Klang stört mich nicht, aber ich hatte nicht erwartet, dass sie mich einem Kreuzverhör unterzieht. Ich biete ihr eine kostenlose Karte an. Ich will ihr keine Lebensversicherung verkaufen oder sie einer spirituellen Belehrung unterziehen. Warum werde ich dann so in die Mangel genommen?
»Ähm, keine Ahnung. Ich hab es mir einfach anders überlegt mit dem Kino. Mehr nicht.«
Ihre Augen verengen sich noch mehr.
»Hat dich jemand versetzt?«
»Was?«
Sie mustert mein Gesicht wie ein durchgeknallter Hellseher, der verräterische Beulen und geheimnisvolle Geburtsnarben sucht.
»Ja, weißt du, was ich denke?«, sagt sie endlich. »Ich denke, dass du mit jemandem zusammen gehen wolltest oder das vielleicht gehofft hast, aber dieser Jemand ist nicht aufgetaucht, und jetzt bist du angepisst und willst deine Karte loswerden, weil — welcher einsame Loser würde jemals auf die Idee kommen, sich einen Film ganz alleine anzuschauen, stimmt’s?«
Sie macht ein trauriges Gesicht und zeigt zugleich auf die Entsprechung auf ihrer Tasche. Mit einer Sache hat sie recht. Ich bin angepisst. Und sie macht es nicht besser.
»Ja, wie auch immer. Pass auf, willst du die Karte oder willst du sie nicht? Wenn du sie willst, dann gehört sie dir. Wenn du sie nicht willst, auch gut. Dann schmeiß ich sie einfach in den Papierkorb. Wie auch immer, mir ist das egal.«
Sie nickt langsam und zeigt mit einem Finger mit schwarz lackiertem Nagel auf mich.
»Du wurdest definitiv versetzt, stimmt’s?« Dann hält sie rasch eine Hand vor mein Gesicht, um die Worte zurückzuhalten, die aus meinem Mund springen wollen. »Aber, um deine Frage zu beantworten, ja, ich nehme deine Karte. Kann sie nicht verfallen lassen. Danke. Aber: Ich werde sie bezahlen.«
»Musst du nicht. Nimm sie einfach.«
»Ich bezahle sie.«
Sie sagt das, als wäre alles andere völlig inakzeptabel. Gut. Was geht es mich an? Ich gebe nach, reiche ihr die Karte und warte, dass sie das Geld rauskramt. Während sie damit beschäftigt ist, die Münzen aus ihrem Portemonnaie zu sammeln, schweift mein Blick ab. Und heftet sich auf die Szene, die sich hinter ihr abspielt.
»Oh, Scheiße«, entfährt es mir ein bisschen zu laut.
Auf der anderen Seite des Foyers öffnet sich die Tür wieder, und ein Mädchen taucht auf.
Diesmal das richtige.
4.
Der Katastrophenfilm
Die halbe Eiskönigin hört auf, in ihrem Portemonnaie zu kramen, und schaut in die Richtung, in die ich starre.
»Ist sie das?«, fragt sie. »Hast du auf sie gewartet? Auf Taylor Swift?«
Ich nicke, runzle dann aber die Stirn.
»Was? Sie sieht doch nicht aus wie Taylor Swift, oder?«
»Äh, doch, genau so.«
»Echt? Finde ich nicht.«
»Wow, wie lange leidest du schon an Gesichtsblindheit?«
Als ich nicht antworte, lässt sie die Münzen wieder in ihr Portemonnaie zurückfallen.
»Also, ich muss los, sonst verpasse ich den Anfang des Films. Hey, vielen Dank für die Casablanca-Karte. Übrigens hab ich es mir anders überlegt und nehme dein Angebot mit der Freikarte an. Echt großzügig von dir. Tschüss!«
Mein Gesichtsausdruck spiegelt offenbar die Gedankenexplosion in meinem Kopf wider.
»Nur Spaß«, sagt sie. »Glückwunsch. Dein Leben hat soeben eine glückliche Wendung genommen. Und jetzt, wo … Everything Has Changed … brauchst du die hier wohl.«
Aus irgendeinem Grund singt sie Teile des letzten Satzes.
»Hast du gecheckt, was ich gerade gemacht habe?«
Und bevor ich Nein sagen kann, weil ich es tatsächlich nicht geschnallt habe, hat sie mir die Karte wieder in die Hand gedrückt und ihren Weg zum Schalter fortgesetzt.
Ich drehe mich rasch zu dem anderen Mädchen um. Sie steht jetzt innerhalb der Automatiktür, zieht ihren NEW-YORK-Pullover aus und bindet sich ihn um die Taille. Er sieht aus, als wäre er dafür gemacht, dort zu sein. Nachdem sie ihre Haare und ihr Top zurechtgezupft hat, lässt sie den Blick rasch durch das Foyer schweifen. Als er auf mich fällt, hält sie inne.
Und schaut dann über mich hinweg.
Okay. Nicht ganz die Begrüßung, die ich mir erhofft hatte.
Ich warte auf den Schwenk zurück zu mir. Diesmal zwinge ich mich, die Hand zu heben und ihr mit wackelnden Fingern idiotisch zuzuwinken.
Sie sieht es. Zögert und lächelt verhalten. Mein Herz vollführt eine Art Sprung von einer Klippe und befindet sich im freien Fall. Eine Sekunde später erhellt ein richtiges Lächeln ihre perfekten Züge, sie nimmt ihre Tasche und kommt auf mich zu.
Oh — mein — Gott. Sie kommt auf mich zu. Es passiert. Es passiert tatsächlich. Mein Herz steigt aus dem freien Fall aus und schießt in die Stratosphäre hinauf. Meine Damen und Herren, wir sind jetzt offiziell im vollen Liebeskomödien-Flugmodus. Houston, wir haben keine Probleme!
»Vorlesung Stadtplanung, richtig?«
Ein PWW steht direkt vor mir und lächelt.
»Genau.«
Dann lächelt sie nicht mehr, und eine Hand fliegt zu ihrem Mund.
»Oh, und ich habe immer noch deinen Kuli, nicht wahr? Pass auf, hier ist er.«
Sie will die Reißverschlüsse verschiedener Fächer ihres Designer-Rucksacks öffnen, aber ich kann sie gerade noch davon abhalten.
»Nein, nein, es ist okay. Ist egal. Mach dir keine Gedanken. Bitte. Behalt ihn.«
Sie stellt den Rucksack auf den Boden.
»Bist du sicher? Ich weiß, dass er dadrin ist … irgendwo. Ich muss höchstens zehn, vielleicht auch fünfzehn Minuten hektisch suchen, dann habe ich ihn. Allerhöchstens zwanzig Minuten. Bist du sicher, dass du ihn nicht mehr brauchst?«
»Ganz sicher«, sage ich zu ihr. »Und wenn ich jemals einen Ersatz kaufen muss, schmeiße ich einfach die Schule und besorge mir einen Job oder raube eine Bank aus oder so.«
Wow. Leichter Anflug von Humor. Woher kam der? Gute Arbeit, Hirn und Mund!
Sie denkt über meine Worte nach.
»Na ja, solange es dir keine Umstände macht.«
Und wir kichern beide.
Habe ich sie als perfektes weibliches Wesen bezeichnet? Das wird ihr bei Weitem nicht gerecht. Sie ist außerdem intelligent und witzig. Und was noch erstaunlicher ist: Sie spricht mit mir — alias stinknormaler Typ — intelligent und witzig.
»Ich bin übrigens Helena.«
»Hi. Ich bin Sebastian.«
Nicht zu fassen. Dieser Dialog könnte direkt aus einem meiner Traum-Liebeskomödien-Drehbücher stammen!
Sie schaut hinüber zur Wanduhr. Ihr Profil sieht aus wie aus einem Hochglanzmagazin. Ich muss an mich halten, damit ich nicht mein Handy zücke und ein paar Fotos schieße.
»Hey, fängt Casablanca nicht um halb elf an?«
»Ja, aber keine Sorge, zuerst laufen immer Trailer und Werbung. Außerdem zeigen sie noch eine kurze Stummfilmkomödie, glaube ich zumindest. Wenn du dir also gleich eine Karte kaufst, verpasst du nichts.«
Helena verdreht die Augen und fährt sich mit einer Hand durch die Haare. Sie fallen gleich wieder an Ort und Stelle zurück. Perfekt.
»Schön wär’s«, sagt sie. »Aber durch Umstände, auf die ich offenbar keinen Einfluss habe, werde ich wohl nicht in Casablanca gehen. Ich gehe in die Elf-Uhr-Vorstellung von The Fast and the Furious 8 oder 12 — welche Folge es inzwischen auch immer ist. Und weißt du, warum? Weil mein Freund sagt, dass Casablanca sich nach einem Scheißfilm für alte Idioten und Schwachköpfe anhört.«
Und auf einmal wird meine Liebeskomödien-Traumwelt von einer gewaltigen Flutwelle erfasst und verwandelt sich in einen Katastrophenfilm. Hinter Helena öffnet sich die Tür.
»Und aufs Stichwort ist er da«, sagt sie.
Die Katastrophe nimmt ihren Lauf.
Helenas Freund kommt zu uns. Er trägt enge schwarze Jeans und ein hellblaues T-Shirt, das ihm offenbar jemand auf den Körper gemalt hat. Seine Haare sind mit Gel zugekleistert, und sein Scheitel sieht aus wie mit einem Laserstrahl gezogen. Er schaut uns beiden kurz in die Augen, bevor er wie ein männliches Model aus einem Herrenmodekatalog neben Helena posiert. Ohne etwas zu sagen, schlingt er den Arm um ihre Taille und treibt zugleich eine Streitaxt durch mein Herz. Im Augenblick bin ich nicht sicher, ob ich mich in einem Katastrophenfilm oder einem Horrorstreifen befinde. Vielleicht in beidem.
»Corban, das ist Sebastian. Wir haben uns heute Morgen in der Stadtplanungsvorlesung kennengelernt. Sebastian hat mich gerettet, als mein Kuli den Geist aufgegeben hat. Sebastian, das ist Corban, der renommierte Filmkritiker.«
Corban sieht Helena mit gequälter Miene an und nickt in meine Richtung, als wollte er sagen: »Ich sehe, dass du da stehst, aber du interessierst mich ungefähr so sehr wie der Teppich. Vielleicht weniger. Moment, mach daraus definitiv weniger.«
»Hast du die Karten?«, fragte er Helena.
»Nein, ich bin gerade erst …«
Corban wartet nicht, bis sie den Satz beendet hat.
»Ich hole sie«, murmelt er und schreitet wie auf einem Laufsteg zur Kasse.
Helena blickt ihm hinterher und verzieht das Gesicht in übertriebenem Entsetzen. Ich frage mich unwillkürlich, ob sie wohl ein Gesicht machen kann, mit dem sie nicht mehr schön wäre.
»Es wäre schrecklich, wenn wir den Anfang des Films verpassten. Wie sollten wir jemals die Handlung kapieren? Es sei denn, Fast and Spurious 92 wäre im Grunde genommen dasselbe wie jeder andere Film der Reihe. Aber hey, wie wahrscheinlich wäre das?«
Ich schenke ihr mein bestes mitfühlendes Lächeln, aber innerlich schreie ich: Verlass ihn! Er ist ein arrogantes Arschloch. Geh stattdessen mit mir in Casablanca. Wir haben uns weit vom Drehbuch entfernt. Könnte jemand mal CUT rufen! Wir müssen diese Liebeskomödie wieder auf Kurs bringen. Jetzt sofort!
Aber es sieht nicht so aus, als würde das in absehbarer Zeit geschehen. Stattdessen stelle ich fest, dass Helena versucht, ihre glatte, makellose Stirn in Falten zu legen. Jetzt zeigt sie auf die Karte in meiner Hand.
»Aber was ist mit dir? Du gehst doch in Casablanca, und die Vorstellung hat vor fast zwanzig Minuten begonnen. Warum hängst du hier draußen rum? Wartest du noch auf jemand?«
Ja, natürlich warte ich auf jemanden. Ist das nicht offensichtlich? Auf dich! Ich warte, dass du dieses arrogante Arschloch verlässt und mit mir kommst.
»Na ja, ich … ähm …«
Meine Gedanken erstarren. Spontane Reaktionen sind nicht gerade meine Stärke. Ich brauche Zeit, um alles genau zu durchdenken, es von jedem möglichen Blickwinkel aus zu betrachten und alle Für und Wider abzuwägen und mir den Kopf zu zerbrechen und erst dann die, wie ich immer argwöhne, falsche Entscheidung zu treffen. Und überhaupt, wie soll ich ihre Frage beantworten? Sage ich Ja oder Nein? Wenn ich Ja sage, was soll ich dann sagen, auf wen ich warte und warum sie noch nicht hier sind? Und wenn ich Nein sage, dann hat sie recht. Warum hänge ich dann immer noch draußen im Foyer herum?
»Ich will nur … na ja, ich … du weißt schon … ich wollte …«
Und während ich weiter sinnfrei vor mich hin labere, erlischt langsam das fröhliche Leuchten in Helenas perfekten Augen, und ihre perfekten Zähne verschwinden hinter den perfekten Lippen, während ihr Lächeln erstirbt. Eine Diashow von Erkenntnis, Mitleid und Beschämung läuft auf ihrem Gesicht ab.
Sie hat die Antwort gefunden. O Gott. Sie hat die Antwort auf ihre Frage gefunden. Sie schaut in die Augen eines Vollidioten, und sie weiß es. Und es sollte noch schlimmer kommen. Viel schlimmer. Denn sie ist drauf und dran, ihr beschämendes Wissen in erniedrigende und egovernichtende Worte zu fassen.
»Hey, ich hoffe, du warst nicht … ich meine … ich hoffe, du dachtest nicht … na ja … dass …«
Mein persönlicher Liebes-/Katastrophen-/Horrorfilm rast auf seinen qualvollen Höhepunkt zu. Ich wäre keineswegs erstaunt, wenn er zu einem ausgewachsenen Splatter-Festival verkommen würde. Und dreimal darfst du raten, welcher stinknormale Vollidiot das erste Schlachtopfer sein würde. Ich mache mich auf den unvermeidlichen Angriff gefasst, als ich im Augenwinkel einen weißen Schatten wahrnehme und spüre, wie sich ein Körper neben mich schiebt.
»Puh! Geschafft. Sorry, dass du warten musstest.«
Ich schaue auf einen halb rasierten Kopf und ein mit Granatsplittern bestücktes Ohr. Die halbe Eiskönigin steht neben mir und wedelt mit einer Casablanca-Karte. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Eine überraschende Wendung, so viel ist klar. Aber aus welchem Drehbuch stammt sie? Liebeskomödie, Katastrophenfilm, Horrorstreifen, Splatter? Oder was ganz anderes? Wer immer dieses Ding schneidet, macht einen lausigen Job!
Die halbe Eiskönigin schaut erwartungsvoll von mir zu Helena und wieder zurück. Sie setzt zum Sprechen an, und ich hoffe inständig, dass das, was sie dann sagt, dem Ganzen hier einen Sinn verleiht.
»Also«, sagt sie zu mir, »willst du mich nicht vorstellen?«
5.
Der Sandkasten
Dich vorstellen? Klar. Allerdings hab ich keine Ahnung, wer du bist!
Leider hat mein Mund wie immer schon losgelegt, bevor mein Gehirn den Hauch einer Chance hatte, einen Plan runterzuladen.
»’tschuldigung. Ja. Ähm, das ist Helena …«
Mist, und was jetzt? Moment mal. Mir wird gerade etwas klar. Ich weiß nicht, wie die halbe Eiskönigin heißt, aber fest steht, Helena weiß es auch nicht. Ich kann also einfach irgendeinen Namen nehmen! Mir muss nur einer einfallen. Irgendein Mädchenname. Blöderweise hat mein Gehirn gerade dichtgemacht, und der einzige Mädchenname, der mir einfällt, ist Helena, aber der ist schon vergeben! Spiel auf Zeit! Spiel auf Zeit!
»… und ääähh, Helena … das ist … ähm …«
Los. Ein Name für die halbe Eiskönigin. Irgendein Name! Und endlich tropft einer von irgendwoher in mein Gehirn.
»… Elsa.«