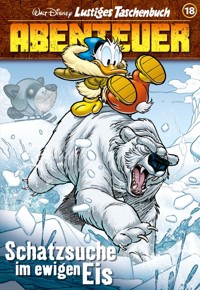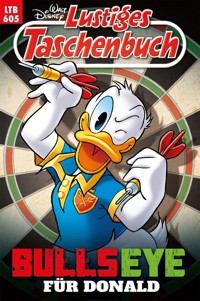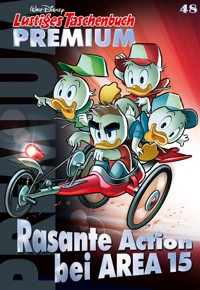11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Ein Straßenjunge wird zum Anführer. Eine Prinzessin wird zur Revolutionärin. Die Geschichte von Aladdin wird nie wieder dieselbe sein. Als Jafar die Lampe des Dschinni stiehlt, nutzt er seine ersten beiden Wünsche, um Sultan und der mächtigste Zauberer der Welt zu werden. Ab sofort lebt das Volk von Agrabah in ständiger Angst. Um den machtbesessenen Herrscher aufzuhalten, müssen Aladdin und die abgesetzte Prinzessin Jasmin die Bewohner von Agrabah vereinen. Doch schon bald droht ein Bürgerkrieg das Land zu zerreißen. Werden sie es schaffen, Jafar zu stürzen bevor es zu spät ist? In der Reihe 'Twisted Tales' werden die beliebtesten Disney-Klassiker aus einer vollkommen anderen Perspektive erzählt. Sie präsentieren sowohl die Held*innen als auch die Bösewichte in einem völlig neuen Licht. Ein vielschichtiges Fantasy-Abenteuer voller neuer Blickwinkel, dunklerer Welten, überraschenden Twists und düsteren Geheimnissen. Moderne Märchen-Adaption mit einer starken Heldin, die für ihre Selbstbestimmung kämpft: Ein packender Coming-of-Age-Roman, in dem Prinzessin Jasmin die Hauptrolle spielt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Für meinen Sohn Alex,
der – im Prinzip – ein kleiner Schurke
und nun alt genug ist, meine Bücher zu lesen.
Hab Spaß mit ihnen!
Außerdem für David Kazemi für die Details,
die das alte Agrabah wieder zum Leben erweckt haben,
auch wenn wir uns nicht einig darüber sind,
was gutes Baklava ausmacht.
– L. B.
Prolog
Hoch oben und weiß strahlte der Mond auf die Stadt herab, so hell wie – so hieß es – die Sonne in den Ländern des Nordens. Die weißen Lehmziegelbauten erglühten wie Kieselsteine an einem fernen Strand. Wie in einem Traum erschienen die goldenen Zwiebeltürme der Hauptstadt flimmernd vor den blassen Dünen und der dunklen, sternenklaren Weite.
Die Hitze des Tages hatte sich längst in die Wüste zurückgezogen, und die Stadt, die in der Hitze des Nachmittags vor sich hingedämmert hatte, erwachte nun endlich zum Leben. Die Straßen füllten sich mit Menschen, die Tee tranken, schwatzten, lachten und Freunde besuchten. Vor den Cafés saßen alte Männer über dem Brettspiel Schatrandsch. Obwohl es längst Schlafenszeit war, waren die Kinder noch auf und spielten auf den Gehwegen ihre eigenen Spiele. Männer und Frauen kauften von den Abendverkäufern Roseneis und Schmuck. Das Leben im Mondschein spielte sich in Agrabah laut und überschwänglich ab.
Allerdings nicht überall in Agrabah.
In einem anderen Stadtteil erstreckten sich die Straßen still wie Schatten und schwarz wie der Tod. Bunt und prächtig gekleidet konnte sich dort niemand sicher fühlen. Selbst die Bewohner blieben lieber zu Hause oder hielten sich in versteckten Gassen und geheimen Passagen auf, die abseits der Straßen durch das Viertel führten. Die weißen Hauswände waren verblasst und löchrig, Lehmklumpen bröselten aus den Ziegelschichten des Mauerwerks.
Nur noch halbfertige Holzkonstruktionen erinnerten an den Traum des ehemaligen Sultans, der das Viertel umgestalten, seine Straßen verbreitern und es mit Wasser versorgen wollte. Er war vergiftet worden, und danach war das gesamte Projekt zum Stillstand gekommen. Jetzt pfiff der Wüstenwind um die skelettartigen Überreste seines großen Plans wie um am Galgen baumelnde Leichen.
Es war das Viertel der Straßenratten. Hier lebten Diebe, Bettler, Mörder und die Ärmsten der Armen. Kinder, die niemand wollte, Erwachsene, die niemand je mit irgendeiner ehrlichen Arbeit beauftragen würde … Sie alle hatten hier eine Bleibe gefunden: Verwaiste, Unglückliche, Kranke und Ausgestoßene. Dies war ein völlig anderes Gesicht von Agrabah.
Zwischen Hütten und Baracken, verfallenen öffentlichen Gebäuden und maroden Gebetsstätten stand ein kleines Haus, das in einem etwas besseren Zustand war als die anderen. Seine Lehmwände sahen so aus, als seien sie im vergangenen Jahrzehnt zumindest einmal weiß getüncht worden.
In einer zerbrochenen Schale vor der Tür wuchsen ein paar Wüstenblumen, die jemand durch regelmäßige Gaben kostbaren Wassers am Leben hielt. Zwar war er zerfetzt, aber vor dem Eingang lag ein echter Teppich, auf dem Besucher ihre Sandalen abstellen konnten – für den unwahrscheinlichen Fall, dass sie welche besaßen.
Durch ein schlüssellochförmiges Fenster drang das sanfte Summen einer Frau zu den Passanten heraus. Wer durch den Sichtschutz aus Holz spähte, konnte sie sehen: Sie hatte sanft blickende Augen und trug ihre Lumpen mit der Anmut einer Königin.
Ihre Kleidung war sauber, genau wie die Hose, die sie im durch das Fenster scheinenden, fleckigen Mondlicht sorgfältig flickte.
Plötzlich klopfte es laut an der Tür. Dreimal und sehr kräftig. So klopfte niemand im Straßenrattenviertel. Hier klang das Klopfen meist scheu und manchmal wie eine verschlüsselte Botschaft.
Überrascht legte die Frau ihre Arbeit behutsam beiseite, zog ihr Kopftuch zurecht und ging zur Tür.
„Wer ist denn da?“, rief sie und legte die Hand an den Türgriff.
„Ich bin’s, Mama“, erklang eine Stimme.
Mit einem erfreuten Lächeln schob die den Riegel zurück.
„Aber Aladdin“, ermahnte sie lachend, „eigentlich kannst du das besser …“ Sie hielt inne, als sie bemerkte, dass vor der Tür vier Personen standen.
Darunter war ihr Sohn Aladdin, mager wie alle Straßenratten-Kinder.
Er war barfuß und hatte wie sein Vater dunkle Haut und dichtes rabenschwarzes Haar, das mit Straßenstaub bedeckt war. Seine Haltung hatte ihm seine Mutter beigebracht: den Kopf hocherhoben, die Brust herausgestreckt. Eine Straßenratte war er nur dem Namen nach.
Seine Freunde – falls sie so zu bezeichnen waren – standen etwas mehr an der Seite, kichernd und jederzeit zur Flucht bereit. Wenn es Ärger gab, hatten Morgana und Duban mit Sicherheit etwas damit zu tun.
An ihrem durchtriebenen Blick erkannte Aladdins Mutter, dass sie so schnell wie möglich entkommen wollten. Hinter ihrem Sohn stand ein großer, schlanker Mann in einem langen blauen Gewand mit farblich passendem Turban. Akram, der Basarhändler für Trockenfrüchte und Nüsse.
Seine knochigen Finger umklammerten die Schulter ihres Sohns und drohten, noch fester zuzufassen, sollte der Junge auch nur an Flucht denken.
„Ihr Sohn“, sagte Akram höflich, aber verärgert, „und seine … Kumpane. Sie haben schon wieder auf dem Basar gestohlen. Lehr deine Taschen aus, Straßenratte!“
Aladdin zuckte gleichgültig mit den Schultern und stülpte seine Hosentaschen nach außen. Getrocknete Feigen und Datteln kullerten heraus, aber er ließ sie immerhin nicht achtlos auf den Boden plumpsen.
„Aladdin!“, sagte seine Mutter scharf. „Du böser Junge!“ Sie wandte sich an Akram. „Es tut mir wirklich leid, werter Herr. Morgen wird Aladdin den ganzen Tag Botengänge für Sie erledigen. Er tut, was Sie wünschen. Er schleppt Wasser für Sie.“ Aladdin wollte protestieren, aber ein Blick seiner Mutter brachte ihn zum Schweigen.
Duban und Morgana lachten ihn aus.
„Und für euch beide gilt dasselbe“, fügte sie hinzu.
„Sie sind nicht meine Mutter“, rief Morgana frech. „Sie haben mir gar nichts zu sagen. Niemand kommandiert mich herum.“
„Was für ein Unglück, dass du keine Mutter hast, wie diese arme Frau eine ist“, bemerkte Akram ernst. „Dein Kopf wird auf einer Säbelspitze enden, noch bevor du sechzehn Jahre alt bist, Mädchen.“
Morgana streckte ihm die Zunge heraus.
„Los, komm“, meinte Duban etwas nervös. „Lass uns abhauen.“
Die beiden rannten in der Dunkelheit davon. Aladdin sah ihnen traurig nach. Seine Freunde ließen ihn mit einer Strafe allein, die sie alle verdient hatten.
„Es täte dir gut, dich von ihnen fernzuhalten, meiner Meinung nach“, sagte Akram nachdenklich. „Jedenfalls habt ihr alle drei Glück gehabt, dass ich euch erwischt habe und niemand anders. Als Bezahlung für die Früchte, die ihr gestohlen habt, hätten einige der Händler eure Hand verlangt.“
„Wartet, lassen Sie mich die Ware einpacken, damit Sie sie wieder mitnehmen können.“ Aladdins Mutter nahm ihrem Sohn das Obst ab und sah sich nach einem passenden Tuch zum Einwickeln um.
„Lassen Sie nur“, wehrte Akram verlegen ab. Seine Augen huschten durch die kleine, dunkle Hütte. „Ich habe für heute schon alles zusammengepackt. Und eine hart arbeitende Frau, die so … allein ist, sollte nicht für Sünden bestraft werden, die sie nicht begangen hat. Betrachten Sie sie als Geschenk.“
Die Augen von Aladdins Mutter blitzten auf. „Ich habe Ihre Almosen nicht nötig. Mein Mann kehrt bestimmt sehr bald zurück“, sagte sie. „Cassim hat sicher Geld verdient und bringt uns an einen Ort, der besser zu seiner Familie passt. Ich schäme mich nur für alles, was er bis dahin hier noch erleben muss.“
„Natürlich, natürlich“, lenkte Akram beschwichtigend ein. „Ich … kann kaum erwarten, ihn wiederzusehen. Er mochte meine Cashewnüsse so gern.“
Aladdins Mutter sonnte sich im Glanz der Erinnerung an ihren Mann, auch wenn sie aus zweiter Hand stammte.
Aladdin zuckte zusammen. Akrams Hand lag wieder auf seiner Schulter, aber statt hart wie ein wütender Häscher zuzugreifen, tätschelte sie ihn nun liebevoll, denn er empfand Mitleid mit dem Jungen.
Dadurch fühlte sich Aladdin nur noch schlechter.
„Na, ist alles in Ordnung?“ Einer der jüngeren Basarwächter trat aus der Nacht hervor. Er hielt einen Knüppel in der Hand und sah mit ernstem Blick zu ihnen. „Ich habe gehört, in Ihrem Zelt ist es zu einem Zwischenfall gekommen, Akram.“
„Es ist alles gut, Rasul“, entgegnete der Händler im gleichen beschwichtigenden Ton, in dem er auch mit Aladdins Mutter gesprochen hatte. „Ein Missverständnis. Jetzt ist alles geklärt. Danke, dass Sie sich danach erkundigen.“
Der Wächter, der offenbar eine Schwäche für etwas zu viel Gebäck hatte, machte keinen Druck, wie es andere Wachleute vielleicht getan hätten. Er sah die ruhige, entschlossene Frau, den niedergeschlagen wirkenden Aladdin und die Armut des Hauses.
„Also gut, Akram. Ich bringe Sie zu Ihrem Zelt zurück. Dies ist bei Nacht kein sicherer Ort für anständige Leute wie Sie.“
„Tausend Dank, Rasul.“ Akram verbeugte sich vor Aladdins Mutter. „Friede sei mit Ihnen.“
„Und mit Ihnen“, antwortete sie kopfnickend. „Und … vielen Dank.“
Als der Händler und der Wächter gingen, schloss sie die Tür und strich ihrem Sohn mit der Hand durchs Haar.
„Aladdin, was machen wir bloß mit dir?“
„Na, was bloß?“, fragte er, gar nicht mehr in sich zusammengesunken. Er grinste wie ein Dieb und hüpfte aufgeregt auf und ab. „Es hat alles geklappt! Schau mal! Unser Festmahl für heute Abend!“
Fröhlich holte er weitere Feigen und Datteln aus seinen Taschen und legte sie in eine Schale, die einen Sprung hatte. Und dann zog er aus der Wickelschärpe, die seine Hose um seine Hüften hielt, frische Mandeln und geräucherte Pistazien – und von irgendwo aus seinem zerfetzten Hemd tauchten Cashewnüsse auf.
„Aladdin!“, rief seine Mutter tadelnd, und er versuchte, nicht zu lachen.
„Das habe ich für dich getan, Mama. Du verdienst etwas Süßes. Du kaufst nie etwas für dich selbst.“
„Ach Aladdin, ich brauche nichts. Nur dich.“
Sie nahm ihn in ihre Arme und drückte ihn fest an sich.
„Mama“, flüsterte Aladdin. „Du gibst mir immer das meiste von allem, was wir zu essen haben. Das ist nicht fair. Ich will doch nur für dich sorgen.“
„Vieles ist nicht fair, Aladdin.“
Sie löste sich von ihm, hielt immer noch seine Hände und sah ihm in die Augen.
„So ist das Leben nun einmal – und deshalb ist es für uns Straßenratten so wichtig, füreinander zu sorgen. Das empfindest du ganz richtig. Du solltest immer auf deine Freunde und deine Familie aufpassen. Denn niemand sonst kümmert sich um uns. Aber das heißt nicht, dass du ein Dieb werden musst.“
Aladdin blickte bekümmert zu Boden.
Sie legte ihre Hand unter sein Kinn, damit er zu ihr aufschaute.
„Wie ungerecht das Leben ist oder wie arm du bist, darf nicht darüber entscheiden, was aus dir wird. Lass das nicht zu. Du entscheidest, wer du sein willst, Aladdin. Willst du ein Held sein, der sich um die Schwachen und Machtlosen kümmert? Oder willst du ein Dieb sein? Wirst du ein Bettler – oder noch Schlimmeres? Du triffst die Entscheidung, nicht die Dinge – oder die Menschen – um dich herum. Du selbst hast es in der Hand, mehr zu sein.“
Er nickte, seine Lippen zitterten. Er war zu alt, um zu weinen. Das war er tatsächlich. Seine Mutter küsste ihn noch einmal, seufzte, ging an ihm vorbei und betrachtete das Obst.
„Vielleicht liegt es daran, dass du hier die ganze Zeit allein mit deiner Mutter bist“, sagte sie mehr oder weniger zu sich selbst. „Du hast keine Spielkameraden außer diesen Taugenichtsen Duban und Morgana. Du brauchst einen richtigen Freund oder vielleicht ein Haustier oder so etwas. Ja, ein Haustier …“
Aber Aladdin hörte ihr nicht mehr zu.
Er ging zum Fenster und schob das Drahtgitter beiseite.
Das Beste, das einzig Gute an ihrem Haus, war: In den im Zickzack verlaufenden Straßen gab es einen Sprung, so etwas wie eine Lücke, die kein Architekt gefüllt hatte, und somit hatten sie einen perfekten Blick auf den Palast.
Er betrachtete die weißen Türme, die im Mondlicht noch heller wirkten, die glitzernden Zwiebeltürme und die bunten Fahnen, die an perfekten Turmspitzen flatterten, die so spitz waren, als könnten sie den Himmel durchbohren.
Du selbst hast es in der Hand, mehr zu sein …
Der ganze Aufstand für einen Laib Brot?
Abu war ein letztes Geschenk von seiner Mutter. Aladdins Vater, der „sein Vermögen im Ausland machen“ wollte, war natürlich nie zurückgekehrt. An dieses Märchen hatte Aladdin ohnehin nie geglaubt, daher war es kein großer Verlust für ihn. Aber seine Mutter hatte befürchtet, er würde zu sehr verwildern und ohne eine richtige Familie zum vereinsamten Einzelgänger werden. Ein Haustier, so hatte sie gedacht, würde ihn besänftigen.
Und vielleicht stimmte das auch – nur dass er jetzt für zwei stahl.
„Der Mittagstisch ist jetzt endlich gedeckt.“ Aladdin machte mit dem Brot eine einladende Handbewegung in Richtung seines Freundes.
„Halt, du Dieb!“
Abu floh. Aladdin sprang auf.
Irgendwie hatten die Basarwächter es tatsächlich geschafft, hinter ihm die Leiter auf das Dach zu erklimmen. Zwei Wachen waren jedenfalls schon oben, und ein wütender Rasul folgte ihnen dicht auf dem Fuße. Er trug den von einem Onyx gekrönten, gestreiften Turban, sein Markenzeichen als Hauptmann der Palastwache.
Trotz ihrer Zusammenstöße musste selbst Aladdin zugeben, dass der Mann sich seinen Aufstieg in den höheren Rang auf ehrliche Weise erarbeitet hatte. Aber das bedeutete nicht, dass Aladdin ihn mochte.
„Ich behalte deine Hände als Trophäe, Straßenratte!“, brüllte Rasul. Schnaufend schleppte er seinen Körper die Leiter hinauf. Er ärgerte sich doppelt, weil es ihn eine so große Anstrengung kostete.
„All das für einen Laib Brot?“, fragte Aladdin genervt.
Er hatte es bewusst von einem der Pferdefuhrwerke gestohlen, die für einen fürstlichen Ausflug beladen waren – ein Picknick für den Sultan, der eine seiner Wüstentouren unternehmen wollte, um Drachen fliegen zu lassen oder ähnlich Unsinniges. So fett, wie er war, konnte der kleine Sultan unmöglich einen Laib Brot vermissen.
Aber seine Palastwache konnte das offensichtlich. Und nach geltendem Recht durfte ein Ankläger die Hand eines Diebs, den er erwischt hatte, zur Strafe abhacken lassen.
Zudem glänzte Rasuls Krummsäbel im Sonnenlicht gerade gefährlich und spitz. Daher sprang Aladdin seitlich von dem Gebäude hinunter.
Aladdin war vieles: schnell, stark, schlau, wendig, vorausschauend, blitzgescheit.
Aber eins war er nicht: unbesonnen.
Während die Wachen kurz innehielten, schockiert über sein in ihren Augen tödlich riskantes und unglaublich verrücktes Verhalten, purzelte ein fast gar nicht nervöser Aladdin zur Straße hinab und griff nach den Wäscheleinen, die er – völlig zu Recht – unter sich vermutet hatte.
Es bestand natürlich immer die Möglichkeit, dass die Seile nicht hielten. Aber Aladdin hatte Glück. Als er die Hände ausstreckte, prallte saubere Wäsche gegen seinen Kopf, und als sein Fall sich verlangsamte, begann das Seil, nach dem er gegriffen hatte, in seinen Händen zu brennen. Erst als der Schmerz unerträglich wurde, ließ er los und landete mit Prellungen und aufgeschlagenen Knien auf der staubigen Straße.
Ihm blieb keine Zeit, über seine Sicherheit, sein Glück oder später zu behandelnde Wunden nachzudenken. Er musste sich sofort überlegen, wie er den Wachen entkommen sollte, die sicher bald heruntereilen würden, um nachzuschauen, was ihm passiert war.
Die Wäscheleinen der Witwe Gulbahar hatten sich um ihn geschlungen. Wenn niemand ihn beobachtete, könnte er sich ganz darin einwickeln und sich als schickes – wenn auch hässliches – Mädchen verkleiden und durch einen der Harems davonschleichen.
Er hielt inne, als über ihm lautes weibliches Gelächter ertönte. Aladdin schaute hoch. Die Witwe selbst lehnte aus dem Fenster und lächelte ihm gar nicht unfreundlich zu. Zwei andere Frauen standen in der Nähe, wo sie vor seinem Erscheinen genussvoll geklatscht und getratscht hatten. Das war ihr einziges Vergnügen des Tages, bevor sie sich ihren Aufgaben widmeten: für Essen zu sorgen und zu arbeiten.
„Ist es nicht etwas zu früh am Morgen, um schon in Schwierigkeiten zu stecken, Aladdin?“, neckte Gulbahar ihn.
„In Schwierigkeiten – autsch – ist nur – aua –, wer sich erwischen lässt“, widersprach Aladdin, der versuchte, seine Schmerzen zu verbergen, während er aufstand und sich ihnen näherte. Er wickelte sich ein Tuch um Kopf und Hals, in der Hoffnung, dass sie den Wink verstanden. Keine Minute später lehnte er sich in – wie er annahm – weiblicher Art an die Hauswand und schob seine Hüften vor, den Rücken der Seite der Gasse zugewandt, von der die Wachen kommen würden.
Gulbahar rollte mit den Augen und schüttelte den Kopf.
„Aladdin, du musst solider werden“, seufzte sie. „Such dir ein nettes Mädchen. Sie wird dir den Kopf zurechtrücken.“
Die anderen Frauen nickten zustimmend. Sie wussten über nette Mädchen Bescheid, waren selbst jedoch weit von dieser Definition entfernt. Aber sie hatten etwas zu essen, und das hatten nette Mädchen in Agrabah oft nicht.
„Da ist er!“, rief Rasul plötzlich. Er und ein ganzer Trupp Wachmänner stürmten die Gasse hinunter und schnitten Aladdin den Weg ab.
Aladdin drehte sich um, um loszurennen.
Aber in Rasuls wütenden Ausfallschritten steckten vermutlich all seine Verärgerung und Energie. Und so gelang es ihm, Aladdins Arm zu packen und ihn herumzuwirbeln.
„Dieses Mal, Straßenratte, werde ich …“
Aber bevor er seine Drohung zu Ende sprechen konnte, sprang ihm ein kreischendes Äffchen auf den Kopf und fuhr mit seinen scharfen Krallen über seine Augen.
„Gerade rechtzeitig, Abu“, sagte Aladdin in dramatischem Ton, zum Vergnügen der zuschauenden Frauen.
Dann rannte er los.
Er entkam Rasul und raste mit Erfolg an den restlichen Wachen vorbei, die ungeschickt die Arme nach ihm ausstreckten. Glücklicherweise waren zehn von ihnen nicht einen Rasul wert. Er war der Einzige, den Aladdin fürchtete, zumal er die Straßen fast so gut kannte wie der Junge.
Eine Stelle, die wie ein Riss in der Stadt aussah, bot Aladdin Zuflucht: zwei Gebäude, die gegeneinanderkippten wie zwei alte Männer, die sich aneinander anlehnten. Aladdin rannte unter ihnen hindurch und fand sich in einem heruntergekommenen Innenhof wieder. Ein ausgetrockneter, nutzloser Brunnen stand in der Mitte. Früher, vor langer Zeit, hatte er vielleicht noch funktioniert, als einem Sultan noch daran gelegen gewesen war, auch den ärmeren Bewohnern von Agrabah etwas Gutes zu tun.
Doch auch Rasul war hier. Mit erhobenem Krummsäbel kam er von der gegenüberliegenden Hofseite auf Aladdin zu.
„Glaub ja nicht, du kämst im Labyrinth der Straßen des Ostens davon, Aladdin“, sagte er streng und lächelte fast, als er Aladdins überraschtes Gesicht sah. „Oh ja, ich kenne deinen Plan. Aber du hast gegen das Gesetz verstoßen und musst dich deiner Strafe unterziehen.“
„Wirst du mir wirklich die Hand abhacken, weil ich einen Laib Brot geklaut habe?“, fragte Aladdin und versuchte, Zeit zu gewinnen, während er leicht auf den Zehen trippelte und im Kreis lief, damit der Brunnen zwischen ihnen blieb.
„Gesetz ist Gesetz.“
Aladdin täuschte einen Schritt nach links vor und versuchte, nach rechts zu entkommen. Rasul ließ sich nicht täuschen. Er schlug mit seinem Krummsäbel nach rechts. Aladdin duckte sich und zog den Bauch ein. Aber ganz unversehrt kam er nicht davon: Ein winziger, scharlachroter Streifen Blut rann über seine Haut. Aladdin keuchte vor Schmerz.
Rasul hielt inne. „Vielleicht lässt der Richter Milde walten, wenn du ihm alles erklärst. Er wird die Umstände abwägen. Aber das ist seine Aufgabe. Meine Pflicht ist es, dich zu verhaften.“
„Tatsächlich? Ich dachte, Baklava zu essen wäre deine Pflicht. Du wirst langsamer, alter Mann“, spottete Aladdin. Mit wütendem Gebrüll ließ Rasul seinen Säbel so hart wie möglich auf ihn niedersausen.
Aladdin duckte sich schnell, krümmte sich zu einem Ball zusammen und rollte sich aus dem Weg. Funkensprühend schlug die Säbelspitze auf dem Kopfsteinpflaster auf. Aladdin kletterte auf ein klappriges altes Gerüst, das sein Gewicht so gerade eben hielt. Das von Rasul würde es ganz gewiss nicht aushalten.
Der Wächter fluchte gequält, und Aladdin rannte, so schnell er konnte, davon – planlos von Dach zu Dach springend. Ohne einen klaren Gedanken oder eine Strategie konzentrierte er sich nur darauf, sich so weit wie möglich vom Basar zu entfernen, bevor er in das ruhigere, dunklere Viertel der Straßenratten hinabstieg.
Ein gellender Schrei tat kund, dass Abu endlich aufgeholt hatte. Er sprang auf Aladdins Schulter und klammerte sich fest, während der Junge sich weiter vorsichtig in der Dunkelheit der Schatten und in leeren Häusern versteckt hielt und durch ihre kaputten Fenster und klaffenden Türen ein- und ausging.
Als sie zu einer Sackgasse kamen, die so heruntergekommen und baufällig war, dass sie als behelfsmäßige Mülldeponie für die Slums diente, hatte er schließlich das Gefühl, eine Pause einlegen zu können. Den Müll transportierte kein Arbeiter der Stadt ab, und so wuchs er zu hohen Haufen an, in denen die Ärmsten der Armen wühlten, die auf übersehene Brocken hofften. Es stank hier, aber es war sicher.
„Uff, der alte Mann wird zwar langsamer, aber auch schlauer“, brummte Aladdin und klopfte sich den Staub von Hose und Jacke. „Und nun, mein Teurer Effendi, feiern wir ein opulentes Festmahl.“
Er ließ sich am Fuß der Mauer nieder und brach sein Brot. Die Hälfte gab er Abu, der sie sich begeistert schnappte. Aladdin wollte gerade ein großes, lang ersehntes Stück abbeißen, als ihn ein Klappern auf dem Pflaster innehalten ließ.
Er machte sich darauf gefasst, dass Wachen kamen und er wieder davonlaufen müsste.
Mit dem Anblick zweier der kleinsten und dürrsten Kinder von Agrabah hatte er jedoch nicht gerechnet. Sie sprangen auf, vor Schreck über den Lärm, den sie selbst beim Wühlen im Müll verursacht hatten, wo sie nach etwas Essbarem suchten. Als sie Aladdin sahen, klammerten sie sich zwar nicht aneinander fest, rückten aber schutzsuchend näher zusammen. Sie hatten riesige Augen. Ihre Bäuche waren geschrumpft. Eins der Kinder war ein Mädchen, was Aladdin jedoch erst bei genauerem Hinsehen erkannte. Ihre Lumpen hingen formlos an ihnen herunter, und sie waren sehr, sehr dünn.
„Ich tue euch nichts. Ihr kommt mir bekannt vor. Sind wir uns schon mal begegnet?“
Die Kinder erwiderten nichts und versteckten, was auch immer sie gefunden hatten – Knochen, Melonenschalen – , hinter ihrem Rücken.
Straßenratten sorgen füreinander. Nach all den Jahren begleiteten Aladdin immer noch die Worte seiner Mutter.
„Hier“, sagte er, stand langsam auf und vermied jede abrupte Bewegung. Er wusste, wie es war, Angst davor zu haben, dass jemand, der größer, gesünder oder älter war, einem wehtun und die letzten Habseligkeiten stehlen würde.
Er streckte seine Hände aus. Die eine war leer, zum Zeichen des Friedens, in der anderen hielt er das Brot.
„Nehmt es“, forderte er sie sanft auf.
Er musste sie nicht groß überreden. Das kleine Mädchen war mutiger. Sie streckte die Hand aus und nahm das Brot, wobei sie sich Mühe gab, nicht zu grapschen.
„Danke“, murmelte sie und brach es sofort fast halb durch. Das größere Stück gab sie ihrem noch dünneren und kleineren Bruder.
Interessiert beobachtete Abu alles und kaute sein eigenes Stückchen.
Aladdin spürte, wie sich die Wut in seiner Kehle zu einem Klumpen formte.
Wann hatten diese beiden Kinder das letzte Mal eine vollständige Mahlzeit gegessen oder einen großen Schluck sauberes Wasser getrunken? Als Kind war es ihm wie ihnen ergangen. Nichts hatte sich seither geändert. Der Sultan saß immer noch in seinem Prachtpalast mit der goldenen Kuppel und spielte mit seinem Spielzeug, während die Menschen auf den Straßen verhungerten. Nichts würde sich je ändern, bis der Sultan – oder irgendjemand – aufwachte und sah, wie sehr sein Volk litt.
Aladdin seufzte und hob Abu auf seine Schulter. Er ging langsam nach Hause. Brot hatte er nicht im Bauch, dafür aber jede Menge Wut und Verzweiflung.
... und für einen Apfel ?
Es wurde Abend. Die Sonne begann ihre Reise abwärts, der Mond bereitete sich auf seinen Aufstieg vor, und Aladdin erwachte aus seinem Nachmittagsschläfchen, bereit zu neuen Taten. Vielleicht hatte ihn genau dieser unerschöpfliche Optimismus all die Jahre, die er in den Slums verbracht hatte, am Leben und gesund gehalten, mehr als seine flinken Füße, sein schneller Verstand und seine schlagfertige Zunge. Wenn er nur seine Augen und seinen Geist offenhielt, war alles möglich.
Sogar ein Abendessen.
Er verließ das Straßenratten-Viertel, um Händler zu bestehlen, die ihn und seine Tricks vielleicht noch etwas weniger gut durchschauten. Affen waren in Agrabah nicht besonders ungewöhnlich, was jedoch nicht für Affen galt, die oft auf dem Basar herumlungerten und dort ständig etwas klauten.
„Ich habe das Gefühl, heute ist Melonentag“, murmelte Aladdin, der im Schatten eines Kamelkarrens versteckt nach möglicher Beute Ausschau hielt. Bei dem Gedanken an reifes, saftiges Obst knurrte sein Magen zustimmend. Er hatte aber noch deutlich in Erinnerung, was am Morgen passiert war, darum traf er seine Wahl zögerlicher als sonst.
Der Melonenhändler, auf den er es abgesehen hatte, schrie eine Frau an und weigerte sich, mit ihr zu feilschen.
„Ich sterbe selbst den Hungertod, wenn ich meinen Preis senke. Das würde dann jeder verlangen. Und wo ist Ihr Kopftuch, unverschämte Frau? Gehen Sie zurück in den Harem, wo Sie hingehören!“
Die Frau wandte sich betrübt um und ging. Ihr langes, schwarzes Haar war zu einem Zopf mit grauen Strähnen gebunden. Ihr Gewand hing lose an ihr herab. Aladdin fiel auf, wie sehr sie seiner Mutter ähnelte. Hinter ihr her trottete ein mageres Mädchen – Kind oder Enkelin.
Ja. Definitiv Melone, dachte er, hob Abu hoch und zeigte ihm den Basarstand. „Das ist etwas für dich, kleiner Freund.“
Langer Ermunterung bedurfte es nicht, bis das Äffchen sich auf den riesigen Stapel dunkelgrüner Früchte zubewegte.
Aladdin sprang auf den Balkon über ihm und glitt von dort vorsichtig auf den Balken, der das Melonenzelt stützte. Er beugte sich vor und lauschte aufmerksam. Als er hörte, wie der Händler Abu brüllend davonjagte, reckte er sich geschmeidig wie eine biegsame Schlange hinab und schnappte sich eine reife Melone in seiner Reichweite.
Sobald er in Sicherheit und nicht mehr zu sehen war, pfiff er eine kurze Botschaft, die wie das Gurren einer Taube klang. Das Affengezeter verstummte auf der Stelle.
„Ja, hau ab, du Dieb!“, hörte Aladdin den Händler schimpfen.
Einen Moment später tauchte Abu auf dem Balken neben Aladdin auf. Dort hockten die beiden, sich in ihrer Haltung merkwürdig ähnelnd. Aladdin schnitt die Melone mit einem spitzen Holzstück auf und servierte sie.
„Dafür lohnt sich der ganze Aufwand. Dies ist das Leben“, sagte Aladdin und gönnte sich seinen ersten großen, saftigen Bissen. Er machte es sich bequem, aß sein Abendessen und spürte, wie die Sonne seine Haut und seine Muskeln erwärmte.
Die blauen Flecken vom Morgen verblassten bereits an seinen Armen und Beinen.
Die letzte Hitze des Tages ließ langsam nach, und die Menschen strömten in Scharen auf den Basar. So weit das Auge reichte, spannten sich bunte Zelte und leuchtende Markisen an den Holzgerüsten auf dem Platz wie unzählige frisch geschlüpfte Schmetterlinge, die ihre Flügel sonnten. Das späte, orangefarbene Licht ließ die weißen Bögen, Türme und Balkone glänzen wie antikes Gold.
Einheimische inspizierten die Produkte und Waren mit scharfen Augen – Männer in Tuniken und Turbanen, Westen und Hosen, Frauen in langen farbenfrohen Gewändern, manchmal aus Seide, manchmal aus Baumwolle, manchmal mit passenden Kopftüchern, manchmal nicht.
Unter ihnen wandelten Fremde, Männer mit seltsamen Augen in orientalischen Dschallabijas und Frauen, die ihre Haut ebenso dunkel geschminkt hatten. An dem ein oder anderen Handgelenk blitzte Gold auf, und in manchem Halsausschnitt funkelten leuchtend grüne Edelsteine.
Aladdin seufzte zufrieden. Gab es einen wundervolleren Ort auf der Welt als das trubelige, kosmopolite Agrabah?
Doch im Schatten standen hagere, alte und so gut wie nackte Männer, die darauf warteten, dass man sie aufforderte, Kamelmist oder andere Abfälle zu beseitigen. Sie hofften auf ein Trinkgeld. Auf diese Weise würden sie die letzten Jahre ihres Lebens verbringen. Was für ein hartes Los. War es nicht an der Zeit, für sie zu sorgen, nachdem sie sich ihr ganzes Leben lang um ihre Familien gekümmert hatten? Damit sie Tee trinken, Schach spielen, Wasserpfeife rauchen und die Zeit mit ihren Enkelkindern genießen konnten?
„Los, komm, Abu, lass uns …“ Aladdin verstummte mitten im Satz.
Er hatte einen Stimmungswandel der Menge auf dem Basar bemerkt. Die Leute drehten ihre Köpfe und schauten einem Mädchen nach, das vorbeiging. Sie trug ein hellbraunes Gewand und ein Kopftuch, wie es hier üblich war, wirkte aber nicht wie eine Basarbesucherin. Sie bewegte sich langsam und betrachtete alles wie ein staunendes Kind. Sie hatte große, klare Augen, und ihr Haar war schwarz wie die Nacht. Auf ihren hübschen Lippen lag ein warmes Lächeln, und sie schien zu grüßen oder sich zu entschuldigen – auch wenn es die Leute nicht kümmerte und sie selbst keine Anstalten machten, etwas zu sagen. Sie bewegte sich mit der Anmut einer Wolke im Wind, als wäre ihr Körper schwerelos. Ihren Kopf hob sie leichtherzig und würdevoll an. Lässig.
Aladdin spürte sein Herz klopfen. Noch nie hatte er sie – oder jemanden wie sie – gesehen.
Als das Mädchen sein Kopftuch zurechtzupfte, wurde in seinem Haar ein raffiniertes Diadem mit einem unfassbar großen Smaragd sichtbar.
Aha, ein reiches Mädchen, das sich ohne seine Bediensteten einen Einkaufstag auf dem Basar genehmigt. Sie lebt gefährlich und schwänzt die Schule.
Und dann fiel Aladdin natürlich auch auf, wie die anderen Leute sie beobachteten. Unverfrorene Augen und verschlagenes Grinsen. Es schlug ihm auf den Magen. Er hatte nur für sich und Abu etwas zu essen gestohlen. Und manchmal für ein hungriges Kind. Andere Straßenratten waren längst nicht so diszipliniert.
So sorglos, wie das Mädchen herumlief, würde sie all ihres Schmucks und ihrer weltlichen Besitztümer entledigt werden, bevor sie das andere Ende des Platzes erreicht hatte. Wären Duban und Morgana hier, hätten sie sie bestohlen oder um ihre Sachen betrogen, und zwar schneller, als eine Melone aufgegessen war. Es sei denn, sie ließen sich von ihren strahlenden Mandelaugen ablenken …
Eine Straßenratte stellte sich ihr wie zufällig in den Weg. Aladdin kannte den Jungen. Er war klein für sein Alter, schlank und schmächtig, hatte einen großen Kopf und ebenso große Augen. Er wirkte immer viel kleiner, als er wirklich war. Gerade tat er so, als wäre er ein sehr, sehr kleines und sehr, sehr hungriges Kind. Und auf mysteriöse Weise war er direkt vor dem Mädchen gelandet.
Aladdin konnte nicht hören, was sie sagte, aber ihr Gesichtsausdruck voller Mitleid ließ es ihn erahnen. Sie war die perfekte Zielscheibe.
Abu schnatterte: Wenn der Mensch nicht klug genug war, seine Melone aufzuessen, wie es sich gehörte, würde sein Affe sie sehr gern essen.
„Pssst!“, befahl Aladdin.
Was als Nächstes passierte, hätte weder er noch irgendeine andere Straßenratte vorhersehen können.
Das schöne Mädchen nahm einen Apfel vom nächstgelegenen Stand und gab ihn dem Jungen. Danach ging sie weiter.
Verwirrt betrachtete die Straßenratte den Apfel und sah ihrem sich entfernenden Allerwertesten nach.
Da hielt der Obsthändler sie fest und verlangte sein Geld. Sie zuckte mit den Schultern und schüttelte den Kopf, als wäre er nicht ganz gescheit.
Die Straßenratte – und alle anderen – starrten sie an, als wäre sie verrückt.
Was wohl auch stimmte. Schließlich war sie gerade eben auf die Idee gekommen, diesen Apfel zu nehmen. Und ihn zu verschenken. Ohne ihn zu bezahlen.
Auch der Händler starrte sie einen Moment lang verständnislos an. Dann packte er sie und warf sie gegen den Stand. Eine schaulustige Menschenmenge drängte herbei. Einige Männer murmelten protestierend hinter ihren Schals, aber niemand rührte sich, um ihr zu helfen.
Der Händler zog einen extrem scharfen Khanjar heraus und hob ihn über ihrem Handgelenk.
Sie schrie, aber Aladdin war schon in die Luft gesprungen und beinahe auf dem Stand gelandet.
„Von meinem Karren stiehlt niemand etwas!“, brüllte der Händler.
Die Spitze seiner Dolchklinge glänzte gefährlich rot im Nachmittagslicht.
„Nein!“, schrie das Mädchen.
Das Messer schnellte herab und pfiff durch die Luft.
Die Menge hielt den Atem an.
„Ich danke Euch, gütiger Herr“, sagte Aladdin, der plötzlich zwischen dem Händler und dem Mädchen stand. Noch bevor jemand den Neuankömmling bemerkt hatte, schob er den Arm des Mannes mit einer Hand sanft weg und packte das Mädchen mit der anderen.
„Tausend Segenswünsche – Sie haben meine Schwester gefunden.“
„Was?“, fragte der Mann überrascht. „Du kennst dieses Mädchen?“
„Ich habe überall nach dir gesucht“, wandte Aladdin sich an das Mädchen und wedelte ermahnend mit dem Zeigefinger vor ihrem Gesicht.
Auch das Mädchen war sichtlich verwirrt.
„Was meinst du …?“, hob sie an.
„Pssst!“, formten Aladdins Lippen. Spiel einfach mit!
„Erklär mir mal, was das soll! Sie hat etwas von meinem Wagen gestohlen!“, schrie der Händler.
„Ich bitte um Entschuldigung, mein Herr. Meine Schwester – macht manchmal Ärger. Sie ist wieder von zu Hause weggelaufen“, sagte Aladdin bekümmert. Er tippte sich seitlich an den Kopf. „Sie ist leider etwas verrückt.“
Bei diesen Worten sah das Mädchen wütend aus.
Aladdin sah sie verzweifelt an.
Endlich verstand sie und nickte leicht mit dem Kopf.
„Sie kennt den Sultan, hat sie gesagt“, fauchte der Händler und musterte Aladdin vor aller Augen demonstrativ mehrmals von oben bis unten.
Mit ihren großen goldenen Ohrringen, der vollkommenen gesunden Erscheinung und ihrer strahlenden Haut war es sogar möglich, dass dieses Mädchen den Sultan kannte. Was jedoch auf Aladdin in seiner abgewetzten Hose ganz und gar nicht zutraf.
Seine Gedanken rasten.
Abu zeterte und hüpfte fragend auf dem Boden herum. Der Affe spürte die allgemeine Unruhe, die in der Luft lag.
Genau, das ist es!
„Sie hält das Äffchen für den Sultan“, flüsterte Aladdin dem Kaufmann mit lauter Stimme ins Ohr. So laut, dass die Menge – und das Mädchen es hörten.
„Oh … äh … weiser, großer Sultan“, nahm sie sein Stichwort auf. Sie blickte auf den Dreck am Boden, dann auf das scharfe Khanjar, das der Händler noch immer in der Hand hielt und jetzt auf Aladdin richtete, und warf sich vor Abu in den Schmutz. „Wie kann ich Euch dienen?“
Die Männer und Frauen in der Menge tuschelten und gaben mitfühlende Laute von sich. Dann wandten sie sich von der peinlichen Szene ab und gingen in alle Richtungen davon.
Der Kaufmann betrachtete das hübsche Mädchen im Straßenstaub, und auch er sah allmählich überzeugt aus.
Jetzt musste Aladdin schnell reinen Tisch machen und verschwinden, bevor etwas schiefging. Unbemerkt schnappte er sich einen weiteren Apfel vom Karren.
„Tragisch, nicht wahr?“, seufzte er bedauernd und reichte dem Händler den Apfel. „Na ja, es ist ja nichts passiert. Komm, Schwesterchen, wir müssen jetzt wieder nach Hause zu Tante Idina.“
Das Mädchen stand auf und gab sich alle Mühe, seine Augen total albern und verrückt zu verdrehen. Das ist ein bisschen viel, dachte Aladdin, aber für ein naives, reiches Mädchen nicht schlecht. Er legte seine Hände auf ihre Schultern und schob sie durch die Menge. Mit steifem Gang ließ sich führen – mehr wie ein Ghul und nicht wie eine Verrückte, aber egal. Es genügte.
Vor einem Kamel blieb sie stehen.
„Hallo, Tantchen Idina!“, sagte sie mit einem breiten, dummen Grinsen.
„Das ist nicht das Tantchen“, erwiderte er mit zusammengebissenen Zähnen und schob sie schneller vorwärts. Abu rief er zu: „Komm schon, Sultan.“
Leider lenkte das die Aufmerksamkeit wieder auf Abu. Der kleine Affe griff sich gerade so viele Äpfelchen von dem Stand, wie er zu fassen bekommen konnte, einen hielt er sogar zwischen seinen Zähnen.
Und jetzt sah ihn der Händler, der dem Vorfall endlich keine Beachtung mehr geschenkt und sich kurz zuvor umgedreht hatte, um sein Obst neu zu sortieren.
Zwar hatte er sich schon vorher geärgert, aber im Vergleich zu jetzt war das gar nichts. Sein Gesicht färbte sich violett und rot vor Wut. Einen Moment lang befürchtete Aladdin beinahe, der Händler würde auf der Stelle tot umfallen.
„Halt, ein Dieb!“
Aladdin ergriff die Hand des Mädchens und rannte los.
Abu flitzte hinter ihnen her und versuchte verzweifelt, wenigstens einen Apfel festzuhalten.
Der Preis der Weisheit
Weit unter den tiefsten Räumen des Palasts erglühte eine geheime Werkstatt rot und orange von dem flüssigen Feuer, das in den Gruben um sie herum floss. Trotz des lodernden, blutigen Glühens war es kühl in dem Raum – geradezu kalt. Dschafar bewegte sich vorsichtig. Mit den Fingern klopfte er ungeduldig auf die goldglänzende Ebenholzoberfläche seines Stabs.
Er war der Großwesir des Sultans und sein engster Berater – und seit dem Tod der Sultanin sein einziger Freund. So viel die Öffentlichkeit auch über die königliche Prinzessin tratschte, über Dschafar wurde nur bei Nacht geredet. Es hieß, er beschäftige sich mit Schwarzer Magie. Sein Stab mit dem Kopf einer Kobra verleihe ihm Macht über andere. Die Leute sagten auch, Dschafar habe den Sultan so vollkommen unter Kontrolle, dass sein Einfluss unendlich groß sei.
Doch neben Gerüchten gab es auch handfeste Fakten über diesen Mann: Er war die zweitmächtigste Person im Sultanat und wusste über alles Bescheid, was in Agrabah geschah. Auch entführte er regelmäßig Menschen und ließ sie in Kerkern verschwinden oder stellte Schlimmeres mit ihnen an.
Unter „Schlimmeres“ war unter anderem das zu verstehen, was in dieser Werkstatt geschah. Seltsame, furchterregende Werkzeuge standen auf dem Tisch, über den sich Dschafar gerade beugte. Aus rostfarbenem Holz geschnitzte Zahnräder waren über und über mit hässlichen Runen bemalt, die zu flüstern schienen, sobald er sich dichter über sie beugte. Schwarzes Metall, das kein Eisen war, drehte und stach sich in bedrohlichen Formen wie ein Käfig um das Holz. Fetzen hauchdünner Dinge – zerrissener Stoff, Spinnseide, blutige Federn – hatten sich in den Dornen verfangen und wehten in einer unsichtbaren Brise wie Haare unter Wasser. Die Luft über all dem bebte und zerbarst, als ginge die Welt unter. Aus dem blutenden, schwarzen Loch erschien eine schwankende Gestalt.
Dschafar beugte seinen Oberkörper weiter zu ihr hinab und versuchte, das Bild zu deuten. Dies war die verbotenste esoterischste Magie, die Menschen seines Schlags kannten: Rizar Hadinok, der Blick ins Jenseits.
In diesem Moment polterte ein aufgedunsenes, verschwitztes Etwas die letzten Steinstufen zu Dschafars Geheimraum herunter. Rasul gab sich offensichtlich Mühe, seine Nervosität nicht zu zeigen, und salutierte so korrekt, wie er konnte.
„Ihr habt mich gerufen, Großwesir?“
„Sie müssen diesen Mann suchen und ihn zu mir bringen. Es ist von äußerster Wichtigkeit für … den Sultan.“
Mit einem langen, spitzen Finger zeigte Dschafar ihm die verschwommene Gestalt in der Luft. Mit kleinen, schleppenden Schritten bewegte sich der Hauptmann der Palastwache darauf zu – bemüht, so viel wie möglich seines Körpers von den grausam aussehenden Werkzeugen fernzuhalten. Aber als er das Bild in der Luft konzentriert betrachtete, verwandelte sich seine Nervosität in Überraschung.
„Den da, Großwesir? Er ist doch bloß ein Junge. Eine Straßenratte. Ein armseliger Dieb auf dem Basar, nichts weiter. Er fügt dem Sultan ganz sicher keinen Schaden zu.“
Bei den anmaßenden Worten des Wächters schnellten Dschafars Augenbrauen streng nach oben. „Meine Magie hat seine Mitwirkung bei gewissen Ereignissen vorausgesagt, die das Schicksal von Agrabah beeinflussen werden. Es ist zwingend notwendig, ihn sofort zu verhaften“, schnauzte er ihn an.
„Ja, natürlich, Großwesir“, entschuldigte sich Rasul eilig mit einer tiefen Verbeugung. Dann erhob er sich, salutierte zum Abschied und riskierte einen letzten Blick durch die verbotene Werkstatt.
„Wo ist denn Jago?“ Die Frage konnte er sich einfach nicht verkneifen.
„Hmmm?“, fragte Dschafar zerstreut und schon wieder mit seinen Instrumenten beschäftigt.
„Euer … Euer … Papagei“, stotterte Rasul. „Er sitzt sonst immer auf Eurer Schulter oder hält sich in Eurer Nähe auf.“
Aus dem Augenwinkel sah Dschafar den Wächter eine Schrecksekunde lang an. „Irgendwo Kekse essen, nehme ich an“, sagte er dann.
„Ja. Ja, natürlich. Großwesir.“ Rasul verbeugte sich noch einmal tief. Dann beeilte er sich, den Raum so schnell wie möglich zu verlassen, ohne dass es auffiel.
Dschafar tippte langsam mit den Fingern der linken Hand auf den Tisch, mit einem nach dem anderen, und betrachtete die Erscheinung.
„Aha“, sprach er langsam zu dem Bild des Jungen. „Du bist also der Einzige, von dem die alten Mächte sagen, er könne die Höhle lebend betreten. Mag es dir viel Nutzen bringen, mein ungeschliffener Diamant …“
Die unsichtbare Seite von Agrabah
Als sie sich weit genug vom Basar entfernt hatten und Aladdin die Luft für rein hielt, brach er vor einem alten Wassertrog fast vor Lachen zusammen.
„Oh wow, hast du sein Gesicht gesehen?“ Er krümmte sich. „Mensch, war der sauer. Jetzt kommt er sich bestimmt total dumm vor. Er hat uns die ganze Geschichte abgekauft. Bis du alles kaputtgemacht hast, Abu.“
Abu schien zu merken, dass er kritisiert wurde. Er sprang von Aladdins Schulter und zeterte laut vor sich hin.
Mit einer Hand an der Seite hatte sich das Mädchen vorgebeugt und keuchte. Als ihr Atem sich pfeifend beruhigt hatte, presste sie ihre Handflächen zusammen und schloss die Augen. Dann machte sie ein paar anmutige Dehnungen, die gut eingeübt wirkten.
„Tut mir leid“, sagte Aladdin. „Du bist es wohl kaum gewohnt, so viel zu laufen, nicht wahr?“
„Ja, es sollte dir wahrlich leidtun, dass du mich davor bewahrt hast, dass mir die Hand abgehackt wird. Und nein, ich renne normalerweise vor niemandem davon. Ich laufe mit Radscha, meinem …“ – sie stockte, als suche sie nach einem passenden Wort – „Hund“.
Sie drückte sich absichtlich vage aus. Dabei musste man kein Genie sein, um zu erraten, dass sie wahrscheinlich ihr ganzes bisheriges Leben in den Frauengemächern eines Herrenhauses oder Schlosses verbracht hatte.
„Wo sind wir hier eigentlich?“, lenkte sie vom Thema ab und sah sich um.
Sie pausierten an einer breiten Kreuzung zwischen drei baufälligen Häusern, die keine ersichtliche Funktion erfüllten.
Es war niemand zu sehen, und der Wüstenwind blies unheilvoll durch die wenigen trockenen Gräser und Unkräuter, die am Rand der Straßen aus festgefahrenem Lehm wuchsen.
Das einzige andere Geräusch kam von einem Kampf in der Nähe – Schreie, unterbrochen von entsetzlichen, klatschenden Schlägen.
Aladdin wurde plötzlich klar, wie das Mädchen sich fühlen musste. Mitten im Nirgendwo allein mit einem Fremden, ohne eine Ahnung, wie sie wieder nach Hause kommen sollte, wo auch immer sie herkam. Wäre er die falsche Sorte Mensch gewesen – ein gefährlicherer Straßenjunge –, hätte er sie an exakt so einen Ort gebracht, um ihr alles zu stehlen, was sie besaß. An einen Ort, wo niemand ihre Schreie hören würde.
„Tja, das könnte ich dir zwar verraten, aber es würde dir wahrscheinlich nicht viel sagen“, antwortete er bemüht freundlich. Dann stand er auf und gestikulierte beim Sprechen wie ein perfekter Fremdenführer. „Offiziell befinden wir uns in der malerischen Wohngegend des ärmsten Teils von Agrabah. Viele Straßen hier haben nicht einmal Namen. Wir nennen sie bloß die Straße östlich von Hakim oder die stinkende Gasse neben dem Rattenfänger. Das nächste ortstypische Wahrzeichen ist die alte osmanische Moschee – dort drüben –, schon jahrhundertelang nicht mehr genutzt, außer von Tauben und Obdachlosen, wenn Sandstürme aus der Wüste bis hierher vordringen.“
Das Mädchen runzelte die Stirn. Nicht verärgert, sondern eher so, als versuche sie verzweifelt, etwas zu verstehen. Etwas von dem, was Aladdin ihr da – so einfach – erzählte, entging ihr.
„Über welches meiner Worte grübelst du nach?“, fragte Aladdin. „Taube oder Sandsturm oder stinkend?“
„Eigentlich war es obdachlos“, antwortete das Mädchen langsam. „Es wohnen – Menschen in der alten Moschee?“
„Nicht die ganze Zeit. Sie ist ziemlich unheimlich. Manche sagen, dort spukt es. Hey, wo wir gerade von Wohnen sprechen, gibt es einen Ort, an den ich dich nach Hause bringen kann?“
Es war natürlich die richtige Entscheidung. Das hübsche Mädchen retten, das hübsche Mädchen nach Hause begleiten. Die Belohnung ablehnen. Also gut, die Belohnung vielleicht nehmen. Wenn es eine Belohnung gab. Aber bekam man nicht in der Regel eine Belohnung? In Wirklichkeit würden sie ihn wahrscheinlich argwöhnisch beäugen, sich das Mädchen schnappen und ihn mit der Spitze eines Krummsäbels davonjagen.
Er hoffte, dass sie wirklich weit weg wohnte, damit es lange dauern würde, sie nach Hause zu bringen. In einer Oase in der Wüste. Das wäre perfekt.
Doch sie schüttelte den Kopf. „Zeig mir dein Zuhause. Ich will sehen, wo du wohnst.“
Aladdin wurde rot, was ihm sehr selten passierte. Damit sie es nicht sah, schüttelte er sein dunkles Haar.
„Ach, das wird dich nicht interessieren. Es ist nichts Besonderes“, wiegelte er ab. Eigentlich war es gar nichts, wenn man unter einem Zuhause ganz im Allgemeinen vier Wände, ein Dach und eine Art Tür verstand.
„Komm schon!“, bettelte das Mädchen. „Ich habe mich in Kamelmist geworfen, um dein Spiel mitzuspielen. Glaubst du etwa, es macht mir etwas aus, wie es bei dir zu Hause aussieht?“
Aladdin ertappte sich beim Grinsen. „Na gut, aber vergiss nicht: Du wolltest es so!“
Er sah kurz um sich und dachte über den besten Weg nach. Dann führte er sie zur Rückseite eines der alten, baufälligen Häuser und stieg eine klapprige Leiter hoch.
„Ähm …?“, fragte sie skeptisch und zuckte bei jeder Sprosse zusammen, als befürchte sie, die ganze Leiter breche ein. „Was machen wir hier?“
Aladdin sprang auf einen Balkon und reichte ihr seine Hand.
Sie nahm sie nicht und sprang ihm flink hinterher.
„Erinnerst du dich an meine Worte arm und stinkend? Tja, ich stinke nicht, aber ich wohne auch nicht gerade in der sichersten Gegend von Agrabah. Ich halte es für besser, wir verlassen die Straßen, denn dort könnten wir gesehen werden.“
„Na und? Was ist daran so schlimm?“, fragte sie.
„Weiß nicht. Was ist falsch daran, nichts für ein Stück Obst zu bezahlen und es dann zu verschenken?“
„Ich wusste nicht …“ Sie verstummte.
„Dass du bezahlen musst?“, beendete Aladdin ihren Satz und lächelte sie sanft an.
„Na gut, ich war das erste Mal auf einem Basar“, gab sie zu. „Ich habe noch nie etwas gekauft. Ich habe nie darüber nachgedacht, wie das läuft, Preise und Geld und so.“
Aladdin konnte sein zufriedenes Grinsen nicht zurückhalten. Wie recht er gehabt hatte, sie für ein reiches Mädchen zu halten, das sich verkleidet hatte.
Sie aber kniff ihre Augen zu schmalen Schlitzen zusammen und warf ihm einen Blick zu, den er sonst nur von der Witwe Gulbahar kannte. „Und hast du etwa einen Geldbeutel mit Goldmünzen bei dir, Schlaumeier? Nicht, dass ich wüsste! Wie bezahlst du denn?“
Aladdin war – möglicherweise zum ersten Mal überhaupt – sprachlos.
„Schlauer Gedanke von dir …“, antwortete er schließlich. „Aber es ist ganz anders! Ich klaue nur, weil ich sonst verhungern würde!“
„Wenn du stiehlst, weil du etwas zu essen brauchst, ist das also in Ordnung. Aber für mich, die es aus Unwissenheit tat, nicht? Außerdem wollte ich nur einem kleinen Kind helfen.“
Aladdin verschränkte die Arme vor der Brust. „Na gut, ja, du bist wirklich sehr schlau. Einigen wir uns einfach darauf, dass wir hier über die Dächer klettern, weil du offenbar nicht weißt, was Stehlen ist, ich es aber weiß und an diese Art von Leben gewöhnt bin. Schau mal, da!“
Er hockte sich auf den Balkon und zog sie an sich. Im Schatten eines schiefen Turms lungerten eine kleine Gruppe Kinder und ein paar Teenager gelangweilt herum.
Sie trugen Lumpen und hatten dunkle Ränder unter den Augen. Zwei der Kleinsten spielten mit einem Kieselstein, den sie sich zuwarfen. Die älteren Kinder bestäubten ihre Arme mit Asche, um kränker auszusehen, als sie es tatsächlich waren.
„Sobald hier irgendjemand auftaucht – und damit meine ich, wer auch immer außer einer anderen Straßenratte –, springen diese Jungs auf und umzingeln ihn. Oder sie. Und betteln. Und wenn er oder sie ihnen nichts gibt – etwa eine Brotkruste oder eine Münze oder manchmal sogar, wenn sie etwas bekommen –, klaut ein Kind alles aus den Taschen, während das andere über seinen Hunger jammert.“
Das Mädchen sah entsetzt aus. „Sie tun alle nur so, als wären sie arm?“
Aladdin lächelte ironisch. „Nein, sie tun nicht nur so. Es ist wahr. Sie sind arm, haben keine Schuhe und kein Dach über dem Kopf, sie haben Hunger. All das stimmt. Aber manchmal erkennen die Menschen die Wahrheit direkt vor ihrer Nase nur mit Kostümen, Make-up und Schauspielerei.“
Ende der Leseprobe