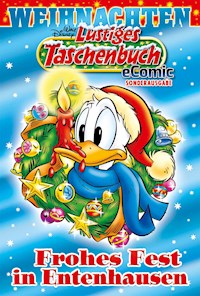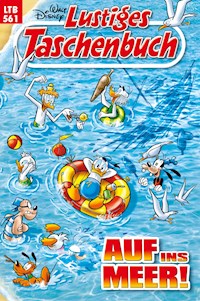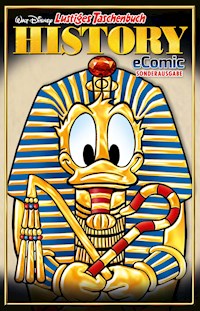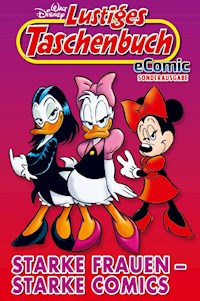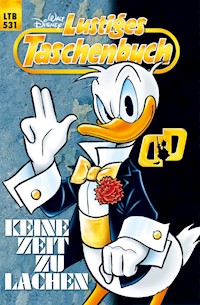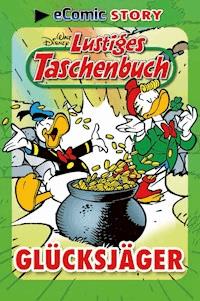Disney. Twisted Tales: Wenn Wünsche wahr werden – Was wäre, wenn die Blaue Fee Pinocchio nicht geholfen hätte? E-Book
Walt Disney
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Ein neuer Band der Bestseller-Reihe Twisted Tales! Von der Spiegel-Bestseller-Autorin Elizabeth Lim Was wäre, wenn die Blaue Fee Pinocchio nicht hätte helfen sollen? Diese New York Times-Bestseller-Serie verwandelt einen weiteren Disney-Klassiker in eine erschütternde Geschichte, in der die Blaue Fee sich über das Feengesetz hinwegsetzt und eine dramatische Kette von Ereignissen in Gang setzt. "Stern hell, Stern hell, der erste Stern, den ich heute Nacht sehe ...". "So beginnt der Wunsch, der alles verändert - für Geppetto, für die Blaue Fee und für eine kleine Marionette namens Pinocchio. Die Blaue Fee darf in dem kleinen Dorf Pariva eigentlich keine Wünsche erfüllen, aber irgendetwas an diesem Wunsch weckt ein lang verschüttetes Flackern in ihr. Vielleicht ist es die Hoffnung, die sie unter der Einsamkeit des alten Mannes spürt. Oder vielleicht ist es die Tatsache, dass sie vor langer Zeit, bevor sie die Blaue Fee war, eine junge Frau namens Chiara aus eben diesem Dorf war, die einen einfachen Wunsch hatte: anderen zu helfen, ihr Glück zu finden. Ihre Schwester Ilaria hat sie deswegen immer gehänselt, denn Ilaria hatte große Träume, ihr verschlafenes Dorf zu verlassen und eine weltberühmte Opernsängerin zu werden. Die beiden standen sich trotz ihrer Differenzen nahe. Während Ilaria alles dafür gegeben hätte, dass eine Fee ihren Wunsch erfüllte, glaubte Chiara nicht an die Überlieferungen, für die ihr Dorf berühmt war. Vierzig Jahre später widersetzt sich Chiara, jetzt die Blaue Fee, den Regeln der Magie, um einer alten Freundin zu helfen. Doch sie wird von der Scharlachroten Fee, ehemals Ilaria, entdeckt, die ihrer Schwester die Verfehlung seit Jahrzehnten übel nimmt. Sie beschließen, die Sache durch eine gute, altmodische Wette zu regeln, wobei das Schicksal von Pinocchio und Geppetto auf dem Spiel steht. Werden die Schwestern einen Weg zurück zueinander finden? Oder ist dies, wie viele Herzensangelegenheiten, ein Spiel, das mit Bedingungen verbunden ist?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Für meine Schwester Victoria und die Liebe, die Musik und das Lachen mit ihrE. L.
Prolog
In dieser Nacht sollte die Blaue Fee nicht auf Wünsche hören, schon gar nicht auf Wünsche aus der verschlafenen kleinen Stadt Pariva. Aber sie spürte einen Stich im Herzen, als sie über die niedrigen Dächer und die engen gepflasterten Gassen flog, und wollte das nicht ignorieren.
Es war schon spät am Abend und in den meisten Häusern schliefen die Bewohner bereits. Nur eine Handvoll Fenster wurden noch von Kerzenlicht erhellt. In ihnen bemerkte die Blaue Fee aufgeregte Gesichter von Kindern und Erwachsenen, die laut riefen: „Seht nur da oben! Eine Sternschnuppe! Und sie leuchtet besonderes hell!“
Und genauso war es auch. Sie leuchtete so hell, dass ihr Licht die Sterne und sogar den Mond in ihrer Nähe überstrahlte.
„Schnell, schnell!“, hörte die Blaue Fee ein Mädchen rufen. „Sie wird vergehen! Wir müssen uns rasch etwas wünschen! Ich wollte schon immer mal eine Sternschnuppe sehen. Und jetzt ist sie da!“
Lächelnd ließ die Blaue Fee sich auf dem Dach des alten Glockenturms von Pariva nieder. Ihre silbernen Schühchen klingelten ganz leise, als sie auf den alten Dachschindeln landete. Der Glockenturm war verlassen, aber selbst wenn das nicht so gewesen wäre, hätte niemand sie bemerkt. Sie war unsichtbar, so wie alle ihrer Art, jedenfalls wenn sie es wünschte. Auf diese Weise konnte sie ihren wichtigen Aufgaben nachgehen, ohne beobachtet zu werden.
Gerade heute war sie besonders dankbar für diese Fähigkeit. Natürlich wusste sie, dass es albern war. Denn inzwischen gab es niemanden mehr in Pariva, der sie erkannt hätte, selbst wenn sie direkt vor ihm oder ihr gestanden hätte. Und trotzdem spürte sie diesen Stich im Herzen immer deutlicher.
Pariva war ein kleines Städtchen, so unbedeutend, dass es auf kaum einer Landkarte von Esperia eingezeichnet war. Es wurde von Bergen und dem Meer begrenzt und schien damals von der Außenwelt nahezu unberührt zu sein. Die Schule sah immer noch so aus wie früher, genau wie der Marktplatz und die Via Mangia – eine Straße mit Lebensmittelläden, darunter die hochgeschätzte Bäckerei Belmagio. Zypressen, Lorbeerbäume und Pinien säumten noch immer den großen Platz im Zentrum, wo die Einheimischen sich zum Plaudern oder Schachspielen oder auch zum Singen trafen.
Waren wirklich schon vierzig Jahre vergangen, seit sie von hier fortgegangen war? Es kam ihr vor, als wäre sie gestern noch durch die schmalen Gassen von Pariva gelaufen, in der Hand einen Sack mit Pinienkernen für die Bäckerei ihrer Eltern. Weißt du noch, wie du immer am Hafen stehen geblieben bist, um zuzuschauen, wie die Fischerboote über das glitzernde Wasser glitten?
Damals war sie noch eine Tochter gewesen, eine Schwester, eine Freundin. Ein zierliches Mädchen, das bei ihren Eltern in einem bescheidenen zweistöckigen Haus an der Via Constanza wohnte, mit einer narzissengelben Tür und einer Steintreppe, die in einen kleinen Innenhof führte. Dort hatte ihr Vater einen Kräutergarten angelegt. Und es hatte ihn immerzu betrübt, wie sehr die Minze wucherte, wo er doch vor allem Basilikum ziehen wollte.
Die Kräuter kamen in den Teig der Brote, die ihre Eltern in ihrem Bäckerladen verkauften. Vater backte die salzigen, Mutter die süßen Teigwaren, darunter Mandelkekse, dick überzogen mit Zitronencreme, Schokoladenbiskuits mit Haselnusspralinen und ihre berühmten Zimtplätzchen. Die Blaue Fee war mit glitzernden Zuckerkristallen an ihren Fingerspitzen aufgewachsen und Mehlstaub, der auf ihren Haaren glänzte wie Schnee. Ihr älterer Bruder Niccolo hatte den zickigen Ofen immer wieder in Gang gebracht und ihre Mutter horchte gerne auf das Knacken der goldbraunen Kruste, bevor die Brote zu singen begannen. Einmal war die Zunge ihrer kleinen Schwester Ilaria ganz grün gewesen, weil sie zu viele Pistazienküchlein verspeist hatte. Über allem hatte etwas Magisches gelegen, vor allem aber in dem Lächeln ihrer Mutter, ihres Vaters und ihrer Geschwister, wenn nach der täglichen Verkaufstour noch etwas von dem Schokoladenkuchen übrig war und sie sich mit ihren kleinen Gabeln erwartungsvoll ein saftiges Stück abstachen.
Nach dem Abendessen hatte sich die Blaue Fee mit ihren Geschwistern ins Blaue Zimmer zurückgezogen, um zu musizieren. Dort waren die Wände blauer als der Himmel im Hochsommer und die Fenster geschwungen wie Regenbögen. Es war ihr Lieblingszimmer im ganzen Haus gewesen.
Die Erinnerungen stimmten sie fröhlich und wehmütig zugleich. Unwillkürlich suchte sie nach ihrem früheren Zuhause. Das Haus war immer noch da, die gelbe Tür verblichen, und das Dach musste ausgebessert werden. Niemand stand am Fenster und wartete auf eine Sternschnuppe.
Mit einem tiefen Seufzer wandte sie sich von dem Haus ihrer Kindheit ab und nahm den Rest der Stadt in Augenschein. Sie beugte sich über den Rand des Dachs vom Glockenturm und legte den Zauberstab ans Ohr, damit sie hören konnte, was die Menschen sich an diesem Abend wünschten:
„Liebe Sternschnuppe, bitte hilf meiner kleinen Maria, damit sie in der Schule vorankommt.“
„Liebe Sternschnuppe, ich möchte, dass mein Baci ganz viele Hündchen bekommt, neun Stück, die alle so aussehen wie er. Und gesund und fröhlich sollen sie sein.“
„Ich wünsche mir mehr Erfolg für mein Geschäft.“
Und so weiter.
Manche Wünsche fand sie angebracht, aber die Blaue Fee konnte sie nicht erfüllen. Ihr war nicht erlaubt, in Pariva Wünsche zu erfüllen. Aber es gab bestimmt eine andere Fee, die die Wünsche hörte, die in dieser Nacht geäußert wurden, und denen half, die es verdienten.
Eine weiße Taube tauchte auf und landete auf ihrer Schulter. Sie gurrte leise und drängte sie zum Gehen.
„Keine Sorge, liebe Freundin“, sagte sie. „Ich weiß, wie spät es ist.“
Sie hatte bereits eine Stunde überzogen und würde sicher vermisst werden, wenn sie noch länger fortblieb. „Leb wohl, mein geliebtes Pariva“, murmelte sie und wollte schon davonfliegen – da drang ein letzter Wunsch an ihr Ohr.
„Stern, ich bitte dich in dieser Nacht inniglich. Ich hab einen großen Wunsch an dich.“
Rasch zog die Blaue Fee einen Kreis durch die Luft und schuf ein magisches Fenster, durch das sie den Sprechenden genauer betrachten konnte: Ein alter Mann kniete auf seinem Bett, neben ihm lag ein schwarzes Kätzchen und schnurrte. Er schaute sehnsüchtig durchs Fenster in den Himmel. Sie erkannte seine Stimme nicht, aber sie kam ihr bekannt vor – freundlich, ernst und getragen.
„Hoffentlich erfüllt er sich“, sprach er weiter.
Und da fiel ihr sein Name wieder ein.
Geppetto.
Es war vierzig Jahre her. Sein Haar war völlig weiß geworden, sein Gesicht so alt, dass sie es nicht wiedererkannte. Aber seine blauen Augen und seine runde, rötliche Nase waren noch so wie damals.
Geppetto wandte sich an sein kleines Kätzchen. Es war sehr hübsch mit seinem schwarzen Fell und den weißen Pfoten. „Figaro, weißt du, was ich mir wünsche?“
Figaro schüttelte den Kopf.
„Ich wünsche mir, mein kleiner Pinocchio könnte ein echter Junge sein. Wäre das nicht schön? Stell dir nur vor!“
Geppetto lächelte verträumt vor sich hin. Aber die Blaue Fee hatte die Gabe, in die Herzen der Menschen zu sehen. Sie spürte die Einsamkeit, die an ihm nagte. Er hatte niemanden, bis auf seine Katze und den Goldfisch in seiner Werkstatt – keine Frau, keinen Sohn, keine Tochter, keine Verwandten. Die Kinder von Pariva liebten die Spielsachen, die er herstellte, aber ihr Lachen hörte er nur tagsüber. An den Abenden fühlte er sich zumeist sehr einsam.
Immer noch mit diesem verträumten Lächeln im Gesicht legte der alte Geppetto sich ins Bett. Nach wenigen Minuten war er eingeschlafen.
Die Sternschnuppe verging am Himmel und die Blaue Fee senkte ihren Zauberstab. Es wurde Zeit, nach Hause zurückzukehren. Eine andere Fee würde sich bestimmt um die Wünsche der Bewohner von Pariva kümmern.
Aber sie konnte sich nicht losreißen.
Der alte Geppetto hatte eine wahre Flut von Gefühlen in ihr ausgelöst – Mitgefühl, Mitleid und ein Hauch von Schuld. Sie hielt inne. Ihr Blick fiel auf eine Holzpuppe in Geppettos Werkstatt. Sie spürte eine Last auf ihrer Brust. Sie wusste, dass sie gehen sollte. Ehrlich gesagt durfte sie überhaupt nicht hier sein. Aber sie schaffte es nicht, sich zu verabschieden.
Die Taube auf ihrer Schulter neigte fragend das Köpfchen und die Blaue Fee lächelte zögernd.
„Aber warum eigentlich nicht?“, sagte sie zu ihrer Begleiterin. „Niemand wird je davon erfahren.“
Und bevor sie sich eines Besseren besinnen konnte, schwenkte sie ihren Zauberstab und verwandelte sich in einen sanften Sternenglanz, der sich zielstrebig auf das Haus von Geppetto zubewegte.
Sie drang durch das offene Fenster ein und wartete, bis Geppetto und seine Katze Figaro tief und fest schliefen, bevor sie sich zurückverwandelte.
Nun stand sie mitten in Geppettos Werkstatt. Hier war sie früher einmal gewesen, vor so langer Zeit, dass es ihr wie ein Traum vorkam. Manches erkannte sie wieder, die Holzbalken unter der Decke, den langen Holztisch vor der Wand mit den Werkzeugen, den Farbtöpfen und Pinseln, die Skizzen. Aber manches war auch anders.
Auf den Regalen standen zahlreiche Spielzeuge aufgereiht: Holzpferde mit beweglichen Beinen, Elefanten mit flatternden Ohren, kleine Familien in Booten, die zu singen anfingen, wenn man sie aufzog. Und es gab Uhren. Bei manchen deuteten die Zeiger auf Sterne, andere zeigten Engel, die auf Wolken standen und zur vollen Stunde in eine Trompete bliesen. Andere waren mit Hasen oder Schafen verziert, die mittags oder um sechs Uhr abends aus ihrem Stall rannten. Schiffe mit roten Segeln hingen unter der Zimmerdecke und Spielzeugsoldaten wachten von einem hohen Regalbrett aus über die Werkstatt.
Allerhand Neues war hinzugekommen, aber der Geruch war der gleiche: Noch immer duftete es nach Fichtenholz und Farbe, nach dem Rauch des Holzofens und nach Kerzenwachs. Geppetto hatte schon immer am liebsten mit Holz gearbeitet und die Blaue Fee freute sich darüber, dass sich das in all den Jahren nicht geändert hatte.
„Du hast dein Versprechen gehalten“, murmelte sie und schaute sich die tanzenden Paare auf den Spieluhren an. „Du wolltest den Menschen Freude bringen und das ist dir gelungen.“
Eine Grille sprang auf eins der Regale und kroch in eine geöffnete Streichholzschachtel. Die Blaue Fee musste lächeln. Sogar das kleine Tier war hier in der kleinen Werkstatt stets willkommen.
Schließlich blieb sie vor Pinocchio stehen, dem Jungen aus Holz, dem Geppettos Wunsch gegolten hatte. Die Puppe lehnte an der Wand. Sie war gerade fertig geworden, die Farbe trocknete noch.
Der Junge war sorgfältig geschnitzt, auch wenn er im Vergleich zu anderen Spielzeugen in der Werkstatt eher schlicht wirkte. Aber die vielen Details, angefangen bei den Sohlen seiner braunen Schuhe bis hin zu den sanft geschwungenen Augenbrauen, waren so fein, dass die Blaue Fee ihn am liebsten umarmt hätte. Dies war zweifellos Geppettos Meisterwerk.
Seine runden Augen hatten einen gewissen übermütigen Ausdruck und sein unschuldiges Lächeln erinnerte an das von Geppetto. Wäre er ein Mensch gewesen, würde man ihn für den Sohn des Spielzeugmachers halten.
Wenn er ein echter Junge wäre.
Die Blaue Fee atmete tief durch. Es lag nicht in ihrer Macht, einen solchen Wunsch zu erfüllen. Aber sie würde es sich nie vergeben, wenn sie jetzt einfach fortging. Wenn sie den Schmerz dieses einsamen Mannes ignorierte, der anderen Menschen so viel Freude beschert hatte – der sogar noch viel mehr Gutes bewirken könnte, wenn er die Möglichkeit dazu hätte.
Die Fee hatte gelernt, dass es wichtig war, seinem Gewissen zu folgen.
„Guter alter Geppetto“, murmelte sie, „du hast so viele Menschen glücklich gemacht. Du verdienst es, dass dein Wunsch in Erfüllung geht.“
Die Kraft der Magie strömte in ihren Zauberstab und der Stern an seiner Spitze begann zu leuchten. Sie deutete damit auf Pinocchios Federhut. „Kleine Holzpuppe aus Pinienholz, wache auf“, sagte sie.
Ein silberner Lichtstrahl schoss aus der Spitze des Stabs und legte sich um Pinocchios Körper.
„Ich möchte, dass du lebendig wirst“, sagte die Blaue Fee.
Das Licht wurde heller und umfing den gesamten Körper der Puppe. Dann verging es und Pinocchio bewegte sich und setzte sich aus eigener Kraft auf. Er rieb sich die Augen und schaute sich um. Seine Hände zitterten.
„Ich kann mich bewegen“, rief er verwundert aus. Er hielt sich erschrocken eine Hand vor den Mund. Seine großen runden Augen blinzelten erstaunt, als er sich fragte, woher diese Worte gekommen waren. „Ich kann sprechen!“, stellte er schließlich fest.
Die Blaue Fee kicherte, als Pinocchio ungelenk aufstand.
„Ich kann gehen.“ Er machte ein paar tapsige Schritte, bevor er gegen den Tisch taumelte und sich festhalten musste.
„So ist es, Pinocchio“, sagte die Blaue Fee freundlich. „Ich habe dir das Leben geschenkt.“
„Wieso?“
„Weil sich Geppetto heute Nacht einen echten Jungen gewünscht hat.“
„Bin ich denn ein richtiger Junge?“
Die Blaue Fee zögerte kurz. Sie wollte seine Freude nicht dämpfen, aber sie wollte ihn auch nicht belügen. Deshalb wählte sie ihre Worte genau. „Nein, Pinocchio. Ob Geppettos Wunsch Wirklichkeit wird, hängt allein von dir ab.“
„Von mir?“, wiederholte Pinocchio.
„Wenn du brav bist, ehrlich und nicht selbstsüchtig, dann wirst du eines Tages ein echter Junge werden.“
„Ein echter Junge!“
Die Blaue Fee lächelte und bemühte sich, das ungute Gefühl zu ignorieren, das sich in ihrer Brust meldete. Sie brachte es nicht übers Herz, der Holzpuppe die Wahrheit zu sagen, nämlich dass sie nicht in der Lage war, Geppettos Wunsch wirklich zu erfüllen. Pinocchio in einen lebendigen, atmenden Holzjungen zu verwandeln, war nicht einfach gewesen und würde sicherlich Folgen haben. Und um aus Pinocchio einen echten Jungen aus Fleisch und Blut zu machen, würde es noch einiges mehr brauchen. Aber was es auch kosten sollte, sie würde für ihn einstehen. Sie würde ihn auf seiner Reise begleiten.
Ich werde einen Weg finden, dachte sie. Geppetto verdient es, glücklich zu sein. Und Pinocchio verdient es, lebendig zu sein.
Sie schaute sich um und versuchte, die Zweifel zu zerstreuen, die an ihr nagten. Denn sogar mit einem so guten Vater wie Geppetto würde ein Junge aus Holz sich viel Ärger einhandeln. Vor allem wenn er so unerfahren war wie Pinocchio.
Ein Gewissen. Pinocchio brauchte unbedingt ein Gewissen.
Die Blaue Fee schaute sich um und bemerkte die kleine Grille, die ihre Unterhaltung mitgehört hatte. Die Fee mochte Grillen genauso gern wie Tauben.
Pinocchio brauchte jemanden, der ihm half. Warum sollte es nicht eine Grille sein?
Diese hier würde es bestimmt gut machen, dass wusste die Fee sofort. Nach einer freundlichen Begrüßung machte sie Signore Jiminy zum Ritter und verpflichtete ihn dazu, Pinocchios Gewissen zu sein.
Dann wandte sie sich wieder an den Jungen aus Holz. „Nun vergiss nicht, Pinocchio: Sei ein braver Junge und halte dein Gewissen rein, wo du auch bist.“
Die Blaue Fee verließ Geppettos Werkstatt in dem gleichen sanften Lichtstrahl, mit dem sie gekommen war. Pinocchio und die Grille winkten ihr zum Abschied. Noch auf dem Weg nach draußen hörte sie, wie die Grille ihren Schützling vor den Gefahren und Versuchungen der Welt warnte.
Jiminy erklärte Pinocchio, wie er das Gute vom Bösen unterschied, außerdem lehrte er ihn zu pfeifen, damit er ihn zu Hilfe rufen konnte.
Die Blaue Fee freute sich und spürte, wie das unangenehme Gefühl in ihrem Herz verschwand. Pinocchio würde es schon gut machen.
Nun musste sie nur noch einen Weg finden, Geppettos Wunsch vollständig wahr werden zu lassen. Bestimmt hätten ihre Feenschwestern ebenfalls Mitleid mit dem armen Geppetto. Sie wollte so bald wie möglich mit ihnen darüber sprechen, am besten bei ihrer monatlichen Zusammenkunft auf dem Wunschstern.
Sie flog auf das Dach der Werkstatt und gönnte ihrer Feengestalt einen letzten Blick auf das Heim ihres alten Freunds. Sie wusste nicht, ob es ihr möglich war, noch einmal hierher zurückzukehren. Dann wandte sie sich ab und wollte sich schon in Richtung Wunschstern aufschwingen, der bereits blass wurde, da fiel ein Schatten über sie.
„Du gibst also immer noch Versprechen, die du nicht halten kannst“, sagte eine Stimme hämisch. „Manche Dinge ändern sich nie.“
Die Blaue Fee kannte die Stimme sehr gut. Ganz langsam drehte sie sich um und blickte in das höhnische Gesicht der Scharlachroten Fee. Sie wollte etwas zu ihrer Verteidigung sagen, brachte aber kein Wort über die Lippen.
„Du bist sprachlos, wie ich sehe“, sagte die Scharlachrote Fee. Sie hielt einen roten Zauberstab in der Hand und schlug damit gegen das Dach des Hauses. Der runde Rubin an der Spitze funkelte rot wie frisches Blut. „Wir haben uns lange nicht gesehen.“
Ilaria hatte Chiara schon immer gerne aufgezogen. Nun gönnte sie sich den Spaß, sie zu verhöhnen, weil sie sich in Geppettos Werkstatt geschlichen und damit die Regeln des Wunschsterns gebrochen hatte. Schlimmer noch: Sie hatte eine Holzpuppe zum Leben erweckt. Ilaria konnte nun an das schlechte Gewissen ihrer Schwester appellieren und sie leiden lassen – es war ein überaus günstiger Moment, kurz bevor Chiara auf den Wunschstern zurückkehrte, um dort Abbitte für ihren Fehltritt zu leisten. Deshalb sagte Ilaria nun: „Beweise mir, dass dein kleiner Pinocchio drei Tage existieren kann, ohne in Schwierigkeiten zu geraten. Falls ihm sein Gewissen dabei hilft, ein guter Junge zu sein, werde ich dir helfen, ihn in einen echten Jungen zu verwandeln.“
Die Blaue Fee sah auf. „Aber diese Art von Zauberei ist …“
„Gegen die Regeln? Aber nicht unmöglich.“ Ilaria schaute auf die kleine weiße Taube, der sie vor vielen Jahren gemeinsam das Leben geschenkt hatten. Der Anblick des Vogels machte ihr die Leere in ihrer Brust schmerzlich bewusst, aber sie schob dieses Gefühl schnell beiseite. „Gemeinsam können wir das schaffen.“
Die Blaue Fee suchte im Gesicht der Scharlachroten Fee nach Anzeichen für Bedauern oder Reue. Nach irgendeinem Gefühl.
Es war keine Überraschung, dass sie nichts fand.
Sie hob den Kopf. Sie hatte keine Lust, sich von der Scharlachroten Fee maßregeln zu lassen. „Ich habe sehr wohl die Absicht, mein Versprechen an Pinocchio zu halten.“
„Und einen echten Jungen aus ihm zu machen? Wie, bitte schön, soll das denn funktionieren?“
„Er ist ein guter Junge. Und ich bin sicher, dass die anderen Feen das auch so sehen werden. Sie werden mir zustimmen, dass Geppetto es verdient hat, glücklich zu sein, und Pinocchio ein Gewinn für die ganze Welt sein wird. Und sie werden mir bestimmt die Erlaubnis erteilen, Geppettos Wunsch zu erfüllen.“
„Aber was ist, wenn Pinocchio es nicht verdient?“ Die Scharlachrote Fee schaute sie vielsagend an. „Du gehst einfach so davon aus, dass er freundlich, höflich und ehrlich sein wird, aber …“
„Aber was?“
„Aber er ist eine Puppe.“ Die Scharlachrote Fee zupfte an einer Strähne ihrer dunklen Haare, als würde sie an den Fäden einer Marionette ziehen. Dann hielt sie bedeutungsvoll inne. „Er hat kein Herz.“
Mit einem Mal verstand die Blaue Fee, was sie damit sagen wollte, und ihr Herzschlag beschleunigte sich. Sie bekam Angst. „Bitte, du darfst nicht …“
„Eingreifen?“, sagte die Scharlachrote Fee lachend. „Aber das ist meine Pflicht. Meine Verantwortung. Wie eigenartig, dass ausgerechnet du, Chiara, nach all den Jahren deine Verantwortung vergisst. Andererseits bin ich doch nicht überrascht. Denn du bist gar nicht so folgsam, wie du immer getan hast.“
Die Blaue Fee verzog wütend das Gesicht bei dieser Beleidigung und weil sie zu allem Überfluss auch noch mit ihrem Geburtsnamen angesprochen wurde. „Hör mal, das stimmt aber nicht …“
„Wenn deine ach so wohlmeinenden Kolleginnen erst einmal herausgefunden haben, was für ein böser Kerl dein Pinocchio ist, wirst du ihn ganz schnell wieder in einen Haufen aus Holz zurückverwandeln. Das wird den armen Geppetto sehr traurig machen.“
„Untersteh dich!“
Die Scharlachrote Fee verzog die Lippen zu einem Lächeln, das Chiara gut kannte und einmal sehr gemocht hatte, aber jetzt wirkte es zutiefst hinterhältig. Es lag keine Freude darin, keine Wärme. Kein fröhlicher Übermut. Es war so kalt, dass es das Lyre-Meer zum Gefrieren bringen könnte.
In den vergangenen vierzig Jahren hatte sich eine tiefe Kluft zwischen ihnen aufgetan.
Die Blaue Fee schloss die Augen. Die Zeiten, als die Scharlachrote Fee mit ihr gesprochen hatte, ohne etwas Böses zu beabsichtigen, waren lange vorbei. Nun fragte sie ängstlich: „Es sei denn …?“
„Es sei denn, du lässt dich auf eine Wette ein“, sagte die Scharlachrote Fee. „Oder bist du dir zu schade und zu rechtschaffen, um an einer harmlosen kleinen Wette teilzunehmen?“
„Wenn du dir etwas ausdenkst, wird es wohl kaum harmlos und klein sein.“
„Es könnte sehr nützlich für deinen lieben kleinen Pinocchio sein“, sagte die Scharlachrote Fee – und fuhr fort, bevor Chiara etwas entgegnen konnte. „Wenn du gewinnst, werde ich den Feen nichts von deinem Fehltritt heute Nacht erzählen. Und ich werde dir helfen, Pinocchio in einen echten Jungen zu verwandeln.“
Die Blaue Fee schaute sie überrascht an. „Du willst mir tatsächlich helfen?“
„Wenn du gewinnst“, bekräftigte die andere. „Solltest du jedoch verlieren …“
Chiara verfiel in Schweigen. Sie wusste, dass der Preis sehr hoch wäre. Aber sie war in einer Zwickmühle. Wenn sie jetzt losging, um den anderen Feen von diesem Erpressungsversuch zu erzählen, würde die Scharlachrote Fee Pinocchio in eine schlimme Intrige verwickeln, und alle auf dem Wunschstern würden von Chiara verlangen, ihren Zauber aufzuheben. Es konnte sogar bedeuten, dass sie ihren Zauberstab und ihre Flügel verlor und für immer aus dem Kreis der Feen ausgeschlossen wurde.
Warum sind wir bloß so gemein zueinander, hätte sie gern laut gefragt. Wollen wir nicht wieder Freundinnen sein, so wie früher?
Aber sie wusste, was die Scharlachrote Fee darauf antworten würde.
Also ließ sie sich ihre Enttäuschung nicht anmerken, sondern sah ihre Rivalin mit eisigem Blick an. „Also gut, Schwester, dann nenne mir deine Bedingungen.“
Kapitel 1
Vierzig Jahre zuvor
Wen man auch fragte, alle Bewohner von Pariva waren der Meinung, dass Chiara Belmagio das freundlichste und netteste Mädchen in der Stadt war. Vor allem ihre Geduld war legendär. Andererseits, wenn jemand mit einer Schwester wie Ilaria Belmagio aufgewachsen war – der hiesigen Primadonna, was sowohl ihre Stimme als auch ihr Benehmen betraf – und sie immer noch als die beste Freundin ansah, musste dieser Jemand schon beinahe ein Engel sein.
Chiara war gerade achtzehn geworden und hatte vor einem Monat, im Juni, ihren Geburtstag gefeiert. Sie war das mittlere Kind von Anna und Alberto Belmagio, den Inhabern der sehr beliebten und einzigen Bäckerei in Pariva. Kurz gesagt, sie konnte ganz passabel Cembalo spielen, mochte Brombeermarmelade lieber als Schokolade und las gerne Bücher unter dem Zitronenbaum ihrer Eltern, wo sie auch anderen Kindern bei ihren Mathematikhausaufgaben half und Nistkästen für junge Tauben baute.
Wie ihre Nachbarn kannte sie die Namen und Gesichter sämtlicher 387 Einwohner von Pariva. Aber im Gegensatz zu den meisten anderen nahm sie sich die Zeit, alle freundlich zu grüßen, denen sie begegnete, sogar den missgelaunten Herrn Tommaso, bei dem es eine echte Herausforderung war. Und es machte ihr große Freude.
Chiara hörte den Menschen gern zu. Auf diese Weise lernte sie viel über die Träume und Hoffnungen der Bürger der kleinen Stadt. Viele träumten davon, Pariva zu verlassen, um woanders zu Ruhm und Reichtum zu kommen, andere von kühnen oder gar romantischen Abenteuern. Chiara hingegen verspürte nie das Bedürfnis, aus Pariva fortzugehen. Sie sehnte sich nicht nach Dingen wie schönen Kleidern oder Einladungen zu mondänen Festen in Vallan. Was aber nicht hieß, dass sie keine Träume hatte.
Im Vergleich zu denen ihrer Geschwister waren sie bescheiden. Sie wollte keine Opernsängerin werden wie ihre Schwester oder ein Meisterbäcker wie ihr Bruder, der das berühmte Roggenbrot ihrer Eltern gerne dem König serviert hätte. Ihr Traum war einfach lächerlich, jedenfalls hätte ihre Schwester es so gesehen, wenn sie davon gewusst hätte.
Aber Chiara erzählte niemandem von ihrem Traum. Im Gegensatz zu den meisten anderen Bewohnern der Stadt hielt sie nie Ausschau nach Sternschnuppen, um sich etwas zu wünschen. Sie war viel zu praktisch veranlagt, um an Wunder zu glauben, die wahr wurden, wenn man sich etwas wünschte oder mit einem Zauberstab wedelte. Vor allem glaubte sie nicht an Feen und auch nicht an Magie, jedenfalls nicht an solche Zaubereien, wie sie in den Geschichten vorkamen, die ihr Vater ihr und ihren Geschwistern erzählt hatte, als sie noch klein waren – von Feen, die Kürbisse in Kutschen verwandelten, oder Zauberstäben, mit deren Hilfe man aus Steinen Diamanten machte.
Sie glaubte an eine andere Magie. An die, mit der man einen Anfall von Melancholie besiegen, einen hungrigen Magen besänftigen oder ein Herz erwärmen konnte. Sie glaubte an Freundlichkeit, Mitgefühl und daran, dass man sein Glück mit jenen teilen sollte, die es nötig hatten.
Ironischerweise sollte ausgerechnet Chiara Belmagio eines Tages einer Fee begegnen.
Es geschah an einem glühend heißen Tag im August, an dem es sogar für Chiara, die die Sonne liebte, viel zu warm war. Sie war draußen im Garten gewesen, wo sie Veilchen und Glockenblumen pflückte. Sie liebte es, den Kunden der Bäckerei Blumen zu schenken. Das machte die Menschen glücklich.
„Mama und Papa haben einen Boten geschickt“, rief ihr älterer Bruder Niccolo von der Hintertür. Er hatte einen Fuß in den Garten gesetzt, einen auf die Türschwelle und achtete peinlich genau darauf, im Schatten zu bleiben. „Du hast heute frei. Niemand kauft bei dieser Hitze Brot.“
Chiara band die Blumen zu einem Strauß und wischte sich die Hände an ihrer Schürze ab. „Kommen Mama und Papa denn bald nach Hause?“
„Sie gehen noch zu den Brunos, nachdem sie ihre letzten Tramezzini verkauft haben. Ich wette, sie werden dort den ganzen Nachmittag Karten spielen.“ Niccolo drehte sich wieder zur Küche um. „Ich habe Limonade gemacht, aus Orangen und Zitronen. Komm rein, bevor Ilaria sie alleine austrinkt.“
Nach weiteren zehn Minuten in der peinigenden Sonne entschloss sich Chiara, das Angebot ihres Bruders anzunehmen. Sie war vollkommen ausgedorrt. Ihr Kopf und ihre Haut fühlten sich so heiß an, als hätte sie Fieber. Als sie ins Haus trat, zog sie ihren Strohhut ab und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Ihr hellblondes Haar klebte an ihren Schläfen, und das blaue Band, das sie sich immer in ihre Haare band, war völlig durchnässt.
Das versprochene Glas Limonade stand in der Küche bereit. Sie trank es hastig aus und genoss den sauren Geschmack. „Ily?“, rief sie in den Flur. „Nico?“
Hinter der Küche lag das blaue Zimmer, in dem sich ihre Familie außerhalb der Mahlzeiten zusammenfand. Von dort hörte sie ihre Geschwister. Die sechzehnjährige Ilaria versuchte mal wieder, ihren Bruder zu einer Bootsfahrt zu überreden. Chiara blieb vor der Tür stehen, sie wollte nicht stören.
„Sei nicht so gemein, Niccolo. Kannst du nicht einmal ein bisschen Mitleid mit deiner armen Lieblingsschwester haben? Ich will doch nur für eine klitzekleine Stunde raus aufs Meer. Und du fährst doch so gerne mit dem Boot …“
„Ich wüsste nicht, dass ich dich jemals als meine Lieblingsschwester bezeichnet hätte“, entgegnete Niccolo und schlug eine Seite des Buchs um, in dem er gerade las. Die dunkelbraunen Haare fielen ihm ins Gesicht. „Diese Ehre wird Chiara zuteil.“
Ilaria ging nicht auf seinen Spott ein. „Dieses Haus ist ein Backofen. Wenn ich noch länger hierbleiben muss, sterbe ich.“
„Dann geh doch spazieren.“
„Draußen ist es auch nicht besser. Du weißt doch, wie empfindlich meine Haut ist. Ich werde einen Sonnenbrand bekommen. Das Einzige, was hilft, ist frische Seeluft.“
„Frische Seeluft gibt’s nur draußen in der Sonne, Schwester“, sagte Niccolo und vertiefte sich wieder in sein Buch. „Ich hab dir doch gesagt, auf dem Meer ist es gefährlich. Es heißt, ein riesiger Wal sei vor der Küste gesichtet worden. Er hat schon vier Fischerboote zum Kentern gebracht.“
„Riesenwale.“ Ilaria verdrehte die Augen. „Jede Wette, wenn es Meerjungfrauen wären, könntest du es kaum erwarten, die Segel zu setzen. Selbst wenn du Gefahr laufen würdest, wegen ihres Sirenengesangs an einer Klippe zu zerschellen.“
„Da draußen gibt es keine Meerjungfrauen, sondern nur einen Wal.“
„Wie du meinst.“ Ilaria ließ sich gegen die blaue Tapetenwand fallen, den Handrücken gegen die Stirn gelegt. Chia kannte das schon – es war der Beginn eines ihrer dramatischen Schwindelanfälle. Schon im Alter von sieben Jahren – als Ilaria entschied, dass sie eine weltberühmte Opernsängerin werden wollte – begann sie, diese Anfälle zu üben. Inzwischen war sie eine Meisterin darin.
Zu ihrem Pech fiel Nico nicht mehr auf ihre Tricksereien herein.
„Du bringst mich um, Bruder“, stöhnte Ilaria. „Ich werde in dieser Hitze sterben, ich bekomme keine Luft mehr.“
„Nur zu. Normalerweise leidest du an Schwindsucht, Liebeskummer oder Langweile. Dass du an Hitze und Luftmangel zu sterben meinst, ist doch mal was anderes. Singst du uns eine zwanzigminütige Arie, während du dahinscheidest?“
Ily starrte ihn wütend an. „Ich habe den Eindruck, du machst dich über mich lustig.“
„Was du mir ziemlich leicht machst.“
Chiaras Schwester verzog das Gesicht, ihre Beine knickten ein und sie glitt graziös zu Boden. In genau drei Sekunden würde sie als wohlkomponiertes Elendsbündel auf dem von ihrer Großmutter handgeknüpften Teppich landen.
Eins, zählte Chiara.
Ilaria hob theatralisch die Hand und wedelte sich Luft zu.
Zwei.
Ilaria zerrte erschöpft an ihrem Kragen.
Drei.
Ilaria fiel elegant zu Boden. Eine Sekunde später klappte Niccolo sein Buch zu, stand auf und trat lässig neben seine ohnmächtige Schwester. „Nanu, heute keine Arie?“, zog er sie auf.
Als sie keine Antwort gab, ließ er sein Buch flach auf ihren Bauch fallen.
Sofort riss sie empört die Augen auf. „Also hör mal – du hättest mir eine Rippe brechen können!“
„Wohl kaum“, sagte Niccolo trocken und hob sein Buch wieder auf, das klein genug war, um es in die Hosentasche zu stecken. „Du hast uns schon so oft eine Ohnmacht vorgespielt, Ily, glaubst du wirklich, wir fallen noch darauf herein?“
Ilaria stand auf, stolzierte zum Spiegel und richtete ihre Frisur: „Das wird dir sehr leidtun, wenn ich erst berühmt bin.“
„Du bist schon längst berühmt für deine Sterbeszenen, jedenfalls hier im Haus.“
Chiara lachte leise und verriet, dass sie draußen vor dem Zimmer mitgehört hatte. Niccolo schaute zu ihr und sein strenges Gesicht verwandelte sich in ein Lächeln. „Siehst du, sogar Chiara stimmt mir zu. Vielleicht möchte sie deinen sterbenden Schwan ja am Cembalo begleiten.“
Ily hob empört die Arme und wandte sich an ihre Schwester. „Er macht sich immerzu über mich lustig. Wie kann ich nur mit so einem ungehobelten Kerl verwandt sein?“
„Vielleicht solltest du deinen Bruder nicht als ungehobelten Kerl bezeichnen“, warf Chiara ein. „Vor allem wenn du ihn um einen Gefallen bittest.“
„Dann eben einen Ignoranten“, lenkte Ilaria ohne eine Spur von Reue ein. „Chia, ich muss hier raus.“ Ihre großen runden Augen sahen sie flehend an. „Hilfst du mir, bitte?“
Chiara schaute ihre Schwester prüfend an. Wenn man sie nebeneinanderstellte, sahen sie nicht gerade wie Schwestern aus und ihr Temperament war so verschieden wie Tag und Nacht. Chiara war – so wie ihr Name sagte – hell und klar mit sonnenverwöhntem goldenem Haar, das die Farbe von ungekochter Pasta hatte, wie Nico gerne stichelte. Ihr Augen waren so blau wie die Blauhäher, die im Frühling auf den Dächern saßen. Sie war freundlich und geduldig. Das einzig Engelsgleiche an der etwas jüngeren Ilaria war ihre Stimme. Ihr Eigensinn und ihre Durchtriebenheit brachten ihre grünen Augen zum Leuchten. Sie hatte dunkle schokoladenbraune Haare, genau wie ihre Mutter und ihr Bruder. Aber beide Schwestern hatten gemeinsam, dass sich auf ihren Wangen rosige Herzen zeigten, wenn sie fröhlich waren, dass sie ihre Köpfe leicht zur Seite neigten, wenn sie grübelten, und dass sie tief aufseufzten, wenn sie klein beigaben – so wie Chiara jetzt.
Warum denn nicht?, fragte sie sich. Immerhin war die Bäckerei geschlossen und brauchte keine Blumen zur Verzierung und ihre Eltern spielten Karten mit Freunden. Viel wichtiger aber war – es würde Ily glücklich machen. Und Chia liebte es, ihre Schwester glücklich zu sehen. Aber wie sollte sie Niccolo überreden, mit ihnen hinauszufahren?
„Denkt doch nur mal an meine Stimme und an meine Zukunft!“, plapperte Ily weiter. „Es schmerzt mich in der Kehle, wenn ich diese stickige Luft einatme.“
„Riech doch mal hier dran“, sagte Chiara und hielt ihrer Schwester einen kleinen Blumenstrauß unter die Nase, den sie draußen gepflückt hatte. Sie machte einen Knicks. „Bitte schön, für die Primadonna von Pariva.“
„Willst du ihr maßloses Ego auch noch befördern?“, schnaubte Niccolo.
Aber Chiara wusste genau, was sie tat. Während Ily an den Blumen roch, setzte sie sich vor das Cembalo und spielte die Eröffnungsakkorde der Lieblingsarie ihrer Schwester. „Die Nachtigall“. Wie sie sich gedacht hatte, konnte Ilaria nicht anders, als in die Musik einzustimmen. Ohne viel nachzudenken, sang sie die erste Strophe, die von einer Nachtigall handelte, die sich im Wald verirrt hatte und laut zwitschert, um den Weg nach Hause zu finden.
Immer wenn im Haus der Belmagios Musik erklang, wurden alle von ihrem Zauber ergriffen, und sofort verschwand alle Zwietracht zwischen den Geschwistern. Die drei hatten früher viele Nachmittage mit gemeinsamem Musizieren verbracht, dabei hatte Niccolo seine Schwestern auf der Violine begleitet. Als Ily das Lied beendete, hatte Niccolo seinen Ärger längst vergessen und klatschte begeistert. Genau das hatte Chiara beabsichtigt.
Auch sie begann zu applaudieren. „Siehst du?“, sagte sie zu Ily. „Das bisschen Hitze kann einer so kraftvollen Stimme wie deiner überhaupt nichts anhaben. Was bedeutet, dass das Vorsingen eine leichte Übung für dich sein wird.“
Ilaria lächelte. „Aber nur wenn du mich am Cembalo begleitest, Chiara.“
„Ich habe nichts anderes vor. Ich werde dich begleiten, solange du mich brauchst.“ Chiara hielt inne und drehte sich langsam zu Niccolo um, während sie ihre Finger dehnte. „Aber ich muss zugeben, dass mir jetzt auch ein bisschen warm geworden ist.“
Das war nicht gelogen. Das Cembalo stand direkt vor dem Fenster und Chiara hatte beim Spielen in der Sonne gesessen. Sie griff nach ihrem Limonadenglas und trank es leer. „Wenn Niccolo nicht mitkommen will, kann ich das Boot ja hinausfahren, um etwas frisch Luft zu schnappen.“
Ilaria war begeistert. „Du bist eine wahre Heilige.“ Sie umarmte ihre Schwester. „Danke, danke, vielen Dank!“
„Ihr könnt doch nicht allein mit dem Boot rausfahren!“, rief Niccolo.
„Warum nicht? Wenn du nicht mitkommen willst …“
Ihr Bruder verzog das Gesicht und zupfte an seinem Ärmel, was er immer tat, wenn er sich geschlagen gab. „Ich habe Ily doch gerade gesagt, dass ich es für zu gefährlich halte.“
„Etwa wegen des Wals?“, fragte Ily abfällig. „Hast du das bei den Seeleuten im Hafen aufgeschnappt? Glaubst du wirklich, dass da draußen ein riesiges Ungeheuer herumschwimmt, das ganze Häuser verschlucken kann?“
Niccolo zuckte zusammen. „Monstro. Alles, was man über ihn sagt, ist wahr.“
„Dann sollten wir uns dieses Ungeheuer unbedingt einmal anschauen.“ Ilaria wusste besser als alle anderen, wie sie ihren Bruder aus der Reserve locken und provozieren konnte. „Es sei denn … du fürchtest dich.“
„Ich? Mich fürchten?“, stieß Niccolo hervor. Aber so wie seine Schultern sich verkrampften, war das tatsächlich der Fall. „Ich habe doch keine Angst vor einem großen Fisch. Ich habe Angst um meine beiden Schwestern.“
„Du klingst, als wären wir zwei arme Lilien, die in der Sonne welken“, warf Ilaria ihm vor. „Wir sind …“
„Dir sehr dankbar, dass du dich um uns sorgst, Nico“, schaltete Chiara sich ein. „Wie wäre es, wenn wir ein Stündchen rausfahren und dabei dicht am Ufer bleiben? Wenn die Wellen zu stark werden, können wir rasch wieder zurückkommen.“ Sie warf ihrer Schwester einen bedeutungsvollen Blick zu. „Ilaria wird dir sogar beim Rudern helfen.“
Niccolo schaute Ily schief an. „Das glaube ich erst, wenn ich es gesehen habe.“
„Ich verspreche es“, sagte Ilaria und legte eine Hand aufs Herz. „Großes Ehrenwort.“
Niccolo schnaubte abfällig. Aber er war kurz davor einzulenken, das sah Chiara an der Art, wie er den Kopf senkte und überlegte. „Ich schätze, es kann nicht schaden, solange wir in Sichtweite der Küste bleiben“, sagte er langsam. „Ich nehme mein Teleskop mit für den Fall, dass Monstro sich zeigt.“
Ilaria stieß einen Triumphschrei aus und drängte Chiara aus dem Zimmer. „Beeil dich! Hol deinen Hut, Chia. Kannst du auch ein paar Brote einpacken?“
„Und Pistazienkekse?“
Ilaria zwinkerte. „Du kannst meine Gedanken lesen!“
Das lenkte Chiaras Lebensweg in eine andere Richtung. Die Vorsehung hatte sich eingeschaltet und ihr befohlen, mit ihren Geschwistern aufs Meer hinauszufahren.
Diese Entscheidung sollte alles verändern.
Kapitel 2
Geppetto machte die Hitze dafür verantwortlich, dass er nicht mehr klar denken konnte und die Werkstatt mitten am Nachmittag verlassen hatte, um mit dem Boot an der Küste entlangzufahren. Es war gar nicht seine Art, raus aufs Meer zu fahren, vor allem in diesem morschen Kahn, den sein Vater manchmal zum Krebsfischen benutzte.
Immerhin war er nicht der Einzige, der diese verrückte Idee hatte. Am Hafen sah er, wie Niccolo Belmagio das Familienboot losmachte, während seine Schwestern Chiara und Ilaria hineinsprangen.
„Sieht so aus, als wollten sie auch eine Tour machen“, murmelte Geppetto. Wenn er zwanzig Minuten gewartet hätte, hätte er ihnen Hallo sagen können.
Er lachte vor sich hin. „Selbst wenn du das getan hättest“, sagte er sich, „wärst du viel zu schüchtern gewesen, um mit ihnen zu reden. Oder dich gar mit ihnen anzufreunden.“ Oh, Niccolo war immer sehr nett zu ihm. Sie waren gleich alt – neunzehn Jahre – und zusammen zur Schule gegangen. Und es gab kaum ein netteres Mädchen als Chiara. Aber Ilaria … Ilaria wusste womöglich gar nicht, dass er existierte.
Geppettos Lachen erstarb. Er hätte niemals laut zugegeben, nicht einmal vor sich selbst, dass er gerne einmal mit Ilaria gesprochen hätte. Also, eigentlich wollte er ihr zuhören. Ihre Stimme, die so rund und klangvoll war wie die einer großen Sängerin, war für ihn das Schönste, was er auf dieser Welt je gehört hatte. Sie klang wie die süßeste Musik in seinen Ohren. Allein schon wenn er daran dachte, breitete sich ein verlegenes Lächeln auf seinem Gesicht aus. Ohne es zu merken, begann Geppetto, vor sich hin zu summen.
Das Summen füllte die Stille zwischen seinen Ruderbewegungen aus. Irgendwann gab er dem Schmerz in seinen Armmuskeln nach und machte eine Pause, um sich auszuruhen. Er war ein guter Seemann, dank der regelmäßigen Ausflüge aufs Meer, die er vor dem Tod seiner Mutter zusammen mit seinem Vater unternommen hatte. Aber er war kein Abenteurer.
Dass er sich das Krabbenboot ohne Erlaubnis genommen hatte und am helllichten Tag aufs Meer hinausfuhr, obwohl er noch Arbeit zu erledigen hatte, schob er auf die Hitze, die ihm seinen gesunden Menschenverstand vernebelt hatte. Er konnte kaum glauben, was er hier tat. Schon in dem Moment, als er ins Boot gesprungen war, hatte er es bereut.
Aber die Strömung war stark, und als er versuchte zurückzurudern, zog sie ihn in die andere Richtung, hinaus aufs offene Meer. Er schaute zurück und sah, wie seine Heimatstadt immer kleiner wurde.
Geppetto fühlte sich unbehaglich und holte tief Luft. „Ich schätze, ich sollte es einfach genießen“, murmelte er.
Er streckte sich aus, verschränkte die Hände hinter dem Kopf und schaute in den Himmel. Wie unendlich weit sich dieses Blau doch erstreckte. Wann hatte er das letzte Mal Wolken am Himmel gesehen? Er arbeitete Tag und Nacht, denn er war der einzige Geigenbauer von Pariva und musste viele Instrumente reparieren. Die Hände seines Vaters waren mit dem Alter angeschwollen und nun musste Geppetto die Werkstatt am Laufen halten. Und er war pflichtbewusst genug, dies ohne Murren zu tun.
Niemals hätte er sich getraut, etwas dagegen zu sagen.
Genauso wenig hätte er sich getraut, jemandem die Gefühle anzuvertrauen, die er in seinem Herzen trug. Heimliche Träume wie den, der ihn heute hinaus aufs Meer geführt hatte.
„Und das werden sie auch für immer bleiben“, sagte er vor sich hin, während er übers Meer blickte. Eine Welle rollte durch das ansonsten ruhige Wasser. „Träume, die Vater niemals verstehen könnte.“
Weitere Wellen hoben und senkten sich und Geppetto glaubte, in weiter Ferne eine Schwanzflosse zu sehen, die sich in die Höhe hob. Ruckartig richtete er sich auf. Er spürte ein unangenehmes Gefühl in seinem Bauch, eine Angst, die ihm riet, besser zurück zum Ufer zu rudern.
Aber dann frischte der Wind auf und eine Möwe schrie. Er merkte, wie dumm er doch war, wenn er sich dadurch diesen perfekten Tag verderben ließ.
„Das ist bestimmt nur ein Seehund“, sagte er lachend vor sich hin. „Sei nicht so ein Feigling, Geppetto.“
Seufzend griff er nach dem Bleistift, den er sich hinters Ohr geklemmt hatte, und nahm sich sein Skizzenbuch vor. Er hatte vielleicht nicht den Mut, seinem Vater von seinen Träumen zu erzählen, aber er würde bestimmt nicht vor einem Seehund Reißaus nehmen. Leise vor sich hin summend, blätterte er durch das Buch und schaute sich seine Zeichnungen an: einen Vater, der mit seinem Sohn den Monte Cecilia bestieg; eine alte Frau, die die Tauben am Brunnen auf dem großen Platz in Pariva fütterte; ein junges Paar, das am Abend vor dem Glockenturm spazieren ging. Als er eine leere Seite gefunden hatte, zeichnete er flink und geübt die Schwanzflosse des Seehunds, die er gerade gesehen hatte. Dann wartete er ab, ob er noch mehr davon sehen würde, während die Wellen immer größer und bewegter wurden.
Alles schien perfekt zu sein.
Doch dann hob etwas das Boot nach oben und das Meer wurde so schwarz wie die Nacht. Geppetto hörte auf zu summen, aber es war schon zu spät.
Zwei zornige grüne Augen erhoben sich aus dem Meer.
Und Geppetto sah sich von Angesicht zu Angesicht Monstro gegenüber.
Kapitel 3
Na schön“, lenkte Niccolo ein, als die Belmagio-Geschwister draußen auf dem Meer waren. „Ich muss zugeben, das war eine gute Idee.“
„Hab ich es nicht gleich gesagt?“, meinte Ilaria, die Niccolos Kompliment genauso genoss wie die frische Brise, die aufgekommen war. Sie zog das rote Band auf, das ihren Pferdeschanz zusammengehalten hatte, und ließ die Haare im Wind flattern. „So sollte man den Sommer verbringen. Das ist viel besser, als in Signora Tappas Laden herumzustehen und Hüte an alte verstaubte Damen zu verhökern. Oder mit Mama Pistazien direkt neben dem Ofen zu hacken. Warum bist du so still, Chiara?“
Chiara lächelte. „Ich genieße die Aussicht.“
Und die war in der Tat wundervoll. Im Norden waren die Berge zu sehen, klar und deutlich, darunter der Monte Cecilia mit seiner schneebedeckten Kuppe, die man kaum von den Wolken unterscheiden konnte. Im Süden wiederum erstreckte sich das blaue Meer ins Unendliche. Das Wetter war perfekt, denn nun wurde die Hitze von einer sanften Brise gemildert, die über das Wasser strich, und das grelle Licht der Sonne von den Schatten der Berge gedämpft.
„Wir hätten Karten mitnehmen sollen“, beklagte sich Ilaria, die keine zwei Minuten still sitzen konnte. Sie griff nach Nicos Teleskop. „Wollen wir ein Spiel spielen? Jeder darf eine Minute durch das Fernrohr schauen, wir machen zwei Runden. Wer den größten Fisch entdeckt, hat gewonnen. Die Verlierer müssen einmal ums Boot schwimmen, einverstanden?“
„Ich glaube nicht, dass du in diesem Kleid ins Wasser springen willst“, gab Niccolo zurück. „Abgesehen davon ist dein Kopf so hohl, dass er davontreiben könnte – und was wäre dann?“
Ily gab ihrem Bruder einen Stoß mit dem Ellenbogen.
Nico hätte beinahe das Ruder fallen gelassen. „He!“
„Lustig wäre es schon“, meinte Chiara nachdenklich. „Wir können ja auf Gewinner und Verlierer verzichten, in Ordnung?“ Sie nahm ihrer Schwester das Teleskop ab, richtete es aufs Wasser und betrachtete die Wellenbewegungen. Eigenartig, sie gingen immer höher und das Wasser wurde immer dunkler. Sie kniff die Augen zusammen, um genauer hinzuschauen, dann folgte sie den Wellen bis zur Krümmung am Horizont. Am Rand ihres Sichtfelds hob sich eine riesige schwarze Schwanzflosse aus dem Wasser.
Sie schnappte nach Luft und sprang auf. „Ein Wal!“, schrie sie aufgeregt.
„Man kann nicht immer gewinnen“, nörgelte Ily, die nicht begriffen hatte, in welcher Gefahr sie schwebten.
Aber Niccolo riss erschrocken die Augen auf, schnappte sich das Teleskop und schaute hindurch. „Um Himmels willen, es ist das Ungeheuer!“
„Lasst mich auch mal sehen“, sagte Ilaria und griff nach dem Fernrohr. Sie hatte noch nicht zu Ende gesprochen, da tauchte Monstro erneut auf und schlug mit der Schwanzflosse aufs Meer wie mit einer gigantischen Peitsche. Als er wieder untertauchte, rollten so hohe Wellen über das Meer, dass sogar die Belmagio-Geschwister spürten, über welche Kräfte dieses Ungeheuer verfügte.
„Habt ihr jemals so ein Riesentier gesehen?“, fragte Niccolo aufgeregt. „Die Schwanzflosse allein ist schon größer als wir drei zusammen.“
„Wir müssen es uns näher anschauen“, drängte Ilaria.
„Hältst du das für eine gute Idee?“, fragte Chiara und hielt sich den Strohhut fest, weil plötzlich ein starker Wind aufgekommen war.
„Wir werden nie wieder eine solche Gelegenheit haben“, sagte Ily und wollte damit Niccolo anstacheln. „Kommt schon, nur noch ein bisschen näher. Wir sind doch meilenweit von ihm entfernt, so wie es aussieht.“
Sie musste ihren Bruder nicht länger überzeugen. Er hatte schon begonnen, das Boot in Richtung des Monsters zu rudern.
„Wir bewegen uns gefährlich weit von der Küste weg“, warnte Chiara. „Denkt daran, was die Seeleute sich erzählen. Monstro ist …“
Bevor sie den Satz beenden konnte, flaute der Wind ab. Die Wellen glätteten sich und das Wasser war wieder so still wie zuvor.
Zu still.
„Er ist weg“, sagte Ilaria und sprang auf, um in die Ferne zu spähen. Der Wal war nirgendwo zu sehen. Frustriert schlug sie gegen die Bootswand. „Da siehst du, was du angerichtet hast, Chia. Jetzt ist er verschwunden!“ Sie verlor die Balance und ließ sich stöhnend auf ihren Sitz fallen. „Alles umsonst. Und jetzt werde ich auch noch seekrank!“
„Entspann dich“, sagte Chiara und rutschte zur Seite, damit ihre Schwester die Beine ausstrecken konnte. Ily legte sich hin und ließ einen Arm über den Rand des Boots baumeln. Das Wasser war wieder so blau wie vorher, als wäre nichts geschehen. Sogar blauer als der Himmel und die Kornblumen und die Veilchen, die Signora Vaci in ihrem Laden verkaufte. Es war Chiaras Lieblingsfarbe.
Chiara tunkte die Hand ins Wasser und ließ sie knapp unter der Oberfläche gleiten, während Niccolo sich kurz vom Rudern ausruhte. Es war immer noch warm, aber die Luft hatte sich abgekühlt. Die kleinen Wellen, die sie verursachte, waren schwarz, genauso schwarz wie das dunkle Wasser eben gerade. War sie die Einzige, die das bemerkte?
Die Haare in ihrem Nacken stellten sich auf und ihr Magen begann zu rumoren. Etwas stimmte nicht. Etwas Böses lag in der Luft – und auch im Wasser. Sie wusste nicht, wie sie darauf kam, aber sie spürte es deutlich. Sie griff nach dem Teleskop und suchte den Horizont ab.
Weit links von ihnen trieben die Überreste eines kleinen Boots vorbei. Holzplanken, ein Fischernetz und ein einzelnes weißes Segel.
Und mitten in diesem Treibgut winkten zwei menschliche Arme und jemand schrie: „Hilfe! Hilfe!“
Chiara schnappte nach Luft. „Da draußen ist jemand!“
„Da draußen ist jemand?“, wiederholte Ilaria. „Ich kann aber niemanden sehen.“
Aber Chiara hörte gar nicht hin. In Windeseile zog sie die Schuhe aus. Jede Sekunde konnte über Leben und Tod entscheiden, sie durfte keine Zeit verlieren. Ihre Knie wurden weich, als sie die mächtigen Wellen bemerkte, die näher kamen und sich mit ohrenbetäubendem Getöse brachen. Und da war es wieder, dieses kalte Ziehen in ihrem Bauch.
Gefahr. Zorn. Angst.
Sie hätte darauf hören sollen, aber Chiara spürte noch etwas anderes jenseits des drohenden Unheils, das sich unter der Meeresoberfläche zusammenbraute. Ihr Herz hatte schon immer besonders sensibel reagiert, wenn jemand in Bedrängnis geriet, und das, was sie jetzt spürte, war ihr nur allzu bekannt.
Hoffnung. Ein banges Gefühl, ganz schwach, ein letztes Aufflackern wie eine Kerze im Wind. Noch kämpfte sie dagegen an, aber es würde nicht mehr lange dauern, bis sie erlosch.
Ich komme, dachte Chiara entschlossen.
Und dann sprang sie vom Boot ins Meer.
Kapitel 4
Das Wasser hatte die perfekte Temperatur für ein Bad. Aber das war nun wirklich das Letzte, woran was Chiara dachte, als sie losschwamm. Sie musste gegen die Strömung ankämpfen, die sie wieder zurück zum Boot drängte, also verdoppelte sie ihre Kraft und ignorierte die Rufe, die hinter ihr ertönten.
„Chia, komm zurück!“
„Chia!“
Das Rauschen der Wellen und des Winds erstickten die Schreie von Nico und Ily und schon bald war Chiara ganz allein. Niemals zuvor war die Welt so still und gleichzeitig so brüllend laut gewesen. Die Brandung dröhnte in ihren Ohren und inmitten dieses Lärms konnte sie noch ihr Herz hören, das lauter schlug als je zuvor, während ihr Atem immer flacher wurde.
Ein Stück Holz trieb in rasender Geschwindigkeit an ihr vorbei, beinahe wäre es gegen ihren Kopf gestoßen. Chiara konnte im letzten Moment ausweichen.
Schwimm zurück, verlangte ihr Körper. Wenn sie weitermachte, riskierte sie, dass eine Welle sie nach unten drückte und ertränkte.
„Hilfe!“, schrie der junge Mann erneut. „Hilfe!“
Es kann sein, dass du sterben musst, schoss es Chiara durch den Kopf, aber es kann genauso gut sein, dass du ihn rettest. Wenn du jetzt aufgibst, hat der arme Junge keine Chance. Dann droht ihm der sichere Tod.
Mehr Gründe waren nicht nötig. Sie schob alle Ängste beiseite und legte alle Kraft in ihre Schwimmzüge. Das salzige Wasser brannte in ihren Augen, ergoss sich mit erstickender Wucht in ihre Kehle, drang durch die Nase wieder heraus. Ihr ganzer Körper schmerzte, aber Chiara hatte nur einen Gedanken.
Schneller. Sie musste schneller schwimmen.
Du musst einen gleichmäßigen Rhythmus finden, sagte sie sich. Und du darfst nicht in Panik geraten.
Aber sie war nur ein menschliches Wesen. Und das Meer war eine ungeheure, unbändige Macht. Bald schon merkte sie, dass sie nicht länger gegen die Wellen ankämpfen konnte. Bei jedem Zug nach vorn wurde sie von der Brandung fünf Züge zurückgeworfen. Sie entfernte sich immer mehr von ihm und konnte sich selbst kaum noch über der Oberfläche halten.
Chiaras Sicht trübte sich, zu heftig brandeten die Wellen ihr ins Gesicht. Immer wieder schlossen sich ihre Augen instinktiv und sie konnte überhaupt nichts mehr erkennen. Immerhin arbeiteten ihre Beine weiterhin, aber ihre Muskeln brannten wie Feuer und sie hatte fast alle Kräfte aufgebraucht.
Hierher, hörte sie mit einem Mal eine Stimme. Es war nicht ihre eigene, sondern eine weibliche Stimme, die sie nicht kannte. Nur noch ein kleines bisschen mehr. Du schaffst es, Chiara Belmagio. Kämpfe weiter.
Die Stimme klang wie die einer Freundin. Chiara vertraute ihr und die Intensität dieser Stimme gab ihr die Kraft, die Augen wieder zu öffnen. Das Sonnenlicht tauchte alles in einen hellen Glanz und sie konnte wieder besser sehen. Noch einmal blinzeln und dann sah sie auch ihn.
Den jungen Mann, der um Hilfe gerufen hatte. Er war bewusstlos und umklammerte kraftlos die Planke, die ihn trug.
Mit ihrer restlichen verbliebenen Kraft schwamm Chiara weiter, bis sie ihn erreicht hatte.
Es war ein Junge aus ihrer Stadt, das erkannte sie sofort. Der Sohn des Geigenbauers. Sie sah ihn nicht sehr oft auf dem großen Platz, aber wenn sie nicht so erschöpft gewesen wäre, hätte sie sich an seinen Namen erinnert.
Sie strengte sich an, seinen Kopf über dem Wasser zu halten. Sein Schnurrbart war nass, seine Haut so kalt, dass sie kaum noch Leben darunter vermutete. „Bleib bei mir“, sagte sie heiser. „Dann wird alles gut.“
Es klang wie eine Lüge, auch wenn sie es so nicht gemeint hatte.
Was nun?, fragte sie sich verzweifelt. Sie konnte ihn nicht schwimmend zu Niccolos Boot bringen. Selbst wenn sie die Kraft dazu hätte, wäre es falsch gewesen. Sie wusste, dass ihre Geschwister nach ihr suchten, und durfte nicht riskieren, dass sie in die falsche Richtung schwamm. Aber es gab auch keine Möglichkeit, den Ertrunkenen wiederzubeleben, solange sie hier im Meer schwammen, nur eine schreckliche Wellenlänge vom Tod entfernt.
Die Sekunden vergingen, jede schien ein Jahrhundert lang zu sein. Jetzt, wo sie nicht mehr schwamm, fühlte sich das Wasser deutlich kälter an als zuvor. Chiaras Zähne klapperten unkontrolliert. Ihr war heiß und kalt zugleich, ihre Muskeln schmerzten erbärmlich, wenn sie auf der Stelle trat, um nicht unterzugehen.
Konzentriere dich, sagte sie zu sich selbst, während sie sich aus dem Wasser reckte und nach Hilfe rief.
Sie wäre beinahe in Tränen ausgebrochen, als sie Niccolo und Ilaria sah. Ihre Schwester ruderte zum ersten Mal in ihrem Leben – was sehr gut daran zu erkennen war, dass sie beinahe das Ruder verloren hätte, als sie nahe genug gekommen war und das Boot stoppte.
„N…n…nehmt ihn z…zuerst“, brachte Chia schlotternd hervor und schob den Sohn des Geigenbauers in die ausgestreckten Arme von Niccolo.
Sie wartete, bis er sicher an Bord war, bevor sie sich von den ausgestreckten Armen ihrer Schwester packen ließ.
„Tu das nie wieder!“, schrie Ily schluchzend und umarmte sie heftig. „Ich dachte, du stirbst.“
„V …v …vorsichtig“, versuchte Chiara es scherzhaft, aber es brach eher wie ein schreckliches Husten aus ihr hervor. „d …du m …machst dir noch dein sch …schönes Kl …Kleid nass.“
„Immerhin lebst du noch und kannst mir helfen, es zu waschen.“
Chiara hätte gelacht, wenn sie gekonnt hätte, aber sie war viel zu erschöpft. Sie ließ sich ins Boot fallen und war kaum noch in der Lage, sich zu bewegen. Sie zitterte und ihre Zähne klapperten laut.
„Trink ein bisschen Wasser“, drängte Ily. „Hier, nimm mein …“
„Gib es … ihm“, ächzte Chiara und deutete auf den Sohn des Geigenbauers. Niccolo drückte fleißig auf den Brustkorb des jungen Mannes, aber es schien vergeblich.
Ilaria drehte sich um. Den beinahe ertrunkenen jungen Mann hatte sie völlig vergessen. „Er ist noch gar nicht bei Bewusstsein. Nico kümmert sich um ihn. Ich bleibe bei dir.“
Chiara musste husten. „Ily …“
„Schon gut, schon gut.“ Ilaria beugte sich über den Sohn des Geigenbauers, packte sein Kinn und schob seinen Schnurbart beiseite. „He, stirb jetzt bloß nicht, während ich zuschaue, ja? Solche Geschichten mag ich nicht hören, schon gar nicht aus dem Mund von Nico und Chiara.“
Als sie mit dem frischen Wasser seine Lippen benetzte, flatterten die Augenlider des jungen Mannes. „Meine Güte“, murmelte er noch halb ohnmächtig. „Eine Fee! Die schönste Fee, die ich je gesehen habe!“
Ilaria kicherte und warf ihrer Schwester einen Blick zu. „Der gefällt mir. Sogar halb tot weiß er wahre Schönheit zu schätzen.“
Der junge Mann kam wieder zu sich und sah sich um. „Oh weh!“, rief er aus und richtete sich auf. Sein Körper war noch nicht so weit wie sein Geist. Daher war er noch nicht in der Lage, sich aufzusetzen – und bekam einen Hustenanfall.
Er prustete und zuckte und das Meerwasser spritzte von seiner Kleidung auf Ilys Kleid.
„Vorsicht!“, schrie sie und hielt die äußere Schicht ihres Kleids in die Sonne. „Das bekommt sonst Falten.“
Niccolo zog sie weg und hielt den jungen Mann fest, der über Bord zu gehen drohte. „Langsam, langsam“, sagte er. „Ganz ruhig atmen.“
„Hier, trink noch etwas.“ Chiara hielt ihm ihre Flasche hin. Sie setzte sich neben den jungen Mann und umfasste seine Hand. Zum Glück war es ein warmer Tag. Die Sonne bewirkte, dass seine Wangen wieder Farbe bekamen.
„Vielen Dank“, sagte er und bemühte sich, ruhig zu atmen. „Vielen Dank.“
„Du bist doch der Sohn vom alten Tommaso“, stellte Niccolo schließlich fest. „Geppetto.“
„Ja, ja, der bin ich“, sagte Geppetto benommen. „Und wer seid ihr?“ Er schaute verkniffen zu Nico hin und seine Hand bewegte sich Richtung Nase, wo die Brille, die er nicht mehr trug, zwei rote Druckstellen hinterlassen hatte. Er beugte sich vor und suchte im Boot danach. „Ohne meine Brille kann ich nichts sehen. Aber ich hab sie wohl verloren.“
„Die hast du ganz bestimmt verloren“, erwiderte Niccolo lachend. „Du bist beinahe ertrunken. Wie gut, dass wir dich und nicht deine Brille herausgefischt haben, meinst du nicht?“
„Niccolo Belmagio!“, rief Geppetto, als er ihn endlich erkannte. „Ich dachte mir doch, dass ich dich in ein Boot steigen sah. Ein Glück, dass du mich bemerkt hast. Ich stehe tief in deiner Schuld.“
„Bedanke dich bei meiner Schwester, nicht bei mir. Chia hat dich gerettet.“
Geppetto wandte sich an sie und senkte den Kopf so tief, als wollte er sich verbeugen. „Ich danke dir, Chiara. Ohne dich wäre ich …“
„Sag bitte einfach Chia zu mir. Das tun alle meine Freunde“, sagte sie.
„Chia“, wiederholte Geppetto. In diesem Moment wurde das Boot von einer hohen Woge erfasst, und Geppetto, der sich mühsam aufgerichtet hatte, kippte wieder um. Er versuchte, die Balance zu halten, und packte dabei Ilarias Arm, den er sofort wieder losließ.
„Es tut mir furchtbar leid, Signorina Ilaria.“ Er hob die Hand nach einem Hut, den er gar nicht mehr aufhatte, und wiederholte: „Furchtbar leid.“
„Davon wird mein Kleid auch nicht wieder trocken“, beklagte sich Ilaria.
„Wir retten jemandem das Leben und du sorgst dich nur um dein Kleid.“ Niccolo schüttelte tadelnd den Kopf. „Und Geppetto hält dich auch noch für eine Fee. Ohne Brille ist er wirklich blind.“
„Sei still!“ Ilaria gab ihrem Bruder einen Klaps auf den Arm. „Er hat gesagt, ich sei eine Fee, weil er mich schön findet.“ Sie beugte sich zu Geppetto und klimperte mit den Augenlidern. „Das meintest du doch, oder?“
„Nun, also … ich …“ Geppetto blickte verlegen nach unten. „Äh, ja, Signorina Ilaria.“
„Siehst du?“ Ilaria neigte triumphierend den Kopf. „Aber wo ich jetzt darüber nachdenke, fällt mir auf, dass ich ihm noch gar nicht meinen Namen genannt habe.“
Das stimmte und Chiara unterdrückte ein Lächeln. Die Gesichtsfarbe des jungen Geppetto verwandelte sich von seekranker Blässe in knalliges Rot.
Ein warmes Gefühl erglomm in Chiaras Herz. Er mag sie, dachte sie.
Das warme Gefühl breitete sich immer weiter aus. Sie kannte es schon, auch wenn sie nicht genau sagen konnte, was es war. Aber immer wenn sie es spürte, passierten schöne Dinge. Die Rettung von Geppetto zum Beispiel. Und in diesem Moment sagte es ihr, dass der junge Mann und Ilaria wunderbar zusammenpassten.
Sie sind wie füreinander geschaffen, dachte Chiara. Andererseits lebte Ilaria schon seit ihrer frühesten Kindheit in Pariva und hatte Geppetto bis zum heutigen Tag überhaupt noch nicht bemerkt.
Ich muss dafür sorgen, dass sich das ändert.
„Pariva ist eine kleine Stadt“, sagte Chia eifrig. „Und du solltest dich bei Ily bedanken, Geppetto. Es war nämlich ihre Idee, mit dem Boot hinauszufahren. Wären wir nicht darauf eingegangen, hätten wir dich nicht bemerkt.“
„Ich danke dir vielmals“, sagte Geppetto zu Ilaria. „Und es tut mir leid, dass ich dein Kleid nass gemacht habe.“
„Ich wollte es bei meinem Vorsingen in Nerio anziehen“, sagte Ilaria geziert und verschränkte die Arme, um so zu tun, als sei sie verärgert. „Jetzt muss ich es noch einmal bügeln.“
Niccolo verdrehte die Augen. „Wenn du wusstest, dass du das Kleid dort tragen willst, warum hast du es dann für diesen Ausflug aufs Meer angezogen?“
„Willst du etwa behaupten, dass ich lüge?“
„Das wäre ja nichts Neues.“
„Du bist ein …“
„Ily“, unterbrach Chiara sie. „Ich helfe dir, das Kleid zu bügeln. Für dein Vorsingen wird es wieder wie neu sein.“
Mit einem triumphierenden Blick ließ Ilaria sich neben ihrer Schwester auf den Sitz fallen. „Das will ich doch hoffen.“
„Es tut mir so leid“, wiederholte Geppetto und sah aus, als beunruhigte ihn Ilarias nasses Kleid weitaus mehr als die Tatsache, dass er beinahe ertrunken wäre. „Wenn ich es mir leisten könnte, würde ich dir ein neues Kleid kaufen. Du hast eine so wundervolle Stimme, ich würde mir nie verzeihen, wenn ich verhindert hätte, dass du deinen Weg einschlägst zu … zu …“
„Zu meiner ruhmreichen Karriere als Primadonna von Esperia“, beendete Ilaria den Satz für ihn. Sie beugte sich interessiert zu ihm hin. „Du hast mich also singen gehört?“
„Ein paarmal im letzten Sommer“, bekannte er. „Das Haus von Signorina Rocco liegt neben der Werkstatt meines Vaters.“
Ily schnappte nach Luft. „Du hast meine Gesangsstunden belauscht?“
„Ich konnte nicht anders“, sagte Geppetto verlegen. „Ich liebe die Oper.“
„Wirklich?“ Jetzt leuchtete Ilarias Gesicht auf und sie streckte Niccolo die Zunge heraus. „Siehst du? Es gibt doch Menschen, die die Oper lieben.“
Niccolo verdrehte die Augen und ruderte weiter.
Hastig griff Geppetto nach einem Ruder, um mitzuhelfen. Als er es ins Wasser tauchte, fragte er Ilaria: „Wirst du in diesem Sommer für die Menschen in Pariva singen?“
„Wohl kaum“, antwortete sie und versuchte, die Falten in ihrem Kleid zu glätten, bevor sie die Hände in den Schoß legte und verschränkte. „Mama behauptet, es sei nicht damenhaft, auf der Straße zu singen. Und seit die Taverne eröffnet hat, hält sie es für zu gefährlich.“