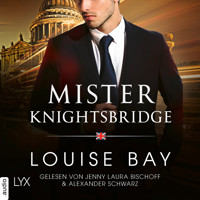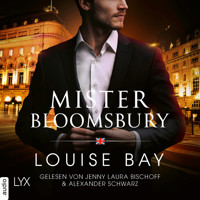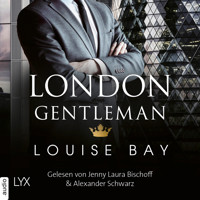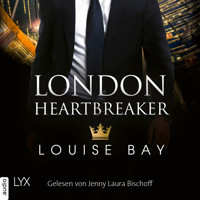9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Doctor
- Sprache: Deutsch
Wenn sich dein One-Night-Stand als dein neuer Boss herausstellt ...
Jahrelang hat Sutton Scott darauf hingearbeitet und ihr Privatleben hintangestellt, jetzt ist es endlich so weit: Sie tritt ihren ersten Job nach dem Medizinstudium am Royal Free Hospital in London an. Doch an ihrem ersten Arbeitstag stellt sich ihr Boss als kein anderer als Dr. Jacob Cove heraus - ihr letztes Blind Date und heißer One-Night-Stand! Der Kardiologe ist der Frauenschwarm des Krankenhauses: sexy, charmant und absolut tabu. Um ihre Karrieren nicht zu gefährden, versuchen beide auf Abstand zu gehen, aber Sutton bekommt die gemeinsame Nacht einfach nicht aus dem Kopf. Und bei jedem Schichtdienst und jeder zufälligen Berührung beginnt ihr Herz gefährlich schnell zu schlagen ...
»Ich liebe dieses Buch! Es gibt nichts Besseres als eine verbotene Romanze, bei der die Anziehungskraft zwischen zwei Menschen stark genug ist, um alle Hindernisse zu überwinden.« MICHELLE_READS_ROMANCE
Der Auftakt der DOCTOR-Reihe von SPIEGEL-Bestseller-Autorin Louise Bay
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 388
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
INHALT
Titel
Zu diesem Buch
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
Epilog
Die Autorin
Die Romane von Louise Bay bei LYX
Leseprobe
Impressum
LOUISE BAY
Doctor Off Limits
Roman
Ins Deutsche übertragen von Wanda Martin
ZU DIESEM BUCH
Sutton Scott hat hart für ihr Medizinstudium arbeiten müssen und jahrelang ihr Privat- und Liebesleben hintangestellt. Deshalb überredet ihre beste Freundin sie zu einem Blind Date – ein bisschen Spaß haben, bevor sie den stressigen Job als angehende Ärztin im Royal Free Hospital in London antritt. Sutton ist zunächst skeptisch, aber positiv überrascht, als sich ihr Date als überaus sexy, witzig und charmant herausstellt. Die beiden verbringen eine leidenschaftliche Nacht miteinander und Sutton bedauert, dass sie es bei diesem einen Mal belassen müssen, denn sie will sich voll und ganz auf ihren neuen Job konzentrieren. Voller Elan erscheint sie an ihrem ersten Arbeitstag im Krankenhaus – und trifft dort prompt auf ihren heißen One-Night-Stand! Dr. Jacob Cove ist nicht nur der Frauenschwarm des Krankenhauses, sondern auch ihr Boss. Eine Beziehung zwischen ihnen ist absolut tabu. Um ihre Karrieren nicht zu gefährden, versuchen die beiden auf Abstand zu gehen, aber Sutton bekommt die gemeinsame Nacht einfach nicht aus dem Kopf. Und bei jedem Schichtdienst und jeder zufälligen Berührung beginnt ihr Herz gefährlich schnell zu schlagen …
1. KAPITEL
SUTTON
In nur fünf Tagen würde ich in einem der renommiertesten Krankenhäuser Londons anfangen und auf den Titel hören, den ich mir hart erarbeitet hatte: Dr. Scott. Der Gedanke würde höchstwahrscheinlich früher oder später dafür sorgen, dass ich mit einer Panikattacke selbst in eine Klinik eingeliefert wurde.
»Und, wie steht’s?«, fragte Parker mich.
»Nicht gut.« Ich zuckte wegen des straffen Gurts um mein Kinn zusammen. Als ich an der Schnalle meines Helms fummelte, fing das Gurtzeug, das ich gerade umgeschnallt bekommen hatte, augenblicklich an, mir in die Oberschenkel zu schneiden. Normalerweise wäre es eine willkommene Abwechslung von der Paukerei am Schreibtisch, in der Natur zu sein, umgeben von hochhaushohen Bäumen, an so frischer Luft, wie sie in London nur sein konnte. Doch nicht heute. Wie ich so die kreuz und quer zwischen die Bäume gespannten Seile betrachtete und die sogenannten Brücken dazwischen, die ich überqueren sollte, befand ich, dass ich auf derartige Abwechslung verzichten konnte. »Die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Panikattacke kriege, ist gerade auf zweiundneunzig Prozent gestiegen.«
»Aber gestern waren wir doch auf vierzig runter«, sagte Parker in einem Tonfall wie eine Teenagerin, die gesagt bekam, dass sie um neun zu Hause zu sein hatte.
»Gestern ging es auch um einen Bus mit offenem Oberdeck, einen übermotivierten Tourguide, mit einer Faszination für den Großen Brand von London, und um Mimosa-Cocktails. Heute befinden wir uns in ganz anderen Gefilden. In jeglicher Hinsicht.«
Meine beste Freundin kannte meine Ängste bezüglich des Berufsstarts im Krankenhaus nur zu gut. Sie hatte meine Studienjahre miterlebt. Die langen Arbeitstage, auf die noch längere Nachtschichten folgten. Mein nicht vorhandenes, den Studiengöttern geopfertes Sozialleben. Meine Angewohnheit, kleine Stoßgebete zum Himmel zu schicken, dass meine Kunden ihren Friseurtermin absagen mögen, damit ich eine zusätzliche Dreiviertelstunde Lernzeit einschieben konnte. Über die Jahre waren genügend meiner Gebete erhört worden, sodass ich alle Abschnitte meines Wegs zur Ärztin geschafft hatte. Mein neuer Beruf war ein langersehntes Ziel, der Gipfelpunkt jeder Sekunde harter Arbeit, die ich in den vergangenen sieben Jahren investiert hatte.
»Ich dachte, ein Hochseilgarten wäre die höchste Form der Ablenkung«, wendete Parker ein. »Das Wortspiel war Absicht.«
»Nicht von meinem bevorstehenden Tod, nein.«
»Schätze, das hatte ich nicht bedacht. Soll ich vorgehen?«
Ich schüttelte den Kopf. Mir war es immer lieber, nicht zu wissen, wie schwierig etwas werden würde, sonst lief man nur Gefahr zu kneifen, ehe man es auch bloß versucht hatte. Hätte ich damals, als ich noch Haare schnitt und mich sechs Tage die Woche über die Urlaube anderer Leute unterhielt, gewusst, was das Medizinstudium mir abverlangen würde, hätte ich mich nie um einen Platz beworben. Seitdem war es jahrelang mehr als schwer gewesen, aber hätte ich gewusst, wie schwer es werden würde, dann hätte ich schon tausendmal vorher aufgegeben. Naivität und blinder Ehrgeiz waren eine starke Kombination.
Einer der Einweiser hängte mein Gurtzeug in das in sich eingedrehte Drahtseil ein und führte mich nach vorn. »Weiter geht’s. Pfeile geben Ihnen die Richtung vor, und in regelmäßigen Abständen entlang des Parcours stehen weitere Helfer.«
»Sind Sie etwa alle für den Fall schwarz angezogen, dass wir aus fünfzig Metern abstürzen und sterben? Damit Sie dann nicht aussehen, als wollten Sie gleich Party machen?«, fragte ich.
Er verengte die Augen. »Wow, Sie sind ’ne ziemliche Optimistin, was?«
»War nur eine Frage«, erwiderte ich.
»Wir sind schwarz angezogen, damit niemand durch knallige Farben abgelenkt wird.«
»Klar doch«, sagte ich wenig überzeugt.
»Außerdem ist in diesem Kletterparcours niemand gestorben«, setzte er hinzu.
Der Elefant auf meiner Brust beschloss, aufzustehen und spazieren zu gehen. »Keine Todesfälle« war zwar ein ziemlich geringer Sicherheitsanspruch, aber ich nahm, was ich kriegen konnte.
»Heute jedenfalls nicht.« Mit einem leichten Schubs beförderte er mich von der Plattform, auf der wir standen, auf die erste »Brücke« zum nächsten Baum. Bei dieser sogenannten Brücke handelte es sich um eine Reihe von Holzplanken in ungefähr fünfzig Zentimeter Abstand zueinander, die mit im Wind klirrenden Ketten verbunden waren. Ein fantasievollerer Mensch würde vielleicht sagen, es höre sich an, als wären wir im Reich der Feen. Ich hingegen wusste, dass es sich wahrscheinlich um eine gefakte Geräuschkulisse vom Band handelte, die nur abgespielt wurde, um die Schreie zu übertönen.
Ich setzte einen Schritt auf die erste Planke und griff nach den waagerecht gespannten Drahtseilen zu beiden Seiten meines Kopfs.
»Wusstest du schon vor all den Jahren, als du damals überlegt hast, Medizin zu studieren, dass du es einmal so weit bringen würdest?«, fragte Parker.
»Wie, so weit, dass ich dem Tod in den Rachen blicke?«
Als ich den nächsten Schritt machte, wurde mir bewusst, dass ich mich nur ungefähr einen Meter über dem Boden befand – vorerst. Wenn ich jetzt herunterfiele und die Sicherheitsgurte versagten, wäre ein gebrochener Zeh das wahrscheinlichste Szenario. Etwas mutiger setzte ich die nächsten Schritte und merkte, dass es gar nicht so schlimm war wie gedacht. Die Planken hatten einen angenehmen Abstand. Wir waren gar nicht so weit oben, und alles fühlte sich ziemlich stabil an – ungefähr so würde ich wohl auch mein Leben beschreiben, nachdem ich nach einigen harten Jahren wieder auf die Füße gekommen war. Ich hatte Arbeit, ein Dach über dem Kopf, Frühstücksflocken im Regal und Milch im Kühlschrank.
Ich betrat die nächste Plattform und drehte mich zu Parker um, die nun am anderen Ende der Brücke losging.
»Alles gut bei dir?«, fragte ich, als sie bei mir ankam.
»Wenn wir hiermit durch sind, dann schon.« Sie schaute grinsend zu mir hoch. »Aber immerhin drehen sich deine Gedanken um einen plötzlichen Tod, statt um deine neue Stelle.«
»Alles hat sein Gutes«, meinte ich. Sie wusste, dass ich diesen Spruch hasste, denn er war kompletter Quatsch. Es hatte nicht alles sein Gutes. Wenn eine Tür zufiel, öffnete sich nicht wie von Zauberhand eine andere, und Silberstreifen am Horizont konnten mir gestohlen bleiben. Ich hasste solcherlei Binsenweisheiten. Ich mochte die Realität. Und die Realität sah so aus, dass das Leben schwer war. Um im Leben etwas zu erreichen, brauchte es harte Arbeit, Leistungswillen und Opferbereitschaft.
»Okay, weiter zur nächsten«, sagte ich und folgte den Pfeilen. »Die nächste sieht ein bisschen höher aus, aber nicht viel.«
Die Planken entlang der nächsten Brücke waren willkürlicher angeordnet – manche überlagerten sich, manche waren klein, andere groß. Ich legte die Strecke mit etwas mehr Selbstvertrauen zurück, und die Gefahr einer Panikattacke ließ ein wenig nach. Jedenfalls bis zu dem Moment, kurz bevor ich die Plattform betrat und die ganze Brücke zu wackeln anfing.
Ich schrie auf.
Hatten sich die Drahtseile gelöst, an denen mein Klettergurt hing? Ich drehte den Kopf – nein, es lag nur daran, dass Parker schon auf die Brücke getreten war, ehe ich sie ganz überquert hatte.
»Ist das denn sicher? Wenn wir beide gleichzeitig auf der Brücke sind?«, fragte ich den Einweiser direkt vor mir.
Er streckte mir eine Hand hin, und ich nahm sie und ließ mich von ihm auf die Plattform ziehen. »Es ist total sicher. Selbst mit hundert Leuten gleichzeitig auf der Brücke wäre es total sicher.«
Ich war mir nicht sicher, ob hundert Leute gleichzeitig darauf passen würden, aber ich würde ganz gewiss nicht zu den einhundert Personen zählen, die das ausprobierten.
»Als Nächstes müssen Sie über diese Kletterwand zu der oberen Plattform und sich dann über ein Netz zur nächsten hangeln.«
Ich legte den Kopf in den Nacken, um zu sehen, wohin er deutete. Der nächste Abschnitt etwa fünf Meter über uns war nicht nur höher, sondern man stand auch nicht mehr aufrecht. Leute hangelten sich über ein Netz aus Seilen und waren somit gezwungen, nach unten zu sehen. »Wer hat sich diesen Parcours ausgedacht? Ein Sadist?«
»Manche Menschen überwinden sich gern«, sagte Parker, als sie bei mir angelangte. »Du zum Beispiel. Du treibst dich stets zu neuen Höchstleistungen an.«
»Mit dem Unterschied, dass ich mich gern am Schreibtisch vor einem Computer überwinde. Wobei keine Lebensgefahr besteht.« Ich fasste nach den kieselförmigen blauen Plastikgriffen an der Kletterwand und begann den Aufstieg.
»Dann dürfte eine Verabredung Samstagabend ja genau dein Ding sein.«
Ich stöhnte. »Neiiin.«
»Bloß ein Abendessen. Das wird eine verdammt gute Ablenkung sein. Ich habe ein Foto gesehen. Wenn du dem Mann gegenübersitzt, wirst du weder in der Lage sein, irgendwo anders hinzugucken, noch, an irgendetwas anderes zu denken. Übrigens sieht dein Hintern von hier unten fantastisch aus. Den solltest du viel mehr betonen.«
Ich gelangte am oberen Ende der Kletterwand an und hievte mich unelegant auf die Plattform. Nachdem ich mich aus der Gefahrenzone gerollt hatte, blieb ich einfach auf dem Rücken liegen, während ich mich fragte, ob es eine Abkürzung hier raus gab und ob Parker mir verzeihen würde, wenn ich sie allein zurückließe.
»Nur fürs Protokoll: Das hier ist ein schrecklicher Ort für ein Date.«
»Das am Samstag ist in einem Restaurant. Mit Stühlen und so weiter. Es bietet zwar auch eine herrliche Aussicht, hat aber einen Fahrstuhl. Sicherheitsgurte sind keine nötig.«
»Klingt nach der Erfüllung meiner Träume. Aber nein. Ich gehe auf kein Date. Etwas mit jemandem anzufangen, ist das Letzte, was ich gerade will. Ich fange bald als Ärztin im Praktikum in einem der besten Krankenhäuser des Landes an. Ich möchte nichts, was mich von Montag ablenkt. Ich möchte mich voll und ganz auf die Arbeit konzentrieren. Es wird schon schwer genug werden, die nächsten zwei Jahre zu überstehen, ohne dabei auch noch zu versuchen, eine Beziehung aufrechtzuerhalten.«
»Du wirst das ganz prima machen.«
»Ich muss mich beweisen. Es wird unter Garantie jede Menge Ärzte geben, die nur darauf warten, dass ich versage. Mein Weg zum Medizinstudium ist schon umstritten genug. Die sollen nicht auch noch Recht bekommen.«
»Ich verstehe nicht, was umstritten daran sein soll, wenn man sich den Hintern aufreißt. Ich weiß schon, viele von denen waren in Oxford und Cambridge und so weiter, aber ihr musstet alle dieselben Prüfungen ablegen.«
Ich sagte nichts weiter. Es hatte keinen Sinn. Parker hatte recht – der Snobismus, der in Ärztekreisen darüber herrschte, wo man studiert hatte und aus welcher Familie man kam, hatte keine Berechtigung und war unfair. Ich hatte schon vor langer Zeit gelernt, dass das Leben nicht fair war. Es nützte nichts, darüber zu jammern.
»Egal, am Montag fängst du im Krankenhaus an«, fuhr Parker fort. »Das Date ist Samstagabend. Ich will dich nicht mit deinem zukünftigen Ehemann bekannt machen, nicht mal mit deinem nächsten Freund. Er ist eine heiße Möglichkeit, den Abend zu verbringen, mehr nicht. Außerdem geht er übernächste Woche für Ärzte ohne Grenzen ins Ausland, von daher besteht gar nicht die Möglichkeit, dass du dich weiter von ihm ablenken lässt, selbst wenn du es wolltest.«
Ich seufzte. Parker hatte recht – ich sollte mein letztes Wochenende in Freiheit genießen, bevor wegen der Schichtdienste und der Erschöpfung Wochenenden für mich nicht mehr existieren würden. »Ich werde wohl rückwärts über dieses Netz kriechen müssen. Du hast heute schon genug von meinem Hintern gesehen.« Ich hockte mich hin und schwang die Beine über den Rand der Plattform, um zu versuchen, Stand auf dem Netz zu finden.
»Super Technik«, rief mir der Einweiser zu. Der machte wohl Witze?
»Siehst du? Du kriegst das mühelos hin«, sagte Parker.
»Ich versuche, dir den Anblick meines Pos zu ersparen, und nicht etwa, ein Kletter-Ass zu werden.«
»Du überraschst dich selbst. Das wird Samstagabend genauso sein, wenn das Essen vorbei ist und du feststellst, dass du einen wunderbaren Abend verbracht hast, ohne ein einziges Mal an Montag zu denken.«
Ich stöhnte. »Hör auf zu versuchen, mich zu überreden.«
Sie ignorierte meine Worte wohlweislich. Ich wollte überredet werden. Das Problem war, dass ich Schuldgefühle bekam, sobald ich weder arbeitete noch lernte. So als hätte ich eine Auszeit, Spaß oder Entspannung nicht verdient. Parker war die Person in meinem Leben, die mich daran erinnerte, dass ich manchmal einfach Mensch sein durfte.
»Es könnte für die nächsten zwei Jahre das letzte Mal werden, dass du Sex hast, schließlich bist du fest entschlossen, während deiner Zeit im Krankenhaus ungebunden zu bleiben.«
Vielleicht sollte ich mich bei einem Typen aus einem anderen Krankenhaus melden, der auch gerade dort anfing, und mit ihm eine Vereinbarung über unverbindliche Sexdates die nächsten zwei Jahre treffen. Das würde zumindest voll in mein bisheriges Beziehungsleben passen. Ich hatte nie die Zeit gefunden, mich auf eine Beziehung einzulassen, während ich mich anstrengte, ein Dach über dem Kopf zu behalten. Ich musste mich auf meine Zukunft konzentrieren.
»Ich dachte, Samstag geht’s um ein Abendessen. Nicht um Sex.«
»Es könnte zu Sex führen. Ich meine, dieser Typ ist echt heiß.«
»Wenn du mir ein Foto von ihm zeigst, ändere ich vielleicht meine Meinung.«
»Nein«, rief sie mir nach. Die Anspannung in ihrer Stimme verriet mir, dass sie sich gerade auf das Netz begab. »Es wird ein Blind Date. Auf die Art sind deine Gedanken umso mehr damit beschäftigt, zu überlegen, wie er wohl sein wird. Das lenkt noch besser ab. Was hast du schon zu verlieren? Es geht um einen Abend deines Lebens.«
»Ich sage dir, was ich zu verlieren habe: einen Abend mit Nick und Vanessa Lachey und einem Haufen Möchtegern-Instagram-Influencern. Gott, wie mir Netflix fehlen wird.«
»Genau. Mit einem heißen Arzt, den du danach nie wiedersehen musst, wirst du viel mehr Spaß haben.«
Ihre Hartnäckigkeit war bewundernswert. Sie versuchte wirklich, zu tun, was sie für das Beste für mich hielt. Wie immer. Jetzt wo sie dermaßen glücklich mit ihrem Verlobten Tristan war, hatte sie das Gefühl, mein Leben bräuchte eine kleine Dosis Mann. Ich konnte es ihr nicht verdenken. Es war schön, sie dermaßen verliebt zu erleben. Außerdem hatte sie sich solche Mühe gegeben, mich diese Woche abzulenken, dass ich ein schlechtes Gewissen dabei hatte, Nein zu ihr zu sagen.
»Ich mache dir einen Vorschlag, wenn wir den heutigen Tag überstehen, ohne im Krankenhaus zu landen, und es schaffen, irgendwann zwischendurch einen Mimosa zu trinken, treffe ich mich mit deinem geheimnisvollen Fremden.«
Um ehrlich zu sein, machte es mich ein bisschen neugierig, jemanden kennenzulernen, der zu Ärzte ohne Grenzen ging. Auch wenn ich mir das selbst nicht vorstellen konnte, gefiel mir der Gedanke, Zeit mit jemandem zu verbringen, der nicht den klassischen Weg ging. Womöglich würde diese ehemalige Friseurin hier ja Gemeinsamkeiten mit einem anderen Arzt entdecken. Wäre mal was Neues.
2. KAPITEL
JACOB
Wenn mal eine Stunde verging, ohne dass einer meiner vier kleinen Brüder anrief oder textete, war das ein guter Tag. Alle schienen zu denken, ich hockte in einem dunklen Zimmer und wartete nur darauf, dass einer von ihnen mich brauchte, und ginge nicht etwa einer anspruchsvollen Arbeit im Royal Free nach, einem der besten Krankenhäuser des Landes. Ich ignorierte den Anruf von Beau und schob mein Handy wieder in die Hosentasche.
»Guten Abend, Dr. Cove«, sagte Dina, eine der Mitarbeiterinnen von der Rezeption der Notaufnahme, als ich im Flur an ihr vorbeiging. Ich lächelte, nickte und dachte bei mir Gott sei Dank, dass ich höflich abgelehnt hatte, als sie mir letztes Jahr auf der Weihnachtsfeier sagte, sie würde mir liebend gern einen blasen. Nicht etwa, weil sie nicht bildhübsch wäre. Und nicht, weil ich was gegen Blowjobs hatte – gab es das überhaupt? Nein, es lag daran, dass ich nicht einer Reihe Frauen begegnen wollte, die meinen Schwanz im Mund gehabt hatten, wenn ich durch die Krankenhausflure ging, nüchtern und im grellen Neonlicht, während meine Schuhe auf dem frisch gewischten Linoleumboden quietschten.
Nennt mich altmodisch.
»Halte dein Privatleben privat.« Das war fast schon ein Mantra in meinem Elternhaus gewesen. Mein Vater war in meiner Kindheit selten da gewesen, aber er hatte immer schnell den einen oder anderen barschen Ratschlag parat gehabt. Auf ein Könnte besser sein oder Warum hast du nicht die volle Punktzahl? war bei ihm stets Verlass, wann immer ich ihm einen nicht ganz perfekten Test zeigte. Bei meinen Brüdern schien er mit den Ratschlägen nicht so schnell zu sein, aber eins sagte er zu jedem von uns: »Halte dein Privatleben privat.« Er sagte es, als jeder von uns sein Medizinstudium begann, jedes Mal, wenn einer von uns eine neue Stelle antrat, und wenn einer sich Ärger einhandelte – egal, ob es passte oder nicht.
Vielen Ratschlägen meines Vaters stimmte ich nicht zu, aber an sein Privatleben-Mantra hatte ich mich immer gehalten. Ein Studienfreund von mir hatte letztes Jahr das Royal Free verlassen, weil er mit zu vielen Krankenschwestern und Assistenzärztinnen rumgevögelt hatte. Als er sich um eine Beförderung bewarb, hatte es geheißen, er bringe zu viel Ballast mit.
Es galt kein Beziehungsverbot für das Krankenhauspersonal. Oder vielleicht doch, aber alle ignorierten es. Die Belegschaft verbrachte einen viel zu großen Teil des Lebens hier, als dass Sex und gar Liebe nicht vorkommen würden. An der Arbeitsstelle mit jemandem anzubandeln, war leicht. Und wenn man erschöpft von den Überstunden und der anspruchsvollen Arbeit war und mal Dampf ablassen wollte oder Kontakt mit einem Menschen brauchte, der weder krank war noch im Sterben lag, war es logisch, dass man sich jemanden in der Nähe suchte.
Aber nicht ich.
Zum einen, weil ich mich an den Ratschlag meines Dads hielt, und zum anderen, weil … na ja, wegen meines Nachnamens. Ich war ein Cove. Der erstgeborene Sohn der Ärzte Carole und John Cove. Mit diesem Nachnamen war eine Erwartungshaltung verbunden. Ich war niemals einfach nur »Jacob« oder »Dr. Cove«. Ich war immer »Jacob Cove, ja genau, von den Coves« oder »Dr. Coves Sohn« oder »Cove – ist Ihre Mutter etwa Carole Cove?« Es war ein Etikett, das ich gewohnt war und das ich nicht eintauschen wollte gegen »Jacob Cove, der Kerl, der alle aus der Kinderheilkunde gedatet hat«. Oder »Jacob Cove, der enttäuschende Sohn der Coves«. Ich wollte nicht, dass Menschen, die ich zwangsläufig jeden Tag sah und denen ich Anweisungen gab oder von denen ich welche bekam, Intimes über mich und mein Sexleben wussten. Ich wollte nicht, dass der Name Cove mit etwas anderem in Verbindung gebracht wurde als mit herausragenden Ärzten. Ich war ehrgeizig und wollte ein bahnbrechender Kinderkardiologe werden oder sogar Regierungsberater für den Fachbereich Kindergesundheit. Ich wollte niemals eine Beförderung verwehrt bekommen, weil ich mit der falschen Person oder mit zu vielen Personen geschlafen hatte. Das war es nicht wert. Wenn die Leute meinen Namen hörten, sollten sie Exzellenz damit assoziieren. Und nicht etwa Sex.
Mein Handy brummte in meiner Tasche, und ich nahm es heraus. Eine Nachricht von Beau.
Nimm ab. Du musst mir einen Gefallen tun.
Das war nichts Neues. Ehe ich dazu kam, zu antworten, leuchtete schon sein Name auf dem Display auf.
Ich ging ran, während ich durch die Tür zum Treppenhaus und dann nach unten ging. Beau war von uns allen am hartnäckigsten, und das hieß schon was. »Die Antwort lautet Nein«, bellte ich ins Telefon.
»Du hast mich ja nicht mal angehört. So schlimm ist es gar nicht.«
»Da möchte ich widersprechen. Wenn ich dir helfen soll, kann es nur schlimm sein.« Beau hatte es faustdick hinter den Ohren. Es würde ihm guttun, eine Zeit lang bei Ärzte ohne Grenzen zu sein.
»Ich mein’s ernst. Du brauchst nicht mehr zu tun, als leckeres Essen zu genießen und Wein zu trinken, der vielleicht sogar gut genug für deinen erlesenen Geschmack ist.« Wenn er solche Komplimente verteilte, musste er meine Hilfe wirklich brauchen.
»Raus damit. Was willst du?«
»Du musst für mich auf ein Date gehen. Nur ein Abendessen und ein paar Drinks. Nichts Weltbewegendes.«
»Ein Date? Spielst du jetzt den Kuppler?«
»Ich will dich nicht verkuppeln. Eine Freundin wollte mich verkuppeln – offenbar mit einer umwerfenden Frau. Es kotzt mich voll an, dass ich nicht kann. Ich möchte nicht in letzter Minute absagen.«
Ich blieb vor der Tür zum Erdgeschoss stehen, um das Gespräch ungestört zu beenden. »Das klingt verdächtig nach einem Mitleidsdate. Wieso –«
»Nein, im Ernst, es ist keins. Sie ist anscheinend echt hübsch. Und sie ist Ärztin. Du kannst mit ihr fachsimpeln. Sie arbeitet im Tommy’s, glaube ich. Neu in London oder so. Ihre Freundin meinte etwas in der Art. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich kann nicht hin, weil …« Er lachte los. »Du wirst es nicht glauben, aber ich bin im Krankenhaus. Ich glaube, ich habe mir die Nase gebrochen.«
»Was?« Wieso lachte er?
»Hatte heute Nachmittag Rugby-Training. Hab einen Ellbogen ins Gesicht gekriegt.«
Nur Beau konnte darüber lachen, dass er sich die Nase gebrochen hatte.
»Wird das Auswirkungen auf deine Reise haben?« Er sollte in einer Woche abfliegen.
»Keine Ahnung«, sagte er. »Schätze, erst mal müssen wir feststellen, ob sie tatsächlich gebrochen ist. Aber ich werde nie im Leben noch rechtzeitig zu dem Date aus dem Krankenhaus kommen.«
»Das Date ist heute Abend?«
»Ja, was glaubst du denn, warum ich dich seit einer Stunde andauernd anrufe?«
Shit, ich hatte gerade Feierabend. Ich war erschöpft. Ich wollte nur noch kurz nach einem Patienten sehen, dann nach Hause und ins Bett. »Kannst du nicht Zach fragen?«
»Er ist in Norfolk.«
Ich hatte vergessen, dass er das Wochenende bei unseren Eltern verbrachte.
»Dann einen deiner Freunde?«
»Als könnte man denen vertrauen.«
Guter Einwand. Seufzend fand ich mich also damit ab, dass ich nicht so früh wie gehofft ins Bett kommen würde. »Du schuldest mir richtig was.«
»Du bist der beste große Bruder, den man sich wünschen kann. Du triffst dich mit ihr ganz oben im NatWest Tower. Ihr Name ist Sutton. Viertel vor neun. Die Rechnung geht auf mich. Ich habe meine Kreditkartendaten im Restaurant hinterlegt. Zu jedem anderen unserer Brüder würde ich jetzt sagen, dass er nichts tun soll, was ich nicht auch tun würde, aber bei dir ist das eh klar. Lass es krachen.«
Ehe ich Gelegenheit hatte, nach Suttons Nachnamen zu fragen, legte er auf. Ich würde ihn umbringen, wenn ich ihn das nächste Mal sah.
»Wollen Sie nach Hause?«, fragte eine Frau hinter mir.
Dina war wie aus dem Nichts aufgetaucht, und ich verzog die Lippen zu einem Lächeln. »Leider nein.«
Sie neigte den Kopf. »Schade. Ich brauche eine Mitfahrgelegenheit.«
»Viel Glück. Ich muss zu einem Patienten.«
Zwar hasste ich es, zu spät zu kommen, aber es kam nicht infrage, dass ich nicht bei Barnaby vorbeischaute. Er war seit fast zwei Monaten Patient bei uns und das älteste von fünf Kindern. Seine Eltern hatten keine Zeit, ihn täglich besuchen zu kommen.
Als ich in Station sechs einbog, sah ich Barnaby aus dem Fenster starren. Ich beugte mich über den Stationstresen. »Hatte Barnaby heute Besuch?«
Annette, die diensthabende Schwester, schüttelte den Kopf und rümpfte die Nase. Niemandem gefiel es, wenn die Kinder keinen Besuch bekamen.
Er war nicht mein Patient, doch Barnaby lag bereits so lange auf der Station, dass ich zwangsläufig mitbekam, was bei ihm los war, wenn ich nach meinen Patienten sah.
Aus der hinteren Hosentasche zog ich eine Guthabenkarte für den Snackautomaten. Ich hatte zwanzig Pfund daraufgeladen, bevor ich den Anruf von Beau angenommen hatte.
»Barnaby, Kumpel«, sagte ich, während ich großen Schrittes auf sein Bett zuging. »Ich hab hier was gefunden, das dir gehört.« Ich wedelte mit der Karte in seine Richtung.
Barnaby sah mich stirnrunzelnd an. »Was ist das?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Probier die mal am Snackautomaten aus.«
»Das kann nicht meine sein. Ich hatte gar keine.« Ich war mir ziemlich sicher, dass Barnabys Eltern nicht viel Geld besaßen.
»Stimmt. Die gehört mir, aber ich darf nichts Ungesundes mehr – du weißt doch, wie das bei alten Männern wie mir ist. Darum … nimm du sie.«
Er sah erst mich an, dann die Karte. Ich warf sie auf seinen Tisch.
Er nickte. »Danke.«
»Was guckst du gerade?« Ich nickte in Richtung Fernseher.
»Nichts«, erwiderte er.
Ich warf einen Blick zur Uhr über dem Stationstresen. Wahrscheinlich würde ich mehr als eine halbe Stunde zum NatWest Tower brauchen, und es war jetzt fast zehn nach acht. Warum musste sich Beau für sein Date ein Restaurant in der Londoner City aussuchen, wenn das West End doch viel näher war?
»Verrat keinem, dass ich es dir gesagt habe, aber auf BBC iPlayer läuft die Serie Peaky Blinders. Die ist gut. Vertrau mir.«
»Ich habe keine Kopfhörer«, sagte er. »Ich kann sie nicht gucken, selbst wenn ich wollte.«
Armer Junge.
»Ah, ich hol dir welche. Wir haben jede Menge herumliegen.« Ich wandte mich ab. Ich war nicht sicher, ob ich überhaupt irgendwo Kopfhörer finden würde, vor allem nicht in den vierzig Sekunden, die mir noch blieben, bis ich losmusste. Ich düste den Flur entlang Richtung Vorratsschrank. Vielleicht lagen Fundsachen darin. Angie, eine Pflegehelferin, deren Schicht gerade zu Ende war, ging an mir vorbei. Als sie lächelte und winkte, erregte das blecherne Tick, Tick, Tick aus dem Ohrhörer, der auf Höhe ihrer Taille baumelte, meine Aufmerksamkeit.
»Hey, Angie?« Sie blieb stehen und drehte sich um. »Kann ich Ihnen Ihre Kopfhörer abkaufen?«
Sie zog den anderen Stöpsel aus dem Ohr. »Was?«
»Ihre Kopfhörer. Wie viel?« Ich zog mein Portemonnaie aus der Hosentasche.
Angie sah mich stirnrunzelnd an. »Die sind nichts Besonderes. Die haben mich ungefähr fünf Pfund gekostet. Wieso wollen Sie die haben?«
Ich hatte keine Zeit, es zu erklären. Während ich einen Zwanzig-Pfund-Schein herausholte, sagte ich: »Würden Sie mir die für zwanzig Pfund überlassen?«
Sie zuckte mit den Schultern und hielt sie mir hin, nahm das Geld jedoch nicht. »Geben Sie sie mir einfach morgen wieder.« Angie verdiente den Mindestlohn.
»Bitte lassen Sie sie mich Ihnen abkaufen.«
»Sie können sie haben«, erwiderte sie.
Ich drückte ihr den lilafarbenen Schein in die Hand, und sie gab mir die Kopfhörer.
»Sie sind komisch, Dr. Cove«, befand sie in einem Tonfall, der verriet, dass ihr die Sache im Grunde egal war – sie machte einfach mit.
»Vielen Dank«, sagte ich und lief zurück zu Barnaby.
Vielleicht würde ich es doch pünktlich ins Restaurant schaffen.
3. KAPITEL
JACOB
Die Sicherheitskontrolle im NatWest Tower glich der am Flughafen – samt Taschendurchleuchten und Metalldetektoren. Ich hatte schon so manches gute Restaurant besucht, aber abgetastet worden war ich deswegen noch nie.
Als ich endlich im zweiundvierzigsten Stock ankam, war ich drei Minuten zu spät. Das passte mir gar nicht.
»Eine Reservierung auf den Namen Beau.«
Beau hatte gemeint, Sutton sei Ärztin. Hoffentlich war sie so jung, dass sie den Namen Cove noch nie gehört hatte. Das war eine alberne Hoffnung, aber vielleicht würde sie so nett sein, so zu tun. Ich hatte keine Lust, den Abend damit zu verbringen, dass sie mir erzählte, wie toll sie meine Eltern fand. Sie waren toll, aber das brauchte ich nicht von einer Fremden zu hören. So sehr ich meine Eltern liebte und stolz auf ihr enormes Ansehen war, manchmal fühlte es sich an, als wäre ich nie erwachsen geworden. Sie waren immer da – bei den Vorstellungsgesprächen an der Universität und als ich mich an Krankenhäusern bewarb. Auf Weihnachtsfeiern und bei Abschiedspartys. Das Erste, worüber sich fremde Leute mit mir unterhalten wollten, waren meine Eltern.
Ihnen gerecht zu werden, war viel. Und es war auch viel, womit man klarkommen musste. Manchmal wünschte ich mir, ich wäre Architekt geworden.
»Ich glaube, wir sind zum Essen verabredet«, rief eine Frau hinter mir. Als ich mich umdrehte und eine wunderschöne Frau sah, die mich erwartungsvoll anschaute, durchlief meinen ganzen Körper Dankbarkeit darüber, dass sich mein Bruder die Nase gebrochen hatte. Sie trug ihr langes kastanienbraunes Haar zu einem lockeren Zopf gebunden, und auf der rechten Wange hatte sie einen Schönheitsfleck. Ihr Lächeln war offen und herzlich, und ich wusste sofort, dass ich Beau einen Drink spendieren musste, wenn ich ihn das nächste Mal sah.
»Du musst Sutton sein«, sagte ich und beugte mich vor, um ihr ein Küsschen auf die Wange zu geben.
»Ist eine ziemliche Prozedur, hier hinaufzugelangen«, sagte sie. »Ich dachte schon, ich wäre zu spät.«
Ich verkniff mir ein Glucksen. Wir hatten es beide gegen zehn vor neun herauf geschafft. Ohne die Sicherheitskontrolle wären wir beide zu früh dran gewesen.
»Aber ich habe gehört, der Ausblick soll es wert sein«, sagte sie.
»Das ist wohl wahr«, erwiderte ich, ohne den Blick von ihr abzuwenden.
Sie errötete, und ich legte ihr eine Hand auf den Rücken, als uns die Frau vom Empfang ins Restaurant führte.
»Wer auch immer das zu dir meinte, hatte recht – die Stadt sieht großartig aus«, sagte ich die Aussicht bewundernd. Das Restaurant hatte eine bodentiefe Fensterfront. Die Sonne war schon fast untergegangen, sodass es am Horizont noch rosa schimmerte und die Lichter der umliegenden Gebäude wie Sterne glitzerten.
»Sensationell«, meinte Sutton und ich konnte nicht anders, als über ihre Begeisterung zu lächeln. »Wir sind mitten in der City, aber alles wirkt total friedlich.«
Wir nahmen im rechten Winkel zueinander Platz, der Tisch war so ausgerichtet, dass wir beide den Ausblick betrachten konnten. Obwohl Sutton und ich uns gerade erst kennengelernt hatten, fühlte es sich intim an. Als sich unsere Knie berührten, zog ich meines weg, damit es ihr nicht unangenehm war. Sie warf mir einen Blick zu und fragte sich offensichtlich genau wie ich, ob wir die Berührung ansprechen sollten.
»Kann ich Ihnen etwas zu trinken bringen?«, fragte uns die Platzanweiserin.
»Sutton, was hättest du gern?«
Sie kaute auf der Innenseite ihrer Wange, ehe sie antwortete: »Ich nehme das, was du nimmst.«
»Also, ich muss morgen nicht arbeiten«, erwiderte ich. Ich ließ es bleiben, noch hinzuzufügen Außerdem zahlt mein Bruder die Rechnung, denn ich wollte nicht, dass sie dachte, ich wäre nur wegen des kostenlosen Essens da. Ärzte im staatlichen Gesundheitswesen verdienten zwar nicht besonders, aber dank eines Nebenverdiensts aus der Studienzeit konnte ich mir Drinks und ein Abendessen in jedem Restaurant der Welt leisten, und den Privatjet dorthin noch dazu. Das konnte sie jedoch nicht wissen.
»Ich auch nicht«, meinte sie. »Zu einer Margarita konnte ich außerdem noch nie Nein sagen.«
Margaritas waren nicht unbedingt mein Lieblingsgetränk. Aber wieso nicht? »Zwei Margaritas, bitte.«
»Du bist Arzt, stimmt’s?«, fragte Sutton, während sie zusah, wie sich die Platzanweiserin mit unserer Bestellung entfernte.
Ich nickte. Ich war mir ziemlich sicher, dass sie meinen Nachnamen nicht kannte, denn ich hatte sie schon vor mehr als zwei Minuten kennengelernt und sie hatte meine Eltern seither nicht erwähnt. »Und du auch, soweit ich weiß?«
»Ja, quasi … Eigentlich wollte ich eine Vereinbarung mit dir treffen.«
»Jetzt schon? Wir haben doch noch nicht mal einen Drink intus.«
Sie stieß ein kurzes Lachen aus, und ihre Schultern senkten sich sichtlich. Sie war nervös, was irgendwie süß war. Ihr Zopf gab den Blick auf ihren langen, elegant geschwungenen Hals frei, der in mir den Wunsch weckte, die Hand auszustrecken und sie zu berühren.
»Ich habe den Arztberuf als Erste erwähnt, das hätte ich lassen sollen. Ich fange demnächst als Ärztin im Praktikum an. Bist du einverstanden, wenn wir nicht über den Beruf oder das Medizinstudium oder Krankenhäuser und all so was reden? Ich darf bloß nicht daran denken. Ich bin so nervös wie eine langschwänzige Katze in einem Zimmer voller Schaukelstühle.«
Eine langschwänzige Katze? Ich wollte loslachen, doch ihr Gesichtsausdruck verriet mir, dass sie es nicht witzig meinte. Ich zuckte mit den Schultern. »Ist mir recht.«
Ihr Vorschlag kam unerwartet – für die meisten Ärzte war ihr Beruf ihr Leben, und der Gedanke, die Medizin einen ganzen Abend lang nicht zu erwähnen, käme ihnen vor, wie in vierundzwanzig Stunden die Chinesische Mauer abzulaufen – nämlich unmöglich. Ich dagegen fand den Gedanken reizvoll. Die Coves redeten ständig über Medizinthemen, das war schon seit ich denken konnte so.
»Wer die Vereinbarung bricht, sollte eine Strafe kriegen«, sagte sie mit einem unerwartet verschmitzten Funkeln in den Augen.
»Verstehe, du machst keine halben Sachen. Was denn für eine Strafe?«
Erst als sie eine Schulter hochzog, nahm ich wahr, dass ihr kobaltblaues, asymmetrisch geschnittenes Oberteil nackte Haut zeigte. Zum ersten Mal im Leben kam mir Blau sexy vor und erinnerte mich nicht an OP-Masken.
Die Platzanweiserin kehrte mit Margaritas in riesigen Gläsern zurück. Als Deko steckten am Rand zu abgefahrenen Formen geschnitzte Orangenschalen.
»Wir haben mit Margaritas angefangen«, sagte sie. »Vielleicht also ein Tequila-Shot als Strafe?«
Sutton war schon jetzt interessanter, als ich erwartet hätte. Ich war mir sicher, dass der Abend lustig werden würde. Beau verpasste was.
»Abgemacht. Der Bann beginnt … jetzt.« Ich erhob mein Glas.
Als sie zur Erwiderung ihres hochhielt, bemerkte ich den herausfordernden Ausdruck in ihren Augen. Sie war eine Kämpfernatur. Ich konnte es ihr ansehen, und das hatte etwas extrem Anziehendes.
Ich trank einen Schluck, doch Sutton zögerte, das Glas noch immer feierlich erhoben. »Weißt du, ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt irgendetwas zu erzählen habe, wenn ich nicht über Medizin reden kann.«
Ich machte das Geräusch eines Buzzers. »Der erste Shot kommt sofort.« Ich hielt einen gerade vorbeigehenden Kellner an und bestellte einen Tequila. »Echt schwach von dir, wenn ich das sagen darf. Du bist ja noch nicht mal aus dem Startloch gekommen. Ab jetzt musst du dir schon ein bisschen mehr Mühe geben.«
Sie lachte und trank einen Schluck Margarita. »Na gut. Also, du bist dran. Erzähl mir was von dir.«
Als der Kellner den Tequila brachte, bedeutete ich ihm, dass dieser für Sutton war.
»Erst wenn du deinen Shot getrunken hast.«
Sie stellte ihre Margarita hin und nahm das Schnapsglas. Noch ehe ich ihr sagen konnte, dass sie nicht bloß daran nippen durfte, kippte sie den Tequila herunter.
Ich trank noch einen Schluck von meinem Cocktail, um den zufriedenen Ausdruck zu überspielen, der mein Gesicht zieren musste.
»Du wolltest was erzählen«, sagte sie ohne jedes Zögern, während ein Grinsen ihre Mundwinkel umspielte.
»Ich habe vier Brüder.«
Sie zog die Augenbrauen hoch. »Wow. Sind sie alle … Wow.«
Ich lachte leise. »Sind sie alle was? Nervensägen? Definitiv.«
»Jünger?«
»Ja, leider. Und bei dir?«
Das Funkeln, das in ihren Augen stand, seit sie herausgefordert worden war, den Shot zu trinken, ließ ein wenig nach. »Ich habe Stiefgeschwister, die ich noch nie getroffen habe. Sie leben in Texas.«
»Wenn man im medizinischen Bereich arbeitet, ist es schwer, Beziehungen zu pflegen.«
»Pling, pling, pling. Wie’s aussieht, brauchen wir noch einen Tequila für den glücklichen Sieger hier«, stellte Sutton fest und strahlte mich an.
»Hey, das zählt nicht. Das war eine allgemeine Feststellung.«
»Ts ts«, machte sie. »Sich um einen Wetteinsatz drücken – sehr unattraktiv. Ich habe auch nicht gekniffen, oder?«, meinte sie herausfordernd und charmant zugleich.
Ich sah ihr fest in die Augen. »Ich fänd’s schrecklich, wenn du mich unattraktiv fändest.« Es stimmte – ich wollte, dass sie mich genauso anziehend fand wie ich sie.
Ich rief den nächstbesten Kellner zu uns und bestellte noch einen Shot. Vielleicht hätte ich gleich eine Flasche ordern sollen. So, wie wir uns anstellten, würden wir schon vor der Vorspeise hackevoll sein.
Ich versuchte, beim Herunterkippen des Tequilas keine Miene zu verziehen, und füllte dann unsere Wassergläser auf. Ich wollte nicht, dass der Abend vorbei war, ehe er richtig angefangen hatte.
»Okay. Jetzt sind wir quitt«, sagte ich. »Fangen wir noch mal von vorn an. Wie steht’s mit Hobbys?«
Als die Kellnerin wiederkam, bestellten wir das Essen, doch es war einer jener Momente, wo ich es nicht erwarten konnte, die Speisekarte zurückzugeben, damit ich mich weiter mit Sutton unterhalten konnte.
»Mal überlegen, was ich sagen kann …«, nahm Sutton den Gesprächsfaden wieder auf. »Ich dusche gern, fahre mit Bus und Bahn …« Sie wand sich, als würde sie angestrengt überlegen. Ich versuchte ein Lachen zu unterdrücken. Auf jedermann außerhalb unseres Berufs hätte sie vielleicht einen langweiligen Eindruck gemacht, aber ich kannte die Phase, in der sie sich gerade befand – es gab wirklich nichts anderes als Arbeit und Lernen. »Ich übertreibe. Ich gehe gern in Bibliotheken oder Kunstgalerien, wenn ich schlimme Angstzustände habe. Ich weiß nicht recht, ob man das tatsächlich als ein Hobby bezeichnen kann, denn ich gehe ja nicht wegen der Bücher oder der Kunst hin – sondern einfach, weil es beruhigend ist. Vielleicht entspannt sich mein Körper auch gezwungenermaßen, weil nichts peinlicher wäre, als an derart ruhigen Orten eine Panikattacke zu bekommen.«
Ich sah zu, wie sich ihre vollen Lippen beim Reden öffneten und schlossen. Sie trug keinen Lippenstift. Abgesehen von etwas Make-up rund um die Augen schien sie sich nicht geschminkt zu haben. Ich fing an zu überlegen, was das hieß, zum Beispiel, dass kein Lippenstift auf mich oder mein Hemd abfärben würde. Ich fragte mich, wie man ihr asymmetrisches Top auszog. Hatte es einen Reißverschluss an der Seite oder war es aus Stretch? Trug sie einen BH oder war sie nackt darunter …
»Findest du nicht?«, fragte sie. »Habe ich dich zu Tode gelangweilt?«
Ich schüttelte den Kopf und versuchte, so zu tun, als wäre ich nicht abgedriftet und hätte angefangen, sie mir nackt vorzustellen. »Ganz und gar nicht.« Meine Alkoholtoleranz war in den letzten Monaten gesunken, aber ich vertrug doch sicher mehr als nur einen Shot. »Vielleicht schlägst du nächstes Mal zwei Fliegen mit einer Klappe: Stress abbauen und Kunst anschauen oder ein Buch ausleihen – je nachdem, wohin du gehst.«
»Ja, vielleicht, aber es funktioniert gut für mich. Wozu das kaputtmachen? Mich an solche Orte zurückzuziehen, hilft mir, wenn ich ein Problem zu lösen habe oder festgefahren bin oder … na ja, wenn ich einfach mal Ruhe und Frieden brauche. Egal, du bist dran«, sagte sie und trank einen Schluck von ihrer Margarita.
Was konnte ich über mich erzählen? »Ich verbringe viel Zeit in Norfolk. Meine Eltern sind dort hingezogen, als sie in Rente gingen, aber wir hatten schon früher ein Ferienhaus dort und haben als Kinder die Sommer dort verbracht.«
»Steht ihr euch nah?«
»Ich habe mich immer gut mit meiner Mutter verstanden. Sie ist der Mittelpunkt unserer Familie.«
»Und dein Vater?«
Ich holte tief Luft. »Tja. Ich meine, ich liebe ihn und –« Wieso hatte ich ihre Frage nicht einfach mit Ja, wir stehen uns alle sehr nah beantwortet? Es wäre die Wahrheit gewesen. Wenn auch nicht die ganze. »Er hat hohe Ansprüche. Als Kind war es manchmal schwer, nicht das Gefühl zu bekommen, ich bliebe hinter den Erwartungen zurück.«
Als ich von meinem Margaritaglas aufschaute, begegnete ich Suttons sanftem, offenem und irgendwie vertrautem Blick. Irgendetwas an ihr gab mir das Gefühl, ich würde sie schon mein Leben lang kennen. Als wäre es unnütz, etwas vor ihr zu verbergen, weil sie mich bereits im Kern kannte.
Sie schenkte mir ein kleines aufmunterndes Lächeln. »Und deine Brüder?«
»Ich beschwere mich immer über sie – und meistens sind sie auch echt nervig –, aber abgesehen von der einen Sache, über die wir zwei ja nicht reden, verbringe ich am liebsten Zeit mit meiner Familie.«
»Das muss schön sein. Das Verhältnis zu deinem Vater ist heute besser.«
Es war keine Frage, eher eine Beobachtung, und zwar eine zutreffende. Mit den Jahren hatte sich die Beziehung zu meinem Vater gewandelt. Ich wusste nicht genau, ob die Veränderung von ihm oder von mir ausgegangen war. War ich erwachsen geworden, oder sah er in mir endlich einen fähigen Mann?
»Und du bist immer noch gern Arzt?«, fragte sie.
Ich zog die Augenbrauen hoch. Ohne mit der Wimper zu zucken, hob sie die Hand, um den Kellner auf sich aufmerksam zu machen, und bestellte noch drei Shots. »Ich möchte nämlich deine Antwort hören und falls nötig noch weiter nachhaken«, erklärte sie.
»Ja, ich bewirke gern etwas in anderer Leute leben. Die diagnostische Seite gefällt mir. Der Umgang mit Patienten. Selbst wenn es sich um etwas Simples handelt – etwa ein gebrochenes Bein oder ein angeborener Schiefhals –, in der Lage zu sein, Menschen zu versichern, dass es gar nicht so schlimm ist, wie sie denken, ist ein Gefühl, dem ich wohl nie überdrüssig werde.«
»Das kann ich nachvollziehen.«
Ich lächelte sie an. »Ich möchte dir noch mehr Fragen stellen.«
»Ich dir auch. Anfangs hätte ich noch Spaß daran, bis mich dann irgendwas ins Schleudern bringt und ich hier abhaue und mir die nächste Bibliothek suche.«
Ich lachte. »Okay.«
Der Kellner kam mit zwei Schnapsgläsern und einer Flasche wieder und wünschte uns noch viel Spaß heute Abend. Wir exten jeder zwei Shots, noch ehe unsere Vorspeisen serviert wurden.
»Können wir noch einen Korb Brot dazu bestellen?«, fragte Sutton. »Ich brauche was, das den Alkohol aufsaugt, sonst musst du mich nachher hier raustragen.«
Das schien gar keine so schlechte Aussicht zu sein. Aber immer langsam. Zuerst wollte ich noch mehr über sie wissen.
Unsere Vorspeisen kamen gerade rechtzeitig, bevor wir von Lockerheit zu Betrunkenheit wechselten. Rettung durch Kohlenhydrate.
»Erzähl mir von Norfolk«, bat sie mich. »Ist es deine Bibliothek?«
Ich seufzte und dachte darüber nach. »Weißt du was? Ich glaube, das war es früher tatsächlich. Es gab Zeiten, da …« Ich überlegte, wie ich darüber sprechen konnte, ohne die Medizin zu erwähnen. Noch mehr Tequila würde ich nicht vertragen. »Es gab in meinem Berufsleben extrem stressige Phasen und … Ich habe das noch nie jemandem erzählt, aber meine Eltern leben am Rand eines Dorfs direkt an der Marsch. Es ist ein wunderschöner Ort, Nichtstun fällt einem dort ganz leicht, weißt du?«
Sie nickte, als verstünde sie genau, was ich meine.
»Überall verlaufen Küstenpfade, und ich habe es immer genossen, sie entlangzuwandern, um den Arbeitsstress abzubauen. Auf einem dieser Spaziergänge entdeckte ich ein altes Ruderboot, das in der Marsch zurückgelassen worden zu sein schien. Weil ich Hunger hatte, kletterte ich hinein, packte einen Proteinriegel aus und aß ihn dort in der Sonne sitzend. Trotzdem war es windig, wir reden schließlich von der Küste und von Norfolk, deshalb beschloss ich, mich in das Boot zu legen, um Schutz vor dem Wind zu haben. Und dann lag ich einfach nur da und dachte nach über … alles und nichts. Ich schaute zu, wie über mir die unterschiedlichsten Wolken vorüberzogen und wünschte mir, ich hätte in Erdkunde besser aufgepasst – es gibt so viele verschiedene Wolkenformen. Ich lauschte den Geräuschen des Meers, dem Wind im Schilf und den Gräsern, den Möwen, den Robben in der Ferne. Es war so etwas wie eine Entstressungskammer. Als ich Stunden später wieder aufstand, fühlte ich mich … wunderbar. Seitdem ist ein Ausflug nach Norfolk immer so, als würde man den Resetknopf drücken.«
»Die Vorstellung von einem Resetknopf gefällt mir. Ich werde mich wohl auf die Suche nach diesem Boot machen müssen. In einer Bibliothek oder einer Kunstgalerie kann ich nämlich nicht stundenlang herumliegen, ohne dass jemand die Polizei ruft. Glaub’s mir, ich habe es versucht.«
Ich lachte. »Das Verrückte daran ist, dass ich nach diesem ersten Erlebnis jahrelang immer wieder zu dem Boot ging. Es hatte jedes Mal denselben Effekt. Und eines Tages, als ich es wieder aufsuchen wollte, war es weg.«
»Vielleicht hat es sich der Eigentümer wiedergeholt.«
»Vielleicht. Es fühlte sich an, als … Das wird sich jetzt anhören, als – ach, schon gut, vergiss es.«
Sie legte ihre Hand auf meine. »Raus damit.«
Als sich unsere Blicke trafen, merkte ich, dass sie aufrichtiges Interesse an meiner Geschichte hatte. Nicht an einer Geschichte von Jacob Cove, dem Sohn von John und Carole Cove oder dem ältesten der fünf Cove-Brüder oder von Dr. Cove. Sie war einfach interessiert an mir.
»Es fühlte sich an, als hätte das Boot seinen Dienst für mich getan, und weil die Phase meines Berufs – meines Lebens –, in der ich es wirklich gebraucht hatte, vorbei war … hatte es sich quasi in Luft aufgelöst.«
Sie nickte. Zwischen uns machte sich angenehmes Schweigen breit.
»Fast wie Magie.« Sie sagte das nicht scherzhaft – nicht wie eine zynische Wissenschaftlerin, der gesagt worden war, sie sei vom Sternzeichen Stier und daher vorherbestimmt, diese oder jene Eigenschaft zu besitzen. Sie sagte es, als könnte sie total verstehen, was ich in Bezug auf das Boot empfand: als hätte es gewisse Zauberkräfte. Als wäre es heilsam für mich gewesen, als ich es brauchte und so lange ich es brauchte.
»Das muss sich für andere albern anhören.«
Sie schüttelte den Kopf. »Sag das nicht. Der Tag, an dem wir aufhören, an Magie zu glauben – wenn auch nur ein kleines bisschen –, wird ein trauriger Tag.« Sie nahm ihre Hand weg, doch ich lehnte mein Knie gegen ihres, weil ich weiterhin Körperkontakt zu ihr wollte. Sie zuckte weder zusammen noch zog sie es weg, sondern sah nur hoch und lächelte mich voller Zuneigung an, so als wären wir alte Freunde.
»Stimmt«, sagte ich. »Die Wissenschaft ist voller Wunder.«
Wir grinsten einander an wie zwei Idioten. Je öfter ich sie lächeln sah, desto glücklicher war ich.
»Ich wollte heute Abend eigentlich gar nicht herkommen«, gestand sie. »Aber ich bin echt froh, dass ich es doch gemacht habe.«
Ich trank einen Schluck Margarita, denn wenn ich mir erlaubt hätte, darauf sofort etwas zu erwidern, hätte ich mich sehr wahrscheinlich zum Narren gemacht. »Geht mir genauso«, sagte ich. »Keine Ahnung, womit ich gerechnet hatte, aber jedenfalls nicht …«
»Ich frage mich, ob du das Boot einmal wiedersehen wirst. Oder ob zur rechten Zeit etwas Vergleichbares in deinem Leben auftauchen wird.« Sie war so schön, dass ich aufspringen und alle im Restaurant an unseren Tisch rufen wollte, damit sie sahen, wie umwerfend sie war.
»Wer weiß, wenn du erst aus sämtlichen Bibliotheken und Kunstgalerien Londons rausgeworfen wurdest, brauchst du vielleicht einen neuen Ort, um deine Angstzustände zu mildern, und dann findest du ein Ruderboot.«
Sie kniff die Augen zusammen, als dächte sie tatsächlich darüber nach. »Da könntest du recht haben. Vielleicht muss ich raus in die Natur.«
»Einen Versuch ist es wert.«