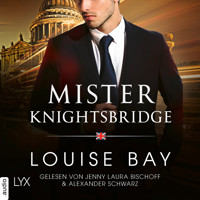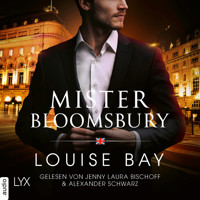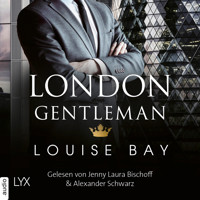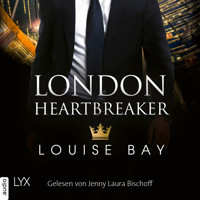11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Doctor
- Sprache: Deutsch
WENN MAN PLÖTZLICH ALLEINERZIEHENDER VATER IST — UND SICH IN DIE NANNY VERLIEBT
Seit dem Tod ihrer Eltern kümmert Eira sich um ihre jüngeren Geschwister und arbeitet als Vollzeit-Nanny, um die Rechnungen begleichen zu können. Doch als sie ein lukratives Jobangebot von Dax Cove erhält, zögert sie. Zu groß ist die Angst, die professionelle Grenze nicht wahren zu können, denn der attraktive Arzt gefällt ihr viel zu gut. Aber Dax ist als neuerdings alleinerziehender Vater einer kleinen Tochter heillos überfordert, und Eira kann einfach nicht ablehnen. Während Dax sich langsam an seine neue Rolle gewöhnt, kommen die beiden sich immer näher. Und es wird von Tag zu Tag schwerer, die Grenze, die Eira sich gesetzt hat, einzuhalten ...
»Für alle Fans von Nanny Romance ist dieses Buch ein Must-Read!« THE BRITISH BIBLIOPHILE
Der fünfte und letzte Band der DOCTOR-Reihe
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 393
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
INHALT
Titel
Zu diesem Buch
Leser:innenhinweis
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
Epilog
Die Autorin
Die Romane von Louise Bay bei LYX
Impressum
LOUISE BAY
Doctor Single Dad
Roman
Ins Deutsche übertragen von Wanda Martin
ZU DIESEM BUCH
Seit dem Tod ihrer Eltern kümmert Eira Cadogan sich aufopferungsvoll um ihre jüngeren Geschwister. Um die Miete und die Rechnungen begleichen zu können, arbeitet sie als Kindermädchen. Da kommt die Stellenanzeige eines vermögenden alleinerziehenden Vaters gerade richtig. Der attraktive Arzt Dax Cove sucht nach einer Vollzeit-Nanny für seinen Säugling. Dennoch zögert Eira, als ihr der Job angeboten wird. Zu groß ist die Angst, die professionelle Grenze nicht wahren zu können, denn der charmante Dax gefällt ihr viel zu gut. Aber der ist mit seiner Vaterrolle heillos überfordert, hat er doch erst vor Kurzem von der kleinen Guinevere erfahren, die bei einem One-Night-Stand entstanden ist, und Eira kann einfach nicht anders, als ihm zu helfen. Während Eira sich liebevoll um Guinevere kümmert und Dax sich langsam an seine neue Rolle gewöhnt, kommen die beiden sich immer näher. Und auf einmal wird es von Tag zu Tag schwerer, die Grenze, die Eira sich gesetzt hat, einzuhalten. Denn es wäre nur zu leicht, sich in diesem Traum von der perfekten kleinen Familie zu verlieren …
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Deshalb findet ihr hier eine Triggerwarnung.
Achtung: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch!
Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Leseerlebnis.
Euer LYX-Verlag
1. KAPITEL
DAX
Ich bin ein verdammtes Glückskind und gebe das nur zu gern zu.
Es gibt nichts in meinem Leben, was ich ändern würde, nicht mal diese Januarkälte, die heute früh besonders rau scheint.
Ich lebe im pulsierendsten Viertel der besten Stadt der Welt: London. Gleich vor meiner Haustür ist alles zu finden, was ich je brauchen werde, von Maßanzügen bis hin zu einigen der schönsten Frauen dieser Welt.
Am allermeisten liebe ich meine Arbeit. Nur dass ich sie nicht bloß liebe und dass es nicht bloß Arbeit für mich ist. Sie ist mehr als eine Passion – sie ist eine Berufung. Zu diesem Zweck bin ich auf dieser Welt.
Durch meine Arbeit in der klinischen Forschung wird sich das Leben von Millionen Menschen verbessern. Meine Laborarbeit ist mein Nachlass. Nicht viele Leute können von sich behaupten, dass man sich noch lange nach ihrem Tod an sie erinnern wird, doch da mein Team kurz vor einem frühzeitigen Durchbruch in der endokrinologischen Forschung ist, wird es zweifelsohne so sein.
Dieser Gedanke beflügelt mich immer, wenn ich auf dem Weg von meiner Wohnung in Marylebone zum UCH bin, dem University College Hospital. Es ist frühmorgens, noch nicht mal sechs, und noch dunkel, oder zumindest so dunkel es mitten in London jemals wird. Die meisten anderen aus meinem Forschungsteam kommen nicht vor neun, aber ein paar von uns starten gern mit einem Vorsprung in den Tag. Beziehungsweise ins Jahr, denn wir haben den zweiten Januar.
Gerade als die Automatiktür am Krankenhaushaupteingang aufspringt, spüre ich mein Handy in der Hosentasche vibrieren. Das muss einer meiner Brüder sein. Kurz überlege ich, es zu ignorieren – ich bin im Tunnel und will mich nicht mit einem ihrer sogenannten Notfälle befassen. Sie haben alle inzwischen Ehefrauen oder Freundinnen. Sie brauchen mich nicht. Doch ich grüße Mason, einen der Wachmänner am Empfangstresen, indem ich mir mit zwei Fingern an die Stirn tippe, und hole das Handy heraus.
Auf dem Display leuchtet eine Nummer in den USA, die ich nicht kenne.
Die Türen des Fahrstuhls gehen auf, doch ich betrete ihn nicht. Stattdessen nehme ich den Anruf an.
»Dax, hallo, hier ist Kelly«, sagt eine Frau.
Kelly … Kelly … Kelly?
Ich versuche, in meinem Hippocampus eine Verbindung herzustellen. Wer zum Teufel ist Kelly? Zum Glück macht sie es mir leicht.
»Vom Santorini.«
Sie meint nicht etwa die Insel, sondern das Restaurant am Ende meiner Straße. Allmählich macht es klick. Wenn ich spät aus dem Labor komme, gehe ich manchmal im Santorini auf einen Teller Tomaten-Keftedes vorbei, die sensationell schmecken. Kelly war dort Kellnerin. Eine Amerikanerin mit tiefschwarzen Haaren, olivgrünen Augen und einer klangvollen Stimme, als sollte sie Profi-Jazzsängerin werden.
Weitere Erinnerungen sickern durch. Vor ein paar Monaten stolperte ich in ihre Abschiedsparty hinein, als ich mich mit Vincent auf ein schnelles Feierabendbier traf. Sie erkannte mich. Wir verbrachten eine schöne Nacht zusammen. Shots. Sex. Ein super Frühstück am Morgen danach. Soweit ich mich erinnere, kehrte sie eine Woche später heim in die USA.
Wahrscheinlich ist es länger her als ein paar Monate. Eher … fast ein Jahr. Seitdem habe ich nichts von ihr gehört. Soweit ich mich erinnere, haben wir uns nie geschrieben, geschweige denn miteinander telefoniert. Haben wir überhaupt Nummern ausgetauscht?
Schätze schon.
»Hallo, Kelly.«
»Wie geht’s dir, Dax? Lange nichts voneinander gehört.«
Kann doch nicht sein, dass sie anruft, um mal zu quatschen. Was will sie? Ich kapiere schlicht nicht, wieso sie anruft. »Bin gerade bei der Arbeit angekommen. Was kann ich für dich tun?«
»Du musst einige Formulare unterschreiben. Damit sie Gültigkeit haben.«
»Ich glaube, du hast dich in der Nummer geirrt, Kelly. Hier ist Dax Cove. Wir haben uns fast ein Jahr nicht gesehen.«
Überzeugt, dass sie mich mit jemand anderem verwechselt, bin ich im Begriff aufzulegen, als sie sagt: »Tatsächlich haben wir uns vor neun Monaten zuletzt gesehen.«
Das kommt ungefähr hin, klingt allerdings seltsam präzise.
»Die Nacht war toll«, sagt sie. »Und als ich zurück in den Staaten war, stellte ich fest, dass ich schwanger bin.«
Hitze fährt mir in die Brust, und mir bleibt die Luft weg. »Ah.« Ich presse die Silbe hervor, als wäre sie ein Felsbrocken, den ich über eine Klippe hieve.
Neun Monate.
»Du brauchst dir deswegen keine Gedanken zu machen. Ich habe mich darum gekümmert.« Sie stößt ein Lachen aus. »Ich bin noch nicht bereit fürs Muttersein.«
Sich darum gekümmert? Was heißt das? Ich bin ganz sicher nicht bereit fürs Vatersein. Jetzt nicht und niemals. Dafür bin ich nicht auf dieser Welt. Anders als meine Brüder, die sich alle irgendwann vorstellen konnten, einmal Vater zu werden, wollte ich noch nie jemandes Dad sein.
»Wie gesagt, ich brauche nur deine Unterschrift auf einigen Formularen. Du stehst als Vater des Babys in der Geburtsurkunde, deshalb musst du die Adoptionseinwilligung unterzeichnen.«
Mehr Hitze fährt durch meinen Körper und in meine Glieder. Eine oder zwei oder drei Sekunden lang bin ich sprachlos. Ich kann kaum einen Gedanken fassen. »Du hast ein Baby gekriegt?«
»Ja«, sagt sie leicht gepresst. »Ich habe dich um nichts gebeten. Ich hab das alles über die Krankenversicherung meines Dads geregelt.«
Es dröhnt in meinen Ohren, ohne dass ich sagen kann, ob das Geräusch durchs Telefon dringt oder in meinem Kopf ist. Ich versuche zu schlucken, damit es weggeht, doch es bleibt. »Du … hast ein Baby gekriegt?«, frage ich, um zu verstehen, was genau geschehen ist.
»Ja. Sie wurde vor gut einer Stunde geboren.«
Sie.
Sie.
Sie.
»Und wann genau hattest du vor, mir das zu sagen?«
»Nie!«, antwortet sie. »Ich habe eine Familie gefunden, die sie adoptieren möchte. Ich habe alles geregelt. Mir war nur nicht klar, dass du die Papiere persönlich unterschreiben musst. So lauten die Vorschriften der Adoptionsagentur oder so. Mit den Einzelheiten bin ich durcheinander. Ich habe eben erst ein Kind zur Welt gebracht.«
»Die Adoptionspapiere«, versuche ich, den Wust an Informationen zu durchdringen, mit denen ich gerade beworfen werde. »Du wurdest also schwanger, hast heute das Kind bekommen und versuchst jetzt gerade in dem Moment, wo wir sprechen, das Kind zur Adoption freizugeben.«
Ich habe ein Kind. Auf dieser Welt. In diesem Moment.
Ich versuche, logisch vorzugehen. Die Informationen zu sortieren und zu überlegen, was ich tun, wie ich reagieren sollte. Meine Knie geben nach, als ich zu begreifen beginne, was gerade geschieht. Ich taumele Halt suchend Richtung Wand, ehe ich noch hinfalle. Das Dröhnen wird lauter, und ich halte mir das freie Ohr zu.
Ich weiß weder, was ich sagen, noch, was ich tun oder denken soll. Es ist, als hätte mein Hirn die exekutiven Funktionen eingebüßt oder so.
»Genau«, sagt sie. »Du musst in einem Videoanruf deinen Pass hochhalten, damit der Mann von der Adoptionsagentur weiß, dass du dein Einverständnis gibst. Dann musst du die Einwilligung unterschreiben. Mehr nicht.«
Ich habe ein Kind.
Eine Tochter.
Ich will kein Kind. Niemals. Kinder gehören nicht zu meinem Lebensplan. Ich habe null Interesse daran, es meinen Brüdern nachzutun – eine Familie zu gründen, Babys in die Welt zu setzen.
Nicht, dass ich meine Nichten nicht liebhabe. Schon. Ich kann bloß das Bedürfnis meiner Brüder nicht nachvollziehen, die eigene Zielstrebigkeit zu trüben. Eine unnötige Ablenkung zu schaffen. Popos abzuwischen und auf Bäuche zu prusten, statt Bedeutendes zu vollbringen, wie sie es alle durchaus könnten. Ich verstehe nicht, warum sie für so etwas Kleines so viel aufgeben wollen.
Sie haben sich dazu entschieden. Meine Eltern entschieden sich dazu. Ich definitiv nicht.
Ich habe Arbeit – eine, die Millionen Menschenleben verändern wird. Einen Menschen großzuziehen, kann nicht wichtiger sein als die vielen anderen, um die es geht.
Nichts von alledem ändert etwas an der Tatsache, dass ich jetzt zu diesem Zeitpunkt Vater bin. Ich habe ein Kind, das kurz davor ist, adoptiert zu werden … und obwohl ich überhaupt keine Tochter will, behagt mir etwas an der Vorstellung nicht, sie von anderen großziehen zu lassen.
Ich wurde von einem Ärztepaar erzogen, das es gewohnt war, Verantwortung für das Leben anderer zu tragen, und ebendieses Verantwortungs- und Pflichtbewusstsein haben sie auch allen meinen Brüdern und mir beigebracht. Anderen die Fürsorge für ein Kind zu überlassen, das ich in die Welt gesetzt habe, widerspricht meinen grundlegenden Überzeugungen – meinem Verständnis von der Welt.
Gleichzeitig war es nicht meine Entscheidung. Stimmt, ich habe entschieden, Sex mit Kelly zu haben. Stimmt, wer mit Sex einverstanden ist, erklärt sich implizit auch einverstanden, die Konsequenzen zu tragen. Aber ich habe wie immer Schritte unternommen, um die Wahrscheinlichkeit dieser Konsequenzen zu minimieren. Es war ein Unfall. Ein Fehler. Und das ändert nichts an der Tatsache, dass ich kein Vater sein will. Ich habe Höheres, Wichtigeres zu tun.
Ich brauche nur ein paar Formulare zu unterschreiben und mein Leben wird so sein wie vor weniger als fünf Minuten.
Also werde ich das machen. Unterschreiben. Vergessen, dass das je passiert ist. Weiter daran arbeiten, eine Million Menschenleben zu verändern anstatt nur eines.
2. KAPITEL
DAX
Ich tippe Vincents Namen ins Handy, und er geht vor dem ersten Klingeln ran.
»Ich muss mir deinen Jet leihen. Ich muss nach Washington, D. C.«, sage ich.
»Schön, von dir zu hören, Dax. Wie geht’s dir? Alles gut? Wie läuft’s mit der Arbeit?« Er zieht mich auf. Schön zu wissen, dass sich manches nie ändert, auch wenn meine Welt kopfsteht.
»Ist er verfügbar?«, gehe ich darüber hinweg.
»Du willst den Jet jetztsofort?«, fragt er. »Draußen ist es noch nicht mal hell.«
»Ja. Geht das?« Vielleicht hätte ich erst nachschauen sollen, ob ein Linienflug zu kriegen ist. Ich hätte mir Fragen von Vincent ersparen können.
Wie aufs Stichwort sagt er: »Was ist denn los? Wo brennt es?«
»Ist der Jet verfügbar?«, frage ich. »Mehr will ich nicht wissen. Wenn nicht, lass mich auflegen, damit ich mir eine Alternative suchen kann.« Ich habe zwar noch nie einen Jet gemietet, aber schwer kann das nicht sein. Ich sehe auf die Uhr. Fünf vor sechs. Mindestens zwei Stunden lang noch wird nichts aufhaben.
»Keine Ahnung. Ich weiß, dass ich ihn gerade nicht nutze, aber was einen Piloten betrifft …«
Während Vincent verstummt, fange ich an, mich zu fragen, wie ich das Baby ohne Pass nach Großbritannien bringen soll. Und ohne Windeln. Fuck. Woran hab ich sonst noch alles nicht gedacht? Mein Plan lautet bisher nur: erstens, Baby herholen; zweitens, eine Nanny einstellen; drittens, mit meinem Leben weitermachen.
Ich weiß nicht, ob es an meiner Erziehung lag, in meinen Genen quasi, oder bloß ein Bauchgefühl war, dass ich Kelly sagte, sie solle die Adoption abblasen. Wie auch immer, die Entscheidung ist gefallen. Ich kann mich nicht um meine Verantwortung für das Kind drücken. Ich war an ihrer Zeugung beteiligt, und jetzt ist es meine Pflicht, an ihrem … Dasein teilzuhaben, schätze ich.
Es ist meine Pflicht,dieses Kind abzuholen und sicherzustellen, dass für es gesorgt wird.
»Die Maschine steht am City Airport. Sie ist in einer halben Stunde bereit.« Vincents Ansage holt mich aus meiner Gedankenspirale.
»Echt?«
»Hör zu, ich hab keine Ahnung, was zum Teufel los ist, aber ich möchte helfen. Brauchst du jemanden, der dich hinfährt?«
»Ich kann ein Taxi nehmen.« Meinen Pass bewahre ich in meiner Schreibtischschublade auf, somit muss ich vorher noch nicht einmal nach Hause.
»Wie sieht’s mit einem Reisegefährten aus?«
»Was?«
»Ich habe ein bisschen Zeit. In einer Stunde kann ich am Airport sein. Wir können zusammen fliegen.«
Ich nicke, bevor ich etwas sage. »Ja, das wäre tatsächlich prima.« Ich finde die Kraft in den Beinen, um in den Eingangsbereich des Krankenhauses zurückzugehen, wo es einen Kiosk gibt, der ein seltsames Warensortiment von Zahnseide bis zu Pantoffeln führt. Genau das Richtige für mich, schließlich bin ich im Begriff, in die USA zu fliegen, um meine Tochter abzuholen.
»Brauchst du sonst noch was?«, will Vincent wissen.
Fast frage ich ihn, ob er Windeln dahat und vielleicht ein paar Babysachen, doch das würde mehr Fragen als Antworten bringen. Ich kann vor Ort noch besorgen, was ich brauche. Wie viel kann so ein Neugeborenes schon für einen schnellen Transatlantikflug binnen achtundvierzig Stunden nach der Geburt brauchen? »Nein, gerade nicht.«
»Wir sehen uns in einer Stunde.«
Er hat mich gar nicht gefragt, wozu ich den Jet brauche. Dafür bin ich ihm dankbarer, als er es je ahnen wird.
Die Flugbegleiterin bietet uns Champagner an, als wäre das vor acht Uhr morgens etwas ganz Logisches. Vincent und Jacob schütteln die Köpfe, ohne mich aus dem Blick zu lassen. Sie starren mich schon seit wir an Bord gegangen sind unentwegt an.
»Nein danke«, sage ich und versuche, den Mund zu einem Lächeln zu verziehen.
»Jetzt weiß ich, das was nicht stimmt«, meint Jacob und fuchtelt dabei mit dem Zeigefinger in meine Richtung. »Du hast gerade versucht, ein unechtes Lächeln aufzusetzen. Ich krieg echt Schiss. Lächeln tust du zwar selten, aber du gaukelst es nie vor. Niemand gegenüber. Was zur Hölle läuft hier?«
Er hat recht. Ich versuche, mich normal zu verhalten, obwohl ich mich überhaupt nicht so fühle. In mir herrscht Aufruhr, wie wenn man weiß, dass das Leben kurz davor ist, sich zu ändern, aber nicht bereit dafür ist. Nicht weil ich denke, der Entschluss, das Baby zu behalten, wäre die falsche Entscheidung gewesen. Eher weil ich nicht recht weiß, welche Konsequenzen meine Entscheidung haben wird. Hätte ich früher Bescheid gewusst, hätte ich eine Nanny einstellen und sie uns dabei begleiten können, das Baby abzuholen, dann wäre alles prima gewesen. Doch wahrscheinlich werde ich mich selbst um dieses Kind kümmern müssen, zumindest bis wir wieder in Großbritannien sind. Und ich habe keinen blassen Schimmer, wo ich anfangen soll.
Ich hole mein Handy heraus, um »Neugeborenes wie versorgen?« zu suchen. Essen, ein Bett, Windeln. Viel mehr braucht es doch wohl nicht?
»Dax, hast du mich gehört?«, fragt Jacob. »Was ist los? Wieso fliegen wir drei in die USA, obwohl ich eigentlich einen Pyjamatag damit verbringen sollte, Weetabix Crunch Cerealien zu essen, weil ich zwei Tage am Stück frei habe.« Er hört sich an wie früher, wenn Nathan ihn beim Kickern geschlagen hat – wie ein nöliger Teenager.
Vincent tätschelt ihm beruhigend den Arm.
»Keine Ahnung, wieso du hier bist«, erwidere ich, während ich auf dem Handydisplay nach oben streiche, unschlüssig, worum ich mich zuerst kümmern sollte. »Ich hab dich nicht gebeten mitzukommen.«
»Er hat’s von sich aus angeboten«, sagt Vincent. »Wir wollen dich unterstützen bei … dem hier, was immer es überhaupt ist.«
»Ich brauche keine Unterstützung.«
»Normalerweise nicht, stimmt«, meint Vincent. »Sonst bist du immer Mr Eigenständig, Mr ›Hab alles im Griff‹, ›Ich brauch euch Primitivlinge nicht‹. Aber heute hast du mich vor sechs Uhr morgens angerufen und wolltest dir meinen Jet ausleihen.« Ich schaue hoch, und unsere Blicke treffen sich. Er hält abwehrend die Hände hoch. »Ist kein Problem. Mein Jet ist dein Jet. Ich meine bloß, dass du mich noch kein einziges Mal um irgendwas gebeten hast. Niemals. Und du tust was, das nicht bis ins Kleinste durchgeplant ist. Mit einem Mal unternimmst du spontane Reisen in die USA und erbittest jetgroße Gefallen.«
»Es passt irgendwie nicht zu dir«, sagt Jacob ein bisschen weniger panisch als zuvor.
Ich zucke mit den Schultern und versuche, mich auf mein Handy zu konzentrieren. »Heute ist eben kein Tag wie sonst.« Nach einigen Sekunden drückender Stille setze ich hinzu: »Sonst werde ich nicht angerufen und kriege gesagt, dass ich Vater bin.«
Als ich schließlich hochschaue, starren Jacob und Vincent mich mit offenem Mund an. Vincent ist die Kinnlade heruntergeklappt, und bei so großen Augen, wie Jacob sie macht, besteht die zweiunddreißigprozentige Wahrscheinlichkeit, dass sie ihm rausfallen.
»Würdest du mal mit Details rausrücken?«, fragt Vincent.
Ich lege das Handy vor mir auf den Tisch und erzähle ihnen, was ich weiß – wobei es sich nicht um viel handelt.
»Du wolltest nie Kinder«, sagt Jacob. »Bist du dir sicher, dass du die richtige Entscheidung triffst?«
Als ich sechzehn war und überlegte, auf welche medizinische Fachrichtung ich mich spezialisieren soll, gab mir mein Dad einen Rat. Ich wollte schon mal frühzeitig anfangen, mich über verschiedene Unis zu informieren. Er sagte mir, wenn ich Schwierigkeiten hätte, mich zu entscheiden, solle ich mich auf etwas festlegen, aber weder jemandem davon erzählen, noch Schritte unternehmen, die die Entscheidung zementieren. Dann solle ich etwa einen Tag lang mit der Entscheidung herumlaufen wie in einem neuen paar Schuhe. Passt sie? Wie fühlt es sich an? Bereue ich etwas?
Ich hatte keine Stunde Zeit, schon gar keine vierundzwanzig, um meine Entscheidung, die Adoption abzublasen, auszutesten, doch ich weiß, dass ich das Richtige tue. Obwohl es mitnichten eine leichte Wahl ist, war sie nicht schwer. Ich spüre die Richtigkeit bis ins Mark.
»Ich weiß bloß, dass ich nicht irgendwo ein Kind haben könnte, das von jemand anderen aufgezogen wird. Ich bin für es verantwortlich.«
»Für sie«, sagt Jacob leise.
»Für sie was?«, frage ich.
»Für sie verantwortlich. Nicht es.«
Stimmt. Für sie. Ein konkretes Babymädchen. Ich reagiere mit einem kurzen, knappen Nicken auf die Berichtigung, sage jedoch nichts weiter.
»Ich gebe jetzt mal kurz das Arschloch«, sagt Vincent, »aber hast du überprüft, ob –«
»Ich habe das Krankenhaus gebeten, eine Blutprobe zu nehmen. Von mir auch, sobald ich dort bin. Aber kommt schon, Leute. Kelly hatte nicht vor, es mir jemals zu sagen. Sie hat nichts davon, mir vorzuspielen, ich sei der Vater. Und es ist auch nicht so, dass sie finanzielle Unterstützung verlangt hätte. Mich anzurufen, war ganz offensichtlich ihr letzter Ausweg.«
»Stimmt wohl«, sagt Jacob. »Also, was wird, wenn du mit dem Baby zu Hause in London bist. Wie können wir dann helfen? Wir sind deine Brüder, Dax. Du kannst uns um Hilfe bitten, weißt du.«
»Ich muss eine Nanny organisieren, die alles Weitere organisiert. Es dürfte keine allzu große Umstellung werden.«
Jacob schnaubt. »Na gut. Alles weiter wie gehabt, sobald du wieder zu Hause bist.«
Ich zucke leicht abwehrend mit den Schultern. »Ja. So ungefähr. Ich muss eins der beiden freien Zimmer zum Kinderzimmer machen, aber –«
»Meinst du nicht, dass du umziehen solltest?«, unterbricht mich Vincent.
»Ich kann zu Fuß zur Arbeit gehen. Warum sollte ich umziehen?«
»Mehr Platz. Soll die Nanny bei euch wohnen?«
Darüber habe ich noch nicht nachgedacht. Die Nanny soll auf jeden Fall einziehen, und ich nehme an, sie kann sich das Zimmer nicht mit dem Kind teilen. Das dritte und letzte Zimmer wird das der Nanny werden müssen. Dann bleibt aber kein Platz mehr für mein Arbeitszimmer. Vielleicht sollte ich mir irgendwann eine größere Wohnung zulegen.
»Das Kind misst keinen halben Meter«, sage ich. »Es wird nicht viel Platz brauchen.«
»Sie wird mehr brauchen, als du denkst«, erwidert Vincent. »Als Erstes mal einen Namen.«
»Weiß ich«, sage ich, obwohl ich mir über Namen noch gar keine Gedanken gemacht habe. Dem Kind einen Namen zu geben, stand auf keiner der Neugeborenen-Checklisten, die ich überflogen habe, seit wir an Bord des Jets sind.
»Vielleicht nimmst du einen mit D«, schlägt Jacob vor. »Damit er zu deinem passt.«
Ich zucke entsetzt zurück. »Im Ernst?« Kopfschüttelnd versuche ich, den Gedanken zu löschen. »Vielleicht nimmst du mal Therapie. Mir fallen direkt etliche Fragen zu deinem Verhältnis zu Mum und Dad ein. Und zu deinem Ego. Klares Nein.«
»Hast du denn einen Namen im Sinn?«, fragt Vincent. »Wir hatten schon Monate im Voraus einen ausgesucht.«
»Noch kenne ich –« Ich bin im Begriff, »es« zu sagen, als mir aufgeht, dass Jacob und Vincent mir dann wahrscheinlich was erzählen, also setze ich neu an. »Noch kenne ich sie ja gar nicht. Ich will keinen Namen aussuchen, der dann … nicht passt.«
»Wie unpragmatisch von dir«, kommentiert Jacob.
»Das ist nur der Anfang«, meint Vincent. Er grinst, als wüsste er ein Geheimnis. »Ich hab so das Gefühl, jetzt wo er Vater ist, werden wir einen ganz anderen Dax kennenlernen.«
Ich unterdrücke den Drang aufzustöhnen. »Es wird keinen anderen Dax geben. Ich habe eine Wiege bestellt, Milch, so Strampler-Babyschlafanzüge, Fläschchen und Windeln. Ich war sehr pragmatisch. Ich weiß bloß noch keinen Namen.« Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, werde ich wohl einen Namen aussuchen müssen, damit ich einen Pass beantragen kann. Vielleicht sollte ich mir ein paar Optionen überlegen. Wie geht man nur daran, einem anderen Menschen einen Namen zu geben? Das erscheint mir … bizarr.
»Wart’s ab, bis sie dich vollkackt«, meint Vincent und lacht in sich hinein. »Das wird eine wunderbare Erfahrung. Ich kann’s nicht erwarten, sie mit dir zu teilen.«
Siewirdmichnichtvollkacken, denke ich im Stillen. Um die Kackwindeln wird sich die Nanny kümmern. Ich sage nicht, dass ich das Kind nie anrühren werde, und wenn sie älter ist, werden wir uns natürlich unterhalten und Zeit zusammen verbringen. Aber meine Forschungsarbeit muss an erster Stelle stehen. Ich führe bereits ein ausgefülltes Leben, und ich habe vor, meine Prioritäten auch beizubehalten, wenn es – wenn sie bei mir lebt.
Ich werde sicherstellen, dass sie eine liebe und fähige Nanny hat. Ich sorge dafür, dass sie die besten Schulen besucht und ihr alle Möglichkeiten offenstehen. Aber ich werde kein Vater sein, der Sabber wegmacht und volle Windeln wechselt. Ich werde weder in Babysprache mit ihr reden noch ihr Schlaflieder vorsingen.
»Du wirst ein toller Vater sein«, meint Vincent. »Alles wird … sich neu fügen, wenn du sie siehst. Lass dir das gesagt sein.«
Ich werde seiner Annahme nicht widersprechen, sonst führt das nur zu einer endlosen Diskussion. Abgesehen von der Zimmeraufteilung meiner Wohnung muss sich gar nichts ändern. Es geht bloß um ein winziges Menschlein, das eine Vollzeitbetreuung haben wird. Wenn die Nanny ihren Job richtig macht, vergesse ich wahrscheinlich, dass das Kind überhaupt im Haus ist.
3. KAPITEL
DAX
Ich fühle mich, als würde ich vom FBI verhört. Seit sie mir das Testergebnis gebracht haben, welches bestätigte, dass ich der biologische Vater des Kinds bin, das Kelly geboren hat, spreche ich schon zwei Stunden lang mit Leuten vom Krankenhaus und von der Adoptionsagentur. Ich versuche, sie zu überzeugen, dass ich das Baby ganz bestimmt nicht zur Adoption freigeben will und ich es mir ganz bestimmt nicht anders überlegen werde.
»Ich möchte bitte das Kind sehen«, sage ich und stehe dabei auf. Denen sind die Fragen und Bedenken ausgegangen, und ich war so geduldig, wie ich nur kann. Ich habe Dinge zu erledigen, eine Arbeit, zu der ich zurückmuss. Ich kann nicht herumsitzen, bis diese Leute – die kein Verfügungsrecht über mein Kind haben – aufhören, sich so wichtig zu nehmen.
»Ich gebe Ihnen meine Visitenkarte«, sagt die kleine blonde Frau mit den roten Fingernägeln von der Adoptionsagentur. »Ich weiß nicht genau, wie Adoptionen in Großbritannien ablaufen, aber wir könnten Ihnen bei dem Verfahren helfen, Ihr Kind wieder in die USA zu bringen und –«
»Wo geht es hier raus? Wo ist das Baby?« Ich fange an, hinter die Türen des kleinen Raums zu schauen, in dem wir uns befinden.
»Wenn Sie hier warten, bringen wir Ihnen ihre Tochter her«, sagt die ältere Frau.
»Ich möchte sie sofort sehen«, erwidere ich. »Oder sonst die Person sprechen, die hier die Leitung innehat.«
»Es kann gleich losgehen«, versichert mir die ältere Frau und schenkt mir ein Lächeln, das sagt, dass sie mich versteht und die andere Frau in Schach halten wird.
»Kommst du klar?«, fragt Vincent von dem Sofa hinten im Raum her, auf dem er sitzt.
»Ja, ich will bloß, dass es vorangeht. Ich muss einen Pass beantragen, damit wir hier wegkommen.«
»Keine Eile, Kumpel. Im Ernst, wir bleiben so lange hier wie nötig.«
Es ist nicht so, als hätten Vincent und Jacob nichts Besseres zu tun. Haben sie ganz sicher. Aber ich weiß zu schätzen, dass er so tut, als wäre er irgendein untätiger Aristokrat, dessen Mailpostfach nicht überquillt und dessen Frau ihn nicht wieder zu Hause erwartet.
Die Tür geht auf, und die ältere Krankenhausangestellte kommt zurück. »Mr Cove, es ist mir eine Freude, Ihnen Ihre Tochter vorzustellen.« Das Wort Tochter poltert durch meinen Kopf wie eine Handvoll Murmeln durch eine Höhle. Ich versuche, das lärmende Geräusch abzuschütteln. Die Krankenschwester schiebt ein transparentes Tablett auf einem Gestell mit Rädern herein, genau so eines gab es auch, als ich Madison und Nathan im Krankenhaus besuchte.
Ich schlucke. »Ja«, sage ich. »Danke.«
Sie schiebt das Bettchen neben mich, und als ich hinunterschaue, ist da ein Deckenbündel und ein Mützchen und ein kleines Stück Gesicht.
Meine Tochter.
Meine Knie geben nach – was ich vor heute nicht kannte, mir jetzt aber besorgniserregend vertraut wird. Ich klammere mich an der Kante des Stubenwagens fest, damit ich nicht umkippe. Vielleicht bin ich dehydriert. Oder kriege vielleicht einen Infekt.
»Ich lasse Sie beide ein paar Minuten allein und schicke dann eine der Schwestern mit den Entlassungspapieren vorbei.«
Ich nicke, während ich das komisch aussehende Wesen im Stubenwagen betrachte.
»Ach, hab ich ganz vergessen«, sage ich. »Ist Kelly hier? Kann ich mit ihr sprechen?«
Die Frau verzieht das Gesicht. »Sie wurde entlassen und ist vor ein paar Stunden gegangen.« Sie blättert durch die Unterlagen, die sie dabeihat. »Aber das hier hat sie Ihnen dagelassen.«
Es ist ein verschlossener brauner Umschlag. Als die Frau geht, setze ich mich wieder hin, nehme die Unterlagen heraus und überprüfe, dass alles korrekt unterschrieben ist. Während wir auf dem Weg hierher waren, habe ich meine Anwälte Dokumente aufsetzen lassen. Sie hat alles unterschrieben, auf sämtliche Rechte verzichtet und überlässt mir vollumfänglich das Sorgerecht für das Kind. Ich möchte keine Unklarheiten. Kelly wollte das Baby zur Adoption freigeben, und unterm Strich wird es für sie keinen Unterschied geben. Sie hat nichts mit dem Kind zu schaffen. Das ist jetzt meine Aufgabe.
Ich stecke die Unterlagen wieder in den Umschlag und packe ihn in meinen Rucksack. Es gibt keine Notiz, keine Postanschrift. Macht die Sache bedeutend leichter.
Als ich den Rucksack zumache, steht Vincent über den Stubenwagen gebeugt, und ich stelle mich zu ihm.
»Sie schläft«, sage ich.
»Das machen sie anfangs viel«, meint Vincent.
Keine Ahnung, wo der Gedanke herkommt, aber ehe ich nachdenken kann, platze ich heraus: »Woher weiß man, dass sie tatsächlich schläft und nicht etwa …« Ich bekomme das Wort tot nicht heraus, meine es jedoch.
»Es gibt einen Sensor zum Anklippen an die Windel«, sagt Vincent. »Der registriert, wenn keine Bewegung stattfindet.«
Mein Herz krampft sich leicht zusammen. Nach Suttons und Jacobs Fehlgeburt war die Freude über Vincents und Kates Baby ein Stück weit von Angst begleitet. Hoffentlich wird es für alle leichter, nachdem Sutton an Weihnachten verkündet hat, dass sie im vierten Monat schwanger ist. Doch ich kann seine Sorge spüren.
»So einen sollte ich vielleicht besorgen«, sage ich.
»Nimmst du sie auch mal hoch?«, fragt er.
Ich kratze mich im Nacken. »Ich will sie nicht wecken. Nicht ehe die ganzen Entlassungspapiere unterschrieben sind und wir gehen.«
Vincent grinst das Baby an wie ein Idiot. »Hast du es deinen Eltern schon gesagt?«, fragt er, ohne den Blick vom Stubenwagen abzuwenden.
Ich schüttele den Kopf. »Ich rufe sie auf dem Rückflug an.«
»Du weißt doch, dass sie es gut aufnehmen werden.« Er lacht auf. »Wer hätte gedacht, dass du mal vor mir Vater wirst?«
Wenn man bedenkt, dass dies ein Wettlauf war, bei dem ich eigentlich nie mitmachen wollte, lautet die Antwort mit Sicherheit: »niemand«.
Ich seufze. Ich mache mir keine Sorgen um die Reaktion meiner Eltern. Ich weiß, dass sie ganz aus dem Häuschen sein werden – auch wenn die Umstände etwas unkonventionell sind. Ich will einfach bloß, dass wieder Normalität einkehrt. Ich wünschte, wir könnten den Teil vorspulen, wo ich alle aus der Familie einladen muss vorbeizukommen, damit sie sie kennenlernen, sie in Babysprache betuddeln und mir tausend Fragen stellen, auf die ich keine Antworten habe. Ich möchte die Nanny dahaben und dass für uns alle Routine herrscht. Dann kann wieder Normalität einkehren.
Jacob kommt zur Tür hereingestürzt, er sieht leicht zerzaust aus. »Ich hab eine gekriegt.« Er hält eine Babyschale fürs Auto hoch. »Die passt auf den Kinderwagen, den ich besorgt habe. Du kannst sie herumschieben.«
»Danke«, sage ich und blicke zum Baby. »Lassen wir sie noch in diesem Bettchendings, bis ich die Entlassungspapiere habe.«
Als Jacob meinem Blick folgt, schmilzt sein Gesichtsausdruck augenblicklich dahin. »Oh, da ist sie ja.« Er beugt sich über sie. »Hallo, Baby Cove. Ich bin dein Onkel Jacob«, gurrt er. »Ich bekomme bald eine Tochter. Ihr zwei werdet beste Freundinnen.«
»Mich wird sie lieber mögen«, wirft Vincent ein.
»Nie im Leben, ich kann super mit Kindern. Das ist mein Job.« Er geht zur anderen Seite des Raums und wäscht sich die Hände an einem Waschbecken, das ich nicht einmal wahrgenommen hatte. »Hast du sie schon hochgenommen?«, fragt er. Mit sauberen Händen streichelt er ihre Wange, und sie dreht ihr Köpfchen zu seinem Finger.
»Hallo, du süße Kleine«, sagt er.
Sie hat die Augen zu, bewegt aber im Schlaf den Mund, sodass er ein perfektes »O« bildet, woraufhin meine Mundwinkel zucken. Ich strecke die Hand aus, berühre mit den Fingerspitzen ihre Stirn und ziehe dann ruckartig die Hand weg.
Wieder geht die Tür auf, und eine Krankenschwester sowie jemand in OP-Kleidung kommen herein. Wir gehen die Entlassungspapiere durch, während Vincent und Jacob um die Aufmerksamkeit meiner Tochter wetteifern.
»Das war’s«, verkünde ich ihnen. »Wir können gehen.«
»Legst du sie in die Babyschale?«, fragt Vincent.
»Klar.« Ich gehe mir die Hände waschen. Es ist nicht so, als hätte ich noch nie ein Neugeborenes gehalten. Doch, na klar – ich habe als Arzt in Weiterbildung in der Geburtshilfe gearbeitet. Doch ich habe noch nie ein Neugeborenes gehalten, für das … ich verantwortlich bin. Ich habe das Gefühl, ich vermassle es gleich und lasse sie fallen oder so.
Ich schiebe eine Hand unter ihren Kopf, die andere unter ihren Po und hebe sie hoch. Sind Babys immer so leicht? Es kommt mir vor, als könnte es leicht passieren, dass ich sie zu fest drücke oder sie durch ein Stolpern ans andere Ende des Raums befördere. Sie ist so zart. Zerbrechlich. Ich muss gegen den Drang ankämpfen, die Wange an ihr Köpfchen zu schmiegen. Keine Ahnung, wen ich beruhigen möchte – sie oder mich.
Ich nicke Jacob zu. »Wie viel wiegt sie?«, frage ich. »Kannst du mal in dem Heftchen nachsehen, das sie mir gegeben haben?«
»Sieben Pfund und zwei Unzen«, liest er vor. »Also gut drei Kilo. Genau richtig.«
Ich schnalle sie in der Schale an und teste die Gurte, um sicherzugehen, dass sie auch festgezogen sind. Ihre besockten Füße ragen unter der Decke hervor, ihr dünnen, nackten Beinchen schauen heraus.
»Ich brauche noch eine zweite Decke«, sage ich und nehme mir innerlich vor, auf dem Rückflug ein paar Onlineeinkäufe zu machen. Wir werden einige Decken brauchen. Und Socken.
»Es liegt eine im Auto«, erwidert Jacob. »Ich habe neben der Babyschale noch ein paar andere Sachen besorgt. Nur dies und das, was du brauchen wirst, bis wir zurück in London sind.«
»Gut«, sage ich. »Wenn wir erst mit einer Nanny zu Hause sind und sich eine Routine eingestellt hat, normalisiert sich alles wieder.«
Grinsend drückt Jacob den Rufknopf des Fahrstuhls. »Nichts wird sich je wieder normalisieren, das sag ich dir.«
Ich schaue hinunter zu dem Kind, das friedlich in seiner Babyschale schlummert – und mit einem Mal weiß ich, wie ich sie nennen werde. »Ihr Name ist Guinevere.«
»War ja klar«, stöhnt Jacob.
Als wir Kinder waren, hat mich Jacob immer mit meinem Faible für die Artussage aufgezogen. Aber der Name passt. Er ist ungewöhnlich, aber man merkt ihn sich. Neve und Gwen sind beides hübsche Spitznamen, und er klingt in Kombination mit Cove gut.
»Als zweiten Vornamen kann sie Mums Namen bekommen. Das wäre also abgehakt. Jetzt können wir den Pass beantragen.«
Je schneller wir den Pass haben, desto schneller können wir nach Hause, desto schneller kann ich eine Nanny einstellen und zu meinem Leben vor Kellys Anruf zurückkehren. In ein paar Tagen wird sich alles wieder normalisiert haben.
4. KAPITEL
DAX
Sämtliche Lebensläufe, die ich mir angesehen habe, sind tadellos, doch die potenziellen Nannys, mit denen ich Vorstellungsgespräche führe, passen einfach nicht.
»Hast du mitgekriegt, wie sie sich ständig in die Haare gefasst hat?«, frage ich, als ich die Wohnungstür schließe. »Sie kümmert sich um ein Neugeborenes. Da kann sie sich nicht ständig in die Haare fassen. Das ist unhygienisch.« Ich zerreiße den Lebenslauf und werfe ihn auf dem Weg zurück ins Wohnzimmer in den Papierkorb. »Sie mag damals Nanny bei den Beckhams gewesen sein, aber bei mir wird sie es nicht.«
»Mir ist nicht aufgefallen, dass sie sich ins Haar gefasst hat«, antwortet Nathan.
Natürlich nicht. Nathan ist nicht gerade für sein Auge fürs Detail bekannt.
»Auf so was sollst du doch achten, damit ich mich drauf konzentrieren kann, was sie erzählen.«
»Gut«, sagt er. »Wer ist als Nächstes dran?« Gähnend streckt er sich gemächlich auf der Couch aus, als würde er gleich Fußball gucken.
Kapiert er es nicht? Dies ist ein Notfall. Ich muss eine Nanny finden. Die Kurzzeitnanny, die die letzten drei Tage hier war, fängt morgen bei einer anderen Familie an. Ich muss heute jemanden finden.
Es klopft an der Tür. »Eigentlich sollte erst in einer halben Stunde wieder jemand kommen«, sage ich.
Nathan macht ein schuldbewusstes Gesicht.
»Was hast du getan?«, frage ich, während ich aufstehe, um die Tür aufzumachen.
Auf der Schwelle stehen Jacob und Vincent. »Was wollt ihr zwei denn hier?«
»Unsere Nichte besuchen«, antwortet Jacob.
»Wir haben Onkel-Besuchsrecht«, sagt Vincent.
»Gott sei Dank, dass ihr da seid«, meint Nathan. »Er macht mich wahnsinnig. Ich war bei sechs Vorstellungsgesprächen dabei, alle mit total guten Nannys, bei denen er jedes Mal fadenscheinige Gründe gefunden hat, sie abzulehnen.«
»Hygiene ist kein fadenscheiniger Grund«, erwidere ich.
»Sie hat sich nicht in die Haare gefasst, Kumpel«, sagt Nathan. »Jede der Nannys, die wir heute gesprochen haben, wäre total in Ordnung.«
»Dies ist meine einzige Aufgabe in Bezug auf Guinevere. Ich muss eine anständige Nanny finden.« Ich werde ein furchtbar schlechter Vater sein, das weiß ich. Das Mindeste, was ich tun kann, ist sicherzustellen, dass sie eine hervorragende Nanny hat.
Jacob grinst mich an. »Du hast mehr als eine Aufgabe. Und du wirst einen Haufen Fehler machen. Mir ist klar, dass dir diese Aussicht nicht behagt, aber daran gewöhnst du dich.«
»Reiß dich mal zusammen«, wirft Vincent ein. »Wer steht als Nächstes auf der Liste?«
Nathan nimmt seine Jacke. »Ich bin dann mal weg. Ich muss mir selbst Gedanken um eine Nanny machen. Viel Glück, Leute. Vielleicht findet ihr jemanden, bis die süße, kleine Guinevere achtzehn geworden ist.«
»Vielen Dank für deine Hilfe«, sage ich, ohne meinen Sarkasmus verbergen zu können, als Nathan auf dem Weg zur Tür an mir vorbeigeht.
»Dax, ich habe fünf Stunden hier gesessen, um dir zu helfen, während du nur rumgeeiert und rumgetrödelt hast. Triff eine Entscheidung, Mann.«
»Er hat recht«, meint Jacob. »Niemand wird gut genug sein, sich um deine Tochter zu kümmern, aber sofern du nicht deine Arbeit aufgeben und es selbst machen willst, brauchst du jemanden.«
Bei dem Wort Tochter stellt sich ein Kribbeln in meinem Nacken ein. So empfinde ich sie nicht. Für mich ist sie einfach Guinevere, ein Kind, für das ich Sorge tragen muss, damit es – gefüttert, gekleidet und erzogen wird.
Er nimmt mir die Unterlagen aus der Hand. »Wer ist das? Die nächste Kandidatin?«
Es klingelt an der Tür.
»Sei nett zu ihr«, zischelt Jacob.
Ich bin zu ihnen allen nett. Was kann ich denn dafür, dass sie nicht den Anforderungen entsprechen? Die hier kommt zwanzig Minuten zu früh. Kann sie etwa die Uhr nicht richtig lesen?
Ich reiße die Tür auf und werde von jemandes Hinterkopf begrüßt, ihr fast schwarzes Haar türmt sich auf, als hätte sie versucht, lauter Heu in eine Mülltüte zu stopfen.
Als sie sich umdreht, scheint ihr Lächeln die Hälfte ihres Gesichts einzunehmen. »Guten Tag. Dax Cove? Ich bin Eira Cadogan.«
Sie trägt einen weinroten Mantel mit kleinen schwarzen Knöpfen. In einer Hand hat sie einen Schirm und über der anderen Schulter eine riesige Tasche, als gehörte ihr der Job schon und sie sei bereit einzuziehen. Irgendwie kommt sie mir vage bekannt vor, ich kann jedoch nicht verorten, wo ich sie vielleicht schon einmal gesehen habe.
»Tut mir leid«, sie schaut an sich herunter, »ich bin voller Matsch.«
Stimmt. Überall auf ihrem Mantel sind Dreckspritzer. Sie blickt zu mir hoch und grinst verschwörerisch, als teilten wir einen Insiderwitz. Tun wir aber nicht. Ich will nicht, dass sich eine Person um mein Kind kümmert, die nicht mal zu einem Vorstellungsgespräch erscheinen kann, ohne auszusehen, als käme sie ramponiert aus einem Kampf mit einem Schwein im Stall.
»Ich glaube, Sie haben da welchen im Gesicht«, sage ich, wobei ich ein Stück vortrete, um genauer nachzusehen. Hat es überhaupt Sinn und Zweck, die hier hereinzulassen? Es ist Zeitverschwendung. Sie ist buchstäblich voller Matsch.
Sie verdreht die Augen, als wäre der Matsch ein nerviges Kind, um das man sich kümmern muss. »Würden Sie mir fünf Minuten geben, um mich sauber zu machen? Es ist jeden Januar dasselbe. Pfützen und Matsch. Man kommt nicht drum herum.«
Wir befinden uns mitten in London. Es ist nicht schwer, um Matsch herumzukommen. Vielmehr würde ich sagen, dass es schwierig ist, welchen zu finden.
»Ich nehme an, einfach –«
Sie schiebt sich an mir vorbei und steuert den hinteren Teil der Wohnung an. »Gleich dahinten?«
»Ja, ganz hinten rechts.« Stöhnend lege ich den Kopf in den Nacken. Ich möchte einfach bloß jemand Gutes finden. Diese Prozedur geht mir voll auf den Sack.
Jacob und Vincent ziehen mich ins Wohnzimmer. »Dieser Lebenslauf ist hervorragend«, meint Vincent. »Portland-Nannys sind die besten«, sagt er. »Sie arbeiten für die Königshäuser dieser Welt.«
»Ich habe heute gelernt, dass Lebensläufe nichts zu sagen haben. Diese eine habe ich nämlich gerade kennengelernt und sie ist’s nicht. Sie ist voller Matsch, Herrgott noch mal. Wie soll sie auf ein Kind aufpassen, wenn sie selbst nicht mal klarkommt?«
»Bei dem Wetter kann jeder Matsch abbekommen«, findet Jacob. »Deswegen kannst du doch niemanden abschreiben.« Als Guinevere zu weinen anfängt, versuche ich, mir nicht anmerken zu lassen, dass ich das extrem lästig finde. Sie hat alles, was sie braucht. Wieso weint sie? Das ist total unsinnig. Ich versuche, sie auszublenden. Die Kurzzeitnanny wird sich kümmern.
»Dieser Lebenslauf ist wirklich toll«, sagt Jacob. »Unter ihren früheren Stationen sind einige beeindruckend hochrangige Namen. Ich wette allerdings, sie ist teuer.«
»Die Frau kriegt die Stelle nicht. Sie sieht aus wie jemand, der Dreck anzieht wie ein Magnet. Sie ist …« Ich verziehe das Gesicht. »Schmutzig.«
Vincent fasst mich bei den Schultern. »Reiß dich zusammen. Nathan hat uns gesagt, was hier los ist. Sofern diese Frau nicht eine Echse rausholt und fragt, ob ihr Babys fressendes Reptil mit hier einziehen kann, musst du ihr die Stelle anbieten.«
»Muss ich nicht.«
»Dann stehst du allein mit einem drei Tage alten Baby da.«
Ehrlich gesagt lasse ich lieber eine Babys fressende Echse auf Guinevere aufpassen, als es selbst zu tun. »Das stimmt, ich muss heute jemanden finden, aber diese Frau wird es nicht. Die Nächste ist bestimmt besser.«
»Es gibt keine Nächste«, wendet Jacob ein. »Nathan sagte, dass du bereits mit sechs von sieben gesprochen hast.«
Ich fange an, die ausgedruckten Lebensläufe auf dem Couchtisch durchzugehen. »Ich bin sicher, es kommen noch ein paar.« Ich schnappe mir die Tabelle, die ich gestern Abend erstellt habe, in der linken Spalte stehen die Kandidatinnen und darüber die fünfzehn Eigenschaften, die mir wichtig sind. In jeder Kategorie bekommt die Bewerberin bis zu zehn Punkte, was einen möglichen Gesamtwert von 150 Punkten ergibt. Sechs waren schon da, und keine hat mehr als fünfundzwanzig Punkte. Es ist nur noch eine einzige Zeile leer.
Jacob hat recht – die Schweineringerin ist die letzte Kandidatin heute.
»War klar, dass du eine Tabelle hast.« Jacob reißt mir das Blatt aus der Hand. »Fünfundzwanzig?! Das ist lächerlich.« Er schüttelt den Kopf. »Ich werde die Kandidatin bewerten, die eben gekommen ist. Wenn sie mehr als hundert Punkte kriegt, musst du sie einstellen. Du kannst doch nicht noch Ewigkeiten lang Vorstellungsgespräche mit Nannys führen.«
»Du wirst Guineveres Nanny nicht aussuchen. Das ist meine Aufgabe.«
»Die du ehrlicherweise aber nicht erledigst«, wirft Vincent ein.
»Hohe Ansprüche zu haben, ist doch nichts Falsches.« Die Frau, die eben gekommen ist – ich sehe zur Bestätigung in der Tabelle nach, dass sie Eira Cadogan heißt –, geht meiner Meinung nach gar nicht. Wenn sie es fertigbringt, voller Matschspritzer zu einem Vorstellungsgespräch zu erscheinen, wie um alles in der Welt soll ich dann mit ihr zusammenleben?
»Hohe Ansprüche sind in Ordnung«, sagt Vincent. »Unerreichbare Ansprüche nicht.«
Ich schiebe die Hände in die Hosentaschen, weil mir unbehaglich ist, wie altbekannt mir dieses Gespräch vorkommt. Über die Jahre habe ich es mit Lehrern geführt, mit meinem Vater, mit Professoren. Meistens war es total scheinheilig, denn die Kritik kam von Menschen, die genauso perfektionistisch sind wie ich.
»Komm schon«, sagt Jacob. »Wir sind hier, um dir eine Entscheidungshilfe zu sein. Ich verspreche, dass wir unsere Nichte keiner Gefahr aussetzen werden. Wir wollen das Beste für sie.« Er nickt mit dem Kopf seitwärts Richtung Tür. »Lass uns mit dieser Frau sprechen. Gib ihr eine Chance. Vielleicht ist sie super für dich und Klein-Gwinnie.«
Ich widerstehe dem Impuls, über den Spitznamen zu stöhnen.
Als ich den Kopf zur Tür hinausstrecke, ist im Flur jedoch keine Spur von ihr zu sehen. »Wo ist sie?«, frage ich. Vincent und Jacob schauen sich nur an.
»Vielleicht hat sie uns gehört und ist gegangen. Wahrscheinlich denkt sie, für dich zu arbeiten, wäre ein Albtraum«, sagt Vincent. »Weiß gar nicht, wie sie darauf kommt.«
Sie kann unmöglich immer noch auf der Toilette sein. Matschbekleckert und auch noch mit Verdauungsstörungen? Das überspannt den Bogen. Als ich durch den Flur gehe, stelle ich fest, dass die Toilettentür zu ist. Darmprobleme, war ja klar. Ich verdrehe die Augen. Das reicht. Es hat absolut keinen Sinn, überhaupt mit dieser Frau zu sprechen.
Eine schöne Singstimme dringt über den Flur. Ich habe die Kurzzeitnanny zwar bislang nie singen gehört, aber ich meine, mich zu erinnern, dass Gesang gut für die Hirnentwicklung von Babys sein soll. In der Absicht, nachzufragen, ob es klug wäre, von dem fröhlichen Schlaflied zu Mozart überzuwechseln, folge ich dem Klang in Guineveres provisorisches Kinderzimmer – nur um dort eine nicht länger matschverkrustete Miss Cadogan vorzufinden, die Guinevere auf der Schulter trägt und ihr vorsingt.
Als sie mich bemerkt, wird ihr ohnehin schon breites Lächeln noch breiter.
»Sie haben eine wunderschöne Tochter.« Der Dreck auf ihrer Wange ist weg, und sie hat den Mantel ausgezogen. Ihr Haar ist nicht unbedingt ordentlich, aber sie sieht nicht mehr so zerzaust aus wie vorhin, als sie vor der Tür stand. »Sie ist ein Schatz.« Sie legt die nun fest eingeschlafene Guinevere wieder in ihr Babybett, das Weinen hat ein Ende.
Die Kurzzeitnanny kommt ins Zimmer geeilt. »Entschuldigung, ich musste mal kurz auf die Toilette.« Sie späht zum Baby. »Schläft sie?«
Eira lächelt. »Klar doch. Bei dem Lied schlafen alle Babys ein.« Sie kneift die Augen zusammen, aber sie … funkeln … irgendwie trotzdem. »Es ist meine Geheimwaffe.« Sie zwinkert mir zu. »Sollen wir?«
Für einen Sekundenbruchteil frage ich mich, was sie meint, dann fällt mir wieder ein, dass sie zum Vorstellungsgespräch da ist.
»Ich hoffe, es macht Ihnen nichts aus, aber meine Brüder werden auch dabei sein. Sie haben mehr Erfahrung mit so was.«
»Kein Problem«, sagt sie und schwebt an mir vorbei, als wäre sie hier in ihrer Wohnung und wüsste genau, wo es langgeht.
Zu viert setzen wir uns ins Wohnzimmer, Eira auf den Barcelona-Sessel am Fenster, wir drei ihr gegenüber auf die Couch. Eira reagiert gut auf unsere Fragen. Dass wir zu dritt sind, scheint sie nicht einzuschüchtern, und sie spielt uns die Antworten auf unsere Fragen volley zurück, als wäre sie Markéta Vondroušová.
»Sie haben sehr beeindruckende Referenzen«, sagt Vincent. »Welche Anstellung mochten Sie am meisten?«
Sie lächelt. »Es gab keine, die ich nicht mochte, aber ich denke, mir sind die am liebsten, wo ich das Gefühl habe, eine große Hilfe zu sein. Ich hatte Posten, da war ich eine von vier Nannys, die rund um die Uhr arbeiteten, sieben Tage die Woche, und da habe ich nie das Gefühl, so viel bewirken zu können, wie wenn ich die einzige Nanny bin.«
»Vier Nannys?« Panik dringt wie ein Splitter in meine Brust. Sollte ich mehr als ein Kindermädchen für Guinevere haben? Eines fürs Wochenende klingt nach einer guten Idee. So weit habe ich noch gar nicht gedacht.
Vincent greift nach seinem Kaffee und schafft es, dabei meinen über den Couchtisch zu kippen.
»Shit«, er hält die Hand unter die Tischkante, um Tropfen aufzufangen, bevor sie auf dem Teppich landen.
Ich sehe mich nach einem Lappen oder so um. »Ich hol Küchenpapier.«
Aus den Augenwinkeln sehe ich, wie Eira aufsteht, eile jedoch aus dem Zimmer.
Als ich mit der Küchenpapierrolle zurückkomme, hockt Eira auf allen vieren beim Couchtisch. »So – Notfall abgewendet. Das sind mir die liebsten.« Lachend steht sie auf. »Ich gehe mal die Taschentücher wegwerfen.«
»Das kann ich machen«, biete ich an, aber sie fegt an mir vorbei Richtung Küche. »Der Mülleimer ist unter der Spüle«, rufe ich ihr nach.
Als sie ins Wohnzimmer zurückkommt, nehme ich den Duft meiner Handseife wahr. Vielleicht ist sie doch nicht so unreinlich, wie ich anfangs dachte. »So.« Grinsend setzt sie sich wieder. Ihre Wangen sind gerötet, als käme sie gerade aus der Kälte herein, und sie hat einen ganz verschmitzten Blick. »Nannys haben immer Taschentücher in der Handtasche. Neben tausend anderen Sachen.«
»Typisch Mary Poppins eben«, sagt Jacob, und da macht es endlich klick bei mir, an wen sie mich erinnert. Der Mantel, der Regenschirm, die Tasche, das … Funkeln in den Augen.
»Unsere Schutzpatronin«, erwidert Eira prompt.