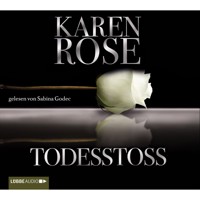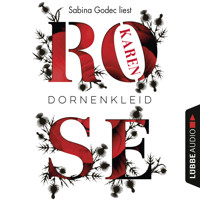9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Dornen-Reihe
- Sprache: Deutsch
Ein atemloser Thriller voller schockierender Wendungen - der Auftakt der Dornen-Reihe von Bestsellerautorin Karen Rose! Ein Thriller mit Gänsehaut-Garantie rund um eine junge Frau, die von einem Alptraum in den nächsten gerät! Der SPIEGEL-Bestseller "Dornenmädchen" ist der Auftakt der Cincinnati-Serie aus der Feder der amerikanischen Autorin Karen Rose, die seit Jahren mit ihren Thrillern (wie "Todesstoß", "Todeskleid" und "Todesherz") große Erfolge feiert. Gnadenlos gejagt von einem Stalker, flieht die junge Psychotherapeutin Faith in das leerstehende Haus ihrer Familie in Cincinnati. Hier will sie einen Neuanfang wagen – doch ihre vermeintliche Zufluchtsstätte entpuppt sich als Ort des Schreckens. Im Keller der Villa werden Leichen gefunden, und Faith gerät ins Visier der Ermittler. Auch FBI-Agent Deacon Novak kann sie als Täterin nicht ausschließen, doch gleichzeitig fasziniert ihn die hübsche Zeugin. Gemeinsam betreten sie einen düsteren Pfad, der weit in Faith' Vergangenheit und auf die Spuren eines eiskalten Psychopathen und Killers führt. Die SPIEGEL-Bestsellerautorin Karen Rose verbindet gekonnt nervenaufreibende Spannung mit einer fesselnden Liebesgeschichte. Ein Pageturner, der alle Fans von Romantic Suspense und Psychothrillern von der ersten bis zur letzten Seite in Atem hält. Die Dornen-Thriller-Serie, die in Cincinnati, Ohio, spielt, ist in folgender Reihenfolge erschienen: - Dornenmädchen (FBI-Agent Deacon Novak und Faith Corcoran) - Dornenkleid (Marcus O'Bannion und Detective Scarlett Bishop) - Dornenspiel (FBI-Agent Griffin »Decker« Davenport und FBI-Agentin Kate Coppola) - Dornenherz (Detective Adam Kimble und Meredith Fallon) - Dornenpakt (Dr. Dani Novak und Diesel Kennedy)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1219
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Karen Rose
Dornenmädchen
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Kerstin Winter
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Gejagt von einem Stalker, flieht die junge Psychotherapeutin Faith in das leerstehende Haus ihrer Familie. Doch der vermeintliche Zufluchtsort entpuppt sich als Falle und offenbart grausame Geheimnisse, die jenseits jeglicher Vorstellungskraft liegen. Faith muss sich fragen: Wird sie jemals diesem Alptraum entkommen?
Inhaltsübersicht
Widmung
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
Dank
Karen Rose bei Knaur
Eine Liste aller Karen-Rose-Romane in chronologischer Reihenfolge:
Verzeichnis der auftretenden Figuren in den Romanen von Karen Rose
Meinen Leserinnen und Lesern auf der ganzen Welt. Durch euch habe ich den tollsten Job, den man sich vorstellen kann.
Meiner wunderbaren Familie und meinen Freunden, die in diesem schwierigen Jahr immer für mich da waren. Ich liebe euch mehr, als ich ausdrücken kann.
Und wie immer für Martin, der mich so liebt, wie ich bin.
Du bist mein ganzes Herz.
Prolog
Oh Gott. Corinne kämpfte gegen die Woge der Übelkeit an, unter der sich ihr Körper zusammenkrümmte. Wein. Viel zu viel Wein. Das ist der schlimmste Kater aller Zeiten.
Obwohl … Moment mal. Das kann nicht sein. Sie schüttelte den Kopf, um wieder klar denken zu können, was ihr allerdings nur kurz gelang. Der Raum kippte, und sie unterdrückte ein Stöhnen. Ich hab seit zwei Jahren nichts mehr getrunken.
Es muss die Grippe sein. Verdammt! Hatte sie sich nicht dagegen impfen lassen? Sie hob die Hände, um sich die Augen zu reiben, doch –
Gefesselt. Die Erkenntnis stürmte mit Wucht auf sie ein. In Panik versuchte sie, die Arme zu bewegen, doch sie hielt inne, als ein scharfer Schmerz in ihre Schultern schoss. Ihre Hände waren gefesselt. Hinter ihrem Rücken.
Und es war auch nicht dunkel. Meine Augen sind verbunden. Sie warf sich zur Seite und hörte das Rasseln einer Kette, bevor ihre Bewegung abrupt gestoppt wurde.
Entsetzen packte sie. Gefesselt. Angekettet. Die Augen verbunden.
Ein Schrei stieg in ihrer Kehle auf, doch aus ihrem Mund drang nicht mehr als ein eingerostetes Krächzen. Ihr Hals war staubtrocken, die Lippen aufgesprungen. Kein Kater. Man hat mir etwas gegeben. Ein Medikament. Drogen.
Aber wie? Und wann? Und wer sollte das getan haben? Wozu? Was hatte man ihr angetan? Sie atmete tief ein und versuchte, sich zu beruhigen. Denk nach, Corinne. Denk verdammt noch mal nach.
Der Modergeruch im Raum brannte ihr in der Nase und löste ein heftiges Niesen aus. Wieder begann sich alles zu drehen. Corinne biss die Zähne zusammen. Zwang die nächste Welle der Übelkeit zurück.
Sie lauschte, aber da war nichts. Kein Geräusch. Kein Wind. Keine Musik. Keine Stimmen.
Okay, okay. Jetzt reg dich erst mal ab und denk nach. Denk nach!
Sie zwang sich, die Arme locker zu lassen, damit der Zug auf der Kette nachließ. Vorsichtig bewegte sie ihre Finger, ihre Zehen, streckte den Rücken, immer darauf bedacht, keine schnellen Bewegungen zu machen.
Sie lag auf einem Bett. Einer Matratze. Mit einem Laken. Einem Kissen. Sie rieb die Wange über den Stoff. Rauh. Der Raum roch muffig, aber das Kissen schien sauber zu sein.
Ein plötzliches Quietschen ließ sie erstarren. Eine Tür öffnete sich und ließ einen kalten Luftzug herein. Sie nahm den Duft nach Zitronen wahr. Ein schriller Schrei ertönte, wurde aber durch das rasche Schließen der Tür gedämpft.
Wer schrie da? Wer ist da? Und dann fiel es Corinne wieder ein. Gestern Abend. Sie waren zum Wohnheim zurückgegangen. Von der Bibliothek. Sie und Arianna. Sie hatten sich zusammen auf den Weg gemacht, weil es schon so spät war.
Oh Gott. Ari ist auch hier. Sie ist es, die schreit. Jemand tut ihr etwas an. Und dann bin ich dran!
»Du bist ja wach.« Die Stimme eines Mädchens. Der Schock riss Corinne aus ihrer Panik. Das Mädchen klang jung. Kein Kind mehr, aber auch noch nicht erwachsen. Ein Teenager? Und es sprach … zögernd. »Ich hab mir Sorgen um dich gemacht«, fügte das Mädchen hinzu.
Corinne hörte schlurfende Schritte. Zähl sie. Eins, zwei … vier, fünf … acht, neun, zehn. Zehn Schritte bis zur Tür.
»Wer bist du?«, flüsterte Corinne. Jedes Wort brannte in ihrer ausgetrockneten Kehle. »Warum bin ich hier?«
Die Matratze neigte sich. Nur ein wenig. Das Mädchen war klein. Leicht. Kühle Hände legten sich um Corinnes Gesicht. »Du hattest Fieber«, antwortete es. »Aber es geht dir besser. Hast du Durst?«
Corinne nickte. »Bitte. Wasser.«
»Bekommst du«, sagte das Mädchen freundlich. Eine Tasse wurde an Corinnes Lippen gehalten. Aus Metall. Kein Glas oder Porzellan. Was man zerbrechen konnte, konnte man auch als Waffe benutzen, aber diese Chance würde sie hier offenbar nicht bekommen.
Das Wasser rann durch Corinnes Kehle, und sie schluckte gierig. »Mehr, bitte.«
»Später«, sagte das Mädchen sanft und legte Corinnes Kopf aufs Kissen zurück. »Du warst sehr krank.«
»Wer bist du? Nimm mir die Augenbinde ab.«
»Das kann ich nicht, tut mir leid.«
»Warum nicht?« Corinne versuchte, sich ihre Angst nicht anhören zu lassen.
»Es geht einfach nicht. Ich darf mich um dich kümmern, aber ich darf dir nicht die Augenbinde abnehmen.«
Die Panik siegte, und Corinne warf sich nach vorne, so dass die Kette rasselte. »Wer zum Henker bist du?«
Die Matratze bewegte sich, als das Mädchen vom Bett sprang. »Niemand«, flüsterte es. »Ich bin niemand.« Schlurfende Schritte entfernten sich. »Ich komme nachher wieder. Dann bringe ich dir Suppe.«
»Warte. Bitte! Bitte geh nicht weg. Wo bin ich?«
Ein leichtes Zögern, dann die resignierte Antwort. »Zu Hause.«
»Nein. Das hier ist nicht mein Zuhause. Ich wohne im Studentenwohnheim. King’s College.«
»Das kenn ich nicht. Hier ist mein Zuhause. Und deins. Ab jetzt.«
Ab jetzt? Oh Gott. »Aber wo sind wir?«
»Keine Ahnung.« Schlicht. Aufrichtig.
»Kannst du mir helfen, von hier wegzukommen?«
»Nein. Nein.« Der Tonfall des Mädchens wurde rigoros vor Furcht. »Das kann ich nicht.«
Aber es hätte ihr gerne geholfen, das hörte Corinne. Oder sie wünschte es sich so sehr, dass sie es in die Stimme des Mädchens hineininterpretierte. Wie auch immer. Sie musste es auf ihre Seite ziehen.
»Also gut«, sagte Corinne sanft. »Kannst du mir denn wenigstens deinen Namen nennen?«
Wieder ein langes Zögern. »Ich muss jetzt gehen.« Die Tür öffnete sich. Aris Schreie drangen laut in den Raum.
»Bitte. Was ist mit meiner Freundin? Sie heißt Arianna. Was geschieht mit ihr?«
Das Mädchen antwortete mit solch einer Endgültigkeit, dass es Corinne vor Furcht die Kehle zuzog. »Er bringt ihr bei, was sie wissen muss.«
»Was denn? Was muss sie denn wissen?«
»Was er von ihr will«, sagte das Mädchen. »Es tut mir wirklich leid.«
Die Tür schloss sich. Corinne wartete ein paar Sekunden. »Hallo? Bist du noch da? Bitte?«
Aber niemand antwortete. Corinne war allein im Dunkeln.
1. Kapitel
»Es ist bloß ein Haus«, murmelte Dr. Faith Corcoran und umklammerte das Lenkrad, während sie ihren Jeep auf Schrittgeschwindigkeit drosselte. »Stell dich nicht so an. Bloß vier Wände, Boden, Dach.«
Dennoch fuhr sie, die Augen stur geradeaus gerichtet, am fraglichen Haus vorbei. Sie musste nicht hinsehen, sie wusste genau, wie es aussah. Ein dreistöckiges Gebäude aus grauen Ziegeln und Natursteinen mit zweiundfünfzig Fenstern und einem eckigen Turm, der kerzengerade in den Himmel wies. Der Boden in der Eingangshalle bestand aus italienischem Marmor, das Mobiliar war aus kostbarem Edelholz, die breite Treppe hatte ein elegant geschwungenes Geländer aus Mahagoni, und der Kristalllüster im Speisesaal funkelte, als sei er aus Edelsteinen gemacht. Das alles wusste sie. Sie kannte das Haus in- und auswendig.
Sie wusste auch, dass es nicht die vier Wände, Boden, Dach waren, die sie wirklich fürchtete, sondern das, was sich darunter befand. Zwölf Stufen und ein Keller.
Am Ende des Wegs wendete sie und hielt schließlich vor dem Haus an. Fast nüchtern stellte sie fest, dass sich ihr Herzschlag beschleunigte. »Das ist ganz normal. Dein Körper reagiert auf Stress. Der beruhigt sich auch wieder.«
Aber wen wollte sie eigentlich damit überzeugen? Die Furcht hatte sich mit jeder Meile, die sie in den vergangenen zwei Tagen gefahren war, kontinuierlich aufgebaut. Als sie eben den Fluss nach Cincinnati überquert hatte, war sie als körperlicher Schmerz in ihrer Brust spürbar gewesen. Und nun, dreißig Minuten später, hyperventilierte sie fast, was nicht nur albern, sondern vollkommen inakzeptabel war.
»Herrgott noch mal, werde endlich erwachsen«, fauchte sie, würgte den Motor ab und riss den Schlüssel aus der Zündung. Als sie aus dem Jeep sprang, gaben ihre Knie beinahe nach, was sie umso wütender machte. Es konnte doch nicht wahr sein, dass allein der Gedanke an das Haus ihr das Gefühl gab, wieder neun Jahre alt zu sein.
Aber du bist nicht mehr neun. Du bist zweiunddreißig und hast bereits mehrere Mordanschläge überlebt. Da wirst du doch wohl keine Angst vor einem Haus haben.
Mit der Kraft ihrer Wut hob Faith endlich den Blick und sah das Anwesen zum ersten Mal seit dreiundzwanzig Jahren. Es wirkte … alt und wuchtig. Bedrückend. Und es war mehr als nur ein bisschen heruntergekommen, doch noch immer eindrucksvoll.
Es wirkte alt, weil es alt war. Das Haus stand seit über hundertfünfzig Jahren auf O’Bannion-Land und zeugte von einem Lebensstil, der schon lange nicht mehr existierte. Hoch und finster erhoben sich die drei Stockwerke vor dem Betrachter, und der Turm war wie ein Befehl, nach oben zu schauen.
Faith gehorchte selbstverständlich. Als Kind war sie nie in der Lage gewesen, sich dem Turm zu widersetzen. Das hatte sich nicht geändert. Und der Turm selbst auch nicht. Er hatte seine eigensinnige Würde behalten, obwohl die Fenster vernagelt waren.
Tatsächlich waren alle zweiundfünfzig Fenster vernagelt, da das O’Bannion-Haus seit dreiundzwanzig Jahren unbewohnt war. Und das war nicht zu übersehen.
Die steinernen Mauern waren intakt, wenn auch verwittert, doch die hübschen viktorianischen Holzverzierungen waren ausgeblichen und voller Risse. Die Veranda war eingefallen, die Glastür blind durch jahrzehntelange Schmutzablagerung.
Vorsichtig bahnte sie sich ihren Weg über die fleckige Rasenfläche zum Tor. Der Zaun war aus Schmiedeeisen. Altmodisch. Errichtet für die Ewigkeit, wie das Haus selbst. Trotz rostiger Angeln ließ sich das Tor öffnen. Die steinernen Gehwegplatten waren geborsten, Unkraut zwängte sich durch die Risse.
Faith nahm sich einen Moment Zeit, ihr jagendes Herz zu beruhigen, bevor sie ihren Fuß probeweise auf die Treppe zur Veranda setzte.
Die Veranda. Ihre Großmutter hatte den überdachten Vorbau, der sich einmal ganz ums Haus herumzog, geliebt. Oft hatten sie hier draußen gesessen und Limonade getrunken, sie und Gran. Und Mama auch. Vorher natürlich. Danach … gab es keine Limonade mehr.
Danach gab es gar nichts mehr. Eine lange, lange Zeit gab es absolut nichts mehr.
Faith schluckte den bitteren Geschmack, der sich in ihrem Mund breitmachte, aber die Erinnerung an ihre Mutter blieb. Denk nicht an sie. Denk an Gran, denk daran, wie sehr sie an diesem alten Kasten gehangen hat. Und sie wäre so traurig gewesen, wenn sie gesehen hätte, wie es hier ausschaut.
Aber Gran würde das Haus nie wiedersehen, denn sie war tot. Und deshalb bin ich hier. Das Haus und alles, was sich darin befand, gehörte nun Faith. Ob sie es wollte oder nicht.
»Du musst ja nicht hier wohnen«, sagte sie zu sich selbst. »Verkauf den Besitz und geh …«
Wohin? Auf keinen Fall zurück nach Miami, so viel stand fest. Du läufst ja doch bloß wieder weg.
Tja, so sieht’s aus – na und? Natürlich lief sie weg. Jeder Mensch, der halbwegs bei Verstand war, würde die Beine in die Hand nehmen, wenn er von einem mörderischen Ex-Häftling verfolgt wurde, der sie bereits mehr als einmal fast getötet hatte.
Manch einer war der Ansicht, dass sie sich nicht wundern dürfe. Wer versuchte, Sexualstraftäter zu therapieren, begab sich automatisch in Gefahr. Und manch einer behauptete sogar, ihr lägen die Täter mehr am Herzen als die Opfer.
Aber die Leute irrten sich. Sie wussten nicht, was sie getan hatte, um zu verhindern, dass die Täter weitere Opfer fanden. Keiner wusste, was sie riskiert hatte.
Vor vier Jahren war Peter Combs in dem Glauben auf sie losgegangen, sie habe ihn bei seinem Bewährungshelfer verpetzt, weil er eine Therapiesitzung bei ihr geschwänzt hatte, die zu seinen Auflagen zählte. Faith schauderte bei dem Gedanken, wozu dieser miese Scheißkerl vermutlich fähig gewesen wäre, hätte er gewusst, dass ihre Rolle bei seiner erneuten Inhaftierung weit über die simple Meldung von Fehlzeiten hinausgegangen war. Aber in Anbetracht des Katz-und-Maus-Spiels, das er seit seiner Entlassung mit ihr trieb, und der Tatsache, dass er ihr nicht nur nachstellte, sondern inzwischen bereits viermal versucht hatte, sie umzubringen, wusste er es womöglich doch. Oder er hatte es sich zusammengereimt.
Automatisch schob sie die Hand in die Jackentasche und spürte das kalte Metall der Walther PK380, ohne die sie seit fast vier Jahren nicht mehr vor die Tür ihrer Wohnung in Miami gegangen war. Die Polizei war keine Hilfe gewesen, also hatte sie kurzerhand selbst für ihre Sicherheit gesorgt.
Sie war ein vernünftiger Mensch. Sie war vorbereitet. Aber sie hatte auch Angst. Und ich bin es so leid, immer Angst zu haben.
Plötzlich fiel ihr auf, dass sie den Blick gesenkt hatte, und sie hob trotzig das Kinn. Ja, sie war weggelaufen. Und sie war ausgerechnet zu dem Ort geflohen, den sie beinahe genauso fürchtete wie den, den sie hinter sich gelassen hatte. Was sich auch jetzt noch genauso verrückt anhörte wie vor zwei Tagen, als sie aus Miami geflüchtet war. Aber es war ihre einzige Chance gewesen. Von jetzt an wird keiner mehr meinetwegen sterben.
Sie hatte so viel von ihrer Habe in den Jeep gepackt, wie hineinpasste, und alles andere zurückgelassen – auch ihre Stelle als Psychotherapeutin und den Namen, unter dem sie ihre Karriere aufgebaut hatte. Ein notariell beglaubigter Namenswechsel, der laut Gericht unter eine Vertraulichkeitsklausel fiel, hatte dafür gesorgt, dass Faith Frye nicht mehr existierte.
Faith Corcoran war ein unbeschriebenes Blatt. Sie konnte ganz von vorne beginnen. Niemand in Miami – Freund oder Feind – wusste von diesem Haus. Niemand wusste, dass ihre Großmutter gestorben war, also konnte es auch niemand Peter Combs verraten. Er würde niemals auf den Gedanken kommen, sie hier zu suchen.
Sie hatte sogar einen neuen Job, eine anständige Stelle in der Personalabteilung einer Bank in der Innenstadt von Cincinnati. Ihre Kollegen würden Anzüge tragen und über Kalkulationen brüten. Sie würde ein festes Einkommen und zum ersten Mal in ihrem Leben Sozialleistungen beziehen. Der größte Vorteil in ihren Augen aber war die Sicherheit, die eine Bank bot, falls ihre Maßnahmen, Faith Frye abzuschütteln, nicht effektiv genug gewesen waren.
Unwillkürlich wanderten ihre Fingerspitzen zu ihrem Hals. Obwohl die Wunde längst verheilt war, erinnerte sie die zurückgebliebene Narbe immer daran, wozu der Mann, der sie jagte, imstande war. Doch immerhin lebte sie noch. Gordon dagegen nicht.
Schuldgefühle und Trauer stiegen in ihr auf und schnürten ihr die Kehle zu. Oh, Gordon, es tut mir so leid. Ihr ehemaliger Chef hatte das Pech gehabt, direkt neben ihr zu stehen, als man das Feuer auf sie eröffnete. Nun war Gordons Frau Witwe, und seine Kinder mussten ohne Vater aufwachsen.
Sie hatte Gordon nicht zurückholen können. Aber sie konnte alles in ihrer Macht Stehende tun, dass so etwas nie wieder geschah. Wenn Combs sie nicht fand, konnte er weder ihr noch jemandem, der zufällig in ihrer Nähe war, etwas antun. Der Tod ihrer Großmutter hatte ihr eine Zuflucht verschafft, die sie nie mehr gebraucht hatte als jetzt.
Das Haus war ein echtes Geschenk. Dass es außerdem ihr ältester Alptraum war, hielt sie nicht davon ab, das Geschenk anzunehmen. Also zwang sie ihre Füße, sich in Bewegung zu setzen, ging bis zur Tür, zog den Schlüssel aus ihrer Tasche und steckte ihn ins Schloss.
Doch die Tür öffnete sich nicht. Nach dem dritten Versuch dämmerte ihr langsam, dass der Schlüssel nicht passte. Der Anwalt ihrer Großmutter hatte ihr den falschen gegeben.
Sie konnte nicht ins Haus, selbst wenn sie es gewollt hätte. Zumindest heute nicht mehr. Die Erleichterung, die sie deswegen empfand, beschämte sie. Du Feigling.
Herrgott, es handelt sich ja nur um eine Verzögerung. Und das auch nur um einen Tag. Morgen würde sie sich den richtigen Schlüssel holen, aber im Moment verlieh ihr die Tatsache, dass sie nicht hineinkonnte, frischen Mut.
Sie spähte durch das schmutzige Glas der Eingangstür und sah eine Halle voller mit Tüchern verhängter Möbel. Ihre Großmutter hatte nur ihre Lieblingsstücke mitgenommen, als sie dreiundzwanzig Jahre zuvor in ein Haus in der Stadt gezogen war. Den Rest hatte sie Faith vererbt.
Der Gedanke daran, das Mobiliar zu enthüllen, entzündete in Faith zum ersten Mal seit einer sehr, sehr langen Zeit einen Funken der Erregung. Viele der Stücke hatten Museumsqualität, wie ihre Mutter ihr gerne und oft gesagt hatte. Das wird eines Tages alles mir gehören, Faith, und wenn ich sterbe, dann gehört es dir, also pass gut auf. Das hier ist dein Erbe, und es wird höchste Zeit, dass du es zu schätzen lernst.
Die Erinnerung dämpfte ihre Aufregung empfindlich. Sie konnte die Furcht, die sie damals bei den Worten ihrer Mutter gepackt hatte, spüren, als wäre es erst gestern gewesen. Aber ich will mein Erbe doch gar nicht, hatte sie geantwortet. Nicht wenn du deswegen sterben musst.
Ein liebevolles Zupfen an ihrem Pferdschwanz. Dummerchen. Ich habe nicht vor, in nächster Zeit abzutreten. Du wirst so alt sein wie Gran, wenn das Haus endlich dir gehört.
In den Augen der Neunjährigen, die sie damals war, hatte Gran längst ein biblisches Alter erreicht. Dann hab ich ja noch ewig Zeit, mir die Sachen anzugucken, oder? Mit einem Augenrollen überspielte sie ihre Erleichterung. Sie interessierte sich ohnehin viel mehr für den Golden Retriever, der dem Sohn der Köchin gehörte, als für die silberne Teekanne in der Hand ihrer Mutter. Kann ich nach draußen spielen gehen? Bitte, Mama, bitte!
Ihre Mutter stieß einen entnervten Seufzer aus. Na gut. Aber mach dich nicht schmutzig. Dein Vater kommt bald zurück, und dann fahren wir nach Hause. Aber, junge Dame, wenn wir das nächste Mal hier sind … Ihre Mutter drohte ihr lächelnd mit dem Zeigefinger. Dann geht’s um Teekannen, ist das klar?
Aber als Faith das nächste Mal das Haus betreten hatte, war es nicht um Teekannen gegangen – es war um nichts mehr gegangen, was Spaß machen konnte. Ihre Mutter war nicht mehr da, und ihr Leben hatte sich unwiderruflich verändert.
Energisch schob Faith die Erinnerung aus ihrem Kopf. Sie hatte in der Gegenwart schon genug Probleme. Alte Wunden wieder aufzureißen, tat ihr gar nicht gut.
Nur leider war dies eine Wunde, die aufgerissen werden musste, wenn sie jemals wirklich verheilen sollte. Seit jenem schrecklichen Tag war sie nicht mehr im Haus gewesen. Sie hatte ihrer Mutter nie gesagt, wie wütend sie war. Sie hatte es niemandem gesagt. Stattdessen hatte sie ihren Zorn, die Kränkung, die Angst überspielt und nach vorne geblickt. Das hatte sie sich zumindest eingeredet. Aber nun, dreiundzwanzig Jahre später, stand sie hier und litt noch immer. War noch immer wütend. Und hatte genauso viel Angst wie zuvor.
Los, Faith. Tu etwas, und zwar jetzt. Resolut wanderte sie um das Haus herum, bevor sie ihre Meinung ändern konnte. Dass sie den Atem angehalten hatte, bemerkte sie erst, als sie ihn lautstark ausstieß.
Da war er, der Friedhof, in einer Ecke des Gartens. In respektablem Abstand zum Haus, wie Gran immer gesagt hatte. Jemand hatte ihn die ganzen Jahre über gepflegt, Unkraut gezupft und sorgfältig das Gras am Zaun gestutzt, der ebenfalls aus Schmiedeeisen war. Die historische Gesellschaft, fiel Faith wieder ein. Grans Anwalt hatte ihr erzählt, dass der örtliche Geschichtsverein für die Instandhaltung aufkam, da der O’Bannion-Friedhof denkmalgeschützt war.
Hier lag ihre ganze Familie begraben, bis zurück zu Zeke O’Bannion, der 1862 in der Schlacht von Shiloh gefallen war. Faith wusste über jeden Bescheid, der einst hier beerdigt wurde, denn im Gegensatz zu silbernen Teekannen fand sie diese Geschichten spannend. Es waren echte Menschen gewesen, die hier ihr Leben gelebt hatten, und Faith war ihrer Mutter wie ein treuer Hund zur Grabpflege gefolgt, hatte ihr beim Unkrautzupfen geholfen und fasziniert zugehört, wie sie von ihren Vorfahren erzählte.
Faith drückte gegen das Tor und runzelte die Stirn, als es sich nicht bewegte. Ein Blick nach unten enthüllte das Problem: ein Vorhängeschloss. Grans Anwalt hatte ihr keinen weiteren Schlüssel gegeben, also ging sie am Zaun entlang, bis sie an dem jüngsten Grabstein angelangt war, ein Doppelstein aus schwarzem Marmor.
Die Inschrift auf der linken Seite war in den vergangenen dreiundzwanzig Jahren verwittert. Tobias William O’Bannion. Faith hatte ihren Großvater als strengen, harten Mann gekannt, der jeden Tag in seinem Leben zur Messe ging. Vermutlich um seine Wutausbrüche zu beichten, dachte sie mit einem Hauch Ironie. Er war ziemlich jähzornig gewesen.
Die Inschrift auf der anderen Seite des schwarzen Steins war neu und scharf umrissen. Barbara Agnes Corcoran O’Bannion. Geliebte Ehefrau, Mutter und Großmutter. Wohltäterin.
Das meiste entsprach der Wahrheit. Gran hatte eine ganze Reihe wohltätiger Organisationen unterstützt. Und Tobias hatte sie auf seine Art geliebt. Auch ich habe sie geliebt, dachte Faith. So sehr sogar, dass sie ihren Mädchennamen angenommen hatte.
Ihre Kinder hatten sie ebenfalls geliebt – größtenteils jedenfalls. Jordan, der jüngere Bruder von Faith’ Mutter, hatte sich klaglos um Gran gekümmert, bis sie aus diesem Leben geschieden war. Faith’ Mutter war Gran absolut ergeben gewesen, obwohl Faith nicht hätte sagen können, wie viel von dieser Hingabe Liebe war. Was Jeremy betraf, das einzige andere noch lebende Kind Grans, so ließ sich schwerlich etwas Gesichertes feststellen. Er hatte sich … der Familie entfremdet.
Faith’ Großmutter war ihren Wünschen entsprechend in aller Stille und nur in Anwesenheit des Priesters und Faith’ Onkel Jordan neben ihrem Mann beigesetzt worden. Wahrscheinlich, dachte Faith, weil Tobias’ Beisetzung zu einem bitteren Familienstreit ausgeartet war, der die O’Bannions vollkommen entzweit hatte.
Und ihre eigene kleine Familie auch, dachte sie, als sie an den nächsten fünf Gräbern vorbeiging, in denen die Nachkommen von Tobias und Barbara lagen, die noch während ihrer Kindheit gestorben waren. Beim sechsten Grabstein blieb sie stehen. Er war von gleicher Machart wie der ihrer Großeltern, die Schrift ebenso verwittert wie die bei Tobias. Was nicht verwunderte, da die Steine zur gleichen Zeit gekauft und bearbeitet worden waren.
Die eine Seite, die ihres Vaters, war zum Glück frei. Die andere kündete von einer schrecklichen Lüge.
»Hallo, Mutter«, murmelte Faith. »Ist schon ein Weilchen her.«
Wie als Antwort zerriss ein schriller Schrei die Stille. Erschrocken fuhr Faith herum und drehte sich einmal um die eigene Achse auf der Suche nach der Herkunft des Schreis, aber sie konnte niemanden entdecken. Niemand war ihr gefolgt, dafür hatte sie gesorgt. Einen gefährlichen Stalker im Nacken zu haben, war ein starker Antrieb, die eigenen Spuren zu verwischen.
Hier war nichts. Nur Faith, das Haus und die fünfzig Morgen brachliegendes Farmland, die vom Grundbesitz der O’Bannions übrig geblieben waren. Sie klopfte leicht auf ihre Jackentasche, um sich von der Waffe beruhigen zu lassen. »Das war wahrscheinlich ein Hund«, sagte sie sich. »Nichts weiter.«
Oder aber ihr Verstand hatte ihr einen Streich gespielt und ließ einen Schrei aus ihrem Alptraum in ihrem Kopf nachhallen. Zwölf Stufen und ein Keller. Manchmal erwachte sie aus dem Alptraum, weil sie tatsächlich lauthals schrie, was ihrem Ex-Mann jedes Mal einen höllischen Schrecken eingejagt hatte. Dieses Wissen verschaffte Faith eine gewisse Befriedigung – was zugegebenermaßen extrem unreif war –, denn Officer Charlie Frye verdiente für das, was er getan hatte, weit mehr als nur einen nächtlichen Schrecken.
Ihre Mutter hatte ihrem Vater sehr viel Schlimmeres angetan. »Dad hatte das nicht verdient. Und ich auch nicht. Wie konntest du nur?« Sie zögerte, dann spuckte sie die Worte förmlich aus: »Seit dreiundzwanzig Jahren hasse ich dich. Ich habe für dich gelogen. Ich habe Dad belogen, damit er nie erfahren musste, was du getan hast. Wenn du also damit bezweckt hast, ihm weh zu tun, dann bist du auf ganzer Linie gescheitert. Wenn du mir weh tun wolltest, dann herzlichen Glückwunsch. Damit hast du einen Volltreffer gelandet.«
Mit einem Mal kam ihr in den Sinn, dass sie sich am besten rächen konnte, indem sie genauso lebte, wie ihre Mutter es immer erwartet hatte: als Herrin des Anwesens. Der Gedanke brachte sie beinahe zum Lächeln, doch als ihr wieder einfiel, wie am Boden zerstört ihr Vater gewesen war, kehrte die Wut mit Macht zurück.
Der Gedanke an Dad rief ihr außerdem in Erinnerung, dass sie ihm ein Versprechen gegeben hatte. Widerstrebend schoss sie mit ihrem Handy ein Foto des Grabsteins und schickte es ihm. Er war alle paar Jahre zum Grab seiner Frau gepilgert, doch nach einem Schlaganfall war er ans Haus gebunden. Faith hatte ihm versprochen, ein Beweisfoto zu machen, dass mit dem Grab alles in Ordnung war.
Bin gut angekommen, schrieb sie. Alles ok. Mamas Grab ist –
Sie hielt inne, während sie nach den richtigen Worten suchte und all die verwarf, die ihm nur weh tun würden. Schließlich glaubte Dad immer noch, dass die Inschrift stimmte. »Gut gepflegt« war ehrlich, fand sie, also tippte sie die Nachricht ein. Ruf dich aus dem Hotel an.
Jetzt anzurufen, wagte sie nicht. Hier, direkt vor dem Grabstein ihrer Mutter, würde es ihr nicht gelingen, die Bitterkeit so weit zu unterdrücken, dass man sie ihr nicht anhörte. Sie schluckte, tippte auf Senden und machte sich mit einem Seufzen auf den Rückweg zu ihrem Jeep. Wenn sie nicht ins Haus gelangte, konnte sie hier heute nichts mehr tun. Sie würde bei dem Walmart in der Nähe ihres Hotels halten, einige Putzutensilien besorgen und früh ins Bett gehen. Morgen gab es viel zu tun.
Seine Hand verharrte mitten in der Luft, als das Licht an der Decke zu blinken begann. Was ist los?
Der Alarm. Jemand war draußen.
»Verdammt«, presste er hervor. Von der Hausverwaltung konnte es niemand sein. Der Rasen war erst vor wenigen Tagen gemäht worden. Also ein Unbefugter. Zorn stieg in ihm auf. Jemand wagte es, hier einzudringen? Und ihn ausgerechnet jetzt zu stören?
Er blickte hinab auf die junge Frau, die vor ihm auf dem Tisch lag. Ihr Mund stand offen, ihr Atem ging flach und stoßweise, ihre Miene spiegelte Verzweiflung. Es hatte ihn zwei ganze Tage gekostet, sie an diesen Punkt zu bringen. Nachdem sie sich mit Zähnen und Klauen gegen ihn gewehrt hatte, hatte sie endlich angefangen zu schreien.
Sie hatte eine überaus bemerkenswerte Schmerzgrenze. Er würde lange, lange Zeit mit ihr spielen können. Aber nicht jetzt. Jemand war ihm zu nahe gekommen, hatte unbefugt das Grundstück betreten. Und darum musste er sich kümmern.
Falls er Glück hatte, hatte sich der Eindringling nur verirrt. Er würde feststellen, dass das Haus leer stand, und wieder verschwinden. Falls nicht …
Er lächelte. Vielleicht hätte er dann einen neuen Spielgefährten.
Er legte das Messer in einigem Abstand beiseite, da er kein Risiko eingehen wollte. Die Frau auf seinem Tisch hatte sich als stark und gerissen erwiesen. Ein wenig zu stark und gerissen für seinen Geschmack, aber das würde er ihr schon austreiben. Der Augenblick, in dem der Wille seiner Gefangenen brach, in dem sie begriffen, dass ihnen niemand zu Hilfe kommen würde und er ihr Meister war, solang es ihm beliebte … Er lächelte. Das war wahre Befriedigung.
Er schloss die Tür seiner Folterkammer und ging in sein Büro, wo er seinen Laptop hochfuhr und die Überwachungskameras aufrief. Vermutlich irgendein Vertreter oder vielleicht ein Wanderer, der –
Schockiert starrte er auf den Monitor. Er war so fassungslos, dass er sich einen Moment lang nicht regen konnte.
Das kann nicht sein. Das kann einfach nicht sein. Aber es war so. Sie war es. Sie war hier. Am Zaun zum Friedhof. Mit versteinerter Miene blickte sie auf die Grabsteine.
Wie kann das sein? Er hatte die Nachrichten genauestens verfolgt. Hatte die Fotos des zerdrückten blauen Toyota Prius’ gesehen. Den Unfall konnte sie unmöglich überlebt haben. Ich hab sie doch umgebracht!
»Scheiße«, flüsterte er. Offensichtlich nicht. Das Weib hatte mehr Leben als ein verdammtes Katzenvieh!
Na los, bring den Job zu Ende. Aber zuerst musste er sich vergewissern, dass sie allein war. Er schaltete zur vorderen Kamera um und war erneut fassungslos. Ein Jeep Cherokee, hellrot. Voller Kartons.
Sie hatte bereits einen neuen Wagen gekauft, aber wenigstens gab es keinen Beifahrer. Gut. Er würde sich ein für alle Mal um sie kümmern. Allerdings würde er sie überrumpeln müssen, denn die Schlampe hatte eine Waffe bei sich, und er musste verhindern, dass sie diese benutzte. Sie ist allein. Bring sie endlich um.
Er schaltete zurück auf die Friedhofskamera und fluchte ein weiteres Mal. Sie hatte das Handy gezückt und schoss ein Foto. Er rannte zur Treppe und stob hinauf, kam rutschend an der Hintertür zum Stehen und spähte durch die Bretter, die das Fenster verbarrikadierten.
Sein Mut sank. Sie gab etwas ins Telefon ein und beendete die Aktion mit einem letzten Tippen.
Sie hatte eine SMS geschrieben. Sie hatte das verfluchte Foto verschickt.
Also wusste nun jemand, dass sie hier gewesen war. Also konnte er sie jetzt nicht töten. Jedenfalls nicht hier. Auf gar keinen Fall hier. Enttäuschung mischte sich mit aufsteigender Furcht. Das konnte er nicht riskieren. Er konnte nicht riskieren, dass die Polizei herkam und herumschnüffelte. Oder schlimmer noch – die Presse.
Spür sie auf und töte sie, aber nicht hier. Er schlich zum Vorderzimmer und spähte dort durchs Fenster. Mit hämmerndem Herzen sah er zu, wie sie ins Auto stieg und davonfuhr.
Am liebsten wäre er sofort in seinen Van gesprungen und ihr gefolgt. Um sie endlich zu erledigen.
Aber er riss sich zusammen und zwang sich, tief ein- und auszuatmen. Er zog es vor, in Ruhe zu planen. Es war immer besser, zu jedem Zeitpunkt der Jagd genau zu wissen, was zu tun war. Im Augenblick war er viel zu durcheinander … und das war nur verständlich. Er war sich schließlich hundertprozentig sicher gewesen, sie getötet zu haben. Tja. Offensichtlich hatte er sich geirrt.
Nun, das ließe sich rasch wieder gutmachen.
Er holte noch einmal tief Luft. Langsam beruhigte er sich, gewann seine Fassung zurück. Das war schon viel besser. Wer den Kopf verlor, machte Fehler. Wer Fehler machte, zog Aufmerksamkeit auf sich, was wiederum umfangreiche Aufräumarbeiten erforderlich machte. Das hatte er auf die harte Tour gelernt.
Sie zu finden, würde kein Problem sein. Er war ihr lange genug auf den Fersen, um zu wissen, welche Hotels sie bevorzugte. Faith war sogar ein noch größeres Gewohnheitstier als er. Obwohl der Jeep ihn überraschte. Noch dazu ein roter! Das war gar nicht ihr Stil, aber vielleicht hatte sie nicht wählerisch sein können, nachdem ihr alter blauer Wagen einen Totalschaden erlitten hatte.
Wie sie es geschafft hatte, aus dem Schrotthaufen lebendig herauskommen, würde sie ihm erklären, ehe er sie endgültig erledigte. Und dass ihm das gelingen würde, stand außer Frage. Er würde sie irgendwo hinlocken und sie ausschalten. Ein für alle Mal. Es ging nicht an, dass jemand herkam und sie hier suchte. Das ist mein Haus. Niemand durfte davon wissen. Das würde alles verderben. Alles, was er sich aufgebaut hatte. Alles, was ihm etwas bedeutete.
Dann nehmen sie mir meine Sachen weg. Meine Sachen! Das durfte nicht geschehen. Denk nach. Plan sorgfältig.
Plötzlicher Schmerz ließ ihn zusammenzucken, und als er auf seine Hand hinabblickte, sah er, dass er sie um den Schlüssel gekrampft hatte. Er war weit aufgebrachter, als er gedacht hatte.
Was … normal war, wie er annahm. Aber letztlich unnötig. Sie war bloß eine Frau wie alle anderen auch. Leicht zu überwältigen. Wenn er sie in seiner Gewalt hatte, würde sie es bitter bereuen, dass sie ihm je zu nah gekommen war.
Allerdings ließ Faith sich nicht so leicht überwältigen. Zu oft schon hatte er versucht, sie zu töten. Sie war vorsichtig geworden, misstrauisch. Also würde er sich etwas mehr anstrengen müssen, um sie an einen Ort seiner Wahl zu locken. Aber wenn dir das nicht gelingt? Wenn sie zurückkommt? Wenn sie versucht, ins Haus zu kommen?
Dann musste er sie eben doch hier umbringen, was die Bullen auf den Plan rufen würde. Und dann nehmen sie mir meine Sachen weg.
Wieder holte er tief Luft und atmete kontrolliert aus. Er durfte keinesfalls in Panik geraten. Niemand würde ihm seine Sachen wegnehmen. Wenn es sein musste, würde er sie eben anderswo hinschaffen.
Niemand wird mir je wieder meine Sachen nehmen. Jetzt nicht und auch in Zukunft nicht.
Sobald Faith die gepflasterte Straße erreicht hatte, diktierte sie eine neue To-do-Liste in ihr Handy. Solche Listen hatten ihr geholfen, bei klarem Verstand zu bleiben und in wahnwitzig kurzer Zeit alles Notwendige zu erledigen, um Faith Frye in Miami zurückzulassen und als Faith Corcoran nach Ohio zu fahren.
Den Nutzen der Listen hatte sie nach dem Tod ihrer Mutter zu schätzen gelernt. Ihr Vater hatte sich mit Alkohol getröstet, und sie hatte mit ihren neun Jahren den Haushalt zu organisieren versucht. Die Listen waren dabei ihre Rettung gewesen.
Morgen würde sie den Anwalt kontaktieren, um die richtigen Schlüssel zu bekommen, dann die Stadtwerke anrufen, damit sie Wasser und Strom anstellten. Außerdem brauchte sie eine Festnetzleitung, da es hier draußen von Funklöchern nur so wimmelte, und –
Oh, nein! Das Herz rutschte ihr in die Hose, als ihr klarwurde, was sie vergessen hatte. Der Handyanbieter. Verdammt. Sie starrte auf das Telefon, das sie in ihrer Hand hielt. Sie hatte ihren Namen, ihre Adresse, ihre Papiere und ihre Kreditkarten ändern lassen, aber nicht ihre Handynummer.
Zorn wallte in ihr auf. Wie um alles auf der Welt hatte ihr das entgehen können?
Nicht nur, dass das Telefon noch auf ihren alten Namen lief, es war auch ein Peilsignal!
Sie bremste den Wagen mitten auf der Straße ab und zog den Chip aus dem Gerät. Morgen würde sie sich ein anderes besorgen. Ein nicht zu ortendes Prepaid-Handy, wie so viele ihrer vorbestraften Patienten es besessen hatten.
Und wenn sie so weit alles geregelt hatte, würde sie zum Haus zurückkehren und in Angriff nehmen, was vermutlich in einen gewaltigen Frühjahrsputz ausarten würde. Kleine Korrektur. Es heißt nicht »das« Haus. Es heißt »dein« Haus. Gewöhn dich daran, dann fällt es dir auch bald nicht mehr so schwer, hineinzugehen.
Entspann dich. Du hast Peter Combs in Miami zurückgelassen. Niemand verfolgt dich. Niemand versucht, dich umzubringen. Hier gibt es nichts, wovor du dich fürchten musst.
Arianna Escobar kam keuchend zu sich, hielt aber hastig den Atem an und lauschte angestrengt. Nichts. Falls er im Raum war, hielt er ebenfalls den Atem an. Sie wartete ab, bis sie nicht mehr konnte, dann stieß sie stöhnend die Luft aus. Verflixt. Sie hatte so sehr versucht, das Stöhnen zu unterdrücken!
Er liebte es, wenn sie stöhnte, das wusste sie inzwischen. Und ihre gequälten Schreie liebte er noch mehr.
Am Anfang war sie wild entschlossen gewesen, ihm zu trotzen. Um ihm keine Befriedigung zu verschaffen.
Aber er tat ihr weh. Sie wimmerte. Er tat ihr weh mit Messern und … Wieder ein Wimmern. Arianna hatte die Zähne zusammengepresst und sich auf die Zunge gebissen, bis sie den Schmerz keine Sekunde länger mehr ertragen konnte. Und dann hatte sie zu seiner Freude geschrien.
Sie hatte geschrien und geschrien, bis ihr Hals wund war. Und dann hatte er ganz plötzlich aufgehört und war mit einem gemurmelten Fluch verschwunden. Sie hatte gehört, wie er die Tür hinter sich schloss. Wann war das gewesen? Sie hatte keine Ahnung. Wegen ihrer Augenbinde konnte sie nichts sehen, konnte nur wenig Licht an den Rändern erkennen. Kurz bevor er geflucht hatte, war es ihr vorgekommen, als hätte über ihr etwas geblinkt.
Er wird zurückkommen. Er kam immer zurück. Zuerst hatte sie gebetet, dass jemand sie retten würde. Vergeblich. Nun betete sie, dass der Tod schnell kam.
Das allerdings schien nicht seinem Plan zu entsprechen. Wer immer er war. Es gefiel ihm eindeutig, das Ganze in die Länge zu ziehen, und das hatte er ihr bereits mehrmals gesagt: Es sollte dauern, dafür würde er schon sorgen!
Das Schlimmste aber war, dass sie nicht wusste, ob er auch Corinne in seine Gewalt gebracht hatte. Zwar hatte sie gesehen, wie er ihre Freundin hinten in den Van gestoßen hatte, bevor sie das Bewusstsein verlor, doch seit sie wach geworden war, hatte sie niemand anderen schreien hören.
Bitte. Lass Corinne entkommen sein. Aber sie glaubte nicht daran. Corinne hatte leblos gewirkt, als er sie in den Van verfrachtet hatte. Als sei sie schon zu diesem Zeitpunkt tot gewesen.
Sie hörte, wie sich die Tür leise schloss, und verspannte sich. Zitronen. Sie roch Zitronen. Das Mädchen war wieder da.
»Hilf mir«, bettelte Arianna. Ihre Stimme war heiser und brüchig. »Bitte, hilf mir doch.«
Ein feuchtes Tuch tupfte ihr die Wangen ab und wischte fort, was vermutlich Schweiß und Blut war. Und Tränen. Arianna hatte von allem reichlich vergossen.
»Es tut mir leid«, flüsterte das Mädchen. »Es tut mir so leid.«
Arianna zerrte wieder an den Fesseln. »Binde mich los. Bitte. Ich hol dich hier auch raus, das verspreche ich.«
Das Mädchen zog langsam die Luft ein, während sie sanft Ariannas Gesicht abwischte. »Ich kann nicht weg. Das geht nicht.«
»Wer sagt das? Ich nehme dich mit. Bitte. Du bist meine einzige Hoffnung.«
»Es tut mir leid.« Das Mädchen erstarrte in der Bewegung. Arianna hörte Schritte auf die Tür zukommen.
Dann ging die Tür auf. Die Atmung des Mädchens beschleunigte sich hörbar. »Ich h-hab s-sie n-nur s-sauber gemacht«, stotterte das Mädchen. »Wie du es mir befohlen hast.«
Es folgte ein lautes Klatschen, als er ihr offenbar eine Ohrfeige verpasste. »Du hast mit ihr geredet. Das ist verboten. Ich hab dir gesagt, dass du mit keiner reden darfst, aber du missachtest meine Befehle. Hol einen leeren Karton aus der Küche und pack meine Sachen. Und deine auch.«
Das Mädchen erwiderte nichts. Arianna hielt den Atem an. Er will weg? Warum?
Aber das zählte nicht. Was zählte, war, dass er sie losmachen musste, wenn er sie fortbringen wollte. Und das ist meine Chance zu entkommen.
Die schlurfenden Schritte des Mädchens bewegten sich zur Tür, die sich leise hinter ihm schloss. Arianna hörte, wie er sich ihr näherte. Sie wappnete sich gegen den Schlag, der kommen würde, zuckte aber dennoch zusammen. Ihre Wange brannte, und ihr Kiefer schmerzte, aber sie schrie nicht auf.
»Hast du um Hilfe gebettelt?«, fragte er mit samtweicher Stimme. »Hast du ihr gesagt, dass sie dich losmachen soll? Tja, sie wird dir nicht helfen. Sie weiß nämlich nicht, wie. Du bleibst hier. Für immer. Es sei denn, ich töte dich.«
Arianna presste die Kiefer zusammen und wartete auf den nächsten Schmerz, aber er entfernte sich von ihr. Einen Augenblick später vernahm sie das Klirren von Metall. Messer, dachte sie. Er packt die Messer zusammen und legt sie in eine Kiste. Es folgte ein lautes, hohles Geräusch. Als ob er etwas zuklappte. Vielleicht einen Deckel? Ja. Wie der Deckel einer Werkzeugkiste.
Die Tür fiel krachend ins Schloss, und er war weg. Arianna atmete langsam aus. Sie wusste nicht, was geschehen war und was es bedeutete, aber sie wusste, dass sie nun eine Chance hatte. Sie würde es schaffen, schwor sie sich. Sie würde sich befreien, Corinne suchen und aus diesem Alptraum fliehen.
Er warf die Tür der Folterkammer zu. Gott, war er sauer! »Roza? Wo zum Teufel steckst du?«
Die Decke, die den Durchgang zu ihrer Kammer verhängte, wurde zur Seite geschoben. »Hier bin ich«, antwortete das Mädchen leise.
»Ich hab dir doch gesagt, du sollst meine Sachen packen. Was machst du hier hinten?«
Sie zögerte. Senkte den Blick. »Aber ich sollte doch auch meine packen.«
Stimmt. Das hatte er gesagt. Aber schließlich konnte sie dafür nicht lange brauchen. Sie besaß vielleicht vier Dinge. »Also gut. Dann mach schon.« Sie bewegte sich nicht. »Was ist denn jetzt noch?«
Sie zog unwillkürlich den Kopf ein. »Was … was ist mit Mama?«
Er starrte auf sie hinab. Sie war dünn, aber sie war größer geworden. Und an … gewissen Stellen runder, wo vorher keine Rundungen gewesen waren. »Was soll mit ihr sein?«
Sie blickte in den dunklen Flur, der zu ihrem Zimmer führte. »Ich kann sie doch nicht einfach hierlassen.«
Er schüttelte den Kopf. Er hatte gewusst, dass sie dumm war, aber nun überraschte sie ihn doch. »Du kannst sie nicht mitnehmen. Das ist doch ekelhaft. Sie ist schließlich nicht präpariert oder so was. Wahrscheinlich besteht sie nur noch aus faulendem Glibber.« Die Mutter des Kindes war im vergangenen Jahr gestorben, während er fort gewesen war, und bei seiner Rückkehr hatte Roza die Schlampe bereits selbst begraben. Weil der Verwesungsprozess schon eingesetzt hatte, hatte er es gut sein lassen. Die Zeit war mit der Frau nicht gnädig umgegangen. Er hätte ihr Gesicht ohnehin nicht erhalten mögen.
Er wusste, dass das Mädchen an dem Grab seiner Mutter hing. Sie sprach damit, schlief daneben. Das verstand er ja. Aber die Überreste mitnehmen? Das Kind war nicht mehr ganz richtig im Kopf.
»In der Küche steht eine Tüte mit Essen zum Mitnehmen.« Das Essen war kalt geworden, während er auf der Suche nach Faith’ rotem Jeep durch die Gegend gefahren war. »Wärm es auf. Und wag es nicht, auch nur einen Bissen davon zu nehmen. Ich merke das, ich habe die Tüte gewogen.«
»Okay«, flüsterte sie.
Das war schon besser. Er hatte ihr zu viele Freiheiten gelassen. Sie hatte sich mit den Gefangenen unterhalten, als er nicht da war, weil er die Zügel zu locker gelassen hatte, seit ihre Mutter gestorben war. Nun musste er ihr wieder beibringen, was Respekt hieß. »Und wenn du damit fertig bist, schrubbst du alles mit Chlorbleiche ab. Jede Wand, jeden Zentimeter Boden. Wenn ich irgendwo eine trockene Oberfläche sehe …«
Dann würde er den Ungehorsam schon aus ihr rausprügeln. Er war in der Stimmung, seinen Frust an irgendetwas auszulassen – oder an irgendwem. Gott mochte dem Kind beistehen, wenn es ihm in die Quere kam. Es war praktisch, dass er Arianna Escobar hatte. Sie würde noch heute Nacht die ganze Wucht seiner Wut zu spüren bekommen. Sie hielt sich für ach-so-zäh und glaubte wahrscheinlich, sie hätte das Schlimmste schon überstanden. Dabei hatte er gerade erst angefangen.
Er hatte Faith nicht gefunden, obwohl er überall dort gesucht hatte, wo sie sich sonst immer herumtrieb, wenn sie auf Besuch bei der alten Schachtel gewesen war, die ihr das Haus vererbt hatte, aber er hatte den roten Jeep nirgendwo entdeckt. Ich hätte ihr sofort folgen müssen. Ich hätte ihr die Reifen zerschießen und sie aufhalten müssen, bevor sie abhauen konnte. Er war ein verdammt guter Schütze. Wenn die Waffe nur geladen gewesen wäre.
Aber das war sie nicht gewesen. Und hätte er sie gestoppt, hätte sie vielleicht noch die Polizei gerufen, bevor er sie hätte schnappen können. Das hätte ihm gerade noch gefehlt.
Dass sie das Haus betreten würde, falls er sie nicht vorher umbrachte, war Fakt. Sie würde sich umsehen und es dann verkaufen. Makler würden kommen und herumschnüffeln. Und meine Sachen anfassen. Er musste sie finden, bevor sie die Chance hatte, hier hereinzukommen. Er wollte ihren Tod, aber zu seinen Bedingungen, denn hätte er sie erst einmal aus dem Weg geschafft, würde er den alten Kasten selbst verscherbeln.
Er hatte den Plan bereits ins Rollen gebracht, also musste sie in der Tat schnellstmöglich von der Bildfläche verschwinden.
Eiligen Schritts ging er in sein Büro, schloss die Tür, rückte den Tisch von der Wand ab und löste die Abdeckung zu seinem Versteck. Es gab Dutzende solcher Verstecke. Manche hatte er selbst eingebaut, andere waren bereits vorhanden gewesen. Diese alten viktorianischen Gemäuer boten Winkel und Nischen zuhauf, und ebendie hatte er sich zunutze gemacht.
Er holte eine Kassette aus der Wand und stellte sie vorsichtig auf dem Tisch ab. Sie war im Laufe der Jahre schwer geworden. Darin befand sich seine wertvollste Sammlung, und sie war das Einzige, was er mitnähme, falls er rasch verschwinden müsste.
Gleichzeitig war diese Kassette der einzige Gegenstand, der seinen Untergang bedeutete, sollte man ihn finden. Er schloss die Kassette auf und hob den Deckel. Sie steckte voller Erinnerungen: Handys und Brieftaschen und Führerscheine. Haarbänder und Ohrringe, Ketten und Ringe. Fotos, Autoschlüssel und Dosen mit Pfefferspray – die niemals zum Einsatz gekommen waren, weil er viel zu schnell gewesen war. Er besaß sogar die Marke einer Polizistin.
Deputy Susan Simpson hatte sie geheißen. Sie war ein kämpferisches Ding gewesen. Groß und drall und viel kräftiger, als sie ausgesehen hatte. Aber letztlich hatte sie sich seinem Willen gebeugt wie alle anderen auch. Sie war ein echtes Sahnestück gewesen, hatte wochenlang durchgehalten, bis sie schließlich gestorben war. An ihr hatte er erstaunlich viel Stress und Zorn abbauen können.
Doch nun stand er unter noch größerem Druck als damals. Die Entführung von Corinne Longstreet am Freitag war schwierig gewesen. Er hatte sie wochenlang beobachtet und nur auf den richtigen Moment gewartet. Es hatte unbedingt Freitag sein müssen. Wegen Faith.
Am Freitagabend war er hochgradig angespannt gewesen. Trotz seiner Müdigkeit war er direkt zum King’s College gefahren, und beinahe hätte er einen Fehler gemacht, der ihn alles gekostet hätte.
Er hatte darauf gewartet, dass sich die zwei Frauen an der Weggabelung trennten. Arianna war zu ihrem Wohnheim abgebogen und hatte Corinne allein und verwundbar zurückgelassen. Sie zu schnappen, war ein Kinderspiel gewesen. Er hatte allerdings nicht damit gerechnet, dass Arianna zurückkommen und ihrer Freundin zu Hilfe eilen würde. Dass es ihm gelungen war, auch noch Arianna zu überwältigen, bevor sie die Chance hatte, die Neun-elf zu wählen, war reines Glück gewesen.
Er wollte keine von beiden jetzt schon töten. Er war noch nicht mit ihnen fertig, noch lange nicht. Er wollte hierbleiben. Seinen Spaß haben. Seinen Frust abbauen. Er musste irgendwie Dampf ablassen, sonst würde er ausrasten.
Und alles wegen Faith Frye. Warum war sie nicht längst gestorben wie jeder normale Mensch, auf den mehrere Anschläge verübt worden waren? Er spürte, wie sich Erregung in ihm ausbreitete und seinen Verstand benebelte. Wenn er seinen Gefühlen zu viel Raum ließ, würde er etwas Unkluges tun. Etwas Spontanes. Und dann würde man ihn erwischen. Das war unvermeidlich. Daher ließ er die Erregung niemals überhandnehmen.
Sobald er mit Arianna fertig war, würde er wieder ruhig, gefasst und gelassen sein.
Und dann würde er Faith Frye finden und sie töten. Seine Probleme wären damit zwar noch längst nicht gelöst, aber sie würden nicht mehr so drängen.
Er nahm die Keycard eines Hotels aus der Schatulle und betrachtete sie stirnrunzelnd. Er konnte sich nicht erinnern, von wem sie stammte, aber das spielte ohnehin keine Rolle mehr. Was dagegen sehr wohl eine Rolle spielte, war, dass nun auch Faith eine solche Schlüsselkarte besäße. Sie musste in einem der hiesigen Hotels untergekommen sein. Es mochte ein Weilchen dauern, aber letztlich würde er sie aufstöbern, und wenn er jede einzelne Unterkunft in der Gegend abtelefonieren müsste.
Mit dem Handy suchte er nach der Nummer der Hotelkette, bei der Faith normalerweise buchte. So war das mit Gewohnheitstieren. Er wählte das erste Haus an. »Faith Fryes Zimmer, bitte.«
»Würden Sie mir den Namen buchstabieren?«, bat der Rezeptionist.
»Frye. F-R-Y-E.«
»Und Sie sind sicher, dass sie ein Zimmer bei uns hat? Ich kann sie in unserem Computer nicht finden.«
Es wäre ja auch zu einfach gewesen, beim ersten Versuch einen Treffer zu erzielen. »Ich hätte schwören können, dass Sie Ihr Hotel genannt hat. Entschuldigen Sie und danke für Ihre Mühe.«
Er rief bei jeder Filiale der Hotelkette im Großraum der Stadt an, aber ohne Erfolg. Seine Frustration hatte bereits ein gefährliches Level erreicht, als das Mädchen leise klopfte. Knurrend riss er die Tür auf und sah es mit einem Tablett in den Händen auf der Schwelle stehen. Sein Abendessen. Fast hätte er es vergessen.
Roza hielt den Blick gesenkt. Ihre Arme zitterten unter dem Gewicht des Tabletts und wahrscheinlich auch vor Angst. Er nahm es ihr ab. »Du sollst nicht lauschen!«
Sie hob den Blick nicht. »Hab ich nicht. Tut mir leid.«
»Geh in dein Zimmer. Du kannst das Tablett morgen abwaschen. Verschwinde. Ich hab zu tun.« Er warf die Tür wieder zu und aß, während er die nächsten Hotels heraussuchte und anwählte. Er musste unbedingt bald eine Pause einlegen. Inzwischen klang seine Stimme patzig, und man würde sich an ihn erinnern, wenn er die Beschimpfungen ausstieß, die ihm auf der Zunge lagen.
Unzufrieden schob er den leeren Teller von sich und kehrte in die Folterkammer zurück. Er würde sich an Arianna abreagieren, bevor er wieder zum Telefon griff. Und wenn es sein musste, würde er die ganze Nacht so weitermachen, bis er Faith ausfindig gemacht hatte.
»Nein, nein, nein! Ich will das nicht. Bitte verlang das nicht!«, schrie Faith wie schon Millionen Male zuvor, aber niemand hörte sie, niemand half ihr. Sie stand an der Kante und starrte in die Schwärze hinab, die sie mit Furcht erfüllte. Sie wusste, was dort unten war. Sie würde nicht noch einmal hinuntergehen.
Immer war es ihr eigener verräterischer Fuß, der sich in Bewegung setzte, über der Finsternis schwebte, sich langsam senkte, bis … bis er die Stufe berührte. Eins. Sie packte das Geländer, schlang ihre Arme darum und klammerte sich mit aller Kraft fest, doch ihre Füße bewegten sich weiter und zerrten sie hinab. Zwei.
Wahnsinnig. Drei. Ich bin wahnsinnig. Vier. Ich verliere den Verstand. Fünf. Sechs. Nein, nein, nein. Bitte nicht. Sie stöhnte jetzt, aber es nützte nichts, es hatte noch nie etwas genützt. Ihre Füße taten Schritt um Schritt. Sieben, acht, neun.
Zehn. Elf. Zwölf. Das war’s. Und jetzt lauf! Aber sie war bereits erstarrt.
Nicht hinsehen. Sie kniff die Augen zu, als ihr Körper sich gegen ihren Willen umdrehte. Nicht! Hinsehen! Sie wusste doch, was sie sehen würde. Nicht die Augen öffnen. Aber ihre Augen öffneten sich jedes Mal.
Rote Schuhe. Keds. Sie schwangen leicht hin und her und zogen die strahlend weißen Schuhbänder durch den Staub. Nicht aufschauen. Nicht. Auf. Schauen. Doch ihr Kinn hob sich und –
Mit einem Ruck setzte sich Faith in ihrem Bett auf. Ihr Atem kam in kurzen Stößen, in ihren Ohren schrillte ihr eigener Schrei. Mit einer Hand tastete sie neben sich nach der Lampe auf dem Nachttisch, mit der anderen nach der Pistole unter dem Kopfkissen. Sie blinzelte in der plötzlichen Helligkeit, während ihr Verstand verzweifelt versuchte, sich in der fremden Umgebung zu orientieren.
Hotel. Sie war in einem Hotelzimmer in Cincinnati. Umgeben von Kartons und Koffern. Sie war allein. Ihr war nichts geschehen. Alles war gut. Schaudernd stieß sie die Luft aus. Inzwischen zitterte sie am ganzen Körper.
Das schrille Klingeln des Telefons zerriss die Stille und ließ sie nach dem Hörer greifen. »Ja?«, fragte sie mit kratziger Stimme.
»Dr. Corcoran, ist alles in Ordnung? Ein Gast auf Ihrer Etage hat einen Schrei in Ihrem Zimmer gehört.«
Das Blut stieg ihr in die Wangen. »Ja, danke, alles in Ordnung«, log sie. »Ich habe schlecht geträumt. Tut mir leid, dass ich die anderen Gäste gestört habe.«
Faith legte den Hörer auf die Gabel, stieg aus dem Bett und schaltete den Fernseher ein. Sie dämpfte die Lautstärke, suchte den Karton mit der Xbox und packte ihn aus.
Ein paar Minuten später setzte sie sich mit dem Controller auf den Boden und nahm das Spiel dort wieder auf, wo sie nach dem letzten Alptraum aufgehört hatte.
»Tja, da werde ich wohl erst einmal ein paar Zombies plattmachen müssen«, murmelte sie. Denn nach einem solchen Alptraum wieder einschlafen zu wollen, war sinnlos, wie sie bereits vor dreiundzwanzig Jahren gelernt hatte.
2. Kapitel
Sie war schlauer geworden, dachte er, während er beobachtete, wie Faith an der Einfahrt eines Parkhauses am Fountain Square ein Ticket zog. Seine Anschläge auf ihr Leben hatten sie vorsichtig gemacht.
Gut für sie, schlecht für mich. Er hatte sie schließlich in einem Hotel mit Parkservice gefunden. Deswegen war ihr Jeep nicht zu sehen gewesen. Er hatte die ganze Nacht gewartet, bis sie wieder auftauchte. Sobald er sie sich geschnappt hätte, würde sie für die schlaflosen Nächte, die sie ihm bereitet hatte, bezahlen.
Vor einer Stunde war sie endlich aus dem Hotel gekommen. Sie hatte sich regelrecht herausgeputzt und trug ein smaragdgrünes Kostüm mit dazu passenden High Heels. Zuerst hatte er angenommen, dass sie sich auf den Weg zu ihrem Anwalt machen würde, aber das hatte sie nicht getan. Stattdessen war sie in die Innenstadt gefahren. Wo sie weiterhin auf der Hut blieb. Das Parkhaus, in das sie nun einbog, hatte Kameras am Eingang. Vermutlich auf jedem Deck.
Es lag sehr zentral in einer der belebtesten Ecken der City, so dass sie zu Fuß zu ihrem Zielort gelangen und sich zwischen den vielen Passanten verstecken konnte. Er würde sie hier kaum allein zu fassen kriegen, aber das war nicht schlimm, denn er hatte ohnehin nicht vor, sie hier zu töten. Er würde abwarten, bis er sie an einen einsamen Ort locken konnte, und zwar an einen, der nicht in der Nähe seines Kellers lag.
Er folgte ihr ins Parkhaus, ohne sich darüber Gedanken zu machen, dass die Kamera ein Bild von ihm schoss, als er das Ticket aus dem Automaten zog. Er war verkleidet, und niemand konnte ihn mit dem Nummernschild aus Tennessee an seinem Van in Verbindung bringen. Die Schilder stammten von dem Auto eines Herumtreibers, der geglaubt hatte, er könne das vermeintlich leerstehende Haus der O’Bannions vorübergehend als Privatunterkunft nutzen, aber das war eine wirklich dumme Idee gewesen. Der Bursche hatte nicht einmal annähernd so lange durchgehalten wie die Frau, die nun auf seinem Tisch lag. Beim ersten kleinen Schnitt mit dem Messer hatte er schon gekreischt wie ein kleines Mädchen.
Der Gedanke weckte seine Lust, zu Arianna zurückzukehren. Geduld! Er würde sich mit seinem neusten Gast befassen, sobald er sich um Faith gekümmert hatte. Nun, da er sie ausfindig gemacht hatte, brauchte er das Haus nicht mehr zu räumen.
Langsam fuhr er über das Parkdeck, als suche er einen freien Platz, während er in Wirklichkeit nach Faith’ rotem Jeep Ausschau hielt.
Stattdessen lief ihm Faith gleich selbst vor den Kühler.
Sie hatte offensichtlich schon geparkt. In ihrem grünen Kostüm, über dem Arm einen dunklen Mantel, kreuzte sie direkt vor seiner Motorhaube den Mittelgang. Plötzlich ließ sie ihren Schlüssel fallen und bückte sich, um ihn wieder aufzuheben, und er musste gegen den schier übermächtigen Drang ankämpfen, das Gaspedal durchzutreten. Er bekam sie auf dem Silbertablett serviert. Los. Tu es. Jetzt.
Aber das wäre mehr als dumm gewesen. Um diese Tageszeit herrschte viel Verkehr im Parkhaus. Er würde es vermutlich nicht einmal bis hinaus auf die Straße schaffen, bevor die Polizei ihm auf den Fersen wäre. Sie konnte nicht einfach so verschwinden wie die anderen. Die Cops würden überall dort suchen, wo sie zuletzt gewesen war. Was den Friedhof und das Haus mit einschloss. Also halt dich an deinen Plan. Sie war es nicht wert, alles zu riskieren.
Er stellte den Van ab, stieg langsam aus und holte absichtlich umständlich seinen Stock hervor, ehe er die Tür schloss. Er wusste, dass er mit dem gekrümmten Rücken und den schlurfenden, unsicheren Schritten locker für neunzig Jahre durchging. Ein schütterer Vollbart verdeckte sein Gesicht, eine Brille seine Augen, ein Hut rundete das Bild ab. Natürlich trug er außerdem wie immer Handschuhe. Er hatte noch nie einen Fingerabdruck hinterlassen, den er nicht hinterlassen wollte.
Als er den Jeep erreichte, ließ er einen Kugelschreiber fallen, so dass er unter den Kotflügel rollte. Behutsam ließ er sich auf ein Knie herab und hob den Stift wieder auf, wobei er sich eine Hand in den Rücken presste, falls ihm jetzt oder später jemand dabei zusehen sollte. Gleichzeitig brachte er den Peilsender, den er in seiner Manteltasche verborgen hatte, unter der Stoßstange an.
Na, bitte. Sein Handy würde piepen, sobald der Jeep sich bewegte. Es interessierte ihn nicht, wohin sie sich innerhalb der Stadt begab. Er wollte nur wissen, wann sie die Stadt verließ und in seine Richtung fuhr. Denn er musste sie töten, bevor sie das Haus betrat.
Detective Catalina Vega stellte den großen Becher colada auf den Tisch ihres Chefs, holte zwei kleine Plastiktassen und füllte sie mit dem dickflüssigen süßen Gebräu. Dann wartete sie darauf, dass der Duft seine Aufmerksamkeit weckte. Der kubanische Espresso war seine große Schwäche, und der Laden in Cats Viertel machte den besten weit und breit.
Lieutenant Neil Davies atmete genießerisch ein, ehe er von seinem Bildschirm aufblickte. »Was wollen Sie, Vega?«
Sie schenkte ihm ein breites Grinsen. »Was ich immer will. Mehr Geld, ein neues Auto, ein protziges Büro wie Ihres.«
Davies lehnte sich in seinem Stuhl zurück und blickte sich in seinem »protzigen« Büro um. Es war kaum größer als ein Garderobenschrank, auf einer Seite seines Schreibtisches stapelten sich die Akten ungelöster Mordfälle.
»Tja, dann sind Sie offenbar noch verrückter als ich«, sagte er gutmütig. Er kippte den Espresso in einem Zug und hielt ihr das Tässchen hin, damit sie es nachfüllte. »Was wollen Sie sonst noch?«
»Das hier.« Sie legte ihm ein Foto auf den Tisch.
»Das ist ein demoliertes Auto«, sagte er nachdenklich. »Warum wollen Sie ein demoliertes Auto?«
»Weil das der Prius ist, der gestern Morgen auf der I-75 die Massenkarambolage verursacht hat, bei der vier Autos ineinandergerauscht sind.«
Er blickte zu ihr auf. »Vermutlich wollen Sie mir sagen, dass es kein Unfall gewesen ist.«
»Richtig, es war keiner. Unsere Kfz-Mechaniker haben festgestellt, dass sowohl Steuerung als auch Bremsen manipuliert wurden. Jeder Schaden für sich genommen, hätte zwingend einen Unfall erzeugt, aber beide zusammen …« Sie zuckte die Achseln. »Der Wagen kreuzte den Mittelstreifen, geriet in den Gegenverkehr, touchierte schleudernd drei Autos und wurde schließlich frontal von einem Sattelschlepper erwischt. Die Fahrerin des Prius’ starb noch an der Unfallstelle, ihr Sohn etwas später. Vier Personen wurden schwer verletzt, zwei befinden sich in Lebensgefahr.«
Davies seufzte. »Das ist eine furchtbare Tragödie, Cat, aber nicht unser Fall. Dafür sind die Verkehrsermittler zuständig. Wieso wissen Sie überhaupt davon? Lassen Sie die Jungs ihren Job tun. Wir haben genügend andere Fälle.«
»Hören Sie sich bitte die ganze Geschichte an. Die Verkehrsabteilung hat bereits mit der Familie der Fahrerin gesprochen. Die Frau hatte den Wagen erst einen Tag zuvor gekauft. Er war noch nicht einmal auf sie umgemeldet. Die Vorbesitzerin hieß Faith Frye.«
»Den Namen kenne ich. Wo habe ich ihn schon mal gelesen?«
»In meinem Bericht zum Shue-Mordfall.« Sie strich mit dem Finger über die Rücken der Ordner auf seinem Tisch, zog einen hervor und reichte ihn ihrem Boss. »Gordon Shue war der Leiter eines Beratungszentrums für Frauen. Dort hat man Opfern von Vergewaltigung, Inzest und anderen Formen von häuslicher Gewalt geholfen. Vor vier Wochen wurde er beim Verlassen seines Büros erschossen, eine Kugel ging in die Brust, eine zweite in den Kopf. Neben ihm stand seine Mitarbeiterin, Dr. Faith Frye.«
Davies lehnte sich stirnrunzelnd zurück. »Okay, ich höre Ihnen zu. Weiter.«
»Frye konnte mir verschiedene Verdächtige nennen – ursprünglich alles Ehemänner oder Partner ihrer Patientinnen. Während sie mit mir sprach, berührte sie immer wieder eine böse aussehende Narbe an ihrem Hals, was mir so sehr auffiel, dass ich mich später über sie schlaumachte. Vor vier Jahren wurde sie selbst von einem Patienten überfallen – einem Sexualstraftäter auf Bewährung. Er hat versucht, ihr die Kehle durchzuschneiden, und beinahe ist es ihm gelungen.«
»Sozialarbeit kann ein gefährliches Geschäft sein«, sagte Davies leise.
Die Frau des Lieutenants war Sozialarbeiterin, und er machte sich ständig Sorgen um sie, wie Cat wusste. »Wenigstens kann Ihre Frau sich besser verteidigen als die meisten anderen.«
»Ja, allerdings, und zwar, weil ich ihr gezeigt habe, wie es geht.« Davies klappte die Shue-Akte zu. »Was steckt also dahinter, wenn sich jemand am Wagen dieser Frye zu schaffen macht, die kurz vorher Zeugin eines Mordes wurde?«
»Meine Recherche vor ein paar Wochen brachte mehr als nur den Messeranschlag auf sie zutage. Nachdem Peter Combs, der Kerl, der sie damals fast umgebracht hatte, auf Bewährung rauskam, fing er an, ihr nachzustellen. Ein Jahr lang.«
»Hat sie Anzeige erstattet?«
Vega nickte ernst. »Dreißig Mal.«