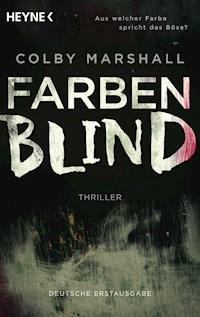2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Mädchen wird Zeugin einer Massenschießerei. Ihre Erinnerung ist die einzige Chance, dem Täter auf die Spur zu kommen. Dr. Jenna Rameys muss herausfinden, wen oder was sie gesehen hat. Aber Molly ist kein gewöhnliches Mädchen: Sie ist von der Welt der Zahlen besessen. Dadurch nimmt sie vieles wahr, was anderen entgeht. Jenna gerät in einen Irrgarten von Spekulationen und falschen Fährten, während es weitere Tote gibt. Sie muss lernen, Mollys Aussagen richtig zu interpretieren, um dem Mörder auf die Schliche zu kommen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 556
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
ZUM BUCH
FBI-Profilerin Dr. Jenna Ramey besitzt die Fähigkeit der Synästhesie, eine neurologische Störung, die scheinbar zusammenhanglose Sinneseindrücke in ihrer Wahrnehmung miteinander verbindet. Doch sie hat gelernt, die Assoziationen zu deuten und für ihre Arbeit zu nutzen. Denn sie können Leben retten.
Die kleine Molly wurde Zeugin einer Massenschießerei. Ihre Erinnerung ist die einzige Chance, dem Täter auf die Spur zu kommen. Es ist nun Jennas Aufgabe herauszufinden, wen oder was sie gesehen hat. Doch Molly ist kein gewöhnliches Mädchen: Die Welt der Zahlen ist der Ort, an dem sie sich wohlfühlt. Dadurch nimmt auch sie vieles wahr, was anderen entgeht: die Anzahl der Schüsse, die Anzahl der Klopfgesten des Schützen gegen sein Handgelenk, bevor er abdrückt, die Anzahl der Minuten, seit sie ihre Großmutter zuletzt gesehen hat. Aber es ist schwer, diese Informationen zu verarbeiten. Jenna gerät in einen Irrgarten von Spekulationen und falschen Fährten, während die Zahl der Toten stetig steigt. Sie muss lernen, Mollys Aussagen richtig zu interpretieren, um einen kaltblütigen Mörder zu fassen …
ZUR AUTORIN
Tagsüber ist Colby Marshall Autorin, abends Tänzerin und Choreografin. Sie hat die Angewohnheit, jedes ihrer Hobbys zum Beruf zu machen, sodass ihr als Workaholic nie die Arbeit ausgeht. Neben ihren gefühlten 9502 normalen Jobs ist sie stolzes Mitglied der International Thriller Writers und der Sisters in Crime. Colby lebt mit ihrer Familie in Georgia. Und sie weiß, worüber sie bei der Graphem-Farb-Synästhesie schreibt, denn sie hat selbst diese seltene Gabe. Besuchen Sie sie online unter colbymarshall.com.
COLBY MARSHALL
Double Vision
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Maria Zettner
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Die Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel Double Vision bei Berkley Books, New York.Taschenbucherstausgabe 03/2017
Copyright © 2015 by Colby Marshall
Copyright © 2017 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkterstraße 28, 81673 München
Redaktion: Birgit Bramlage
Umschlaggestaltung: Eisele Grafik Design, München unter Verwendung von © ilolab
Satz: Uhl + Massopust, AalenISBN 978-3-641-19475-8V002www.heyne.de
1
»Notrufzentrale, wie können wir Ihnen helfen?«
»Ich bin im Supermarkt, und hier schießt einer auf die Leute«, sagte Molly. Sie dachte an die Ereignisse um »911«. Es war das Datum, an dem sie zur Gedenkfeier in die Stadt gingen. Die höchste einstellige Zahl und dann zweimal die kleinste einstellige Zahl. So wie ihr Geburtstag.
»Schätzchen, wie alt bist du?«
»Sechs«, antwortete Molly. Die Anzahl der Saiten auf einer Gitarre. Punkte beim Touchdown im Football. Eins weniger als sieben.
Molly steckte sich das Handy in die Tasche, kletterte in den Container mit gefrorenem Fleisch und rutschte durch auf die andere Seite, wo der Metzger die Stücke zerhackte. Neulich erst war ihr das Loch, durch das er das Fleisch in den Kühlschrank schob, aufgefallen. Sie duckte sich hinter den Container.
PENG. PENG. PENG.
»Ich bin wieder da«, sagte sie und hielt sich das Handy ans Ohr.
»Welcher Supermarkt? Kannst du mir sagen, wo du bist?«
»Lowman’s Discounter«, erwiderte Molly. Mit Mommy kam sie nie hierher. Mommy sagte, die vielen Menschen würden sie verrückt machen, was immer das bedeuten mochte. Grandma dagegen sparte gerne Geld. Ein einzelner Cent macht dich noch nicht reich, hatte sie Molly erklärt, aber hundert Cent sind schon ein Dollar.
»Wie heißt du, Schätzchen?«
Grandma hatte ihr auch gesagt, sie solle Fremden nicht ihren Namen nennen, aber das hier war ja der Mann am anderen Ende von 911. Der zählte nicht.
»Molly Keegan.«
»Hilfe ist unterwegs, Molly. Leg nicht auf, ja? Hast du die Person gesehen, die den Leuten wehtut?«
Peng.
»Ein bisschen.«
»Ist es ein Mann oder eine Frau?«
»Weiß nicht«, flüsterte Molly. Masken waren da nicht sehr hilfreich.
Stille. Jetzt war nichts mehr zu hören.
»Vielleicht ist er ja auch schon weg«, sagte sie.
»Wo bist du gerade, Molly?«, fragte der Mann am Telefon.
»In einem Versteck.«
»Bleib, wo du bist, okay?«
Aber Molly konnte nicht bleiben, wo sie war. Sie musste nachsehen gehen. Was war mit Grandma?
Sie wagte sich ein Stückchen hinter dem Container hervor, spähte umher. Niemand war da. Sie richtete sich auf und kletterte nach draußen. In einem Gang lagen Leute und bewegten sich nicht. Auf dem Boden glitzerte es rot. Schau nicht auf das Rot.
Auf Zehenspitzen schlich sie sich bis zum Gang mit den Müslis, wo sie Grandma das letzte Mal gesehen hatte. Ein benommen aussehender Mann, so ungefähr im Alter ihres Pop-Pops, ihr Grandpa, saß zusammengesackt vor dem Regal, blutete aber nicht. Weiter hinten im Gang lag auf der linken Seite noch ein Mann.
»Haben Sie meine Grandma gesehen?«, flüsterte Molly dem Mann zu.
Dann hörte sie Sirenengeheul, schnelle Schritte. Die Person mit der Waffe tauchte am anderen Ende des Gangs mit den Müslis auf und schaute zur Tür des Supermarkts, wo in der Ferne die Polizeisirenen zu hören waren.
Die Waffe kam nach oben, und der Mann weiter hinten im Gang schrie auf.
Molly ging unter dem untersten, halb leeren Regalbrett in Deckung und zog die Füße ein. Um sie herum fielen krachend Kartons zu Boden, dann knallte sie mit dem Kopf gegen das Metall, sodass ihr Kopf wehtat.
Peng.
»Molly? Molly! Bist du noch da?«, schrie der fünfundzwanzigjährige Yancy Vogul in den Hörer. Dispatcher sollten eigentlich unter Druck die Ruhe bewahren, die Anrufer beruhigen, aber hier handelte es sich um ein Kind. Darauf war er nicht gefasst.
Abgehacktes Keuchen drang an sein Ohr. »Ich bin hier«, sagte die Kinderstimme.
Heilige Scheiße. Danke, Gott.
»Hilfe ist unterwegs«, erklärte Yancy noch einmal. Er hatte seinen Job erledigt, sodass die Cops jetzt wussten, worauf sie sich einließen. Sie waren darauf angewiesen, dass er alles richtig verstand und ihnen genug Informationen lieferte, damit sie nicht ins offene Messer liefen. Damit sie am Abend wieder heil zu ihren Familien zurückkehren konnten.
Aber jetzt war er einfach froh zu hören, dass die Kleine am Leben war.
»Bist du verletzt?«
»Nein«, antwortete sie. »Er ist weggelaufen.«
»Der Schütze?«, fragte Yancy nach.
»Ja.«
Er hätte noch gerne gewusst, in welche Richtung der Schütze geflohen war, was das Mädchen gesehen hatte, aber womöglich durchstreifte sie, wenn er sie das fragte, noch den ganzen Laden, um es herauszufinden. Deswegen unterhielt er sich weiter mit ihr, bis Verstärkung eintraf.
Er trug das letzte Update des Mädchens in sein Protokoll ein in der Hoffnung, dass das ausreichte.
»Sieben«, klang Mollys Stimme in seinem Ohr.
Yancy hatte gar nichts gefragt. »Was meinst du mit Sieben?«
»Mm-hm«, erwiderte sie. »Sieben Schüsse.«
»Woher weißt du das?«
Er hörte Mollys Seufzer am anderen Ende. Als sie wieder etwas sagte, klang sie frustriert angesichts seiner Begriffsstutzigkeit. »Weil ich mitgezählt habe.«
2
Jenna Ramey drückte ihrem Bruder einen Schlüsselbund in die Hand.
»Und vergiss nicht, sowohl die Haustür als auch die Seitentür zu verriegeln, wenn du und Dad im Haus seid, und wenn ihr rausgeht, dann lasst die Verriegelung an der Seite offen. Ich habe heute das Passwort an der Alarmanlage neu eingegeben. Es lautet …«
»Sri Lanka 49 Captain C2«.
»Ich weiß, ich weiß. Du hast es mir schon mal gesagt«, knurrte Charley und nahm Jenna Ayana vom Arm. »Ich dachte, dass du jetzt wieder fürs FBI arbeitest, würde bedeuten, du traust Dad und mir die Bewachung der Festungsanlage zu. Schließlich hast du uns für diesen Job alle aus unserer gewohnten Umgebung gerissen und nach Virginia verschleppt. Und wir machen das ja auch schon seit Jahren.«
Aber das war vorher. »Ich weiß, verbuche es unter nervöse Mutter eines Kleinkinds, okay?«
Natürlich hatte die Tatsache, dass ihre Tochter ein Kleinkind war, nichts damit zu tun. Als ihr Dad und Charley früher auf Ayana aufgepasst hatten, war Claudia sicher in einer geschlossenen Anstalt weggesperrt gewesen. Doch im vergangenen Jahr war es ihrer Mutter irgendwie gelungen, das System zu überlisten. Jetzt streifte sie ungehindert durch die Straßen.
Charley ließ Ayana auf den Boden vor dem Fernseher plumpsen und schaltete den DVD-Player ein. Ayana hatte den Schnuller auch mit drei Jahren noch fest zwischen den Lippen, klatschte in die Hände, als auf dem Bildschirm der Vorspann zu Findet Nemo erschien.
Wie immer spulte Charley vor, bis die gruselige Stelle mit dem Barrakuda vorbei war. »Rain Man, ich weiß, warum du das machst, ich erinnere dich nur daran, dass wir das alles schon besprochen haben. Ich war einverstanden, dein irres Schließanlagensystem umzusetzen, und wir haben sogar ein Sicherheitstraining absolviert, das sich jemand ausgedacht hat, der noch paranoider ist als du. Und das will schon was heißen. Dieses Haus ist besser vor Hausfriedensbruch geschützt als das von dem Typen die Straße runter, der die Halloween-Filme ein bisschen zu ernst genommen hat. Und jetzt raus mit dir!«
Jenna gab Ayana einen Kuss auf das feine blonde Haar, aber das kleine Mädchen nahm keine Notiz davon. Im Fernseher brachte Marlin Nemo gerade bei, in die Anemone zu schwimmen und wieder heraus.
»Hab dich lieb!«, flüsterte Jenna ihr ins Ohr.
Bei diesen Worten nahm Ayana den Schnuller aus ihrem Mund. »Ha liiieeb!«
Und dann war der Schnuller schnell wieder drin und Ayanas Blick auf das Gerät gerichtet.
Charley zuckte die Achseln. »Disney nimmt auf niemanden Rücksicht.«
»Komm, lass mich raus«, sagte Jenna.
Sie wartete geduldig, bis Charley jedes einzelne Schloss entriegelt hatte. Die Schließanlage war nicht sonderlich kompliziert, sofern man mit ihr vertraut war, aber es gab nirgendwo eine schriftliche Anleitung. Jeder Schlüssel war farblich gekennzeichnet, aber die Schlüsselfarben stimmten nicht mit den Farben auf den Schlössern überein. Um zu wissen, welcher Schlüssel in welches Schloss gehörte, musste man die Kombination auswendig lernen. Roter Schlüssel in grünes Schloss, oranger Schlüssel in hellblaues Schloss, gelber Schlüssel in violettes Schloss. Wollte man sie alle öffnen, musste man sie auch in genau dieser Reihenfolge aufschließen. Andernfalls blockierten die Riegel der anderen Schlösser das erste, und die Tür blieb zu. Es existierte nur ein Satz mit den richtigen Schlüsseln, und den musste der »Hauptverantwortliche« im Haus zu allen Zeiten bei sich tragen. Den Schlüsselsatz konnte man nicht auseinandernehmen oder nachmachen, und er war mit einem Peilsender ausgestattet.
Auch die Passwörter wurden niemals aufgeschrieben, und Jenna änderte sie täglich. Deswegen ging Jenna sie auch so oft durch, bevor sie das Haus verließ – ihr Dad und ihr Bruder durften sie nicht vergessen. Es war ihnen ausdrücklich untersagt, sie zu mailen oder sonst wie zu übermitteln. Sie durften immer nur verbal und persönlich weitergegeben werden.
»Ich richte es Dad aus, wenn er von seinem Nickerchen aufwacht. Möchtest du, dass ich eine Urinprobe nehme, um sicherzustellen, dass es auch wirklich Dad ist, bevor ich das mache?«
»Nein danke, Klugscheißer«, erwiderte Jenna. »Der Bluttest reicht völlig. In ein paar Stunden bin ich wieder da.«
Die Tür fiel hinter ihr ins Schloss. Viermal machte es klick. Und damit war sie wieder im Rennen.
Als Jenna nach Quantico kam, war sie anscheinend die Letzte von den Leuten der Behavioural Analysis Unit, der Einheit für Verhaltensanalyse, kurz BAU, die den Raum betrat. Der Konferenztisch innerhalb der verglasten Wände war schon voll besetzt. Ein paar neugierige Blicke folgten ihr, als sie die Tür schloss und das Stimmengewirr von den Arbeitsnischen um sie herum abklang. Aber niemand sagte etwas. Sie sahen alle noch so jung aus, ganz frisch im Job. Ein College-Beau mit Baseballkappe, eine junge Frau in Charleys Alter, die aussah, als könne sie als Linebacker für die Dolphins antreten. Das versprach interessant zu werden.
Jenna setzte sich auf einen Stuhl an der Wand, schon gleich als Außenseiterin deklariert.
Saleda Ovarez, verantwortlicher Special Agent und die Einzige im Raum, mit der Jenna, mit Ausnahme des Kriminaltechnikers Irv, schon zusammengearbeitet hatte, heftete Bilder an ein riesiges Whiteboard. Die dunkelhäutige Frau warf einen Blick auf ihre Armbanduhr.
»Ich wollte eigentlich noch auf Agent Dodd warten, bevor wir weitermachen, aber es ist schon zwei Minuten nach. Wir müssen loslegen.« Ihr Bostoner Akzent war deutlich zu hören. Jenna war demnach doch nicht die Letzte. Sie nahm die spitze Bemerkung ihrer Vorgesetzten über die zweiminütige Verspätung als eine Warnung. Beim nächsten Mal würde sie ihren Vater und ihren Bruder morgens gleich als Erstes instruieren, bevor ein möglicher Anruf kam.
»Ein Killer ist in den Lowman’s Discounter auf der Grady eingedrungen, hat das Feuer eröffnet und ist zu Fuß entkommen. Sieben Opfer, darunter ein ganz spezielles«, erläuterte Saleda und tippte auf das Foto in der linken oberen Ecke. »Miriam Holman, zweiundfünfzig.«
»Sie meinen die Miriam Holman, die Gouverneurin von Virginia?«, fragte der junge Kollege mit der Baseballkappe.
»Genau die.« Saleda nickte.
»Demokratin, stramm links. Hat allen einen höllischen Schrecken eingejagt, als sie gewählt wurde. War der Schütze womöglich ein eingetragenes Mitglied der NRA?«, meinte der Junge. Er rasierte sich doch bestimmt erst seit gestern. Wie hatte er es nur schon bis zur BAU gebracht?
Anfänger.
Saleda kam Jenna zuvor. »Es ist möglich, sogar wahrscheinlich, dass die Tat politisch motiviert war, da die Gouverneurin eine Stunde später nebenan in der Stadtbibliothek sprechen sollte. Aber es ist noch zu früh, um derartige Schlüsse zu ziehen.«
Jenna warf einen raschen Blick auf die übrigen sechs Toten auf der Tafel. Verschiedene Ethnien und Geschlechter. »Die anderen Opfer?«
»Ihre Profile sind in euren Unterlagen«, erwiderte Saleda und gab dem Jungen mit der Baseballkappe einen Stapel mit Schnellheftern in die Hand.
Er nahm sich einen und reichte die restlichen nach rechts weiter. »Noch weitere Prominente?«
Saleda nickte und wies auf das Bild neben dem der Gouverneurin. »Frank Kuncaitis, Bürgermeister von Falls Church. Ist gekommen, um seine Solidarität mit der Gouverneurin zu demonstrieren.«
»Könnte es auch um ihn gegangen sein?«, fragte das grobschlächtige Mädchen mit der langen Hakennase.
»Unwahrscheinlich. Er war nicht sonderlich bekannt oder umstritten. Die anderen sind alle unbeschriebene Blätter.«
»Gibt es Zeugen?«, wollte das Linebacker-Mädchen wissen.
Saleda zog sich die Spange aus den Haaren und schüttelte ihre dunkelbraunen Locken. Sie sah jetzt schon aus, als hätte sie den längsten Tag ihres Lebens hinter sich. »Wie der Zufall es wollte, hatten sie bei Lowman’s Seniorentag. Wir haben eine Reihe von Zeugen, aber die meisten davon können sich nur mit Mühe erinnern, was für ein Tag heute ist, von wichtigen Verbrechensdetails ganz zu schweigen.«
»Wie viele Schüsse gab es?«, erkundigte sich Jenna.
»Wir glauben, es waren sieben«, erwiderte Saleda.
Wie beim Seven-up-seven-down-Kartenspiel. Das sprach Bände. Der Kerl ballerte nicht wild in der Gegend herum in der Hoffnung, alles zu treffen, was sich bewegte. Die Schüsse waren einigermaßen zielgerichtet.
Jenna nickte zum Bild der Gouverneurin hin. »War Miriam Holman das erste Opfer?«
Sie war zwar an erster Stelle angeheftet, aber das konnte auch an ihrem Rang liegen.
»Nein«, antwortete Saleda. »Das vierte. Kuncaitis war das fünfte.«
Viertes und fünftes. Genau in der Mitte. Jenna dachte an Charley, der mit Ayana zu Hause saß und sich vermutlich gerade die Szene anschaute, in der Marlin die Meeresschildkröte trifft. Warum hatte sie nur den Job wieder angenommen?
»Wann brechen wir auf?«
Auf dem Weg zum Tatort nahm sich Saleda endlich die Zeit, Jenna dem Team vorzustellen. Sehr viel mehr konnten sie auch nicht tun, bis sie bei Lowman’s Discounter ankamen. Sowohl der grobschlächtigen Teva als auch Porter, dem College-Beau, verschlug es bei Jennas Namen den Atem, als hätten sich auf Saledas Stirn Hörner gebildet, als sie ihn nannte.
»Tut mir leid«, murmelte Saleda vom Fahrersitz des schwarzen SUV aus.
»Kein Problem. Das passiert mir andauernd«, erwiderte Jenna wahrheitsgemäß. Ihr Name hatte schon unter vielen Aufsätzen in psychiatrischen Fachzeitschriften im ganzen Land gestanden, aber in der Branche kannten sie alle nur von den Geschichten aus ihrer Teenager-Zeit her, die sie zur nationalen Legende gemacht hatten. Sie hatte mithilfe ihrer einzigartigen Fähigkeit, Tage, Zahlen, ja selbst Menschen und Bauchgefühle mit Farben zu assoziieren, der Polizei geholfen, eine »Schwarze Witwe«, ihre Mutter Claudia, dingfest zu machen. Ihre Graphem-Farb-Synästhesie hatte Jenna berühmt gemacht, ihr die Karriere vorgezeichnet und seither unzählige Fälle beeinflusst. Entweder sie akzeptierte es, oder sie entzog sich ihm. Nur eins von beiden würde sie im Leben weiterbringen.
»Übrigens, wo ist Dodd denn eigentlich?«, fragte Jenna vorsichtig. Wer auch immer das noch fehlende Teammitglied war, er konnte sich auf eine gehörige Abreibung gefasst machen, wenn er denn auftauchte.
»Keine Ahnung. Dabei ist es auch noch sein erster Tag, stell dir vor!«, bemerkte Saleda mit einem Anflug von Verachtung in der Stimme. »Ein neues Team aufzubauen ist ein Scheißjob.«
Jennas Handy vibrierte in ihrer Jackentasche. Sie fasste hinein und holte ihr Smartphone heraus. Es war Yancy. Sie hatte ihm gesimst, dass sie unterwegs zu einem Tatort war und dass er heute beim Mittag-, Abend- oder irgendeinem anderen Essen nicht mit ihr rechnen konnte, weil es nach einer größeren Sache aussah.
Jetzt schaute sie auf seine Nachricht.
Ich weiß, dass ich eigentlich nicht fragen darf, aber ich mach’s trotzdem. Ist es das, was ich vermute?
Bei jedem anderen würde sie es bezweifeln, aber wenn man an die vielen Male dachte, bei denen sie aus rein zufälligen, unerklärlichen Gründen auf einer Wellenlänge gelegen hatten, konnte sie es nicht ausschließen. Außerdem arbeiteten sie schon lange bei Ermittungen zusammen, dass sie ihm getrost das eine oder andere Detail anvertrauen konnte.
Sie simste zurück:
Sag mir nicht, dass die Sache in dem Laden schon Schlagzeilen gemacht hat.
Seine Antwort kam in weniger als zwanzig Sekunden.
Doch, hat sie, aber so habe ich nicht davon erfahren. Ich habe den Anruf entgegengenommen.
Scheiße. Jenna schrieb zurück:
Sollte ich da etwas wissen?
Auf jeden Fall. Mach ein Kind namens Molly ausfindig.
Jenna gab Yancys Information an Saleda weiter, während sie an der Absperrung, die die örtlichen Cops vor dem Lowman-Parkplatz aufgestellt hatten, ihren Ausweis zückte. Einer von den diensthabenden Cops nickte und schob die Barriere beiseite, damit Saleda durchfahren konnte. Normalerweise wäre ein solches Blutbad ein Fall für die Ortspolizei, aber wenn zwei gewählte Regierungsvertreter erschossen wurden, hatte das höchste Priorität. Streng genommen war es immer noch ein lokaler Fall, aber die BAU war bereits hinzugezogen worden.
»Wussten wir, dass der Notruf von einem Kind kam?«, fragte Jenna.
Saleda schüttelte den Kopf. »Die Notrufe werden noch ausgewertet. Anscheinend sind mehr als ein Dutzend von Handys aus dem Laden eingegangen. Warum sollen wir das Kind ausfindig machen?«
Jenna zuckte die Achseln. Wenn Yancy fand, sie sollte mit dem Kind reden, dann hatte er schon einen guten Grund dafür. Er kannte das Spiel – und Jennas Arbeitsweise – gut genug, um zu wissen, was hilfreich sein würde. »Das werden wir dann schon sehen.«
So ziemlich alle Polizeifahrzeuge der Stadt schienen sich auf diesem Parkplatz versammelt zu haben. Offenbar hatte die Fahndung nach dem Killer keine besondere Priorität.
Kann die Ortspolizei mit so viel Blut nicht umgehen, oder haben sie Grund zu der Annahme, dass der Schütze keine Gefahr darstellt? Ein toter Verdächtiger? Einer in Haft? Jenna sprang aus dem Wagen und folgte Saleda zum Eingang des Ladens.
»Verantwortlicher Special Agent Saleda Ovarez. Das hier sind Dr. Jenna Ramey, Special Agent Teva Williams, Special Agent Porter Jameson«, erklärte Saleda dem Cop, der sie vor der Tür in Empfang nahm.
Die Bohnenstange von einem Mann schüttelte ihr die Hand.
»Lieutenant Daly, DCPD. Danke, dass Sie gekommen sind. S. A. Dodd ist bereits drinnen.«
Oh, oh.
»Was?«, entfuhr es Saleda halb als Frage, halb als Aufschrei.
»Er inspiziert den Tatort«, erklärte der verdutzte Officer Daly.
»Aha«, erwiderte Saleda, und Jenna nahm wahr, wie sie ihren Ärger mit einer Kraftanstrengung herunterschluckte. Dieser Dodd war schon jetzt ein ziemlicher Problemfall.
»Zeigen Sie uns den Weg?«, bat Saleda den Officer.
»Klar«, sagte Daly. Das Team folgte ihm ins Innere des Ladens.
Als Jenna den Supermarkt betrat, brannte sich die Szene, die sich ihr bot, in ihr Bewusstsein ein, wo sie sich zu all den anderen Tatortbildern gesellte, mit denen sie im Laufe der Jahre konfrontiert worden war. Überall auf dem Boden Blutflecke und Fußspuren. Hoffentlich ist die Spurensicherung da rangekommen, bevor die örtlichen Cops alles nach Strich und Faden kontaminiert haben.
Die ersten drei Opfer befanden sich in der Obst- und Gemüseabteilung. Zwei von ihnen lagen nahe beieinander vor der Apfel- und Apfelsinenauslage, Opfer Nummer eins mit dem Kopf an den Füßen von Opfer Nummer zwei.
»Eins und zwei, Clovis Carter und Lily Ross. Beide weiblich, achtundfünfzig beziehungsweise fünfundfünfzig Jahre alt«, fasste Saleda für das Team zusammen.
Der Schütze musste hereingekommen sein, sich nach rechts gewandt und die Ersten umgelegt haben, die er zu Gesicht bekam. Entweder hatte er keine Bedenken zu schießen, oder doch eher so viele Bedenken, dass ihn eventuell der Mut verlassen würde? Wie blindwütig war der Täter vorgegangen?
»Eiskalt«, murmelte Porter. »Sieht das nach Auftragsmord aus?«
»Kann man jetzt noch nicht sagen«, erwiderte Saleda.
Weiter hinten in der Obst- und Gemüseabteilung lag Opfer Nummer drei, Sherman Frost. Der Siebenundsechzigjährige hatte ursprünglich quer über den Zucchini gelegen, aber jemand hatte versucht, ihn von dort weg in Sicherheit zu bringen. Durch die Kugel in seinem Rücken war er verblutet, bevor Hilfe eintraf.
Als Nächstes hatte sich der Schütze den Gang mit den Konserven vorgenommen. Den ging Jenna jetzt schweigend hinter Officer Daly hinunter, als wäre das hier eine Touristenattraktion und er ihr Fremdenführer. Nach den Blutspritzern auf Miriam Holmans Gesicht zu urteilen, hatte der Schütze den Schuss vom Ende des Ganges ausgeführt. Ihr Gesicht war an der linken Seite gestreift worden, und das Blut war über ihre linke Schulter auf ein Bord mit Nudeln geströmt. Bizarr.
»Nach dem Schuss auf das dritte Opfer zu urteilen, scheint der Schütze kleiner zu sein«, bemerkte Teva.
Der Killer hatte außerdem auf die ersten beiden Opfer aus einem Winkel geschossen, der für einen Rechtshänder sprach. Dieser Schuss dagegen tendierte nach links. Wenn er hergekommen war, um diese spezielle Zielperson, die Gouverneurin, zu töten, hatte er einen echt miserablen Schuss abgefeuert. Der Job war zwar erledigt, aber trotzdem …
»Wenn du der Schütze wärst, würdest du dann nicht präziser auf jemanden zielen, den du abknallen sollst?«, fragte Jenna.
»Was hast du im Sinn?«, wollte Saleda wissen.
Jenna biss sich auf die Lippe. »Er ist nicht größer, als der Schuss auf das dritte Opfer nahelegt. Dieser hier ist einfach nur anders. Bei den ersten drei Opfern hat er die Waffe direkt vor sich gehalten. Hier sieht es fast aus, als ob …«
»Er ihn über seine Schulter abgefeuert hätte«, ergänzte Porter.
Jenna nickte. »Fast so, als wäre es ihm erst nachträglich noch eingefallen.«
»Könnte es sein, dass er sie zuerst nicht gesehen hat? Hatte er vielleicht Angst, sie könnte ihm entwischen?«
»Hm, vielleicht«, erwiderte Jenna. Falls er sie doch gesehen hatte und verhindern wollte, dass sie entkam, würde das die These stützen, dass er Angst vor dem Töten hatte, es ihm an Selbstvertrauen mangelte. Das zeichnete ein ganz anderes Bild als das eines abgebrühten Schlächters, der Freude am Töten hatte. Andererseits …
Jenna machte keine Anstalten, die Farben hervorzuholen, die sich in ihrem Kopf bemerkbar zu machen versuchten. Sie hatte bestimmte Ahnungen, wollte aber warten, bis sie sich konkretisieren ließen.
»Weiter«, sagte Saleda bestimmend.
Officer Daly führte sie nach rechts, vorbei an den Gängen mit Müslis, Backwaren und Keksen. In der Feinkostabteilung im hinteren Ladenbereich, gegenüber der Obst- und Gemüseabteilung, lag die Leiche von Opfer Nummer fünf, Bürgermeister Frank Kuncaitis.
»Ihm wurde aus nächster Nähe ins Gesicht geschossen«, fasste Officer Daly das Bild für sie zusammen.
»Und wir sind sicher, dass der Bürgermeister nicht die Zielperson sein kann?«, fragte Teva.
»Sag niemals nie«, murmelte Jenna. Irgendetwas war hier total daneben. Sie zwang sich, die Blautöne zu ignorieren, die sich mit Gewalt Aufmerksamkeit zu verschaffen suchten. Keine Farbanalysen, bevor sie nicht Zeit gehabt hatte, alles zu verarbeiten.
Opfer Nummer sechs befand sich in der Nähe der Kassen. Eine Kugel war von hinten zwischen ihre Schulterblätter eingedrungen. Rita Keegan war mit dem Gesicht nach unten auf den Fliesen gelandet. Allerdings waren ganz offensichtlich panische Kunden, vielleicht sogar der Schütze selbst, durch ihr Blut gelaufen und hatten es über den gesamten Eingangsbereich verschmiert.
»Warum hat er wieder Kurs auf den Ausgang genommen?«, fragte Porter. »Sein Bewegungsmuster ergibt überhaupt keinen Sinn.«
Saledas Blick wanderte von Opfer Nummer sechs zur Tür. »Und wo ist Opfer Nummer sieben?«
Officer Daly zeigte in die Richtung des Müsli-Regals, an dem sie vorhin vorübergekommen waren. »Wir müssen ein Stück zurück.«
»Hatte er Angst, sein Schuss auf die Gouverneurin könnte nicht getroffen haben? Nochmal zurück, um sicherzugehen?«, warf Porter ein.
Teva schüttelte den Kopf. »Aber wieso ging er weiter in den Laden hinein für den Bürgermeister und kam dann noch mal zurück für sie? Wenn sie deine Zielperson ist, gehst du doch direkt auf sie zu, verpasst ihr eine Kugel zwischen die Augen und haust ab.«
»Was das angeht, warum nicht besser warten und sie erschießen, während sie ihre Rede in der Bibliothek hält? Da wäre sie eine leichte Beute gewesen«, murmelte Jenna. »Da gäbe es dann zwar ein Sicherheitsteam, aber für einen vorsätzlichen Mord ist das einfacher. Vorhersehbar. Wenn die Security dort ein Problem war und hier nicht, konnte er doch warten, bis sie in die Bibliothek hineinging. Er wusste ja, dass sie da lang musste.«
»Vielleicht hat es ja mehr mit dem Bürgermeister zu tun, als wir dachten«, sagte Saleda. Sie hatte neben Rita Keegan gekniet und die Richtung der Blutspritzer untersucht. Jetzt erhob sie sich.
In Gang sieben war Opfer Nummer sieben, Blake Spiegel, ebenfalls frontal erschossen worden, nur schien er dem Schützen das Gesicht zugewandt zu haben. Die Kugel hatte ihn in die Brust getroffen, nach hinten geworfen und war dann durch ihn hindurchgegangen und in eine Wand im hinteren Ende des Ladens eingedrungen.
Manche Schüsse in den Rücken, die Brust. Andere treffen ins Gesicht, aber nicht sauber. »Er scheint nicht besonders geübt zu sein. Er trifft sieben mit sieben Schüssen, aber keiner ist perfekt ausgeführt. Ich würde sagen, ein militärischer Hintergrund ist zweifelhaft.«
»Der Einschusswinkel der Kugel, die Spiegel getroffen hat, ist auch eigenartig. Sie ist durch ihn durchgegangen, aber die Einschussstelle liegt etwas links von der Austrittsstelle. Es scheint, als ob er ein bisschen von der Seite her auf ihn geschossen hat, genau wie bei der Gouverneurin«, sagte Porter.
Die Unstimmigkeiten bei den Schüssen, die Reihenfolge der Opfer. Irgendetwas an der ganzen Sache war faul. Jenna war noch nicht bereit dafür, dass sich die Farben schon so deutlich einstellten. In der Vergangenheit waren mit Verbrechen assoziierte Farben in ihrem Kopf aufgeleuchtet, die auf Bauchgefühlen beruhten. Aber erst, nachdem sie genügend Informationen hatte, um diese Gefühle zu deuten. Dieses Mal dagegen waren die Schüsse im Gang mit den Müslis von Violett überlagert, bevor sie genug gesehen oder gehört hatte, um sich darauf einzulassen. Eine völlig andere Farbe als das Blau, das den restlichen Tatort durchdrang.
»Das ist der einzige junge Mann«, stellte Teva fest. »Die anderen waren alle über fünfzig.«
»Na ja, es ist nun mal Seniorentag«, sagte Officer Daly.
Da war was dran. Deshalb sollte man aber trotzdem nicht das Alter dieses Opfers außer Acht lassen. Überhaupt fragte sich Jenna, je mehr sie sich den Tatort vergegenwärtigte, ob die ursprüngliche Schlussfolgerung, dass die Gouverneurin das Motiv für die Bluttat war, nicht vollkommen danebenlag. Das erste und das letzte Opfer sollten auf jeden Fall noch einmal genauer unter die Lupe genommen werden. Die chronologische Reihenfolge war beim Opfer-Profiling sehr wichtig, selbst dann, wenn eins der Opfer ein politisches Amt bekleidete. Die Opfer mochten zwar nach dem Zufallsprinzip ausgewählt sein, aber es konnte sich eben auch anders verhalten.
Saleda sprach in ihr Handy. »Irv, wir brauchen Material zu den Opfern, Genaueres als das, was wir derzeit haben. Vorgeschichte, Familie, Freunde. Wir geben dir noch mehr Einzelheiten durch, aber nimm erst mal die Namen und klopfe sie auf das Übliche hin ab: Militär, Finanzen, Beruf, Stressfaktoren und so weiter.«
Sie beendete das Gespräch mit dem Kriminaltechniker und wandte sich an das Team. »Teva, Sie fangen mit den Zeugen auf dem Parkplatz an. Porter, sehen Sie nach, was die SpuSi Interessantes zu bieten hat. Jenna und ich nehmen uns die Zeugen vor, die den Schützen tatsächlich gesehen haben.«
»Irgendwelche Vorgaben für mein Team bezüglich der Fahndung?«, erkundigte sich Daly.
Saleda warf Jenna einen Blick zu.
»Noch nicht. Suchen Sie weiter, aber gehen sie behutsam ans Werk. Der Verdächtige ist bewaffnet und gefährlich«, erwiderte Jenna. Sie sah noch einmal auf das siebte Opfer auf dem Boden und malte sich aus, wie die Kugel in einem eigenartigen Winkel durch seine Brust in den hinteren Bereich des Ladens geflogen war. Dann fügte sie noch als Nachtrag hinzu: »Bewaffnet, gefährlich und möglicherweise psychisch labil.«
3
Eldred saß auf dem Parkplatz des Supermarkts. Er kannte sich nicht mehr aus. Die Polizei hatte ihm gesagt, er müsse noch bleiben, aber er verstand nicht, warum. Hatte er etwas Unrechtes getan? War er etwa verhaftet?
In letzter Zeit hatte sich in seinem Leben immer mehr verändert. Zuerst hatte Nancy ihm gesagt, er könne nicht mehr allein zu Hause bleiben. Eines Tages hatte sie eine nette Pflegerin mitgebracht, die an den Abenden bei ihm bleiben sollte, wenn Nancy keine Zeit hatte. Dann hatte seine Tochter seine Lebensverhältnisse ein zweites Mal geändert. Sie erklärte ihm, das mit der Pflegerin zu Hause würde nicht funktionieren. Er müsse in ein Haus mit betreutem Wohnen ziehen, zu seiner eigenen Sicherheit.
Papperlapapp. Zu seiner eigenen Sicherheit. Für seine Sicherheit konnte er ja wohl selber sorgen, Himmelherrgott. Er war doch schließlich kein Baby mehr! Er lebte schon über siebzig Jahre auf dieser Erde und sorgte für sich, verdammt! Andererseits … er befand sich in einem Supermarkt. Wie war er da hingekommen? Seine Tage waren in letzter Zeit so in Schieflage geraten, wie in einem Zerrspiegel auf dem Jahrmarkt.
»Sir?«, sagte eine große junge Frau mit braunen Haaren zu ihm und berührte ihn dabei an der Schulter.
»Wer sind Sie?«
»Sir, mein Name ist Special Agent Teva Williams. Ich bin vom FBI. Können Sie mir Ihren Namen nennen?«
Selbstverständlich konnte er ihr seinen Namen nennen! Eldred. Eldred. Oh, verdammt. Eldred … »Eldred Beasley.«
»Danke, Mr. Beasley«, erwiderte sie und notierte sich seinen Namen in einem Notizbuch. Ach, sie hatte große Ähnlichkeit mit Nancy und war bestimmt so in den Zwanzigern. Vielleicht auch dreißig mit diesen langen Haaren, die im Wind rauschten. »Mr. Beasley, können Sie mir sagen, wo im Laden Sie sich befanden, als Sie hörten oder sahen, dass etwas nicht stimmte?«
Nicht stimmte? Was meinte sie damit?
Konzentriere dich.
»Was meinen Sie?«, fragte er.
»Sir, wo waren Sie, als die Schüsse fielen? Können Sie sich erinnern?«
Selbstverständlich kann ich mich erinnern! »Schüsse?«
»Dad!«
Eldred drehte sich um und sah seine Tochter hinter einem orange-weißen Absperrgitter, wo sie auf und ab hüpfte und ihm wie wild zuwinkte. Sie redete hitzig auf den Officer vor dem Gitter ein, allerdings konnte Eldred nicht verstehen, was sie sagte.
»Mr. Beasley?«, sagte die junge Frau vor ihm noch einmal.
»Ja?«
»Mr. Beasley, als die Schüsse losgingen, in welchem Teil des Ladens waren Sie da?«
Er starrte die Frau an. War sie womöglich verrückt? Schüsse. Da waren keine Schüsse. »Ich … ich weiß nicht, was Sie wissen wollen …«
Einen Augenblick später schlängelte sich ein Cop zu der jungen Frau durch. »Das da an der Absperrung ist die Tochter des Mannes. Sie sagt, ihr Vater hat Alzheimer und ist sich möglicherweise nicht im Klaren, wo oder wer er ist. Sie würde gerne herkommen …«
Die junge Frau blickte auf Eldred, dann wieder zurück zu Nancy. »Lassen Sie sie durch.«
Alzheimer? Das war ja wohl das Lächerlichste, was er je gehört hatte! Er war vollkommen in Ordnung!
Nancy kam auf ihn zu gerannt und nahm ihn in den Arm. »Oh, Gott sei Dank ist dir nichts passiert!«
»Was machst du hier, Nan?« Er trat ein Stück von ihr zurück, damit er ihr in die Augen sehen konnte. Ihr Gesicht war … irgendwie anders. »Hast du was Neues mit deinem Make-up gemacht?«
Nancys Augen wurden feucht, und sie machte ein verzagtes Gesicht. »Nein, Dad, ich …« Sie hielt inne und wandte sich an die junge Frau. »Nancy. Ich bin Eldreds Tochter.«
»Freut mich. S. A. Teva Williams.« Sie gaben sich die Hand.
Jetzt, wo er sie aus der Nähe sah, merkte Eldred sofort, dass Nancy und diese Frau überhaupt keine Ähnlichkeit miteinander hatten. Die Frau war viel jünger und Nancy reifer, als er dachte. Das war wohl typisch für Väter. Man machte sich immer das schmeichelhafteste Bild von seinem Kind.
»Kann ich Sie kurz sprechen?«, fragte Nancy die junge Frau.
»Sicher«, kam als Antwort zurück.
Sie traten ein Stück zur Seite, und Eldred sah zu, wie Nancy und die junge Frau ein paar hastige und gedämpfte Worte wechselten. Er sah sich um. Zum ersten Mal nahm er den Parkplatz bewusst wahr. Überall Polizeifahrzeuge, Menschen mit Decken um den Schultern, die sich umarmten und weinten.
Etwas regte sich undeutlich in Eldreds Hinterkopf. Was ging hier vor?
Im nächsten Augenblick war Nancy wieder neben ihm und legte ihm die Hand auf den Arm. »Ich werde hier bei dir sitzen bleiben, Dad. Wir müssen noch ein bisschen warten. Dann kommst du für eine Weile mit zu mir nach Hause. Wie wäre das?«
»Wozu?« Erklär mir das bitte mal alles hier.
Nancy drückte beruhigend seine Schulter. »Ich möchte dich im Moment einfach gerne in meiner Nähe haben, weil ich nicht … Dad, erinnerst du dich, was da drinnen passiert ist?«
Eldred fühlte, wie die Hitze in seinem Gesicht hochstieg. »Erinnern? Natürlich erinnere ich mich! Ich war nur …«
Doch bevor er noch ein weiteres Wort sagen konnte, brannten ihm die Tränen in den Augen. Er biss sich kräftig auf die Lippe, um sie zurückzuhalten, doch Nancys gerunzelte Stirn sagte ihm, dass sie es bereits bemerkt hatte.
»Ach, Dad«, sagte sie und nahm ihn fest in die Arme.
Er sah zu, wie ein paar Tränen auf den Hals seiner Tochter tropften, dann drückte er die Augen fest zu. Jetzt, wo er sie geschlossen hatte, fühlte sie sich an wie Sarah. Seine Frau gehörte zu den wenigen Dingen, an die er sich noch deutlich erinnern konnte, obwohl Jahre vergangen waren, seit sie an einen Ort verschwunden war, an den er ihr nicht folgen konnte.
Mochte Gott ihm beistehen, wenn er sie je verlieren sollte. Alles andere konnte er entbehren, aber wenn ihm Sarah entglitt …
Er durfte sie nicht verlieren. Nicht noch einmal.
Blut. Schüsse. Schnelle Schritte. Ein Monster.
Eldred löste sich aus der Umarmung seiner Tochter und sah ihr in die Augen. »Da war Blut.«
Nancy blinzelte. »Hast du was gesehen, Dad? Hast du den Schützen gesehen?«
Wovon redete sie da? »Welchen Schützen?«
Sie seufzte und schüttelte den Kopf. »Schon gut!«
Und sie schloss ihn erneut in die Arme.
4
Officer Daly brachte Jenna und Saleda zur rückwärtigen Lagerhalle, wo man die Zeugen, die den Schützen tatsächlich gesehen haben wollten, gesondert untergebracht hatte. Überall war Schniefen oder leises Gemurmel zu hören, wenn einige der weniger traumatisierten Anwesenden miteinander flüsterten.
»Ich bin dann draußen vor dem Eingang«, sagte Daly.
Sobald er außer Hörweite war, beugte sich Jenna zu Saleda hin. »Du suchst Dodd, ich suche Molly?«
»Gute Idee«, erwiderte Saleda.
Jenna ließ den Blick über den überfüllten Raum schweifen auf der Suche nach der kleinsten Zeugin. Sie hätte ja Daly danach gefragt, nur war das noch kein FBI-Fall, und Jenna wollte nicht, dass die Ortspolizei das Mädchen in die Mangel nahm, sofern es sich vermeiden ließ. Sie wusste, wie ihr zumute wäre, wenn Ayana sich in diesem Raum befände. Es waren auch keine Eltern da, die auf sie aufpassen konnten.
Sie schlängelte sich durch die Menge und erspähte schließlich das kleine braunhaarige Mädchen. Sie saß in einer Ecke und hatte die Arme um die Beine geschlungen. Und sie war nicht allein.
Der Mann, der ihr gegenüberhockte, sah aus, als wäre er Ende fünfzig. Er gestikulierte beim Reden mit seinen Händen, die von Altersflecken überzogen waren. Sein Haar war an den Seiten seines eiförmigen Kopfes dichter als oben.
Während Jenna näher heranging, konnte sie hören, was er zu dem kleinen Mädchen sagte.
»Und was ist passiert, nachdem du dich hinter dem Fleischcontainer versteckt hattest?«
Sie zog die Lippen ein, anscheinend tief in Gedanken. »Ich hab mit dem Mann vom Notruf gesprochen. Ich hab ihm gesagt, dass die Schüsse aufgehört hatten. Ich bin rausgekrochen, um nachzusehen, ob der Schieß-Mann weg war. Um nach Grandma zu sehen.«
Mit seiner Selbstbeherrschung klang das Kind, als wäre es bereits viel älter. Sie wirkte vollkommen ruhig, geradezu souverän.
»War er denn weg?«, erkundigte sich der Mann in Zivil.
Wer ist der Kerl?
»Entschuldigung«, schaltete sich Jenna in das Gespräch ein. »Kann ich Sie kurz sprechen?«
Als er sich zu ihr umdrehte, stellte Jenna fest, dass er nicht nur ungefähr im gleichen Alter war wie ihr Dad, er hatte auch noch seine Größe.
Er schaute kurz zu Molly zurück. »Bin gleich wieder da«, sagte er und zwinkerte ihr zu. Er richtete sich auf und zog die hellbraune Jacke über seinem schwarzen Rollkragenpullover gerade. Als sie sich ein paar Schritte von dem Kind entfernt hatten, räusperte er sich. »Darf ich fragen … «
»Dr. Jenna Ramey, BAU«, unterbrach ihn Jenna.
»Ah, Sie sind Dr. Ramey. Freut mich sehr. Gabriel Dodd.«
Jenna zuckte zusammen. Zu dumm, dass sie und Saleda nicht zusammengeblieben waren. Saleda brauchte jetzt eigentlich keine Zeit mehr damit zu verschwenden, nach ihm zu suchen, aber auf keinen Fall wollte Jenna ihn noch weiter mit diesem Kind alleine lassen. Er hatte schon einmal gegen die Regeln verstoßen, indem er die Einsatzbesprechung geschwänzt hatte. Woher sollte sie wissen, ob er nicht auch noch bei einer minderjährigen Zeugin Mist baute?
»S.A. Dodd. Schön, Sie kennenzulernen. Und wer ist Ihre kleine Freundin?«
Dodd zeigte ein warmes, großväterliches Lächeln. Feine dünne Linien breiteten sich wie die Kerben in einer Holzmaserung um seine Augen aus. »Sie wissen doch, wer sie ist, sonst wären Sie nicht so scharf drauf gewesen, sie zu finden. Vergessen Sie nicht, Doc, wir sind im selben Team.«
Ich weiß nur, dass sie das Kind ist, mit dem Yancy am Telefon gesprochen hat.
»Genau genommen ist mein einziger Anhaltspunkt, dass das Kind den Notruf gewählt hat«, entgegnete Jenna. »Was wissen Sie von ihr?«
Er schüttelte den Kopf. »Inzwischen weiß ich, dass ihre Großmutter unter den Opfern ist, eine gewisse Rita Keegan, und für ein so junges Mädchen, das gerade die Ermordung seiner Oma mitansehen musste, ist sie erstaunlich ruhig und gefasst. Das überrascht mich allerdings weniger als vermutlich viele andere. Meiner Erfahrung nach gehen Kinder häufig besser mit dem Tod um als die meisten Erwachsenen, einfach, weil man ihnen nicht immer nur Angst davor eintrichtert. Aber ursprünglich bin ich nur hierhergekommen, weil sie eben ein Kind ist. Kinder sind ehrlich, sie bemerken Dinge, die vielen anderen nicht auffallen. Molly hat einen einzigartigen Blickwinkel.«
Wollte Yancy deshalb, dass ich dieses Kind ausfindig mache? Da steckt doch sicher noch mehr dahinter.
»Genau. Haben Sie schon irgendetwas Brauchbares erfahren?«
Dodd zuckte die Achseln. »Ich hatte noch keine Zeit, viele Fragen zu stellen. Sie können gerne dazukommen.«
Mit diesen Worten wandte er sich wieder seiner Befragung zu und hockte sich neben Molly.
Wenn du sie nicht besiegen kannst, verbünde dich mit ihnen.
Jenna setzte sich im Schneidersitz neben S. A. Dodd, Molly gegenüber.
»Ist dir irgendetwas an dem Mann mit der Waffe aufgefallen, Molly?«, fragte Jenna. Es wäre schön, wenn sie gleich klärende Fragen stellen könnte wie etwa, ob er groß oder klein war, dick oder dünn, aber leider galt so etwas als Suggestivfrage. In Verbindung mit einem Kind war es genau das, was vor Gericht alles, was Molly sagte, im Handumdrehen wertlos machen würde – falls sie den Kerl jemals zu fassen kriegten.
Das dunkelhaarige Mädchen nickte. »Ja, er hatte eine Maske an. Aber wollen Sie wissen, wie er aussah, als ich ihn gesehen habe oder lieber, was er davor gemacht hat?«
Geradezu unheimlich. »Möchtest du uns sagen, was dir aufgefallen ist?«
Molly schaute an die Decke, als versuche sie eine echt schwierige Rechenaufgabe zu lösen. »Ich weiß, wie viele Schritte er von da ab gemacht hat, als ich angefangen habe zu zählen. Acht, wie auf dem Magic-8-Ball von meiner Freundin Jana. Und er hat auch geklopft.«
»Geklopft?«, wiederholte Dodd.
Ihr Kopf bewegte sich ruckartig auf und ab. »Ja, er hat mit der Hand auf seine Waffe geklopft.«
Jenna blinzelte und sah dem Mädchen prüfend in die Augen. Dieses Kind war blitzgescheit, und äußerst wachsam. Kein Wunder, dass Yancy fand, sie sollte sich mit ihm unterhalten. »Wie hörte sich das an, Molly?«
Molly klatschte dreimal mit der Hand auf ihr Knie.
Jenna zog unwillkürlich die Augenbrauen hoch. »Wann ist dir das denn aufgefallen?«
»Nur einmal. Als ich ihn auf den Gang zukommen gesehen habe, wo ich war.«
»Kannst du das bitte noch einmal machen?« Einheitlichkeit war hier der Schlüssel. Ganz entscheidend.
Klopf, klopf, klopf.
Wieder dreimal.
Grün war die Farbe, die Jenna immer mit der Zahl drei assoziierte. Drei Klopfzeichen. Ein Gedanke, den sie noch nicht vollständig erfassen konnte, fing an sich zu regen.
»Oh, Gott sei Dank!«
Jenna drehte sich in die Richtung um, aus der die Stimme gekommen war, doch der Mann war bereits bei Molly, nahm sie schwungvoll auf den Arm und drückte sie fest an sich. Mit geschlossenen Augen neigte er den Kopf zu ihr hinunter.
»Tut mir leid, wenn wir stören«, sagte Saleda und legte eine Hand auf Jennas Schulter. »Dr. Jenna Ramey, das hier ist Liam Tyler, Mollys Stiefvater.«
Jenna setzte ein neutrales Gesicht auf, um beim Anblick der offensichtlichen Erleichterung des Mannes, Molly heil und gesund anzutreffen, nicht in Tränen auszubrechen. Hank hätte in einer vergleichbaren Situation dasselbe mit Ayana gemacht. Yancy liebte Ayana zwar heiß und innig und ging wirklich wunderbar mit ihr um, doch hatte sie sich schon viele Male gefragt, ob ein Mann, der nicht Ayanas Vater war, für sie so da sein und sie lieben könnte wie ein richtiger Dad. Zu sehen, wie Liam Tyler beim Anblick von Molly von seinen Gefühlen überwältigt wurde, ging ihr sehr zu Herzen. Vielleicht war es ja doch möglich.
Jenna streckte die Hand aus. »Freut mich, Sie kennenzulernen. Wir haben uns gerade ein bisschen mit Molly über das unterhalten, was sie heute beobachtet hat.«
Liam riss die Augen auf, vermutlich bei dem Gedanken, dass Molly etwas so Grauenvolles hatte mitansehen müssen, doch dann löste er sich von Molly. Er lächelte sie an. »Und konntest du helfen?«, fragte er.
Gott sei Dank. Keiner von diesen Eltern, die ihr Kind auf dumme Gedanken bringen, indem sie vor Besorgnis ausflippen. Das macht die Sache erheblich leichter.
»Na klar«, sagte das frühreife Mädchen und seufzte tief, als wäre das die dümmste Frage, die er stellen konnte. »Ich habe ihnen gesagt, wie viele Schritte der böse Mann gemacht hat, und wie oft er geklopft hat. Ich wollte ihnen noch sagen, wie viel Uhr es war, aber dazu bin ich nicht ge…«
Liam wandte sich von Molly weg zu S. A. Dodd hin. »Es tut mir furchtbar leid. Sie macht das manchmal. Wir arbeiten dran, aber leider ist es immer noch ihre Lieblingsbeschäftigung.«
Jenna neigte den Kopf. »Wie bitte? An was arbeiten Sie?«
Liam setzte Molly wieder auf den Boden und zog ihr den Mantel gerade. Dabei sah er über ihren Kopf hinweg Jenna an. »Die Sache mit den Zahlen. Sie erzählt Ihnen lang und breit von all den Dingen, die sie zählt, aber ich bezweifle, dass Ihnen das helfen wird …«
»Oh, nein, nein«, fiel Jenna ihm hastig ins Wort. Es war besser, ihn zu unterbrechen und unhöflich zu erscheinen, als ihm Gelegenheit zu geben, Molly zu suggerieren, dass sie mit irgendetwas hinterm Berg halten sollte, weil es unwesentlich war. Eltern meinten es ja immer gut, aber sie begriffen nie, dass schon der kleinste Fingerzeig an Kinder den Unterschied zwischen Antworten und einem fehlenden Puzzleteil bedeuten konnte. Sie lächelte Molly an, die sich entnervt den Bemühungen ihres Stiefvaters zu entziehen versuchte, ihr ein ordentliches Äußeres zu verleihen. »Die Zahlen sind total hilfreich, Molly. Genau wie alles andere, an das du dich erinnerst. Wie viel Uhr war es denn?«
Molly schaute zu ihr hoch und grinste, sichtlich stolz auf sich. »Drei Uhr fünfundvierzig. Das habe ich behalten, weil die Zahlen ja alle hintereinander kommen: drei-vier-fünf.«
Das hättest du auch behalten, wenn sie es nicht täten. Jenna konnte beinahe sehen, wie sich die Räder in Mollys Kopf drehten und Zahlen mit Ereignissen, Menschen, Wörtern verzahnten. Sie war gar nicht so viel anders als Jenna.
»Da habe ich auf meine Uhr geschaut, aber ich weiß nicht so genau, wann das Klopfen angefangen hat«, sprach Molly weiter. Dabei schaute sie zu Liam Tyler hin.
Das unterschwellige Bemühen, die Billigung des Vaters zu erhalten. Sich zu vergewissern. Diese Befragung würde ihnen mehr bringen, wenn sie irgendwo mit Molly sprechen konnten, wo kein Elternteil auch noch so gut gemeinte Ermutigungen geben konnte.
Jenna hockte sich vor Molly. »Wir werden später sicher noch mehr Fragen an dich haben, und in der Zwischenzeit sagst du deiner Mom oder deinem Stiefvater Bescheid, wenn dir noch etwas einfällt, was wichtig sein könnte, okay?«
Molly nickte ernst. »Ich werde ganz fest darüber nachdenken.«
Daran hatte Jenna keine Zweifel.
»Kann ich sie jetzt nach Hause bringen?«, erkundigte sich Liam Tyler und nahm Molly bei der Hand. Seine Stirn war in tiefe Sorgenfalten gelegt. So angespannt wie sein Gesichtsausdruck mussten wohl auch seine Nerven sein.
Saleda lächelte. »Sicher. Hier ist meine Karte. Bitte, rufen Sie an, wenn es etwas Neues gibt. Wir melden uns. Wahrscheinlich machen wir in den nächsten Tagen einen Termin für eine weitere Befragung auf dem Revier.«
Liam nickte. »Danke.«
Während sie sich von Molly und ihrem Stiefvater entfernten, nickte Jenna in die Richtung von Special Agent Dodd. »Saleda, das ist S. A. Dodd.«
Saleda verlangsamte nicht ihren Schritt, doch Jenna konnte spüren, wie angespannt sie wurde. »Freut mich, Sie kennenzulernen, Special Agent. Sagen Sie, ist es bei Ihnen üblich, als Erster am Tatort Ihres Einsatzteams zu erscheinen? Sind Sie einfach nur unglaublich schnell, oder gibt es so etwas wie einen Frühbucherrabat, von dem wir anderen nichts wissen?«
Dodd lachte leise. »Es ist eher so, dass ich gerade in der Gegend war.«
Saleda blieb stehen. »Nun, von jetzt an sollten Sie wissen, dass es bei uns Einsatzbesprechungen gibt und sich alle Teammitglieder dort einfinden, selbst wenn Sie Mr. Rogers sind.«
Autsch.
»Gebührend zur Kenntnis genommen«, erwiderte Dodd, und aus seiner Stimme klang kein Hauch von Animosität.
Das hast du sehr viel besser weggesteckt, als ich es getan hätte.
»Was haben wir denn schon rausgekriegt?«, erkundigte sich Dodd.
Ich würde allerdings gerade jetzt auch nicht den Bogen überspannen.
Saledas Augen verengten sich, doch sie blickte weiter geradeaus und setzte sich wieder in Bewegung. »Nicht viel, angesichts dessen, dass die meisten Zeugen senil, verstört und traumatisiert sind.«
»Was ist mit den Angestellten?«, fragte Jenna.
»Die meisten haben überhaupt nichts gesehen. Entweder sie hatten keine freie Sicht, oder sie haben Schüsse gehört, sich unter Theken in Deckung gebracht und vor Angst in die Hosen gemacht«, erwiderte Saleda. »Was ist mit dem Kind?«
Klopfen. »Sie hat ein paar Sachen erwähnt. Sie hat den Kerl tatsächlich gesehen, ihn aber nicht wirklich beschrieben.«
»Könnte sie bei einem Phantombild helfen?«
»Eher nicht. Für diese Art von Details hat sie nicht genug gesehen.« Klopfen. Drei Klopfgeräusche. Was hat es damit auf sich?
»Das Mädchen ist allerdings sehr schlau. Ihr sind mehr Dinge aufgefallen als den meisten Leuten um sie herum«, schaltete sich Dodd ein.
»Ja, ich finde auf jeden Fall, dass wir noch mal mit ihr reden sollten«, murmelte Jenna. Sie nahm sich vor, später ein paar Gedanken zu Papier zu bringen und zu überlegen, wie sie äußere Erscheinungsformen mit Zahlen in Verbindungen bringen konnte, wenn sie Molly noch einmal befragte.
»Die örtlichen Kollegen errichten im Umkreis von sechzig Meilen Straßensperren. Viel weiter kann er unmöglich gekommen sein, aber leider haben wir so gut wie keine Anhaltspunkte. Keine Indizien, ob er in einem Auto oder zu Fuß entkommen ist oder auf eine andere Art und Weise. Nach allem, was wir wissen, könnte er auf einem Einhorn davongeritten sein«, erklärte Saleda.
»Wir sollten auch mal bei den umliegenden psychiatrischen Kliniken nachfragen, ob in letzter Zeit irgendwelche stationären Fälle entlassen wurden. Diese Sache riecht mir verdächtig nach jemandem, dem eine innere Stimme eingibt, Gouverneurin Holman wäre im Begriff, Virginia von Aliens regieren zu lassen«, sagte Dodd.
Unwillkürlich nickte Jenna. Das mit der Gouverneurin und den Aliens mochte ja etwas übertrieben sein, aber vom ersten Augenblick an war ihr aufgrund des dilettantischen Vorgehens des Schützen, verbunden mit der augenscheinlich gezielten Planung des Ganzen, die Farbe Blau in den Sinn gekommen. Sie assoziierte dieses spezielle Königsblau mit einer Reihe von Dingen, aber in diesem Fall sagte ihr Bauchgefühl ihr, dass es, ungeachtet aller möglichen anderen Implikationen, auf Unterordnung hindeutete. Für gewöhnlich assoziierte sie Rottöne mit Macht und Blautöne mit Unterordnung. Einer ihrer prominentesten Fälle im letzten Jahr war so ein klassisches Beispiel. Zwei Täter hatten dabei zusammengewirkt, einer hatte sich in ihrem Kopf rot, der andere blau bemerkbar gemacht – als dominant beziehungsweise gefügig. In dieser Einzeltäter-Situation allerdings kam es ihr vor, als würde das gefügige Blau bedeuten, dass der Killer einem Drang nachgab, den er nicht kontrollieren konnte. Eine psychische Erkrankung, sei es nun Schizophrenie oder auch etwas anderes, war eine einleuchtende Erklärung für einen derartigen Zwang. Echte Psychopathen wirkten erschreckend normal, und sie legten für gewöhnlich eine starke Kontrolle über ihre Handlungsweise an den Tag. Das Problem war, dass sie kein Gewissen hatten und sich keine Gedanken um Recht und Unrecht machten.
Jennas Handy vibrierte in ihrer Jackentasche. Reflexartig griff sie danach, und das Herz schlug ihr dabei bis zum Hals. Jedes Mal, wenn dieses Telefon klingelte, kamen ihr schlagartig die schlimmsten Szenarien in den Sinn. Sie hörte praktisch schon Claudias höhnische Stimme am anderen Ende, dass sie sich irgendwie Ayana geschnappt habe. Nach allem, was im letzten Jahr geschehen war, hätte Jenna sich beim Gedanken an Ayana eher freiwillig als Supermarkt-Schütze der Polizei gestellt, als nicht ans Telefon zu gehen.
»Tut mir leid, ich muss da rangehen«, sagte sie ohne weitere Erklärungen. Sie hatte Saleda bereits gesagt, dass sie nur dann ins Team zurückkam, wenn sie aus genau diesem Grund zu allen Zeiten ihr Handy bei sich tragen durfte. Mangels besserer Alternativen konnte Saleda es ihr nicht verwehren.
Als sie sich ein paar Schritte von Saleda und Dodd entfernt hatte, ging Jenna ran. Es war weder Claudia noch ihr Bruder oder ihr Vater mit Nachrichten über ein Problem mit Ayana.
Es war Gerald Fitz, der Anwalt ihres Exfreundes.
»Dr. Ramey, tut mir leid, wenn ich störe, aber Sie müssen heute Morgen noch herkommen und ein paar Papiere unterschreiben, damit ich sie fertig machen kann.«
Nicht schon wieder. Als wäre der Horror von Hanks Ermordung nicht schon genug gewesen, erfuhr sie in den Tagen nach seinem Tod, dass er sie zu seiner Testamentsvollstreckerin gemacht hatte. Dabei hatte sich Folgendes ergeben: Wenn ein Cop eine so hohe Lebensversicherung abschloss, dass bei einem sehr wahrscheinlichen Arbeitsunfall die gesamte Zukunft seiner Tochter gesichert war, gingen Familienmitglieder, mit denen er jahrelang kein Wort mehr gewechselt hatte, offensichtlich davon aus, dass sein Testament auch seine trauernden Hinterbliebenen berücksichtigte. Selbst wenn seine einzigen Vermögenswerte in Wahrheit aus nichts weiter bestanden als einem renovierungsbedürftigen Haus, das aus einer Zwangsversteigerung stammte, sowie einem geerbten Stück Land in der Nähe seines Elternhauses. Doch angesichts der Versicherungssumme kamen die lange verschollenen Verwandten plötzlich aus der Versenkung hervor, schnüffelten herum und fanden schließlich heraus, dass das Grundstück erheblich mehr wert war, als ursprünglich angenommen. Sie machten geltend, dass es von Rechts wegen ihnen zustand und wollten das Testament anfechten. Schließlich hatte Hank Ayana als Alleinerbin in seinen Versicherungspolicen genannt. In seinem Testament war sie zwar auch bedacht, aber erst ein Jahr nach ihrer Geburt. Alle, die dort früher vermerkt waren, konnten argumentieren, dass sie immer noch Ansprüche hatten. Schließlich hatte aus ihrer Sicht jedenfalls die Person, die das Sagen hatte, gute Aussichten, von ihrem Ausscheiden aus dem Testament zu profitieren.
»Ich bin gerade bei der Arbeit, Mr. Fitz. Es muss bis morgen warten …«
»Geht nicht«, erwiderte er. »Ich muss es bis zum Fünften des Monats einreichen, Dr. Ramey.«
»Na, dann reicht morgen doch. Es ist ja erst der Dritte«, sagte Jenna.
Sie hielt den Atem an. Drei Klopfzeichen.Dritter März. Dritter Tag im dritten Monat. Das Bild eines Tatorts, das sie vor Kurzem in den Nachrichten gesehen hatte, schoss ihr durch den Kopf. »Scheißkerl.«
»Wie bitte?!«, entgegnete Fitz.
»Oh, Entschuldigung«, murmelte Jenna. »Nicht Sie. Ich muss Schluss machen. Ich rufe später noch mal an.«
Sie beendete das Gespräch und ging hastig zu Saleda und Dodd zurück. Kein Wunder, dass ihr dieses Verbrechen nicht politisch motiviert vorgekommen war. Das war es nicht, zumindest machte es nicht den Anschein.
Zeit war jetzt von entscheidender Bedeutung.
Als sie wieder neben Saleda und Dodd stand, war Saleda gerade dabei, Sergeant Daly Anweisungen zu geben, was auf der Pressekonferenz über das aktuelle Täterprofil preisgegeben werden konnte.
»Mach das nicht«, fiel Jenna ihrer leitenden Ermittlerin ins Wort. Manchmal war eben Insubordination angesagt. »Das ist nicht irgendein dahergelaufener Amokschütze. Wir kennen ihn.«
5
Als Jenna, Saleda und Porter nach Quantico zurückkamen, hatte Irv die gewünschten Akten und Fotos schon für sie bereitgestellt. Dodd wollte unbedingt noch bei Lowman’s bleiben und ein bisschen herumfragen. Da Saleda von ihm genervt war, vermutete Jenna, dass sie ihn ohnehin lieber nicht in ihrer Nähe hatte. Sie erklärte sich einverstanden, dass er am Tatort blieb und Zeugen befragte, solange Teva ihm dabei zur Hand ging – beziehungsweise auf ihn aufpasste.
Jetzt trat Porter an den Holztisch und hielt eins der Fotos an einer Ecke hoch. »Wenn der Dreifach-Schütze der Kerl ist, der bei Lowman’s herumgeballert hat, warum hat er dann nicht auf jedes der Opfer dreimal geschossen?«
Sobald Jenna klar geworden war, dass sich die Schießerei im Supermarkt am 3. März gegen 3 Uhr 33 am Nachmittag zugetragen hatte, hatte Mollys Bemerkung über das dreimalige Klopfen des Killers für sie schlagartig einen Sinn ergeben. Bis vor ungefähr sechs Wochen hatte der Dreifach-Schütze den Südosten zwei Monate lang gleichermaßen in Angst und Schrecken wie in Faszination versetzt. Der Täter, der sich immer noch auf freiem Fuß befand, erschoss seine Opfer erst, nachdem er sie irgendwie mit einer Aufeinanderfolge der Ziffer drei in Verbindung gebracht hatte. Soweit sie wussten, war er seit gut sechs Wochen nicht mehr aktiv gewesen. Das vermuteten sie jedenfalls oder ihnen waren ein paar Todesfälle entgangen.
Warum der Killer seine übliche Vorgehensweise der drei Schüsse auf das jeweilige Opfer aufgegeben hatte, war Jenna zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar, und sie wollte auch nicht darüber spekulieren. Aber er war es, er musste es einfach sein.
»Alles, was mir im Moment dazu einfällt, ist, dass der Dreifach-Schütze im Hinblick auf seine Mordstatistik noch ein Anfänger ist. Er hat erst drei Opfer auf seinem Konto und geht damit kaum als Serienmörder durch. Serienmörder entwickeln sich. Sie experimentieren, testen aus, was geht und was nicht. Der Dreifach-Schütze tötet aufgrund von bizarren Verkettungen, was eindeutig dafür spricht, dass er eine Zwangsneurose hat, möglicherweise Schizophrenie. Nur weil ihm Stimmen in seinem Kopf das Töten befehlen, ist noch lange nicht gesagt, dass er nicht lern- und anpassungsfähig ist«, gab sie Porter zur Antwort.
Sie warf einen Blick auf das Foto von Opfer Nummer eins in Porters Hand. Die sechsundzwanzigjährige Wendy Ulrich war in der Tiefgarage ihres Apartmentkomplexes in Fairfax tot aufgefunden worden. Man hatte ihr dreimal in die Brust geschossen. Sie hatte einen Kassenzettel von Demetris Diner Takeout bei sich. Er war in der Mitte durchgerissen worden, und jeweils eine Hälfte lag auf ihren Augenlidern. Sie war Kundin Nummer dreihundertdreiunddreißig gewesen.
Porter reichte Jenna das Bild des zweiten Opfers, Maitlyn O’Meara. Die Frau mittleren Alters war auf einem Rastplatz in der Nähe der Ausfahrt 9B ermordet worden, nur eine Stadt vom Schauplatz des ersten Mordes entfernt. Auch auf sie war dreimal geschossen worden. Aus den Einschusswunden hatte der Gerichtsmediziner den Schluss gezogen, dass der Killer sich seinem Opfer aller Wahrscheinlichkeit nach zu Fuß genähert und es von hinten erschossen hatte, als es weglief. Blutflecke wiesen darauf hin, dass sie sich auf den Rücken gedreht hatte, woraufhin er ihr aus einiger Entfernung in die Brust schoss und dann einmal aus nächster Nähe in den Kopf. Er hatte ihren Führerschein zerschnitten und die beiden Hälften auf die geschlossenen Augenlider gelegt.
»Glauben Sie, die Sache mit den Augen hat etwas mit Selbstverachtung zu tun? Er will nicht, dass die Opfer ihn ansehen, also bedeckt er ihre Augen?«, fragte Porter, der inzwischen das Bild des dritten und bislang letzten bestätigten Opfers zur Hand genommen hatte.
»Möglich«, erwiderte Jenna, doch etwas an dem gefügigen Blau, das sie mit diesem Killer assoziierte, nagte an ihr. Sie verdrängte es. Damit konnte sie sich später noch befassen. »Aber unter den Papierstücken auf ihren Lidern sind ihre Augen zu. Ich bezweifle stark, dass alle drei Opfer mit bereits geschlossenen Augen an Schusswunden gestorben sind. Folglich muss er sie selbst schließen.«
»Das wäre ein weiterer Unterschied zu den Schüssen bei Lowman’s«, stellte Saleda fest.
Porter hob die Hand. »Moment mal, wenn er ihnen die Augen zumacht, damit sie ihn nicht sehen können, warum dann die Zettel auf den Lidern? Hasst er sich selbst so sehr, dass er eine doppelte Schutzschicht braucht?«
»Unwahrscheinlich. Eher benutzt er die Zettel als Visitenkarte. Schließlich geben sie uns jedes Mal einen Hinweis auf seinen Beweggrund für den Mord«, sagte Saleda. »Der Kassenzettel für Bestellung Nummer 333. Maitlyn O’Mearas Führerschein, nachdem er sie offensichtlich ins Visier genommen hat, weil ihr Nummernschild 33 3RBC lautete. Die Schlüssel auf dem dritten Opfer.«
Jennas Blick richtete sich auf das Foto in Porters Hand. Ainsley Nickersons Exmann hatte sie in ihrem Apartment 333J gefunden, nachdem sie nicht auf seine Anrufe reagierte, wann sie die gemeinsame achtjährige Tochter von ihrem Wochenende bei ihrem Vater abholen wollte. Sie war in ihrer Badewanne erschossen worden, und auf ihren geschlossenen Augen lagen zwei Schlüssel. Einer war ihr Wohnungsschlüssel, der andere ein Schlüssel zum Haus ihrer Mutter. Beide waren von ihrem eigenen Schlüsselring entfernt worden.
Jenna stellte sich einen Mörder ohne Gesicht vor, wie er sich über die Frau beugte, der er gerade dreimal in den Oberkörper geschossen hatte, um ihr behutsam die Augenlider zu schließen, beinahe als würde sie schlafen. Die Geste war intim, geradezu zärtlich. Bei dem Gedanken an das Schließen der Augen nach dem Tod eines Menschen brannte sich das Blau noch stärker in Jennas Kopf ein.
»Die Zettel mögen ja Visitenkarten sein, aber einem Toten die Augen zu schließen ist Ausdruck von Respekt und Bedauern«, sagte Jenna. Sie bemühte sich nach Kräften, die Verbrechen in dem karmesinroten Farbton zu sehen, der in ihrem Gehirn den sinnlosen, entsetzlichen Gewalttaten vorbehalten war, für die Psychopathen oft keine andere Triebfeder hatten als die Schockwirkung, doch das kühle Blau setzte sich immer wieder durch. »Dieser Kerl versucht nicht, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen oder uns zu verspotten. Er ist reumütig.«
Saleda zuckte die Achseln. »Das könnte passen. Wenn er schizophren ist, hat er ja nicht unbedingt alles im Griff. Vielleicht wird ihm ja erst nach der Tat klar, was er getan hat.«
»Dass er den Leuten im Supermarkt nicht die Augen zugemacht hat, ergibt also noch weniger Sinn …«, bemerkte Porter.
»Außer dass Uhrzeit und Datum immer noch auf ihn als unseren Unbekannten deuten«, entgegnete Saleda.
»Aber wieso ist er so radikal von seiner bisherigen Vorgehensweise abgewichen? Warum sieben Menschen und nicht nur einer, der zufällig um 3 Uhr 33 bei Lowman’s an die Kasse gegangen ist?«, wunderte sich Porter.
»Verdammt gute Frage«, murmelte Jenna, während sie ihm das Bild von Ainsley Nickerson aus der Hand nahm. Die Rothaarige hatte zwei Kugeln in der Brust und eine in der rechten Schulter. Falls der Schütze ihr gegenübergestanden hatte, passte das zu der Annahme, dass der Lowman-Killer Rechtshänder war. »Wenn der Schütze aus etwa zwei Metern Entfernung von der Badewanne auf Ainsley Nickerson geschossen hat, muss er in schneller Folge gefeuert haben. Anders ließe sich der Schulterschuss kaum erklären. Jemand mit einer militärischen Ausbildung – verdammt, sogar jedes Landei, das von klein auf jeden Abend im heimischen Garten rumgeballert hat – hätte doch wohl bei allen drei Schüssen eine bessere Trefferquote gehabt, oder nicht?«